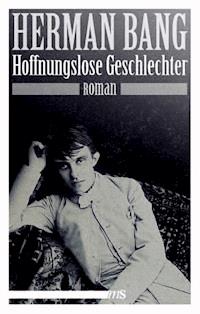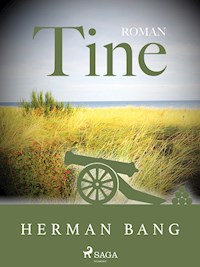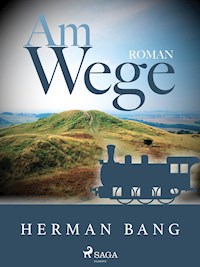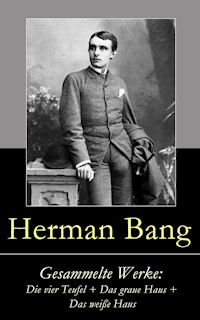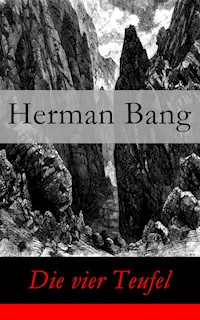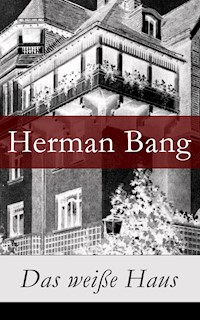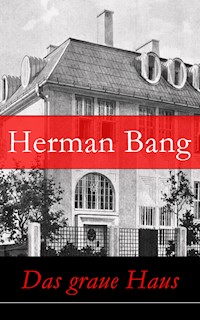Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herman Bang beschreibt seine Frühe Kindheit. Das weiße Haus in dem Bang seine glücklichsten Jahre verbrachte. Die Mutter ist die Seeles des Hauses, mit ihrer lebensfrohen Natürlichkeit und einer kindlichen Lust am Umhertollen. Aber schon ist ein Schatten auf das weiße Haus gefallen, der die Freude dämpf und die Sehnsucht nach Vergangenem weckt. REZENSIOIN "'Das weiße Haus' von 1898 und 'Das graue Haus"' von 1901, Pendantromane, wie die Titel erkennen lassen, zeigen Herman Bang als einen Autor von düsterer Komik, mit einem starken Sinn fürs Szenische und einer Erzähltechnik, die weit über die Jahrhundertwende vorausweist." - Michael Maar, Frankfurter Allgemeine AUTORENPORTRÄT Herman Bang, geboren 1857 auf Alsen, Nordschleswig, wuchs als Pfarrerssohn in der dänischen Provinz auf und versuchte sich als Schauspieler, Regisseur und Feuilletonist, ehe er sich der Literatur zuwandte. Lesereisen führten ihn durch ganz Europa. Bang gilt als der bedeutendste dänische Vertreter des literarischen Impressionismus. Seine Schriftstellerkollegen in Deutschland erkannten Bang früh als einen der bedeutendsten Prosaautoren der skandinavischen Moderne. Und 100 Jahre nach seinem Tod zieht Herman Bang immer mehr Leser in seinem Bann. Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse und Thomas Mann empfahlen seine Bücher, Klaus Mann machte ihn zum Helden einer Erzählung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herman Bang
Das weiße Haus
Saga
Für einen Freund
Tell me the tales
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.
long long ago–
long ago.
Kindheitstage, ich will euch zurückrufen, Zeiten ohne Neid, freundliche Zeiten, eurer will ich gedenken.
Der leichte Schritt meiner Mutter wird in hellen Stuben ertönen, und Menschen, die nun ergraut des Lebens Bürde tragen, werden lachen wie einst, da sie ihr Schicksal nicht kannten. Mögen die Toten wieder die sanften Stimmen erheben, und alte Lieder fließen dem Chor der Erinnerung ein.
Aber auch bittere Worte werden verlauten, schwere Worte, wie man sie sagt, wenn man den bitteren Kampf mit dem schweren Leben kennt.
Tell me the tales,
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.
Es war zu Hause in der Dämmerstunde.
Draußen legte sich sacht Schleier auf Schleier über den schimmernden Schnee. Die Gebäude versanken, die großen Pappeln verschwanden. Nur Jens, der Stallknecht, schlich mit seiner Laterne um die Ställe.
Drinnen saßen wir, die Kinder, auf Schemeln versammelt. Die Stube war groß und ihre Winkel fern. Wir verbargen die Köpfe hinter einer Gardine, vielleicht war die Finsternis schuld daran.
Ganz leise ertönte die Stimme der Mutter, und die Saiten des Klaviers klangen zart wie die einer Harfe:
„Tell me the tales,
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.“
Der Gesang verstummte. Kein Laut war zu hören. William, der der Mutter am nächsten saß, war auf seinem Schemel eingeschlafen.
„Mutter, sing weiter.“
Ein Lichtschimmer huschte über die weißen Tasten, über alle Möbel hinweg und verschwand. Jens ging lautlos mit seiner Laterne an den Fenstern vorüber.
„Mutter, sing weiter.“
Eine Tür wurde geöffnet, ganz behutsam. Es war Vaters Tür.
„Herr Peder warf die Runen auf den Holzsteg,
den Klein-Helle dann überschreiten sollte.
Dann ließ er Anker hieven,
die Brise kam zur Zeit,
zurück blieb Jütlands Küste
und manche Dänenmaid.
Schöne Worte freuen manche Herzen,
schöne Worte
machten mir viel Schmerzen,
schöne Worte.“
Es ist still. Die Mutter, fein und schlank, gleicht einem Schatten. Wenn der Schatten schweigt, hört man die große Uhr.
„Schöne Worte
freuen manche Herzen,
schöne Worte
machten mir viel Schmerzen,
schöne Worte.“
Draußen wird leise eine Türklinke bewegt. Das sind die Mägde, die zuhören möchten. Im Schein des Messingleuchters sitzen sie rund um den Küchentisch und lauschen, während „Frau Pastor singt“.
Der Großknecht stiehlt sich herein. Die Holzschuhe hat er vorsichtig abgestreift, nun lehnt er sich an den Türpfosten neben dem Wassereimer.
„Kinder.“
„Ja, Mutter.“
„Singt mit.“
Die Mutter greift etwas kräftiger in die Tasten und singt:
„Schön ist die Erde,
prächtig Gottes Himmel,
herrlich ist der Seelen Pilgergang.“
Zaghaft dringen die Stimmen der Kinder aus den Winkeln durch das Dunkel, angeführt von der Stimme der Mutter:
„Durch alle schönen Reiche der Erde
ziehen wir singend zum Paradies.“
Draußen in der Küche sitzen die Mägde noch immer still um das brennende Licht.
Die Kerlsmarie wischt sich mit dem Rücken ihrer rissigen Hand eine Träne fort:
„Das“, sagt sie, „will die Gnädige gesungen haben, wenn sie mal stirbt.“
Alles ist still. Nur die große Uhr bei der Tür spricht.
Da sagt aus seiner Ecke leise einer der Jungen: „Mutter, sing noch mal das, was ich nicht verstehe.“
Der Schatten der Mutter löst sich nicht aus dem Schweigen.
Dann ertönen wieder – doch schwächer als zuvor – die harfenähnlichen Saiten:
„Tell me the tales,
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.“
Kindheitstage, ich will euch zurückrufen – Zeiten der Sehnsucht und ohne Schuld, da es dem Herzen wohl erging. Wehmutsvolle Tage, da die Tränen sanft waren.
Kindheitstage, da Mutter lebte.
Ich entsinne mich an einen Tag, als wir Brombeeren sammelten – Mutter, wir Kinder und Tine von der Schule.
Es gab so viele Beeren, und ihre Ranken waren so hübsch.
Hinunter in die Gräben ging es und dann die Hecken entlang. Wir Kinder fingen uns in den Ranken und schrien. Unsere Gesichter waren so verschmiert, daß wir wie die Kinder von Lars, dem Schmied, aussahen.
„Seht doch nur den Jungen, seht doch nur den Jungen“, rief die Mutter.
Aber Tine hatte eine mächtige Ranke gegriffen, die von dunklen Beeren nur so prangte, und rasch warf sie sie der Mutter um die Schultern.
„Oh, Sie schöne Frau“, sagte sie.
Die Mutter stand am Zaun, die Ranke fiel ihr auf die Brust. Hochaufgerichtet stand sie da, hinter ihr der leuchtende Himmel.
Kindheitstage, ich will euch zurückrufen.
Es war ein weißes Haus, und seine Tapeten waren hell.
Alle Türen standen offen, auch im Winter, wenn eingeheizt wurde.
Zwischen den Mahagonimöbeln befanden sich Marmortische und auch weiße Konsolen, sie stammten von Auktionen auf Schloß Augustenborg. Die alten Porträts waren mit Immortellen umwunden, und viel Efeu gab es, denn Efeu, das sich an einer hellen Wand emporrankte, liebte die Mutter.
Das Gartenzimmer war so weiß, daß es zu leuchten schien.
Die Kinder mochten dieses Zimmer, und auch die Treppe zum Garten, auf deren weißgestrichenem Geländer sie hinunterrutschten.
„Kinder, Kinder“, rief die Mutter, „lehnt euch nicht an das Geländer.“
„Um Himmels willen“, sagte sie zu Tine, der Tochter des Schullehrers, „eines Tages brechen sie sich noch den Hals. – Der Tischler wird ja auch nie geholt.“
Das Geländer war morsch und wurde niemals ausgebessert.
Aber schon bald wurde die Tür zum Garten geschlossen, die Läden wurden zugemacht und grüne Vorhänge über die weißen Gardinen gezogen, warm und anheimelnd. Denn die Mutter wollte den Garten und die große Allee nur sehen, wenn die Sonne schien und lange am Himmel stand.
„Du lieber Gott, wie mag es nur im Küchengarten aussehn“, sagte sie plötzlich zu Schullehrers Tine, als sie nachmittags beim Kaffee saßen.
Drei Viertel des Jahres kam sie nicht in den Küchengarten.
Er lag weit hinter der Pappelallee und hinter der Einfahrt, und die Kinder durften nicht dorthin, denn sie könnten ja nasse Füße bekommen. Manchmal jedoch, wenn der Weg am allerschlechtesten und der ganze Hof ein grundloser Morast war, da wollte die Mutter nach dem Garten sehen.
In den Holzschuhen von Kerlsmarie und mit geschürzten Rökken zog sie los, quer über den Hof.
Alle Mägde standen auf der Treppe und schauten ihr hinterdrein. „Kinderchen, Kinderchen“, rief sie; sie kam mit ihren Holzschuhen keine zehn Schritte weit, da war sie auch schon steckengeblieben.
Wenn sie nach Hause kam, mußte sie zur Stärkung warmen Zwieback haben.
„Meine Liebe“, sagte sie zu der Lehrerstochter, „warum bleiben die Menschen im Winter nur nicht zu Hause?“
Die Kinder spielten auf dem Teppich. Er hatte viele große Felder, rote und graue. Die Felder waren Königreiche, über die die Kinder herrschten und um die sie kämpften. Sie gerieten in Streit dabei, und dann gab es Tränen. Mit den Möbeln bauten sie Barrikaden um ihre Königreiche. Die ganze Wohnstube war ein einziges babylonisches Durcheinander.
„Was diese Kinder doch für einen Lärm machen können“, sagte die Mutter zum Stubenmädchen – dabei feuerte sie die Kinder selbst zum Lärmen an.
„So, so, nun verliert Nina wieder ihre Höschen.“
Mit den Spitzenhöschen gab es ewig Ärger. Bald zerknautschten sie, und bald gingen sie im Streit der Königreiche verloren.
Der Großknecht, der Knecht und der Stallknecht waren bei ihrer Arbeit. Bedächtig und langsam gingen sie zwischen Stall und Tenne hin und her.
Wenn die Stalltür geöffnet wurde, hörte man die Kühe brüllen.
„Mutter“, sagte Nina, „jetzt ruft Williams Kuh.“
Doch manchmal, wenn der Vater nicht daheim war, konnte es geschehen, daß die Mutter den Stallknecht bat, „nur für einen Augenblick“ alle Kühe hinaus auf den weißen Hof zu lassen. Und dann sprangen sie im Schnee umher, alle vierzehn, die braunen, die weißen und die gefleckten, und die Kinder jubelten.
„Laßt sie nicht auf die Koppel, laßt sie nicht auf die Koppel“, rief die Mutter. Sie stand auf der Treppe und lachte am lautesten.
Aber in eine der gefleckten Kühe war der Teufel gefahren.
„Oh, wie sie rennt“, sagte die Mutter.
Sie rannte und rannte, den Schwanz senkrecht in die Höhe, und konnte erst beim Dorfschulzen wieder eingefangen werden.
Doch wenn dann der Vater nach Hause kam, war die Stalltür verschlossen, und der Hof lag da wie zuvor. Die Mutter jedoch, die barhäuptig auf der Hoftreppe gestanden hatte, hatte Zahnweh bekommen.
Tine mußte geholt werden.
Immer mußte Tine geholt werden.
Tine kam, die Kleiderschürze über den Kopf gezogen.
„Lieber Gott, was bringen Sie nur für eine Kälte mit herein“, sagte die Mutter, die stets fror und fröstelte, sobald nur eine Tür ging.
„Tine, ich habe Zahnschmerzen“, sagte sie.
Der Toilettenspiegel mußte geholt und auf einen großen Tisch gestellt werden, und dann wurde mit ein paar Zweiglein von einem Busch, der im Garten des Schullehrers wuchs, „geräuchert“.
Tine, das Stubenmädchen und alle Kinder standen rundherum.
Das ganze Schlafzimmer war eine Dampfwolke, während sich die Mutter mit offenem Mund über die rauchenden Zweige beugte.
„Tine, Tine, jetzt!“ rief die Mutter.
Tine sollte ihr mit einer Haarnadel in den Zähnen stochern.
„Da ist er, da ist er“, rief die Mutter, „schaut euch den Wurm an.“
Tine hatte sich so angestrengt, daß vom Toilettenspiegel ein Stück Emaille absprang.
An diesen Wurm in den Zähnen glaubte die Mutter felsenfest, und wenn drei, vier Würmer zum Vorschein gekommen waren, hörten ihre Zahnschmerzen ein für allemal auf.
Aber nur Tine und niemand anders konnte sie herausbohren. Und gewissenhaft bohrte sie sie allen Kindern aus den Zähnen.
„Lieber Fritz“, sagte die Mutter zum Vater, der mit Einwänden kam, „ich sehe die Würmer ja mit meinen eigenen Augen. – Aber es muß auch mit Zweigen von Kärböllings Busch geräuchert werden.“
Der Amtsarzt von Sönderborg meinte, der Rauch von Schullehrers Buschgewächs sei sehr giftig.
So eine Zahnwehprozedur konnte oft einen halben Nachmittag dauern, bis die Dämmerung hereinbrach.
In der Dämmerung war es in der Waschküche schön. Der warme Dampf erfüllte den Raum, und das Feuer unter dem Kessel sah aus wie ein großes rotes Auge. Die Mägde klopften die Wäsche mit den Waschhölzern, daß es von der Decke widerhallte.
Die Mutter saß auf einem Schemel mitten im Lärm.
Nirgendwann und nirgendwo anders lief das Mundwerk der Mägde so flink wie in der Waschküche.
Der gesamte Dorfklatsch kam zur Waschküchentür herein.
Stundenlang konnte die Mutter auf ihrem Schemel sitzen und zuhören, bis sie dann plötzlich wieder in die Stube lief. Und ganz unweigerlich sagte sie nach solchen Stunden in der Waschküche: „Du liebe Güte, auf was diese Menschen alles kommen können.“
Und es schien, als wollte sie mit ihren schönen Händen etwas von sich fortschieben.
„Daß Sie sich das auch alles anhören mögen“, sagte Tine.
„Ja, sie sehen doch so lustig aus“, entgegnete die Mutter und ahmte die Mägde nach.
Sie konnte jeden Menschen nachahmen, der ins Haus kam.
Doch an den meisten Tagen blieb sie, wenn es dämmerte, in der Wohnstube. Da sang sie. Aber manchmal in der Dämmerstunde saß sie in ihrem hohen Rohrsessel auf dem Podest am Fenster, die Hände im Schoß.
Dann sprach sie leise in die stille Stube.
Am liebsten sprach sie davon, wie es sein würde, wenn sie alt wäre und graues Haar hätte, ganz graues Haar.
Und sie wäre Witwe und alle ihre Kinder erwachsen, und sie wäre arm.
„Schrecklich arm“, sagte sie.
Dann könnte abends nichts weiter auf den Tisch kommen als Butter und Käse in der alten Käseglocke aus Kristall.
„Aber gut muß die Butter sein“, sagte sie.
Und sie malte aus, wie weiß das Tischtuch sein müßte und wie dann die Kinder alle kämen, jedes von seiner Arbeit, und sie würden Tee trinken an dem Tisch, an dem sie säße, grau und still und alt, und arm. Denn in ihren Augen glich Armut einer traumhaften Sorglosigkeit.
Sie hatte wohl nie andere „Arme“ gesehen als jene, die in den weißgemalten Häuschen entlang der Dorfstraße wohnten.
Wenn dann der Tee getrunken war und der Vater das Haus verlassen hatte, kamen die besten Stunden. Das war die Zeit, in der die Puppen zum Vorschein kamen. Der Eßtisch wurde wie zu einem Festmahl ausgezogen, und die Mutter saß würdevoll zwischen all ihren Pappschachteln. Darin waren die Puppen aufbewahrt.
„Jetzt, jetzt können sie hervorkommen, denn jetzt ist Vater weg.“
Und sie kamen hervor, zu Hunderten. Es waren Figuren aus Modejournalen, die sie ausgeschnitten und auf Holzklötzchen geklebt hatte. Jede hatte auf der Rückseite einen Namen – jede war eine eigene Persönlichkeit, und dann wurden sie über den ganzen Tisch hin aufgebaut. Die Komödie begann, und die Mutter führte Regie. Die Puppen gaben Gesellschaften und gingen zu Besuch.
Sie plauderten und machten Knickse und Diener.
Die Mutter wurde ganz rot vor Anstrengung, mit ausgebreiteten Armen dirigierte sie die Puppen und bewegte sie über den ganzen Tisch.
Die Kinder hatten ihre eigenen Puppen, und auch die Mamsell hatte ihre. Aber diese Pappfiguren konnten es der Mutter nie recht machen, und so sprach sie für sie alle.
„Jungfer Jespersen, Jungfer Jespersen, Sie vergessen ja Fräulein Lövenskjold.“
Fräulein Lövenskjold war stehengeblieben, und sie sollte sich doch bewegen. Für die Mutter waren es keine Puppen. Für die Mutter waren es Menschen. Sie sprachen und sie agierten und sangen. Sie spielten hundert Komödien, bald in einem Badeort und bald in Paris.
Die Kinder schauten zu, vor ihnen auf dem Tisch schien sich, vornehm und fein, die ganze Welt zu bewegen.
Die Mägde kamen herein. Sie hörten so gern zu. Sie verstanden kein Wort, aber sie standen da wie die Säulen und versteckten die Hände unter den Schürzen. Wenn den Puppen etwas Trauriges widerfuhr, weinten sie.
Aber gerade als die Komödie im schönsten Gange war, fuhr die Mutter auf, und alle Puppen purzelten durcheinander – schnell in die Schürzen und in die Schachteln damit.
Der Vater kam nach Hause.
„Den Tisch zusammen, den Tisch zusammen.“
Mägde und Kinder hatten zu tun. Die Mutter selbst konnte sich nicht rühren vor Schreck.
„Gott, warum sind die Kinder auch noch auf“, sagte sie.
Und die Kinder verschwanden Hals über Kopf in die Betten.
Die Mutter aber saß auf dem Sofa zwischen den beiden Mahagonischränkchen und war so erschrocken, daß sie Zwieback und Konfitüre haben mußte.
Manchmal verkleidete sie auch die Mägde.
Eines Abends war sie mit den Kindern allein zu Hause.
Da pochte es kräftig gegen die Hoftür, und die Mamsell mußte hinausgehen und öffnen und kam schreiend zurück: „Da war ein Landstreicher ..., da war ein Landstreicher ...“ Und gerade als die Mutter am lautesten schrie, kam der Landstreicher in die Stube hinein. Garstig war er, und die Kinder kreischten auf. Aber plötzlich entdeckte einer der Jungen, daß es die große Marie war.
„Mutter, das ist ja die große Marie“, rief er.
Doch im gleichen Augenblick flüsterte die Mutter Marie ins Ohr: „Geben Sie Nina eins hinter die Ohren.“
Und Nina bekam von Marie eine Ohrfeige, daß es klatschte.
Da glaubten die Kinder, daß es ein Landstreicher war.
Danach bot die Mutter der Kerlsmarie einen Schnaps an, und den mußte sie hinunterschütten, denn nun war sie ja ein richtiger Kerl.
Weißes Haus, du weißes Haus, deine Erinnerungen kommen wie eine jubelnde Schar – sie kommen und sammeln sich um Eine.
Könnte ich doch ein Bild aus Worten fügen, das nie verginge – es wäre Jugend und Lächeln, Anmut und Trauer, Freude mit betrübten Augen, Schwermut, die mit bebendem Mund lacht; hilflose Hände, die nur andrer Not zu helfen wußten, zarte Glieder, die in der Sonne sich regten und froren, wenn sie unterging.
Ein Bild von ihr, die das Leben liebte und an seiner Sorge starb.
Sie starb wie eine schöne Blume, die man bricht.
Keine Rose, auch keine Lilie.