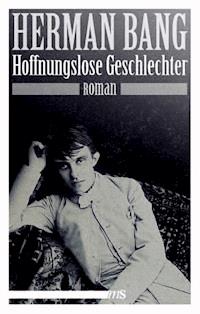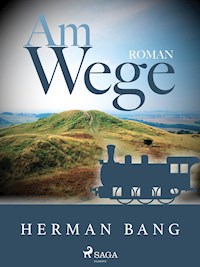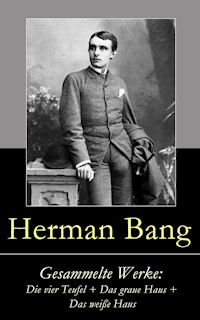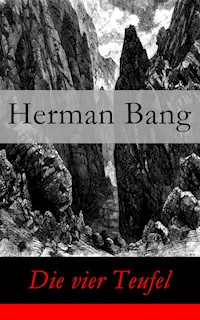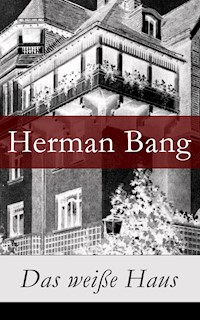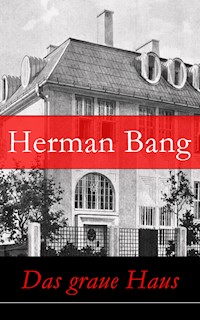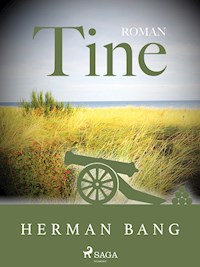
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tine, die Tochter des Küsters auf einer malerischen dänischen Ostseeinsel, ist bei dem jungen Ehepaar Berg ein gern und häufig gesehener Gast. Doch dann bricht jäh der deutsch-dänische Krieg von 1864 in die Idylle ein: Tines friedliches Heimatdorf liegt plötzlich am Rand eines Schlachtfelds, Flüchtlinge und Verwundete werden einquartiert, während der Kanonendonner immer näher rückt. Inmitten der spannungsgeladenen Atmosphäre wird sich Tine ihrer lange verdrängten Gefühle für Berg bewusst. Hermann Bang, dänischer Schriftsteller, geboren am 20.4.1857 auf Alsen, gestorben am 29.1.1912 in Ogden (Utah, USA) auf einer Vortragsreise. Schon früh war Herman Bang der bedeutendste dänische Journalist seiner Zeit, aber auch sehr kontrovers diskutiert. Er lebte das Leben eines Dandys, inszenierte sich als Gesamtkunstwerk nach dem Vorbild von Huysmans und Wilde; seine homosexuellen Neigungen zeigte er auch öffentlich, was ihm Anfeindungen und Isolation in Dänemark eintrug. Herman Bang war der bedeutendste dänische Vertreter des literarischen Impressionismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herman Bang
Tine
Roman
Saga
Zur Erinnerung an meine Mutter
Dies Buch gehört dir.
Damals, als du noch stark und glücklich warst, machten wir eines Tages, wie wir es in meiner Kindheit so oft taten, wenn die Dämmerung kam, eine „Wunschwanderung“ durch die Strassen der Stadt: in den Ladenfenstern suchten wir uns alles aus, was wir uns wünschten, wir teilten uns die Herrlichkeiten, die uns nicht gehörten, und stritten uns um sie. An diesem Tage blieben wir auch vor dem Buchladen stehen und du last alle Titel auf den Bänden und sagtest: „Wenn du nun einmal ein Buch schreibst, musst du meinen Namen darauf setzen.“
Und später, als du schon krank warst und wir so oft in den kümmerlichen Alleen des „Wäldchens“ spazieren gingen, — du brauchtest die späte Septembersonne, — nahmst du eines Tages meine Hand und sagtest mit deiner Stimme, die so voll Angst und Zärtlichkeit war: „Wenn ich nun tot bin und du, mein Junge, einmal ein Künstler geworden bist, willst du dann dafür sorgen, mir versprechen, dafür zu sorgen, dass sie — mich nicht ganz vergessen?“
Und du weintest, Mutter, weil du sterben musstest.
Deine Bitte habe ich nie vergessen.
Jetzt setze ich deinen Namen vor dieses Buch. Ich weiss, es ist deiner Liebe so wenig, wie deines Herzens oder deines Geistes würdig. Aber dies Buch ist in dem Erinnern an dich in mir entstanden, an dem Ort, wo du mich geboren. Dir war er bis zum Tode deine Heimat.
Kriegszeiten und eine fremde Macht verheerten bald diesen lichten Ort, wo dich, die in Freude und Sonne leben musste, Weichheit und Wärme umgab. Wie die Feinde über unser altes Heim, brach bald auch das Unglück über uns herein.
Und jetzt, wo du längst gestorben bist, setze ich deinen Namen vor dies Buch vom Unterliegen und von unserem verlorenen Heim.
Ich tue es jetzt, wo meine Jugend vorbei ist; und alles, was ich in zehn Jahren schrieb, schrieb, um zu leben, und schrieb, um zu schreiben, scheint mir oft so unendlich fern und doch so unendlich klar vor mir zu liegen.
Zwei Dinge streiten sich in all diesen Worten — und der Streit wird wohl niemals ganz enden —: mein altes Vätergeschlecht und du, die, neu und fremd, in dasselbe hineinkam. Du trugst seinen Namen mit begeisterter Hingabe. Du liebtest es, wie ich. Während eines Jahrhunderts hatte es Staatsmänner hervorgebracht, die das Land nicht vergessen wird, berühmte Ärzte, die für Generationen die grössten und volkstümlichsten im Norden waren.
Aber dann wurden die Söhne dieses Geschlechts Priester, weil sie zu schwach waren, Blut zu sehen, und untätige Müssiggänger, deren leere Hirne künstlich angefeuert werden mussten.
Du erzähltest mir oft von dem Ruhme unsers Geschlechts. Einer seiner grossen Ärzte hinterliess mir die Erzählung von all den Verirrungen und Krankheiten desselben: er wollte — zur Belehrung — seine Fäden in die Geschichte des Geschlechts hineinwinden.
Mein Geschlecht in mir schrieb wohl in meiner Jugend viel, sehr viel.
Aber auch du, Mutter, schriebst das Deinige.
Stella Höeg und Nina und Fräulein Agnes und Frau Katinka — das ist dein Blut. Diese Gestalten, das bist du, du allein. Sie sind Kinder deiner Freude und Kinder deines Leides. Sie haben dein Gesicht und deine Stimme. Sie lieben und leiden mit deinem Herzen. Sie gingen jung ins Grab, wie du, und aus dem gleichen Kummer.
Und sollten sie Lebenskraft haben — selbst nur für wenige Jahre — so wirst auch du so lange nicht vergessen werden.
Vor dieses Buch setze ich deinen Namen, als eine Erinnerung an die lichte Zeit und an ein Heim, das man hinter einer Tür flüchtig erschaut hat, die schnell geschlossen ward. Als der Unfriede über unser altes Haus kam, kam bald auch das Unglück und der Tod über uns.
Erstes Kapitel
Tine lief noch immer weinend neben dem Wagen her, während Frau Berg die letzten Worte laut in Dunkelheit und Wind hinausrief:
„Das machen Sie noch zurecht, in der blauen Kammer, heute abend ... heute abend noch!“
„Ja, ja,“ antwortete Tine und konnte vor Weinen nicht sprechen.
„Und grüssen Sie, grüssen Sie!“ rief Frau Berg unter Schluchzen; der Wind verwehte ihr Wort. Noch ein letztes Mal lief Tine hinzu und griff nach ihrer ausgestreckten Hand, aber sie erhaschte sie nicht mehr. Da blieb sie stehen, und wie ein grosser Schatten glitt der Wagen schnell ins Dunkel hinein. Nun hörte man ihn nicht mehr.
Tine ging nach Hause durch die Allee über den Hof, wo die Jagdhunde leise winselten. Sie öffnete die Tür zum Hausflur; da war es so öde mit den leeren Kleiderrechen und Herlufs Spielzeugecke, die nun ausgeräumt war. Sie ging in die Küche, wo das Talglicht mit einer qualmenden Schnuppe zwischen den Resten vom Teetisch brannte.
In der Gesindestube sassen die Leute still beisammen, Lars am oberen Ende des Tisches.
„Ich soll grüssen,“ sagte Tine mit halber Stimme, und es wurde wieder still. Nur Maren, die mit der Schürze über dem Kopf wie ein wackelndes Bündel dasass, heulte hinten am Ofen mit langgezogenem Schluchzen auf.
„Ja,“ sagte Lars nach einer Weile bedächtig, „nun sind sie fort!“ Und der Hofknecht nickte zur Bekräftigung.
„Wir sollen gleich alles für den Oberförster herrichten,“ sagte Tine leise wie vorhin und ging hinaus; Sophie, das Stubenmädchen, die helfen sollte, folgte ihr.
Im Flur öffnete sie die Tür zum Wohnzimmer. Die Lampe brannte ruhig auf dem leeren Tisch, und die weit offen stehenden Türen zu den anderen Zimmern gähnten diesen verlassenen Raum wie drei stille, dunkle Schlünde an.
„Den Nähtisch hat sie mit,“ sagte Sophie.
„Ja,“ seufzte Tine. Der Platz auf dem Fenstertritt war leer.
„Und auch die Bilder,“ sagte Sophie und zeigte mit dem Finger auf die hellen Flecke auf der Tapete um den Spiegel herum, die Spuren von den Familienbildern, die heruntergenommen waren.
In Tine wollten wieder die Tränen aufsteigen, und sie wandte sich ab.
„Ja, wir wollen anfangen,“ sagte sie, und sie gingen mit dem Licht die Treppe zum Schlafzimmer hinauf. Die beiden Betten standen nebeneinander, mit derselben Decke zugedeckt — Tine hatte sie zum letzten Weihnachtsfest gestrickt; am Fussende stand Herlufs Gitterbett, leer.
Beim Anblick des leeren Bettes öffneten sich bei Sophie wieder die Schleusen, und mit dem Licht in der Hand begann sie von damals zu erzählen, als „der Junge“ klein war. Sie war Herlufs erstes Kindermädchen gewesen, und es gab für sie auf der Welt keinen anderen Jungen als ihn.
„Er war knapp erst geboren, als ich sein Kindermädchen wurde,“ sagte sie in ihrem jütländischen Kleinstadtdialekt, einer sonderbar gedrückten Sprechweise: sie schien Mühe zu haben, den Mund richtig aufzumachen, und sie verschluckte die meisten E. „Er wollt nie von andern als von mir getragen werden — und von der gnädigen Frau;“ sie schnob hinter jedem Wort auf, — „nein, er wollt nicht ...
Ich hab ihn so oft zur Gnädigen hinübergetragen,“ sagte sie, „morgens, denn da wollte er durchaus rüber,“ sie lächelte plötzlich unter Tränen, „und die Wärme haben, der Strick!“ schloss sie und weinte von neuem.
„Ja,“ sagte Tine, die auf der Bettkante sass. Sie dachte an die Wintermorgen, wenn sie mit dem Tuch um den Kopf herübergelaufen kam, sobald es hell wurde — dann schlug sie mit den flachen Händen dreimal gegen die Schlafstubentür, um Frau Berg und Herluf zu wecken, die noch in süssem Schlummer lagen.
Frau Berg richtete sich schlaftrunken im Bett auf. „Das ist Tine, das ist Tine,“ rief sie, während sie mit den Händen auf das Deckbett schlug. „Kaffee, Kaffe—ee!“ schrie sie mit ihrer fröhlichen Stimme, dass man es unten in der Küche hören konnte, und Herluf in seinem langen Nachtrock begann vor Vergnügen wie ein Eichhörnchen im Bett herumzuspringen.
Während sie schwatzten, zog Tine die Schuhe aus und setzte sich in Bergs Bett ans Fussende, die Decke über sich gezogen, um sich zu wärmen.
So sassen sie und plauderten stundenlang.
Herluf war „Chinese“ mit gespreizten Fingern, und Herluf schlug Purzelbäume über alle Betten hinweg; Frau Berg und Tine lachten, dass die Bettstellen wackelten und wiegten, und Sophie stellte sich mit einem Kaffeerest im Spülnapf in die Tür, um Teil an dem Vergnügen zu haben. Aber schliesslich wurde Sophie ganz beleidigt um Herlufs willen und sie sagte: „Das Kind soll nicht immer so springen und Theater spielen.“ Und sie nahm ihn aus dem Bett heraus, um ihn ins Wohnzimmer zu tragen und ihn in der Wärme anzukleiden. Frau Berg und Tine blieben in den Betten und schwatzten das Blaue vom Himmel herunter — der Mund stand Frau Berg nie still, wenn sie mit Küsters Tine zusammen war —, bis Tine plötzlich mit einem Satz aus dem Bett stob. Die Haustür ging.
„Der Oberförster!“ rief sie und konnte kaum in die Schuhe hinein vor lauter Eile.
„Schliess zu, schliess zu!“ rief Frau Berg, „schliess doch zu!“
Und Tine drehte den Schlüssel in der Tür um.
„Ja, ja, ich kleide mich an, Henrik!“ rief sie Berg zu, der anklopfte, und sie hiess Tine mit dem Waschgeschirr klappern, damit er glauben sollte, sie sei schon auf.
... Sophie stand noch immer mit dem Licht vor dem Gitterbett und schwatzte von ihrem Herluf und vergoss Tränen über Gutes und Böses.
„Aber ein Racker war er,“ sagte sie. „Ja, das war er,“ wiederholte sie.
Tine sass noch auf der Bettkante und lächelte: „Ja, was Frau Berg für Einfälle hatte.“
Sie dachte an den Morgen, wo der Oberförster ins Haus getreten war, während sie noch im besten Schwatzen in den Betten sassen. Frau Berg hatte sie plötzlich an den Beinen gepackt — der Oberförster war schon auf der Treppe — und hatte sie unter des Försters Deckbett gesteckt; er war schon an der Tür: „Still, still!“ wisperte Frau Berg.
Er war schon drin. Tine lag mäuschenstill. Und Frau Berg erzählte und schwatzte mit dem Oberförster, der zuhörte und lachte und sich hinsetzte, mitten auf sein Bett.
„Du setzt dich auf Tine, du setzt dich auf Tine!“ schrie Frau Berg, ganz atemlos vor Lachen ... Und Tine fuhr aus dem Bett heraus, hochrot, mit verhaltenem Weinen, und lief zur Tür hinaus, die Treppe hinunter, bis zur Schule, und kam drei Tage lang nicht in die Oberförsterei, so schämte sie sich.
... Tine stand auf, und sie begann das Bettzeug vom Bett des Oberförsters abzunehmen und häufte es vor der Tür auf.
„Nimm das Licht mit,“ sagte Tine, sie wollte die leere Stube nicht sehen.
Sie trugen die Betten und die Matratzen die Treppe hinunter durch die Zimmer, wo alle Türen hinter ihnen offen blieben.
„Es ist so leer, als wären wir alle abgereist,“ sagte Sophie.
„Ja,“ sagte Tine, die eine Matratze schleppte. In dem blauen Fremdenzimmer war es kalt wie in einem Keller; seit dem Sommer hatte niemand darin geschlafen. Das eine Gastbett musste heraus, und das andere wurde an die Wand gerückt.
Während Tine und Sophie noch mit den Laken und dem Waschgeschirr hantierten, kamen die alten Böllings, um die Tochter zu holen. Als Madam Bölling in die Wohnstube kam, wo es von allen Seiten durch die offenen Türen zog, blieb sie auf dem Läufer stehen und sah sich mit Tränen in den Augen um.
„Ja, nun sind sie fort,“ sagte sie und faltete die Hände.
Die beiden Alten setzten sich still auf ihre gewohnten Plätze, zwei Stühle vor dem Sofatisch, ein wenig ins Zimmer hinaus; in der Oberförsterei wollten sie nie auf dem Sofa sitzen, das war Frau Bergs Platz, — während Tine aus und ein ging und Sophie Holz für den blauen Kachelofen herbeitrug; sie hatte mittlerweile das Kopftuch umgelegt.
Das Kopftuch war das Zeichen, dass sie durch die Abreise „ihre Kopfschmerzen“ bekommen hatte. Das geschah regelmässig an fünf von den sieben Tagen der Woche, und dann war sie so furchtbar verstimmt, dass sie kaum mehr als ja oder nein antwortete und gerade nur das Allernotwendigste tat. Nach einer grossen Wäsche ruhte Sophie sich acht Tage mit ihren Kopfschmerzen aus und kujonierte das ganze Haus.
Tine erschien in der Tür zum Zimmer des Oberförsters: „Wollt ihr sehen?“ sagte sie, „nun sind wir fertig.“
„Na, lass mal sehen,“ versetzte der alte Bölling, und sie gingen durch das Zimmer des Oberförsters in die blaue Kammer, wo das eine schmale Bett verlassen an der hellblauen Wand stand; es war da so kalt, dass die beiden Alten zusammenschauerten. Sie standen alle drei vor dem Bett. Tine hatte Frau Bergs Bild über dem Kopfende aufgehängt. „Na, hier liegt er ja ganz prächtig,“ sagte Bölling und versuchte zu lächeln. Sie waren alle drei gleich nahe daran, von ihrer Trauer übermannt zu werden.
„Ja, wenn es jetzt schön warm wird,“ sagte Madam Bölling, „wenn es jetzt warm wird, dann geht’s schon.“
Sie kehrten ins Wohnzimmer zurück und setzten sich wieder, Tine auf den Fenstertritt, wo der Nähtisch gestanden hatte. Sie sprachen nicht viel, nur ab und zu ein Wort, während sie alle an dasselbe dachten. Madam Bölling schüttelte immerfort den Kopf und blickte im Zimmer umher.
„Ja, es ist wahrlich ein schönes Haus gewesen,“ sagte sie.
Die beiden alten Böllings gebrauchten ständig das Wort „wahrlich“, das sie sozusagen von Berufs wegen übernommen hatten durch Böllings häufigen Umgang mit der Bibel.
Madam sass wieder eine Weile still, bis ihre Gedanken eine andere Richtung nahmen.
„Es ist doch wohl alles gut mitgekommen und gut eingepackt?“ fragte sie. „Und sind die Brombeeren gut im Kasten verschnürt?“
Die Brombeeren waren zwei Kruken mit Eingemachtem, das Frau Bölling selber eingekocht hatte, damit Frau Berg es mit nach Kopenhagen nehmen sollte.
„Denn das ist ihr Lieblingskompott, Tine,“ sagte Madam, „wirklich, und drüben soll es keine geben.“
„Der Oberförster hat sie selber festgeschnürt, Mutter,“ sagt Tine.
„Ja, wir haben hier manches Mal Brombeeren gegessen,“ fährt Madam Bölling in demselben stillen Ton fort, „und Marmelade — zum Zwieback,“ schloss sie nach einer Pause.
„Das haben wir,“ sagte Tine und sah vor sich hin. Sie dachte an die Abende, wo nach ihnen in die Schule geschickt wurde, meistens, wenn der Oberförster fort war; und sie gingen nach dem Tee herüber, und die Einmachgläser und Zwieback kamen auf den Tisch, und sie assen von Unterschalen, während sie schwatzten und Frau Berg und sie lachten und sangen.
„Ein Lied, Tine, ein Lied!“ rief Frau Berg und schlug auf die Sofalehne; und sie stimmten an: „Herr Peter“ oder „Vogel, flieg über des Furesees Fluten“ und „Im Königswalde“, bis ein Walzer daraus wurde und sie sich auf dem Teppich drehten und Frau Berg ausser Atem Milchpunsch verlangte, der in einer Steinkruke hereingebracht wurde.
„Ja, das reicht für manchen Abend,“ sagte Madam Bölling, die noch immer an die Brombeeren dachte, „da kann sie es machen wie hier zu Hause.“
Und der alte Bölling, der mit gefalteten Händen dasass und nicht hörte, was die anderen sprachen, sondern seinen eigenen Gedanken nachhing: dass jetzt dreizehn hier im Kirchspiel einberufen waren, das hatte er ausgerechnet — der alte Bölling sagte:
„Ja, ja, Gottes Wille geschehe!“ und stand auf.
Die Alten wollten nach Hause; Tine wollte ja doch bleiben und auf den Oberförster warten. Aber Tine liess sie nicht gehen; sie mussten ihr erst helfen, sie konnte die leuchtend hellen Flecken rings um den Spiegel nicht sehen, sie mussten etwas anderes aufhängen, etwas, das sie verdeckte. Sie holte „König Friedrich“ und „Die Schlacht bei Idstedt“ und „Fredericia“ aus der Gartenstube herbei, und die beiden Alten hielten die Bilder, während sie den Spiegel losmachte.
Frau Bölling stand mit den Helden von Idstedt, die noch mit den weissen Binden um die Stirn weiterkämpften. Sie sah sie unverwandt an, und ein paar heimliche Tränen fielen auf das Glas nieder; sie dachte an jene, die jetzt Gesundheit und Leben hingeben sollten.
„Gib her, Mutter,“ sagte Bölling und nahm das Bild, aber auch er behielt es so lange, dass Tine es ihm aus den Händen nehmen musste.
Nun hingen die Bilder, und die Alten, die schon ihre Überkleider anhatten, setzten sich wieder auf die beiden Stühle und sahen zu den Helden von Idstedt und zum König empor.
Tine war hinausgegangen und kam mit einem vierten Bilde wieder. Es war ein Porträt von König Christian als Thronfolger, in der Uniform der reitenden Garde; das hatte in einem der Fremdenzimmer gehangen. Sie schlug unter König Friedrichs Bild einen Nagel ein und hängte das Porträt an den leeren Platz.
Alle drei standen eine Weile schweigend vor den vier Bildern.
„Ja, wahrlich, das ist richtig, Tine,“ sagte Bölling, „das ist doch der König.“
Die Alten kamen in den Flur hinaus, das Talglicht in der Küche war im Niederbrennen. Tine stellte das Licht an das Fenster, damit es den Eltern ein wenig über den Hof leuchte. Vom Waschhause her tönte lauter Lärm; das war Maren, die vor lauter Kummer bis in die sinkende Nacht hinein scheuerte und polterte, während sie zu der Melodie „Wer weiss, wie nahe mir mein Ende“ sang, dass es auf dem Hof widerhallte:
„Es liegt nun Friedrich aufgebahret
Und schlummert sanft für ewge Zeit.
Rings trauernd kniet sein Volk gescharet,
Es weint um ihn aus Dankbarkeit,
Der kühn versprach: Ich kenn die Pflicht!
Käm höchste Not, ich lass euch nicht!“
Die Eltern hatten den Hof verlassen, aber Tine blieb auf der Treppe stehen. Sie horchte nach den Jagdhunden, die in ihrer Hütte knurrten. Dann lächelte sie: die wollte sie herübernehmen ins Zimmer — das würde den Oberförster freuen, wenn er nach Hause kam. Es war doch etwas Lebendes, das ihn empfing.
Sie ging über den Hof und öffnete die Scheunentür, wo die Hundehütte war. Ajax und Hektor sprangen unter leisem Geheul an ihr hinauf, und dann liefen sie vorauf in die offene Haustür hinein.
Im Wohnzimmer setzte Tine sich auf den leeren Fenstertritt. Sie meinte noch nie so betrübt gewesen zu sein, so beklommen und bedrückt wie jetzt, während sie auf den öden Hof hinausblickte. Das Licht am Küchenfenster flackerte noch einmal über das Weiss der Scheune, dann war auch das verlöscht, und sie sah nur den Schatten des Walnussbaumes mitten auf dem dunklen Hof. Es war gestern abend gewesen; Frau Berg hatte hier neben ihr auf dem Fenstertritt gesessen und auf den blattlosen Baum hinausgesehen. „Ob ich zurückkommen kann, wenn er wieder grünt?“ hatte sie gefragt und hatte geweint und beide Arme um ihren Hals gelegt.
Draussen im Waschhause sang Maren immer noch, dass es schrill in den dunklen Abend hinausschallte:
„Drum Männer nun und Frauen weinen.
Erloschen ist der Freude Licht,
Und dankbar winden ihm die Seinen
Nun einen Kranz, der welket nicht.
Ein ewiges Erinnrungsband
Umflicht den König und sein Land.“
Tine sass, die Hände im Schoss gefaltet, während Ajax und Hektor mit grossen Augen auf dem Teppich zu ihren Füssen lagen.
Die Hunde sprangen auf, ein Wagen fuhr an der Treppe vor. Das war der Oberförster. Er trat ins Haus, wo Sophie ihm leuchtete, und er brachte Grüsse von Herluf und von seiner Frau.
„Und ich bin einberufen,“ sagte er kurz.
Er ging in das Zimmer und Tine folgte ihm. Sie ging langsam hin und löschte die Lichte am Klavier aus, die sie angezündet hatte, eins nach dem andern.
„So kommt alles auf einmal,“ sagte Berg.
Das war Tines einziger Gedanke gewesen: „So kam alles auf einmal!“ Dann besann sie sich und fragte:
„Weiss Ihre Frau es?“
„Ja, Jessen brachte die Nachricht aufs Schiff.“
Sie setzten sich an den Tisch, den Tine gedeckt hatte, und besprachen nun mit stumpfen, schleppenden Stimmen, wie es mit der Bewirtschaftung und der täglichen Arbeit werden sollte; mit den Arbeitskräften war es eine schwierige Sache. Lars musste ja vielleicht mit, und die meisten Tagelöhner mussten auch fort.
„Die Forstwirtschaft muss wohl grösstenteils liegen bleiben, dazu bleiben keine Hände.“
„Nein,“ sagte Tine.
Sie sprachen von den Einberufenen. Es war fast aus jedem Hause im Kirchspiel einer einberufen. Man nahm sie mir nichts, dir nichts den Ihrigen fort.
„Ja, beim Dachdecker Anders ist es der reine Jammer. Anne war heute in der Schule, mit ihren beiden Kleinen auf dem Arm — wie sie weinte, ach, wie sie weinte, Anders sei schon fort und was sie machen solle — ach, wie sie weinte ...“
Bei diesen Worten zuckte es auch um Tines Mund.
„Ja,“ sagte Berg, „denen sitzt ja vom letzten Krieg der Bruder da — beide Beine abgeschossen.“
„Ja,“ sagte Tine leiser, und nach einer Weile, „vor den Krüppeln haben die Leute Angst!“
Sie verstummten eine Weile. Die Hunde gingen liebkosend von einem zum anderen, aber niemand beachtete sie. Berg sprach wieder von der Wirtschaft. Einen Vertreter wüsste er. Den einarmigen Baron Staub konnte er immer haben, er war disponibel — „der hat ja sein Teil weg, durch einen Fehlschuss,“ sagte er. Und fast ohne Übergang lehnte er sich an die Wand zurück und starrte ins Licht: „Nun sind sie längst draussen auf der See.“
Tine schien es, als folge er ihnen mit den Augen über das Wasser, während er es sagte. Sie wollte ihm so gern etwas sagen, das ihn aufmunterte und seine Stimmung verbesserte. „Sitzt du darum hier,“ sagte sie zu sich selbst, „es fehlte bloss noch, dass du selber weintest!“
Aber sie fand nichts. Es waren ja niemals viele Worte zwischen dem Oberförster und ihr gewechselt worden; sie hatte nie mit ihm zu schwatzen gewagt wie mit dem Hardesvogt oder dem Kaplan bei Götsches oder mit irgend jemandem, vor dem man nicht solchen „Respekt“ hatte. In der Oberförsterei sprach sie ja nur mit Frau Berg. Schliesslich sagte sie in einem Ton, der munter sein sollte:
„Nun, und wir haben uns so gesputet mit der blauen Kammer, das hätten wir uns sparen können, Sophie und ich!“ Sie stand auf.
„Ist die schon imstande? Sie müssen doch auch alles machen, Tine!“
Berg ergriff ihre Hand, und das Blut stieg Tine ins Gesicht — das geschah bei der geringsten Veranlassung, wenn sie in der Oberförsterei war. Herr Oberförster müsse es doch mal sehen, sagte sie, und sie öffnete die Tür; aber plötzlich blieb sie in seinem Arbeitszimmer stehen, und er ging allein in das Fremdenzimmer hinein.
„Wie gemütlich und warm es da ist!“ sagte Berg, als er zurückkam.
Tine wollte nun gehen. Sie fand es so ungewohnt beklemmend, als seien sie beide allein im ganzen Hause — in dem verlassenen Hause.
Aber der Oberförster trat an den Tisch und sagte:
„Da steht von der Beisetzung in den neuen Zeitungen; wollen wir das nicht erst lesen?“
Für Tine war es immer ein Fest, wenn der Oberförster aus den Zeitungen vorlas, die am Mittwoch- und Sonnabendabend kamen, oder aus einem Buch aus dem Bücherschrank, aus den Tragödien von Öhlenschläger.
„Gern,“ sagte sie. „Aber Sophie möchte gewiss auch zuhören.“ Und sie ging hinaus, um das Mädchen zu rufen, das mit verbundenem Kopf neben dem Herde sass und schlief und nun mit hineinkam, um sich in die Ecke hinter dem Bücherschrank zu setzen, von wo sie so oft zugehört hatte, wenn vorgelesen wurde.
Berg öffnete langsam die schwarzumrandete Zeitung und legte einen Augenblick die Hände darüber zusammen:
„Nun ist er also zur Ruhe gekommen,“ sagte er bewegt und leise. Er begann halblaut den Bericht über „des Königs letzte Fahrt“ vorzulesen. Ringsum in dem stillen Hause hörte man keinen Laut, ausser seiner gedämpften Stimme.
Tine folgte den Worten nicht; sie hörte nur die Stimme, die sie von manchen stillen Abenden her kannte, und sie sah Frau Berg vor sich, wie sie da unter der Lampe sass, und sie hörte sie lachen, wie sie über Tines strömende Tränen zu lachen pflegte, die Tränen, die jetzt wieder hervordrangen, eine nach der andern.
„... Nun wurden Lichte und Fackeln angezündet, die zu des Königs letzter Reise leuchteten, und die Anwohner des Weges wetteiferten, dem Heimgegangenen die letzte Ehre zu erweisen. Die Glocken läuteten von allen Türmen, und jedes Gehöft und jedes Haus, auch das ärmste, hatte Lichte an allen Fenstern. An vielen Orten hatten sich in der dunklen Nacht Gruppen von stummen Zuschauern gebildet ...“
Hinten in der Ecke ging Sophies Schluchzen in lautes Weinen über, aber der Oberförster las unbeirrt weiter.
„Dicht am Bahnhof hielt der Wagen. Die acht schwarzbehangenen Pferde wurden abgespannt und von Stalldienern fortgeführt, die ihren hohen Herrn zu Fuss begleitet hatten. Eine Segeltuchdecke wurde über den Wagen gespannt, um ihn und den Sarg vor dem beginnenden Sprühregen zu schützen.
Husaren hielten die letzte Wacht bei König Friedrich VII ....“
Berg hielt ein wenig inne ... seine Stimme begann heiser zu werden.
Tine sass und sah vor sich hin; sie dachte an die Tragödien, die sie wieder und wieder gelesen hatten, die von Axel und dann die von der Königin Zoë ... Im fünften Akt fing auch Frau Berg immer an zu weinen, und wenn eine sehr schöne Stelle kam, drückten sie sich unter dem Tisch die Hände.
Berg las weiter von dem Leichenzug und von der Leichenrede. Er war so bewegt, dass seine Stimme fast versagte.
„... Er ist nun abberufen von seinem Volk, aber die Liebe des Volkes begleitet ihn mit einem herzlichen Ade zum Grabe. Dies Ade erklingt aus allen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft, vom Krieger, der für ihn und das Vaterland auf dem Walplatz kämpfte, von denen, die aus den Taten des Friedens erkennen, dass Unternehmungsgeist und Wohlstand unter ihm gestiegen sind; vom ehrsamen Bauernstands, für den Friedrich VII. vollendet hat, was Friedrich VI. begann ...“
„Ja,“ sagte Berg, „das ist wahr.“
Tine fuhr zusammen, als er innehielt; und als er wieder begann, lauschte sie auch auf die Worte; es war ja der letzte Abend, wo sie lasen — für so lange, so lange ...
„... Wieder ward der Sarg emporgehoben und zur Kapelle getragen, an deren Eingang sich die Herolde und ein Teil des Volkes aufgestellt hatten. Der Zug durchschritt, die Geistlichkeit voran, den Eingang der Kapelle, der Sarg wurde auf seinen Platz gesetzt, der Bischof von Seeland sprach auf einer schwarzdrapierten Rednertribüne ein Gebet, die letzte Begräbniszeremonie fand statt, und die Salutschüsse vor der Kirche verkündeten, dass jetzt König Friedrich beigesetzt war.“
Sophie hatte ihr Gesicht mit den Händen bedeckt. Tine sah nur nach Berg hin, der weiterlas:
„... Das Gefolge verliess unter Orgelklängen schweigend die Kirche, und die Majestäten kehrten nach Kopenhagen zurück.“
Berg faltete die Zeitung zusammen; bevor jemand sprach, erhob sich Tine und verabschiedete sich.
Da sagte Berg, indem er den Kopf an die Wand lehnte und weit in die Stube hinausblickte — wie vorhin schon einmal:
„Wie der Junge doch weinte, als er ins Boot kam!“
Sophie sollte Tine begleiten, und sie zündeten die Laterne an. Ihr flackerndes Licht fiel unbestimmt über Hecken und Bäume. Sophie sprach von Ahnungen und Vorzeichen: Daran sei kein Mangel gewesen — es sei jetzt im Sommer nicht eben behaglich in der Försterei gewesen — so wie es nachts gehaust hätte.
Den „Wagen“ hätte sie allein dreimal gehört, so deutlich sei er das letztemal vor der Treppe vorgefahren. Und als sie hinausliefen, war kein Wagen weit und breit — weit und breit, das habe die Frau auch gesehen.
„Und das weiss man doch,“ schloss Sophie und schnaufte, „was so ein Gefahre bedeutet ... wenn man es dreimal hört ...“
Tine sprach nicht, und sie gingen weiter durch die Dunkelheit. Der Hund in Per Eriksens Hof fuhr auf, und bei Jungfer Jessen erwachte der Mops.
„Ja, Gott halte seine Hand über den Herrn und die Frau,“ sagte Sophie in einem Ton, als würfe sie Erde auf sie beide.
Tine holte Luft wie jemand, der frierend erwacht.
„Wie kalt es sein muss am Danewerk,“ sagte sie.
Sie waren zur Krugecke gelangt, und Tine wusste, dass Sophie sich fürchtete, um die Nachtzeit dem Kirchhof zu nah zu kommen.
„Nun kann ich allein gehen, Sophie,“ sagte sie. „Besten Dank, Sophie. Und dann passt du wohl auf Herrn Oberförsters Tee auf, dass er gerade so wird, wie immer — nicht?“
„Ja, adieu, Jungfer Tine.“
„Adieu.“
Tine hörte die Hunde, die bei Sophies Vorbeikommen wieder auffuhren, während sie langsam zum Schulhause ging.
Tine klopfte an und hörte erst Dagge, der zu kläffen anfing, und dann die Mutter, die aus dem Bett stieg und herauskam.
„Ich bin es, Mutter,“ sagte sie.
Madam Bölling machte in Nachtjacke und Rüschenhaube auf. „Der Oberförster ist einberufen,“ sagte Tine, als sie in den Flur trat.
„Ach Herr Gott, ach Herr Gott,“ klagte Madam Bölling und liess alle Türen offen, während sie wieder hinein zu Bölling ging; „ach Herr Gott, ach Herr Gott!“
„Das war ja zu erwarten,“ sagte Bölling, der aufrecht im Bett sass.
Tine musste erklären, wie es gewesen sei. Jessen hatte die Botschaft ans Dampfschiff gebracht. „Na, da hat sie es erfahren, na, da hat sie es erfahren“ — Madam Bölling wiederholte unablässig dieselben Worte —, „na, da hat sie es erfahren, die Ärmste.“
„Ja, Gott sei uns gnädig,“ sagte Bölling mit gefalteten Händen, als sie endlich still wurde.
Tine war müde und sagte gute Nacht. Sie drückte auf die Klinke der Schulzimmertür, um zu sehen, ob sie verschlossen war, bevor sie die Treppe hinaufstieg, und während sie über den Boden ging, trug sie das Licht vorsichtig um des Strohs willen, auf dem die Gravensteiner ausgebreitet lagen.
In ihrer Kammer stellte sie den Wecker und setzte die Goldlackstöcke vom Fenster auf den Fussboden.
Unten schwatzten noch die Eltern, es klang beinah, als wäre es in derselben Stube.
„Ja, Gott beschütze uns alle,“ sagte der Vater noch einmal unten. „Jetzt sind es vierzehn hier aus dem Kirchspiel.“
Dann verstummten die Alten allmählich, und Tine hörte ihre gewohnten Atemzüge ruhig und beinahe taktfest durch das Haus schallen.
Sie konnte nicht schlafen. Sie lag und dachte an einen Tag im Herbst — den letzten, wo Oberförsters und sie im Walde gewesen waren ...