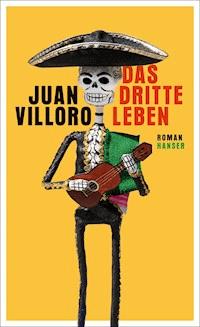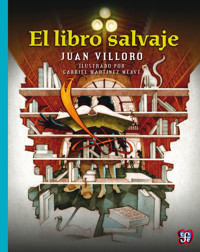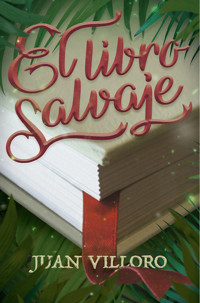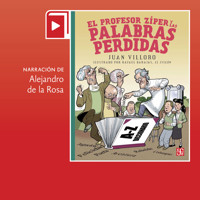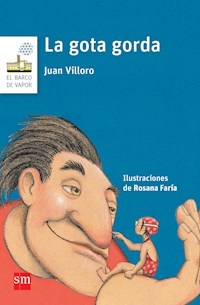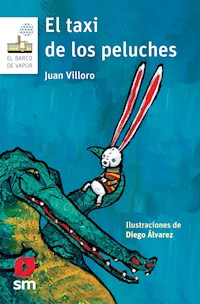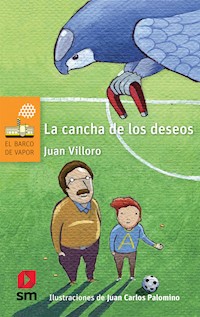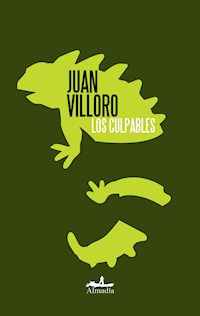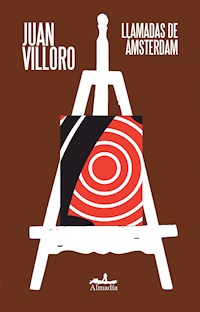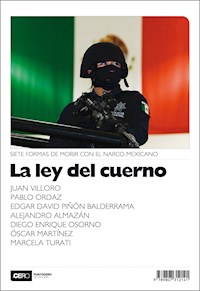Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Mit Büchern kann der 13-jährige Juan wenig anfangen, bis er die Sommerferien bei seinem buchvernarrten Onkel Tito verbringt. Der lebt in einer gigantischen Bibliothek und er hat gleich einen Auftrag für Juan: Er soll Das wilde Buch finden, ein rebellisches Buch, das sich dem Gelesenwerden widersetzt und lange von niemandem gefunden werden konnte. Juan lässt sich auf das Abenteuer ein. Zwischen sonderbaren Buchtypen entdeckt er die tollsten Geschichten – nur Das wilde Buch nicht. Erst als er seine erste Liebe, die Apothekerstochter, von der Magie der Bücher überzeugt und eine Verbindung zum echten Leben herstellt, offenbart es sich … Ein fantasievolles Jugendbuch über die Liebe zum Lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Villoro
DAS wilde BUCH
Aus dem Spanischenvon Birgitt Kollmann
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel
El libro salvaje bei Fondo de Cultura Económica, Mexico.
ISBN 978-3-446-24709-3
© Juan Villoro 2008
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Marion Blomeyer, Lowlypaper, München
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für meine Schwester Carmen
INHALT
Vorwort
Die Trennung
Eisen aus der Flasche
Onkel Tito
Bücher, die ihren Platz verlassen
Hilfe aus der Apotheke
Beherrsche deine Kraft
Ein Buch erzählt nicht immer dieselbe Geschichte
Schattenbücher
Das wilde Buch
Die Geschichte löscht sich aus
Ein Feind
Das Piratenbuch
Der Fürst bestimmt
Onkel Titos Romane aus der Küche
Catalina in der Bibliothek
Die Zeit und die Kekse
Geräuschlose Motoren
Zickzackstrahlung
Der Schattenclub
Ein köstlicher Köder
Was beginnt, wenn etwas anderes endet
VORWORT
Was ich erzählen möchte, geschah, als ich dreizehn war. Ich habe diese Geschichte nie vergessen können, es ist, als hielte sie mich noch immer fest im Griff. Es klingt vielleicht seltsam, aber ich spüre tatsächlich ihre Hände im Nacken, und zwar so deutlich, dass ich sogar weiß, dass es sich um Hände in Handschuhen handelt.
Solange diese Geschichte ein Geheimnis bleibt, wird sie mich gefangen halten. Doch jetzt, wo ich mich daranmache, sie aufzuschreiben, spüre ich bereits eine gewisse Erleichterung. Die Hände der Geschichte liegen zwar noch immer um meinen Hals, doch ein Finger hat sich bereits gelöst, wie ein Versprechen, dass ich frei sein werde, wenn dieses Buch beendet ist.
DIE TRENNUNG
Alles begann mit dem Duft von Kartoffelbrei. Immer wenn meine Mutter schlecht gelaunt war oder einen Grund zur Klage hatte, gab es bei uns Kartoffelbrei. Dann zerstampfte sie die Kartoffeln besonders heftig; wie eine Furie ging sie auf sie los. Dabei entspannte sie sich. Ich habe Kartoffelbrei immer gern gegessen, auch wenn er bei mir zu Hause normalerweise einen Beigeschmack von Problemen hatte.
Als ich an jenem Nachmittag nach Hause kam und mir der Geruch von Kartoffelbrei in die Nase stieg, ging ich gleich in die Küche, um nachzusehen, was los war. Meine Mutter bemerkte mich nicht. Sie weinte stumm.
Ich hätte alles getan, damit sie wieder die lächelnde Frau würde, die ich über alles liebte, aber ich hatte keine Ahnung, womit ich sie wieder froh machen könnte.
Von dem Tag an hörte ich sie nachts schluchzen. Damals fing das auch an, dass ich zu ungewöhnlichen Stunden aufwachte. Bis dahin hatte ich immer wie ein Stein geschlafen, doch als ich dreizehn wurde, ging es irgendwann mit diesem immer wiederkehrenden Albtraum los, meinem »scharlachroten Traum«. Er begann jedes Mal in einem langen, dunklen, modrig riechenden Gang. Am Ende des Gangs flackerte eine Flamme. Ich ging näher, und langsam verstand ich, dass ich wohl in einem Schloss war. Meine Schritte hallten im Dunkeln wider, daran merkte ich, dass ich Eisenstiefel trug. Ich war ein Soldat in einer Rüstung und sollte am Ende dieses Gangs jemanden retten, jemanden, der weinte. Anscheinend eine Frau; ihre Stimme klang angenehm, wenn auch sehr traurig. Ich ging auf dieses Weinen zu, doch ich brauchte ungeheuer lange, um voranzukommen. Mit jedem Schritt schien der Gang länger zu werden. Endlich gelangte ich in einen Raum mit roten Wänden. Scharlachrot, escarlata auf Spanisch, war zu jener Zeit meine Lieblingsfarbe. Allein schon der Klang des Wortes gefiel mir: Escarlata! Irgendwo hier musste die weinende Frau sein, das wusste ich, obwohl ich sie nie zu Gesicht bekam. Bevor ich mich auf die Suche nach ihr machte, trat ich wie hypnotisiert von diesem dunklen Rot auf eine der Wände zu. Erst als ich dicht davor stand, erkannte ich, dass diese Wände von niemandem rot gestrichen worden waren – sie waren durch und durch flüssig. Ich berührte die Fläche mit den Händen, und zwischen meinen Fingern quoll Blut hindurch.
An dieser Stelle wachte ich immer auf, voller Todesangst.
Dann machte ich Licht, betrachtete die Weltkarte auf meinem Schreibtisch und das letzte Kuscheltier, das nur noch gelegentlich in meinem Bett schlafen durfte. Hätte damals jemand gewagt, mich noch als Kind zu bezeichnen, wäre ich wütend geworden. Mit dreizehn fühlte ich mich schon als junger Mann. Und mein Stoffkaninchen hatte ich nur noch, weil ich an ihm hing, doch ich konnte genauso gut ohne es schlafen und mich allein verteidigen. Nicht einmal in den Nächten des scharlachroten Traums nahm ich es mit ins Bett. Es sah mich dann aus seiner Ecke an, mit diesen Augen, von denen das eine etwas tiefer saß als das andere. Es dauerte jedes Mal lange, bis ich wieder einschlafen konnte, doch nie bat ich mein Kaninchen um Hilfe.
In den Albtraumnächten hatte ich immer großen Durst. Wenn dann das Wasser, das meine Mutter mir jeden Abend auf den Nachttisch stellte, schon leer getrunken war, traute ich mich nicht, in die Küche zu gehen, um etwas zu trinken – gerade so, als wäre sie der Ort aus meinem »scharlachroten Traum«.
Um mich abzulenken, betrachtete ich in solchen Nächten meine Weltkarte. Mein Lieblingsland war Australien, das in der Farbe einer Kaugummiblase eingezeichnet war. In Australien lebten auch meine Lieblingstiere: der Koala, das Känguru und das Schnabeltier.
Was mir an den Koalas am besten gefiel, war ihre Art, sich an den Ästen festzuhalten. Und so als wäre ich selbst ein Koala im Baum, umschlang ich nach den Albträumen mein Kissen ganz fest. So schlief ich dann irgendwann ein. Das Licht ließ ich brennen.
Dass mir so schreckliche Dinge in den Kopf kamen, hing vielleicht auch damit zusammen, dass ich im Wachstumsalter war. Meine Freunde in der Schule liebten Geschichten von Geistern und Vampiren – ich nicht. Mir reichte mein schrecklicher Traum.
Eines Nachts wachte ich noch erschrockener auf als sonst. Ich machte Licht und untersuchte voller Angst meine Hände, ob sie tatsächlich voller Blut waren. Doch außer den Tintenflecken, die ich aus der Schule mitgebracht hatte, war da nichts. Ich schaute zu meiner Weltkarte hinüber, doch noch bevor ich anfangen konnte, an ferne Länder zu denken, hörte ich ein Schluchzen. Es kam vom Flur her und hörte sich unverwechselbar nach der Stimme meiner Mutter an.
Dieses Mal wagte ich es aufzustehen. Dieses Schluchzen war wichtiger als mein Albtraum und meine Angst. Barfuß ging ich zum Schlafzimmer meiner Eltern.
Mein Vater und meine Mutter schliefen in getrennten Betten. Die Vorhänge vor dem Fenster waren geöffnet, und Mondlicht fiel auf das Bett meines Vaters, das näher am Fenster stand. In meinem Leben habe ich seither viele Betten gesehen, aber kein Anblick hat mich mehr verstört als jener: Das Bett meines Vaters war leer.
Mama weinte. Die Augen hielt sie geschlossen, und so merkte sie gar nicht, dass ich im Zimmer war. Ich ging zum Bett meines Vaters, schlug es auf und legte mich hinein. Es roch wundervoll nach Leder und Rasierwasser. Ich atmete tief ein, und im nächsten Moment schlief ich auch schon. Nie mehr habe ich besser geschlafen als in jener Nacht.
Am nächsten Morgen war meine Mutter gar nicht erfreut, als sie mich im Bett meines Vaters entdeckte. Ich erzählte ihr, ich sei wohl ein Schlafwandler und dort gelandet, ohne es selbst zu wissen.
»Das fehlt mir gerade noch!«, rief meine Mutter. »Ein Sohn, der schlafwandelt!«
Auf dem Schulweg machte meine Schwester Carmen sich darüber lustig, dass ich im Schlaf durch die Gegend lief. Doch dann fragte sie mich, ob ich ihr das Schlafwandeln nicht auch beibringen könne. Carmen war zehn und glaubte mir noch jedes Wort. Ich erklärte ihr, dass ich zu einem Club gehöre, dessen Mitglieder zu nächtlichen Treffen zusammenkämen. Dabei gingen sie durch die Straßen der Stadt und schliefen doch immer weiter.
»Wie heißt denn euer Club?«, wollte Carmen wissen.
»Der Schattenclub«, antwortete ich. Es war das Erste, was mir einfiel.
»Kann ich da auch mitmachen?«
»Das ist nicht so einfach«, antwortete ich. »Vorher muss man mehrere Proben bestehen.«
Carmen bat mich, sie einmal nachts zu wecken, um sie in meinen Club mitzunehmen. Ich versprach es, tat es aber natürlich nie.
Meine Mutter machte sich Sorgen, ich könne tatsächlich schlafwandeln, und rief ihre Freundin Ruth an. Die hatte während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland gelebt und haarsträubendere Dinge erlebt als ein schlafwandelndes Kind. Wenn meine Mutter mit Ruth telefonierte, hörte sie von ihr Geschichten, die so viel schlimmer waren als unsere, dass sie davon gleich wieder ruhiger wurde.
Als ich an jenem denkwürdigen Tag aus der Schule kam, telefonierte Mama mit Ruth, und trotzdem kam aus der Küche der Geruch von Kartoffelbrei. Dieses Mal schienen die schrecklichen Geschichten ihrer Freundin sie nicht beruhigen zu können.
Ich brachte meinen Rucksack in mein Zimmer, ging zur Toilette und wusch mir die Hände (die verflixten Tintenflecke waren immer noch da!). Anschließend ging ich in die Küche, von wo mir dieser Duft in die Nase stieg, der so verlockend war und doch immer Probleme ankündigte.
Ich blieb in der Tür stehen und sah, dass meine Mutter leise weinte. Ich stellte ihr die Frage, die ich in der Schule tausendmal geübt hatte:
»Wo ist Papa?«
Durch ihre Tränen hindurch sah sie mich an. Sie lächelte wehmütig, als schaute sie in eine schöne, aber zerstörte Landschaft.
»Wir müssen reden«, sagte sie, doch dabei beließ sie es. Sie stampfte nur weiter die Kartoffeln, zündete sich eine Zigarette an, rauchte hastig und ließ Asche ins Püree fallen.
Steif wie eine Statue blieb ich geduldig stehen, bis sie schließlich sagte: »Dein Vater wird eine Weile nicht zu Hause wohnen. Er hat sich ein Studio gemietet. Er hat im Moment sehr viel Arbeit, und wir machen ihm zu viel Krach. Wenn er mit der Arbeit fertig ist, fliegt er nach Paris, wo er eine Brücke baut.«
Aus irgendeinem Grund kam mir der Gedanke, dass mein Vater wohl nie mehr zurückkehren würde in das Bett, das ich im Mondlicht gesehen hatte.
Meine Mutter kniete sich vor mich und umarmte mich. Noch nie hatte sie mich so auf Knien umarmt.
»Du musst keine Angst haben, Juanito«, sagte sie.
Immer wenn sie mich Juanito nannte, passierte etwas Schreckliches. Es war kein Kosename, sondern ein Krisenname. So etwas wie der Kartoffelbrei unter den Namen.
»Mach dir keine Sorgen«, antwortete ich ihr. »Du hast ja mich.«
Etwas Schlimmeres hätte ich nicht sagen können. Sie weinte heftiger als je zuvor und umarmte mich ganz fest, so lange, bis der Kartoffelbrei anbrannte.
Weil meine Schwester nach der Schule noch zur Klavierstunde musste, kam sie erst später nach Hause, als wir schon Pizza aßen. Carmen war bester Laune an diesem Nachmittag, weil sie so viel Pizza essen durfte, wie sie wollte. Mama hatte nämlich keinen Appetit.
»Ich muss euch etwas sagen«, begann Mama. Sie redete, als würde sie auf jedem Wort herumkauen. »Papa ist auf Reisen gegangen.«
Carmen fand das toll. Vermutlich dachte sie an das neue Stofftier, das Papa ihr bestimmt mitbringen würde.
Es machte mich traurig, dass meine Schwester so zufrieden war, nur weil sie die Wahrheit nicht kannte, aber ich hätte alles dafür getan, dass sie sie nie erfuhr.
Damals waren Scheidungen noch nicht so in Mode. Von meinen Freunden hatte keiner geschiedene Eltern. Trotzdem wusste ich mit meinen dreizehn Jahren natürlich, dass es so etwas gab. Einmal hatte ich einen sehr lustigen Film gesehen über einen Jungen, der ein wundervolles Leben führte, weil er zwei Zuhause hatte und in beiden sehr verwöhnt wurde.
Meine Eltern stritten sich nicht, aber sie redeten auch nicht so miteinander, dass man den Eindruck hatte, sie liebten sich. Nie gaben sie sich einen Kuss oder hielten sich an den Händen. Eines Nachmittags hatte ich im Schreibtisch meines Vaters herumgekramt und in einem Buch einen Brief entdeckt. Er lag in einem Umschlag mit fantastischen Zeichnungen: rosa Spiralen, blauen Sternchen, grünen Blitzen. Wie die Hülle einer Schallplatte mit Rockmusik kam er mir vor.
Der Brief in dem Umschlag war von einer Freundin, die schrieb, wie sehr sie meinen Vater liebe und dass sie hoffe, mit ihm nach Paris reisen zu können. Auf einmal spürte ich ein großes Loch im Magen und ging mit dem Brief zu meiner Mutter.
Das war zwei Monate, bevor bei uns der Kartoffelbrei anbrannte. Manchmal gab ich mir die Schuld dafür, dass meine Mutter so traurig wurde. Alles war nur passiert, weil ich ihr den verdammten Brief gegeben hatte.
»Wirst du dich scheiden lassen?«, fragte ich meine Mutter, als Carmen uns nicht hören konnte. Anders als der Junge in dem Film hatte ich keine Lust, vergnügt in zwei Häusern zu leben. Ehrlich gesagt wollte ich meinen Vater gar nicht mehr sehen. Ich wollte nur, dass er zurückkam, damit meine Mutter wieder fröhlich war. Sonst nichts.
»Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht«, antwortete sie mir. »Aber Papa hat euch beide sehr lieb, und das ist doch schließlich das Wichtigste.«
Mir war es nicht wichtig, ob er mich liebte. Sie sollte er lieben, das wollte ich. Ich ging in mein Zimmer, um einen wichtigen Eid zu leisten. Vor der Weltkarte, mit dem Blick auf Australien, schwor ich, dass wir in diesem Haus wieder glücklich sein würden, auch wenn ich mich dafür sehr anstrengen müsste.
In jener Nacht hatte ich zwar keine Albträume, aber schlafen konnte ich auch nicht.
Ich ging in das Zimmer, das einmal das gemeinsame Schlafzimmer meiner Eltern gewesen war und in dem jetzt ein Bett übrig war. Wenigstens glaubte ich das. Ich wollte mich schon hineinlegen, als ich sah, dass Carmen mir zuvorgekommen war. Wie immer, wenn sie schlief, machte sie ein sehr zufriedenes Gesicht. Vielleicht träumte sie gerade, dass sie Mitglied im Schattenclub geworden war.
EISEN AUS DER FLASCHE
Meine Mutter fing an, überall Zigaretten herumliegen zu lassen. Oft rauchte sie sie höchstens zur Hälfte. Sie war so nervös und telefonierte so viel, dass die Zigaretten sich im Aschenbecher sammelten, ohne dass sie auch nur eine zu Ende rauchte. Manchmal kam es mir vor, als lebten wir in einem Indianerzeltlager, umgeben von Rauchzeichen.
Der Geruch von Asche und Kartoffelpüree war allgegenwärtig. In der Woche, in der mein Vater ausgezogen war, aßen wir von Montag bis Samstag Fleischklößchen mit Kartoffelpüree. Am Sonntag brachte meine Mutter uns zu ihrer Freundin Ruth, bei der wir leckere deutsche Würstchen zu essen bekamen, die mit etwas gewürzt waren, was ich bis dahin noch nicht gekannt hatte: Muskatnuss.
Mama kam uns erst spät abholen, als Carmen schon schlief, im Arm ihren Stoffbiber. Ich schlief auch schon fast, bekam aber doch noch mit, worüber meine Mutter und ihre Freundin sich unterhielten.
»Das Schlimmste sind die Ferien«, sagte Mama. »Ich habe keine Ahnung, was ich so lange mit ihnen machen soll.«
Mit ihnen waren Carmen und ich gemeint.
»Irgendetwas wird sich schon ergeben«, sagte Ruth. »Ich kann mich um La Pinta kümmern.«
La Pinta, das war unsere schwarzweiße Malteserhündin. Es überraschte mich, beruhigte mich aber auch ein bisschen, dass Ruth sich lieber um den Hund kümmern wollte als um uns.
Aber wieso konnten wir in den Ferien nicht zu Hause bleiben? Noch zwei Wochen, dann wäre das Schuljahr zu Ende. Unser Lehrer war auch nicht mehr erpicht darauf, uns etwas beizubringen; er teilte nur noch Papier aus und ließ uns irgendetwas zeichnen, stundenlang. Danach sangen wir endlos lange Lieder, und wenn wir falsch sangen, machte das auch nichts. Es war, als wäre der eigentliche Unterricht schon zu Ende und wir wären nur der Form halber noch da, um die Tage bis zu den Sommerferien, den »großen Ferien«, wie wir sagten, irgendwie zu füllen.
Der schönste Moment in unserem Leben war immer der erste Ferientag. Dann schien die Sonne am Morgen anders ins Zimmer. Eine kraftvolle, honigfarbene Sonne, die die Vorhänge erwärmte und verkündete, dass uns zwei Monate ohne Schule erwarteten. An so einem ersten Ferientag schien alles möglich, so als käme das Licht direkt aus Australien und seinen Wüsten aus rötlichem Sand.
Der erste Ferientag – das ist so, als hättest du ein Jahr lang etwas nicht mehr gegessen, was dir eigentlich unheimlich gut schmeckt (Schokolade oder Spaghetti oder Brathähnchen). Wenn du es nach all der Zeit wieder probierst, dann findest du es noch viel leckerer als je zuvor.
Pablo, mein bester Freund, wohnte nur zwei Straßen weiter. Wir hatten schon viele Pläne gemacht für den Sommer, unter anderem wollten wir in ein verlassenes Haus einsteigen, das zerbrochene Fensterscheiben hatte und in dem wilde Katzen lebten. Dieser Sommer sollte der beste meines Lebens werden. Doch Mama hatte anderes mit mir vor.
Als ich eines Nachmittags vom Spielen mit Pablo nach Hause kam, standen im Flur lauter Pappkartons.
»Die Sachen von deinem Vater«, erklärte mir Mama.
Ich beugte mich über eine Kiste und sah lauter Bücher. Mein Vater ist Ingenieur und hat ein Buch mit einem merkwürdigen Titel geschrieben: Klappbrücken. Er hat mir erklärt, dass solche Brücken sich in der Mitte teilen und heben können, damit auch größere Schiffe darunter durchfahren können.
Ich dachte, Papa komme irgendwann seine Sachen holen, doch stattdessen erschienen schon bald zwei Männer von einer Spedition und trugen alles in null Komma nichts aus dem Haus.
»Die Sachen kommen erst einmal in ein Lagerhaus, bis dein Vater aus Paris zurückkommt«, erklärte Mama.
»Hast du nicht gesagt, er mietet sich ein Studio?«
»Er baut eine Brücke in Paris.«
Das konnte schon sein, dass er nach Paris ging, um dort eine Brücke zu bauen, aber bestimmt würde er dort auch diese Freundin treffen, die ihm den Brief geschickt hatte. Ihre Zeichnungen auf dem Briefumschlag hatten mir zwar sehr gefallen, aber dass mein Vater mit ihr verreiste, gefiel mir überhaupt nicht.
Und genauso wenig gefiel es mir, dass mein Vater dort eine Brücke baute. Bestimmt würde es wieder so eine Brücke werden, die sich in der Mitte teilen und anheben ließ, damit Schiffe hindurchfahren konnten, schließlich war das seine Spezialität. Mir persönlich waren Brücken lieber, bei denen sich die Teile nicht voneinander trennten, sondern fest verbunden blieben, um zwei Ufer miteinander zu verbinden.
Meinetwegen konnten Papas langweilige Bücher ruhig verschwinden.
Meine Mutter nahm blaue Tabletten gegen ihre Kopfschmerzen ein. Später erfuhren wir, dass sie nicht einfach Kopfschmerzen hatte, sondern etwas, das noch viel mehr wehtat und Migräne hieß.
Außerdem litt sie an einer Magenschleimhautentzündung. Weil Orangensaft ihr nicht gut bekam, trank sie ihn durch ein Röhrchen aus Glas, um beim Trinken keine Luft zu schlucken (die ihr offensichtlich noch schlechter bekam). Meine Mutter war so hübsch, dass sie sogar dann noch gut aussah, wenn sie Saft trank und dabei ein Gesicht machte, als müsste sie Glasscherben schlucken, die sich in ihr in lauter kleine Splitter auflösten.
Jeden dritten Tag schickte sie mich in die Apotheke, um ihr Tabletten gegen die Migräne oder für den Magen zu kaufen. Als wir einmal unsere Oma besuchten, sagte die: »Das kommt alles von den Zigaretten, die sind daran schuld.«
Aber meine Mutter schaffte es einfach nicht, das Rauchen aufzugeben, schon gar nicht jetzt, wo sie so viele Probleme am Hals hatte. Wenn meine Oma über das ewige Gequalme schimpfte, kniff meine Mutter ein Auge zu, als wäre sie ein Bandit mit einer Pistole und wollte gleich abdrücken, dann zündete sie mit den flinken Fingern einer Expertin ein Streichholz an und rauchte die nächste Zigarette betont genüsslich und langsam. Dabei blies sie kleine Kringel aus dem Mund, die uns in der Rauchzeichensprache der Indianer sagen sollten: Ich tue, wozu ich Lust habe.
Eines Nachts träumte ich, ich sei einer weißen Katze in das verlassene Haus gefolgt. In jedem Zimmer hatte jemand Möbel in Brand gesteckt. Als ich den Wohnraum betrat, brannte dort ein großer Tisch, während mein Vater seelenruhig auf einem Sofa saß und Zeitung las. Plötzlich fing die Zeitung Feuer, doch mein Vater unternahm nichts, um es zu löschen. Im Gegenteil: Er betrachtete das Feuer, als wäre es nur eine Zeitungsmeldung, die ihn nichts anging. Bevor die Flammen seine Hände erreichten, bin ich aufgewacht.
Mir kam der Gedanke, dass mein Vater lieber mit brennenden Möbeln und einer brennenden Zeitung in einem verlassenen Haus lebte als mit uns. Ich wurde sehr böse auf ihn und schlug auf mein Kissen ein, so lange, bis ich nicht mehr konnte. Anschließend stellte ich mir wieder vor, ich sei ein Koala, und umschlang das Kissen, als wäre es ein Ast von meinem Baum. Vom vielen Weinen wurde der Bezug nass. Vielleicht träumte ich deshalb danach von einem heftigen Regen in Australien, wo ich glücklich als Koala lebte.
Besonders gern legte ich mich in mein Bett, wenn es frisch bezogen war. Es fühlte sich so gut an, zwischen den kühlen, duftenden Laken zu liegen. Doch wegen all der Probleme, seit mein Vater ausgezogen war, vergingen viele Tage, ohne dass meine Bettwäsche gewechselt wurde. Erst fiel mir das nicht weiter auf, doch irgendwann fragte ich mich nachts, ob meine Laken wohl je wieder nach Seifenblasen duften würden.
Auch Carmen bemerkte den unangenehmen Geruch und verteilte ein paar Tropfen Shampoo auf ihrer Bettwäsche, damit sie wie neu roch.
Damit niemand sah, dass sie geweint hatte, trug meine Mutter jetzt immer eine Sonnenbrille. Wie jemand von der Mafia sah sie aus. Vor allem, wenn sie dazu noch eine Zigarette im Mundwinkel klemmen hatte und ein Kopftuch trug. Aber irgendwie sah sie trotzdem gut aus. Bei der Mafia gibt es nämlich sehr schöne Frauen.
Zwei Tage vor den Ferien sagte sie zu uns: »Wir müssen reden.«
Wir setzten uns ins Esszimmer, und sie fing an, eine Melone aufzuschneiden. In letzter Zeit war sie so nervös, dass sie sich dauernd in die Finger schnitt, wenn sie Essen zubereitete. Bevor sie anfing zu kochen, legte sie deshalb schon immer die Schachtel mit dem Heftpflaster bereit. Wenn sie die Wunde noch mit Alkohol reinigte, schmeckte unser Essen, als käme es aus der Apotheke.
Ich fürchtete schon, sie könne sich einen Finger abschneiden, während sie mit uns redete. Aber zum Glück ließ sie das Messer sinken, bevor sie sagte: »La Pinta wird die Ferien bei Ruth verbringen.«
Das sagte sie so, als wäre es völlig normal, dass Hunde in den Ferien verreisten.
»Und wir?«, fragte Carmen.
Dieser Teil des Gesprächs kostete Mama schon mehr Mühe. Die Worte kamen aus ihrem Mund, als wären sie aus Watte.
»Die Familie Bermúdez mag dich sehr«, antwortete sie schließlich.
Leila Bermúdez war die beste Freundin meiner Schwester. Wie immer war Carmen über diese Lösung des Problems sehr glücklich. Ich glaube, selbst wenn sie auf einem kenternden Schiff wäre, fände sie es noch toll, ein aufblasbares Rettungsboot zu besteigen. Carmen besitzt die Gabe, selbst den schlimmsten Momenten etwas Gutes abzugewinnen.
Da Carmen zu ihrer besten Freundin geschickt wurde, nahm ich an, dass ich zu Pablo sollte. Doch meine Mutter sagte: »Du gehst zu Onkel Tito.«
»Warum?«
»Weil er darum gebeten hat.«
»Ich will aber lieber zu Pablo. Oder zu Oma.«
»Pablo hat vier Geschwister, sie haben keinen Platz für dich. Und Oma ist viel zu alt, um sich um jemanden zu kümmern.«
»Ich will aber zu jemand anderem.«
»Warum?«
»Onkel Tito wachsen weiße Haare aus der Nase.« Etwas anderes fiel mir nicht ein. Und es stimmte ja auch: Onkel Tito rasierte sich die Ohren, weil auch dort weiße Haare wuchsen, aber gegen die Haare, die ihm aus der Nase wuchsen, unternahm er nichts.
»Dein Onkel hat dich sehr lieb«, sagte meine Mutter.
Auch das stimmte. Jedes Mal, wenn wir ihn besuchten, las er mir eine Geschichte vor aus einem der vielen Tausend Bücher, die er in seinem Haus stehen hatte. Er konnte wunderbar von Drachen erzählen, von Schwertern aus dem Mittelalter oder von Raketen, die es irgendwann in der Zukunft geben würde. Aber bei ihm wohnen mochte ich nicht. Was sollte ich denn den ganzen Tag machen in so einem düsteren Haus voll eingestaubter Bücher?
Onkel Tito war ein Cousin meiner Mutter. Er hatte keine Kinder und lebte schon immer allein, umgeben von seiner immensen Bibliothek. Warum hatte er sich bloß gewünscht, dass ich zu ihm kam? Ich fand ihn nett, aber es war mir ganz recht, wenn ich ihn nur selten sah.
»Er hat großartige Bücher«, fügte meine Mutter noch hinzu.
»Aber keinen Fernseher«, sagte ich.
Fernsehen mochte ich genauso gern wie Brathähnchen. Dagegen interessierten Bücher mich wenig, schon gar nicht solche über technische Themen.
Wir diskutierten dann aber nicht weiter, weil Mama nervös wurde und eine Scheibe von der Melone abschnitt. Prompt lief eine dünne Blutspur über den Tisch.
»Nicht einmal eine Melone kann ich aufschneiden!«, schimpfte sie völlig verzweifelt.
Carmen und ich redeten auf sie ein, dass das nicht stimme, dass es im ganzen Haus niemanden gebe, der besser Melonen zerteilen könne als sie. Damit war die Frage meiner Ferien erst einmal vom Tisch.
Am nächsten Tag sagte ich mir, dass meine Mutter mich viel zu lieb hatte, um mich tatsächlich zu Onkel Tito zu schicken. Das war einfach unvorstellbar.
Dass La Pinta zu Ruth kam und dort lernen würde, auf Deutsch zu bellen, fand ich gut, und auch dass Carmen zu ihrer Freundin Leila Bermúdez ziehen würde. Doch ich selbst wollte bei meiner Mutter bleiben. Sie brauchte mich, davon war ich fest überzeugt.
Am letzten Schultag vergaß Mama, uns abzuholen. Sie kam auch sonst oft zu spät, dann waren wir die letzten Kinder, die auf dem Schulhof warteten, doch dieses Mal vergaß sie uns komplett. Der Hausmeister wollte die Schule abschließen, denn auch für ihn hatten die Ferien begonnen. Also nahm ich Carmens Rucksack und meinen eigenen und sagte meiner Schwester, wir würden nach Hause laufen. Ich kannte die Strecke, aber zu Fuß war ich sie noch nie gegangen. Wir brauchten geschlagene zwei Stunden, bis wir endlich ankamen.
Was konnte passiert sein, dass meine Mutter uns nicht abgeholt hatte? War sie gestorben? Oder in Ohnmacht gefallen? Oder hatte sie solche Schmerzen, dass keine Tablette mehr half?
Wir klopften an die Wohnungstür. Fünfzehn Sekunden, sagte ich mir, ich gebe ihr fünfzehn Sekunden. Wenn sie bis dahin nicht aufgemacht hat, dann heißt das, sie ist tot.
Es dauerte dreizehn Sekunden, dann ging die Tür auf. Mama starrte uns völlig verdutzt an, so als kämen wir aus einem Traum. Erst dann begriff sie, dass sie uns vergessen hatte.
»Großer Gott! Wie spät ist es denn?«, rief sie. »Ich vergesse aber auch alles.«
Erschrocken bat sie uns immer wieder von Neuem um Entschuldigung.
»Ich habe eure Koffer gepackt und darüber völlig die Zeit vergessen«, erklärte sie uns.
Carmens Koffer war schon fix und fertig, daneben stand ein Korb mit ihren liebsten Kuscheltieren.
»Fehlt nur noch Juanito«, stellte meine Schwester fest und ging los, um das Stofftier zu holen, das sie nach mir benannt hatte (dafür, dass ich zugestimmt hatte, sie einmal in den Schattenclub mitzunehmen).
Selbst da glaubte ich noch, dass zwar Carmen die Ferien woanders verbringen, ich aber bleiben würde. Mama würde sich unmöglich von mir trennen können. Doch schon war sie auf dem Weg in mein Zimmer. »Jetzt noch deine Sachen.« Langsam folgte ich ihr.
Als ich hereinkam, kniete sie vor meinem Bett, faltete Hemden und legte sie vorsichtig in den Koffer. Das macht sie nur, um mir weiszumachen, ich würde auch verreisen, aber mir kann sie nichts vormachen, dachte ich.
Sie legte immer noch mehr Dinge in den Koffer, und schließlich nahm sie einen kleinen dunklen Gegenstand in die Hand, eine Glasflasche. Der Kinderarzt hatte mir Eisen verordnet. Jeden Morgen sollte ich einen Löffel von einem schwarzen Sirup nehmen. Er schmeckte ekelhaft, aber der Arzt hatte gesagt: »Eisen ist gut fürs Wachstum« – so als wäre ich eine Brücke im Bau. Ich hasste diese Medizin, von der die anderen dachten, sie sei so gut für mich.
Erst in dem Moment, als ich sah, wie die Flasche mit dem Eisen in meinem Koffer verschwand, begriff ich, dass es tatsächlich wahr war – ich sollte das Haus verlassen und zwei lange Monate bei meinem Onkel Tito verbringen. Wenn meine Mutter etwas so Kostbares und Ungewöhnliches wie diese Flasche einpackte, dann meinte sie es ernst.
Damals lernte ich, ein für alle Mal, dass die Glaubwürdigkeit einer Geschichte von gewissen Einzelheiten abhängt. Als die Flasche im Koffer verschwand, musste ich den Tatsachen wohl ins Auge sehen: Mir stand die Abreise bevor in ein Haus, das ich kaum kannte.
Was ich in dem Moment allerdings nicht wissen konnte, war, was mir noch bevorstand: nämlich das größte Abenteuer meines Lebens.
ONKEL TITO
Mein Onkel Tito lebte im alten Teil von Mexiko-Stadt. In diesem Viertel hatte man einige Häuser mit Hammerschlägen demoliert und dann ganz abgerissen, um an ihrer Stelle moderne Gebäude zu bauen; andere fielen von allein in sich zusammen, und bei wieder anderen hatte man die Balkone fest angebunden, damit sie nicht denen auf den Kopf fielen, die gerade unten vorbeigingen.
In diesem einsturzgefährdeten Gebiet, das die Erwachsenen das Zentrum nannten, stand auch das Haus von Onkel Ernesto oder »Tito«, wie die Familie zu ihm sagte. Für die Boten, die ihm die Bücher ins Haus brachten, die er in Buchhandlungen in allen Teilen der Welt bestellte, war er »Don Tito«.
Mein Onkel lebte mit drei Katzen zusammen, einer schwarzen namens Obsidiana (nach dem schwarzen Stein), einer weißen namens Marfil (was so viel bedeutet wie Elfenbein) und Domino, dem Sohn der beiden, der weiß mit schwarzen Flecken war und den ich am liebsten mochte.
Seit achtundfünfzig Jahren lebte mein Onkel nun schon allein, nur in der Gesellschaft seiner Bücher und seiner Katzen. Irgendwann einmal hatte er jedoch, zur großen Überraschung der Familie, beschlossen, es sei nun für ihn an der Zeit zu heiraten. Ein Jahr dauerte die Ehe mit dieser Frau, von der ich nur noch weiß, dass sie eine runde Brille trug und wegen des Staubs auf den Büchern ständig niesen musste.
In einem Moment der Verzweiflung sagte die Dame zu meinem Onkel: »Wir können nicht länger in diesem Labyrinth leben. Ich bin allergisch gegen altes Papier.« Mein Onkel gab ihr recht. Er überließ das Haus den Büchern und zog mit seiner Frau in eine kleine Wohnung. Doch ein Leben ohne seine Bibliothek war zu traurig für ihn, und so beschloss er schließlich, seine Ehefrau zu verlassen und zu seinen Büchern zurückzukehren.
Deshalb überraschte es mich auch so, dass ich ausgerechnet zu Onkel Tito sollte. Er fühlte sich doch wohl in dieser Einsamkeit. Nie feierte er Feste oder lud zu irgendwelchen Treffen ein. Andere Gesellschaft als die seiner drei Katzen schien ihm nicht zu fehlen. Warum also wollte er dann, dass ich zu ihm kam? Es war alles sehr merkwürdig.
In meinem Koffer lag auch ein Buch: Alles über Spinnen. Das hatte ich zwar schon gelesen, aber genau aus dem Grund hatte ich es eingepackt: Lieber las ich ein tolles Buch noch einmal, als dass ich mit einem unbekannten ein Risiko einging.
An Onkel Titos Tür war ein Türklopfer angebracht, der mir sehr gefiel: der Kopf eines Löwen, der auf ein halbmondförmiges Metall biss.
Das Nachbarhaus wurde gerade abgerissen, und bei dem Höllenlärm war von unserem Klopfen kaum etwas zu hören. Meine Mutter sagte, ich solle kräftig mit dem Fuß gegen die Tür treten, doch meine Schuhe hatten Gummisohlen und machten keinen großen Lärm. Einen Moment lang hoffte ich schon, dass Onkel Tito nie öffnen würde und ich mit Mama wieder nach Hause fahren könnte. Doch gerade da ging die Tür auf.
»Klopft ihr schon lange?«, fragte der Onkel. »Im Haus hört man kaum, was draußen passiert.«
Das stimmte. Kaum hatte er die Tür hinter uns geschlossen, breitete sich eine große Stille um uns aus, so als befänden wir uns am Grunde des Meeres.
»Das Haus ist speziell isoliert«, erklärte Onkel Tito. »Nur so kann ich mich aufs Lesen konzentrieren.« Dabei sah er mich so groß an, dass ich dachte, seine Augen würden gleich aus ihren Höhlen springen.
Am liebsten hätte ich gesagt: Starr mich nicht so an, ich bin kein Buch, aber das traute ich mich dann doch nicht.
Schon der Flur war voller Bücherregale, und selbst dazwischen stapelten sich dicke Bände bis zur Decke.
»Kommt ins Wohnzimmer«, sagte Onkel Tito.
Das sogenannte Wohnzimmer war etwas aufgeräumter. Zwar gab es auch hier Bücher an den Wänden, aber auf den Sesseln lagen wenigstens keine. Wir setzten uns an einen Tisch, auf dem anstelle eines Tischtuchs eine Landkarte ausgebreitet war. Direkt vor mir lag Australien. Das sei mein Lieblingsland, sagte ich.
»Vorzügliche Wahl, mein lieber Neffe«, sagte Onkel Tito. »In dieser roten Wüste findet man zwar kaum kulturelle Zeugnisse und nur wenige Altertümer, doch Australien ist die Heimat des Schnabeltiers, des fantastischsten Tiers überhaupt, ein Sammelbecken biologischer Vielfalt, eine Enzyklopädie all dessen, was ein Tier sein kann, ohne es aber ganz zu sein. Das Schnabeltier könnte eine Ente sein, ein Biber oder ein Murmeltier. Sein Geheimnis besteht darin, sich als andere Tiere zu tarnen, um hinter dieser Tarnung ganz es selbst zu sein. Ein großartiger Nebendarsteller!«
Ich verstand kein Wort. War Onkel Tito verrückt geworden, seit ich ihn zuletzt gesehen hatte?
Begeistert sprach er weiter: »Außerdem ist Australien berühmt für seine herrlichen Meereswellen. Nicht nur wegen ihrer Form, sondern auch, weil in ihnen die Australierinnen baden, eine Spezies, die dem Schnabeltier noch überlegen ist. Warte, irgendwo muss ich doch noch einen Kalender haben mit Bildern von australischen Bikinischönheiten.«
Meine Mutter sah Onkel Tito besorgt an und nahm mich bei der Hand. Sie schien es schon zu bereuen, dass sie mich hergebracht hatte. Mich hingegen begannen die seltsamen Worte des Onkels zu interessieren.
»Möchtet ihr einen Rauchtee?«, fragte er, und ohne die Antwort abzuwarten, war er auch schon aus dem Zimmer.
Meine Mutter strich mir übers Haar und sah mich traurig an. »Meinst du, du kommst hier zurecht, Juanito?«