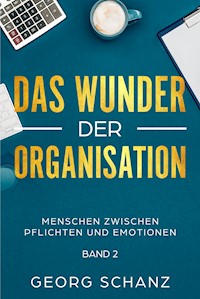
15,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Schwierigkeiten theoretische Organisationsmodelle auf konkrete Fälle zu übertragen, besteht darin, dass wir es in der Regel von unterschiedlichen Begriffs- und Funktionswelten zu tun haben. Die Synchronisierung scheitert häufig daran, dass der Lösungsanspruch quantitativ und qualitativ zu hoch ist. Solche Aufgaben sollten stufenweise angepasst werden, wobei ein überschaubares Konzept sich bessergestalten lässt als ein überdimensioniertes, das nicht mehr beherrscht werden kann. Dosierte Anpassungen nach oben sind leichter zu realisieren als der "große Wurf".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georg Schanz
Das Wunder der Organisation
Menschen zwischen Pflichten und Emotionen
Band 2
5. Interaktionsanalyse und –beeinflussung
6. Antriebskräfte des Menschen
7. Organisationskonzepte in Theorie und Praxis
8. Nachwort: Das Wunder der Organisation
2. Auflage 2018
Autor: Georg Schanz (GSB), Postfach 14 03 31, 40073 DüsseldorfWEB: http://www.personalentwicklung-gsb.deE-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-7469-3437-2 (Paperback)
978-3-7469-3438-9 (Hardcover)
978-3-7469-3439-6 (e-Book)
Georg Schanz
Das Wunder der OrganisationMenschen zwischen Pflichten und Emotionen
Band 2
Vorwort zur 2. Auflage 2018
Georg Schanz, Postfach 14 03 31, 40073 Düsseldorfhttp://www.personalentwicklung-gsb.de
Der Inhalt zur 2. Auflage 2018 entspricht mit nur sehr wenig Änderungen der 1. Auflage 2017.
Zur Zeit arbeite ich an einer Fallstudie zu Großprojekten in Deutschland. Dort scheint mir Handlungsbedarf zu sein und ich werde sie in der nächsten Auflage aufnehmen und sie auch als Online-Broschüre herausbringen.
Großprojekte wie der Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (Finanzbedarf September 2006 2 Mrd. EUR; Juni 2014 5,4 Mrd. EUR bis zum Abschluss ca. 6,5 Mrd.) werden nicht im vorgesehen Zeitrahmen abgeschlossen, vermutlich, weil ein umfassendes Projektcontrolling und eine übergreifende Koordination (Multiprojektmanagement) fehlen bzw. nicht funktionieren.
Und das, obwohl syndikatsähnliche „Joint Venture Verbindungen auf Vertragsbasis“ (Beteiligungsstruktur - Länder Berlin, Brandenburg und die Bundesrepublik Deutschland, Bundes- und Landesregierungen, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsführung, Konsortien, Behörden jeglicher Art, Körperschaften - wie der TÜV, Krisenmanagement, Unternehmens- und Projektberatungen, Großunternehmen wie Lieferanten usw.) dahinter stehen. Dazu kommt eine moralisch-rechtliche Komponente mit Compliance Management (Kenntnis und Anwendung der geltenden Gesetze, Richtlinien und internen Anweisungen) und Corporate Governance (Regeln guter und verantwortungsvoller Unternehmensleitung und – kontrolle, Transparenz des Leitungs- und Kontrollsystems gegenüber der Öffentlichkeit); das bezeichnet die im Unternehmen eingerichteten Maßnahmen und Prozesse, um Regelkonformität, Nachvollziehbarkeit und Gleichbehandlung sicherzustellen.
Die Unübersichtlichkeit und Komplexität sich überschneidender Bedingungen und Zuständigkeiten, warum das nicht so funktioniert hat, ist m.E. darauf zurückzuführen, dass die funktionellen Koordinations- und Überwachungsfunktionen nicht eindeutig genug für die Aufgabenträger formuliert waren und damit auch sachlichzeitliche Auslöser, Eingriffe und die damit verbundenen Entscheidungsbefugnisse (Interventionsstufen) nicht geregelt waren bzw. nicht verstanden wurden.
Dazu kommt, dass Prominenz aus Politik und Wirtschaft (Aufsicht und Führung) nicht zwangsläufig die koordinierende und fachliche Kompetenz mitbringt, die solche Aufgaben brauchen.
Alternative Betrachtung
Aber was hätte man mit geringerem Aufwand tun können, ohne das Gesamtziel aufzugeben? Der Umzug des Münchner Flughafens Riem nach Erding (Erdinger Moos) hätte in der ersten Phase ein Muster für den Umzug des Tegeler Flughafens (Flughafen Tegel - Berlin Airport) zum neuen Standort sein können. Der spätere Ausbau zum Großflughafen Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ hätte mit weniger Zeitdruck erfolgen können. Weil man aber alles auf einmal machen wollte, kam diese Alternative nicht zum Tragen, was dann letztlich zu riesigen Problemen führte.
Was muss ein Organisator nach diesen Ausführungen bedenken: Es ist Vorsicht geboten, nicht aber Passivität, auch bei Projekten, die als relativ unbedeutend angesehen werden: Wer Projekte definiert und ausschreibt, sollte bei der Vielfalt aller Faktoren die Risiken erkennen, nach Möglichkeit eingrenzen und versuchen nur das methodisch (ggf. zeitlich versetzt / Stufenplan) in die Praxis umzusetzen, was tatsächlich zu definierten Terminen gebraucht wird. Es kommt nicht darauf an, die eleganteste Lösung zu finden (im Regelfall zu teuer), sondern die geeignete. Nach Gomez/ Zimmermann soll das Ergebnis stimmen, weniger die Perfektion der Prozesse (Zelte statt Paläste). Oder „manchmal ist weniger mehr“.
Georg Schanz
Das Wunder der OrganisationMenschen zwischen Pflichten und Emotionen
Band 2
Verfasser:
Georg Schanz, Postfach 14 03 31, 40073 Düsseldorf http://www.personalentwicklung-gsb.de
Georg Schanz hat in Betriebswirtschaft in Hamburg studiert und war danach zunächst im Controlling (J.D. Möller, Optische Werke Wedel, Beiersdorf Hamburg, Herose Hamburg, IBM Sindelfingen, SABA Villingen) beschäftigt.
Aufgrund einer Fördermaßnahme des Regierungspräsidenten Düsseldorf konnte er ein Studium der Wirtschaftspädagogik (Universität Köln) aufnehmen. Bedingung war, dass er gleichzeitig als Lehrer an der Fachschule für EDV (Düsseldorf / Hochdahl) tätig wurde. Damals gab es noch zu wenig Lehrkräfte mit Praxiskenntnissen in der EDV.
Folgende Fächer hater dort unterrichtet:
• Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
• Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung
• Marketing und Unternehmensführung
• Verwaltungsorganisation und Entscheidungsprozesse
• Organisationsstrukturen und –prozesse (Planung und Realisierung mit EDV-Einsatz)
• Rechungswesen mit Wirtschaftlichkeitsanalysen
• Finanzierung, Investitions- und Finanzmanagement
• Projekt- und Investitionsrechnung, Ertrags- und Kostentheorie
• Grundlagen der Produktions- und Materialwirtschaft (Logistik)
• Information, Kommunikation und Interaktion
• Psycho-soziale Wirkungen in Organisationssystemen
Während Nach meines Studiums der Wirtschaftspädagogik an der Universität Köln habe hat er am Lehrstuhl an folgenden Projekten mitgearbeitet:
• Organisation und Automation
• Organisationsmittel / Datenverarbeitung
• Didaktische Prinzipien im Unterrichtan Wirtschaftsschulen
• Lenkung und Impulsgebung im wirtschaftsberuflichen Unterricht
• Theorien und Modelle der psychosozialen Pädagogik
• Bildungspolitische Entwicklungstendenzen der beruflichen Weiterbildung
Die Abschlussarbeit an der Universität Köln „Die Gestaltung der Interaktionen zwischen Trägern organisatorischer Gestaltung und Organisierten – Mögliche Konzepte und ihre Problematik“ war eine interdisziplinäre organisations-psychologische Aufgabenstellung zwischen den Lehrstühlen Wirtschaftspädagogik (Prof. Schmiel), Organisation (Prof. Grochla) und Informatik (Prof. Schmitz).
Danach war er 30 Jahre in der Personal- und Organisationsentwicklung tätig sowohl angestellt (20 Jahre lang bei DIETZ Computer-Systeme und der Océ Deutschland GmbH Mülheim an der Ruhr) wie freiberuflich (SIEMENS München, Karstadt Essen, Commerzbank Frankfurt).
Georg Schanz
Das Wunder der OrganisationMenschen zwischen Pflichten und Emotionen
Band 2
Was Herrn Schanz bis heute stört, ist die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis: Entweder gibt es gute Theoretiker, die sich in realen Organisationen schwer tun, oder zupackende Praktiker, die wissenschaftliche Ansätze nicht kennen oder anwenden. Beide Leistungsvorteile zusammen gibt es nicht so häufig – dabei kann man integrativ mehr erreichen.
Dass eine Person allein umfassende Strukturen und Prozesse einer großen Organisation planen, konzipieren, realisieren und steuern kann, ist eher die Ausnahme. Er/Sie kann das im Regelfall nicht zeitgerecht und nicht umfassend gewährleisten. Kooperation in geeigneten Gruppen schafft die Möglichkeiten, Probleme umfassend zu analysieren, geeignete Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Allerdings bedarf es der planmäßigen Koordination einer solchen Gruppenarbeit, ansonsten besteht die Gefahr, dass solche Projekte sich zu breit entwickeln und manchmal im Chaos enden
Andererseits wird zu viel auf einmal angepackt und versucht methodisch in der Praxis umzusetzen, um allmählich festzustellen, dass wir bei der Vielfalt aller Faktoren – vor allem bei denen, die wir kaum oder gar nicht kennen, an sich im Dunklen tappen und dabei von den Ergebnissen überrascht werden.
Neben dem fachlichen Verständnis einer Funktion braucht jeder Wissen (Umfang, Tiefe, Komplexität), Intelligenz (Verstehen, Analyse und Interpretation), Fähigkeiten (z.B. spezifische Begabungen), Eignung (z.B. Talent), Kompetenz (z.B. anerkannte Beherrschung von einem Aufgabengebiet), Antrieb (Offenheit für Selbst- und Fremdmotivation) und Durchhaltevermögen (Fleiß, Intensität, Ausdauer), um zu verstehen, wohin er will und wofür er geeignet ist.
Diese Einsichten sollen repetitives Lernen (z.B. Nachahmung) durch autonomes Lernen (selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernen) ersetzen und m Ergebnis „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein. Der zu einer Person passende Zuschnitt der Aufgabenebene ist entscheidend:
Ein Buchhalter z.B. soll nicht agieren wie ein Geschäftsführer, sondern die im geschäftlichen Verkehr eines Unternehmens anfallenden Finanz-, Erfolgs- und Leistungsdaten erfassen, verbuchen, abschließen, kontrollieren und den unterschiedlichen Zwecken zugänglich machen (Handels- und Steuerbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung usw.).
Entsprechend der jeweiligen Ebene sollen Verantwortliche im zeitlichen Ablauf in ihrem Aufgabenbereich erkennen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Bei den leitenden Mitarbeitern bis zur Führung geht es einerseits darum die darum, Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle des Zuständigkeitsbereiches wahrzunehmen und zum anderen, die Mitarbeiter/Innen dafür zu gewinnen, das Unternehmen permanent und selbstverantwortlich im Auge zu behalten, Fehlerquellen aufzudecken und zu beheben, den internationalen Wettbewerb zu beobachten und das Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten, eine Art des dauerhaften KVP-Prozesses. Dabei ist eine schrittweise überschaubare Anpassung an die gewünschten Ziele, Paradigmen und Szenarien sicherer und weniger riskant.
Der Verfasser versucht im Folgenden Brücken zu bauen zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Es kommt nicht darauf an, die eleganteste Lösung zu finden (im Regelfall zu teuer), sondern die geeignete. Nach Gomez/Zimmermann soll das Ergebnis stimmen, weniger die Perfektion der Prozesse (Zelte statt Paläste). Oder „manchmal ist weniger mehr.
Das Wunder der OrganisationMenschen zwischen Pflichten und Emotionen
Umfang von Kapiteln und Anhängen Seiten
BAND 2: Interaktionen – Antriebskräfte – Organisationskonzepte
5. Interaktionsanalyse und –beeinflussung
6. Antriebskräfte des Menschen
7. Organisationskonzepte in Theorie und Praxis
8. Nachwort: Das Wunder der Organisation – Menschen zwischen Pflichten und Emotionen
Anhang 10 Konflikte
Anhang 11 Wie steht es heute mit dem Organisationsansatz von Erich Kosiol?
Anhang 12 Stellenbeschreibung „Leiter in der Fertigung“
Anhang 13 Grochlas systemorientierte Organisation
Danksagungen
BAND 1: Formale und psycho-soziale Grundlagen
0. Vorwort: Das Wunder der Organisation – Menschen zwischen Pflichten und Emotionen
1. Verhaltensmuster - Psycho-Soziale Strukturen und Prozesse in Organisationen
2. Formale und psycho-soziale Kategorien (Strukturen und Prozesse)
3. Struktur und Funktionen des menschlichen Gehirns
4. Vom Individuum zur Gruppe
Anhang 1 Risiken und Fehlentwicklungen
Anhang 2 Mensch-Maschine-Systeme
Anhang 3 Beispiel Deutsch-Englisch, ASCII- und Binär-Code
Anhang 4 Zu Einsichtslernen (Zeit online)
Anhang 5 Emotionale Intelligenz
Anhang 6 Bill Gates / PC-Technologien
Anhang 7 Intelligenztest
Anhang 8 Beispiel Signifikanzbestimmung
Anhang 9 Entwicklungen und Fehlentwicklungen (gestern bis heute)
5 Interaktionsanalyse und –beeinflussung
5.1 Begriffliche Abgrenzung
5.2 Interaktions- und Verhaltenseigenschaften (Kommunikation)
5.3 Interaktionsgefüge als Ausdruck sozialer Organisation
5.4 Interaktion und Argumentation
5.5 Sprecharten-, formen -, absichten bei Lernprozessen
5.6 Dialog- und Diskussionsformen als Lehr/Lernformen im Interaktionszusammenhang
5.6.1 Dialog
5.6.1.1 Logik des Dialogs (Thesen, Antithesen und Gesetzlichkeiten)
5.6.1.2 Dialogwiedergaben und Interpretationsspielraum
5.6.1.3 Prinzipien des Dialogs
5.6.1.4 Zusammenfassung des Dialognutzens
5.6.1.5 Dialogbeispiel (Erlernen des Schachspiels)
5.6.2 Diskussion
5.6.2.1 Die Diskussion als multidimensionale Ausbreitung der Dialogstruktur
5.6.2.2 Weitere Regeln der Diskussion
5.6.3 Wirkungen von Dialog und Diskussion
5.6.3.1 Sprach-, Sprechlogik und Sprechmelodie
5.6.3.2 Diskurstechniken
5.7 Individuelles und kollektives Verhalten (Gruppeninteraktionen)
5.8 Dispositionen und Improvisationen
5.9 Bedeutungsdiskrepanzen
5.10 Interaktonsanalyse (auch Interaktionsprozeßanalyse)
5.10.1 Bales-Beobachtungskategorien
5.10.2 Interaktionen als Elementarformen sozialen Verhaltens (nach George Caspar Homans)
5.10.3 Maßeinheiten der Interaktionsanalyse
5.10.3.1 Behavior Sequence (Interaktionsfolge) und Behavior Set (Verhaltenssatz)
5.10.3.2 Anlässe, Reizverstärkung und Verhaltensrepertoire
5.10.4 Interaktionsfolgen und Souveränität
5.10.4.1 Merkmale der Souveränität
5.10.4.2 Authentizität
5.10.4.3 Identifikation („Man ist mit sich selbst im Reinen“.)
5.10.4.4 Erfahrung
5.10.4.5 Anpassung (Lernprozesse)
5.10.4.6 Konsequenz (persönlichkeitstypisches Verhalten)
5.10.5 Auswirkungen der Interaktion
5.11 Interaktionsfolgen und Souveränität
5.11.1 Merkmale der Souveränität
5.11.2 Authentizität
5.11.3 Identifikation („Man ist mit sich selbst im Reinen“.)
5.11.4 Erfahrung
5.11.5 Anpassung (Lernprozesse)
5.11.6 Konsequenz (persönlichkeitstypisches Verhalten)
5.11.7 Auswirkungen der Interaktion
5.12 Interaktionsbeeinflussung (Interaktionssynthese)
5.12.1 Rewards und Costs (Bewertung von Interaktionen)
5.12.2 Versuch einer Bewertung
5.12.3 Verhaltensabhängigkeiten
5.12.4 Soziale Interaktionen
5.13 Rang-Theorie
5.13.1 Rangdefinitionen
5.13.2 Interaktionsmethodik und -dynamik
5.13.3 Gleichrangigkeit
5.13.3.1 Funktionsschema
5.13.3.2 Formale und informale Einflüsse
5.13.3.3 Gruppenziele und Zielkonkurrenzen
5.14 Rangungleichheit
5.14.1 Funktionsschema: Vorgesetzter und Untergegebener (informaler Führer)
5.14.2 Informale Einflüsse (Beeinträchtigungen durch die formalen Führung)
5.14.3 Führungsarten und -einflüsse
5.14.4 Führungseignung-, -Persönlichkeit und –interaktionen
5.14.5 Führungsrolle und Führungsinteraktionen
5.15 Interaktionen zur Regelung und Klärung von Störungen
5.15.1 Systemkonformismus und Gruppenintegration
5.15.2 Anpassungsprozesse, Glaubwürdigkeit und Konsequenz
5.15.3 Erwartungs- und Kontaktstruktur (Reaktionswahrscheinlichkeit)
5.15.4 Informelle Macht und Bereinigung von Störungen
5.16 Soziale Harmonisierung (Interaktionssynthese, Gruppendynamik)
5.16.1 Ziele, Absichten und methodische Ansatzpunkte
5.16.1.1 Individuum und Gruppe (Interaktion und Kommunikation)
5.16.1.2 Absichten und Stimmungen
5.16.1.3 Interdisziplinäre und Integrale Ansätze des Interaktionsaustausches
5.16.1.4 Interaktionsmethoden aus organisatorischer Sicht
5.17 Interkulturelles Lernen
5.17.1 Globale Betrachtung
5.17.2 Unternehmensbetrachtung (Unternehmenskultur)
5.17.3 Unternehmenskultur und Organisationsanforderungen
5.17.3.1 Organisation und Organisationsansätze
5.17.3.2 Organisation und Anpassungshintergründe
5.18 Bewertung und Steuerung kommunikativer, koordinativer und kooperativer Interaktionen
5.18.1 Kenntnis der Interaktionsstrukturen
5.18.1.1 Übersicht
5.18.1.2 Organisatorische Bestimmungen der Gestaltungssituationen
5.18.1.3 Koordination, Kooperation und Soziale Harmonisierung
5.18.1.4 Gestaltungsinteraktionen zwischen Organisatoren und Organisierten
5.18.2 Verhaltensmuster in Organisationen
5.18.2.0 Funktionsschema
5.18.2.1 Psycho-soziale und emotionale Verhaltensmuster
5.18.2.2 Instrumentale Verhaltensmuster
5.18.2.3 Rationale Verhaltensebene
5.18.3 Beschreibungs- und Auswertungskriterien
5.18.3.0 Funktionsschema Struktur-, Faktoren- und Funktionsanalyse
5.18.3.1 Strukturelle und dynamische Merkmale von Interaktionsverhältnissen
5.18.3.2 Dynamische Strukturanalyse
5.18.3.2.0 Funktionsschema: Dynamische Strukturanalyse
5.18.3.2.1 Fehlerquellen der Operationalisierung
5.18.3.2.2 Wie könnte eine operationale Hypothesen in einem solchen Fall aussehen?
5.18.3.2.3 Fehlerquellen der quantitativen und qualitativen Erfassung von Interaktionen
5.18.3.2.4 Interaktions- und Handlungsorientierung
5.18.3.3 Faktorenanalyse
5.18.3.3.0 Funktionsschema
5.18.3.3.1 Interaktionsverhältnissen in der Faktorenanalyse
5.18.3.3.2 Primäre Faktoren (first-level factors): und Sekundäre Faktoren (second-level factors)
5.18.3.4 Funktionsanalyse
5.18.3.4.0 Funktionsschema Interaktionelle Funktionen
5.18.3.4.1 Interaktionelle Funktionen
5.18.3.4.2 Funktionen und Dysfunktionen
5.18.3.4.3 Funktionsdiagramm als operationale Strukturierungshilfe
5.18.4 Sensibilisierung und Gruppendynamik als „soziale Systemgestaltung“
5.18.4.0 Funktionsschema
5.18.4.1 Individualität, Interaktion und Kommunikation
5.18.4.2 Fehlentwicklungen, Unschärfen und Widersprüche
5.18.5 Charakterisierung der Interaktionsmethoden
5.18.5.0 Funktionsschema Hypothesen, Theorien und Gestaltungsansätze
5.18.5.1 Hypothesen, Theorien und Gestaltungsansätze
5.18.5.2 Interaktiogramm als quantitative Beobachtungsstruktur
5.18.5.3 Bales-Beobachtungskategorien als qualitative Beobachtungsstruktur
5.18.6 Sensitivity Training
5.18.6.0 Funktionsschema
5.18.6.1 Charakterisierung
5.18.6.2 Betroffenheit und Gruppenverhältnisse
5.18.7 Konfrontationstechniken
5.18.7.0 Funktionsschema
5.18.7.1 Charakterisierung
5.18.7.2 „künstliche“ Konfrontation (Reizkonfrontation)
5.18.7.3 Exposition
5.18.7.4 Nochmaliges interaktives Durchleben eines tatsächlichen Konfliktes
5.18.7.5 Konflikteskalation (Steigerung des Konfliktpotentials bis zur Konfliktmüdigkeit)
5.18.8 Psychoanalyse und –synthese
5.18.8.0 Funktionsschema
5.18.8.1 Psychoanalyse
5.18.8.2 Psychosynthese
5.19 Einsatzmöglichkeiten und Transferproblematik von Interaktionsmethodiken
5.19.0 Übersicht (1) Einsatzmöglichkeiten
5.19.0 Übersicht (2) Transferproblematik von Interaktionsmethodiken
5.19.1 Charakterisierung der Interaktionsmethodiken im Zusammenhang
5.19.2 Einsatzmöglichkeiten und Transferproblematik
5.19.2.1 Einsatzmöglichkeiten
5.19.2.2 Eignung zur sozialen Kompetenz
5.19.2.3 Transferproblematik
5.20 Konflikte
5.20.1 Abweichendes Verhalten (Devianz) und Risikoverhalten (Streit- und Konfliktkultur)
5.20.1.1 Individualdevianz oder primäre Devianz
5.20.1.2 Gruppendevianzen
5.20.2 Konfliktmerkmale
5.20.3 Verdeckte und offene Konflikte
5.20.4 Konflikte aus Rollen- und Gruppenbeziehungen
5.20.5 Konfliktkompetenz (Konfliktrichtung)
5.20.6 Appetenz-, Aversions- und Appetenz-Aversions-Konflikte
5.20.7 Konfliktsynthese (Wechselwirkungen aus Konfliktverbindungen)
5.20.8 Sensivity Training, Konfrontationstechniken und Psychoanalyse und –synthese
5.20.9 Zusammenfassung Konfliktstrukturen und –prozesse





























