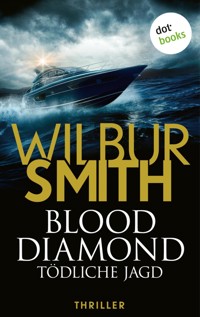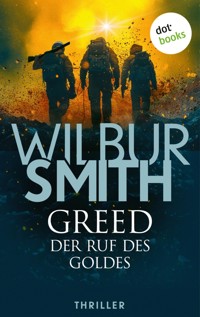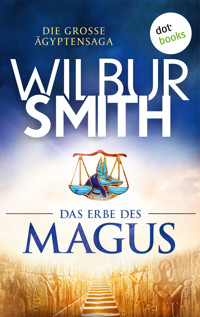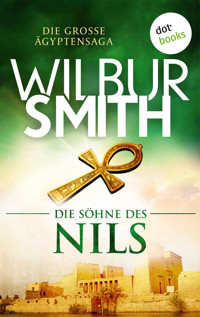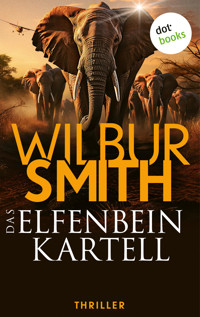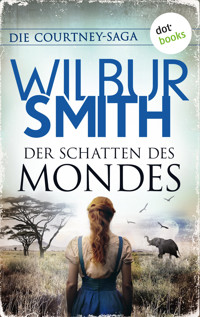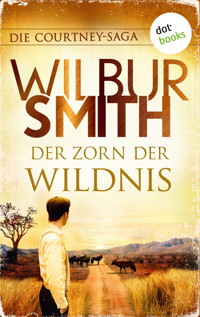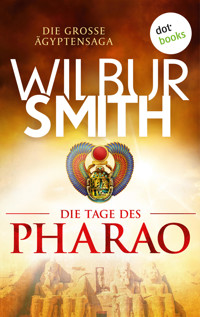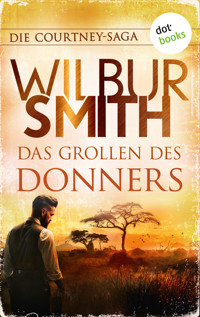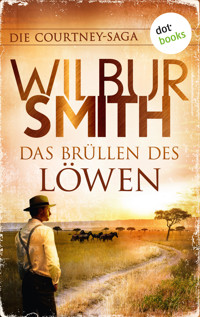Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Courtney-Saga
- Sprache: Deutsch
Das internationale Phänomen, das den Weltruhm des Autors begründet hat: »Wilbur Smith – dieser Name bedeutet eine unwiderstehliche Mischung aus Action, Abenteuer und Romantik!«, urteilt die Washington Post.Ein zerrissenes Land – eine unmögliche Liebe … Südafrika, 1968. Mit ihrem Vater, dem südafrikanischen Botschafter in London, kehrt die schöne und eigenwillige Isabella Courtney in ihre Heimat zurück – und verliebt sich Hals über Kopf in den attraktiven Ramón. Was Isabella nicht weiß: Ramón ist ein KGB-Agent und ehemaliger Kampfgefährte Fidel Castros, der die Anti-Apartheit-Bewegung mit allen Mitteln unterstützen soll. Als sich ihr Geliebter als der berüchtigte »Goldene Fuchs« zu erkennen gibt, ist es schon fast zu spät. Vor eine unmögliche Wahl gestellt, muss Isabella sich entscheiden: Zwischen ihrem Vater und ihrem Land oder dem Mann, den sie liebt – und ihrem ungeborenen Sohn … Der dramatische Afrika-Roman »Das Zeichen des Fuchses« von Bestseller-Autor Wilbur Smith ist der achte Band seiner epochalen historischen Familiensaga um die Familie Courtney – Fans von Jeffrey Archer und Ken Follett werden begeistert sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südafrika, 1968. Mit ihrem Vater, dem südafrikanischen Botschafter in London, kehrt die schöne und eigenwillige Isabella Courtney in ihre Heimat zurück – und verliebt sich Hals über Kopf in den attraktiven Ramón. Was Isabella nicht weiß: Ramón ist ein KGB-Agent und ehemaliger Kampfgefährte Fidel Castros, der die Anti-Apartheit-Bewegung mit allen Mitteln unterstützen soll. Als sich ihr Geliebter als der berüchtigte »Goldene Fuchs« zu erkennen gibt, ist es schon fast zu spät. Vor eine unmögliche Wahl gestellt, muss Isabella sich entscheiden: Zwischen ihrem Vater und ihrem Land oder dem Mann, den sie liebt – und ihrem ungeborenen Sohn …
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: www.wilbursmithbooks.com/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/WilburSmith/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/thewilbursmith/
Die große Courtney-Saga des Autors um die gleichnamige südafrikanische Familie erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »Golden Fox« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »In den Fängen des Fuchses« bei Wilhelm Goldmann.
First published in 1990 by Macmillan an imprint of Pan Macmillan Ltd.
Copyright © Wilbur Smith 1990
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Cathy Withers-Clarke, chrisdaviez, Daniel Bearham und AdobeStock/Ricky
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-98952-950-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Das Zeichen des Fuchses
Die Courtney-Saga 8
Aus dem Englischen von Wulf Bergner
dotbooks.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Lesetipps
Kapitel 1
Ein Schwarm von Schmetterlingen stieg im Sonnenlicht auf und wurde von der leichten Sommerbrise davongetrieben. Hunderttausend junge Gesichter blickten staunend auf.
Im Vordergrund der weiten Rasenfläche saß eine junge Frau, die er seit zehn Tagen beschattete. Mittlerweile war er auf eigentümliche Weise mit all ihren Gesten und Bewegungen vertraut geworden: Er wußte, wie sie den Kopf hielt, wenn sie etwas interessierte, wie sie ihn schräg legte, um zuzuhören, oder ihn ungeduldig in den Nacken warf. Jetzt sah sie zu der bunten Schmetterlingswolke auf, und ihr Mund öffnete sich vor Bewunderung.
Auf der Bühne über ihr hielt ein Mann in einem weißen Satinhemd eine weitere Schachtel hoch und setzte lachend eine neue Schmetterlingswolke frei. Gelbe, weiße und buntschimmernde Insekten flatterten davon. Die Menge war fasziniert.
Einer der Schmetterlinge flog schwankend vorbei, und obwohl sich ihm hundert Hände entgegenreckten, flatterte er weiter und landete schließlich auf dem Gesicht der jungen Frau. Selbst über das Gemurmel der Menge hinweg konnte der Beobachter ihr glückliches Lachen hören – und lächelte aus Sympathie mit.
Sie griff nach dem Schmetterling und nahm ihn behutsam zwischen ihre Hände. Einige Sekunden lang hielt sie ihn fest, um ihn mit den indigoblauen Augen zu betrachten, die der Beobachter schon so gut kannte. Ihr Gesichtsausdruck war mit einem Mal wehmütig, und sie flüsterte dem Schmetterling etwas zu.
Dann lächelte sie, sprang auf und reckte auf den Zehenspitzen stehend beide Arme in die Luft. Während der Schmetterling auf ihrer ausgestreckten Hand zögernd die Flügel bewegte, hörte der Beobachter ihre Stimme.
»Flieg! Flieg für mich!« Die Menschen in ihrer Nähe sahen auf.
»Flieg! Flieg für den Frieden!«
Alle achteten jetzt nur auf sie, wie sie da stand: groß, schlank, mit sonnengebräunten Armen und Beinen. Der Mode gemäß war ihr Minirock so kurz, daß sein Saum hochglitt, als sie sich streckte, und einen hübschen Hintern ahnen ließ.
In dieser Haltung schien sie eine ganze Generation zu verkörpern: frei, wild, lebendig, und er fühlte die emotionale Zustimmung aller, die sie sahen. Selbst der Mann auf der Bühne beugte sich nach vorn, um sie besser sehen zu können, verzog seine breiten Lippen zu einem Lächeln und rief: »Friede!« Die haushohen Lautsprechertürme auf beiden Seiten der Bühne verstärkten seine Stimme hundertfach: »Friede!«
Der Schmetterling flatterte davon, und sie schickte ihm einen Handkuß nach, als er sich auch schon in der bunten Wolke aus Insekten verlor.
Die junge Frau sank wieder ins Gras, und alle berührten oder umarmten sie.
Auf der Bühne breitete Mick Jagger die Arme aus. Sobald Ruhe herrschte, sprach er zu der Menge. Seine Stimme klang undeutlich und der Dialekt so unverständlich, daß der Beobachter den Nachruf auf ein Mitglied der Band, das erst vor wenigen Tagen während eines wilden Wochenendes in einem Swimmingpool ertrunken war, kaum begriff.
Gerüchte besagten, das Opfer sei mit Drogen vollgepumpt gewesen, als es ins Wasser gegangen war. Kurz darauf legten die Gitarren los, und Jagger begann, »Wild Woman« zu singen. Binnen Sekunden rasten hunderttausend Herzen, zuckten und pulsierten hunderttausend junge Leiber, reckten sich zweihunderttausend Arme empor und wogten wie ein Kornfeld im Sturm.
Der Beobachter schien in der begeisterten Menge allein: isoliert und unbeteiligt, von der ohrenbetäubend lauten Musik, die über ihn hinwegbrandete, nicht betroffen, studierte er die junge Frau und wartete auf seine Chance.
Auch sie bewegte sich zu den heftigen Rhythmen, paßte sich dem Wogen der dichtgedrängten Leiber an – aber mit einer bemerkenswerten Grazie, die sie aus der Menge hervorhob. Ihr schwarzes Haar mit den rötlichen Lichtern war zu einer Hochfrisur aufgetürmt, aus der sich lockige Strähnen gelöst hatten, die sich um ihren Nacken kringelten, wie um dessen eleganten Schwung hervorzuheben.
Unmittelbar vor der Bühne war durch einen niedrigen Holzzaun eine winzige Enklave für einige wenige Privilegierte abgetrennt worden. Dort saß Marianne Faithfull – in einem fließenden langen Gewand, mit bloßen Füßen – mit den anderen Ehefrauen und Freundinnen der Bandmitglieder. Ihr Blick war entrückt, und ihre Bewegungen wirkten schlafwandlerisch langsam. Kinder krabbelten um sie herum; alle wurden von Hell’s Angels beschützt. Diese sahen bedrohlich aus: schwarze Wehrmachtsstahlhelme, Ketten und Eiserne Kreuze um den Hals, nietenbesetzte schwarze Lederwesten, eisenbeschlagene Motorradstiefel und einige Tätowierungen auf den Armen. Mit Gummiknüppeln an den Gürteln und scharfkantigen Schlagringen an den Fäusten beobachteten sie die Menge und warteten auf Unruhestifter.
Die Musik hämmerte weiter – eine Stunde lang und noch eine; der Geruch der Menge erinnerte immer mehr an einen Tierkäfig, weil manche Zuhörer – Frauen wie Männer –, die im Gedränge eingekeilt waren und keinen Augenblick versäumen wollten, gleich dort uriniert hatten, wo sie saßen.
Die Dekadenz, die schamlose Ausgelassenheit und die grobe Sinnlichkeit des Ganzen widerten den Beobachter an. Seine Augen waren gerötet und brannten, und er hatte Kopfschmerzen vom rhythmischen Hämmern der Gitarren. Eigentlich hätte er längst gehen sollen. Wieder ein Tag vergeudet, um auf eine Chance zu warten, die einfach nicht kommen wollte. Aber er hatte es nicht eilig. Er konnte warten.
Schließlich setzte er sich in Bewegung, überquerte den sanften Hügel, auf dem er eingezwängt gestanden hatte, und drängte sich durch die tobende Menge.
Dann sah er sich erneut um und kniff die Augen zusammen, als die junge Frau mit ihrem Begleiter sprach, seine Antwort lächelnd mit einem Kopfschütteln quittierte und aufstand. Auch sie bahnte sich mühsam einen Weg durch die Menge.
Der Beobachter änderte seine Richtung und ging schräg hügelabwärts weiter, um sie abzufangen, weil sein Instinkt ihm sagte, daß der Augenblick, auf den er gewartet hatte, nun gekommen war.
Hinter der Bühne standen etliche Übertragungswagen, jeder so groß wie ein Doppeldeckerbus und so dicht nebeneinander geparkt, daß nur eine schmale Lücke blieb.
Die junge Frau folgte dem niedrigen Zaun, der die Sattelschlepper umgab, und versuchte dann, auf die andere Seite der Bühne zu gelangen, aber das Gedränge war so groß, daß sie nicht durchkam und sich verzweifelt umsah. Dann arbeitete sie sich zum Zaun vor, setzte mit einer Flanke hinüber und verschwand zwischen zwei hohen Fahrzeugen. Einer der Hell’s Angels sah sie dort eindringen und rannte hinter ihr her.
Der Beobachter brauchte fast zwei Minuten, um die Stelle zu erreichen, an der die junge Frau über den Zaun gesprungen war. Er schlüpfte zwischen die hohen Stahlflanken der Wagen.
Dann zwängte er sich durch den Zwischenraum und hatte gerade die Fahrertür erreicht, als er ganz in der Nähe unterdrückte Protestschreie hörte.
Der Hell’s Angel hatte die junge Frau eingeholt und drückte sie jetzt gegen den vorderen Kotflügel des Sattelschleppers. Er hatte ihr einen Arm auf den Rücken gedreht, so daß ihre Hand sich fast in Höhe der Schulterblätter befand. Sie setzte sich verzweifelt zur Wehr, aber er preßte sie mit seinen Hüften gegen den Kotflügel, beugte sich über sie und versuchte, sie zu küssen. Die junge Frau machte ein Hohlkreuz und warf ihren Kopf von einer Seite zur anderen, um ihm auszuweichen. Er lachte, streckte die Zunge heraus und versuchte, damit zwischen ihre Lippen zu kommen.
In diesem Augenblick trat der Beobachter vor und berührte seine Schulter. Der Mann erstarrte und sah sich um. Seine Augen waren trüb, aber sie wurden sofort klar, und er stieß die junge Frau heftig von sich weg. Dann griff er nach dem Gummiknüppel.
Der Beobachter berührte ihn unter dem Ohr, dicht unter dem Rand seines Stahlhelms. Als er fest mit zwei Fingern zudrückte, erstarrte der Hell’s Angel. Er gab ein heiseres Krächzen von sich; dann löste sich die Starre, und er brach zusammen und wand sich in heftigen Krämpfen. Die junge Frau starrte ihn erschrocken an. Der Beobachter stieg über den Mann weg und zog sie mühelos hoch.
»Kommen Sie«, forderte er sie halblaut auf. »Bevor seine Freunde hier aufkreuzen.«
Hinter dem LKW-Parkplatz begann ein Labyrinth aus schmalen Pfaden durch Rhododendronbüsche. Während sie einen davon entlangliefen, fragte die junge Frau atemlos: »Haben Sie ihn umgebracht?«
»Nein.« Er sah sich nicht einmal um. »In weniger als fünf Minuten ist er wieder auf den Beinen.«
»Aber Sie haben ihn flachgelegt. Wie haben Sie das fertiggebracht? Sie haben ihn kaum angefaßt.«
Er gab keine Antwort, blieb aber hinter der nächsten Kurve stehen und drehte sich nach ihr um.
»Alles in Ordnung?« fragte er, und sie nickte.
Er musterte sie. Er wußte, daß sie vierundzwanzig Jahre alt war. Eine junge Frau, deren dunkelblaue Augen nüchtern und neugierig waren. Trotz der Bedrohung gab es keine Tränen, keinen hysterischen Anfall, nicht einmal ein Zittern; ihre Hand fühlte sich schmal, fest und warm an.
Der Bericht des Psychiaters, den er studiert hatte, traf zumindest in diesem Punkt zu: Sie war selbstbewußt und widerstandsfähig; sie hatte den Schock des Überfalls bereits fast überwunden. Dann sah er, wie ihre Wangen sich röteten und ihr Atem unter dem Ansturm neuer Emotionen merklich schneller ging.
»Wie heißen Sie?« wollte sie wissen, während sie ihn mit einer Intensität anstarrte, die ihm vertraut war. Die meisten Frauen starrten ihn so an, wenn sie ihm zum ersten Mal begegneten.
»Ramón«, antwortete er.
»Ramón«, wiederholte sie halblaut. Gott, wie schön er war! »Und weiter?«
»Das würden Sie mir nicht glauben.« Sein Englisch war perfekt, zu perfekt. Er war kein Engländer; seine Stimme paßte zu seinem Gesicht: ernst, tief und schön.
»Versuchen Sie’s mal«, forderte sie ihn auf.
»Ramón de Santiago y Machado.« Das klang wie Musik in ihren Ohren. Der romantischste Name, den sie je gehört hatte.
»Wir müssen weiter«, sagte er, während sie ihn noch immer anstarrte.
»Ich fürchte, ich kann nicht mehr rennen«, wandte sie ein.
»Wollen Sie etwa als Motorradmaskottchen enden?«
Sie lachte: »Sie dürfen mich nicht zum Lachen bringen. Ich muß dringend aufs Klo.«
»Am Parkeingang gibt’s Toiletten. Schaffen Sie’s bis dorthin?«
»Ich glaub’ schon.«
»Gut, dann weiter!« Er zog sie an der Hand mit sich.
In der Nähe der Serpentine sah Ramón sich erneut um. »Die Begeisterung Ihres Freundes scheint abgekühlt zu sein«, sagte er. »Der Kerl ist nirgends zu sehen.«
»Wie weit ist’s noch?«
»Gleich sind wir da.« Als sie das Parktor erreichten, ließ sie seine Hand los und steuerte auf ein diskret mit Büschen getarntes niedriges Klinkergebäude zu. An der Tür zögerte sie jedoch.
»Ich heiße Isabella, Isabella Courtney, aber meine Freunde nennen mich Bella«, sagte sie über ihre Schulter hinweg, bevor sie hastig durch die Tür verschwand.
»Ja«, murmelte er. »Ja, ich weiß.«
Kapitel 2
Sogar im WC war die laute Musik zu hören.
Als sie die Hände wusch, begutachtete sie sich im Spiegel. Ihre Frisur war reichlich zerzaust; sie brachte sie wieder in Ordnung. Ramón hatte dichte schwarze Locken. Er trug sein Haar lang, aber nicht zu lang. Sie wischte ihren Lippenstift mit einem Papiertaschentuch ab und legte neuen auf. Ramóns Lippen waren voll und weich, aber stark. Wie sie wohl schmecken würden?
Sie ließ den Lippenstift wieder in ihre Handtasche fallen und beugte sich nach vorn, um ihre Augen im Spiegel zu begutachten. Auf ihre Augen konnte sie stolz sein: Sie leuchteten irgendwo zwischen kornblumen- und saphirblau. Ramón hatte grüne Augen. Das war ihr als erstes aufgefallen. Ein klares Grün, das schön, aber ... tödlich war. Genau! Um das zu erkennen, hätte sie nicht erst miterleben müssen, wie er den Hell’s Angel erledigt hatte. Ein Blick in diese Augen hatte genügt, um ihr zu zeigen, daß er ein gefährlicher Mann war. Sie spürte im Nacken ein wundervolles Prickeln, eine Mischung aus Angst und Vorfreude. Vielleicht war dies tatsächlich der Mann, den sie suchte.
»Ramón de Santiago y Machado.« Sie wiederholte seinen Namen mit kehliger Stimme, kostete ihn genüßlich aus und beobachtete, wie ihre Lippen die einzelnen Bestandteile formten. Dann richtete sie sich auf, machte kehrt und zwang sich dazu, bewußt langsam zu gehen.
Sie machte einen leichten Schmollmund und verbarg das Blau ihrer Augen unter langen, dichten Wimpern, als sie ins schräg einfallende goldene Sonnenlicht hinaustrat – und blieb wie angewurzelt stehen.
Er war weg! Sie war im ersten Augenblick wie vor den Kopf geschlagen und sah sich ungläubig um. »Ramón«, sagte sie unsicher und lief auf den Weg hinaus. Dort kamen Hunderte von Menschen auf sie zu – die ersten Konzertbesucher, die der Lawine, die bald folgen würde, zu entkommen versuchten –, aber keiner von ihnen war die elegante Gestalt, nach der sie Ausschau hielt.
»Ramón«, sagte sie und lief zum Parktor. Draußen tobte der Verkehr die Bayswater Road entlang, und sie blickte verzweifelt nach links und rechts. Er hatte sie einfach stehen lassen. Das war ihr neu. Sie hatte ihm gezeigt, daß sie ihn begehrte – deutlicher hätte sie’s ihm nicht zeigen können –, und er war einfach verschwunden.
Plötzlich wurde sie wütend. Das tat man Isabella Courtney nicht an, niemals!
»Verdammter Mistkerl!« fauchte sie. »Der Teufel soll ihn holen!«
Aber ihr Zorn hielt nur wenige Sekunden an. Danach wurde sie traurig.
»Er kann doch nicht einfach abhauen«, sagte sie laut. Es hörte sich an wie das Quengeln eines verzogenen kleinen Mädchens; sie wiederholte den Satz und versuchte erwachsene Wut hineinzulegen, aber auch das klang nicht sehr überzeugend.
Mit einem Mal hörte sie grölendes Gelächter und drehte sich um. Eine Horde Hell’s Angels stolzierte den Weg entlang – noch hundert Meter entfernt, aber genau auf sie zu. Hier konnte sie nicht bleiben.
Das Konzert war zu Ende, die Besucher strömten zu den Ausgängen. Ihre Freunde konnte sie im Gewühl unmöglich wiederfinden. Sie sah sich nochmals um: nichts.
»Wer braucht ihn überhaupt, den verdammten Dago?« murmelte sie wütend und setzte sich entschlossen in Bewegung.
Hinter ihr ertönte ein Chor aus Pfiffen und Beifallsrufen, und einer der Hell’s Angels gab ihr mit lauter Stimme Marschkommandos: »Links, rechts, links ...«
Sie wußte, daß ihre hohen Absätze ihren Po herausfordernd wackeln ließen. Sie hüpfte erst auf einem Fuß, dann auf dem anderen weiter, während sie ihre Schuhe abstreifte, und lief dann barfuß den Gehsteig entlang. Sie hatte ihren Wagen auf dem Botschaftsparkplatz am Strand gelassen und mußte deshalb vom Lancaster Gate aus mit der U-Bahn fahren, um ihn abzuholen.
Sie fuhr einen Mini-Cooper Jahrgang 1969. Wer zum »Swinging Set« gehörte, fuhr heutzutage einen Mini, an Samstagabenden parkten vor Anabel’s mehr Minis als Rolls-Royce oder Bentleys.
Isabella warf ihre Schuhe auf den Rücksitz, ließ den Motor an und gab Gas, bis die Nadel des Drehzahlmessers im roten Bereich stand. Die quietschenden Reifen hinterließen schwarze Gummispuren auf dem Asphalt; ein Anblick, der ihr Vergnügen bereitete.
Sie brach ihren eigenen Rekord nach Highveld, der Residenz des Botschafters in Chelsea. Daddys Dienstwagen – ein Bentley mit Standern auf den Kotflügeln – parkte in der Einfahrt, und Klonkie, sein Chauffeur, salutierte grinsend. Daddy hatte den größten Teil seines Personals aus Kapstadt mitgebracht.
Isabella bemühte sich, Klonkie freundlich anzulächeln und ihm die Schlüssel zuzuwerfen. »Seien Sie ein Schatz, Klonkie, und parken Sie meinen Wagen.« Sie durfte ihre schlechte Laune an jedem anderen auslassen, nur nicht an den Dienstboten. »Sie gehören zur Familie, Bella«, pflegte ihr Vater zu sagen. Tatsächlich waren die meisten von ihnen schon vor Bellas Geburt in Weltevreden, dem Stammsitz der Familie am Kap der Guten Hoffnung, angestellt gewesen.
Ihr Vater saß an seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer im Erdgeschoß mit Blick auf den Garten. Er hatte Jacke und Krawatte abgelegt, und auf der Schreibtischplatte türmten sich Akten. Aber als sie hereinkam, warf er seinen Füllfederhalter weg und drehte sich nach ihr um. Sein Gesichtsausdruck hellte sich auf.
Isabella setzte sich auf seinen Schoß und küßte ihn. »Gott«, murmelte sie, »du bist der schönste Mann der Welt.«
»Ich will dein Urteil nicht in Zweifel ziehen«, antwortete Shasa Courtney lächelnd, »aber darf ich fragen, wie ich zu dieser Ehre komme?«
»Männer sind brutal oder langweilig«, sagte sie. »Bis auf dich, versteht sich.«
»Aha! Und womit hat Roger sich deinen Zorn zugezogen? Mir ist er ziemlich fad, eher harmlos vorgekommen.«
Roger war der junge Mann, mit dem sie im Konzert gewesen war. Sie hatte ihn im Gedränge vor der Bühne zurückgelassen; jetzt brauchte sie sogar einen Augenblick, um sich überhaupt an ihn zu erinnern.
»Von Männern bin ich lebenslänglich kuriert«, behauptete Isabella. »Wahrscheinlich ziehe ich mich in ein Kloster zurück.«
»Könntest du damit wenigstens bis morgen warten? Ich brauche dich heute abend als Gastgeberin, und wir haben noch keine Tischordnung festgelegt.«
»Erledigt«, sagte sie. »Bevor ich ins Konzert gefahren bin.«
»Und das Menü?«
»Das haben Chef und ich letzten Freitag besprochen. Keine Panik, Papa. Es gibt alles, was du magst: Jakobsmuscheln und Lamm aus Camdeboo.« Shasa bewirtete seine Gäste vorzüglich.
Was den Transport der Lebensmittel vom Kap der Guten Hoffnung nach London anging, traf es sich günstig, daß ohnehin wöchentlich ein Kühlschiff der Reederei Courtney nach England auslief.
»...und ich hab’ heute morgen dein Dinnerjackett aus der Reinigung geholt, und ich hab’ dir bei Budds in der Picadilly Arcade drei neue Smokinghemden und ein Dutzend Augenklappen machen lassen. Die anderen sind schon so ausgefranst gewesen. Ich hab’ sie weggeworfen.«
Sie blieb auf seinem Schoß sitzen, während sie seine Augenklappe zurechtrückte. Shasa hatte sein linkes Auge verloren, als er im Zweiten Weltkrieg Hurricanes gegen die Italiener in Abessinien geflogen hatte. Seine schwarzseidene Augenklappe verlieh ihm etwas verwegen Piratenhaftes.
Shasa lächelte zufrieden. Als er Bella eingeladen hatte, mit ihm nach London zu kommen, war sie erst einundzwanzig gewesen, und er hatte lange überlegt, bevor er ihr die mühsame Aufgabe, in der Botschaft als Gastgeberin zu fungieren, angetragen hatte. Diese Sorgen hätte er sich sparen können. Schließlich war sie von ihrer Großmutter erzogen worden. Außerdem hatte er seinen Butler, den Küchenchef und die Hälfte des übrigen Personals vom Kap mitgebracht, so daß sie mit einem tadellos funktionierenden Team hatte anfangen können. In diesen drei Jahren hatte Isabella sich in Diplomatenkreisen einen Ruf geschaffen, und ihre Einladungen waren begehrt – außer bei den Botschaften der Staaten, die keine Beziehungen mehr zu Südafrika unterhielten.
»Soll ich die anderen ablenken, damit du nach dem Dinner eine halbe Stunde mit deinem Kumpel aus Israel verschwinden kannst, um eine Atombombe zu bauen?«
»Bella!« sagte er stirnrunzelnd. »Du weißt, daß ich solches Gerede nicht mag!«
»Nur ein Scherz, Daddy. Hier hört uns keiner.«
»Nicht mal unter vier Augen, Bella.« Er schüttelte streng den Kopf. Das war der Wahrheit unangenehm nahegekommen. Seit fast einem Jahr bestanden zwischen Shasa und dem israelischen Militärattaché geheime Verbindungen, die zum Vorteil beider Staaten ausgebaut werden sollten.
Seine Strenge verflog, als sie ihn küßte. »Ich muß jetzt gehen und baden.« Sie stand von seinem Schoß auf. »Die Gäste kommen um halb neun. Ich bin um zehn nach acht hier, um dir die Schleife zu binden.« Shasa hatte sich die Smokingschleife vierzig Jahre lang selbst gebunden, bis Isabella beschlossen hatte, er sei dazu nicht imstande.
Shasas Blick fiel auf ihre Beine. »Wenn deine Röcke noch kürzer werden, Mademoiselle, reicht dir demnächst ein breiter Gürtel.«
»Versuch bitte, kein alter Spießer zu sein. Das paßt gar nicht zu einem der swingendsten Papas des zwanzigsten Jahrhunderts.« Bella ging zur Tür und wackelte dabei absichtlich mit dem Po.
Shasa seufzte, als die Tür sich hinter ihr schloß. »Eine Ladung Dynamit mit verdammt kurzer Zündschnur«, murmelte er. »Vielleicht ist’s gut, daß wir bald heimreisen.«
Im September war seine dreijährige Amtszeit als Botschafter vorbei. Dann unterstand Isabella wieder der strengen Aufsicht ihrer Großmutter Centaine Courtney-Malcomess. Shasa war sich darüber im Klaren, daß seine Erziehung zuweilen unzulänglich gewesen war, und er wollte die Verantwortung gerne abgeben.
Für Shasa war der Botschafterposten in London einer politischen Strafversetzung gleichgekommen. Als Premierminister Hendrik Verwoerd im Jahre 1966 ermordet worden war, hatte Shasa sich ernstlich verkalkuliert und auf den falschen Nachfolger gesetzt. Sobald John Vorster Premierminister war, wurde Shasa auf diesen politisch eher belanglosen Posten abgeschoben – aber er hatte die Niederlage nahezu in einen Triumph verwandelt.
Seine angeborene Geschäftstüchtigkeit, sein gutes Aussehen, sein Charme und seine Überredungskunst waren ihm äußerst nützlich gewesen. Bevor Shasa Botschafter in London geworden war, hatte er viel mit Armscor zu tun gehabt; Vorster hatte ihm nun angeboten, nach seiner Rückkehr Generaldirektor von Armscor zu werden.
Armscor war das größte Industrieunternehmen, das jemals in Afrika existiert hatte. Mit seinem Aufbau hatte das Land auf ein von dem amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower angeordnetes Waffenembargo reagiert, dem sich jetzt rasch weitere Staaten anschlossen, um Südafrika zu schwächen. Armscor faßte die gesamte Rüstungsindustrie des Landes unter einheitlicher Führung zusammen und wurde mit vielen Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt finanziert.
Es war eine gewaltige und verlockende Aufgabe, zumal die weitgefächerten Firmen, aus denen das Finanz- und Handelsimperium der Courtneys bestand, gut geführt wurden. In den drei Jahren seiner Botschaftertätigkeit hatte Shasa die Verantwortung und Geschäftsleitung allmählich seinem Sohn Garry übergeben.
Garry war begabt. Mit erstaunlichem Instinkt, der Shasa oder Centaine Ehre gemacht hätte, hatte er neulich das Ende einer Hausse und den folgenden Kurssturz vorausgesehen. Statt Verluste zu erleiden, hatten die Courtney Enterprises nach dem Crash noch kapitalkräftiger dagestanden und die Gelegenheitskäufe, die der Markt jetzt bot, gelassen wahrnehmen können.
Nein – Shasa schüttelte lächelnd den Kopf –, Garry machte seine Sache ausgezeichnet, und es war nicht in seinem Sinn, ihn verdrängen zu wollen. Andererseits war Shasa fast noch jung – nicht viel über fünfzig. Nach seiner Rückkehr würde er wieder eine Aufgabe brauchen, die ihn geistig und körperlich forderte. Dafür war der Job bei Armscor perfekt.
Natürlich wollte er seinen Sitz im Vorstand des Familienunternehmens behalten, aber selbst dann konnte er den größten Teil seiner Zeit und Energie der Führung von Armscor widmen. Ein Großteil der Zulieferverträge ließ sich an Firmen vergeben, die von den Courtney Enterprises kontrolliert wurden. Von dieser Zusammenarbeit sollten beide Unternehmen profitieren.
Nanny hatte bereits das Modellkleid von Zandra Rhodes herausgelegt und Isabellas Bad einlaufen lassen.
»Sie kommen spät, Miss Bella. Und ich muß Sie noch frisieren.«
»Laß das Getue, Nanny«, protestierte Isabella, aber Nanny schob sie ohne Umstände ins Bad, wie sie’s schon vor zwanzig Jahren getan hatte.
Während Isabella mit einem wohligen Seufzer bis zum Kinn in dem dampfenden Schaum versank, sammelte Nanny ihre ausgezogenen Sachen ein.
»Ihr Rock hat Grasflecken, Kind. Was haben Sie angestellt?« Nanny war immer besorgt.
»Ich hab’ Rugby mit einem Hell’s Angel gespielt, Nanny – unser Team hat dreißig zu null gewonnen.«
»Irgendwann kriegen Sie noch mal richtig Schwierigkeiten. Die Courtneys sind alle heißblütig. Wird allmählich Zeit, daß Sie in feste Hände kommen und heiraten.«
»Erzähl mir lieber, was heute passiert ist. Was ist mit Klonkies neuer Freundin?« Isabella wußte, wie man sie ablenken konnte.
Nanny liebte Tratsch, und sie berichtete Isabella alles, was sich tagsüber ereignet hatte. Isabella hörte nur mit halbem Ohr zu. Als sie aufstand, um sich einzuseifen, begutachtete sie ihren Körper.
»Findest du, daß ich zu dick werde, Nanny?«
»Sie sind zu dünn, darum hat Sie noch keiner geheiratet«, behauptete Nanny und verschwand nach nebenan ins Schlafzimmer.
Isabella bemühte sich, ganz objektiv zu sein, während sie sich betrachtete. Eigentlich war alles gut so. »Ramón de Santiago y Machado«, flüsterte sie, »du wirst nie wissen, was dir entgangen ist.« Weshalb war ihr dabei nur so elend zumute?
»Sie führen schon wieder Selbstgespräche, Kind.« Nanny kam mit einem großen Badehandtuch zurück und hielt es Isabella hin. »Schluß jetzt mit der Planscherei. Wir sind schon zu spät dran.« Sie hüllte Isabella in das Handtuch, als sie aus der Wanne stieg, und begann ihr energisch den Rücken zu frottieren. Es hatte keinen Zweck, Nanny davon zu überzeugen, daß sie sich selbst abtrocknen konnte.
»Nicht so grob!« Das sagte Isabella seit zwanzig Jahren, und Nanny ignorierte ihren Protest auch heute.
»Wie oft bist du verheiratet gewesen, Nanny?«
»Sie wissen genau, daß ich viermal verheiratet gewesen bin – aber nur einmal kirchlich getraut.« Nanny machte eine Pause und betrachtete sie prüfend. »Warum fragen Sie danach?«
»Nein!« Isabella wich ihrem Blick aus, schlüpfte in ihren Morgenrock und ging rasch ins Schlafzimmer hinüber.
Sie griff nach ihrer Haarbürste, aber Nanny nahm sie ihr nach dem ersten Bürstenstrich aus der Hand.
»Das ist meine Aufgabe, Kind«, sagte sie resolut, und Isabella setzte sich, schloß die Augen und gab sich dem vertrauten Genuß hin, daß Nanny ihr die Haare bürstete.
»Weißt du, ich glaube, daß ich mir ein Baby zulege, damit du jemand anderen hast, den du bemuttern kannst, und ich dich endlich los bin.«
Nanny ließ einen Bürstenstrich aus, so gut gefiel ihr diese Idee, aber dann sagte sie streng: »Bevor wir von Babys reden, wird erst mal geheiratet!«
Die Kreation von Zandra Rhodes war ein seidiger Anzug aus Pastellfarben mit Pailletten- und Perlenstickerei. Sogar Nanny nickte mit zufriedener Miene, als Isabella eine Pirouette vor ihr drehte.
Isabella war zu einer letzten Besprechung mit Shasa unterwegs, als sie auf der Treppe stehenblieb. Der spanische Geschäftsträger gehörte auch zu den Dinnergästen des heutigen Abends.
»Ja, natürlich.« Der spanische Geschäftsträger nickte sofort, als sie den Namen erwähnte. »Eine alte andalusische Familie. Soviel ich mich erinnere, hat der Marqués de Santiago y Machado Spanien nach dem Bürgerkrieg verlassen und ist nach Kuba gegangen. Damals haben ihm große Zuckerrohrplantagen gehört, aber ich vermute, daß die Familie unter Castro enteignet worden ist.«
Ein Marqués! Diese Auskunft ließ Isabella sekundenlang verstummen. Von spanischen Adelstiteln hatte sie so gut wie keine Ahnung, aber sie stellte sich vor, ein Marqués rangiere gleich unterhalb eines Herzogs.
»Marquesa Isabella de Santiago y Machado.« Das klang wundervoll! Mit zittriger Stimme fragte sie: »Wie alt ist der Marqués?«
»Oh, der müßte schon älter sein. Ende Sechzig oder Anfang Siebzig.«
»Hat er vielleicht einen Sohn?«
»Tut mir leid, das weiß ich nicht.« Der Diplomat schüttelte den Kopf. »Aber das läßt sich leicht feststellen. Wenn Sie wünschen, ziehe ich einige Erkundigungen für Sie ein.«
»Oh, das wäre sehr liebenswürdig.« Isabella legte ihm ihre Hand auf den Arm und schenkte ihm ihr schönstes Lächeln.
Kapitel 3
»Sie haben fast zwei Wochen gebraucht, um Kontakt aufzunehmen – und als Sie’s endlich geschafft hatten, haben sie ihn gleich wieder abreißen lassen.« Der Mann an der Schmalseite des Tisches drückte seine Zigarette aus und zündete sich sofort eine neue an. Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand waren dunkelgelb verfärbt, und der Qualm der ovalen türkischen Zigaretten, die er unablässig rauchte, füllte den kleinen Raum mit bläulichem Dunst. »Glauben Sie, sich Ihren Anweisungen entsprechend verhalten zu haben?«
Ramón Machado zuckte leichthin mit den Schultern. »Nur so war ihre Aufmerksamkeit zu wecken und zu erhalten. Sie dürfen nicht vergessen, daß diese Frau männliche Bewunderung gewöhnt ist. Sie braucht nur einen Finger zu heben, und schon wird sie von Männern umschwärmt. Ich glaube, daß Sie in dieser Sache auf mein Urteil vertrauen müssen.«
»Sie haben den Kontakt abreißen lassen.« Der Ältere wußte, daß er sich wiederholte, aber dieser Kerl reizte ihn.
Er mochte ihn nicht. Nicht daß er jemals volles Vertrauen zu einem seiner Agenten gehabt hätte, aber dieser war eindeutig zu selbstbewußt. Wo ein anderer wahrscheinlich gezittert hätte, hatte er die Zurechtweisung mit einem Schulterzucken abgetan. Er hatte sein eigenes Urteil unverschämterweise über das eines Vorgesetzten gestellt.
Joe Cicero starrte ihn durchdringend an. Seine Augen waren auffällig dunkel im Gegensatz zu seiner blassen Haut und den silbergrauen Haaren, die ihm strähnig über die Ohren und in die Stirn hingen. »Sie hatten Befehl, Kontakt aufzunehmen und zu halten.«
»Entschuldigung, Genosse Direktor, ich hatte Befehl, mich bei der Frau einzuschmeicheln, aber doch nicht, mich wie ein tollwütiger Hund kläffend auf sie zu stürzen.«
Sein Benehmen war einfach aufreizend, aber das war nicht das einzige. Er war Ausländer. Für Joe Cicero war jeder Nichtrusse ein Ausländer. Auch wenn die angebliche sozialistische Waffenbrüderschaft etwas anderes diktierte, waren in seinen Augen alle gleich: Tschechoslowaken, Ostdeutsche, Jugoslawen, Kubaner, Ungarn und Polen – alles Ausländer. Es brachte ihn auf, die Verantwortung für wesentliche Bereiche der Abteilung, die er fast dreißig Jahre lang geleitet hatte, an andere abgeben zu müssen. Vor allem an Leute dieser Art.
Machado war nicht nur Ausländer, sondern auch durch Herkunft und Abstammung unheilbar korrumpiert. Er war kein Sproß des Proletariats, nicht einmal der verachteten Bourgeoisie, sondern ein Angehöriger jenes verhaßten und überholten Klassen- und Privilegiensystems: ein Aristokrat.
Gewiß, Machado schämte sich seiner Abstammung und benützte seinen Titel heute nur mehr, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber nach Joe Ciceros Überzeugung floß in seinen Adern verdorbenes Blut, und seine aristokratischen Manieren und Vorlieben waren eine Beleidigung all dessen, woran er selbst glaubte.
Außerdem war er in Spanien geboren, einem faschistischen Land, in dem traditionellerweise eine katholische Monarchie herrschte.
»Sie haben sie entwischen lassen«, warf er ihm erneut vor.
»Nachdem Sie soviel Zeit und Geld vergeudet haben.« Er merkte, daß er schwerfällig und wenig einfühlsam reagierte, und war sich bewußt, daß seine Kräfte nachließen. Die Krankheit unterminierte bereits seine geistigen Fähigkeiten.
Ramón lächelte. »Sie hängt wie ein Fisch an der Angel; sie darf nur schwimmen und tauchen, bis ich’s für richtig halte, die Leine einzuholen.«
Damit hatte er seinem Vorgesetzten erneut widersprochen, und Joe Cicero dachte über die letzten, jedoch gewichtigsten Gründe für seine Abneigung gegen diesen Mann nach. Seine Jugend, sein glänzendes Aussehen, seine Gesundheit. Alles erinnerte ihn schmerzlich an seine eigene Sterblichkeit, denn Joe Cicero war todkrank.
Bei seinem letzten Moskauaufenthalt hatten die Ärzte Lungenkrebs diagnostiziert und ihm vorgeschlagen, sich in einem Sanatorium für hohe Offiziere behandeln zu lassen. Aber Joe Cicero hatte es vorgezogen, im Dienst zu bleiben, um seine Abteilung geordnet an einen Nachfolger übergeben zu können. Damals hatte er noch nicht gewußt, daß dieser Spanier sein Nachfolger werden würde. Hätte er davon gewußt, hätte er sich vielleicht fürs Sanatorium entschieden.
Er fühlte sich müde und mutlos. Seine Reserven waren verbraucht. Er konnte kein Dutzend Schritte mehr gehen, ohne wie ein Asthmatiker zu keuchen und zu husten.
In letzter Zeit wachte er immer häufiger nachts auf, rang nach Atem und lag dann in Schweiß gebadet und von schrecklichen Zweifeln geplagt im Dunkeln. Hatte sich dieses pedantische, pflichtbewußte Leben gelohnt? Was hatte er schon vorzuweisen? Auf welche Erfolge konnte er tatsächlich zurückblicken?
Seit fast dreißig Jahren arbeitete er beim KGB in der Afrikaabteilung der Hauptverwaltung IV. Seit einem Jahrzehnt leitete er die für den afrikanischen Kontinent südlich des Äquators zuständige Unterabteilung Süd, was logischerweise dazu geführt hatte, daß er – und mit ihm seine Sektion – sich hauptsächlich auf den fortschrittlichsten und reichsten Staat dieses Gebiets konzentriert hatte: die Republik Südafrika.
Der dritte Mann am Tisch war ein Südafrikaner. Bisher hatte er geschwiegen, aber jetzt sagte er leise: »Ich verstehe nicht, weshalb wir soviel Zeit damit verbringen, über diese Frau zu diskutieren.« Die beiden sahen ihn an. Um Raleigh Tabaka war stets eine Aura von spezieller Intensität, von energiegeladenem Sendungsbewußtsein, das die Aufmerksamkeit anderer fesselte.
Joe Cicero hatte sein Leben lang mit schwarzen Afrikanern, den nationalistischen Führern der Befreiungsbewegungen und des Kampfes um den Sieg des Sozialismus, zusammengearbeitet. Er hatte sie alle gekannt: Jomo Kenyatta und Kenneth Kaunda, Kwame Nkrumah und Julius Nyerere. Einige von ihnen hatte er näher kennengelernt – Männer wie Moses Gama, der den Märtyrertod erlitten hatte, und Nelson Mandela, der noch immer im Gefängnis der weißen Rassisten schmachtete.
Für Joe Cicero gehörte Raleigh Tabaka zu dieser Art Männer. Tatsächlich war Raleigh ein Neffe Moses Gamas. Er war dabei gewesen, als die südafrikanische Polizei ihn ermordet hatte. Er schien Gamas zwingende Persönlichkeit und Charakterstärke geerbt zu haben. Mit nur dreißig Jahren war er bereits stellvertretender Führer des Umkhonto we Sizwe – des »Speers der Nation«, wie der militärische Flügel des African National Congress in Südafrika sich nannte –, und Joe Cicero wußte, daß er sich im Einsatz und in den ANC-Gremien wieder und wieder bewährt hatte. Er besaß die Fähigkeiten, den Mut und die Tatkraft, es weiter zu bringen als jeder andere Afrikaner.
Obwohl Joe Cicero ihn dem weißen spanischen Adligen vorzog, wußte er recht gut, daß die beiden Männer sich trotz unterschiedlicher Abstammung und Hautfarbe sehr ähnlich waren. Harte und gefährliche Männer, an Gewalt und Tod gewöhnt, die von Natur aus für subtile politische Machtkämpfe und Intrigen begabt waren. Das waren die Männer, denen Joe Cicero die Zügel übergeben mußte, und er grollte ihnen und haßte sie deswegen.
»Diese Frau könnte außerordentlich wertvoll sein«, stellte er nachdrücklich fest, »wenn sie geschickt geführt und ihr Potential voll ausgeschöpft wird. Aber das kann der Marqués Ihnen am besten erklären. Dies ist sein Fall, und er hat die Zielperson genau studiert.«
Ramón Machados Blick wurde starr und feindselig.
»Mir wär’s lieber, wenn der Genosse Direktor diesen Titel nicht gebrauchen würde«, sagte er kalt. »Nicht einmal im Scherz.«
Joe Cicero wußte, daß dies so ziemlich die einzige Möglichkeit war, den glatten Panzer des Spaniers zu durchbohren.
»Ich bitte um Entschuldigung, Genosse.« Joe Cicero ließ scheinbar zerknirscht den Kopf hängen. »Aber lassen Sie sich durch meinen kleinen Versprecher nicht von Ihrem Bericht abhalten.«
Ramón Machado schlug den vor ihm auf dem Tisch liegenden Ordner auf, ohne jedoch einen Blick hineinzuwerfen.
»Wir haben der Frau den Decknamen ›Red Rose‹ gegeben und ihr Persönlichkeitsprofil von unseren Psychologen erarbeiten lassen. Alles deutet darauf hin, daß sie sehr empfänglich für eine geschickte Anwerbung sein müßte. In ihrer Position könnte sie eine äußerst wertvolle Agentin werden.«
Raleigh Tabaka beugte sich vor. Ramón konstatierte, daß er zunächst auf Fragen oder Bemerkungen verzichtete, und wußte diese Zurückhaltung zu schätzen. Sie hatten noch nicht eng zusammengearbeitet – dies war erst ihre dritte Begegnung –, und beide waren noch dabei, sich gegenseitig einzuschätzen.
»Red Rose kann in ein emotionales Dilemma gestürzt werden. Durch ihren Vater gehört sie der herrschenden weißen Klasse in Südafrika an. Ihr Vater beendet demnächst seine Tätigkeit als Botschafter seines Landes in Großbritannien und kehrt zurück, um Generaldirektor der nationalen Rüstungsindustrie zu werden. Sein enormer Reichtum beruht auf Bergwerken, Grundbesitz und Finanzbeteiligungen; nach den Oppenheimers und der Anglo-American Company dürfte seine Familie die reichste und einflußreichste Südafrikas sein. Darüber hinaus hat er beste Verbindungen zu den höchsten Kreisen des herrschenden rassistischen Regimes. Wichtiger ist jedoch die Tatsache, daß Red Rose von ihrem Vater angebetet wird. Sie kann alles von ihm haben, was ihr Herz begehrt. Zum Beispiel Zugang zu höchsten Regierungskreisen und Informationen jeglicher Geheimhaltungsstufe – selbst über seine neue Tätigkeit in der nationalen Rüstungsindustrie.«
Raleigh Tabaka nickte. Er kannte die Familie Courtney und hielt die vorgetragene Einschätzung für richtig. »Ich kenne Red Roses Mutter, sie steht auf unserer Seite«, murmelte er.
»Richtig. Shasa Courtney ist seit sieben Jahren von seiner Frau Tara geschieden. Sie ist eine Komplizin Ihres Onkels Moses Gama bei seinem Bombenanschlag auf das weiße Rassistenparlament gewesen, für den er verhaftet und später ermordet worden ist. Außerdem ist sie seine Geliebte gewesen und hat einen unehelichen Sohn von ihm. Nach dem mißlungenen Bombenanschlag ist Tara Courtney mit Gamas Kind aus Südafrika geflüchtet und lebt jetzt in London, wo sie in der Anti-Apartheid-Bewegung aktiv ist. Trotz ihrer Mitgliedschaft im ANC gilt sie als nicht kompetent und emotional stabil genug, um mit mehr als Routineaufgaben betraut zu werden. Gegenwärtig betreibt sie ein Haus für ANC-Mitarbeiter, übernimmt manchmal Kurierdienste oder hilft, Kundgebungen und Demonstrationen zu organisieren.«
»Gut«, sagte Raleigh Tabaka ungeduldig. »Ich kenne die Frau, ich weiß von ihrer Beziehung zu meinem Onkel, aber hat sie wirklich Einfluß auf ihre Tochter? Red Rose scheint doch ganz auf ihren Vater fixiert zu sein?«
Ramón nickte. »Außer ihrer Mutter gibt es ein weiteres Mitglied der Familie, das radikale Ansichten vertritt: ihren Bruder Michael, der ungleich größeren Einfluß auf sie hat. Außerdem gibt es noch andere Mittel, sie gefügig zu machen.«
»Welche denn?« wollte Raleigh wissen.
»Eines davon ist die Honigfalle«, sagte Joe Cicero. »Deshalb hat der Marqués – Entschuldigung! – Genosse Machado ihre Bekanntschaft gesucht. Die Honigfalle ist eine seiner Spezialitäten.«
»Sie halten mich also auf dem laufenden«, stellte Raleigh Tabaka fest, ohne sofort eine Antwort zu bekommen. Obwohl er Mitglied der kommunistischen Partei war und dem Exekutivrat des ANC angehörte, war er im Gegensatz zu den beiden anderen kein KGB- Offizier. Ein Mann wie Joe Cicero handelte stets und in erster Linie als KGB-Offizier, auch wenn seine Beförderung vom Obersten zum Generalmajor erst vor vier Wochen ausgesprochen worden war – gleichzeitig mit der Diagnose der Moskauer Klinik, daß er an einem doppelseitigen Lungenkarzinom leide. Joe Cicero vermutete, er sei lediglich befördert worden, damit er nach lebenslänglichen treuen Diensten mit einer höheren Pension in den Ruhestand gehen könne. Trotzdem stand für ihn fest, daß seine Loyalität vor allem Mütterchen Rußland und dann dem KGB zu gelten habe; folglich erhielt der ANC nur das absolut notwendige Mindestmaß an Informationen.
Ramón Machados Bindungen waren ebenso eindeutig definiert. Er war von Geburt Spanier und trug einen spanischen Adelstitel, aber seine Mutter war eine Kubanerin mit Schlehenaugen und Rabenhaar gewesen. Ramóns Vater hatte sie als junge Haushälterin auf den Besitzungen der Machados in der Nähe der kubanischen Hauptstadt Havanna kennengelernt. Nach der Hochzeit war der Marqués mit seiner schönen bürgerlichen Gattin nach Spanien zurückgekehrt.
Im Bürgerkrieg hatte der Marqués gegen General Francos Nationalisten gekämpft. Trotz seiner adligen Abstammung und des ererbten Reichtums war Ramóns Vater ein aufgeklärter und liberaler Mann. Er ging zur republikanischen Armee, war während der Belagerung Madrids Bataillonskommandeur und wurde schwer verwundet. Nach dem Krieg fand die Familie Machado die Diskriminierung und Unterdrückung durch Francos Regime unerträglich. Die Marquesa überredete ihren Gatten dazu, mit ihr und ihrem kleinen Sohn zu der heimatlichen Karibikinsel zurückzukehren. Obwohl die Machados den größten Teil ihres spanischen Besitzes verloren hatten, besaßen sie noch große Ländereien auf Kuba. Wie sich jedoch bald zeigte, war das Leben unter der Diktatur Fulgencio Batistas kaum besser als unter der Francisco Francos.
Ramóns Mutter war die Tante eines hitzköpfigen kommunistischen Studenten namens Fidel Castro, den sie bewunderte. Sie war in der mit Agitation und Intrigen geführten Kampagne gegen Batistas Regime aktiv, und der junge Ramón verdankte seine ersten politischen Überzeugungen ihr und ihrem gefeierten Neffen.
Nachdem Fidel Castro als Anführer des kühnen, aber fehlgeschlagenen Angriffs am 26. Juli 1953 auf die Kaserne Moncada in Santiago inhaftiert worden war, wurden auch Ramóns Eltern mit den übrigen Rebellen verhaftet.
Ramóns Mutter überlebte die polizeilichen Verhöre in Havanna nicht, und sein Vater starb nur wenige Wochen später im selben Gefängnis an Mißhandlungen und gebrochenem Herzen. Der Besitz der Familie wurde erneut konfisziert, und Ramón erbte nur den ohne Grundbesitz und Geldvermögen wertlosen Titel eines Marqués. Zu seinem Glück nahm die Familie Castro sich des damals Vierzehnjährigen an.
Als Fidel Castro im Zuge einer Amnestie aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging Ramón mit ihm nach Mexiko und gehörte als Sechzehnjähriger zu den ersten Soldaten der kubanischen Befreiungsarmee im Exil.
In Mexiko lernte er erstmals, sein ungewöhnlich gutes Aussehen zu nutzen und seinen natürlichen Charme im Umgang mit Frauen zu perfektionieren. Als er siebzehn war, hatten seine Kameraden ihm den Spitznamen El Zorro Dorado – »Goldfuchs« – gegeben, und sein Ruf als unwiderstehlicher Liebhaber war entstanden.
Ramón gehörte zu den Überlebenden, die sich mit Castro in die Sierra Maestra retteten. In den nun folgenden Jahren des Guerillakampfes wurde El Zorro in Dörfer und Kleinstädte entsandt, um viele Dutzende von Frauen – junge und weniger junge, schöne und weniger ansehnliche – zu umgarnen. In Ramóns Armen wurden sie begeisterte Töchter der Revolution. Mit jeder Eroberung wurde er als Verführer geschickter und selbstbewußter, so daß die von ihm angeworbenen Revolutionärinnen letztlich entscheidend zum Sieg der Revolution und dem Sturz von Batistas Regime beitrugen.
Unterdessen hatte Castro das Potential seines jungen Verwandten und Schützlings erkannt, und sobald er an die Macht gekommen war, belohnte er ihn, indem er ihn zum Studium aufs amerikanische Festland schickte. Während Ramón an der University of Florida Soziologie und Politikwissenschaften studierte, nutzte er die Gelegenheit, um in den Reihen der Exilkubaner zu spionieren, die mit Unterstützung der amerikanischen CIA eine Konterrevolution und die Rückeroberung der Insel planten.
Vor allem durch Ramóns Informationen wurden Ort und Zeitpunkt der Landung in der Schweinebucht im Voraus bekannt, so daß die Invasoren vernichtet werden konnten.
Als er sein Studium an der University of Florida abgeschlossen hatte und nach Havanna zurückkehrte, machte der dortige KGB- Resident Fidel Castro den Vorschlag, ihn zur weiteren Ausbildung nach Moskau zu schicken.
Mit Wissen und Billigung von Fidel Castro wurde Ramón vom KGB angeworben. Wegen seiner Beziehungen war es nur logisch, daß er zum Vorsitzenden eines gemeinsamen Ausschusses für die Koordinierung kubanischer und sowjetischer Interessen in Afrika ernannt wurde.
Als es dann notwendig wurde, als Nachfolger des kränkelnden Generals Cicero einen neuen Leiter der Unterabteilung Süd der Afrikaabteilung zu ernennen, war Ramón wegen seiner Qualifikationen und Erfahrungen der beste Kandidat.
»Sie halten mich also auf dem laufenden«, sagte Raleigh Tabaka. Er würde allerdings nur das erfahren, was er unbedingt wissen mußte. Nach Auffassung Ramóns und seiner Regierung war die Förderung dieses Mannes und der Organisation, die er gern als herrschende Elite Südafrikas hinstellte, lediglich ein Schritt auf dem Weg zum Sieg des Sozialismus in ganz Afrika.
»Selbstverständlich halten wir Sie in dieser Sache wie in Bezug auf alle übrigen Themen von gemeinsamem Interesse stets auf dem laufenden«, versicherte Ramón ihm.
Raleigh Tabaka nahm die eitle Selbstgefälligkeit des Weißen sehr genau wahr, obwohl er sich nichts anmerken ließ. Er arbeitete seit vielen Jahren mit den Russen und Kubanern zusammen und hatte längst begriffen, daß im Umgang mit ihnen nur ein Prinzip absolut gültig war: Ihnen war nicht zu trauen – unter keinen Umständen und nicht einmal, wenn es scheinbar nur um Kleinigkeiten ging.
Er hatte gelernt, Zustimmung zu heucheln und falsche Signale der Befriedigung wie seine bewußte körperliche Entspannung und sein offenes, vertrauensseliges Lächeln auszusenden. Trotzdem vergaß er keine Sekunde lang, daß sie Weiße waren.
»Schön«, sagte er, »dann sind wir uns also einig, daß Sie sich um die Frau kümmern. Damit dürfte das Thema abgeschlossen sein.«
»Augenblick!« Ramón hob abwehrend eine Hand, bevor er sich wieder an Joe Cicero wandte. »Wenn ich bei Red Rose weitermachen soll, stellt sich die Frage der Spesen für dieses Unternehmen.«
»Wir haben doch schon zweitausend Pfund bewilligt«, protestierte der General.
»Die reichen gerade für die ersten Wochen. Das Spesenkonto muß erheblich aufgestockt werden. Red Rose ist die Tochter eines Großkapitalisten, und um ihr zu imponieren, muß ich die Rolle des spanischen Granden weiterspielen.«
Sie diskutierten noch einige Minuten miteinander, während Raleigh Tabaka ungeduldig mit seinem Bleistift auf die Tischplatte klopfte. Als das Aschenbrödel der Hauptverwaltung IV mußten die Afrikaabteilung und ihre Unterabteilungen um jeden Rubel kämpfen.
Würdelos, dachte Raleigh, während er zuhörte, wie die beiden miteinander feilschten. Sie glichen mehr zwei alten Weibern, die am Rande einer staubigen afrikanischen Straße Kürbisse verkauften.
Zuletzt wurden sie sich doch einig, und Raleigh hatte Mühe, sich seine Verachtung nicht anmerken zu lassen, als er wiederholte: »Können wir jetzt die Termine für meine Afrikarundreise besprechen?« Er hatte geglaubt, dies sei der Grund für die heutige Besprechung. »Ist die Genehmigung aus Moskau inzwischen da?«
Die Diskussion dauerte bis in den Nachmittag hinein. Der Qualm von Joe Ciceros Zigaretten verfinsterte das durchs einzige Fenster in den Raum fallende Sonnenlicht.
Schließlich klappte Joe Cicero den vor ihm liegenden Ordner zu und blickte auf. »Damit haben wir alles behandelt, glaub’ ich – oder hat jemand noch was Neues?«
Die beiden anderen schüttelten den Kopf.
»Genosse Machado geht wie üblich als erster«, sagte Cicero. Zu den elementarsten Sicherheitsvorkehrungen gehörte, daß sie niemals miteinander gesehen werden durften.
Kapitel 4
Ramón verließ das Konsulat durch den Eingang zur Visaabteilung im belebtesten Teil des Gebäudes, wo er unter den vielen Studenten und sonstigen Reisenden, die sowjetische Visa beantragten, kaum auffiel.
Direkt vor dem von einer Mauer umgebenen Konsulat befand sich eine Bushaltestelle. Er nahm den Bus, stieg aber bereits an der nächsten Haltestelle aus und eilte durchs Lancaster Gate in die Kensington Gardens. Dort blieb er im Rosengarten, bis er sicher war, daß er nicht beschattet wurde, und durchquerte dann den Park.
Seine Wohnung lag in einer engen Seitenstraße der Kensington High Street. Sie war eigens für das Unternehmen Red Rose angemietet worden, und obwohl sie nur ein Schlafzimmer hatte, war das Wohnzimmer elegant und geräumig.
In den zwei Wochen seit seinem Einzug war es Ramón gelungen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Sein persönlicher Besitz war als Diplomatengepäck aus Kuba nach London transportiert worden. Außer einigen guten Gemälden, die er von seinem Vater geerbt hatte, bestand der Besitz aus einer kleinen Bibliothek und silbergerahmten Photos seiner Eltern, ihres Schlosses in Andalusien und ihrer Plantagen in der Karibik. Die Gläser und das Porzellan waren unvollständig, aber sie trugen das Wappen der Machados. Wie er Red Rose kannte, hatte sie einen Blick für solche Einzelheiten.
Ramón sah auf seine alte Uhr, ein weiteres Familienerbstück, das ihm am Handgelenk ungewohnt war. Er rasierte sich schnell, aber sorgfältig, duschte und spülte sich den Gestank von Joe Ciceros türkischen Zigaretten aus dem Haar.
Auf dem Weg ins Schlafzimmer begutachtete er sich automatisch im Spiegel. Sein Körper war sportlich-schlank, sein Bauch flach, seine Körperbehaarung lockig schwarz. Diese Musterung im Spiegel geschah ganz ohne Eitelkeit. Gesicht und Körper war für ihn lediglich Mittel zum Zweck. Ramón machte sich keine Illusionen über die Vergänglichkeit körperlicher Attribute – aber er bemühte sich, sich zu pflegen.
»Morgen wird trainiert!« versprach er sich. Mehrere Stunden Training pro Woche würden ihn in Form halten, damit er das Unternehmen Red Rose durchstehen konnte.
Zur Reithose aus schräggeripptem Kavalleriecord trug Ramón ein salbeigrünes Trevirahemd mit grüner Krawatte unter seiner Reitjacke aus Harris-Tweed. Seine Reitstiefel saßen wie eine zweite Haut, und das eingefettete Leder bildete bei jeder Bewegung völlig gleichmäßige Falten über seinen Knöcheln. Dieser Effekt ließ sich weder durch Geld noch durch Handwerkskunst, sondern nur durch jahrelange liebevolle Pflege erzielen.
Er wußte, daß Red Rose eine begeisterte Reiterin war; in ihrem Leben spielten Pferde eine wichtige Rolle. Sie würde diese Stiefel als Zeichen der Mitgliedschaft in der exklusiven Elite erkennen, der sie selbst angehörte.
Ramón sah nochmals auf seine Uhr; keine Minute zu spät.
Er sperrte seine Wohnungstür ab und verließ das Haus. Die Regenwolken, die nachmittags drohend am Himmel gestanden hatten, hatten sich aufgelöst, was einen herrlichen Sommerabend versprach.
Der Reitstall befand sich in einer engen Seitengasse hinter der Gardekaserne. Der Stallmanager erkannte ihn sofort. Während Ramón sich eintrug, las er die vorigen Eintragungen und sah, daß er wieder einmal Glück hatte. Red Rose hatte ihr Pferd erst vor zwanzig Minuten abgeholt.
Er ging zu den Ställen hinüber, wo sein eigenes Pferd gesattelt bereitstand – eine Fuchsstute, die Ramón sorgfältig ausgewählt und mit 500 Pfund von seinem Spesenkonto gekauft hatte. Er prüfte Sattel und Zaumzeug, sprach beruhigend auf die Stute ein, dankte dem Stallknecht mit einem Nicken und schwang sich in den Sattel.
An einem Abend wie diesem tummelten sich etwa fünfzig weitere Reiter auf dem Platz an der Rotten Row. Ramón ließ die Stute unter den Eichen im Schritt gehen, während Gruppen von Reitern in beiden Richtungen vorbeitrabten. Red Rose war bisher nirgends zu sehen.
Sobald die Stute etwas warm geworden war, ließ er sie antraben.
An der Park Lane wendete Ramón und ließ die Stute schneller traben; Galopp war verboten. In etwa hundert Metern Entfernung kam ihm eine Vierergruppe entgegen: zwei Paare, elegant gekleidete und berittene junge Leute, und Red Rose hob sich von ihnen ab wie ein Kolibri von einem Spatzenschwarm.
Unter ihrer Reitkappe wallte ihr Haar wie Rabenschwingen hervor und glänzte im milden Abendsonnenschein. Als sie lachte, blitzten ihre Zähne auf, und ihr Teint war von der frischen Luft und dem Wind zartrosa.
Ramón erkannte den neben ihr reitenden Mann. In den zwei Wochen, die er Red Rose nun schon beobachtete, hatte er sie fast ständig begleitet. Ramón hatte Auskünfte über ihn eingeholt. Er war der zweite Sohn einer ungeheuer reichen Braudynastie: ein verweichlichter Playboy des Typs, den die vornehme Londoner Gesellschaft als »Deb’s Delight« oder »Hooray Henry« kannte. Er hatte Red Rose vor vier Tagen zum Konzert der Rolling Stones begleitet und seither weitere zwei Abende auf einem halben Dutzend Parties in Chelsea und Knightsbridge mit ihr verbracht.
Ramón war aufgefallen, daß sie ihn mit einer Art amüsierter Herablassung behandelte, als sei er ein übermäßig liebebedürftiger Bernhardinerwelpe, und an diesen Abenden nur mit ihm allein gewesen war, wenn er sie mit seinem MG von einer Party zur anderen gefahren hatte. Er glaubte zu wissen, daß die beiden nicht miteinander schliefen, was im Sommer 1969 ungewöhnlich war.
Er wußte natürlich auch, daß Isabella Courtney keine Heilige war. In den drei Jahren, die sie jetzt in Highveld lebte, hatte sie nachweislich mindestens drei explosive, wenn auch kurzlebige Affären gehabt.
Als der Abstand sich verringerte, konzentrierte Ramón sich auf sein Pferd und beugte sich nach vorn, um der Stute den Hals zu tätscheln. Er sprach leise auf Spanisch mit ihr, während er Red Rose unter den Augenbrauen hervor beobachtete. So mußte sie glauben, er sehe sie gar nicht, während ihm in Wirklichkeit nichts entging.
Sie waren schon fast aneinander vorbei, als die junge Frau ruckartig den Kopf hob und große Augen bekam. Ramón ignorierte sie jedoch und ritt weiter.
»Ramón!« Ihr Ruf war laut und befehlend. »Warten Sie!«
Er zügelte sein Pferd und sah sich mit leicht irritiertem Stirnrunzeln um. Red Rose hatte gewendet und ritt hinter ihm her. Ramón machte weiter ein reserviertes, leicht frostiges Gesicht, als sei ihm ihre flüchtige Bekanntschaft unangenehm.
Isabella holte ihn ein und zügelte ihr Pferd, bis es neben seinem im Schritt ging. »Erinnern Sie sich nicht an mich? Isabella Courtney. Sie sind mein Retter gewesen.« Ihr Lächeln war untypisch verlegen. Männer erinnerten sich stets an sie – auch wenn ihre letzte Begegnung nur flüchtig gewesen war oder schon lange zurücklag. »Beim Konzert im Park«, schloß sie unbeholfen.
»Ah!« Ramón lächelte endlich strahlend. »Das Motorradmaskottchen. Ich bitte um Entschuldigung. Da sind Sie etwas anders angezogen gewesen.«
»Sie haben nicht gewartet, damit ich mich bedanken konnte«, sagte sie vorwurfsvoll. Sie mußte sich beherrschen, um vor Erleichterung darüber, daß er sie endlich erkannt hatte, nicht laut zu lachen.
»Sie brauchten sich nicht zu bedanken. Außerdem hatten Sie Dringenderes zu erledigen, wenn ich mich recht erinnere.«
»Sind Sie allein da?« Sie wechselte rasch das Thema. »Wollen Sie sich nicht uns anschließen? Ich möchte Sie mit meinen Freunden bekannt machen.«
»Oh, ich will Ihnen keine Umstände machen.«
»Bitte!« drängte Isabella. »Sie werden Ihnen gefallen; sie sind wirklich amüsant.«
Ramón verbeugte sich leicht im Sattel. »Wie könnte ich eine so freundliche Einladung einer so schönen Frau ablehnen?« stimmte er zu, und Isabella fühlte sich, als umschließe ein Schraubstock ihre Brust. Sie konnte kaum atmen, während sie in die grünen Augen dieses finsteren Engels blickte.
Die anderen drei hatten angehalten und warteten auf sie. Noch bevor Isabella ganz heran war, sah sie bereits, daß Roger ein mürrisches Gesicht machte. Mit einem Anflug von Rachsucht genoß sie es um so mehr, jetzt sagen zu können: »Roger, darf ich dich mit dem Marqués de Santiago y Machado bekannt machen? Ramón, das ist Roger Coates-Grainger.«
Isabella sah, daß Ramón ihr einen fragenden Blick zuwarf, und merkte erst dann, daß die Nennung seines Titels ein Faux-pas gewesen war, weil sie ihn eigentlich noch gar nicht kennen konnte.
Ihr flüchtiges Unbehagen war jedoch vergessen, als sie ihn Harriet Beauchamp vorstellte und beobachten konnte, wie ihre Freundin auf ihn reagierte. Harriet war Isabellas beste Freundin in London, was eher auf symbiotische Vorteile als auf echte Freundschaft zurückzuführen war. Lady Harriet war Isabellas Eintrittskarte in die wirklich feine Londoner Gesellschaft. Als Tochter eines Earls war sie dort willkommen, wo Isabella trotz ihres Geldes und ihrer Schönheit nur als neureiche Ausländerin mit komischem Akzent gegolten hätte. Harriet hatte ihrerseits beobachtet, daß Isabella Courtney stets und überall von Männerhorden umlagert war. Unter Harriets molliger, unscheinbarer, farblos blonder Erscheinung verbarg sich eine unersättliche Liebhaberin, und Isabella war gern bereit, ihr einige Verehrer abzutreten.
Im Allgemeinen funktionierte diese Übereinkunft bestens, aber Ramón war kein abgelegter Verehrer, zumindest vorläufig noch nicht. Deshalb brachte Isabella geschickt ihr Pferd zwischen die beiden und funkelte Harriet eine stumme Warnung zu. Harriet fühlte sich sehr geschmeichelt. Sie wußte recht gut, daß sie für Isabella niemals eine Konkurrenz sein konnte, aber als Rivalin behandelt zu werden war schmeichelhaft.
»Marqués?« murmelte Ramón, als sie weiterritten. »Sie wissen viel mehr über mich als ich über Sie.«
»Oh, ich muß Ihr Bild in einer der Klatschspalten gesehen haben«, antwortete Isabella etwas von oben herab, während sie dachte: Mein Gott, hoffentlich glaubt er nicht, daß ich mich so sehr für ihn interessiert habe, daß ich mich erkundigt habe.
»Ah, bestimmt im ›Tatler‹«, nickte Ramón. Dabei existierte nirgends ein Photo von ihm – außer vermutlich in den Akten der CIA und bei einigen weiteren Geheimdiensten in aller Welt.
»Richtig, im ›Tatler‹, dort muß ich’s gesehen haben.« Isabella nutzte dankbar diesen Ausweg, den er ihr gewiesen hatte. Dann machte sie sich daran, ihn zu umgarnen, ohne ihr Interesse allzu deutlich auszudrücken oder ihm damit lästig zu werden. Das war einfacher, als sie erwartet hatte. Ramón besaß einen legeren Charme, ein Savoir-vivre, das ausgezeichnet zu ihrer Gruppe paßte. Schon bald schwatzten und lachten sie miteinander wie alte Freunde – bis auf Roger, der zusehends mürrischer wurde.
Als sie bei einsetzender Dämmerung zum Stall zurückkehrten, ritt Isabella dicht neben Harriet her und zischte ihrer Freundin zu: »Lad ihn für heute abend zu deiner Party ein!«
»Wen?« Harriet riß ihre blaßblauen Augen auf und spielte die Ahnungslose.
»Du weißt genau, wen ich meine, du Hexe! Glaubst du vielleicht, ich hätte nicht gemerkt, wie du ihn angehimmelt hast?«
Kapitel 5
Lady Harriet Beauchamp hatte das Stadthaus ihrer Familie in Belgravia ganz für sich, wenn ihre Eltern auf dem Lande waren. Ihre Parties gehörten zu den heißesten der ganzen Stadt.
An diesem Abend kreuzte das Ensemble des Erfolgsmusicals »Hair« nach der Vorstellung fast vollzählig auf. Die Schauspieler waren geschminkt und trugen ihre Bühnenkostüme, und eine Band aus Jamaika, die Harriet engagiert hatte, spielte sofort eine Calypsoversion von »Aquarius«.
Die Party versprach, äußerst turbulent zu werden. Zwischendrin verschwanden Paare in den oberen Schlafzimmern. Isabella fragte sich, was Harriets Vater, der zehnte Earl, wohl von den Besuchern in seinem Himmelbett gehalten hätte.
Sie wartete ab, auf halber Höhe der geschwungenen Marmortreppe sitzend, die Haustür und zugleich die Ereignisse im Ballsaal und im Salon im Auge behaltend.
Tanzen mochte sie nicht, obwohl sie immer wieder dazu aufgefordert wurde. Sie hatte Roger Coates-Graingers schwerfällige Aufmerksamkeiten und seichten Humor so entschieden abgewehrt, daß er beleidigt in Richtung Champagnerbar abgezogen war. Wahrscheinlich ist er schon besoffen, überlegte sie sich.
Keiner der Gäste hatte Lust, noch woanders hinzugehen. Die zweiflüglige Teakholztür öffnete sich nur, um weitere Gäste einzulassen, und der Lärm und das Gedränge wurden von Minute zu Minute schlimmer.
Eine weitere Gruppe kam lärmend herein, und Isabellas Laune besserte sich schlagartig, als sie im Gedränge einen dunklen Lockenkopf sah. Aber sie merkte fast augenblicklich, daß dieser Mann zu klein war.
Wie um Buße zu tun, hatte sie sich den ganzen Abend lang mit einem einzigen Kelch Champagner begnügt. Sie sah sich nach Roger um, aber der tanzte gerade mit einer Frau, die ihn anhimmelte. Sie hatte ein grauenhaftes Lachen.
Puh, ist die schlimm! dachte Isabella. Und Roger sieht wie ein Trottel aus.
Sie warf einen Blick auf die französische Porzellanuhr über der Tür zum Salon, stellte fest, daß es zwanzig vor eins war, und seufzte.
Morgen um halb eins gab Daddy ein wichtiges Mittagessen für einflußreiche Abgeordnete der konservativen Partei und ihre Ehefrauen. Wie üblich fiel Isabella dabei die Rolle der Gastgeberin zu.
Sie hätte heimfahren sollen, um ausgeschlafen zu sein, aber sie konnte sich noch nicht losreißen.
Wo zum Teufel steckt er? dachte sie. Er hat mir versprochen, daß er kommt! Tatsächlich hatte er gesagt, er werde versuchen, später kurz vorbeizuschauen. Und sie hatten so glänzend harmoniert, daß es praktisch wie ein Versprechen war.
Sie lehnte eine weitere Aufforderung zum Tanzen ab, ohne auch nur den Kopf zu heben.
»Ich warte keine Minute länger als bis ein Uhr«, versprach sie sich. »Das ist mein letztes Wort!«
Dann schien ihr Herz einen Augenblick lang stillzustehen, bevor es ihr bis zum Hals schlug. Die Musik klang plötzlich heiterer, der Lärm und das Gewühl wirkten nicht mehr bedrückend, ihre trübe Stimmung verflog, und sie fühlte sich von einer Woge aus Erregung und wilder Vorfreude getragen.