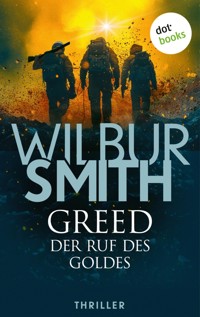
9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nichts treibt Männer so sehr zu Verrat wie Gold … 3000 Meter unter der Erde kann dich ein einziger Fehler das Leben kosten … Als erfahrener Manager der »Sonder Ditch Goldmine«, einem der größten Betriebe Südafrikas, trägt Rod Ironsides viel Verantwortung: Hier verrichten seine Männer Tag und Nacht gefährliche Arbeit, um tief im Herzen der Erde nach Gold zu schürfen. Als ihm der Besitzer der Mine, der skrupellose Manfred Steyner die Chance seines Lebens anbietet, ahnt Rod noch nicht, dass dies einen Preis hat, den er vielleicht nicht zahlen kann … Doch ein Mann wird an seinen Taten gemessen, und als es zu einer schrecklichen Katastrophe in der Goldmine kommt, muss Rod beweisen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist … »Unglaublich lesenswert … Voller Intrigen, Romantik, Gier, Grausamkeit und rasanter Action.« El Paso Herald-Post Der packende Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes« von Bestseller-Autor Wilbur Smith wird alle Fans von Clive Cussler begeistern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
3000 Meter unter der Erde kann dich ein einziger Fehler das Leben kosten … Als erfahrener Manager der »Sonder Ditch Goldmine«, einem der größten Betriebe Südafrikas, trägt Rod Ironsides viel Verantwortung: Hier verrichten seine Männer Tag und Nacht gefährliche Arbeit, um tief im Herzen der Erde nach Gold zu schürfen. Als ihm der Besitzer der Mine, der skrupellose Manfred Steyner die Chance seines Lebens anbietet, ahnt Rod noch nicht, dass dies einen Preis hat, den er vielleicht nicht zahlen kann … Doch ein Mann wird an seinen Taten gemessen, und als es zu einer schrecklichen Katastrophe in der Goldmine kommt, muss Rod beweisen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist …
eBook-Neuausgabe August 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1970 unter dem Originaltitel »Gold Mine« bei William Heinemann Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Goldmine« bei Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft mbH, Wien und Darmstadt.
First published in 1970 by William Heinemann Limited
Copyright © Wilbur Smith 1970
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1989 Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft mbH, Wien und Darmstadt
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Fernando Cortes und shutterstock/piyaphong, Barock , Ljupco Smorovski
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-98952-664-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Greed – Der Ruf des Goldes
Thriller
Aus dem Englischen von Claus Velmeden
dotbooks.
Kapitel 1
Obwohl der Ventilator in der Ecke Windstöße von sich gab, war es stinkheiß in Rod Ironsides’ Büro.
Er langte nach der versilberten Thermosflasche mit eisgekühltem Wasser am Rand des Schreibtischs, hielt jedoch in der Geste inne, weil die Flasche zu tanzen anfing, ehe er sie noch fassen konnte. Sie hüpfte über die polierte Holzfläche. Der Schreibtisch selbst schwankte, und die Papiere darauf raschelten. Auch die Wände des Zimmers zitterten, und die Fenster klapperten in ihren Rahmen. Vier Sekunden lang dauerte das Beben, dann wurde es wieder still.
»Mein Gott!« murmelte Rod und nahm den Hörer eines der drei Telefone ab. »Hier ist der Direktor im Untertagebau. Geben Sie mir das Gesteinslaboratorium, aber machen Sie fix, mein Guter.« Ungeduldig trommelte er mit seinen Fingern auf den Schreibtisch, während er auf die Verbindung wartete.
Die Tür zum nächsten Zimmer wurde geöffnet, und Dimitri steckte seinen Kopf herein. »Hast du das gemerkt, Rod? Das war ’ne schlimme Sache.«
»Ich hab’s gemerkt.«
Dann tönte es aus dem Apparat: »Hier Dr. Wessels.«
»Peter, ich bin’s – Rod. Hast du das eben mitbekommen?«
»Ich hab’ mir noch kein Bild machen können. Wartest du einen Moment?«
»Ja.« Rod zügelte seine Ungeduld. Er wußte, daß Peter Wessels der einzige war, der die vielen komplizierten elektronischen Geräte im Instrumentenraum des Laboratoriums richtig zu handhaben wußte. Das Laboratorium war ein gemeinschaftliches Forschungszentrum der vier bedeutendsten Goldminengesellschaften. Sie hatten eine Viertelmillion Rand ausgegeben, um das Gestein und die seismischen Bewegungen unter Druck fachmännisch zu untersuchen. Das Gebiet der Sonder Ditch Gold Mining Company war zum Standort des Laboratoriums ausgewählt worden. Nun hauste Peter Wessels mit seinen Mikrofonen Hunderte von Metern tief unter der Erde. Seine Tonbandgeräte und Meßapparate zeichneten jede Störung auf.
Wieder verging eine Minute. Rod drehte sich in seinem Sessel um und starrte durch die Spiegelglasscheibe auf den monströsen Turm von Schacht 1, der so hoch war wie ein zehnstöckiges Gebäude. »Los, Peter, los, mein Junge«, murmelte er vor sich hin. »Ich hab’ zwölftausend meiner Leute da unten.«
Immer noch mit dem Hörer am Ohr blickte er auf seine Uhr. »Halb drei Uhr«, murmelte er. »Die denkbar schlechteste Zeit. Sie werden noch in den Stollen sein.« Dann hörte er, wie am andern Ende der Hörer aufgenommen wurde.
Die Stimme von Peter Wessels klang fast entschuldigend. »Rod?«
»Ja.«
»Es tut mir leid, Rod. Auf Sektion Sugar sieben Charlie zwei hast du in fast dreitausend Meter Tiefe eine Explosion Stärke sieben.«
»Mein Gott!« rief Rod und warf den Hörer auf die Gabel. Im nächsten Augenblick war er mit finsterem Gesicht von seinem Schreibtisch aufgesprungen. »Dimitri!« bellte er seinen Assistenten an, der noch immer unter der Tür stand. »Höchste Gefahr! Wir dürfen nicht abwarten, bis sie uns rufen. Eine Explosion Stärke sieben! Der Kern liegt mitten in unserem östlichen Abbau auf Sohle fünfundneunzig.«
»Heilige Mutter Gottes«, sagte Dimitri und schoß in sein Büro zurück. Er beugte seinen schwarzen Lockenkopf über das Telefon, und Rod hörte ihn sprechen: »Das Minenkrankenhaus ... den Rettungsdienst ... den Chef des Bewetterungsbüros ... das Büro des Generaldirektors ...«
Rod wandte sich um, als die Außentür seines Büros aufgemacht wurde und Jimmy Paterson, sein Elektroingenieur, eintrat.
»Wie steht’s, Rod?«
»Schlecht.«
Dann drängten die übrigen Sektionschefs ins Zimmer. Sie unterhielten sich gedämpft, steckten Zigaretten an, husteten und scharrten mit den Füßen. Alle schauten nach dem weißen Telefon auf Rods Schreibtisch. Die Minuten schlichen wie lahme Insekten dahin.
»Dimitri!« schrie Rod, damit sich die Nervosität legte. »Hast du einen Förderkorb am Schacht?«
»Sie halten die Mary Anne für uns bereit.«
»Fünf meiner Männer prüfen das Hochspannungskabel auf Sohle fünfundneunzig«, warf Jimmy Paterson ein, doch achtete niemand auf ihn. Alle starrten auf das weiße Telefon.
»Hast du schon den Boss ausfindig gemacht, Dimitri?« fragte Rod, der vor seinem Schreibtisch hin und her marschierte. Erst wenn er neben den andern Männern stand, sah man, wie groß er war.
»Er ist unter Tage. Um halb eins ist er ’runtergefahren.«
»Gib allen Sektionen Bescheid, daß er Kontakt mit mir aufnimmt.«
»Das hab’ ich schon getan.«
Das weiße Telefon schrillte.
Eine Sekunde lang zerrte das Geräusch an Rods Nerven. Dann drückte er den Hörer ans Ohr. Erst nach einer Weile konnte er in der Ferne das Schnaufen eines Mannes vernehmen. »Sprechen Sie doch, Mann! Was ist passiert?«
»Der ganze verdammte Kram ist eingestürzt«, keuchte die Stimme. Sie war heiser und rauh – vom Schrecken und vom Staub.
»Von wo aus reden Sie denn?« fragte Rod.
»Sie sind noch unten drin«, fuhr die Stimme fort. »Sie schreien. Unter dem Gestein. Sie schreien.«
»In welcher Sektion sind Sie?« Rod sprach kalt und hart, um den Schock des Mannes zu überwinden.
»Der ganze Stollen ist über ihnen zusammengebrochen. Das ganze verfluchte Zeug.«
»Zum Teufel mit Ihnen! Sie dummer Scheißkerl!« brüllte Rod in den Apparat. »Sagen Sie mir endlich, in welcher Sektion Sie sind!«
Einen Moment herrschte verblüfftes Schweigen. Dann war der Mann wieder zu hören. Diesmal war sein Ton fester. Offenbar ärgerte er sich über die Beleidigung.
»Sohle fünfundneunzig, Hauptförderung, Sektion dreiundvierzig, östlicher Abbau.«
»Wir kommen.« Rod legte auf, nahm seinen gelben Helm aus Fiber und die Lampe vom Tisch.
»Tote?« erkundigte sich der kleine Grieche.
»Ganz sicher. Unter dem Gestein hören sie Schreie.«
Rod setzte den Helm auf. »Kümmere dich um den Übertagedienst, Dimitri.«
Kapitel 2
Rod war noch mit dem Zuknöpfen seines weißen Overalls beschäftigt, als er den Schacht erreichte. Automatisch las er über dem Eingang die Worte: »Seid wachsam! Bleibt am Leben! Dank eurer Zusammenarbeit hat diese Mine sechzehn Tage lang ohne Todesfälle gearbeitet.«
Wir werden die Zahl ändern müssen, dachte Rod grimmig.
Die Mary Anne wartete. In den Eisenkäfig schoben sich die Männer der Unfallstation und des Notdienstes. Dieser kleine Förderkorb war nur für das Personal bestimmt. Zwei andere – viel größere – konnten hundertzwanzig Mann aufnehmen. In der Mary Anne fanden lediglich vierzig Menschen Platz. Das genügte jetzt.
»Los«, sagte Rod und stieg hinein.
Die stählernen Rolltüren schlossen sich, die Glocke ertönte zweimal, der Boden sank unter ihm weg, als der Korb in die Tiefe glitt. Rod fühlte, wie sich sein Magen gegen die Rippen preßte. Ununterbrochen sausten sie in die Düsternis hinunter. Die Mary Anne knarrte und lärmte, die Luft roch und schmeckte bald nach Chemikalien, es wurde heiß. Rod stand mit eingezogenem Kopf an der Wand. Der Käfig war kaum höher als einen Meter achtzig, so daß er mit dem Helm nicht aufrecht stehen konnte. »Also kriegen wir heute mal wieder ’ne blutige Rechnung serviert«, sagte er sich wütend.
Er war jedesmal wütend, wenn die Erde ihren Tribut an zerstückeltem Fleisch und zerbrochenen Knochen verlangte. Alles Geschick der Menschen und die während sechzig Jahren unterirdischen Abbaus in Witwatersrand gesammelten Erfahrungen wurden eingesetzt, um den Blutzoll so niedrig wie möglich zu halten. Doch wer sich in zwei- oder dreitausend Meter Tiefe begab, um dort eine Viertelmillion Tonnen Felsgestein im Monat loszuschlagen, wer in den niedrigen und schrägen Quarzgängen nach Gold schürfte – der mußte auch dafür bezahlen. Denn der Druck im Fels verstärkt sich bis zur Belastungsgrenze, dann stürzen die Stollen ein, und es gibt Tote.
Rod krümmte die Knie, als der Korb langsamer sank und in der hellerleuchteten Sektion auf Sohle 66 hielt. Rasselnd ging die Tür auf, und Rod schritt den Hauptfördergang entlang, der so breit war wie ein Eisenbahntunnel. Man hatte ihn zementiert und gekalkt. An der Decke baumelten Glühbirnen. In sanfter Krümmung verlor er sich in der Ferne.
Die Leute vom Rettungsdienst folgten ihm. Sie rannten nicht, aber sie gingen mit der mühsam unterdrückten Nervosität von Männern, die sich einer Gefahr nähern. Rod führte sie zu einem weiteren Schacht, der noch tiefer ins Erdreich gebohrt worden war. Man kann einen Schacht, in dem an Stahlseilen hängende Körbe Lasten hinauf- und hinunterbefördern, nur bis zu einer gewissen Tiefe ins Gestein treiben. Die Grenze liegt bei etwa zweitausend Metern. Dort muß man von neuem beginnen: Raum für eine Kopfstation aus dem gewachsenen Felsen sprengen und von hier aus einen noch tiefer ins Erdinnere führenden Schacht anlegen.
Dort wartete schon der nächste Korb auf sie. Die Männer standen innen Schulter an Schulter. Die Tür wurde zugeknallt, und mit einem Stoß, der die Eingeweide hob, jagten sie in die Finsternis hinab. Tiefer und tiefer.
Rod knipste die Stirnlampe auf seinem Helm an. Jetzt flogen Staubteilchen durch die Luft – durch eine Luft, die vorher absolut rein gewesen war.
Staub! Einer der Todfeinde aller Bergleute. Staub, den die Explosion aufgerührt hatte. Jetzt war das Bewetterungssystem nicht mehr imstande, die Luft zu reinigen.
Die Fahrt schien kein Ende zu nehmen. Bald war es so heiß, daß der perlende Schweiß auf den Gesichtern der Arbeiter rings um ihn glänzte. Dann wurde der Staub immer dichter. Einer hustete. Die hellerleuchteten Stationen glitten an ihnen vorüber: 76, 77, 78. Sie schossen immer tiefer. Dann glich der Staub einem feinen Nebel. 85, 86, 87. Keiner hatte bisher gesprochen. 93, 94, 95. Die Geschwindigkeit ließ nach. Endlich hielt der Korb.
Klirrend sprang die Tür auf. Sie waren beinahe dreitausend Meter unter der Erde.
»Los, kommt!« befahl Rod.
Kapitel 3
Hundertfünfzig, vielleicht auch zweihundert Männer drängelten sich in der Vorhalle der Station 95. Sie waren noch schmutzig von der Arbeit in den Stollen. Ihre Kleidung war verschwitzt. Aber sie lachten und schwatzten mit der Erleichterung von Leuten, die soeben einer fürchterlichen Gefahr entronnen waren.
Mitten in der Halle waren fünf Bahren abgestellt. Auf zweien hatte man hellrote Decken über die Gesichter der darauf liegenden Männer gezogen. Die Gesichter der drei andern sahen aus, als seien sie mit Mehl bestäubt.
»Zwei«, knurrte Rodney. »Bis jetzt.«
In der Station herrschte ein wüstes Durcheinander. Männer irrten ziellos umher. Mit jeder Minute kamen weitere aus unbeschädigten Stollen, die jetzt aber doch als gefährdet galten.
Rod blickte sich um und erkannte einen seiner Obersteiger. »McGee«, schrie er. »Schaffen Sie hier Ordnung. Die Leute sollen sich in Reihen niedersetzen, bis sie verladen werden. Wir wollen die Schicht sofort hinaufschaffen. Gehen Sie in den Förderraum. Sagen Sie ihnen dort, ich möchte zuerst die Männer auf den Bahren hochgebracht haben.«
Er wartete, bis McGee seine Anweisungen befolgt hatte. Dann sah er auf die Uhr. Es war vierzehn Uhr sechsundfünfzig. Mit Erstaunen begriff er, daß erst sechsundzwanzig Minuten vergangen waren, seit er die Explosion in seinem Büro gespürt hatte.
»In Ordnung«, meinte Rod. »Kommt.« Und er führte seine Hilfsmannschaft in die Förderstrecke.
Der Staub war dick. Er mußte husten. Die Hängende Wand war hier niedriger. Während er mühsam weiterstapfte, sann er über die verhängnisvolle Wortwahl der Grubenarbeiter nach, die das Dach einer Ausschachtung »Hängende Wand« nannten. Das ließ an einen Galgen denken. Jedenfalls erinnerte es an die Tatsache, daß einem Millionen Tonnen Gestein über dem Kopf hingen.
Die Strecke verzweigte sich, und Rod schlug untrüglich den richtigen Weg ein, denn sein Gedächtnis enthielt eine exakte dreidimensionale Karte des fast dreihundert Kilometer langen Tunnelsystems der Sonder-Ditch-Gruben. Plötzlich kamen sie zu einer Tförmigen Gabelung. Diese beiden Gänge waren noch niedriger und enger. Zur Rechten lag Sektion 42, zur Linken 43. Die Staubwolken waren nun so dicht, daß sie nur noch drei Meter weit sehen konnten. Der Staub hing in der Luft und sank kaum wahrnehmbar herab.
»Die Bewetterung ist kaputt«, rief Rod über die Schultern. »Van den Bergh!«
»Ja, Sir.« Der Leiter des Notdienstes trat näher.
»Ich brauche frische Luft in diesem Gang. Machen Sie sich an die Arbeit. Nehmen Sie die Segeltuchleitung, wenn es sein muß.«
»Gut.«
»Dann will ich Wasserschläuche haben, die diesen Dreck hier auf die Erde kleben.«
»Gut.«
Rod wandte sich wieder um. Der Boden war rauh, und das Gehen fiel schwer. Dann stießen sie auf mehrere Förderwagen, die mit goldhaltigem Quarz gefüllt waren und verlassen im Gang standen. »Zum Teufel, schafft das Zeug aus dem Weg!«
Nach fünfzig Schritten hielt er inne. Die Haare auf seinen Unterarmen richteten sich in die Höhe. Nie konnte er sich an diese Laute gewöhnen, so oft er sie auch schon gehört hatte.
In dem bewußt abgebrühten Jargon der Grubenarbeiter hießen sie die »Winsler«. So winselte ein Mann, wenn auf seinen Beinen die Last von hundert Tonnen schwerem Fels lag und dessen Rückgrat vielleicht gebrochen war. Ein Mann, den der Staub zu ersticken drohte und dessen Geist von der Todesangst zerrüttet wurde. In seiner Falle rief er um Hilfe. Er flehte Gott an. Er schrie nach seiner Frau, nach seinen Kindern oder nach seiner Mutter.
Rod ging weiter. Das Schreien wurde lauter. Es war ein schreckenerregendes Schreien, kaum noch menschlich, ein Seufzen und Stammeln, das jäh verstummte, bis der Mann von neuem aufheulte, so daß einem das Blut in den Adern gerann.
Plötzlich erblickte Rod vor sich im Staubnebel die Schatten von Männern. Ihre Grubenlampen warfen grotesk verzerrte Lichtstreifen ins Halbdunkel.
»Wer ist da?« rief Rod.
»Gott sei Dank, daß Sie gekommen sind, Mr. Ironsides.«
»Wer ist da?«
»Barnard.« Der Schichtführer von Sektion 43.
»Was ist passiert?«
»Die ganze Hängende Wand des Stollens ist zusammengekracht.«
»Wie viele Leute waren im Stollen?«
»Zweiundvierzig.«
»Wie viele sind noch drin?«
»Bis jetzt haben wir sechzehn heil herausgeholt, zwölf leicht Verletzte, drei, die auf Bahren gelegt werden mußten, und zwei Tote.«
Wieder fing der Winsler an, aber jetzt klang seine Stimme schon viel schwächer.
»Und wer ist das?« fragte Rod.
»Ihm sind zwanzig Tonnen Fels auf das Becken gestürzt. Ich habe ihm zwei Morphiumspritzen verpaßt, aber sie helfen ihm nicht.«
»Können Sie in den Stollen hinein?«
»Ja. Es ist ein Loch zum Durchkriechen da.« Barnard beleuchtete den Haufen blauen Quarzes, der den Gang wie eine zusammengebrochene Gartenmauer schloß.
Licht schimmerte durch das Loch. Sie vernahmen knirschende Geräusche und gedämpfte Stimmen.
»Wie viele Leute arbeiten da drin, Barnard?«
»Ich ...« Barnard zögerte. »Ich glaube, es sind zehn oder zwölf.«
Rod packte ihn am Overall und riß ihn fast von den Füßen. »Das glauben Sie?« Im Strahl der Lampe war Rods Gesicht weiß vor Wut. »Sie haben zwölf meiner Jungs hineingejagt, um neun zu retten!« Mit einem Ruck preßte er den Schichtführer gegen die Wand. »Sie Scheißkerl! Sie wissen, daß die meisten dieser neun schon erledigt sind. Sie wissen, daß dieser Stollen eine Todesfalle ist, und dennoch hetzen Sie noch einmal zwölf Männer hinein, damit sie vor die Hunde gehen, und Sie kennen ihre Namen nicht! Nach wem, zum Teufel, sollen wir dann suchen, wenn die Hängende Wand wieder bricht?« Er ließ den Schichtführer frei und trat zurück. »Holen Sie die Leute ’raus. Machen Sie den Stollen frei.«
»Aber Mr. Lemmer, der Generaldirektor, ist doch drin. Er hat den Stollen inspiziert.«
Einen Augenblick war Rod verblüfft, dann knurrte er: »Und wenn der Staatspräsident drin ist – machen Sie den Stollen frei. Wir fangen von vorn an, aber diesmal richtig.«
Binnen weniger Minuten kamen die Leute wieder aus dem Loch gekrochen. Sie waren weiß wie Maden, die über einen verfaulten Käse wimmeln.
»Gut«, meinte Rod. »Ich setze jedesmal nur vier Mann ein.« Rasch wählte er unter den mehligen Gestalten vier aus, darunter einen riesigen Mann, auf dessen rechter Schulter die Messingplakette eines Boss Boy befestigt war.
»Big King, bist du denn auch da?« Rod stellte die Frage in Fanikalo, der Universalsprache in den Minen, die es ermöglichte, daß eine Belegschaft aus etwa zwölf verschiedenen Volksgruppen sich untereinander verständigen konnte.
»Jawohl«, antwortete Big King.
»Du willst also noch mehr Auszeichnungen kriegen?« Vor einem Monat war Big King an einem Seil sechzig Meter tief in einen Erzgang hinabgelassen worden, um einen weißen Bergmann zu retten. Die Gesellschaft hatte ihm für seine mutige Tat eine Belohnung von hundert Rand gezahlt.
»Wer spricht von Auszeichnungen, wenn die Erde das Fleisch von Männern frißt?« rügte Big King sanft. »Das da heute ist ja ein Kinderspiel. Kommt der Nkosi mit in den Stollen?« Das war eine Herausforderung.
Rod hatte im Stollen eigentlich nichts zu suchen. Er war der Mann, der zu organisieren und zu koordinieren hatte. Dieser Herausforderung durfte er jedoch nicht ausweichen. Jeder Bantu würde sonst glauben, er sei aus Angst zurückgewichen und habe andere Menschen in den Tod geschickt.
»Ja«, entgegnete Rod, »ich komme mit in den Stollen.«
Das Loch war gerade so groß, daß er hindurchschlüpfen konnte. Das Streckenstück hatte die Größe eines durchschnittlichen Zimmers, aber die Hängende Wand war bis auf einen Meter heruntergebrochen. Rod ließ den Strahl seiner Lampe darüber wandern. Das Gestein war aufgerissen und gefährlich. »Ein Bündel Weintrauben« nannten die Bergleute so etwas. »Eine schöne Bescherung«, sagte er und leuchtete den Boden ab.
Der Winsler lag in Rods Reichweite. Sein Oberkörper ragte von der Hüfte an unter einem Felsbrocken in der Größe eines Autos hervor. Jemand hatte eine Decke um ihn geschlungen. Er lag nun ganz still da. Als jedoch das Licht auf ihn fiel, hob er den Kopf. Seine Augen starrten wie irr. Er nahm nichts mehr wahr. Über sein von Grauen verzerrtes Gesicht strömte der Schweiß. Sein Mund stand offen – groß und rosa leuchtete er in der glänzenden Schwärze seines Gesichts. Und wieder begann er zu schreien, doch mit einemmal wurde sein Geheul durch einen rotschwarzen Blutstrahl erstickt, der ihm aus der Kehle schoß.
Während Rod entsetzt zusah, fiel der Kopf des Bantus zurück. Sein Mund glich jetzt einem Wasserspeier – nur spritzte kein Wasser aus ihm, sondern der Lebenssaft. Dann sank er langsam nach vorn, und sein Gesicht schlug auf das Gestein.
Rod kroch zu ihm, hob den Kopf hoch und bettete ihn auf die Decke. Blut tropfte auf seine Hände. Er wischte es an seinem Overall ab. »Also drei bis jetzt«, sagte er. Und er ließ den Sterbenden zurück und kroch tiefer in den eingestürzten Stollen hinein. Big King folgte ihm.
Nach einer Stunde war es zu einem Wettstreit gekommen, zu einem Kräftemessen zwischen den beiden Männern. Hinter ihnen stützten drei andere den Gang ab. Sie reichten das Gestein von Hand zu Hand, das Rod und Big King gelockert hatten. Rod wußte, daß er sich geradezu kindisch benahm: Er hätte in der Förderstrecke zurückbleiben und nicht allein die Rettungsaktion leiten, sondern auch alle übrigen Entscheidungen treffen sollen, die jetzt angebracht waren. Die Gesellschaft bezahlte ihn schließlich für seinen Verstand und seine Erfahrung, nicht aber für seine Muskelkraft.
Zum Teufel, dachte er. Selbst wenn wir heute abend die Sprengung versäumen, werde ich hier bleiben. Er schaute Big King an und griff nach einem größeren Felsbrocken. Zunächst langte er mit den Armen zu, dann legte er die volle Wucht seines Körpers in den Griff, aber der Fels saß fest. Big King umschloß mit seinen gewaltigen schwarzen Händen den Stein, und sie zerrten nun gemeinsam. Mit einem Schwall kleinerer Steine bekamen sie ihn endlich frei. Sie schoben den Brocken zwischen sich nach hinten und grinsten einander an.
Um neunzehn Uhr verließen Rod und Big King den Stollen, um sich auszuruhen, Sandwiches zu essen und Kaffee zu trinken.
Rod telefonierte mit Dimitri. »Wir sind an beiden Schächten zum Sprengen fertig, Rod. Außer euch sind achtundfünfzig Mann in deiner Sektion dreiundvierzig.« Dimitris Stimme klang quäkend über das Feldtelefon.
»Bleib am Apparat.« Rod überdachte die Lage. Das dauerte diesmal länger als sonst, denn er war müde und fühlte sich erschöpft. Wenn er aus Furcht, noch mehr Gestein zu lockern, die Sprengung an beiden Schächten stoppen ließ, kostete das die Gesellschaft eine Tagesproduktion: zehntausend Tonnen goldhaltigen Fels im Wert von hundertsechzigtausend Rand oder zweihunderttausend Dollar, eine Achtung gebietende Summe. Vermutlich waren die eingeschlossenen Männer bereits tot, und durch die Explosion war der Druck im Gestein der Sohle 95 wohl weitgehend verpufft. Es bestand demnach wenig Gefahr, daß noch mehr Unheil angerichtet wurde.
Aber vielleicht war doch noch einer am Leben, lag irgendeiner noch atmend im dunklen Schoß des zerborstenen Gesteins? Wenn in der Sonder-Ditch-Mine alle Knöpfe für die elektrische Zündung gedrückt wurden, gingen achtzehn Tonnen Dynamit zugleich los. Die Sprengwirkung war beträchtlich. Sie konnte weitere »Weintraubenbündel« zum Einsturz bringen.
»Dimitri«, entschied Rod, »laß alle Zündungen an Schacht zwei um neunzehn Uhr dreißig losgehen.« Schacht 2 war fünf Kilometer entfernt. Das würde der Gesellschaft einen Verlust von achtzigtausend Rand ersparen. »Dann zündest du im Abstand von jeweils fünf Minuten die südlichen, nördlichen und westlichen Abbaustrecken hier auf Schacht eins.« Die zeitliche Verteilung der Sprengung würde die Gefahr vermindern. Und so konnten weitere sechzigtausend Rand für die Taschen der Aktionäre gerettet werden. Der finanzielle Gesamtverlust durch das Unglück würde somit etwa zwanzigtausend Rand betragen. Nicht allzu viel, dachte Rod sardonisch. Menschenblut war billig. Man konnte es für drei Rand pro halben Liter bei der Blutbank kaufen.
»Gut.« Er stand auf und reckte seine schmerzenden Schultern. »Ich werde alle Leute im Schacht in Sicherheit bringen, bevor wir sprengen.«
Kapitel 4
Nach den aufeinanderfolgenden Sprengungen schickte Rod seine Leute in den Stollen zurück, und um einundzwanzig Uhr entdeckten sie die Leichen zweier Maschinenjungen, die gegen ihre eigenen Bohrgeräte gepreßt worden waren. Drei Meter entfernt fanden sie einen weißen Grubenarbeiter. Sein Körper war unverletzt, sein Kopf jedoch zerquetscht.
Um dreiundzwanzig Uhr stießen sie auf zwei andere Maschinenjungen. Rod war im Fördergang, als sie die beiden durch die Öffnung schoben. Keiner von ihnen hatte noch Ähnlichkeit mit einem Menschenwesen. Sie sahen wie rohes Fleisch aus, das man im Dreck gewälzt hatte.
Kurz nach Mitternacht gingen Rod und Big King abermals in den Stollen, um das Team vor Ort abzulösen, und zwanzig Minuten später krochen sie über Geröllschutt in eine Kammer, die auf unerklärliche Weise intakt geblieben war. Hier drinnen war es so heiß wie in einem Dampfbad. Rod prallte unwillkürlich vor dem feuchten und stickigen Brodem zurück, der ihnen ins Gesicht schlug. Dann zwang er sich, weiterzukriechen und durch die Spalte zu lugen.
Drei Schritte vor ihm lag Frank Lemmer, der Generaldirektor der Sonder-Ditch-Mine. Er lag auf dem Rücken. Der Helm war ihm vom Kopf gefallen, und eine tiefe Wunde klaffte oberhalb seiner Augen. Blut tropfte in sein silbriges Haar. An manchen Stellen war es bereits schwärzlich verklumpt. Lemmer blickte blinzelnd wie eine Eule in das Licht der Lampe.
Schnell richtete Rod den Strahl zur Seite. »Mr. Lemmer«, sagte er.
»Zum Teufel, was haben denn Sie bei der Rettungsmannschaft zu suchen?« knurrte Frank Lemmer. »Das ist nicht Ihre Aufgabe. Haben Sie denn in zwanzig Jahren Bergbau nicht einmal das gelernt?«
»Wie geht es Ihnen, Sir?«
»Schaffen Sie einen Arzt her«, versetzte Lemmer. »Ihr müßt mich aus diesem Ding da heraushacken.«
Rod kroch näher heran und verstand, was Lemmer meinte. Bis zum Ellbogen war sein Arm unter einem schweren Felsbrocken begraben. Rod fuhr mit der Hand darüber. Nur eine Sprengung konnte diese Masse beseitigen. Frank Lemmer hatte – wie immer – recht.
Mühsam kroch Rod durch die Öffnung zurück und rief: »Bringt das Telefon her.«
Nach einigen Minuten hatte er den Apparat und war mit der Schachtstation auf Sohle 95 verbunden, die als Erste-Hilfe-Station und als Rastplatz für die Geretteten hergerichtet worden war. »Hier Ironsides. Geben Sie mir Dr. Stander.«
»Warten Sie, bitte.«
Nach einem Moment meldete sich der Arzt: »Hallo, Rod, was ist?«
»Dan, wir haben den Alten gefunden.«
»Wie geht’s ihm? Ist er bei Bewußtsein?«
»Ja, aber festgeklemmt. Du wirst ihn amputieren müssen.«
»Bist du sicher?« fragte Stander.
»Ich bin verdammt sicher«, gab Rod zurück.
»O Gott«, meinte Dan.
»Mir tut’s auch leid.«
»Na gut. An welcher Stelle hat’s ihn denn erwischt?«
»Am Arm. Du wirst über dem Ellbogen schneiden müssen.«
»Reizende Aussicht.«
»Ich warte hier auf dich.«
»Geht in Ordnung. In fünf Minuten bin ich da.«
Kapitel 5
»Komisch. Man sieht immer wieder, wie die Leute draufgehen, aber man ist unentwegt überzeugt, einem selber werde es nie passieren.« Frank Lemmers Stimme war fest und ruhig.
Der Arm mußte taub sein, dachte Rod, der neben ihm lag.
Lemmer wandte ihm jetzt den Kopf zu. »Warum werden Sie nicht Farmer, Junge?«
»Sie wissen doch, weshalb ich’s nicht tue«, erwiderte Rod.
»Ja.« Lemmer lächelte schwach. Nur die Lippen zuckten. Mit der freien Hand wischte er über seinen Mund. »Wissen Sie, in drei Monaten wäre ich in Pension gegangen. Beinahe hätte ich’s geschafft. Sie werden genauso enden, Junge – im Dreck mit zerschlagenen Knochen.«
»Vom Ende ist keine Rede«, versetzte Rod.
»Wirklich nicht?« fragte Frank Lemmer, und diesmal lachte er.
»Was gibt’s denn da zu lachen?« erkundigte sich Dr. Stander und steckte seinen Kopf in die kleine Kammer.
»Herrgott, Sie haben aber lange gebraucht, bis Sie den Weg nach hier gefunden haben.«
»Gib mir deine Hand, Rod.« Dan schob seine Tasche durch die Spalte. Als er dann hereingekrochen war, sagte er zu Lemmer: »Union Steel hat heute abend mit achtundneunzig Cents abgeschlossen. Ich hatte Ihnen zum Kauf geraten.«
»Viel zu viel. Weit über dem Wert«, schnaubte Lemmer.
Während Dan sich neben ihn in den Staub legte und seine Instrumente hervorholte, debattierten beide über Aktien und Kapitalanlagen.
Als Dan die Spritze voll Pentathol hatte und Lemmers sehnigen Arm betupfte, wandte sich der Generaldirektor wieder Rod zu. »Wir haben hier ganz schöne Arbeit geleistet, Rodney, Sie und ich. Ich wünschte, sie würden jetzt Ihnen die Leitung übertragen, aber das werden die Burschen nicht tun. Sie sind noch zu jung. Doch wen sie auch an meinen Platz stellen werden, haben Sie ein Auge auf ihn. Sie wissen den Grund. Lassen Sie ihn nicht alles durcheinanderbringen.«
Dann fuhr die Nadel in sein Fleisch.
In viereinhalb Minuten hatte Dan den Arm amputiert, und siebenundzwanzig Minuten später starb Frank Lemmer an dem Schock und der Erschöpfung im Förderkorb, der ihn wieder zutage brachte.
Kapitel 6
Wenn er für Pattis Unterhalt gezahlt hatte, blieb Rod nicht mehr allzu viel Geld übrig für Extravaganzen, aber eine dieser Extravaganzen war sein großer cremefarbener Maserati. Es war ein Modell aus dem Jahre 1967, das beim Kauf schon an die 50000 Kilometer hinter sich hatte, aber die Raten rissen doch jeden Monat ein ordentliches Loch in seine Gehaltstüte.
An einem Morgen wie heute hielt er die Ausgaben jedoch für gerechtfertigt. Er fuhr die Kehren am Hang des Kraalkops hinab, und als die Nationalstraße sich flach zur letzten Etappe nach Johannesburg hindehnte, drückte er fest auf die Tube. Der Wagen preschte davon wie ein Löwe. Der Ton des Auspuffs wurde tiefer und dröhnender.
Normalerweise brauchte man von der Sonder-Ditch-Mine bis nach Johannesburg eine Stunde, aber Rod schaffte es in vierzig Minuten. Es war Samstagmorgen, und er befand sich in bester Stimmung. Außerdem war er neugierig.
Seit seiner Scheidung führte Rod ein Doppelleben. An fünf Tagen der Woche war er ein leitender Mann der Minengesellschaft, doch an den beiden restlichen fuhr er mit seinen Golfschlägern im Kofferraum des Maserati in die Stadt, den Schlüssel zu seiner Luxuswohnung in Hillbrow in der Tasche und ein sorgloses Lachen um den Mund.
Heute war seine Vorfreude größer als je zuvor. Außer der zweiundzwanzigjährigen Blondine, die darauf wartete, ihren Abend der Unterhaltung von Rodney Ironsides zu widmen, sah er der geheimnisvollen Einladung von Dr. Manfred Steyner entgegen. Sie war ihm von einer namenlosen weiblichen Person zugegangen, die sich als »Dr. Steyners Sekretärin« vorgestellt hatte. Am Tag nach der Beisetzung von Frank Lemmer hatte sie angerufen und als Termin Samstag elf Uhr genannt.
Rod war Manfred Steyner noch niemals begegnet, aber er hatte natürlich von ihm gehört. Jeder, der für eine der fünfzig oder sechzig Gesellschaften arbeitete, die zur Central Rand Consolidated Group zusammengeschlossen waren, mußte schon von Manfred Steyner gehört haben, und die Sonder Ditch Gold Company war eine der Gesellschaften des Konzerns.
Steyner hatte Wirtschaftswissenschaft studiert und besaß den Doktorgrad von Cornell. Er war vor knapp zwölf Jahren zur C. R. C. gekommen. Damals war er dreißig gewesen, und nun lag er ganz vorn im Rennen. Hurry Hirschfeld konnte schließlich nicht ewig leben, wenngleich er durchblicken ließ, er werde dazu imstande sein, und sobald er ins Gras gebissen hatte, sollte Manfred Steyner ihn als Vorsitzenden ablösen. So hieß es wenigstens.
Vorsitzender der C. R. C. zu sein war ein beneidenswerter Posten. Der Pfründeninhaber wurde automatisch einer der fünf mächtigsten Männer in Südafrika. Und das bedeutete, daß er auch in den Staatsangelegenheiten ein Wörtchen mitzureden hatte.
Die Chancen lagen günstig für Dr. Steyner: Er verfügte über ein Hirn, das ihm den Spottnamen »Computer« eingetragen hatte. Niemand war je imstande gewesen, bei ihm auch nur das geringste Versagen festzustellen. Und was noch schwerer wog: Er hatte sich vor zehn Jahren die Mühe gemacht, Hurry Hirschfelds einzige Enkelin einzufangen und zu heiraten, als sie gerade die Universität von Kapstadt verlassen hatte.
Dr. Steyner nahm eine bedeutende Stellung ein, und Rod war gespannt darauf, ihn kennenzulernen.
Es war zehn Minuten vor elf, als er das Messingschild »Dr. M. K. Steyner« in einer abgelegenen Straße des wohlhabenden Vororts Sandown fand. Das Haus war von der Fahrbahn aus nicht zu sehen. Rod ließ den Maserati langsam durch das hohe weiße Tor mit seinen Giebeln in imitiertem Cape-Dutch-Stil rollen. Diese Giebel, so meinte er, zeugten von einem schrecklichen Geschmack. Die Gartenanlagen dahinter waren jedoch nahezu paradiesisch. Rod kannte sich in Gesteinsarten aus. Blumen waren nicht gerade seine starke Seite. Er wußte zwar, daß die üppigen roten und gelben Blüten vor dem Rasen Cannas waren; für die übrige Blumenpracht, die ihn umgab, wußte er indessen keine Bezeichnung. »Hm«, murmelte er ein wenig scheu. »Hier muß sich ja einer mächtig viel Arbeit gemacht haben.«
Hinter einer Biegung der Einfahrt stand das Haus. Es war ebenfalls im Cape-Dutch-Stil erbaut, und Rod verzieh nun Dr. Steyner sein Portal. »Hm«, wiederholte er und brachte den Maserati zum Stehen.
Cape Dutch ist ein Stil, der sich schwer kopieren läßt: Auch nur eine Einzelheit unter hundert, die nicht am richtigen Platz ist, kann die Gesamtwirkung zerstören. Dieser Bau hier war jedoch vollkommen. Er gab einem das Gefühl der Zeitlosigkeit, der Beständigkeit, zugleich aber auch das der Schönheit und der Eleganz.
Rod betrachtete sich das alles mit Neid. Er liebte schöne Dinge wie seinen Maserati, aber das war eine andere Art von Besitz. Er war eifersüchtig auf den Mann, dem dies gehörte. Sein eigenes Jahreseinkommen würde nicht einmal zur Anzahlung des Grundstücks ausreichen. Na, schließlich hatte er ja seine Mietwohnung, dachte er und grinste wehmütig. Dann ließ er seinen Wagen zu den Garagen rollen.
Welches der richtige Eingang war, vermochte er nicht zu erkennen. Aufs Geratewohl schlug er einen der gepflasterten Wege ein, die alle auf das Haus zuführten. An einer Krümmung des Pfades bot sich ihm ein Anblick, der gleichfalls nicht zu verachten war. Was er sah, war kleiner als das Haus, wirkte aber auf Rod weitaus stärker. Es handelte sich um den Inhalt einer ebenfalls schönen Helanca-Hose, die aus einem exotischen Busch hervorragte.
Rod war bezaubert. Er blieb stehen und wartete, während der Busch bebte und raschelte, wobei die Rückseitenpartie hin und her zappelte. Plötzlich ertönte ein wenig damenhafter Fluch. Der Hoseninhalt streckte sich. Die Dame richtete sich auf, steckte einen Zeigefinger in den Mund und lutschte geräuschvoll daran. »Es hat mich gestochen. Dieses verdammte Insekt hat mich gestochen!«
»Nun, Sie sollten es auch nicht in Versuchung führen«, meinte Rod.
Sie wirbelte herum. Als erstes bemerkte Rod ihre Augen. Sie waren so groß, daß sie das ganze Gesicht beherrschten.
»Ich habe nicht ...«, begann sie und hielt dann inne. Sie nahm den Finger aus dem Mund. Instinktiv fuhr sie mit einer Hand durchs Haar, mit der andern strich sie über ihre Bluse und wischte Blätter ab. »Wer sind Sie?« erkundigte sie sich, und der Blick ihrer großen Augen glitt über seine Gestalt. So verhielten sich im allgemeinen Mädchen und Frauen zwischen sechzehn und sechzig, die Rodney Ironsides zum erstenmal sahen, und er war dafür dankbar.
»Ich bin Rodney Ironsides und habe eine Verabredung mit Dr. Steyner.«
»Oh.« Eilig stopfte sie ihren Blusenzipfel in ihre Slacks. »Mein Mann wird in seinem Arbeitszimmer sein.«
Er hatte gewußt, wer sie war. Mindestens fünfzigmal schon hatte er ihr Foto in den Zeitungen gesehen, doch diese Aufnahmen zeigten sie meist im Abendkleid und mit Diamanten behangen, nicht aber in einer Bluse, deren einer Ärmel aufgerissen war, und auch nicht mit locker baumelnden Zöpfen. Auf den Bildern war ihr Make-up makellos. Jetzt war sie überhaupt nicht geschminkt. Ihr Gesicht war erhitzt und verschwitzt.
»Ich muß schauderhaft aussehen. Ich bin bei der Gartenarbeit«, erklärte sie unnötigerweise.
»Kümmern Sie sich denn selber um den Garten?«
»Ach, nur so ein bißchen, damit die Muskeln nicht einschlafen«, antwortete sie.
»Der Garten ist herrlich«, sagte Rod.
»Meinen Sie?«
»Das hier ist eine Protea, nicht wahr?« Er deutete auf den Busch, aus dem sie soeben herausgekrabbelt war.
»Ja, eine Protea nutans«, erwiderte sie. Er muß Ende der Dreißig sein, überlegte sie. Seine Schläfen werden schon grau. »Es gibt mehr als zweihundert verschiedene Sorten von Proteen«, fuhr sie fort. Seine Stimme paßt nicht zu seinem Äußeren, grübelte sie. Er sah wie ein Preisboxer aus, aber er sprach wie ein Rechtsanwalt. Wahrscheinlich war er auch einer. Meist kamen Anwälte oder Geschäftsleute zu Manfred.
»Tatsächlich? Jedenfalls ist der Busch wunderschön.« Rod berührte eine der Blüten.
»Nicht wahr? Ich habe fünfzig Sorten hier im Garten.«
Und plötzlich lächelten sie einander an.
»Ich bringe Sie ins Haus«, sagte Theresa Steyner.
Kapitel 7
»Hier ist Mr. Ironsides, Manfred.«
»Danke sehr.« Dr. Steyner saß in einem Raum, der nach Wachs roch, am Schreibtisch. Er machte sich nicht die Mühe aufzustehen.
»Möchten Sie gern eine Tasse Kaffee?« fragte Theresa auf der Türschwelle. »Oder Tee?«
»Nein, vielen Dank«, antwortete Dr. Steyner, ohne Rod zu fragen. »Schon gut, Theresa.«
Sie ging hinaus.
Rod blieb an der Tür stehen. Er musterte den Mann, von dem er so viel gehört hatte.
Manfred Steyner sah jünger aus als zweiundvierzig. Sein Haar war hellbraun, fast blond, und glatt nach hinten gestrichen. Er trug eine Brille mit schwerer schwarzer Fassung, und sein Gesicht war glatt und seidenweich wie das eines Mädchens. An seinem Kinn ließ sich kein Bartschatten erkennen. Seine Hände, die auf der glänzenden Tischplatte lagen, waren ohne ein Härchen, so daß Rod sich fragte, ob er wohl ein Enthaarungsmittel benutzte.
»Treten Sie näher.«
Rod kam an den Tisch.
Steyner hatte ein schneeweißes Seidenhemd an, dazu trug er eine Krawatte in den Farben des Royal Johannesburg Golf Club und Manschettenknöpfe aus Onyx. Rod bemerkte, daß das Hemd und die Krawatte ganz neu und unbenutzt waren. Also stimmte, was man ihm erzählt hatte: Steyner bestellte seine von Hand gemachten Hemden jeweils zwölfdutzendweise und zog jedes nur einmal an.
»Setzen Sie sich, Ironsides.« Steyners Aussprache hatte einen leichten deutschen Akzent.
»Dr. Steyner«, entgegnete Rod gelassen, »Sie haben die Wahl: Entweder nennen Sie mich Rodney oder Mr. Ironsides.«
Steyners Gesicht blieb ausdruckslos. »Ich möchte gern ein wenig über Ihre Vergangenheit sprechen, Mr. Ironsides. Gewissermaßen als Einleitung zu unserem Gespräch. Sie haben doch nichts dagegen?«
»Nein, Dr. Steyner.«
»Sie wurden am 16. Oktober 1931 in Butterworth in der Transkei geboren. Ihr Vater war Kaufmann, Ihre Mutter starb 1939. Ihr Vater gehörte als Hauptmann der Infanterie von Durban an und starb an der Verwundung, die er im Winter 1944 in Italien erlitten hatte. Sie wurden von Ihrem Onkel mütterlicherseits in East London großgezogen. Nachdem Sie sich 1947 am Queen’s College in Grahamstown hatten immatrikulieren lassen, gelang es Ihnen nicht, ein Stipendium für Bergbau an der Universität von Witwatersrand als Bergbauingenieur zu erhalten. Sie haben sich daraufhin an der Bergbauschule der Regierung eintragen lassen und Ihre Sprenglizenz im Jahre 1949 erworben. Dann sind Sie als Anfänger bei der Blijvooruitzicht Gold Mining Company eingetreten.«
Dr. Steyner erhob sich von seinem Schreibtisch und ging zu der getäfelten Wand. Dort drückte er auf einen verborgenen Schalter. Ein Teil der Täfelung glitt zur Seite und enthüllte ein Waschbecken und einen Handtuchhalter. Während er weitersprach, fing er mit übertriebener Sorgfalt an, sich die Hände einzuseifen und zu waschen.





























