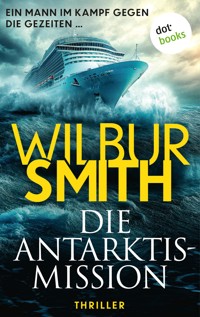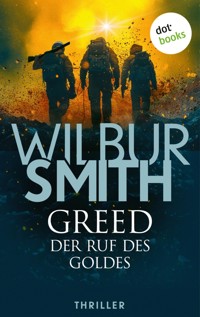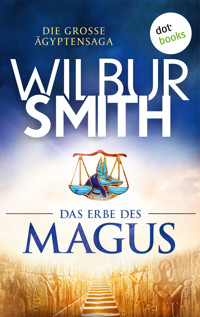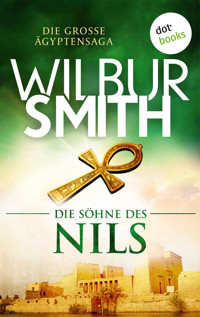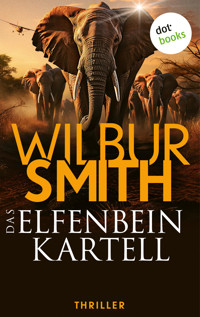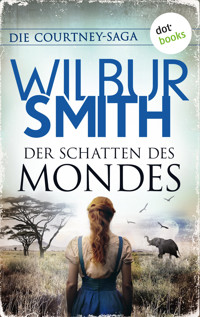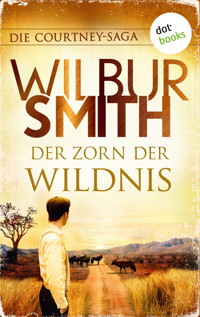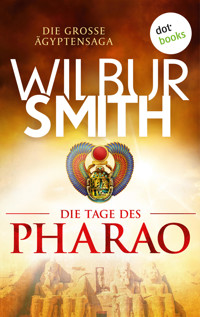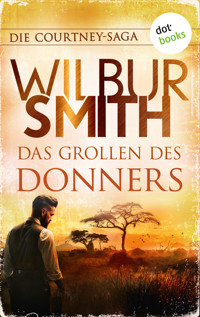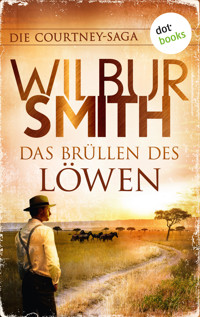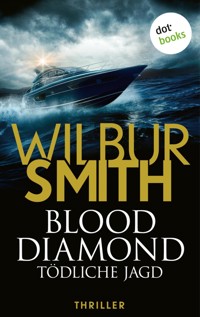
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Manche Menschen haben niemals genug … Als Pflegesohn des unnachgiebigen Unternehmers Van Der Byl wächst Johnny Lance im Schatten von Macht und Reichtum auf. Doch ein schicksalhaftes Ereignis in seiner Kindheit ändert alles, und Johnny wird aus der Familie verstoßen. Auf sich allein gestellt, unternimmt er das gewagte Vorhaben, auf dem diamantenreichen Meeresboden vor der wilden, südafrikanischen Küste nach Ruhm und Reichtum zu suchen. Aber hier erwartet ihn bereits Benedict, der verwöhnte Spross der Familie, der im illegalen Diamantenschmuggel tätig ist – und der alles daran setzten wird, den Mann, der einmal sein Bruder war, zu ruinieren. Ihr Kampf findet einen dramatischen Showdown in einer von wilden Tieren bevölkerten Wüste, unter der unnachgiebigen Sonne Afrikas … »Unglaublich lesenswert … Voller Intrigen, Romantik, Gier, Grausamkeit und rasanter Action.« El Paso Herald-Post Der packende Action-Thriller »Blood Diamond – Tödliche Jagd« von Bestseller-Autor Wilbur Smith wird alle Fans von Clive Cussler und Ken Follett begeistern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Pflegesohn des unnachgiebigen Unternehmers Van Der Byl wächst Johnny Lance im Schatten von Macht und Reichtum auf. Doch ein schicksalhaftes Ereignis in seiner Kindheit ändert alles, und Johnny wird aus der Familie verstoßen. Auf sich allein gestellt, unternimmt er das gewagte Vorhaben, auf dem diamantenreichen Meeresboden vor der wilden, südafrikanischen Küste nach Ruhm und Reichtum zu suchen. Aber hier erwartet ihn bereits Benedict, der verwöhnte Spross der Familie, der im illegalen Diamantenschmuggel tätig ist – und der alles daran setzten wird, den Mann, der einmal sein Bruder war, zu ruinieren. Ihr Kampf findet einen dramatischen Showdown in einer von wilden Tieren bevölkerten Wüste, unter der unnachgiebigen Sonne Afrikas …
eBook-Neuausgabe September 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1971 unter dem Originaltitel »The Diamond Hunters« bei Heinemann, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1975 unter dem Titel »Die Diamanten-Erben« bei Heyne und in einer Neuausgabe unter dem Titel »Diamanten-Fieber« bei Bastei Lübbe.
First published in 1971 by William Heinemann Ltd
Copyright © Wilbur Smith 1971
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1975 by Wilhelm Heyne Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/brickrena und AdobeStock/vectorwin
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-98952-353-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Blood Diamond – Tödliche Jagd
Thriller
Aus dem Englischen von Gabriele Redden
dotbooks.
Kapitel 1
In Nairobi war seine Maschine drei Stunden lang aufgehalten worden, und obwohl er vier große Whiskys getrunken hatte, schlief er sehr unruhig, bis die Boeing in London Heathrow landete. Johnny Lance fühlte sich, als ob man ihm eine Handvoll Sand in jedes Auge geworfen hätte. Er war sehr schlechter Laune, als er die Unannehmlichkeiten der Zoll- und Paßkontrolle über sich ergehen lassen mußte, bevor er in die Halle des Flughafens kam. Dort traf er den Agenten der Van Der Byl Diamond Company.
»Angenehmen Flug gehabt?«
»Wie zur Hölle!« brummte Johnny.
»Da konnten Sie ja schon mal Erfahrungen sammeln«, grinste der Agent. Sie hatten zusammen schon tolle Zeiten erlebt. Zögernd grinste auch Johnny. »Haben Sie mir ein Zimmer und einen Wagen besorgt?«
»Im Dorchester – und einen Jaguar.« Der Agent gab ihm die Schlüssel. »Außerdem habe ich zwei Plätze erster Klasse in der Neun-Uhr-Maschine zurück nach Kapstadt reservieren lassen. Die Flugkarten liegen bei der Hotelrezeption.«
»Guter Junge!« Johnny steckte die Schlüssel in seinen Cashmere-Mantel, und sie gingen zum Ausgang.
»Wo ist eigentlich Tracey van der Byl?«
Der Agent zuckte die Schultern. »Seitdem ich Ihnen geschrieben habe, habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich wüßte nicht, wo Sie sie suchen sollten.«
»Na, großartig, einfach großartig!« sagte Johnny bitter, als sie auf den Parkplatz kamen. »Fangen wir mit der Suche bei Benedict an.«
»Weiß der Alte denn über Tracey Bescheid?«
Johnny schüttelte den Kopf. »Er ist ein kranker Mann. Ich habe es ihm nicht erzählt.«
»Hier ist Ihr Wagen.« Sie standen vor einem silbergrauen Jaguar. »Haben Sie noch Zeit für einen Drink?«
»Diesmal nicht, leider.« Johnny setzte sich hinter das Steuer. »Nächstes Mal.«
»Ich werde Sie daran erinnern«, sagte der Agent und ging.
Es war schon fast dunkel, als Johnny die Hammersmith-Brücke überquerte, und in dem feuchten Abendnebel verfuhr er sich zweimal in diesem Labyrinth von Belgravia, bevor er seinen Jaguar in einer der engen Gassen hinter dem Belgrave Square parken konnte.
Die Fassade des Hauses war sehr pompös erneuert worden, seitdem er das letztemal hier gewesen war. Johnny verzog den Mund. Unser guter Benedict war in puncto Geldverdienen nicht sehr eifrig, aber er verstand sich darauf, es auszugeben.
Die Fenster waren hell erleuchtet, und Johnny schlug den Türklopfer ein halbes Dutzend Mal, so daß es in den Gassen hallte. In der Stille, die darauf folgte, hörte er hinter den Vorhängen Stimmengeflüster, ein Schatten huschte schnell an einem Fenster vorbei.
Johnny wartete drei Minuten in der Kälte, dann ging er ein paar Schritte zurück.
»Benedict van der Byl«, rief er laut, »wenn du bei zehn die Tür nicht geöffnet hast, trete ich das verdammte Ding ein.« Er holte tief Luft und rief noch einmal. »Hier ist Johnny Lance – und du weißt, daß ich das wahrmache, was ich sage.«
Sofort öffnete sich die Tür. Ohne den Mann, der sie hielt, eines Blickes zu würdigen, ging Johnny hinein.
»Verdammt noch mal, Lance, du kannst nicht einfach hier hereinkommen.« Benedict van der Byl kam hinter ihm her.
»Warum nicht?« Johnny schaute zurück. »Das ist eine Firmenwohnung – und ich bin der Generalmanager.« Bevor Benedict antworten konnte, war Johnny in der Halle.
Ein Mädchen hob seine Kleider auf und rannte nackt in einen der Schlafräume. Ein anderes Mädchen zog einen langen Kaftan über seinen Kopf und schaute Johnny schmollend an. Ihre Haare waren in wildem Durcheinander. Die steifen, abstehenden Locken gaben ihr ein geradezu groteskes Aussehen.
»Hübsche Party«, sagte Johnny und musterte den Filmprojektor auf dem Tisch und die Leinwand auf der anderen Seite des Raumes. »Sogar Filme.«
»Bist du ein Bulle?« wollte das Mädchen wissen.
»Deine Unverfrorenheit stinkt mir, Lance.« Benedict van der Byl band den Gürtel seines seidenen Hausmantels zu.
»Ist er ein Bulle?« fragte das Mädchen noch einmal.
»Nein«, versicherte Benedict, »er arbeitet für meinen Vater.« Mit dieser Feststellung gewann er an Selbstsicherheit, richtete sich zu voller Größe auf und strich seine langen, dunklen Haare zurück. Seine Stimme bekam ihre alte Arroganz. »Eigentlich ist er Daddys Botenjunge.«
Johnny drehte sich zu ihm um und sprach das Mädchen an, ohne es anzusehen.
»Hau ab, Kleine, geh zu deiner Freundin.«
Sie zögerte.
»Hau ab!« Johnnys Stimme war scharf wie ein Messer. Sie ging. Die beiden Männer standen sich nun gegenüber. Sie waren gleichaltrig, beide Anfang dreißig – beide groß, beide dunkelhaarig – sonst aber völlig verschieden.
Johnny hatte breite Schultern und schmale Hüften, seine Haut war von der Wüstensonne gebräunt. Die Linie seines breiten Unterkiefers war klar, und die Augen schienen immer noch ferne Horizonte zu suchen, während seine Stimme den unverkennbar harten Akzent des anderen Landes hatte.
»Wo ist Tracey?« fragte er.
Benedict zog mit gespieltem, arrogantem Erstaunen eine Augenbraue hoch. Seine Haut war blaß-oliv, unberührt von der Sonne, denn es waren Monate vergangen, seitdem er in Afrika gewesen war. Die Lippen waren rot, als ob sie geschminkt wären. Seine einst klassischen Züge waren aufgeschwemmt, und er hatte kleine Säckchen unter den Augen. Der seidene Morgenmantel konnte seinen plumpen Körper, der verriet, daß er gerne viel aß und trank, nicht verbergen.
»Mein lieber Freund, wie um alles in der Welt kommst du darauf, daß ich wissen könnte, wo meine Schwester ist? Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen.«
Johnny wandte sich ab und ging zu einem der Bilder an der Wand. Der Raum war voll von Originalen südafrikanischer Maler – Alexis Preller, Irma Stern und Tretchikoff – eine ungewöhnliche Mischung aus verschiedensten Techniken und Stilarten. Einige Experten hatten den ›Alten‹ überzeugt, daß sie gute Investitionen darstellten.
Johnny drehte sich um und schaute Benedict prüfend an, so wie er es gerade noch mit den Bildern getan hatte. Er verglich ihn mit dem jungen Athleten, der dieser noch vor wenigen Jahren gewesen war. In seiner Erinnerung sah er Benedict vor vollen Tribünen mit der Grazie eines Leoparden über den Rasen laufen, sich vor dem hohen Bogen, den der Ball beschrieb, umdrehen, ihn auffangen, den Kopf hoch erhoben, darauf wieder in das Feld einbrechen, um den Ball zurückzuschießen.
»Du wirst ganz schön fett, mein Lieber«, sagte er leise.
Benedict wurde rot vor Wut. »Mach, daß du rauskommst«, schnaubte er.
»Eine Minute noch – sag mir, wo Tracey ist.«
»Hab’ ich dir nicht schon gesagt, daß ich nicht weiß, wo sie ist. Hurt wahrscheinlich in Chelsea rum.«
Johnny fühlte Zorn in sich aufsteigen, aber seine Stimme blieb ruhig. »Woher kriegt sie Geld?«
»Weiß ich nicht. Der Alte ...«
Johnny schnitt ihm das Wort ab. »Der Alte gibt ihr ein Taschengeld von zehn Pfund die Woche. Ich habe aber gehört, daß sie viel mehr herausschmeißt.«
»Herrgott, Johnny«, Benedicts Stimme wurde freundlicher. »Ich weiß es nicht. Es geht mich nichts an. Vielleicht Kenny Hartford ...«
Wieder unterbrach ihn Johnny ungeduldig. »Kenny Hartford gibt ihr nichts. Bei ihrer Scheidung hat sie auf Unterhalt verzichtet. Ich will aber wissen, wer ihre Reise in die Vergessenheit finanziert. Du vielleicht, großer Bruder?«
»Ich?« Benedict war gekränkt. »Du weißt, zwischen uns wird keine Zuneigung verschwendet.«
»Muß ich es aussprechen?« fragte Johnny. »Na, gut. Der Alte stirbt – ohne jemals seinen Schrecken allen Schwächen und Sünden gegenüber verloren zu haben. Wenn aus Tracey eine drogenabhängige kleine Hure wird, dann hat unser guter Benedict wieder alle Chancen, seine alte Beliebtheit zurückzuerlangen. Es wäre für dich doch ein gutes Geschäft, wenn du jetzt ein paar Tausender springen läßt, um Tracey in die Hölle zu schicken, sie für immer von ihrem Vater und all den fetten Millionen zu trennen.«
»Wer hat was von Drogen gesagt?« brauste Benedict auf.
»Ich.« Johnny trat dicht vor ihn hin. »Wir haben noch ein kleines Geschäft miteinander, und das ist noch nicht abgeschlossen. Es würde mir ein großes Vergnügen bereiten, dich auseinanderzunehmen, um herauszufinden, wie du funktionierst.«
Er hielt Benedicts Augen für lange Sekunden fest, bis dieser Johnnys Blick nicht mehr standhalten konnte, sich abwandte und sich mit dem Gürtel seines Hausmantels beschäftigte.
»Wo ist sie, Benedict?«
»Ich weiß es nicht, verdammt!«
Johnny bewegte sich langsam auf den Filmprojektor zu, rollte ein paar Meter des Filmstreifens ab und hielt das Celluloid gegen das Licht.
»Hübsch!« sagte er und preßte vor Ekel die Lippen hart aufeinander.
»Leg das sofort wieder hin«, fauchte Benedict.
»Du weißt doch, was der Alte davon hält, oder nicht, Benedict?«
Plötzlich wurde Benedict blaß. »Er würde dir nicht glauben.«
»Doch, das würde er.« Johnny warf den Streifen auf den Tisch und wandte sich um. »Er glaubt mir, weil ich ihn niemals belogen habe.«
Benedict zögerte und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Sie hatte sich eine kleine Wohnung in Chelsea gemietet. Stark Street, No. 23. Einmal kam sie bei mir vorbei.«
»Warum?«
»Ich habe ihr ein paar Pfund geliehen«, stieß Benedict schmollend hervor.
»Ein paar Pfund?« fragte Johnny.
»Na gut, ein paar hundert Pfund. Sie ist ja schließlich meine Schwester.«
»Verdammt anständig von dir«, lobte ihn Johnny. »Schreib die Adresse auf.«
Benedict ging zu seinem mit Leder bespannten Schreibtisch und schrieb die Adresse auf eine Karte. Er kam zurück und gab sie Johnny.
»Du hältst dich wohl für groß und gefährlich, Lance.« Seine Stimme vibrierte vor Zorn. »Aber ich bin auch gefährlich – auf meine Weise. Der Alte lebt nicht mehr lange. Wenn er abgetreten ist, dann werde ich dich erwischen.«
»Du ängstigst mich zu Tode«, grinste Johnny und ging hinaus zu seinem Wagen.
Es war ziemlich starker Verkehr auf dem Sloane Square, als Johnny den Jaguar langsam Richtung Chelsea fuhr. Er hatte viel Zeit, nachzudenken; sich zu erinnern, wie nahe sie sich gestanden hatten. Er, Tracey und Benedict.
Wie sie als Kinder an den endlosen Stränden, in den Bergen und den von der Sonne ausgedörrten Ebenen von Namaqualand, die für sie Spielplatz waren, herumtollten. Das alles war noch, bevor der Alte am Slang River sein Glück machte, bevor sie überhaupt Geld für Schuhe hatten. Als Tracey noch Kleider aus Mehlsäcken trug. Als sie noch alle drei auf einem Pony zur Schule ritten, aufgereiht wie kleine Spatzen auf dem Zaun.
Er erinnerte sich, wie sie die heißen, sonnigen Tage, an denen der Alte fort war, mit Gelächter und geheimen Spielen verbrachten. Wie sie jeden Abend in der Lehmhütte in die ›kopje‹ geklettert waren und aus dem Fenster gen Norden über das endlose Land schauten, das im Sonnenuntergang orange- und violett-farben war, um die Staubwolke zu sehen, die die Rückkehr des Alten ankündigte.
Und dann die fast schmerzliche Aufregung, wenn der staubige lärmende Ford, dessen Kotflügel nur noch mit Draht befestigt waren, plötzlich im Hof stand und der Alte herausstieg, einen schweißigen Hut im Nacken und Staub in den Bartstoppeln. Wie er Tracey kreischend über seinen Kopf schwang. Dann wandte er sich Benedict zu und zuletzt Johnny.
Johnny hatte sich nie gefragt, warum er immer zuletzt kam. Es war immer so gewesen: Tracey, Benedict, Johnny, immer in dieser Reihenfolge. Er hatte sich auch niemals darüber gewundert, daß sein Name Lance war und nicht van der Byl. Dann kam es zu einem plötzlichen Ende, der ganze sonnige Kindheitstraum war vorbei und verloren.
»Johnny, ich bin nicht dein richtiger Vater! Deine Eltern starben, als du noch sehr klein warst.« Und Johnny hatte ihn ungläubig angestarrt.
»Verstehst du mich?«
»Ja, Pa.«
Traceys Hand tastete nach seiner unter dem Tischtuch, aber er riß sie weg.
»Ich glaube, es ist besser, wenn du mich nicht mehr so nennst.«
Er konnte sich genau an den Ton des Alten erinnern, neutral, sachlich, während das zerbrechliche Kristall seiner Kindheit in Splitter zersprang. Damals hatte die Einsamkeit begonnen.
Johnny beschleunigte den Jaguar und fuhr in die King’s Road. Er war überrascht, daß die Erinnerungen so schmerzlich waren. Die Zeit hätte die Wunden längst heilen sollen.
Sein Leben war dann ein endloser Kampf um die Anerkennung des Alten geworden – auf seine Liebe hatte er nicht zu hoffen gewagt.
Bald darauf hatte es dann große Veränderungen gegeben, denn eine Woche später war der Alte mitten in der Nacht und völlig unerwartet aus der Wüste zurückgekommen. Das Bellen der Hunde und das laute Lachen des Alten hatte sie schläfrig aus ihren Betten gescheucht.
Der Alte hatte die Petroleumlampe angezündet, und sie saßen alle vier um den geschrubbten, hölzernen Tisch. Wie ein Zauberer legte er etwas vor sie hin, das aussah wie ein großes Stück zerbrochenes Glas. Die drei Kinder starrten es an, ohne zu wissen, was es war. Das Licht fing und brach sich in dem Kristall wie Feuer, und kleine Blitze funkelte es auf dem Stein.
»Zwölf Karat«, lachte der Alte, »blau-weiß und ohne Makel, und wo ich den gefunden habe, wartet noch eine ganze Wagenladung davon.«
Danach kamen die neuen Kleider, Autos, der Umzug nach Kapstadt, die neue Schule und das große Haus am Wynberg Hill – aber immer kämpfte er um die Anerkennung des Alten. Er erreichte sie nie, aber er weckte Benedict van der Byls Eifersucht und seinen Haß. Da ihm der Elan und die Entschlußkraft Johnnys fehlten, konnte Benedict niemals dasselbe erreichen, ob nun im Klassenzimmer oder auf dem Sportplatz. Johnny setzte den Maßstab, und Benedict war weit abgeschlagen, und deswegen haßte er ihn.
Der Alte bemerkte es nicht, denn er war selten bei ihnen. Sie lebten allein in dem großen Haus, abgesehen von einer mageren, stillen Haushälterin. Der Alte kam nur hin und wieder für kurze Zeit. Immer schien er müde und abgelenkt. Manchmal brachte er aus London, Amsterdam oder Kimberley Geschenke mit, die ihnen nichts bedeuteten. Sie wünschten sich eher, daß alles so geblieben wäre, wie es vorher war, draußen in der Wüste.
In der Leere, die der Alte hinterließ, blühte die Feindseligkeit und Rivalität zwischen Johnny und Benedict, und sie nahm solche Ausmaße an, daß Tracey gezwungen war, sich zwischen den beiden zu entscheiden. Sie wählte Johnny.
In ihrer Einsamkeit klammerten sie sich aneinander.
Das ernste kleine Mädchen und der große schlaksige Junge bauten sich ein Schloß gegen die Einsamkeit. Es war ein heller sicherer Platz, wo die Traurigkeit sie nicht erreichen konnte – und Benedict war davon ausgeschlossen.
Johnny ordnete seinen Jaguar ein, um in die Old Church Street einzubiegen. In Chelsea fuhr er am Fluß entlang. Er fuhr ganz automatisch, und die Erinnerungen kamen zurück.
Der Versuch, das Bild des Schlosses der Liebe und Wärme, das Tracey und er gebaut hatten, einzufangen und festzuhalten, mißlang, denn seine Gedanken sprangen zu jener Nacht, in der es eingestürzt war.
Eines Nachts war Johnny von leisem Weinen geweckt worden. Barfuß und nur mit seinem Pyjama bekleidet war er dem herzzerreißenden Schluchzen gefolgt. Er war damals vierzehn Jahre alt und hatte Angst in dem großen, dunklen Haus.
Tracey weinte in ihre Kissen, und er hatte sich über sie gebeugt. »Tracey. Was hast du? Warum weinst du?«
Sie sprang auf, kniete sich auf das Bett und warf die Arme um seinen Hals. »O Johnny. Ich hatte einen Traum, einen schrecklichen Traum. Halt mich ganz fest, geh nicht weg. Laß mich nicht allein.«
Ihr Flüstern war undeutlich und wurde von Tränen erstickt. Er hatte sich neben sie gelegt und sie umarmt, bis sie eingeschlafen war. Danach war er jede Nacht in ihr Zimmer gegangen. Alles war völlig unschuldig und kindlich, das zwölfjährige Mädchen und der Junge, der ihr Bruder war, wenn auch nicht dem Namen nach. Sie umarmten sich im Bett und flüsterten und lachten heimlich, bis sie eingeschlafen waren.
Dann war das Schloß eines Nachts durch das helle Deckenlicht gesprengt worden. Der Alte stand in der Tür des Schlafzimmers und Benedict war hinter ihm, tanzte vor Aufregung in seinem Schlafanzug und sang triumphierend.
»Ich hab’s dir ja gesagt, Pa. Ich hab’s dir ja gesagt!«
Der alte Mann bebte vor Zorn, sein Haar sah aus wie die Mähne eines verwundeten Löwen. Er zog Johnny aus dem Bett und schlug Traceys Hände fort.
»Du kleine Hure«, brüllte er, während er den erschrockenen Jungen mit der einen Hand hielt. Er lehnte sich vor und schlug seiner Tochter mit der anderen mitten ins Gesicht. Johnny zog er die Treppen hinunter in sein Arbeitszimmer, während Tracey schluchzend auf ihrem Bett lag. Er stieß ihn mit solcher Heftigkeit in das Zimmer, daß Johnny gegen den Schreibtisch torkelte. Er war zum Schrank gegangen, hatte einen Rohrstock herausgenommen, Johnny bei den Haaren gepackt und ihn mit dem Gesicht nach unten über den Schreibtisch geworfen.
Der Alte hatte ihn vorher auch schon geschlagen, aber niemals so wie jetzt. Wahnsinnig vor Zorn, waren seine Schläge ziellos, und einige trafen Johnnys Rücken.
Doch in all seinem Schmerz und seiner Qual war ihm tödlich bewußt, daß er nicht schreien durfte. Er biß sich so hart auf die Lippen, daß er den salzigen Blutgeschmack in seinem Mund spürte. Er darf mich nicht schreien hören! Und er unterdrückte das Stöhnen, während seine Pyjamahosen von Blut durchtränkt wurden.
Sein Schweigen jedoch diente der Raserei des Alten nur als Ansporn. Er schleuderte den Rohrstock fort, zog den Jungen hoch und attackierte ihn mit bloßen Händen. Er schlug Johnnys Kopf von einer Seite zur anderen, mit harten, offenen Schlägen, die in seinem Schädel wie grelle Blitze explodierten.
Noch immer hielt sich Johnny auf den Füßen und klammerte sich an der Schreibtischkante fest. Seine Lippen waren aufgerissen und geschwollen, sein Gesicht aufgedunsen und voller dunkler Blutergüsse, bis der Alte schließlich weit hinter die Grenze der Zurechnungsfähigkeit getrieben war. Er schleuderte seine Faust in Johnnys Gesicht – und durch eine wundervolle Erlösung fühlte er die Schmerzen in einer warmen Flut von Dunkelheit schwinden.
Kapitel 2
Johnny hörte eine fremde Stimme: »... als ob er von einem wilden Tier angefallen worden ist. Ich werde die Polizei benachrichtigen müssen.«
Dann eine Stimme, die er kannte. Es dauerte eine Weile, bis er wußte, wer es war. Er versuchte seine Augen zu öffnen, aber sie schienen fest verschlossen. Sein Gesicht war dick geschwollen und heiß. Er konnte die geschwollenen Augenlider etwas öffnen und erkannte Michael Shapiro, den Sekretär des Alten.
Dieser sprach leise mit dem anderen Mann. Um ihn war der Geruch von Antisepticum. Der Arztkoffer stand offen neben seinem Bett.
»Hören Sie zu, Doktor. Ich weiß, es sieht schlimm aus – aber sollten Sie sich nicht erst mit dem Jungen unterhalten, bevor Sie etwas unternehmen?«
Sie schauten beide zum Bett.
»Er ist wieder bei Bewußtsein!« Sofort setzte sich der Doktor zu ihm. »Was ist passiert, Johnny? Sag uns, was passiert ist. Wer immer das getan hat, wird bestraft werden, das verspreche ich dir.«
Das waren die falschen Worte. Niemand durfte den Alten bestrafen.
Johnny versuchte zu sprechen, aber seine Lippen waren steif und geschwollen. Noch einmal versuchte er es. »Ich bin gefallen«, sagte er. »Ich bin gefallen. Niemand! Niemand! Ich bin heruntergefallen.«
Als der Arzt gegangen war, kam Michael Shapiro und stellte sich neben ihn. Seine dunklen jüdischen Augen schienen noch dunkler vor Mitleid, und da war noch etwas – Ärger vielleicht, oder Bewunderung. »Ich nehme dich mit zu mir, Johnny. Es wird schon wieder gut werden.«
Für zwei Wochen kümmerte sich Helen, Michael Shapiros Frau, um ihn. Die Wunden vernarbten, und die Blutergüsse verschwanden langsam. Nur seine Nase blieb krumm und behielt einen kleinen Höcker in der Mitte. Er studierte seine neue Nase im Spiegel und mochte sie. Wie ein Boxer sah er aus, oder wie ein Pirat, aber es dauerte einige Monate, bevor er seine Nase betasten konnte, ohne daß sie weh tat.
»Hör zu, Johnny. Du wirst auf eine neue Schule gehen, ein gutes Internat in Grahamstown.« Michael Shapiro versuchte, begeistert zu klingen. Grahamstown war fünfhundert Meilen entfernt. »In den Ferien kannst du in Namaqualand arbeiten und alles über Diamanten, und wie man sie abbaut, lernen. Das freut dich doch, oder?«
Johnny dachte eine Minute lang nach und beobachtete Michaels Gesicht.
»Dann werde ich also nicht nach Hause zurückkehren?« Zu Hause, das hieß, das Haus am Wynberg Hill. Michael schüttelte den Kopf.
»Wann werde ich sie ...«, Johnny zögerte, um die richtigen Worte zu finden, »wann werde ich sie wiedersehen?«
»Ich weiß es nicht, Johnny«, antwortete ihm Michael ehrlich.
Wie Michael versprochen hatte, war es tatsächlich eine gute Schule.
Am ersten Sonntag, nach dem Gottesdienst, war er den anderen Jungen in das Klassenzimmer gefolgt, wo sie eine Stunde Zeit hatten, um Briefe zu schreiben. Die anderen hatten sofort begonnen, an ihre Eltern zu schreiben. Johnny saß elend an seinem Tisch, bis die Aufsichtsperson an seinem Platz stehenblieb.
»Schreibst du nicht nach Hause, Lance?« fragte er freundlich. »Ich bin sicher, sie wollen wissen, wie es dir geht.«
Gehorsam nahm Johnny seinen Stift in die Hand und überlegte, was er schreiben könnte. Schließlich schrieb er:
Sehr geehrter Herr!
Ich hoffe, Sie freuen sich zu hören, daß ich wieder in der Schule bin. Das Essen ist gut, aber die Betten sind hart. Wir gehen jeden Tag in die Kirche und spielen Rugby (Football).
Ihr ergebener Johnny
Von da an, bis er drei Jahre später auf die Universität ging, schrieb er jede Woche an den Alten. Jeder Brief begann mit derselben Anrede und fuhr fort: ›Ich hoffe, Sie freuen sich zu hören ...‹ Er bekam niemals eine Antwort. Einmal pro Semester bekam er einen Brief von Michael Shapiro, der ihm mitteilte, was für seine Ferien geplant sei. Meistens war es eine Zugreise quer durch das Karroo-Gebiet zu einem verlassenen kleinen Dorf in der verdörrten Einöde. Dort wartete dann ein Flugzeug, das der Van Der Byl Company gehörte, um ihn noch weiter in die Wüste, zu einem der Konzessions-Gebiete der Firma zu fliegen. Und genau wie Michael Shapiro versprochen hatte, lernte er eine Menge über Diamanten.
Als die Zeit gekommen war, auf die Universität zu gehen, war es selbstverständlich, daß er Geologie studieren würde.
Während all dieser Zeit war Johnny ein Ausgestoßener der Van-der-Byl-Familie. Er hatte keinen von ihnen mehr gesehen – weder den Alten noch Tracey, noch nicht einmal Benedict.
Dann, an einem ereignisreichen Nachmittag, sah er sie alle drei.
Es war sein letztes Universitätsjahr. Sein Examen war ihm sicher. Seit seinem ersten Semester war er der Beste gewesen und inzwischen zum Sprecher der Studentenschaft gewählt worden. Nun stand ihm eine weitere Ehrung bevor.
In zehn Tagen würde das Nationale Sport-Komitee die Auswahl des Rugby-Teams bekanntgeben, das auf die Mannschaft von Neuseeland treffen sollte – und Johnnys Nominierung auf dem rechten Flügel war ihm genauso sicher, wie sein Examen in Geologie.
Die Sportpresse hatte ihn ›Jag Hond‹ getauft, nach dem gefürchteten Vorfahren des afrikanischen Jagdhundes; ein Tier von unglaublicher Zähigkeit und Sicherheit, das seine Beute im Lauf anfällt. Der Spitzname war ihm geblieben und Johnny ein Liebling der Massen.
In der Mannschaft gab es noch ein anderes Rugby-Idol, dessen Platz in der Nationalmannschaft ebenso sicher schien. In seiner Rolle als Verteidiger dominierte Benedict van der Byl auf dem Rugby-Feld mit einer Grazie und Artistik, die fast göttlich war. Er war hochgewachsen und breitschultrig, mit langen kräftigen Beinen.
Johnny führte das Gäste-Team auf die weiche grüne Rasenfläche und, während er auf und ab sprang, um sich locker zu machen, schaute er auf die überfüllten Tribünen, um zu sehen, ob die Hohenpriester des Rugby alle versammelt wären. Er sah Doktor Danie Craven mit anderen Auserwählten auf ihren privilegierten Plätzen gleich unter den Presse-Boxen. Unterhalb des Doktors saß der Premierminister, der sich mit ihm unterhielt.
Dieses Treffen der beiden Universitäten war einer der Höhepunkte der Rugby-Saison, und die ›Aficionados‹ waren Tausende von Meilen gereist, um es zu sehen.
Der Premierminister lächelte und nickte, dann beugte er sich vor und berührte die Schulter eines großen weißhaarigen Mannes, der eine Reihe vor ihm saß.
Johnny fühlte ein elektrisches Prickeln entlang seines Rückgrats, als der weißhaarige Mann den Kopf hob und ihn direkt anschaute. Es war das erstemal seit jener schrecklichen Nacht, daß er den Alten sah.
Johnny salutierte, und der Alte starrte ihn lange Sekunden an, bevor er sich abwandte, um mit dem Premierminister zu sprechen.
Nun kamen die Tambourmajorinnen auf das Feld. Weiß gestiefelt und in den Farben der Universität Kapstadt, mit kurzen schwingenden Röcken und großen Hüten marschierten sie ein. Hübsche junge Mädchen, mit vor Aufregung und Anstrengung geröteten Gesichtern.
Das Dröhnen der Menge pulsierte in Johnnys Ohren, denn Tracey van der Byl führte die Parade an. Obwohl zehn Jahre vergangen waren, und sie sich in eine junge Frau verwandelt hatte, erkannte er sie sofort wieder. Ihre Arme und Beine waren sonnengebräunt, und das dunkle Haar glänzte auf ihren Schultern. Sie warf die Beine in die Höhe, sprang hoch, rief die traditionellen Anfeuerungsrufe und wirbelte ihren jungen, festen Körper herum, während die Menge schrie und tobte und sich langsam in Hysterie steigerte. Johnny beobachtete Tracey. Völlig regungslos stand sie in dem tobenden Aufruhr. Sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte.
Dann war die Show vorbei. Die Tambourmajorinnen zogen sich zurück, und das Heim-Team trabte auf das Feld.
Durch die Gegenwart von Tracey und dem Alten verstärkte sich Johnnys Haß auf den weißgekleideten Spieler, der gerade dabei war, die Kontrolle über den Abwehrraum der Mannschaft von Kapstadt zu übernehmen. Benedict van der Byl stellte sich in Position und drehte sich um. Aus seinem Kniestrumpf holte er einen Kamm und fuhr damit durch seine dunklen Haare. Die Menge schrie und pfiff, denn sie liebte diese kleine theatralische Geste. Benedict steckte den Kamm in den Strumpf zurück, stellte sich in Positur, eine Hand auf der Hüfte, sein Kinn arrogant in die Höhe gereckt, und überblickte die gegnerische Mannschaft.
Plötzlich fing er Johnnys Blick ein, worauf sich seine Pose veränderte. Er schaute auf den Boden und scharrte mit den Füßen.
Der Anpfiff kam, und das Spiel begann. Es bot alles, wovon die Menge geträumt hatte, ein Spiel, an dem man sich weidete und an das man sich noch lange erinnern würde. Massive Angriffe der Stürmer, lange, gefährliche Überfälle der Verteidiger. Der Ball wanderte von Hand zu Hand, bis ein Aufeinanderkrachen den Ballträger zu Boden schleuderte. Ein hartes, schnelles und sauberes Spiel schwang von einer Seite zur anderen. Hundertmal sprangen die Zuschauer auf ihre Füße, Augen und Münder in unerträglicher Spannung weit aufgerissen, und sie sanken stöhnend zurück, wenn der Ball Zentimeter vor der Torlinie gehalten wurde.
Drei Minuten vor Spielende stand es immer noch null zu null. Aus einem Handgemenge heraus griff Kapstadt an, brach durch eine Lücke in der Verteidigung, dann flog der Ball in einem langen Paß durch die Luft und wurde sauber, ohne einen Schrittfehler vom Kapstädter Außenstürmer, aufgefangen. Seine Füße huschten über den Rasen, und wieder sprangen die Massen stöhnend auf und sanken zurück.
Während sie darauf warteten, den Ball zu fangen, flüsterte Johnny leise Befehle. Sein goldbraunes Trikot war schweißnaß, und er hatte Blutflecken auf seinen weißen Shorts.
»Hol den Ball wieder. Nicht damit rennen. An Dawie abgeben. Steil schießen, Dawie.«
Johnny sprang hoch, direkt in die Fluglinie des geworfenen Balles, und stieß ihn mit der Faust genau in Dawies Hände. Im selben Moment drehte er seinen Körper, um die Angreifer abzuwehren.
Dawie fiel zwei Schritte zurück und schoß. Die Wucht des Schusses schlug seinen Fuß über seinen Kopf, und der Stoß schleuderte ihn vorwärts.
Der Ball stieg langsam wie ein Wurfspiel, erreichte den Zenit seiner Flugbahn hoch über dem Mittelfeld und schwebte dann zurück zur Erde.
Zwanzigtausend Köpfe folgten seinem Flug, regungslose Stille hatte sich über das Feld gesenkt – und in diesem unnatürlichen Schweigen hatte es Benedict van der Byl tief in seine eigene Hälfte zurückgetrieben. Er schien genau zu wissen, wo der Ball aufkommen würde, und lief mit großen verhaltenen Schritten, während er mit der Präzision eines talentierten Athleten die Zeit berechnet hatte. Der Ball fiel genau in seine Arme, und er bewegte sich langsam auf das Mittelfeld zu, um den Winkel für den Abstoß zu öffnen. Es lag noch immer diese spannungsvolle Stille über dem Feld, und alle Augen waren auf Benedict van der Byl gerichtet.
»Jag Hond!« Ein einzelner Ruf aus der Menge alarmierte sie, und zwanzigtausend Köpfe schauten auf die andere Spielhälfte.
»Jag Hond!« dröhnte es jetzt. Johnny hatte sich freigelaufen, als er auf Benedict zulief. Aber es war ein sinnloser Versuch, einen Spieler von Benedicts Kaliber jetzt noch zu stoppen. Er war zu weit entfernt gewesen, doch Johnny gab sein Letztes bei diesem Angriff her. Sein schweißnasses Gesicht war starr vor Entschlossenheit, und Gras- und Erdstücke flogen um ihn.
Dann passierte etwas Unvorhergesehenes, geradezu Unglaubliches. Benedict blickte sich um und sah Johnny. Er wurde unsicher, machte zwei ungeschickte schleifende Schritte und versuchte in seine eigene Spielhälfte abzuschwenken. All seine Selbstsicherheit, all sein Können und seine Grazie waren von ihm gefallen. Er stolperte und wäre fast hingefallen, während der Ball ihm entglitt und über das Feld rollte.
Benedict krabbelte ihm nach, tastete blindlings, schaute sich um, und ein Ausdruck nackter Furcht war nun auf seinem Gesicht. Johnny war sehr nahe gekommen. Er schnaubte bei jedem Schritt wie ein angeschossener Löwe, seine Lippen waren zu einer mörderischen Parodie eines Grinsens verzogen. Benedict van der Byl fiel auf die Knie, bedeckte seinen Kopf mit beiden Armen und krümmte sich auf dem Rasen.
Ohne ihn anzusehen, fegte Johnny an ihm vorbei und bückte sich im Laufen nach dem Ball.
Als Benedict, immer noch kniend, aufblickte, stand Johnny zehn Meter entfernt zwischen den Torpfosten und beobachtete ihn. Dann legte Johnny den Ball absichtlich zwischen seine Füße, um die Formalität des Touch Down zu vervollständigen. Als hätten sie sich abgestimmt, schauten Johnny und Benedict jetzt hinüber zu den Ehrentribünen. Sie sahen den Alten langsam aufstehen und auf den Ausgang zugehen, während die Menge tobte.
Am Tag nach dem Spiel fuhr Johnny wieder in die Wüste.
Er stand in einem drei Meter tiefen Schürfgraben, der in das felsige Gestein geschlagen war. Es war unerträglich heiß in dem engen Graben, und Johnny trug nur ein paar knappe Khaki-Shorts. Seine sonnengebräunten Muskeln glänzten vor Schweiß, aber er schlug unbeirrt Gesteinsproben aus dem Felsen. Er legte eine alte ozeanische Erdstufe frei, die seit Jahrmillionen unter dem Sand begraben war. Hier auf dem Grundgestein hoffte er eine dünne Schicht Diamantengestein zu finden.
Er hörte, daß über ihm ein Jeep scharf bremste. Dann das Knirschen von Schritten. Johnny richtete sich auf und hielt seinen schmerzenden Rücken.
Der Alte stand am Rand des Grabens und schaute auf ihn herab. Er hielt eine zusammengefaltete Zeitung in der Hand. Das war das erstemal in all den Jahren, daß Johnny ihn aus der Nähe sah, und die Veränderung schockierte ihn. Das buschige Haar war schneeweiß, und seine Züge waren faltig und zerknittert wie die einer englischen Bulldogge. Die gebogene Nase stand scharf hervor. Aber für sein Alter war er sehr rüstig, und seine Augen hatten immer noch dieses kalte, undurchdringliche Blau.
Er ließ die Zeitung in den Graben fallen. Johnny fing sie auf, ohne den Blick von ihm zu wenden.
»Lies!« sagte der Alte. Die Sportseite war vorne und die Schlagzeile groß und fettgedruckt:
JAG HOND IN. VAN DER BYL OUT!
Der Schock war so angenehm wie der Sprung in einen Gebirgsbach. Er war ausgewählt worden, er würde das gold-grüne Trikot und das Emblem, den Springbock, tragen.
Er schaute stolz und glücklich auf und wartete darauf, daß der Alte etwas sagen würde.
»Überleg’s dir«, sagte der Alte mit warmer Stimme. »Willst du Rugby spielen oder für die Van Der Byl Diamond Company arbeiten? Du kannst nur eines.« Und er ging zurück zum Jeep und fuhr davon.
Johnny telegrafierte seinen Verzicht dem Doktor persönlich. Ein Sturm des Protestes und der Beschimpfungen folgte. Hunderte von bösen Briefen, die Johnny erreichten, bezichtigten ihn der Feigheit und des Verrats und noch schlimmerer Dinge.
Johnny war froh, weitab in der Wüste zu sein.
Kapitel 3
Weder Johnny noch Benedict spielten jemals wieder Rugby. Als er jetzt darüber nachdachte, fühlte er immer noch einen kleinen Stich der Enttäuschung. Er hatte sich das gold-grüne Ehrenabzeichen so sehr gewünscht. Scharf fuhr er den Jaguar an den Straßenrand, suchte auf dem Stadtplan von London nach der Stark Street und fand sie in der Nähe der King’s Road. Er fuhr weiter und dachte daran, wie der Alte ihm diese Ehrung fortgenommen hatte. Seine Ohnmacht war ihm fast unerträglich gewesen.
Seine Gefährten in der Wüste waren Männer vom Ovambostamm aus dem Norden, und einige dieser wortkargen Männer waren, von der Wüste geprägt, genauso zäh und kompromißlos wie ihre Umgebung.
Die Namib- und die Kalahari-Wüste sind zu den einsamsten Plätzen der Welt zu zählen, und die Wüstennächte sind lang. Nicht einmal die unaufhörlich harte Arbeit konnte Johnny genügend ermüden, um seine Träume von einem hübschen Mädchen in einem kurzen, weißen Rock und hohen, weißen Stiefeln – oder von einem alten weißhaarigen Mann mit einem Gesicht wie ein Granitfelsen zu zerstören.
Aber aus diesen langen Tagen und den noch längeren Nächten kamen gute Leistungen hervor, die wie Meilensteine den Weg seines Erfolges markierten. Er entdeckte ein neues Diamantenfeld, klein, aber reich, in einer Gegend, in der kein Mensch Diamanten vermutet hätte. Er steckte ein Stück Land ab, auf dem er Uran gefunden hatte, und das daraufhin die Van Der Byl Company für zweieinhalb Millionen verkaufte, und er machte andere Entdeckungen, die fast so wertvoll und spektakulär waren.
Mit fünfundzwanzig war Johnny Lance in der Diamanten-Industrie als einer der kommenden jungen Männer bekannt.
Er hatte gute Angebote – eine Partnerschaft in einer Gruppe von beratenden Geologen, Feldmanager für eine der hartringenden kleineren Firmen. Aber Johnny lehnte ab. Es waren gute Angebote, aber er blieb bei dem Alten. Dann bemerkte ihn die ›Große Firma‹. Vor einem Jahrhundert wurde die erste (Blue-Ground-)Diamantenader in Südafrika auf dem Grund des Buren De Beer entdeckt. Der alte De Beer hatte seine schwer zu bewirtschaftende Farm für 6000 £ verkauft, ohne zu ahnen, daß ein Schatz, der 300 000 000 £ wert war, unter der dunklen trockenen Erde lag. Dieses Vorkommen wurde ›De Beers New Rush‹ genannt, und eine Horde von Diamantengräbern, kleinen Geschäftsleuten, Landstreichern, Glücksrittern, Schurken und Halunken kam, um sich einzukaufen und in winzigen Claims, kaum größer als ein Zimmer, nach Diamanten zu suchen.
Aus dieser Horde von Glückssuchern ragten zwei Männer heraus, denen nach kurzer Zeit alle De-Beer-Claims gehörten. Als diese zwei, Cecil John Rhodes und Barney Barnato, ihren Reichtum zusammenlegten, wurde ein fantastisches finanzielles Unternehmen geboren. Aus bescheidenen Anfängen war eine Firma mit ehrfurchtsgebietender Respektabilität und Vornehmheit gewachsen. Ihr Reichtum war unvorstellbar, ihr Einfluß unermeßlich und ihr Einkommen astronomisch. Sie kontrollierte die Diamantenbelieferung der ganzen Welt. Sie kontrollierte auch Bergwerkskonzessionen über Gebiete in Zentral- und Südafrika, die Tausende von Quadratmeilen groß waren und deren Reserven von noch nicht abgebauten Adern nicht errechnet werden kann. Kleine Diamantenfirmen sind neben dem Riesen geduldet, bis sie eine bestimmte Größe erreichen, dann sind sie plötzlich Teil des Riesen, verschlungen wie Pilotfische vom Tigerhai, dem sie zu frech geworden sind. Die große Firma kann es sich leisten, die besten Schürfgebiete, die besten Ausrüstungen und die besten Männer zu kaufen. Und so griff sie mit einem ihrer vielen Fangarme nach Johnny Lance. Das Gehalt, das man geboten hatte, war doppelt so hoch wie sein jetziges und dreimal so hoch wie er je verdienen würde.
Johnny lehnte ab. Vielleicht hatte es der Alte gar nicht bemerkt, vielleicht war es purer Zufall, daß Johnny eine Woche später Feldmanager des Unternehmens an der Küste wurde. Und der Spitzname, den man ihm hier gab, war ›King Canute‹. Die Van Der Byl Company besaß siebenunddreißig Meilen der Küsten-Konzession: ein schmaler Küstenstreifen, vierzig Meter über der Hochwassermarke und vierzig Meter unter der Niedrigwassermarke. Die Konzession des Hinterlandes gehörte der großen Firma. Sie hatten das Land, ein Dutzend abgelegene Farmen, aufgekauft, lediglich, um das Abbaurecht zu erhalten. Die Konzession für die Zwölfmeilenzone hatten sie auch. Diese wurde ihnen schon vor zwanzig Jahren von der Regierung garantiert. Aber der Van Der Byl Company gehörte der Küstenstreifen, und es war ›King Canutes‹ Aufgabe, ihn zu bearbeiten.
Der Meeresnebel dampfte wie grauer Perlenstaub von den kalten Wassern des Benguela-Stromes herauf. Aus den Nebelbänken heraus schlugen die hohen Wogen auf den hellgelben Sand und an die von Wellen zerfurchten Klippen von Namaqualand. Die Wellen bäumten sich gegen die Felsen auf. Ihre Schaumkronen zitterten, wurden leuchtend grün, lösten sich sprühend auf und glitten wieder hinunter in das schäumende, dröhnende Meer.
Johnny stand auf dem Fahrersitz des offenen Land-Rovers. Er trug eine Schaffelljacke, die ihn vor der Kälte des Morgennebels schützte, und seine dunklen Haare wehten ihm ins Gesicht.
Sein Unterkiefer war nach vorne geschoben und seine Hände in den Taschen zu Fäusten geballt. Er schaute finster, als er die Höhe und die Wucht der Wellen schätzte. Mit einer unbeholfenen ärgerlichen Bewegung zog er die linke Hand aus der Tasche und schaute auf seine Uhr; noch zwei Stunden und drei Minuten bis zur Ebbe. Dann steckte er die Hand zurück in die Tasche und schaute sich nach seinen Planierraupen um.
Er hatte elf hellgelbe D.-8-Planierraupen, die an der Hochwassermarke in einer Reihe standen. Die Fahrer beobachteten ihn gespannt.
Dahinter, in einigem Abstand, warteten die Bagger. Es waren riesige plumpe Fahrzeuge, deren Reifen einen Durchmesser von gut zwei Metern hatten. Wenn es soweit war, würden sie mit einer Geschwindigkeit von fünfzig Stundenkilometern herankommen und eine Fünfzehn-Tonnen-Ladung landeinwärts transportieren, daraufhin die nächste Ladung abholen.
Johnny reckte seinen Körper und wartete auf den richtigen Moment, in dem er Maschinen mit einem Wert von einer Viertelmillion Pfund ins Meer schicken würde, in der Hoffnung, eine Handvoll glitzernder Steine zu finden.
Der Augenblick kam, und Johnny prüfte noch eine halbe Minute lang seine Vorbereitungen, bevor er handelte.
»Los!« schrie er in sein Sprachrohr und schwenkte seinen Arm unmißverständlich.
»Los!« rief er noch einmal, aber genau wie das Tosen der Brandung verlor sich seine Stimme in dem dröhnenden Motorengeräusch der Dieselmaschinen. Mit gesenkten Schaufeln rollten diese Stahlmonster vorwärts.
Sie schoben den Sand vor sich her, häuften ihn auf, arbeiteten sich unablässig vorwärts, während die Fahrer die Kontrollhebel wie wild schalteten. Die Dieselmotoren brüllten, stotterten und brüllten wieder.
Die Mauer aus Sand traf auf die ersten Wellen. Das Meer schien sich erstaunt und unsicher vor dem Deich aus Sand zurückzuziehen.