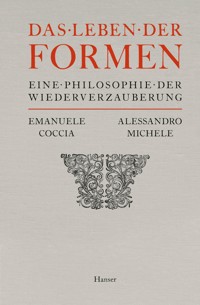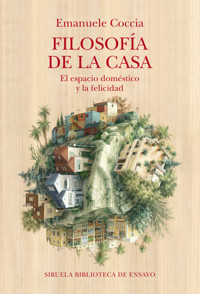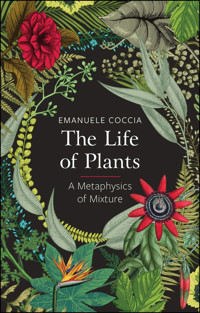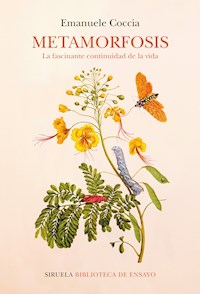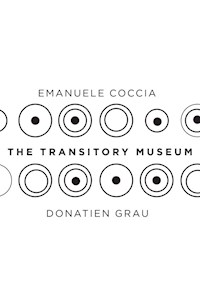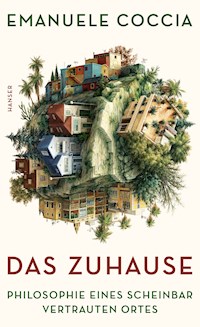
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie das Zuhause unsere Psyche beeinflusst. »Ein aufschlussreiches Buch, das die Räume erhellt und verstehen lässt, was sie bedeuten.« la Repubblica Drei Zimmer, Küche, Bad – ist damit erklärt, was ein Zuhause ist? Keineswegs, beweist Emanuele Coccia in seiner „Philosophie des Wohnens“. Obwohl die Philosophie von jeher eine besondere Beziehung zur Stadt hatte, ging es ihr bislang kaum um Häuser und Wohnungen. Dabei spielt das Zuhause für das menschliche Glück eine entscheidende Rolle. Die Aufteilung der Räume spiegelt und verstärkt soziale und kulturelle Ungleichheiten. Emanuele Coccia zeigt, wie Wohnzimmer, Flur und Küche die Psyche prägen. Meisterhaft verknüpft er das Leben zwischen vier Wänden mit der ökologisch drängenden Frage, wie der Mensch die Welt zu seinem Zuhause macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie das Zuhause unsere Psyche beeinflusst. »Ein aufschlussreiches Buch, das die Räume erhellt und verstehen lässt, was sie bedeuten.« la Repubblica Drei Zimmer, Küche, Bad — ist damit erklärt, was ein Zuhause ist? Keineswegs, beweist Emanuele Coccia in seiner »Philosophie des Wohnens«. Obwohl die Philosophie von jeher eine besondere Beziehung zur Stadt hatte, ging es ihr bislang kaum um Häuser und Wohnungen. Dabei spielt das Zuhause für das menschliche Glück eine entscheidende Rolle. Die Aufteilung der Räume spiegelt und verstärkt soziale und kulturelle Ungleichheiten. Emanuele Coccia zeigt, wie Wohnzimmer, Flur und Küche die Psyche prägen. Meisterhaft verknüpft er das Leben zwischen vier Wänden mit der ökologisch drängenden Frage, wie der Mensch die Welt zu seinem Zuhause macht.
Emanuele Coccia
Das Zuhause
Philosophie eines scheinbar vertrauten Ortes
Aus dem Italienischen von Andreas Thomsen
Hanser
Für meine Tochter
Einführung
Das Zuhause jenseits der Stadt
Die Philosophie hatte immer schon eine besondere Beziehung zur Stadt. Dort ist sie entstanden und hat sich weiterentwickelt, dort wurde über ihre Vergangenheit und Zukunft nachgedacht. Die Geschichte der Philosophie handelt von Straßen, Märkten, Versammlungen, Kultstätten und Palästen, in denen sich die Macht konzentrierte. Es ist eine Geschichte, die weniger einem Roman gleicht als vielmehr der Karte einer Grand Tour, auf der dieses esoterische und elitäre Wissen von Stadt zu Stadt, Land zu Land und Kontinent zu Kontinent weitergegeben wurde.
Auf dieser philosophischen Landkarte wäre die großgriechische Stadt Kroton, das heutige Crotone in Kalabrien, besonders deutlich hervorgehoben. In dieser Stadt, in der Pythagoras im Jahr 532 v. Chr. seine Schule gründete, erhielt die Philosophie ihren zunächst wohl ironisch gemeinten Namen. In der Sprache der damaligen Zeit beschrieb der Begriff »Philosophia«, also die »Liebe zur Weisheit«, nämlich etwas, das irgendwo zwischen dem Wunsch nach Wissen und dem Bekenntnis zum Dilettantismus lag, denn die Weisheitssuchenden betrachteten sich keineswegs als »Experten«. Als Nächstes würde einem Betrachter der Karte wohl Athen ins Auge springen, wo Platon (387 v. Chr.) und Aristoteles (335 v. Chr.) ihre Schulen in der Akademie und im Lykeion gründeten. Hier erhielt die Philosophie ihre höheren Weihen und verstand sich von nun an selbst als Stadt. Während sie in Kroton die Lebensregel einer Gemeinschaft aus Individuen war, die beschlossen hatten, anders zu leben als andere, erhob sie in Athen den Anspruch, der Maßstab für die Beziehungen aller Menschen zu sein. In Syrakus scheint die Philosophie dann der Versuchung erlegen zu sein, die Macht an sich zu reißen und sich selbst zum Souverän aufzuschwingen. Sie entwickelte sich dort zur Quelle des Gesetzes, das alle Handlungen und Meinungen regelt, und zur Hüterin aller Wahrheiten, die die Stadt anerkennen und pflegen durfte. In Rom wurde der Wunsch, »belebtes Gesetz« (lex animata) zu werden, so radikal umgesetzt, dass man das Denken mit Recht und Gesetz gleichsetzte. Auch Paris darf auf der philosophischen Karte nicht fehlen, wo die Philosophie zum Lehrgegenstand wurde, und ebenso wenig Frankfurt, wo sie lernte, eine Kraft des Protestes zu sein, die verhindert, dass alle Städte mit sich selbst übereinstimmen.
Die Liste der Städte, in denen sich die Philosophie niedergelassen hat, ist schier endlos. Und anders als vielleicht manche vermuten, beschränkt sich unsere philosophische Landkarte keineswegs auf Europa, sondern reicht weit darüber hinaus. In Alexandria etwa begegnete die Philosophie der jüdischen Kultur und Religion und vermischte sich mit ihr. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor allem die Schriften Philons, die bis heute unsere Sichtweise auf das Göttliche prägen. In Hippo Regius, dem heutigen Annaba in Algerien, entdeckte die Philosophie die erste Person und lernte nicht nur »Ich« zu sagen, sondern auch sich in das Alltagsleben der Menschen hineinzuversetzen. Hier schrieb Augustinus seine Confessiones (Bekenntnisse). In Bagdad wurde die Philosophie zum Treffpunkt der Kulturen, als man die persönliche Bibliothek des Kalifen Hārūn ar-Raschīd 832 in ein »Haus der Weisheit« umwandelte, das Philosophen, Astronomen, Mathematikern und anderen Gelehrten offenstand, ganz gleich, woher sie kamen, welche Sprache sie sprachen oder welcher Religion sie angehörten.
Die Philosophie war allerdings nicht nur in Metropolen und Hauptstädten zuhause, sondern erblühte oftmals auch in der Provinz. Einige der wichtigsten philosophischen Abhandlungen wurden in kleineren Städten verfasst. Spinozas Ethik etwa entstand in Voorburg und Den Haag, Hegels Phänomenologie des Geistes im beschaulichen Jena, wo auch viele Protagonisten der deutschen Romantik, wie die Brüder Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck oder Clemens Brentano, zuhause waren. Alle diese Städte haben ihre unauslöschliche Signatur im Corpus der Philosophie hinterlassen, eine Hieroglyphe aus verdichteten Gedanken, in der die Atmosphäre, das Licht und die Existenz einer jeden von ihnen verewigt ist.
Und doch verschleiert dieses wunderschöne philosophische Diorama einen wichtigen Sachverhalt. Athen, Rom, Bagdad oder Alexandria sind im Grunde nämlich nur hypnotische Kulissen, die zwar jedes Theater in den Schatten stellen, aber letztlich nicht mehr Substanz besitzen als ein gewaltiges Schattenspiel. Sie mögen ja die Geburtsstätten der Philosophie sein, aber letztlich sind die Städte dieser Welt nichts weiter als riesige Freilichtbühnen, die uns vorgaukeln, anderswo zu sein, während sie den Ort, an dem wir uns wirklich befinden, vor uns verbergen. Wir tun alle so, als wüssten wir das nicht, dabei bewohnt keiner von uns tatsächlich eine Stadt. Das ist unmöglich, denn Städte sind im wahrsten Sinne des Wortes unbewohnbar. Wir können endlose Stunden in ihnen verbringen und wunderbare oder schreckliche Momente erleben. Wir können im Büro sitzen, einen Schaufensterbummel machen oder das Straßengewirr erkunden, uns in Theatern oder Kinos vergnügen, in Bars oder Restaurants etwas zu uns nehmen, auf Sportplätzen unsere Runden drehen oder in Schwimmbädern unsere Bahnen ziehen. Aber früher oder später müssen wir nach Hause zurückkehren, denn bewohnen können wir diesen Planeten immer und nur dank und mittels eines Zuhauses. Seine Form ist nicht entscheidend. Es kann sich um ein Hotel oder eine Wohnung handeln, ein Sofa oder einen Wolkenkratzer, es kann so unordentlich sein wie eine Rumpelkammer, so ärmlich wie eine Scheune oder so prachtvoll wie ein Palast, es kann aus Stein oder faltbarem Leder bestehen, das man mit sich herumtragen kann. Aber irgendwo in der Stadt gibt es immer ein Zuhause, in dem wir leben können. Ein Leben, das versucht, den städtischen Raum unmittelbar zu bewohnen, ist zum Scheitern verurteilt, denn der einzige wahre Stadtbewohner ist der Obdachlose. Er führt jedoch ein ungeschütztes, verletzliches Leben, das ihn tödlichen Gefahren aussetzt.
Allen Übrigen erschließt sich die Stadt jedoch nur durch ein wie auch immer geartetes Zuhause. Ich habe Teile meines Lebens in Paris, Berlin, Tokio und New York verbracht, aber bewohnen konnte ich diese Städte immer nur mit Hilfe von Schlafzimmern und Küchen, Stühlen, Schreibtischen, Schränken, Badewannen und Heizkörpern.
Wohnen ist allerdings weit mehr als ein zu lösendes Raumproblem. Denn es bedeutet nicht, von etwas umgeben zu sein oder einen bestimmten Teil des auf der Erde verfügbaren Raumes zu okkupieren. Wohnen heißt, Beziehungen zu bestimmten Menschen und Dingen aufzubauen, Beziehungen, die so intensiv sind, dass wir sie ebenso brauchen wie die Luft zum Atmen. Das Zuhause ist eine Kraft, die unser ganzes Sein beeinflusst und damit alles, was sich innerhalb seines magischen Kreises befindet. Architektur oder Biologie spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle, denn wir bauen Häuser heute nicht etwa, um uns vor den Elementen zu schützen oder den Raum mit der genealogischen Ordnung und unserem ästhetischen Empfinden in Einklang zu bringen. Vielmehr stellt jedes Haus, jedes Zuhause eine moralische Realität dar. Wir bauen Häuser, um in gemütlicher Form den Teil der Welt zu beherbergen, der für unser persönliches Glück unerlässlich ist. Und dazu gehören nicht nur Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände, sondern auch Ereignisse, Erinnerungen, Vorstellungen und eine bestimmte Atmosphäre.
Andererseits beweist die Praxis des Häuserbauens, dass sich die Moral — die Theorie des Glücks — nicht auf ein paar psychologische Ermahnungen und Lehren über gute Absichten, Sorgfalt und Seelenhygiene reduzieren lässt. Das Zuhause repräsentiert eine materielle, Menschen und Gegenstände gleichermaßen einbeziehende Ordnung. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Haushalt der Dinge und Gefühle, der sich selbst und andere in einer räumlichen Einheit zu etwas verbindet, was wir im weitesten Sinne als »Fürsorge« bezeichnen. Glück ist weder ein Gefühl noch eine rein subjektive Erfahrung, sondern der willkürliche Gleichklang, der Menschen und Dinge für einen flüchtigen Moment in einer engen körperlichen und geistigen Beziehung vereint.
Dessen ungeachtet hat die Philosophie dem Zuhause bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Vom männlichen Drang nach gesellschaftlicher Anerkennung und dem Streben nach Macht und Einfluss in der Stadt beseelt, hat sie jahrhunderte-, wenn nicht jahrtausendelang den häuslichen Raum vollkommen vergessen. Dabei ist sie mit ihm weit enger verbunden als mit jeder Stadt auf dieser Welt. Nach den ersten griechischen Abhandlungen über die oikonomia, die sich im konkreten Sinne des Wortes mit Haushaltsführung befassten und großen Einfluss hatten, verlor die Philosophie den häuslichen Raum aus dem Blick. Diese Vernachlässigung ist unverzeihlich, denn sie hat dazu beigetragen, das Zuhause zu einem Unrechtsraum zu machen, in dem Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ungleichheit zur unbewussten, sich selbst reproduzierenden Gewohnheit wurden. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern etwa hat ihre Wurzeln im Zuhause, was perfiderweise auch noch als Rechtfertigung dieses Zustandes dient. Denn die Verhältnisse am heimischen Herd bildeten die Grundlage eines Eigentumsrechts, das zu einer von wirtschaftlicher Ungleichheit geprägten Gesellschaftsordnung führte. Und das moderne Zuhause hat die Situation auch deshalb noch weiter verschärft, weil sich in diesem bis auf wenige Ausnahmen nur für Menschen geeigneten Raum der Gegensatz zwischen Mensch und Nicht-Mensch, zwischen Stadt und Wald, zwischen »Zivilisation« und »Wildnis« auf radikale Weise manifestiert.
Indem sie das Zuhause vergessen hat, hat die Philosophie sich selbst vergessen. Dabei war diese vernachlässigte Sphäre die Brutstätte der meisten Ideen, die sich auf den Planeten und seine Geschichte ausgewirkt haben. In diesem Raum, der sogar in ein und derselben Stadt ganz unterschiedliche Formen annehmen kann, wird das Fleisch zum Wort.
Doch die Philosophie vernachlässigte das Zuhause nicht nur, sie ordnete es Stadt und Politik unter und verbaute sich damit selbst den Weg zum Glück. Sie überließ das Zuhause den Kräften von Genealogie und Eigentum, so dass es in sich zusammenschrumpfte, bis es nur noch den Anforderungen des menschlichen Körpers diente, während alles, was mit Glückseligkeit zu tun hat, aus seinen vier Wänden verbannt und hinaus in die Stadt verlagert wurde. Das Glück ist zum bloßen Schattenspiel verkommen, weil es aus dem zu eng gewordenen häuslichen Ambiente herausgelöst und zu einem politischen Faktum erhoben wurde, das sich nur im städtischen Raum entfalten kann. Gleichzeitig ist die moderne Stadt im Grunde nichts weiter als eine heterogene Ansammlung von Orten, Techniken und Einrichtungen, die gewissermaßen als Gegenentwurf zum Zuhause erschaffen wurde, um das Glück und die Freiheit zu beherbergen, für die dort kein Platz mehr war. In der Stadt konnten die Menschen mit Hilfe von Arbeit, Konsum, Bildung, Kultur oder einfachen Vergnügungen jenen unreflektierten Naturzustand überwinden, der sie daran hinderte, Dinge zu verändern, die von einer vermeintlichen »biologischen« Ordnung oder von angeblichen Grundbedürfnissen vorgeschrieben wurden. Jahrhundertelang lag die Welt, in der man zumindest theoretisch mit anderen gleichgestellt sein konnte, darum jenseits der eigenen Haustür. Ob nun in Schulen, Kinos, Theatern, Restaurants, Bars, Museen, Clubs, Geschäften, Parks, Straßen, Parlamenten, Kirchen, Synagogen oder Moscheen, erst jenseits der eigenen vier Wände wurde die Welt wirklich erfahrbar. Erst außer Haus war sie voller Gesichter, Gegenstände und Ideen, die zu groß und intensiv waren, um in der Begrenztheit von Wohnzimmern und Küchen Platz zu finden.
Von Platon über Hobbes und Rousseau bis hin zu Rawls war die moderne Stadt so etwas wie der große Taschenspielertrick der Philosophie. Sie war eine Art philosophisches Trompe-l’œil, ein Traum von Freiheit und kollektives Trugbild, das die Menschen von ihrem Zuhause ablenken und seine Bedeutung herunterspielen sollte, so als sei es nicht mehr als ein Schrank, in dem man etwas verstaut, um es getrost vergessen zu können.
Allerdings hat sich die Philosophie nicht allein schuldig gemacht, denn das Zuhause wurde auch von anderen Disziplinen systematisch vernachlässigt. Im Laufe der Zeit hat es sich in eine Art Maschine verwandelt, die alles aufsammeln muss, worüber wir nicht öffentlich sprechen können oder sollen. Jahrhundertelang war das Haus der »Rest«, was übrig bleibt, wenn die Show vorüber ist, der Bodensatz, den niemand mit uns teilen konnte oder wollte.
Anders als die Städte sind die Häuser, aus denen sie bestehen, in aller Regel keine öffentlichen Orte. Nur in sehr wenigen Fällen kann sich die Allgemeinheit ein Bild von den Bewohnern, der Einrichtung oder den Ereignissen machen, die darin stattgefunden haben. Und selbst wenn etwas darüber bekannt ist, wird dieses Wissen niemals in derselben Weise geteilt wie das Wissen über die Stadt. Das Zuhause bleibt in aller Regel anonym und erhält keinen Namen, der die Zeiten überdauert. Identifizierbar ist es nur über topografische Koordinaten, die Adresse oder ein Türschild, das schon per definitionem austauschbar sein muss. Ein Blick auf jede x-beliebige Stadt genügt, um zu erkennen, wie absurd das ist. Wie würden wir wohl über Städte denken, wenn sie nicht Venedig, Marseille, Peking oder Dakar hießen, sondern nur GPS-Koordinaten wären oder alle zehn Jahre umbenannt würden?
Es ist beinahe so, als wollte das Zuhause gar nicht in der Zeit erkannt werden und seine Geschichte am liebsten verbrennen, um unbelastet von Erinnerungen eine neue beginnen zu können. Als ob das Zuhause eine Maschine wäre, die es dem Leben ermöglichte, keine Spuren zu hinterlassen. Als ob sich die Zeit in ihm nicht in Form von Geschichte anhäufen könnte, sondern das Zuhause ein zyklisch wiedererwachendes Bewusstsein wäre, das sich an nichts erinnert, was vor seinem Schlaf geschehen ist.
In den vergangenen Jahrzehnten sind diese Marginalisierungsmechanismen jedoch teilweise durchbrochen worden. So dienen die von der Industrie erdachten Konsumprodukte vor allem der Ausstattung des häuslichen Ambientes. Die Erfindung des Fernsehens hat die psychische Grenze zwischen städtischem und häuslichem Leben aufgehoben und den öffentlichen Raum ein Stück weit ins Haus geholt. Und schließlich erschufen die sogenannten sozialen Medien einen mobilen öffentlichen Raum ohne geografische Verankerung, der weitgehend dem Bild unserer Wohnungen nachempfunden ist.
Dieses Vordringen der Stadt und ihrer Geister ins Zuhause hat unsere Lebensrhythmen und die Art unseres Wohnens radikal verändert, wenn auch noch nicht seine Strukturen. Im Bestreben, das Glück jenseits unseres Zuhauses zu finden, scheinen wir uns in den Träumen von Männern und Frauen zu verfangen, von denen wir längst nichts mehr wissen. Die Badezimmer, Küchen, Flure und Schlafzimmer, in denen wir wenigstens die Hälfte unseres Lebens verbringen, und die dieser Aufteilung innewohnende funktionale Typologie unseres Zuhauses sind die Projektion von unzähligen »Ichs«, die die Welt schon vor langer Zeit verlassen haben. Das macht das moderne Zuhause zu einer Art platonischen Höhle, einer moralischen Ruine aus der menschlichen Vergangenheit. Wenn wir die Welt wieder in einen Ort mit hohem gemeinschaftlichen Glückspotenzial verwandeln wollen, müssen wir diese Erfahrung auf ganz neue Weise formen und mit Inhalt füllen.
In der modernen Philosophie steht die Stadt im Mittelpunkt, aber die Zukunft des Planeten kann nur im häuslichen Ambiente liegen. Wir müssen uns dringend mit dem Zuhause auseinandersetzen, denn es ist an der Zeit, diesen Planeten endlich in unser wahres Zuhause zu verwandeln, oder besser gesagt unser Zuhause in einen wahren Planeten, einen Ort also, an dem alle willkommen sind. Wir verwenden gerade große Anstrengungen darauf, unsere Städte zu globalisieren, dabei sollten wir lieber unsere Wohnungen öffnen, um sie mit der Erde in Einklang zu bringen.
Umzüge
Sie standen überall herum und hatten das Wohnzimmer in ein Labyrinth aus Pappe, Klebeband und Qualen verwandelt. Ich habe Umzugskartons immer schon gehasst. Allein schon ihre Farbe treibt einem jede Freude aus. Ich bückte mich, um den ersten anzuheben, als unvermittelt eine Welle aus verworrenen Erinnerungen über mich hinwegschwappte. Wie oft hatte ich genau das schon getan? Ich hielt einen Moment inne und versuchte, mich an die Anzahl der Umzüge zu erinnern, die ich bereits hinter mir hatte. Ich kam auf 30.
Ich konnte einfach nicht weitermachen. Es war Juli, ich lebte seit drei Jahren in Paris und hatte kaum zwei Tage Zeit für den Umzug. 48 Stunden, um 80 Umzugskartons zu kaufen, mein aus Kleidung, Geschirr, Büchern, Fotos und Erinnerungen bestehendes Leben darin zu verpacken, einen Transporter zu mieten, ihn zu beladen, an der neuen Wohnung wieder zu entladen und mein Leben an diesem mir nahezu unbekannten Ort wieder aufzunehmen. Ich wollte mit meiner damaligen Partnerin zusammenziehen, mit der ich eine Tochter erwartete. Wir lebten übergangsweise in einer Wohnung im Süden der Stadt, die einem nach Berkeley gezogenen Freund gehörte. Von dort aus wollten wir in aller Ruhe nach »unserem Zuhause« suchen, einem Ort, an dem alles — von den Wänden über die Möbel und Einrichtungsgegenstände bis hin zu den Empfindungen — unseren gemeinsamen Vorstellungen entsprach. Umzüge sind das profane, alltägliche Pedant zum Jüngsten Gericht, in dem die Verdammten von den Auserwählten getrennt werden und eine Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart gezogen wird, die zugleich die Grenze zwischen Schmerz und Glück ist. Umzüge sind Übergangs- und Verwandlungsrituale.
Wir wohnten vier Monate in diesem Übergangsdomizil und fanden erst einige Wochen vor dem Umzug eine Wohnung in den östlichen Vororten von Paris. Dort lebten Künstler, Designer und junge Paare. Die Räume hier waren größer und die Parks grüner, weshalb man nicht das Gefühl hatte, im Einzugsgebiet der Hauptstadt, sondern bereits in einem Dorf in der Provinz zu wohnen.
Wir blieben kaum ein Jahr in Montreuil, denn ich erhielt eine Einladung in die Vereinigten Staaten, und wir zogen nach New York. Dort lebten wir nun zu dritt neun Monate lang in einer kleinen Wohnung an der Upper West Side, nur einen Steinwurf von der Universität entfernt, an der ich arbeitete. Die Wohnung befand sich in einem von diesen typischen New Yorker Gebäuden mit einem Pförtner, der Tag und Nacht hinter einem großen Tresen saß und den Eingang bewachte. Hier machte meine Tochter Colette ihre ersten Schritte. Ich war nur mit wenigen Taschen angekommen, doch am Ende meines Aufenthalts hatten sich Dutzende Kartons mit Besitztümern angesammelt, die ich über den Atlantik verschicken musste. Mit anderen Worten, ein Großteil dieses New Yorker Lebensjahres reiste getrennt von mir.
Zurück in Europa zogen wir wieder in die Wohnung am Stadtrand von Paris. Aber auch diesmal blieb ich dort nicht lange, denn nur ein Jahr später verließ mich meine Partnerin. Also suchte ich mir eine andere Wohnung und verpackte Leben und Ängste erneut in Pappkartons.
Aber auch das war nicht von Dauer, denn über viele Jahre zog ich durchschnittlich einmal pro Jahr um und wechselte mit der Wohnung meistens auch die Stadt. Nicht selten befand sich mein neues Zuhause in einem anderen Land, Tausende Kilometer vom alten entfernt. Zu dieser Zeit bedeutete ein Umzug für mich, dass ich fast alles aufgeben musste, was ich hatte. Und beileibe nicht nur die Möbel.
Zum bislang letzten Mal bin ich vor anderthalb Jahren umgezogen. Die Wohnung liegt unweit der Kirche Saint Germain, in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das sich von außen gesehen gefährlich nach innen zu neigen scheint. Anders als die aus derselben Zeit stammenden Hôtels particuliers hat es so gar nichts Herrschaftliches an sich und man sieht ihm sein Alter an. Die Flachreliefschilde, die die Hofwand neben dem Efeu zieren, haben sehr unter dem sauren Regen gelitten und sind stark verwittert. Im Hof liegt auch die halboffene Treppe, die zu meiner Wohnung führt. An den Wänden des Treppenhauses hat die Zeit ebenfalls ihre Spuren hinterlassen, doch niemand hat es je gewagt, sie zu beseitigen. In diesem Fall sind die Altersflecken nämlich ein Zeichen der Schönheit. Zum ersten Mal liebe ich den Ort, an dem ich lebe.
Dessen ungeachtet werde ich wahrscheinlich nicht sehr lange dort bleiben. Denn obwohl ich einen starken Widerwillen gegen Umzugskartons empfinde, von denen mittlerweile 150 im Keller auf ihren Einsatz warten, habe ich keine Angst davor, ein weiteres Mal umziehen zu müssen.
Im Laufe der Jahre habe ich über 30 Mal ein neues Zuhause betreten und schließlich wieder verlassen. Während ich das schreibe, wird mir klar, dass ich noch nie versucht habe, mir alle meine Wohnungen nebeneinander vorzustellen. Und das ist auch verständlich, denn dabei käme ein kleines Stadtviertel aus völlig unvereinbaren Welten heraus. Jedes Zuhause enthielte Gesichter, die ich kaum wiedererkennen würde und mit denen ich in meinem jetzigen Leben so gut wie nichts gemeinsam hätte.
30 Ansammlungen von Wänden, die das, was ich als meins betrachtete, aufnahmen, schützten und behüteten. Aber nicht im Sinne von Recht und Besitz, denn vieles von dem, was »mein« war, war nicht durch ein Eigentumsverhältnis an mich gebunden, das ich vor Gericht hätte geltend machen können. Es handelte sich nämlich nicht nur um materielle Dinge, es waren Erinnerungen, Empfindungen, Erfahrungen und vor allem die Leben anderer Menschen, die mir zwar nicht gehörten, aber trotzdem auch meine waren.
30 Zuhause sind vor allem 30 Orte unterschiedlicher Form und Größe, die an meiner Stelle »Ich« sagten. Aber keines von ihnen hat es geschafft, den richtigen Ton zu treffen, denn meine eigene Stimme habe ich in ihnen nicht wiedererkannt.