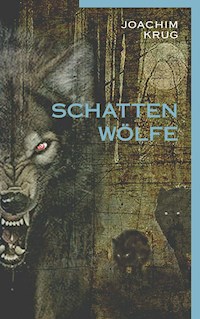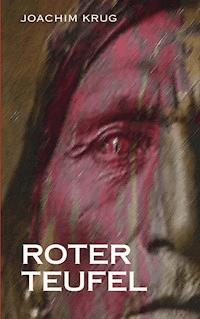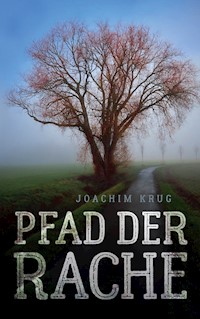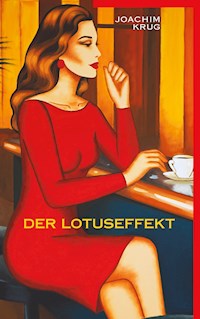Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tod eines Studenten, der sich vor einen Zug wirft, wird kurzerhand als Selbstmord zu den Akten gelegt. Als wenig später ein Rollstuhlfahrer von einem Linienbus erfasst wird, behauptet dessen Mutter, die beiden Studenten seien von einer eifersüchtigen und neidischen Kommilitonin verflucht und in den Tod getrieben worden. Ist es tatsächlich möglich, dass die Psychologiestudentin Lucie von Steinbach diese Männer mittels parapsychologischer Kräfte getötet hat? Hauptkommissar Jan Krüger fühlt sich überfordert und bittet seinen Freund Maynard Deville, einen Schamanen mit telepathischen Fähigkeiten, um Hilfe. Und plötzlich nimmt der Fall eine kaum für möglich gehaltene, umerwartete Wende...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
»Die Frau mit dem zweiten Gesicht ist gesegnet und verflucht zugleich, als ob alles Unheil dieser Welt in ihrem schmalen Körper Platz fände.«
Lucie von Steinbach, die »Hexe von Connewitz«
Eine Hexe mit dämonischer Macht, vermag den Himmel niederzulegen, die Erde aufzuhängen, Quellen zu vertiefen, Berge zu schmelzen, Geister heraufzuholen, Götter herabzuziehen, Sterne auszulöschen, tatsächlich die Unterwelt zu illuminieren.
Apuleius, antiker Schriftsteller und Philosoph, 125 - 170
Als Tom Smith noch einmal am Klavier Platz nahm, im Hintergrund wabernde Lichtstrahlen seine Silhouette herausarbeiteten und sich der Song langsam aber unaufhaltsam steigerte, gingen ein letztes Mal die Hände in die Höhe und die begeisterte Menge sang enthusiastisch jedes einzelne Wort des Refrains mit.
These are the marching orders/These were the rules that we break/These are the doubts we cling to/Tryin’ to get more/Tryin’ to get more…
Hannah und Jan waren so frühzeitig im Haus am Auensee eingetroffen, damit sie einen Platz ganz vorn an der Bühne ergattern konnten. Die Editors waren Hannahs Lieblingsband, der Bandleader Tom Smith neben Chris Martin von Coldplay einer ihrer absoluten Favoriten. Jan war zunächst nur widerwillig dem Wunsch seiner Freundin nachgekommen, die schweineteuren Konzertkarten zu besorgen und sich dann noch wie ein Teenager in Schlagdistanz zur Band in die erste Reihe zu stellen. Seit er bei einem Black Sabbath-Konzert in Oberhausen gut zehn Jahre zuvor von Ozzy Osbourne direkt vor der Bühne stehend, wie Schlachtvieh mit einem eiskalten Wasserschlauch abgespritzt worden war und danach mitten im Winter wie ein Wischmob durchnässt den Heimweg antreten musste, hatte er sich geschworen, sich nie mehr bei einem Rockkonzert so weit nach vorn zu wagen. Ganz zu schweigen von der amtlichen Erkältung, mit der er sich danach geschlagene vier Wochen herumschleppen musste. Bei dem Gedanken daran fröstelte es ihm immer noch.
Die dichtgedrängte Menge bewegte sich im Rhythmus der Musik und ob er wollte oder nicht, er wurde durch die Masse der Leiber wie ein Pendel von rechts nach links geworfen, bis er schließlich das Gleichgewicht verlor und auf seinen Nebenmann prallte, dessen halbvoller Bierbecher im hohen Bogen durch die Luft flog und seinen lauwarmen Inhalt auf Jans Lederjacke vergoss. »Oh sorry«, entschuldigte er sich bei dem Typen, der ihn kopfschüttelnd anstarrte. »Ey, Opa, issen Rockkonzert hier, der Seniorentanztee findet morgen Abend draußen auf der Seeterrasse statt. Hast dich wohl im Datum geirrt, oder?«
Im Augenwinkel sah er wie Hannah ausgelassen feierte. Sie sprang, sie tanzte und sie sang den Refrain so inbrünstig, als wäre es das Letzte, was sie noch auf Erden tun würde, bevor sie mit einem großen Knall unterginge. In dem Pulk der zwanzig- bis vierzigjährigen kam er sich als beinahe sechzigjähriger vor wie ein Fossil aus längst vergangenen Zeiten. Klar, seine Rockidole waren entweder steinalt oder hatten schon längst das Zeitliche gesegnet. Jim Morisson, Robert Plant, Ian Gillan oder Ozzy Osbourne kannte hier wahrscheinlich keiner mehr. Obschon, oftmals war er überrascht, wie gut sich die junge Generation mit der Rockmusik der Siebziger auskannte. Die Meute um ihn herum allerdings machte nicht den Eindruck, als würde sie sich für Klassiker wie Riders On The Storm oder Stairway To Heaven interessieren. Aber klar, er hatte die Musik, die seinem Vater gefiel, auch nicht gemocht. Im Gegenteil, er hatte es gehasst, wenn zu jeder sich bietenden Gelegenheit James Last-Platten gespielt wurden. Non Stop Dancing Nummer eins bis gefühlt hunderttausend, sein Vater konnte von diesem Gedudel nicht genug kriegen, während sich ihm regelmäßig die Zehennägel kräuselten, wenn sich die Nadel auf das schwarze Vinyl senkte.
Jan war das Konzert eine Spur zu ruhig, die einzelnen Songs zu düster und viel zu melancholisch. Ein paar Songs gefielen ihm aber dennoch ausgesprochen gut. Immer dann, wenn Stücke aus dem Debütalbum der Band gespielt worden, die sich durch einen treibenden, gitarrenlastigen Sound auszeichneten, packte auch ihn das Tanzfieber, das sich allerdings nicht mehr als in einem leichten Kopfwippen bemerkbar machte. Harte Männer tanzen nicht. Songs wie Lights, Munich oder Blood erinnerten ihn ein stückweit an die Chameleons, eine englische Rockband, die Mitte der Siebziger Hits wie Up The Down Escalator, Don’t Fall und Paper Tigers hatten. Diese unsterblichen Riffs fanden sich in diesen Editors-Songs durchaus wieder. Wenigstens etwas, dachte er und warf einen Blick auf die Uhr. Noch eine Zugabe konnte er jetzt nicht gebrauchen. Schließlich wollte Hannah nach dem Konzert noch was Trinken gehen. Und wenn seine Freundin einmal in Stimmung war, konnte der Abend erfahrungsgemäß lang und die Nacht verdammt kurz werden. Er hatte ihr versprochen, heute mal so richtig einen Drauf zu machen, egal, ob am nächsten Morgen wieder die Pflicht rufen würde oder nicht. Und klar, versprochen war versprochen, da zählten keine Ausreden.
Vorsichtshalber hatte Jan ihren Chef Rico Steding vorgewarnt, dass er morgen nicht vor Mittag mit ihnen rechnen sollte. Der hatte nur süffisant gegrinst und ihm einen schönen Abend gewünscht, wohlwissend, wie Hannah drauf war, wenn sie mal so richtig ausgelassen feiern ging. Jetzt blieb ihm nur die Hoffnung, dass sie heute Nacht nicht auch noch zu einem Einsatz gerufen würden. Der Gedanke daran ließ ihn kurz zusammenzucken, als die letzten Takte von Marching Orders erklangen und sich nach der zweiten Zugabe das endgültige Ende des Konzerts andeutete. Der Jubelsturm der gut 2.500 Editors-Fans ließ ihm beinahe das Trommelfell platzen. Okay, es reicht, ihr wart gut aber untersteht euch, noch einen Drauf zu legen, dachte Jan und hielt schon mal Ausschau nach einer Schneise, durch die sie sich den schnellsten Weg Richtung Ausgang bahnen konnten.
Doch er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Besser gesagt, ohne die euphorisierten Fans. Die elektrisierte Menge begann zu trampeln und zu springen und forderte mit stakkatoartigem Klatschen eine weitere Zugabe. Und Hannah mittendrin. Sie schrie sich die Seele aus dem Leib: »Zuga-be, Zu-ga-be!«
Jan schüttelte verständnislos den Kopf. Dann zuckte er mit den Schultern. Was soll’s, wer A sagt muss auch B sagen, dachte er sich und stimmte solange in den Chor der Fans mit ein, bis die Engländer ein drittes Mal zurück auf die Bühne kamen.
Make our escape, you’re my own Papillon/The world is too fast, feel love before it’s gone, sang Tom Smith.
Jan nickte, Recht hat er, der gute Mann, sagte er sich und begann zu tanzen, richtig zu tanzen.
Ein halbe Stunde später standen sie draußen vor dem Konzertsaal des Hauses am Auensee und umarmten sich in der bereits feuchtkalten Nachtluft. »Danke, mein Schatz«, seufzte Hannah und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Atemberaubend ist die einzige Vokabel, die mir einfällt. Die Band war super und Tom Smith, hey, der Kerl ist einfach nicht von dieser Welt«, schwärmte sie.
»Ja, der hat mich sogar ein bisschen an den jungen Neil Young erinnert. Der war…«
»…wie bitte? Das war, äh, ist doch dieser hässliche, kauzige Eigenbrötler, der so nuschelt, als hätte der ’ne heiße Kartoffel zwischen den Zähnen? Und den vergleichst du mit dem Halbgott Tom Smith, diesem begnadeten Sänger und Songschreiber, dieser männlichen Sexbombe auf zwei Beinen?« Hannah grinste ihn provozierend an.
»Genau, Entschuldigung, wie konnte ich nur? Ich dachte der Kerl schläft jeden Moment ein und kippt von der Bühne, nur gut, dass ihn zwischendurch mal die Gitarren seiner Band geweckt haben«, lachte Jan.
Hannah gab ihm einen Stupser in die Seite. »Ist da etwa einer eifersüchtig? Na ja, von der Bettkante würde ich diese Sahneschnitte bestimmt nicht stoßen.«
»Wäre wohl auch nicht nötig, der wäre wahrscheinlich vorher bei seinen eigenen Songs eingepennt«, konterte Jan.
Die beiden mussten lauthals lachen. »Also gut, was machen wir jetzt mit diesem angebrochenen Abend?«, fragte Hannah.
»Ab ins FachWerk würde ich sagen«, schlug er vor, hakte Hannah unter und zusammen machten sich die beiden zu Fuß auf den Weg in das nur etwa fünfhundert Meter entfernte Café am Rande der Weißen Elster.
Das gemütliche Restaurant in der Rittergutstraße war nach dem Konzert im Haus am Auensee bereits gut besucht, doch die beideb hatten Glück und konnten noch einen kleinen Tisch direkt am Fenster der ehemaligen guten Stube des unter Denkmalschutz stehenden, liebevoll restaurierten, Fachwerkhauses ergattern. Jan hatte einen Bärenhunger und hoffte, dass die Küche auch noch kurz nach Mitternacht geöffnet hatte.
»Tut mir leid, was Warmes kann ich Ihnen leider nicht mehr anbieten«, zuckte die Bedienung entschuldigend die Schultern. »Aber ich kann unsere Käse-Salami-Platte mit selbstgebackenem Bauernbrot und Kräuterbutter aus der Provence empfehlen, sehr lecker.«
Jan lief das Wasser im Munde zusammen. »Sehr gerne und bringen Sie uns bitte eine Karaffe halbtrockenen Rotwein und eine Flasche Mineralwasser medium.«
Hannah griff nach der Hand ihres Freundes. »Vielen Dank, das war wirklich ein schöner Abend. Das Konzert war unglaublich. Die Editors live, wow, so schnell kommen die sicher nicht mehr nach Leipzig. Und ich war dabei, hey, davon werde ich wohl noch meinen Enkeln erzählen.« Hannahs Augen glänzten.
»Enkel? Puh, na, dann müssen wir uns aber ranhalten«, grinste Jan.
»Hm, klar, in deinem Alter. Wer weiß, wie lange das noch klappt?«
»Was soll das denn heißen, junge Frau? Gibt es etwa Anlass zu klagen?«
»Nee, aber wenn wir nicht bald zu Potte kommen, werden die Freunde deiner Kinder womöglich glauben, du wärst nicht der Vater sondern der Opa.«
»Okay, also dann müssen wir wohl in Sachen Umfang und Intensität ’nen Zahn zulegen, oder?«
»Versprich nicht, was du nicht halten kannst, Großer«, lachte Hannah.
Mittlerweile war der Laden brechend voll. Eng aber gemütlich, dachte sie, beugte sich über den Tisch und gab ihrem Freund einen Kuss.
»Muss mal kurz für kleine Mädchen, bin gleich wieder zurück«, sagte sie, stand auf und verschwand Richtung Theke, an deren Kopfseite sich der Eingang zu den Toiletten befand. Als sie gerade die Tür öffnen wollte, sprach sie jemand von hinten an. »Ach, da sieh mal einer an, Hähnchen, was für eine Überraschung. Dass ich dich so schnell wiedersehen werde, hätte ich echt nicht gedacht.«
Hannah zuckte zusammen. Diese Stimme kannte sie. Sie hielt kurz inne, dann drehte sie sich langsam um. Ein großer, kräftiger Kerl mit schmalzigen, zurückgekämmten Haaren grinste sie an.
»Ricky, was für ’ne Überraschung. Ich dachte du sitzt noch, oder sind die sechs Jahre etwa schon rum?«
»Nee, bin wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden.« »Ach, warst wohl so ’ne Art Musterhäftling, wie? Na dann, Glückwunsch, Ricky. Man sieht sich«, sagte Hannah und wollte weitergehen, als sie plötzlich ein kräftiger, tätowierter Arm am Handgelenk packte.
»Hey, nicht so schnell, Hähnchen. Ich denke, wir zwei haben da noch ’ne kleine Rechnung offen, oder?«
»Nimm gefälligst deine ungewaschenen Wichsgriffel weg, Freundchen, sonst…«
»…sonst was? Rufst du etwa Opa Bernstein zu Hilfe? Ach nee, der Spast ist doch sicher schon Rentner, oder? War damals kein feiner Zug von dir, Hähnchen, einen alten Klassenkameraden dermaßen vor Gericht in die Pfanne zu hauen. Aber ich hätt’s mir ja denken können. Hast in der Schule ja schon gepetzt. Sag mal, war dein Alter nicht bei der Stasi? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, deswegen bist du wohl auch Bulle geworden, oder?«
Hannah versuchte sich dem festen Griff zu entziehen, doch Ricky Buchner war ein kräftiger Bursche. Was er nicht im Kopf hatte, hatte er in den Armen. Eine gefährliche Konstellation, wie Hannah wusste. Der Kerl stammte wie sie aus Markranstädt und war schon zu Schulzeiten ein gefürchteter Rabauke gewesen. Dass er mal irgendwann auf die schiefe Bahn geraten würde, war praktisch vorprogrammiert.
»Es reicht jetzt, Ricky, lass mich los, sonst landest du schneller wieder im Knast, als dir lieb ist.«
»Warum denn so zickig, Hähnchen? Früher warst du viel lockerer. Hatten doch ’ne Menge Spaß zusammen, oder?«
»Wir? Nicht, dass ich wüsste.«
»Na ja, du hast immer lieber mit diesen Bürschchen aus gutem Hause rumgemacht. Denen hast du das Hirn rausgevögelt, warst echt ’n steiler Zahn, Hähnchen. Es hieß immer, du würdest besonders gut blasen. Würd ich ja mal gern rausfinden.«
Ricky zog Hannah zu sich heran und versuchte ihr in den Schritt zu fassen, als ihn von hinten eine kräftige Hand an der Schulter packte.
»Hey, Cowboy, es reicht, nimm deine Pfoten weg.«
Ricky drehte sich um und blinzelte Jan aggressiv an. »Was willst du denn, Opa? Jetzt sag bloß nicht, dass du was mit diesem hässlichen Fossil hast, Hähnchen.«
Mittlerweile war der Wirt hinter der Theke auf die Streithähne aufmerksam geworden.
»Wenn ihr euch prügeln wollt, dann macht das draußen. Hier drinnen ist Ruhe, klar, sonst rufe ich die Polizei.«
»Nicht nötig, die ist schon da«, rief Jan und hielt seinen Ausweis in die Höhe.
»Oh, dein neuer Partner, Hähnchen? Sag mal, warum stecken die dich immer mit diesen alten Knackern zusammen? Hast du irgendwas ausgefressen, oder haben die jungen Bullen Angst vor dir, heh?« Ricky wollte sich über seinen vermeintlichen Scherz halb totlachen.
»Was ist so lustig, Fettsack? Komm, erzähl, dann kann ich mitlachen«, provozierte Jan.
»Pass mal auf, du Affe, ich kloppe dir gleich deine Fressleiste so tief in den Rachen, dass du dir die Zahnbürste durch den Arsch einführen musst, klar?«
Mittlerweile hatte Ricky Hannah losgelassen und sich bedrohlich nahe vor Jan aufgebaut. Der Wirt griff zum Telefon, als ihm einer von Rickys Kumpels auf den Arm schlug. »Hey, lass das Freundchen, wir haben hier was zu klären, verstanden?«
Hannah schob sich an den Streithähnen vorbei und fasste Jan am Arm. »Komm wir gehen«, forderte sie.
»Moment, ich bin hier noch nicht fertig. Außerdem steht mein Essen auf dem Tisch. Und was ich bestellt und bezahlt habe, esse ich auch auf.«
»Das wird aber schwierig sein, so ohne Zähne, Opa«, schnauzte Ricky und stieß ihm die flache Hand vor die Brust. Hannah wusste genau, was jetzt passieren würde und versuchte ein Letztes Mal, die Streithähne zu trennen.
»Lass gut sein, Ricky, trink dein Bier und beruhige dich. Du weißt, was dir blüht, wenn du einen Polizisten angreifst. Du fährst in Nullkommanichts wieder ein.«
»Polizist? Ich sehe hier keinen. Nur so ein mieses, altes Arschloch, das mich angepackt und beleidigt hat. Oder, Jungs, was meint ihr?«, brüllte Ricky.
Jan wusste genau, dass er handeln musste. Und zwar jetzt. Diese Typen würden nicht mehr einlenken. Ein kurzer Blick in seine Augen genügte und Hannah hatte erkannt, dass es zu spät war, Jan zu bremsen. Sie trat einen Schritt zurück und zuckte machtlos die Achseln.
»Also, Speckschwarte, dann lass mal sehen«, winkte er Ricky zu sich heran. Der ließ sich nicht lange bitten und holte weit aus, um seinen Kontrahenten mit einem kapitalen Schwinger ins Land der Träume zu schicken. Kein Problem für Jan, den viel zu langsamen Schlag auszupendeln. Ricky wurde vom Schwung seines Heumachers aus dem Gleichgewicht gebracht und hatte sichtbar Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
»Nicht so stürmisch, Freundchen«, provozierte er, wohlwissend, dass dieser Spruch Ricky noch wütender machen würde. Der drehte sich um und stürmte wie ein wild gewordener Stier auf seinen Gegner zu. »Ich mach dich alle, du Drecksau«, schrie er außer sich vor Zorn.
Adrenalinverseuchte Hitzköpfe waren Jans liebste Gegner, weil es relativ einfach war, mit ihnen fertig zu werden. Er wartete, bis der große, schwere Kerl sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf ihn stürzte. Dann schlug er blitzschnell eine kurze trockene Gerade auf das Brustbein des Angreifers. Das Knacken des Knorpels übertönte für einen kurzen Moment die Musik im Raum. Ricky Buchner sackte zu Boden wie eine Marionette, deren Fäden gekappt worden waren.
Als einer seiner Kumpel sich aus dem Hinterhalt auf Jan stürzen wollte, trat Hannah dem Kerl von hinten in die Kniekehle, ebenso, wie er es ihr beigebracht hatte. Laut aufschreiend, sank der Typ in die Hocke und krümmte sich vor Schmerzen.
»Okay, Leute, alles unter Kontrolle. Wir rufen jetzt die Kollegen. Sie können sich alle wieder hinsetzen. Die Show ist vorbei«, rief Jan.
»Lass uns hier verschwinden«, flüsterte Hannah.
»Und meine Käse-Salami-Platte und der teure Rotwein?«, wollte Jan noch bleiben.
»Ein anderes Mal. Komm jetzt, bevor diese Typen wieder zu sich kommen.« Sie fasste ihren Freund am Arm und zog ihn Richtung Ausgang.
»Wie hat der Kerl dich gerade genannt? Hähnchen?«, fragte Jan. »Wie kommt der denn da drauf? Hähnchen - ich fass es nicht«, schüttelte er den Kopf.
»Egal, erzähl ich dir später und jetzt raus hier«, hatte es Hannah eilig.
Marktplatz von Crockwell, New South Wales, Australien
Maynard reichte der Kundin den Beutel mit den Tomaten. »2,95, bitte«, sagte er und nahm einen Zehn-Dollar-Schein entgegen. Währenddessen fiel sein Blick auf zwei unbekannte Männer, die ein paar Meter weiter mit einer älteren Frau sprachen.
»Äh, Entschuldigung, aber zehn Dollar ist doch wohl ein wenig happig für ein Kilo Tomaten, auch wenn das zweifelsfrei die besten sind, die man hier weit und breit bekommen kann.«
»Oh, natürlich. Tut mir leid…, äh, einen Moment bitte«, antwortete Maynard und suchte in seiner Kasse das Wechselgeld zusammen.
Die Frau des Bäckers nahm das Geld und lächelte. »Nicht ganz bei der Sache heute, James, wie?«
»Nein, nein, alles in Ordnung. Ich dachte nur, ich hätte da gerade…«
»…eine schöne Lady entdeckt? Na ja, als Junggeselle sollte man immer die Augen offenhalten. Wer weiß, irgendwann läuft einem bestimmt mal die Richtige über den Weg.«
»Äh, nein, ich …, na ist ja auch egal. Einen schönen Tag noch, wünsche ich. Danke für den Einkauf.«
»Nichts zu danken, James, immer gern. Wir sehen uns morgen früh«, verabschiedete sich Eileen, die zusammen mit ihrem Mann die Bäckerei am Marktplatz führte, in der Maynard jeden Morgen Brot und Brötchen kaufte.
Die beiden Männer standen immer noch da und diskutierten gestikulierend mit der alten Frau gegenüber. Er schloss seine Kasse, verstaute sie unter seiner Regenjacke unterm Tresen, zog seine Schürze aus und beschloss, dort drüben mal nach dem Rechten zu sehen. Er hatte diese Männer hier noch nie zuvor gesehen und zwei Typen in dunklen Anzügen und Sonnenbrillen verhießen mit Sicherheit nichts Gutes. Entweder waren das Polizisten oder Gangster. Und beides bedeutete Ärger. Ärger, dem eine alte Frau allein nicht gewachsen war. Auch nicht Meredith, obwohl sie alles andere, als auf den Mund gefallen war.
»Gibt’s ein Problem?«, erkundigte sich Maynard.
»Wer will das wissen?«, antwortete der Kleinere der beiden, drehte sich um, nahm seine Sonnenbrille ab und zuckte kurz zusammen, als er einem hünenhaften, breitschultrigen Indianer mit tiefen Narben im Gesicht gegenüberstand. Ein Anblick, der ihm sichtlich Unbehagen bereitete.
»Wer seid ihr und was wollt ihr von der Frau?«, fragte Maynard gereizt.
»Ich denke nicht, dass dich was angeht, Freundchen«, nahm der Kerl seinen ganzen Mut zusammen, darum bemüht, vor diesem Riesen nicht einzuknicken. »Und jetzt schleich dich, wir haben hier was zu klären.« Der Typ setzte seine Brille wieder auf und wandte sich erneut Meredith zu.
»Hören Sie, gute Frau, das ist kein Bagatelle. Dafür kommen Sie ein paar Jahre hinter Gitter. Und ob Sie das in Ihrem Alter noch überleben werden, ist eher unwahrscheinlich. Also, wo sind die beiden? Raus mit der Sprache. Wir wissen, dass Sie denen geholfen haben, unterzutauchen. Spannen Sie unsere Geduld nicht länger auf die Folter, sonst nehmen wir Sie mit und führen Sie dem Haftrichter vor«, drohte der Mann, währenddessen sein jüngerer Kollege Maynard abschätzend musterte.
»Was wollen diese Typen von dir, Meredith? Kann ich dir irgendwie behilflich sein?«
»Ach, schon gut, James, ich denke, die beiden Herren sollten jetzt gehen und wiederkommen, wenn sie Beweise für ihre abstrusen Anschuldigungen haben.«
»Beweise? Brauchen wir nicht. Es gibt Zeugen, die Sie zusammen mit den Flüchtigen gesehen haben. Das reicht aus, um Sie festzunehmen, kapieren Sie das?«
»Ihre Ausweise bitte«, grätschte Maynard dazwischen.
»Ich habe dir gesagt, du sollst dich verpissen. Wer bist du überhaupt? ’Ne billige Kopie von Sitting Bull oder Crazy Horse? Ja, ist denn schon wieder Karneval in Crockwell? Ich glaub’ s gerade nicht.«
»Wenn sie sich nicht ausweisen können, möchte ich sie bitten, zu gehen«, forderte Maynard.
Der Jüngere machte wütend einen Schritt auf Maynard zu, als sein Chef ihn an der Schulter zurückhielt. »Nein, Robertson, schon gut.«
Der Chef griff in die Innentasche seines Jacketts, holte einen Ausweis heraus, klappte ihn auf und hielt ihn Maynard vors Gesicht. »Chief Gerald Gardner, Bundespolizei, Einwanderungsbehörde und Sie sind?«
»Das ist James, mein Freund und Beschützer, er hat eine Farm draußen an der Redground Road«, sagte Meredith.
»Hm, na gut. Dann werden wir uns wohl mal bei Ihnen umsehen müssen, Miss«, sagte der Chef, der offenbar wenig Lust auf eine Auseinandersetzung mit diesem respekteinflößenden Hünen hatte.
»Wenn Sie einen Durchsuchungsbeschluss vorlegen können, jederzeit gern und jetzt würden wir hier gern wieder unsere Arbeit machen. Vom Rumstehen und Labern verdienen wir nämlich nichts«, blieb Meredith, die jeden Donnerstag auf dem Markt Blumen und handgefertigten Holzschmuck verkaufte, standhaft.
»Ihr habt’s gehört, Freunde«, grinste Maynard.
»Dir wird dein dreckiges Grinsen schon noch vergehen, Geronimo«, meckerte Robertson.
»Hören Sie, Mr…«,
»…Deville«, ergänzte Maynard.
»Meinetwegen, Deville, oder wie auch immer. Ich rate Ihnen, sich nicht weiter in unsere Angelegenheiten einzumischen, sonst werden wir Sie mal genauer unter die Lupe nehmen müssen. Und glauben Sie mir, wir finden immer, was wir finden wollen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wenn Sie tatsächlich helfen wollen, dann überzeugen Sie diese alte Dame besser davon, uns zu verraten, wo sie diese dreckigen Mexikaner versteckt hat. Die sind letzte Woche aus dem Hochsicherheitslager für Migranten in Blaxland geflohen und zuletzt hier in Crockwell gesehen worden. Wir werden diese Typen finden. Mit oder ohne ihre Hilfe. Und wenn wir herausbekommen, dass sie denen geholfen haben, irgendwo unterzutauchen, wird sie die volle Härte des Gesetzes treffen. Illegale zu beherbergen, ist sicher kein Kavaliersdelikt. Das bedeutet in der Regel eine mehrjährige Haftstrafe. Ich hoffe, das ist ihnen klar«, belehrte Chief Gardner. »Kommen Sie, Robertson, wir verschwenden hier nur unsere Zeit.«
»Einen wunderschönen Tag noch, die Herren«, rief Meredith den Beamten grinsend hinterher.
Als Hannah um kurz nach acht in die Küche kam, saß Jan bereits am Frühstückstisch und trank Kaffee.
»Schläfst du eigentlich nie, oder leidest du unter seniler Bettflucht? Ist ja nicht normal, ich bin immer noch totmüde und du sitzt hier putzmunter wie ’n Fisch im Wasser, frühstückst in aller Ruhe und Gelassenheit und liest gemütlich die Tageszeitung. Alter Falter, du bist echt ’ne Maschine, Jan Krüger!«
»Und frische Brötchen habe ich auch schon geholt, mein Schatz. Setz dich, der Kaffee ist gleich durchgelaufen.«
»Hm, alles in Ordnung bei dir? Hast du mir vielleicht irgendwas zu beichten oder so?«
»Ich? Nee, wieso? Schlaf wird allgemein überbewertet. In Afghanistan haben wir…«
»Ja ja, ich weiß, da habt ihr manchmal tagelang gar nicht geschlafen. Klar, weil ihr euch mit literweise Cardiazol, Pentetrazol und Ephedrin zugeschüttet hattet bis der Arzt kam. Da warst du aber auch ein Vierteljahrhundert jünger, Herr Major.«
»Boah, Vierteljahrhundert? Wie klingt das denn? Komme mir vor wie Methusalem.«
»Okay, das sah aber gestern Abend nicht so aus. Hast dem lieben Ricky ’ne amtliche Rechte verpasst. Sein Brustbein hat geknackt wie ’n morscher Ast. Da wird der noch ’n paar Wochen mit zu tun haben.«
Jan zuckte die Schultern. »Wer nicht hören will, muss fühlen. Aber du wolltest mir noch erzählen, woher du den Kerl kennst.«
»Aus Markranstädt. Sind früher zusammen zur Schule gegangen. Sein Vater hatte nach der Wende die Tankstelle an der Lützner Straße übernommen. Ricky hat da gearbeitet. Jedenfalls solange, bis er komplett auf die schiefe Bahn geraten ist. Hat mit seinen Kumpels Einbrüche auf Bestellung ausgeführt. Als er unten am Kulkwitzer See ’ne Villa eines reichen Leipziger Autohausbesitzers ausrauben wollte, haben wir ihn geschnappt. Der war so dämlich und hat draußen am Tor die Überwachungskamera übersehen und sich direkt darunter die Maske vom Kopf gezogen. Bernstein und ich haben ihn noch in derselben Nacht verhaftet. Und da er bereits mehrfach vorbestraft war, hat der Richter ihm volle acht Jahre verpasst. Na ja, wohl auch deshalb, weil er dem Aupairmädchen ’ne Eisenstange über den Schädel gehauen hat. Gott sei Dank hat die überlebt, sonst wäre Ricky lebenslänglich in den Knast gewandert.«
»Hm, klingt fast so, als hättest du Mitleid mit dem Kerl.«
»Mitleid? Nee, das ist das falsche Wort. Ricky hatte zwar immer ’ne große Klappe, aber wenn’s drauf ankam, hat der schnell den Schwanz eingezogen. Ganz nach dem Motto, Hunde, die bellen, beißen nicht. Im Grunde war er ein harmloser Aufschneider, der gern seine Muskeln gezeigt hat, aber nie jemanden was getan hat. Na ja, bis auf ein paar Raufereien unter Gleichaltrigen.«
»Und jetzt ist er sauer auf dich, weil du ihn damals eingelocht hast.«
»Keine Ahnung. Ich war seinerzeit ja noch ganz frisch dabei. Glaube nicht, dass der mich bei der Festnahme überhaupt erkannt hat. Seine Wut richtete sich wohl eher gegen Hans Bernstein. Der hatte ihn bereits vorher ein paar Mal erwischt. Muss ihn anrufen, denke ich, damit er weiß, dass Ricky wieder draußen ist.«
»Und aus welchem Grund hat der dich »Hähnchen« genannt?«
»Tja, keine Ahnung. Plötzlich hatte ich diesen Spitznamen weg. Zum einen war »Hähnchen« wohl ’ne Ableitung von Hannah, zum anderem war ich als junges Mädchen ziemlich dürr. So ’ne Art halbe Portion, oder eben auch ’n halbes Hähnchen. Hat mich ehrlich gesagt nicht besonders gestört. Zumal meine Freunde mich nie so genannt haben.«
»Was meinte er denn damit, du wärst ein steiler Zahn gewesen und hättest mit den Bürschchen aus reichem Hause rumgevögelt?«
»Na ja, als ich dann mit dem Schwimmen angefangen habe, hat sich mein Körper relativ schnell verändert. Aus dem Hähnchen war in kurzer Zeit ein gut gebautes, strammes Huhn geworden«, lachte Hannah.
»Aha und da standen die Verehrer dann Schlange, oder?«
»Klar, aber ich hatte einen festen Freund. Er hieß Lars und war der Sohn vom Bürgermeister. Ricky hat natürlich versucht bei mir zu landen, war aber komplett chancenlos. Das hat er wohl nicht vergessen.«
»Und dieser Lars? Was ist aus dem geworden?«, wollte Jan wissen.
»Hat gleich nach dem Abitur in den Westen rübergemacht und in München Informatik studiert. Hab ihn vor ein paar Monaten getroffen. Arbeitet bei BMW in München, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ein Reihenhaus in Ismaning.«
»Tja und du? Bist Polizistin in Leipzig, geschieden, ledig und kinderlos und lebst mit einem abgehalfterten, älteren Kollegen in ’ner trostlosen Zweier-WG.«
»Ha, aber ein Reihenhaus hab ich auch. Ist doch auch was, oder?«
Jan stand auf, schenkte Hannah Kaffee ein und gab ihr einen Kuss. »Lass es dir schmecken, mein Hähnchen«, grinste er.
»Hm, naja, wie ’n Hähnchen sehe ich heute sicher nicht mehr aus, dann doch eher wie ein strammes Huhn…«
»…auf das der Hahn megastolz ist. Sag mal, wann wollten wir im Büro sein?«
»Gegen zehn, so war’s mit Rico abgemacht.«
»Ob die wohl schon was vom dem Vorfall gestern Abend wissen?«
»Nee, denke nicht, dass Ricky uns angezeigt hat. Der wird ganz brav die Füße stillhalten. Kann natürlich sein, dass der sich an uns rächen will. Abwarten.«
»In den nächsten sechs Wochen jedenfalls nicht. Sein angeknackstes Brustbein wird ihn schon noch ’ne Weile beschäftigen«, glaubte Jan.
Maynards Farm an der Redground Road in Crockwell
Nachdem die Bundespolizei Meredith’ kleinen Hof komplett auf den Kopf gestellt hatte, wusste Maynard, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis die Haie von der Einwanderungsbehörde mit vollem Besteck auf seiner Ranch aufkreuzen und alles auf links drehen würden. Meredith hatte ihm gebeichtet, dass sie ein mexikanisches Geschwisterpaar bei sich zu Hause versteckt hatte, das aus dem Blaxland-Komplex geflohen war und sich des Nachts im Kofferraum eines Reisebusses bis nach Crockwell durchgeschlagen hatte. Tagsüber hatten Eduardo und Constanza sich im Schutze der Wälder verborgen gehalten, sich tagelang von Beeren und Pilzen ernährt und Flusswasser getrunken und hatten dann vollkommen erschöpft auf dem Hof von Meredith um Hilfe gebeten, in der Hoffnung, dass die alte Frau nicht die Polizei benachrichtigen würde.
Meredith Connor hatte die achtzig bereits weit überschritten und bewohnte allein einen kleinen Hof östlich der Redground Road nur etwa zwei Kilometer von Maynards Farm entfernt. Sie war dort aufgewachsen und hatte ihr Leben lang bis zur Rente als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Crockwell gearbeitet. Als ihre Eltern starben, hatte sie die Schafe und Rinder verkauft und begonnen, Blumen zu züchten und in ihrer eigenen Werkstatt Holzschmuck herzustellen. Meredith war ein spiritueller Mensch. Sie glaubte felsenfest an eine tiefere Dimension des Daseins und dass wir alle Antworten in uns selbst finden. Die Stille und die Natur vermittelten ihr ein Gefühl, dass es da noch etwas anderes gab, etwas zwischen den Zeilen. Etwas, das wir nicht sehen, riechen, hören, fühlen oder schmecken können.
Maynard half der alten Frau bei Arbeiten auf ihrem Hof, die sie selbst nicht mehr verrichten konnte. Er hackte Holz, mähte die Rasenflächen, schnitt die Hecken und erledigte Renovierungsarbeiten an Haus und Scheune.
Abends saßen die beiden oft bei Tee, Räucherkerzen und einem feinen australischen Single Malt zusammen, obwohl Maynard niemals einen Tropfen Alkohol angerührt hatte. Doch in diesem Fall machte er gern eine Ausnahme. Sie erzählten sich Geschichten aus ihrem Leben. Meredith war fasziniert davon, wenn Maynard über Ereignisse und Erlebnisse sprach, die vermeintlich unerklärlich und jenseits jeglicher Vorstellungskraft angesiedelt waren. Er erzählte ihr von seinem Vater und seinem Großvater, die ihn in die Geheimnisse des Schamanismus eingeweiht hatten. Er brachte ihr bei, wie sie durch Meditation zu einem höheren Bewusstseinszustand gelangen konnte, der es ihr erlaubte, mit der spirituellen Welt in Verbindung zu treten.
Meredith nannte Maynard nur bei seinem eigentlich ersten Vornamen James, weil ihr Vater so hieß. Sie kochte gelegentlich für ihn und wusch seine Wäsche. Und sie erzählte ihm vom Leben der Bauern und Schafzüchter, wie es vor mehr als fünfzig Jahren gewesen war. Ihr Vater besaß eine Schafherde mit weit mehr als tausend Tieren. Sie hatte viel von ihm gelernt und galt viele Jahre als anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Schafzucht. Doch vor ein paar Jahren konnte sie die Arbeit nicht mehr bewältigen und verkaufte die Tiere. Schweren Herzens, wie sie glaubhaft versicherte. »Ich hatte noch zweihundertfünfzig Schafe und ich kannte jedes Einzelne beim Namen. Sie waren alle meine Kinder, James. Ich habe sie alle geliebt, auch wenn ich gelegentlich das ein oder andere zur Schlachtbank führen musste. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich auch liebten. Der Umgang mit Tieren ist was ganz Besonderes. Du musst sie achten und respektieren, du musst sie hegen und pflegen und du darfst ihnen niemals ein Leid zufügen. Was die Tiere dir dann an Liebe und Zuneigung zurückgeben, ist das pure Glück auf Erden. Ein Mensch kann einem dieses Gefühl niemals vermitteln, James, niemals.«
Maynard wusste genau, wovon sie sprach. Gelegentlich nahm er seine Dobermänner Castor und Pollux mit zu Meredith, die er vor einigen Jahren aus Afghanistan mitgebracht hatte, nachdem ihr Besitzer Ibrahim von den Taliban ermordet worden war. Da sich niemand um die Hunde kümmern wollte, sollten sie erschossen werden. Ibrahim hatte die Hunde scharf gemacht, um seinen Hof zu bewachen. Er hatte sie auch auf Maynard gehetzt, als der Ibrahim aufgesucht hatte, um ihn wegen seines Verrats an die Taliban zur Rede zu stellen. Als Castor und Pollux sich auf ihn stürzen wollten, hielten sie urplötzlich inne, zogen winselnd den Schwanz ein und legten sich ihm ergeben zu Füßen. Ibrahim hatte seinen Augen nicht getraut und hatte fortan eine panische Angst vor dem »Roten Teufel«, wie die Taliban Maynard ehrfurchtsvoll nannten.
Meredith hatte anfangs großen Respekt vor den beiden riesigen Hunden. Doch Maynard hatte ihr schnell beigebracht wie sie mit den Tieren umgehen musste. »Du kannst mit ihnen Kraft deiner Gedanken in Verbindung treten. Auch Tiere haben telepathische Fähigkeiten. Du musst sie erkennen und entwickeln. Gute Hunde hören aufs Wort, Castor und Pollux verstehen auch ohne Worte.«
»Und funktioniert das auch umgekehrt? Ich meine, können sie dir mitteilen, was sie wollen oder denken?«, fragte Meredith aufgeregt.
»Telepathie beruht auf Gegenseitigkeit. Ist entweder nur der Sender oder der Empfänger telepathisch veranlagt, ist eine Kommunikation nicht möglich.«
»Soll das etwa heißen, du hast den beiden Hunden diese telepathischen Fähigkeiten beigebracht?«
»Zum Teil ja, aber sie haben sich auch schnell empfänglich dafür gezeigt und irgendwann gelernt, auch als Sender zu fungieren.«
Meredith schüttelte den Kopf. So sehr sie daran glauben wollte, sie konnte es sich einfach nicht vorstellen, was Maynard meinte. Konnte er mit den Hunden kommunizieren wie mit Menschen? Nur eben nonverbal.
Maynard lächelte. »Du glaubst mir nicht? Na gut, pass auf. Sag mir, was sie tun sollen.«
»Äh, ja, was denn zum Beispiel?«
»Lass dir was einfallen.«
»Sie sollen zu mir aufs Sofa springen und sich rechts und links neben mich setzen.«
»Gut, dann sag es ihnen mit der Kraft deiner Gedanken.«
»Wie bitte? ich besitze doch gar keine telepathischen Fähigkeiten.«
»Nein? Probier es aus.«
Meredith fixierte die beiden Hunde und befahl ihnen gedanklich, aufs Sofa zu springen. Es tat sich… nichts.
Maynard lachte. »Du sollst sie nicht hypnotisieren, Meredith.
Sag es ihnen einfach mittels deiner Gedanken, du brauchst sie dabei nicht anzustarren. Das wiederum verstehen sie nicht. Im Gegenteil, das Anstarren werten sie als Aggression. Das kann gefährlich werden.«
Meredith stieß einen tiefen Seufzer aus, trank einen kräftigen Schluck Single Malt, lehnte sich zurück und schloss ihre Augen.
»Sag es ihnen, Meredith, sag es ihnen einfach«, flüsterte Maynard.
Meredith erschrak sich fast zu Tode, als Castor und Pollux plötzlich aufs Sofa sprangen und sich rechts und links neben sie setzten.
»Verdammt, James, du hast geschummelt. Als ich die Augen geschlossen hatte, hast du nachgeholfen, oder?«
Maynard lachte. »Na ja, ein wenig schon, aber fürs erste Mal war das gar nicht schlecht, Meredith. Die beiden mögen dich. Ist doch schon mal ein guter Anfang.«
Jetzt mussten beide lachen. Meredith erhob ihr Glas. »Es ist so ein Glück für mich, James, dass du da bist. Danke für deine Freundschaft.«
»Es ist mir eine Ehre, dich zu kennen, Meredith, du bist meine Schwester im Geiste«, antwortete Maynard.
»Na, wohl eher deine Mutter, du Charmeur und jetzt lass uns noch ein Glas zusammen trinken. Ist einfach wunderbar, dieser Sullivan Cove French Oak Cask, der beste Single Malt der Welt.«
Maynard hatte Eduardo und Constanza auf seine Farm gebracht. Er wusste genau, dass Chief Gardener und sein Adlatus Robertson längst registriert hatten, dass er Meredith helfen würde, die beiden Mexikaner zu verstecken. Sie würden nachts kommen, wenn er nicht damit rechnen würde. Wahrscheinlich nach Mitternacht, wenn er sich vermeintlich im Tiefschlaf befände. Und sie würden mit einem kompletten Einsatzkommando anrollen, das in wenigen Minuten das gesamte Areal umstellen und absuchen würde.
Doch Maynard war vorbereitet. Sich mit Waffengewalt zu widersetzen war nicht nur sinnlos, sondern würde ihn auch auf schnellstem Weg zurück in den Knast befördern. Nein, das war beileibe keine Option. Er hatte andere Pläne. Sollten sie kommen, diese Kopfgeldjäger und Sklaventreiber. Er würde ihnen einen gebührenden Empfang bereiten. Diese Nacht würden sie nie wieder vergessen, dafür würde er sorgen. Und nicht nur er.
Als Hannah und Jan gutgelaunt ihr Büro im Polizeipräsidium an der Dimitroffstraße betraten, fand Jan eine Nachricht auf seinem Schreibtisch, dass er sich bitte umgehend beim Chef oben melden sollte. »Chef oben« war der Polizeioberrat Horst Wawrzyniak, »Chef unten« Dezernatsleiter Rico Steding.
»Hm, was will der denn von mir? Gibt’s jetzt ’nen Einlauf, weil wir erst um zehn zum Dienst erscheinen?«, wunderte er sich.
»Keine Ahnung, vielleicht wirst du ja befördert. Dann muss ich dich wohl siezen und mit »Chef« ansprechen, oder?«, flunkerte Hannah.
»Klar und dann möchte ich jeden Morgen frische Brötchen und die Tageszeitung auf dem Frühstückstisch haben. Und frischen Kaffee natürlich«, grinste Jan und machte sich auf den Weg in die erste Etage. Mit flauem Gefühl in der Magengegend klopfte er kurz an und betrat das Büro des Polizeichefs.
»Herr Hauptkommissar, schön, dass Sie’s einrichten konnten. Wie war das Konzert gestern Abend?«, schien der Chef bester Laune zu sein.
»Morgen, Chef. Besser, als ich erwartet habe. Bin ja eigentlich nur Hannah zuliebe mitgegangen.«
»Ja, was tut man nicht alles für die Frauen. Ich weiß, wovon ich rede – Dauerkarte im Gewandhaus – Oper, Operetten, Sinfonieorchester am laufenden Band. Meine Frau liebt diesen Kram. Als Stones-Fan ist das alles nur schwer zu ertragen. Aber ich lasse das alles geduldig über mich ergehen – des lieben Friedens willen.«
Jan lachte. »Na, ganz so schlimm ist das bei mir nicht. Die Editors sind zwar nicht die Doors, aber trotzdem eine richtig gute Band. Kannte ich vorher gar nicht, jetzt werde ich mir mehr von denen anhören. Sie sollten mal ’n Ohr wagen, Chef. Man kann ja nicht immer in der Vergangenheit hängenbleiben, oder?«
»Stimmt, mache ich ja auch nicht. Allerdings werde ich wohl von echter, handgemachter Musik nicht mehr loskommen, damit bin ich aufgewachsen. Bands wie Soundgarden, Pearl Jam oder R.E.M. sind mir da naturgemäß lieber, als dieser ganze Elektronikkram.«
»Kann ich gut verstehen, Chef. Geht mir ähnlich.«
Der Polizeioberrat nickte zustimmend und setzte von einer Sekunde auf die andere eine geschäftsmäßige Miene auf. »Gut, kommen wir zur Sache. Sie wissen, dass ich in gut einem halben Jahr in Pension gehen werde. Meine Nachfolge hatte ich bereits vor längerer Zeit geregelt – dachte ich jedenfalls. Jetzt hat sich plötzlich eine neue Situation ergeben. Das Land Sachsen hat ja seit geraumer Zeit einen neuen Innenminister. Diese neue Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD hat ausgerechnet einen Grünen zum Innenminister ernannt. Dieser Kerl raubt mir den letzten Nerv. Er hat sich strikt dagegen ausgesprochen, einen ehemaligen Volkspolizisten und Stasi-Mitarbeiter zum Polizeichef von Leipzig zu ernennen. Jetzt haben wir den Salat. Ich bin ehrlich gesagt ratlos – oder besser gesagt – ich war es. Ich habe diesem Dr. Carl Möllering gestern einen neuen Vorschlag unterbreitet und er schien davon recht angetan.«
Jan rutschte nervös auf seinem Stuhl herum und kräuselte die Stirn. »Soll das etwa heißen, Rico ist raus?«
Der Polizeioberrat nickte mit zusammengekniffenen Lippen. »Ja, so kann man das wohl sagen. Irgendwann holt uns unsere Vergangenheit ein. Obwohl Rico nachgewiesenermaßen kein Stasi-Spitzel war, hat dem Innenminister seine Arbeit als Volkspolizist als Argument dafür ausgereicht, keine ehemaligen Mitglieder und Helfer des SED-Regimes in leitende Positionen des Polizeiapparates zu integrieren.«
»Oh, verdammt, haben Sie Rico schon darüber informiert?«
Waffel, wie der Polizeioberrat von seinen Leuten hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, schüttelte den Kopf. »Ist nicht so einfach. Wir sind Freunde. Er wird nicht verstehen, dass mir in dieser Angelegenheit die Hände gebunden sind. Bisher ist die Politik immer den Vorschlägen der Polizei gefolgt, wenn es darum ging, Führungspositionen im Polizeiapparat neu zu besetzen. Das Veto des Innenministers ist ein absolutes Novum. Ein Grüner eben, was soll ich dazu noch sagen, verdammt? Dieser alternative Tomatenpflücker sollte lieber in Ostfriesland Schafe hüten, da wäre er besser aufgehoben. Von Polizeiarbeit hat der so viel Ahnung wie ’n Ochse vom Klavierspielen.«
Waffel hatte sich in Rage geredet. Er zog seine Schreibtischschublade auf, holte eine Packung Marlboro heraus, stand auf, öffnete das Fenster und zündete sich eine Zigarette an. »Auf einen Sargnagel mehr oder weniger kommt es in meinem Alter auch nicht mehr drauf an, oder?«, kommentierte er und blies eine weiße Rauchwolke aus dem Fenster.
»Also, wenn ich das richtig verstehe, ist Rico komplett außen vor, oder gibt es vielleicht doch noch die Möglichkeit, den Innenminister umzustimmen?«, wollte Jan wissen.
»Nein, das Maximale, was ich bei diesem Öko-Heini rausholen konnte, war einen weiteren Vorschlag zu unterbreiten«, antwortete Waffel, seinen Blick starr aus dem Fenster gerichtet.
»Und das haben Sie getan.«
Der Polizeioberrat nickte, zog noch einmal tief an seinem Glimmstängel, schnipste ihn aus dem Fenster, drehte sich um und starrte seinen Mitarbeiter wortlos an.
in diesem Moment wusste Jan, was Waffel ihm gleich sagen würde. Und der Polizeioberrat hatte sofort registriert, dass sein Gegenüber verstanden hatte.
»Ich sehe, Sie ahnen es schon. Ja, ich habe Sie als meinen Nachfolger vorgeschlagen. Und der Innenminister hat, nachdem er sich eingehend über Sie erkundigt hatte, grünes Licht gegeben, Sie ganz oben auf die Kandidatenliste zu setzen.«
Für einen Moment war Jan sprachlos. Er war ins Büro des Chefs gekommen, um sich einen Rüffel abzuholen, weil er heute erst um zehn zum Dienst erschienen war und fünf Minuten später war er plötzlich aussichtsreicher Kandidat auf das Amt des Leipziger Polizeichefs.
»Danke für Ihr Vertrauen, Chef, aber ich denke, dass ich für diese Position nicht geeignet bin. Ich bin Ermittler, ich möchte an der Front stehen, zusammen mit meinen Kollegen Fälle lösen und zwar draußen an der frischen Luft. Einen Schreibtischjob in der Verwaltung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sorry.«
»Ich weiß, ich weiß, das kommt jetzt alles total überraschend für Sie. Doch was ist die Alternative? Wenn Sie den Job nicht machen, schicken die einen von außen, den keiner kennt und wo niemand weiß, was da auf uns zukommt. Denken Sie an alle unsere Mitarbeiter. Wenn Rico diese Position nicht übernehmen darf, wären Sie die beste Wahl. Sie werden Ihre Leute hinter sich haben, davon bin ich fest überzeugt. Auch Rico, wenn er seine erste Enttäuschung überwunden hat. Und was die Art Ihrer Tätigkeit anbelangt, Sie entscheiden selbst, wie weit Sie als Polizeichef im Tagesgeschäft Einfluss nehmen oder nicht. Ich bin hier auch nicht als der geborene Sesselfurzer angetreten, war viele Jahre ganz dicht am Geschehen. Erst als Sie hier aufgekreuzt sind, der vermeintliche Problemfall aus Hamburg, konnte ich mich peu a peu aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Sie haben richtig Schwung in unsere verstaubte Bude gebracht. Wir sind um hundert Prozent effektiver, seit Sie den Laden hier übernommen haben. Weiß doch jeder, dass sie da unten der Boss sind und das weiß auch Rico, glauben Sie mir.«
»Mit Verlaub, Chef, ich denke, da unterschätzen Sie Rico Steding gewaltig. Ohne ihn geht bei uns gar nichts. Das Gleiche gilt übrigens für Hannah und Josie. Wir sind ein Team und die Betonung liegt auf »ein«. Allein sind wir nichts, zusammen sind wir alles.«
»Ja, zum Kuckuck, ich weiß und daran soll sich ja auch nichts ändern. Niemand wird Sie daran hindern, weiterhin am operativen Geschäft teilzunehmen.«
Jan zuckte die Achseln. »Wann wollen Sie Rico mitteilen, dass er raus ist?«
»Na ja, ich habe schon mal versucht, es ihm durch die Blume zu sagen. Ich denke, der ahnt das schon seit Langem. Allerdings werde ich es ihm jetzt offiziell mitteilen müssen, bevor der Innenminister eine Entscheidung fällt. Wäre fatal, wenn er das von anderen erfahren müsste.«
»Also gut, ich muss das zuerst mit Hannah besprechen. Und dann werden wir uns gemeinsam mit Rico und Josie zusammensetzen und darüber reden, wie unsere weitere Zusammenarbeit aussehen sollte. Damit das ganz klar ist, ohne deren Einwilligung werde ich diesen Posten auf gar keinen Fall übernehmen.«
»Gut, aber das muss jetzt zügig passieren, sonst kriegen Sie hier einen neuen Chef vor die Nase gesetzt, wo im Moment keiner weiß, wer das sein wird und wie der seine neue Aufgabe hier angehen wird. Dieses Risiko sollten Sie nicht eingehen. Ich muss mich zum Glück nicht mehr damit rumschlagen, aber gehen Sie mal davon aus, dass ein grüner Innenminister eher einen Alternativen auf diesen Stuhl setzen wird. Dann Gute Nacht, Adele!«
»Wie lange habe ich Zeit?«, fragte Jan.
»Hm, am besten bis gestern, aber ein paar Tage kann ich das alles schon noch hinauszögern. Jetzt muss ich zunächst mal Rico in Kenntnis setzen. Dafür wird er mich vermutlich hassen. Wird wohl das abrupte Ende einer innigen Männerfreundschaft bedeuten«, seufzte Waffel.
»Abwarten, Chef. Also danke für Ihr Vertrauen. Ich werde das auch erst mal sacken lassen müssen.«
Jan stand auf, schüttelte dem Polizeioberrat die Hand und verließ das Büro als ein anderer, als er gekommen war.
Eduardo und Constanza stammten aus Neza-Chalco-Itza, kurz Neza genannt, ein Vorort der 22 Millionen Einwohner Metropole Mexiko-City, in dem rund vier Millionen Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum in provisorischen Blech- und Holzhütten ohne Strom und fließend Wasser unter katastrophalen hygienischen Bedingungen lebten, oder besser gesagt, vegetierten. Die Geschwister hatten früh ihre Eltern verloren und verdienten ihr Geld, in dem sie die riesigen Müllhalden nach noch brauchbaren Gegenständen durchsuchten, um diese für ein paar Peso anderen Menschen zu verkaufen, denen es auch nicht viel besser ging als ihnen. Das Geld reichte zumindest, sich mit dem Notwendigsten zu versorgen und dadurch zu überleben.
Eduardo und Constanza wollten weg von diesem fürchterlichen Ort. Irgendwo hin, wo sie ein menschenwürdiges Leben führen konnten. Sie hatten einen Onkel in Australien, der ihnen nach dem Tod ihrer Eltern angeboten hatte, sie bei sich aufzunehmen. Doch das war lange her und das Geld für diese lange Reise hatten weder er noch sie.
Doch dann half ihnen der Zufall. Eine mexikanische Reederei suchte für eines ihrer großen Kreuzfahrtschiffe Personal. Billige Arbeitskräfte, die als Putzfrauen oder Aushilfskellner arbeiteten, ohne sich über die schwierigen Bedingungen an Bord zu beschweren. Das bedeutete rund sechzehn Stunden Arbeit pro Tag für einen Lohn von 120 Peso, also nicht mal fünf Euro. Dazu gab es einen Schlafplatz in einer großen Gemeinschaftskabine und eine warme Mahlzeit am Tag. Die Reise ging von Puerto Vallerta nach Sydney und zurück und dauerte gut einen Monat.
Das Problem war, dass die Geschwister keinen Reisepass besaßen und deswegen das Schiff nicht verlassen durften.
Nach genau 29 Tagen legte das Schiff in Sydney an. Eduardo hatte dem Chef vom Wäschedienst 5.000 Peso bezahlt, um sie in Schmutzwäschecontainern zu verstecken und von Bord zu bringen. Drei Tage später wurden sie von der Polizei aufgegriffen. Der Luxusliner hatte längst wieder abgelegt, ohne zunächst ihre Abwesenheit bemerkt zu haben. Eduardo und Constanza wurden inhaftiert und nach einer Woche ins Auffanglager für illegale Migranten nach Blaxland gebracht. Als sie zwei Wochen später in ein Internierungslager nach Papua-Neuguinea verschifft werden sollten, gelang ihnen die Flucht, als sie kurz vor dem Ablegen des Schiffes von Bord sprangen und sich solange im Wasser verborgen hielten, bis sie sicher waren, dass niemand mehr nach ihnen suchte. Die beiden waren gute Schwimmer. Bei Anbruch der Dunkelheit waren sie an Land geschwommen und versteckten sich vollkommen erschöpft in einer Tiefgarage. Am frühen Morgen nutzten sie das Chaos des einsetzenden Berufsverkehrs und schlichen sich in einen vollbesetzten Zug der Metro, der sie zum Flughafen brachte. Kontrollen gab es keine. Edurado wusste, dass es von hieraus Zug- und Bahnverbindungen ins Inland gab. Sie nutzten erneut die Gunst der Stunde und sprangen in einen Zug nach Campbelltown und verbargen sich dort während der Fahrt in einer Toilette.
Am Busbahnhof in Campbelltown hielten sie Ausschau nach Reisebussen mit dem Ziel ins Inland. Die Busse waren durchweg vollbesetzt und die Chance, irgendwo unbemerkt einzusteigen, gleich null. Dann nahm Eduardo seinen ganzen Mut zusammen, riss bei einem gerade anfahrenden Bus eine seitliche Gepäckklappe auf und sprang mit seiner Schwester hinein, in der Hoffnung, dass der Busfahrer sie nicht bemerkt hatte. Die beiden hatten keine Ahnung, wohin die Fahrt ging und vor allem, wo sie endete. Doch alles, was möglichst weit entfernt von Sydney sein würde, wäre ihnen jetzt recht.
Nach gut drei Stunden Fahrt verlangsamte der Bus seine Geschwindigkeit. Kurz bevor er stoppte, öffnete Eduardo die Gepäckraumklappe und die beiden blinden Passagiere sprangen heraus auf die Straße und verschwanden so schnell wie möglich im Pulk der wartenden Menschen am Busbahnhof von Crockwell im Bundesstaat New South Wales.
Auf einer Karte in einem Glaskasten stellte Eduardo zu seiner Erleichterung fest, dass sie etwa dreihundert Kilometer südwestlich von Sydney entfernt waren. Doch ihr Ziel lag immer noch gut dreitausend Kilometer weit weg von hier. Im Moment hatte er keine Ahnung, wie sie jemals dort hingelangen sollten. Jetzt brauchten sie zunächst etwas zu essen und wärmere Kleidung. Die Nächte waren kalt, obwohl tagsüber die Sonne schien und es bis zu 32 Grad heiß wurde.
Sie beschlossen, außerhalb der Ortschaft eine Farm zu suchen, wo sie ihre Arbeitskraft anbieten konnten, um sich ein paar Dollar zu verdienen. Vielleicht gab es ja irgendwo da draußen einen netten, hilfsbereiten Menschen, der nicht gleich die Polizei rufen würde, wenn sie um Hilfe baten.
Schließlich beobachteten sie ein paar Kilometer nördlich der Stadtgrenze eine alte Frau, die auf dem Feld vor ihrer Farm Blumen schnitt. Constanza wagte sich vorsichtig zu ihr hinüber und sprach sie in gebrochenem Englisch an. Meredith musterte das Mädchen von vielleicht zwanzig Jahren argwöhnisch. Als dann auch noch Eduardo auf der Bildfläche erschien, der sich solange an der Straßenböschung versteckt hatte, befürchtete sie gar einen Überfall. Doch dann lächelte Constanza sie an und sagte ihr, dass sie keine Angst vor ihnen haben müsste, sie wollten nur etwas zu essen und vielleicht für die Nacht ein Dach über den Kopf. Schließlich willigte Meredith ein und nahm die beiden mit auf ihre Farm, gab Ihnen Brot, Butter, Milch und Käse, legte ihnen frische Kleidung heraus und ließ sie im Stroh in der Scheune übernachten.
Eduardo hatte nicht die Spur einer Idee, wie sie in das dreitausend Kilometer entfernte Mataranka gelangen sollten. Dort lebte ihr Onkel Diego, der Cousin ihres Vaters Santiago, der vor über dreißig Jahren mit seinen Eltern aus Mexiko ausgewandert war und in der Kleinstadt im Northern Territory ein Motel und einen Caravan-Park betrieb.
Doch jetzt gab es Hoffnung. Maynard hatte die beiden jungen Mexikaner, kurz bevor die Polizei bei Meredith aufgetaucht war, abgeholt und auf seiner Farm versteckt. Maynard hatte einen guten Kumpel, der Pilot war und mit seiner zweimotorigen Propellermaschine vom Typ Cessna 402 C von Crockwell aus als Zubringer aus kleinen Städten zu den Luftdrehkreuzen fungierte. Die Maschine bot zehn Passagieren Platz und war meistens ausgebucht. Theodor Crankwell, von seinen Freunden kurz »Crasher« genannt, besaß wie Maynard zwei Dobermänner, mit denen die beiden nebenbei einen Hundesportverein betrieben.
Maynard hatte Crasher von den beiden jungen Mexikanern erzählt und bat ihn um Hilfe.
»Hey, Mann, bist du wahnsinnig? Wenn die mich erwischen, bin ich meine Lizenz los und wandere obendrein in den Knast. Du weißt, ich helfe, wo ich kann, aber die Nummer ist mir zu heiß«, bat er um Verständnis.
»Du musst ja nicht wissen, dass sie an Bord sind. Sie sind in die Maschine eingebrochen und haben sich im Gepäckteil versteckt. Und genau dort werden sie den Flug über bleiben. Deine Fluggäste werden bestätigen können, dass du keine Ahnung davon hattest, dass da hinten zwei blinde Passagiere mitfliegen. Wann fliegst du wieder hoch in den Norden?«, fragte Maynard.
»Hm, na ja … übermorgen. Und du meinst, dieser Plan wird tatsächlich funktionieren?«
»Klar, warum nicht? Ich bringe die beiden zum Flugplatz und verstaue sie im Frachtraum. Die werden keinen Mucks von sich geben. Wenn du in Mataranka gelandet bist, gehst du in Ruhe ’ne Tasse Kaffee trinken, bis die beiden verschwunden sind. Vergiss aber nicht, vorher die Klappe zum Gepäckraum zu entriegeln.«
»Mannomann, James, wahrscheinlich scheiße ich mir in die Hose vor Angst. Aber okay, ich helfe dir.«
Eduardo und Constanza weinten Tränen vor Glück, als Maynard ihnen seinen Plan eröffnet hatte. »Wir können den Mann nicht bezahlen. Wir haben nicht mal mehr tausend Peso«, jammerte Constanza.
»Darüber zerbrecht euch mal nicht den Kopf. Allerdings müssen wir jetzt erst einmal die nächsten beiden Nächte überstehen. Diese Bluthunde werden kommen. Wahrscheinlich bereits heute Nacht«, vermutete Maynard.
»Dann sind wir verloren, dann war alles umsonst. Und Meredith und du müsst ins Gefängnis«, seufzte Constanza mit Tränen in den Augen.
»Nein, nicht wenn ihr genau tut, was ich euch sage. Diese beiden Blutsauger von Bundespolizisten werden diese Nacht nie wieder vergessen. Sie werden winseln vor Angst, wenn ich mit ihnen fertig bin.«
Die beiden jungen Mexikaner hatten keine Ahnung, wovon Maynard redete, aber sie hofften inständig darauf, dass dieser hünenhafte, hilfsbereite Indianer es tatsächlich schaffen würde, die Polizei zu überlisten.
»Was wollte Waffel?«, fragte Hannah.
»Ach, nix Besonderes. Brauchte wohl einen zum Quatschen, Kaffee trinken und Lakritze essen. Wird langsam einsam um den alten Mann«, antwortete Jan, nickte unauffällig in Richtung Rico Steding, der scheinbar gerade in seine Unterlagen vertieft war und schüttelte kurz den Kopf.
Hannah hatte verstanden und wechselte sofort das Thema. »Draußen wartet ’ne Frau auf dich, die unbedingt mit dir sprechen will. Es geht wohl um ihren Sohn, der vorgestern am Hauptbahnhof von einem Linienbus angefahren wurde. Keine Ahnung, was die von dir will, ich konnte sie leider nicht abwimmeln.«
»Hm, merkwürdig, wohl kaum ein Fall für die Mordkommission. Na gut, ich frage sie mal, warum sie hier ist«, sagte Jan und erkundigte sich kurz telefonisch bei den Kollegen, bevor er hinaus auf den Flur ging.
»Guten Tag, Herr Kommissar, mein Name ist Paula Zöger, ich bin die Mutter von Lukas, der vor zwei Tagen mit seinem Rollstuhl vor den Linienbus geraten ist und jetzt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt.«
»Das tut mir sehr leid, Frau Zöger, aber warum kommen Sie damit zu mir? Ich bin bei der Mordkommission und nicht für Verkehrsunfälle zuständig.«
»Weil das kein Unfall war, sondern versuchter Mord.«
Jan war überrascht. „Hm, ich habe gerade kurz mit meinen Kollegen gesprochen. Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass ihr Sohn die Straße überqueren wollte und offenbar den Bus übersehen hat. Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen. Wahrscheinlich war er für einen kurzen Moment unaufmerksam. Das passiert immer wieder, leider.«
»Vor etwa einer Woche kam ein junger Mann um, der vor einen ICE gesprungen ist. Selbstmord, wie es offiziell heißt. War es aber nicht, Herr Kommissar, Jonas Reeder ist ermordet worden.«
Jan setzte sich auf die Bank neben die Frau und schüttelte leicht den Kopf. »Bei aller Liebe, gute Frau, sowohl die Kollegen als auch die Gerichtsmedizin haben den Suizid dieses Mannes bestätigt. Und ich habe gehört, dass eine Überwachungskamera auf der Brücke den Sprung aufgezeichnet hat. Also, Sie irren sich, Frau…
»…Zöger. Nein, ich bin sicher, dass es Mord war und bin auch felsenfest davon überzeugt, dass auch mein Sohn ermordet werden sollte. Die Sache ist nicht ganz einfach zu erklären. Sie werden mich wahrscheinlich für verrückt halten, aber ich weiß wer hinter diesen Taten steckt.«
Jan atmete einmal tief durch. »Hören Sie, Frau Zöger, in beiden Fällen haben bedauerliche Umstände eine Rolle gespielt. Möglicherweise hatte Jonas private oder sogar psychische Probleme, die Kollegen ermitteln momentan in diese Richtung und Lukas war einfach für einen Moment unaufmerksam, so schwer das auch zu verstehen sein mag. Ich hoffe, dass es ihrem Sohn bald besser geht. Danke, dass Sie gekommen sind, aber ich kann leider nichts für Sie tun, denke ich.« Jan stand auf und reichte der Frau die Hand.
»Lucie von Steinbach«, sagte sie.
»Wie bitte?«
»Sie hat Jonas ermordet und wollte auch meinen Sohn umbringen. Und wenn Sie nichts unternehmen, wird es bald noch mehr Opfer geben.«
»Äh, ich verstehe nicht…«
»Das ist auch schwer zu verstehen. Aber ich weiß, dass Sie sehr erfolgreich sind, in dem, was Sie tun. Und das ist man nur, wenn man auch bereit ist, über den Tellerrand hinaus zu denken und zu sehen. Lucie von Steinbach ist eine Hexe, sie besitzt übersinnliche Kräfte. Sie ist zu Dingen fähig, die selbst Wissenschaftler immer wieder in Erstaunen versetzen. Sie kann Gedanken lesen, Gegenstände bewegen, ohne sie zu berühren und den Ort wechseln, ohne sich zu bewegen. Und sie ist in der Lage, Menschen zu manipulieren, sie dazu zu bringen, etwas zu tun, das sie bei klarem Bewusstsein niemals tun würden. Und das Diabolische daran ist, diese Menschen können sich nicht dagegen wehren.«
Jan setzte sich wieder. »Woher wissen Sie das alles?«
»Lucie von Steinbach ist Studentin der Psychologie. Sie ist an der Uni Leipzig in einer Arbeitsgruppe zusammen mit meinem Sohn, Jonas Reeder, Marvin Mertens und Robin Keller. Professor Rotermund leitet diese Gruppe, die sich mit Hypnose, Okkultismus, Parapsychologie und mit einer Reihe von unerklärlichen Phänomenen beschäftigt. Alle diese fünf Studenten haben Erfahrungen mit Telepathie, Telekinese und bestimmten Manipulationstechniken, wie Suggestion, Autosuggestion, sowie verschiedenen Hypnoseverfahren und was es auf diesem Gebiet sonst noch so alles gibt.«
»Hm, klingt spannend und beängstigend zugleich. Aber aus welchem Grund sollte Lucie von Steinbach ihren Kommilitonen etwas antun wollen? Und vor allem, wie soll sie das angestellt haben? Haben Sie sie mal darauf angesprochen?«
»Tja, sie ist nach Jonas’ Tod verschwunden und seitdem auch nirgendwo mehr aufgetaucht. Warum sie das getan hat, weiß ich nicht, aber Lukas hat mir erzählt, dass sie manchmal andere Menschen, mit denen es Probleme gab, mit einem Fluch belegt hat. Und die hatten dann in der Tat darunter zu leiden, ob jetzt tatsächlich etwas passiert war, oder nicht. Sie ist eine Hexe, Herr Kommissar und sie ist sehr gefährlich, glauben Sie mir.«
Jan zog die Augenbrauen hoch. „Das klingt natürlich schon ein wenig nach Grimms Märchen, Frau Zöger. Die Polizei kann sich nur an die Fakten halten und die sind in beiden Fällen eindeutig. Aber gut, ich werde mich mal umhören und versuchen, mit dieser Lucie Kontakt aufzunehmen.«
»Reden Sie am besten zunächst mit Professor Rotermund. Der wird Ihnen bestätigen, was ich gerade erzählt habe. Ich weiß, das ist im Moment alles schwer vorstellbar, aber es ist wahr, leider.«
»Ich kümmere mich drum«, sagte Jan stand auf und reichte Frau Zöger die Hand.
»Danke, dass Sie mich angehört haben und denken Sie bitte daran: Es gibt noch weitere potentielle Opfer. Ich hoffe, für sie ist es nicht schon zu spät.«
Maynard Devilles Farm an der Redground Road in Crockwell
Maynard wusste, dass sie kommen würden, lange bevor sie tatsächlich eintrafen. Er spürte es, konnte es voraussehen. Irgendwo tief in seinem Unterbewusstsein war die seltene Gabe der Präkognition verankert, der Vorhersehbarkeit bestimmter Ereignisse. In der Parapsychologie wurde diese Fähigkeit als außersinnliche Wahrnehmung angesehen, die rational nicht erklärbar war.
Er hatte sich um Mitternacht mit Castor und Pollux vor den Kamin gesetzt, einen Kräutertee gekocht, natürlich nicht ohne einen erbsengroßen Klumpen Rohopium darin aufzulösen, und starrte konzentriert und nachdenklich in das Kaminfeuer. Das Lodern der Flammen und das Knistern des getrockneten Akazienholzes beruhigten und schärften seine Sinne. Das wahre Chaos ist lautlos. Es spielt sich im Kopf ab. In dieser Nacht würde er sich an alles erinnern, was ihm seine Lehrmeister, die Schamanen, beigebracht hatten. Er würde seinen Gegnern entgegentreten, aber sie würden ihn nicht sehen. Er würde mit ihnen sprechen, aber sie würden ihn nicht hören. Das einzige, was sie wahrnehmen würden, wenn er in ihre Köpfe eindrang, war dieser eigenartige, süßliche, aromatische Geruch nach orientalischen Kräutern, vermischt mit einer Prise Opium und Schwarzem Afghane.
Etwa zehn Minuten, bevor das Sondereinsatzkommando der Bundespolizei auf seiner Farm eintraf, schlug Maynard die Augen auf. Vor seinem inneren Auge sah er einen schwarzen BMW mit dem Bundesagenten Robertson am Steuer und Chief Gardener auf dem Beifahrersitz. Er konnte ihre Gesichter sehen. Die Mienen der beiden Männer strahlten Entschlossenheit aus, eine Art von Siegessicherheit.
Ihnen folgte ein Einsatzfahrzeug der New South Wales Police Force mit acht Männern der Sondereinheit der Bundespolizei. Schwerbewaffnete, gut ausgebildete Kämpfer, die ihren Job schnell, effektiv und hochprofessionell erledigen würden, ohne Rücksicht auf Verluste.
Um exakt ein Uhr nachts trafen die beiden Einsatzfahrzeuge auf dem Hof der Deville-Farm an der Redground Road ein. Die Bewegungsmelder reagierten unverzüglich und die Lichtmasten in allen vier Ecken des Areals fluteten den Hof mit gleißendem Licht. Die Fahrzeuge stoppten etwa in der Mitte des Gehöfts, die Schiebetür des Einsatzfahrzeugs wurde aufgerissen und die ganz in schwarz gekleideten, maskierten Männer sprangen heraus und verteilten sich auf dem Gelände, während Gardener und Robertson ausstiegen und schnellen Schrittes über den Hof zum Wohnhaus liefen. Chief Gardener pochte mit dem Durchsuchungsbeschluss in der Hand mit geballter Faust an die massive Holztür. Robertson hatte seine Waffe gezogen, blieb gut einen Meter hinter seinem Chef stehen und zielte auf die Tür.
»Bundespolizei. Öffnen Sie, Deville. Wir haben einen richterlichen Durchsuchungsbefehl.«
Als sich nichts tat, legte der Polizeichef nach. »Hören Sie, Deville, wir wissen, dass Sie da sind. Entweder Sie öffnen jetzt, oder wir brechen die Tür auf.«
Robertson gab ein Zeichen nach hinten und zwei Männer mit einem Rammbock im Anschlag bauten sich einsatzbereit vor der Tür auf.
Plötzlich erlosch das Licht. Erst stellten die Lichtmasten ihren Dienst ein, Sekunden später fielen auch die hell erleuchteten Scheinwerfer der Einsatzfahrzeuge aus. Von einer Sekunde zur anderen war es stockdunkel geworden.
»Verdammt, Robertson, was soll der Scheiß? Sorgen Sie gefälligst dafür, dass die Scheinwerfer wieder eingeschaltet werden.« Sein Adjudant brüllte ein paar kurze Befehle in die Dunkelheit, dann stand plötzlich einer der Männer vom Einsatzkommando hinter ihnen. Robertson erschrak. »Verdammt, Mann, schleichen Sie sich nicht an wie ’n räudiger Köter, benutzen Sie gefälligst ihre Taschenlampen.«
»Tut mir leid, Sir, die Dinger funktionieren nicht, genauso wie die Scheinwerfer der Fahrzeuge. Alles tot«, meldete der Mann.
»Wie bitte? Wollen Sie mich verarschen?« Robertson zog sein Smartphone aus der Tasche und schaltete es ein. Nichts. Das Display blieb dunkel. »Was zum Teufel ist hier los? Kann mir das vielleicht mal jemand erklären?«, meckerte er.
»Los«, befahl Chief Gardener, »aufbrechen.«