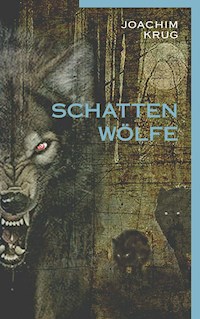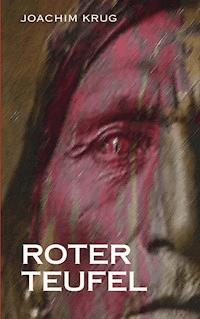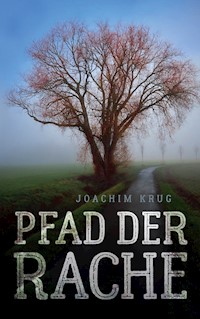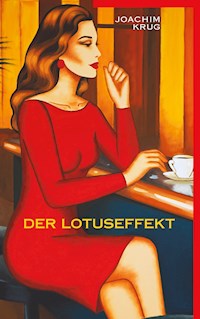Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Leipziger Hauptkommissar und ehemalige Major Jan Krüger soll mit seiner Erfahrung als Afghanistan-Veteran bei der Evakuierung von Bundesbürgern aus Kabul helfen. Doch diese Mission erweist sich als brandgefährlich. Während das Ultimatum der Taliban, den Flughafen zu räumen, in einer Woche abläuft, versuchen sowohl radikale Teile der Taliban als auch der wiedererstarkte IS den Airport zu stürmen und einzunehmen. Gleichzeitig ist die Leipziger Polizei damit beschäftigt einen ungelösten Fall neu aufzurollen. Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle wurde eine Frau erschossen. Zwanzig Jahre später haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Jetzt wird fieberhaft nach einem Mann gefahndet, der bisher als verschwunden galt. Plötzlich ergibt sich ein heiße Spur und die führt nach Kabul. Gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen Jans Einsatz in Kabul und der Suche nach dem Mörder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
»Ich bin nicht da. Ich bin nie dagewesen. Ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen. Sucht nicht nach mir, ihr werdet mich nicht finden.« (Der Mann, der spurlos verschwand)
Tom sah besorgt aus dem Seitenfenster. Ein heftiges Unwetter braute sich zusammen. Innerhalb weniger Minuten hatte sich der Himmel zugezogen und die Sonne hinter einem dichten schwarzen Schleier versteckt. Gewaltige Wolkenpferde galoppierten, vom aufkommenden Sturm getrieben, über den Himmel, der urplötzlich sinnflutartig seine Schleusen geöffnet hatte.
Erbsengroße Hagelkörner prasselten auf die Windschutzscheibe der schwarzen Regierungslimousine, die im Schritttempo über die Theodor Rossevelt Brigde kroch, um nicht in den schnell anwachsenden Wasserlachen die Bodenhaftung zu verlieren und in den Potomac gespült zu werden wie ein taumelndes Papierschiffchen auf hoher See. Tiefes Donnergrollen ertönte und Blitze zuckten grell über die schwarze Wand am Firmament wie ein mahnendes Zeichen des himmlischen Strafgerichts.
Doch diese Naturgewalten waren nichts gegen den bedrohlich am Horizont heraufziehenden Hurrikan, der ihn treffen könnte, wenn er in wenigen Minuten das Oval Office betreten würde. Ob er dieses Unwetter unbeschadet überstehen würde, war im Moment ungewiss und erschien ihm mehr als unwahrscheinlich, als er nachdenklich die Einschläge der Hagelkörner auf der gepanzerten Windschutzscheibe beobachtete.
Klar, die CIA hatte ihren Anteil an dem Desaster, das sich gerade auf dem Kabuler Flughafen abspielte, aber verantwortlich dafür war die verfehlte Afghanistan-Politik der Regierungen der Vereinigten Staaten, die in den vergangenen Jahren eine Reihe von Fehlentscheidungen getroffen hatten. Doch Politiker wären keine Politiker, wenn sie nicht ständig versuchten, andere für ihre Fehler verantwortlich zu machen. Nur wer die hohe Kunst beherrschte, stets die anderen für die eigenen Fehler an den Pranger zu stellen, vermochte langfristig politisch zu überleben. Verfehlungen einzugestehen war zwar ehrenhaft, aber wenig zielführend. Deshalb war es das oberste Gebot, zur rechten Zeit einen geeigneten Sündenbock aus dem Hut zu zaubern, um nicht selbst zwischen den Mühlsteinen der Kritik zermahlen zu werden.
Als der schwarze Cadillac in die Pennsylvania Street einbog und nur noch wenige Meter vom Weißen Haus entfernt war, fühlte sich Thomas Bauer wie das Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Klein, unbedeutend, wehrlos, der perfekte Sündenbock eben. Dass ein konservativer Präsident einen liberalen CIA-Direktor in Langley duldete, war ungewöhnlich, dass er ihn im Zweifelsfall stützte, ausgeschlossen.
»Kommen Sie rein, Bauer, und setzen Sie sich zu diesen Versagern«, herrschte ihn Präsident Jonathan Bishop an und wies ihm einen Stuhl vor seinem riesigen Mahagonischreibtisch. »Ich will gleich zur Sache kommen. Mir liegen eine Reihe von Berichten der Agency zur Lage in Afghanistan vor. Ich gehe davon aus, dass Sie im Bilde sind, oder?«
»Ja, Sir, sicher«, nickte Tom Bauer.
Der Präsident hob den Kopf und blinzelte den CIA-Direktor über den Rand seiner Lesebrille an. »Gut, dann können Sie mir ja auch sicher erklären, wie Ihre Leute zu dieser, nennen wir es mal, kapitalen Fehleinschätzung der Lage gelangen konnten. Die stellt sich nämlich momentan vollkommen anders dar, wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte.«
»Ich verstehe…«, wollte Tom gerade ansetzen, als ihm der Präsident ins Wort fiel.
»Nein, Bauer, Sie haben überhaupt nichts verstanden. Tausende von US-Bürgern sitzen in Kabul fest und warten händeringend auf ihre Evakuierung, bevor sie von den Taliban geschnappt und abgeschlachtet werden«, zürnte er.
»Und Sie…, Sie müssen gar nicht so hämisch grinsen, General.
Ihre Männer sind nicht in der Lage, unsere Leute da rauszuschaffen. Was zum Teufel läuft da schief?«, wandte sich der Präsident an den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Mortimer McFaden.
»Uns sind die Hände gebunden, Sir. Es lagen geheimdienstliche Berichte vor, dass Kabul sicher sei und die Taliban den Verteidigungsring der Regierungstruppen nicht durchbrechen könnten«, spielte der General dem CIA-Director den Schwarzen Peter zu.
»Als die ersten Flugzeuge eintrafen, um unsere Leute auszufliegen, befand sich der Flughafen bereits in der Hand der Terroristen. Wir konnten einen Teil des Geländes zurückerobern, was allerdings nicht viel nützt, weil die Taliban sämtliche Zufahrten zum Flughafen blockieren. Da kommt derzeit niemand durch.«
Verteidigungminister Robert Lynott räusperte sich. »Wir haben Verhandlungen mit den Taliban aufgenommen, um zu erreichen, dass sie unseren Leuten ungehinderten Zugang zum Flughafen gewähren.«
»Und mit welchem Ergebnis?«, fragte der Präsident im scharfen Ton.
»Naja, sie fordern, dass die USA die neue Regierung anerkennen und unverzüglich sämtliche Soldaten aus Afghanistan abziehen sollen.«
»Aha, na wenn die sonst nichts wollen…«, schüttelte der Präsident den Kopf.
»Wir haben denen Geld geboten und zugesichert, uns bis zum Monatsende vollständig aus Kabul zurückzuziehen«, meldete sich Außenminister Kenneth Robertson zu Wort. »Wir stehen kurz vor einer Einigung. Danach haben wir genau noch eine Woche Zeit, unsere Landsleute in Sicherheit zu bringen und von dort zu verschwinden.«
»Aber auch das wird zunehmend schwieriger, weil die Taliban sich plötzlich vermehrt den Attacken des IS ausgesetzt sehen. Es heißt, dass die Islamisten bereits bis an die Stadtgrenzen vorgedrungen seien«, berichtete General McFaden.
»Stimmt«, nickte Tom Bauer, »die Lage wird immer unübersichtlicher. Teile der regulären afghanischen Armee haben sich dem IS angeschlossen, andere sind zu den Taliban übergelaufen.
Wiederum andere haben sich auf den Weg ins Pandschirtal gemacht, um die letzte Bastion der Afghanischen Widerständler um Ahmad Massoud zu unterstützen. Das Gebiet rund um den Flughafen ist von den Taliban eingekesselt, der IS attackiert diese Region mit gezielten Angriffen auf die Besatzer, um diesen strategisch wichtigen Punkt zu kontrollieren. Und damit nicht genug, denn im Hintergrund lauert die Al Kaida auf ihre Chance als lachender Dritter aus dem Konflikt zwischen den Taliban und dem IS hervorzugehen. Da herrscht im Moment Chaos pur und es ist nahezu ausgeschlossen, unsere Leute durch diesen Belagerungsring zu schleusen. Ich denke, wir müssen so schnell wie möglich einen harten, gezielten Militärschlag durchführen.«
»Das Problem ist, dass uns die Zeit davon läuft. Wir haben nur noch wenige Tage, dann wird der Flughafen vollständig in der Hand der Taliban sein«, befürchtete General McFaden.
Der Präsident schüttelte unzufrieden den Kopf. »Wir müssen handeln, meine Herren. Wer da was verbockt hat, klären wir später. Also, ich möchte konstruktive Vorschläge hören. Das Leben vieler US-Bürger steht auf dem Spiel.«
»Und das von einigen tausend Afghanen, die für die USA gearbeitet haben und nun von den Taliban verfolgt werden. Auch denen gegenüber stehen wir in der Pflicht, Sir«, ergänzte Außenminister Robertson.
»Wir haben ein massives logistisches Problem. Es gibt nur eine Start- und Landebahn, die wir uns mit den anderen Nationen teilen müssen. Es bleiben also immer nur einige kleine Zeitfenster pro Tag, in denen unsere Maschinen starten und landen können.
Während die Briten und Franzosen ihre Leute direkt nach Hause fliegen, bringen die Deutschen ihre Staatsbürger zunächst nach Taschkent. Dadurch können sie ihre Flugzeuge effektiver einsetzen und mehr Menschen schneller aus der Gefahrenzone schaffen. Wir sollten das auch tun«, schlug Thomas Bauer vor.
»Es ist ja nicht so, dass wir großartig in Verzug wären. Es wurden bereits mehr als 9.000 Menschen evakuiert. Die Frage ist, wie lange wir das noch tun können, bis die Taliban den Flughafen stürmen. Ich denke auch, dass wir dringend militärische Unterstützung brauchen. Unsere Soldaten vor Ort gehen ein hohes Risiko. Sie versuchen an Sammelpunkten in der Stadt Menschen aufzunehmen und entweder mit gepanzerten Fahrzeugen oder mit Hubschraubern zurück zum Flughafen zu gelangen. Ein Wunder, dass es dabei noch keine Toten gegeben hat«, sagte General McFaden.
Es klopfte an der Tür. Ein Sekretär trat ein und legte dem Präsidenten einen Bogen Papier auf den Schreibtisch. »Die Meldung ist vor wenigen Minuten eingetroffen, Sir«, sagte er und verließ den Raum.
»Was in aller Welt…verdammt nochmal«, wurde der Präsident blass, als er die Eilmeldung las. »Es hat eine schwere Explosion am Kabuler Flughafen gegeben. Die Ursache steht noch nicht fest, aber es sollen mehrere Menschen getötet oder verletzt worden sein. Es wird vermutet, dass sich ein Selbstmordattentäter mitten in der Menge der Wartenden in die Luft gesprengt hat.«
Jan saß an seinem Schreibtisch und sichtete Akten ungelöster Fälle. Im Moment war es in Leipzig ruhig. Zumindest gab es keine nennenswerten Gewaltdelikte, die für die Mordkommission relevant gewesen wären.
»Was dabei, was für uns interessant sein könnte?«, fragte sein Chef, Dezernatsleiter Rico Steding.
»Keine Ahnung, möglich«, zuckte Jan die Achseln. »Sag mal, Peter Krause aus Dölzig, hat der was mit unserem Kollegen zu tun?«
»Hm, wahrscheinlich hast du die Akte von dem Tankstellenüberfall an der 181 vorliegen. Ich erinnere mich, da wurde damals eine unbeteiligte, junge Frau erschossen. Tja, die Täter konnten leider nicht gefasst werden. Es gab zwar eine Reihe von Indizien, aber die Überwachungskamera war ausgefallen und es gab weder Fingerabdrücke noch konnte brauchbare DNA am Tatort gefunden werden. Wir mussten die Verdächtigen wieder auf freien Fuß setzen.«
»Bei dem Opfer hatte es sich um eine gewisse Elena Krause gehandelt. Sie war gerade mal erst neunzehn.«
»Ja, stimmt, aber das war nicht Krauses Tochter, sondern seine Nichte. Schlimme Sache damals.«
»Und dieser Fall schlummert jetzt seit dreizehn Jahren in den Archiven, ohne dass da mal jemand nachgehakt hat?«
»Scheint so.«
»Und Krause? Hat der nicht weiter versucht, die Schuldigen zu finden?«
»Klar, aber irgendwann machte das eben keinen Sinn mehr. So viel ich weiß, hat der sich die Verdächtigen im Alleingang vorgeknöpft, aber deren Anwalt hat dem schnell einen Riegel vorgeschoben. Es wurde Kontaktverbot erlassen und Krause war aus dem Spiel. Irgendwann hat er dann entnervt aufgegeben.«
»Ich seh mir das mal genauer an, vielleicht fällt mir noch was auf«, sagte Jan.
»Klar, tu das. Wo ist eigentlich Hannah?«
»Bei ihrer Gynäkologin, müsste jeden Moment zurück sein.«
»Oh, gibt’s Probleme?«
»Nein nein, alles gut. Mutter und Kind sind wohlauf. Routinecheck, mehr nicht.«
»Wisst ihr eigentlich schon…«
»Klar, aber sagen wir nicht«, grinste Jan.
»Verstehe, ist ja auch eigentlich egal, oder? Hauptsache die beiden sind gesund.«
»Du sagst es, Rico.«
Es klopfte an der Bürotür und Horst Wawrzyniak trat ein.
»Morgen, Männer«, schien er gutgelaunt zu sein. »Nix los? Oder ist das die Ruhe vor dem Sturm?«
»Wälzen gerade ein paar alte Fälle. Sag mal, weißt du noch, wie das damals mit Krauses Nichte war? Dieser Mord an der alten Esso-Tankstelle draußen in Dölzig?«
»Hm, mussten wir nicht die vermeintlichen Täter mangels Beweisen laufen lassen?«
»Ich erinnere mich dunkel, dass es zwar Spuren gab, aber der DNA-Abgleich ohne brauchbare Ergebnisse geblieben war«, meinte Rico.
»Stimmt. Wir haben dann einige Jahre später die Proben erneut ins Labor geschickt, aber wieder ergebnislos. Seitdem liegt der Fall bei den Akten und verstaubt im Keller«, berichtete Waffel, wie der Polizeidirektor von seinen Leuten hinter vorgehaltener Hand genannt wurde.
»Merkwürdig, dass die Namen der Verdächtigen in der Akte nicht zu finden sind«, wunderte sich Jan.
»Der Anwalt hat damals darauf bestanden, alle Daten im System zu löschen, die in Verbindung mit seinen Mandanten standen«, erinnerte sich Waffel.
»Und ihr könnt euch nicht mehr an die Namen erinnern?«
»Nee, ist dreizehn Jahre her.« »Und Krause?«
»Möglich. Aber wir sollten uns reiflich überlegen, ob wir nochmal alte Wunden aufreißen sollten«, gab Rico zu Bedenken.
»Stimmt. Außerdem gibt es für Sie was anderes zu tun, Herr Hauptkommissar«, wandte sich der Polizeidirektor an Jan.
»Ach ja?«
»Ja, habe heute Morgen einen Anruf vom Bundesnachrichtendienst erhalten und vor einer halben Stunde hat sich die Bundeswehr bei mir gemeldet«, sagte Waffel.
Jan richtete sich aufmerksam in seinem Schreibtischsessel auf und kräuselte fragend die Stirn.
»Sie werden gebraucht. Sie sollen nach Kabul fliegen und mit ihrer Afghanistanerfahrung beim Rücktransport der Deutschen Staatsangehörigen behilflich sein. Da klemmt es wohl im Moment an allen Ecken und Kanten.«
»Was? Soll das ’n Scherz sein?«
»Nein, die haben da unten Probleme und brauchen dringend Experten, die sich mit Land und Leuten auskennen. Der Einsatz soll maximal zwei Wochen dauern.«
»Die ticken wohl nicht richtig. Meine Karriere als Soldat ist längst beendet, genauso wie meine Einsätze für die CIA und den BND. Nein, da müssen die sich woanders umsehen. Freiwillig kriegen mich keine zehn Pferde mehr da runter.«
»Zehn Pferde nicht, aber eine Einberufung zur Wehrübung.«
»Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Wehrübung? Dazu bin ich nicht verpflichtet.«
»Scheinbar doch. Sie sind Reserve-Offizier. Sie können jederzeit dienstverpflichtet werden. Es sei denn, Sie wären mittlerweile dienstunfähig.«
»Woher wissen Sie das?«
»Hat mir der Kerl, ein Oberst der Reserve, ausgiebig am Telefon erklärt.«
»Dann lass ich mich krank schreiben, verdammt.« »Zu spät, die haben sich bereits ein amtliches Gesundheitszeugnis besorgt. Die wissen, dass Sie topfit sind. Wer beim Polizeitriathlon als fast sechszigjähriger die Fünftausend in zwanzig Minuten läuft, hat wohl keine Ausreden.«
»Wie bitte? Das glaub ich jetzt nicht«, konnte es Jan nicht fassen.
»Was glaubst du nicht?«, fragte Hannah, die gerade zur Tür hereinkam.
»Äh, wir…wir reden gerade über einen alten ungelösten Fall«, stotterte Jan.
»Ach wirklich? Über welchen denn?«
»Die Sache mit Krauses Nichte. Kam vor dreizehn Jahren bei einem Tankstellenüberfall ums Leben. Die Täter konnten unerkannt entkommen«, schaltete Rico schnell, der natürlich sofort bemerkt hatte, dass Jan seiner schwangeren Freundin zunächst nichts von der Anfrage des BND erzählen wollte.
»Hm, ich erinnere mich. Gibt’s da was Neues?«
»Nee, nicht wirklich. Bin beim Durchblättern der alten Akten auf den Namen Krause gestoßen und wollte wissen, ob unser Kollege was damit zu tun hatte«, antwortete Jan.
»In der Tat, hatte er. Krause hat diesen Roy Schachner auf eigene Faust in die Mangel genommen. Das hätte ihm um ein Haar den Job gekostet.«
»Roy Schachner?«
»Ja, der Typ war ein Kleinkrimineller aus Dölzig. Hat Anfang der 2000er ’ne Reihe von Einbrüchen und Raubüberfällen begangen, wurde jedoch nur einmal auf Bewährung verurteilt. Der Typ ist allerdings längst Geschichte.«
»Wieso zum Henker hast du diesen Kerl noch so gut auf dem Schirm?«, wunderte sich Jan.
»Weil ich den Burschen kannte. Der trieb sich früher auch oft in Markranstädt rum. Eigentlich war er ein kleines Licht. Brach in Wohnungen von alten Leuten ein und klaute allerhand Kleinkram, den er dann im Internet verhökerte. Roy war nicht gewalttätig, konnte eigentlich keiner Fliege was zuleide tun. Deshalb konnte ich mir damals auch nicht vorstellen, dass der mit ’ner Knarre rumgefuchtelt hat. Bei seiner Festnahme konnten keine Schmauchspuren an seinen Händen nachgewiesen werden und bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden keine Waffen gefunden.«
»Und was war mit dem DNA-Abgleich?«
»Negativ, so viel ich weiß.«
»Hm, und wieso war sich Krause dann so sicher, dass er der Täter war?«
»Die Kassiererin wollte ihn anhand seiner Stimme und seiner Statur erkannt haben. Außerdem konnte Schachner zur Tatzeit kein Alibi vorweisen. Und die Täter haben damals ein paar Flaschen Wodka mitgehen lassen. Die leeren Flaschen mit Schachners Fingerabdrücken darauf fand man in einem Glascontainer in der Nähe seiner Wohnung in Dölzig. Sein Anwalt behauptete später, Schachner hätte die Flaschen vor dem Container liegen sehen und sie als umweltbewusster Bürger aufgehoben und eingeworfen.«
»Kompliment, was du noch alles weisst. Elefantengedächtnis nennt man das wohl, würde ich sagen«, wunderte sich Rico.
»War mein Fall damals«, erklärte Hannah, »mit Hans Bernstein im Team natürlich.«
»Vielleicht sollten wir uns diesen Schachner nochmal vorknöpfen«, dachte Jan laut.
»Kannst du dir sparen. Der liegt mittlerweile auf dem Dölziger Friedhof. Kam gut ein Jahr nach dieser Sache bei einem Autounfall ums Leben. Hat wie schon einige besonders taffe Typen zuvor die Kurve auf der 186 bei Priesteblich unterschätzt. Da wird’s im Winter spiegelglatt und wenn man nach der langen Geraden nicht vom Gas geht und zu spät zu scharf bremst, katapultiert einen die Eisbahn mit Schmackes in die Botanik. Da hat’s schon so manchen Ritter der Landstraße zerlegt.«
»Tja, wenn das so ist, dann machen wir eben wieder den Deckel drauf«, seufzte Jan und schlug die Akte zu.
»Warte mal. Wir sollten nachsehen, ob wir in der Asservatenkammer noch das Röhrchen mit den Haaren und Hautschuppen finden, die die Spusi damals sichergestellt hat. Und die könnte sich Josie dann nochmal vornehmen. Dreizehn Jahre in der Geschichte der DNA-Forschung sind ein echter Quantensprung.
Würde mich nicht wundern, wenn Frau Doktor, äh…Professor, nicht ein paar brauchbare Ergebnisse hervorzaubern könnte.«
»Klar, warum nicht«, meldete sich der Polizeidiektor zu Wort.
»Am besten, Sie übernehmen das persönlich, Frau Hauptkommissarin.«
»Ist mir ein Vergnügen, Chef.«
»Äh, na dann, gut. Danke für den Kaffee. Ich melde mich dann später nochmal.«
»Welchen Kaffee?«, verstand Rico Bahnhof.
»Na, den von heute Morgen.«
»Ach den. Ja klar, natürlich, immer wieder gern, Horst«, hatte jetzt auch Rico verstanden.
Jan rollte hinter seinem Rücken mit den Augen, was Hannah nicht sehen konnte. Doch die hatte längst registriert, dass hier gerade noch was anderes im Busche war, wollte aber Jan später danach fragen, wenn er es ihr nicht schon vorher von allein erzählt hätte.
»Ich hoffe, es ist alles in Ordnung mit dir und dem Baby«, wechselte Rico das Thema.
»Oh ja, alles Bestens. Mäxchen blüht und gedeiht.«
»Mäxchen?«
»Ja, Mäxchen, der Name ist Platzhalter für unser Baby. Irgendwie muss ich es ja nennen, solange wir noch keinen Namen haben.«
»Es?«
Jan grinste. »Guter Versuch, Rico.«
Hannah lächelte. »Könnte jetzt tatsächlich einen Kaffee vertragen, einen starken sogar.«
»Was denn? Schwangere sollen doch keinen…«
»Ich bin nur schwanger, nicht krank, Rico. Also her mit dem Muckefuck, verdammt.«
Der erwartete Volltreffer hatte sich zum Glück lediglich als Schuss vor den Bug erwiesen. Thomas Bauer tigerte unruhig in der operativen Kommandozentrale der Central Intelligence Agency herum und wartete im Stundentakt auf die neuesten Nachrichten der Agenten vorort. Die Lage in Kabul war äußerst fragil und konnte sich ständig verändern.
»Was wir wissen, ist, dass es die Taliban nicht waren. Im Gegenteil, unter ihnen gibt es die meisten Opfer. Und es war wohl kein Selbstmordattentäter, sondern wahrscheinlich war der Sprengsatz in einem geparkten Fahrzeug versteckt. Wenn es tatsächlich der IS war, hätten die wie üblich längst in den Sozialen Netzwerken mit diesem Anschlag geprahlt. Kann allerdings noch kommen. Wir halten es auch durchaus für möglich, dass das Attentat auf die Taliban von Ahmad Massouds Leuten ausgeführt wurde.
Oder die Al Kaida wollte den Taliban zeigen, dass sie auch noch da sind. Immerhin lebt ihr Anführer irgendwo mitten in Kabul.
Den in diesem Labyrinth aufzuspüren ist allerdings unmöglich«, lautete der aktuelle Bericht aus Kabul.
»Ich kenne jemanden, der weiß, wo Mohamed Jashari zu finden ist. Und dieser Mann weiß auch, wie man mit den Taliban umgehen muss«, sagte Thomas Bauer und blickte um ihn herum in fragende Gesichter. »Okay, ich brauche eine Leitung zum Bundesnachrichtendienst.«
»Mit Verlaub, Sir, in Deutschland ist es jetzt fünf Uhr morgens«, sagte eine junge Frau, die mit Kopfhörern vor einem überdimensionalen Bildschirm saß, auf dem via Satellit eine Weltkarte abgebildet war.
»Stellen Sie sich vor, Mrs…«, Tom musste mit einem Auge auf ihr Namensschild peilen, »…Turner, auch ich kann sechs Stunden zurückrechnen. Also, worauf warten Sie?«
»Natürlich, Entschuldigung, Sir«, wurde Kathleen Turner rot und stellte die Verbindung nach Wiesbaden her.
Es hatte eine Weile gedauert, bis Tom einen kompetenten Gesprächspartner in der Leitung hatte.
»Lenz«, meldete sich eine verschlafene Stimme.
»Guten Morgen, Sir, mein Name ist Thomas Bauer. Entschuldigen Sie bitte den Anruf in aller Herrgottsfrühe, aber wir benötigen dringend Ihre Hilfe. Es ist wichtig und es eilt. Wir brauchen einen Ihrer Männer für einen Einsatz in Kabul. Der Mann ist Major der Reserve. Er ist jetzt Hauptkommissar bei der Polizei in Leipzig und hat früher in Absprache mit Ihrer Behörde für die CIA gearbeitet.«
»Also, wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um einen ehemaligen Soldaten, der mal für den BND tätig war?«
»Ja, er war als Major der Bundeswehr in Afghanistan und hat dort in enger Absprache mit dem BND eine Spezialeinheit der CIA geleitet. Sein Name ist Major Jan Krüger.«
»Und der ist jetzt bei der Polizei in Leipzig?«
»Ja.«
»Warum fragen Sie dann nicht direkt dort nach? Der BND ist nicht mehr für ihn zuständig.«
»Es gibt Vereinbarungen zwischen dem BND und der CIA, in Fragen der Sicherheit eng zusammenzuarbeiten und über Vorgänge, die auch den anderen betreffen, zu informieren. Deshalb wäre es mir lieber, Sie würden diese Angelegenheit regeln und den Mann in Marsch setzen. Er ist Beamter und hat dem Staat zu dienen, oder? Würden Sie sich bitte darum kümmern, Sir? Das wäre einfach großartig.«
»Na, schön, ich werde gleich morgen früh sehen, was ich für Sie tun kann. Verprechen kann ich allerdings nichts.«
»Doch, das können Sie und zwar sofort. Ich kann jetzt allerdings auch auflegen und direkt den Innenminister anrufen, der für den CIA-Direktor sicher ein offenes Ohr haben wird. Wie war noch gleich Ihr Name? Lenz, wie der Frühling? Nur dass ich ihm dann auch die Person benennen kann, die sich in dieser Angelegenheit von internationaler Tragweite quergestellt hat.«
»Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der CIA-Direktor sind, Sir. Also gut, ich werde mich sofort um diese Angelegenheit kümmern und rufe zurück, sobald ich den Mann erreicht habe.«
»Danke, Herr Lenz. Ach, eins noch: Erwähnen Sie Major Krüger gegenüber bitte nicht, dass die CIA ihn angefordert hat und nennen Sie auf gar keinen Fall meinen Namen. Schicken Sie ihn im Auftrag des BND nach Kabul. Wenn möglich, soll der Mann sich noch heute in Marsch setzen. Bringen Sie ihn mit einer Bundeswehrmaschine nach Taschkent. Danach kümmern wir uns um ihn.«
»Ich werde umgehend alles Notwendige in die Wege leiten, Sir.«
Tom legte auf und schob einen genervten »Arschkriecher« hinterher.
»So, nun mal Butter bei die Fische, Großer. Was ist los?«, fragte Hannah, als die beiden im Auto auf dem Weg nach Hause saßen.
»Ich soll nach Kabul fliegen und bei der Evakuierung unserer Landsleute behilflich sein. Ich habe zwar keine Ahnung, was ausgerechnet ich da soll, aber irgendjemand scheint da so eine Idee zu haben.«
»Soll das ein Witz sein? Wenn ja, weiß ich allerdings nicht, an welcher Stelle ich lachen soll«, war Hannah überrascht.
»Waffel hat mir mitgeteilt, dass die Bundeswehr mich zu einer Reserveübung einberufen hat«, schüttelte Jan verständnislos den Kopf.
»Ja und? Dann sag denen doch, dass du nicht interessiert bist. Die können dich ja wohl nicht zwingen, oder?«
»Oh doch, leider.«
»Echt jetzt? Na, dann lass dich doch einfach krankschreiben, basta.«
»Zu spät, die haben sich ein amtliches Gesundheitszeugnis besorgt. Und da steht wohl drin, dass ich gesund und munter bin wie’n Fisch im Wasser.«
»Wie bitte? Dürfen die das so einfach?«
»Schätze, da hat der Bundesnachrichtendienst seine Finger im Spiel und die dürfen alles.«
»Und was jetzt?«
»Ja nichts, abwarten. Angeblich ist der Einsatz auf maximal zwei Wochen begrenzt. Ich werde sicher bald Genaueres erfahren.«
»Hast du nicht die Nachrichten verfolgt? Da unten ist die Hölle los. Die Taliban stehen kurz davor, den Flughafen zu stürmen und einzunehmen. Und in dieses Pulverfass sollst du eintauchen?
Haben die eigentlich’n Rad ab, diese Idioten?«, schimpfte Hannah wie ein Rohrspatz.
»Hm, mal sehen, vielleicht erledigt sich die Sache ja von selbst.
Wenn die Taliban das Gelände unter Kontrolle haben, müssen die Evakuierungen ohnehin eingestellt werden. Ist aber im Moment alles noch Spekulation.«
»Ich kann mir denken, wer dir diesen Mist eingebrockt hat«, meckerte Hannah.
»Hab ich auch schon dran gedacht«, antwortete Jan, der natürlich genau wusste, von wem seine Freundin sprach.
»Und der hat nicht mal die Eier, dich selbst anzurufen?«
»Na ja, der CIA-Direktor rekrutiert seine Agenten nicht persönlich. Ist aber durchaus möglich, dass Tom seine Finger im Spiel hat.«
»Hm, kein schöner Gedanke, dass »Mäxchen« vielleicht ohne Vater aufwachsen wird«, haderte Hannah.
»Hey, nun mal mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich denke, ich hab schon gefährlichere Aufträge gemeistert.«
»Klar, weil der Devil immer auf dich aufgepasst hat. Diesmal wird er dir nicht helfen können.«
»Wer weiß? Vielleicht haben die den auch kontaktiert.«
»Dazu müssen die ihn erstmal ausfindig machen. Am besten du rufst an und fragst ihn.«
»Solange ich nichts Konkretes weiß, werde ich nicht die Pferde Scheu machen.«
»Wahrscheinlich hast du recht«, zuckte Hannah mit den Schultern.
»Sag mal, was weisst du eigentlich noch über diesen Fall mit Krause und diesem Kerl aus Dölzig?«, wechselte Jan bewusst dasThema.
»Roy Schachner? Der war’s nicht. Der hatte wohl drei Komplizen. Einer saß im Fluchtwagen, die anderen beiden haben mit ihm zusammen die Tankstelle überfallen. Krauses Nichte, Elena hieß sie, glaube ich, war eher zufällig da. Die hatte wohl vergessen Grillkohle zu besorgen und wusste, dass die an der Tanke welche hatten. Sie stand mit einem Beutel an der Kasse und wollte bezahlen, als die Typen hereingestürmt kamen. Nachdem die sich das Geld und ein paar Flaschen Wodka geschnappt hatten, wollten die gerade wieder türmen, als die Kassiererin zum Handy griff, um die Polizei zu rufen. Einer der Männer hatte das bemerkt und ohne Vorwarnung mehrere Schüsse abgegeben. Ein Querschläger traf Elena im Kopf. Sie war auf der Stelle tot. Die Frau an der Kasse blieb unverletzt.«
»Und die wollte Roy Schachner erkannt haben?«
»Ja und damit hatte sie wohl recht. Die anderen blieben jedoch unerkannt. Schachner war dabei, aber er hat nicht geschossen.
Der Mörder war einer seiner Komplizen.«
»Und die konntet ihr auch im Umfeld von Schachner nicht ermitteln? Verwandte, Freunde, Bekannte? Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm.«
»Da sollten wir besser mit Krause drüber reden. Der hat ja später noch jahrelang auf eigene Faust weiterermittelt. Es gab wohl noch eine Reihe von Verdächtigen aus dem Kleinkriminellenmilieu, aber Schachners Komplizen blieben weiterhin unbekannt.
Krause hat den Mann beim Versuch, die Namen aus ihm herauszuprügeln, halb totgeschlagen. Merkwürdigerweise hat Schachner auf eine Anzeige verzichtet. Keine Ahnung warum.«
»Hm, das ist mehr als merkwürdig. Das hätte Krause wohl den Job gekostet.«
»Wohl wahr. Aber wie gesagt, da sollten wir mit ihm drüber reden. Aber erst dann, wenn Josie die DNA nochmal gründlich gecheckt hat. Sollte das ergebnislos bleiben, sollten wir diesen Fall ruhen lassen«, schlug Hannah vor.
»Macht Sinn«, nickte Jan und drehte das Radio lauter. »Hey, Wahnsinn, kennst du den Song?«
»Nee, aber wenn du ihn noch lauter machst, singt dein Sohn gleich mit«, warnte Hannah.
»Oh, Entschuldigung, dimmte Jan umgehend die Lautstärke. Ist aber trotzdem extrem geil, oder?«
Leb dein Leben jeden Tag/Lebe so wie du es magst/Leb für jemand, den du liebst/Für den du immer alles gibst/Leb als wär’s dein letzter Tag.
Gesegnet und verflucht/Gefunden und gesucht/In Flammen und erfroren/Gewonnen und verloren.
Durch Ebbe und durch Flut/Aus Asche und aus Blut/In Ruhe und im Sturm/Bin ich wieder geboren/Hab’s tausendmal versucht/Gesegnet und verflucht.
»Hm, nicht schlecht, wer ist das? Rammstein?«
»Nee«, prustete Jan los. »Nicht Rammstein, das ist Nino De Angelo.«
»Wie bitte? Dieser Schnulzensänger? Der macht jetzt Heavy Metal? Ich glaub’s nicht. Braucht der Kohle?«
»Möglich, aber egal. Ich mag das. Gute Mucke, starker Text, geiler Sänger«, schwärmte Jan.
»Hm, naja, auf jeden Fall hat er recht mit dem, was er da singt.
Hätte den Song auch »Carpe Diem« nennen können, das ist ja wohl die mehr oder weniger offene Botschaft. Aber du hast recht, geil gesungen. Hätte ich dem Schlagerfuzzi nie und nimmer zugetraut. Hab den immer in einen Topf mit Howard Carpendale und Frank Schöbel geworfen.«
»Frank Schöbel? Wer zum Teufel ist das denn?«, wunderte sich Jan.
»War der Top-Schlagersänger in der DDR. Trat oft in der Sendung »Ein Kessel Buntes« auf. Das war die Samstagsabend-Unterhaltung aus dem Friedrichspalast, mit vielen Stars und Sternchen. Auch damals schon mit Interpreten aus dem Westen. Ihr hattet »Wetten, dass…« und wir eben »Ein Kessel Buntes«. Ich glaube, beide Sendungen wurden sogar mal von Wolfgang Lippert moderiert. Naja, jedenfalls ist Frank Schöbel dort oft aufgetreten. Übrigens ein gutaussehender Bursche. Wir haben früher alle für den geschwärmt.«
»Hm, die Puhdys, Karat, City oder Silly kenne ich, aber Frank Schöbel? Muss ich wohl mal googlen.«
»Tu das, Großer, aber zuerst solltest du mal weiterfahren. Es ist seit gefühlt einer halben Stunde grün«, blickte Hannah demonstrativ Richtung Ampel, als auch schon das Hupkonzert hinter ihnen einsetzte.
»Ja ja, schon gut, ihr Spasten. Ein alter Mann ist kein D-Zug.«
»Nee, in deinem Fall eher ein ICE, der sich durch Nichts und Niemanden aufhalten lässt«, grinste sie und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
Special Agent James Walker war der Verzweiflung nahe. Er versuchte jetzt bereits geschlagene zwei Stunden, seinen Bericht nach Langley abzusetzen, doch alle Kommunikationswege schienen wie abgeschnitten. Es gab zurzeit weder ein Handynetz noch funktionierte das Internet. Das Satellitentelefon hatte keinen Empfang und das Festnetz im Tower neben der Landebahn war tot, gab keinen Ton mehr von sich.
»Verdammt, Leute, hat einer ’ne Ahnung, was hier los ist?«, rief er einer Gruppe von Marines zu, die gerade dabei war, einen weiteren Wohncontainer neben der Landebahn aufzubauen, den die letzte Boeing C-17 Globemaster, die etwa eine Stunde zuvor gelandet war, an Bord hatte.
»Die haben die Funkmasten gesprengt, das Internet abgeschaltet und den Strom abgedreht. Dauert ’ne Weile bis wir die Dieselaggregate in Betrieb haben. Versuchen Sie’s mit dem Satelittentelefon, Sir.«
»Hm, das Ding gibt auch keinen Mucks mehr von sich.«
»Störsender wahrscheinlich. Ändern Sie die Sendefrequenz solange, bis Sie ein Freizeichen bekommen. Kann dauern, klappt aber gewöhnlich.« »Okay, danke.«
Es hatte fast eine Stunde gedauert, bis endlich eine Verbindung zustande kam. Walker ließ sich sofort mit CIA- Direktor Thomas Bauer verbinden, dem er direkt unterstellt war.
»Die Lage wird immer brenzliger, Sir. Die Taliban haben uns sämtliche Kommunikationswege abgeschnitten. Das Satellitentelefon ist momentan die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die Marines sind heilfroh über die drei Schützenpanzer und den Kampfpanzer, die die Globemaster mit dem letzen Flug nach Kabul geschafft hat. Damit gelingt es momentan, die Taliban davon abzuhalten, uns zu überrennen und die Start-und Landebahn zu blockieren. Sagten Sie nicht, es gäbe eine Vereinbarung mit denen, dass wir hier weiterhin ungestört unsere Leute rausschaffen können?«
»Die gibt es, Special Agent Walker. Ist nur die Frage, wie lange es dauert, bis die Talibanführer mit dieser Information zu ihren Kämpfern am Flughafen durchdringen und ob die sich dann auch tatsächlich daran halten«, antwortete Tom Bauer.
»Im Moment geht hier gar nichts. Seit die Globemaster gelandet ist, steht alles still. Es geht das Gerücht, dass eine französische Maschine beim Landeanflug von einer Boden-Luft-Rakete getroffen worden sei. Die Briten und die Deutschen haben ihre Flüge derzeit eingestellt, bis sich die Situation geklärt hat. Das sollten wir auch tun, Sir. Wenn gerade eine Maschine nach Kabul unterwegs ist, müssen Sie dafür sorgen, dass sie nach Taschkent umgeleitet wird.«
»Okay, macht Sinn, Walker. Wir tun alles, um die Vereinbarung mit den Taliban aufrechtzuerhalten, um unsere Leute da rauszuholen. General McFaden hat den Befehl erteilt, im Notfall schwere Waffen einzusetzen, wenn die Taliban auf die Idee kommen sollten, unsere Zone auf dem Flughafen anzugreifen. Außenminister Robertson befindet sich in Kontakt mit der Talibanführung und versucht uns bis Monatsende Zeit zu verschaffen, unsere Mission erfolgreich zu Ende zu bringen.«
»Es sind im Augenblick allerdings weniger die Taliban, die uns Sorgen machen. Der IS hat sich neuformiert und ist bereits bis vor die Tore Kabuls vorgedrungen. Es geht das Gerücht, dass sie für die Explosion am Flughafen verantwortlich sind. Man spricht von mittlerweile über dreihundert Toten, zumeist Taliban und Zivilisten.«
»Okay, Walker, halten Sie durch. Wir werden Verstärkung in Marsch setzen. Wenn notwendig, werden wir mit aller Gewalt gegen diese Terroristen vorgehen, egal ob Taliban, IS oder Al Kaida. Wir haben unsere Verbündeten kontaktiert und arbeiten eng mit den Briten, Deutschen und Franzosen zusammen. Die Deutschen haben uns bereits angeboten, unsere Leute auf ihren Stützpunkt nach Taschkent zu bringen. Sie organisieren von dort aus den Weiterflug nach Incirlik.«
»Klingt gut, Sir…Sir? Hallo?« Die Verbindung war zusammengebrochen.
»Agent Walker? Agent Walker?…, verdammt, das war’s. Haben wir ein Bild?«, fragte Tom Bauer.
»Leider nein, die Satellitenverbindung ist unterbrochen. Aber sehen Sie sich das hier mal an, Sir. Hat das französische Fernsehen gerade ausgestrahlt«, sagte Kathleen Turner, ein junge, hübsche Brünette Anfang dreißig, die nicht etwa, wie die CIA-Mitarbeiterinnen unter dem erzkonservativem Ex-CIA-Chef Chief Broderick, mit Dutt, Katzenaugenbrille und einfarbigen, dezenten Kostüm ausstaffiert, sondern leger in Jeans und T-Shirt gekleidet war.
Auf dem Monitor war eine heftige Explosion zu erkennen, die offenbar mit einer Handykamera gefilmt worden war. Das Video war ohne Ton, die Bilder dafür umso grausamer. Wo sich vorher noch eine Menschenmenge dicht vor dem Zaun des Kabuler Flughafens gedrängt hatte, war urplötzlich nur noch ein kahler Fleck übriggeblieben. Scheinbar hatte sich der Handyfilmer weit genug entfernt aufgehalten, um nicht selbst getötet zu werden. Er taumelte, das Handy fiel zu Boden, aber der Mann rappelte sich wieder auf und zeigte der Welt das unfassbare Ausmaß der Zerstörung, das diese offenbar gewaltige Detonation angerichtet hatte. Überall verstreut lagen Verletzte, Tote oder Leichenteile, darunter auch viele Frauen und Kinder.«
Tom Bauer zeigte sich zutiefst erschüttert. »Was zum Teufel geht nur in diesen verfluchten Terroristen vor? Glaube nicht, dass Allah diese hinterhältigen, brutalen Attacken auf unschuldige Frauen und Kinder gutheißt. Wir müssen diese Verbrecher aufhalten, verdammt. Verbinden Sie mich mit General McFaden, sofort!«, wies er seine Mitarbeiterin an.
Professor Dr. Nussbaum hatte nicht lange gebraucht, um die DNA-Proben auszuwerten., die ihr per Kurier in aller Frühe zugestellt worden waren. Die Gerichtsmedizinerin schlief nie viel und war bereits zeitig auf den Beinen gewesen, um die Proben zu analysieren. Als sie um kurz nach acht anrief, saß Hannah noch am Frühstückstisch.
»Na, mein Täubchen, wie fühlt ihr euch heute morgen? Hat »Mäxchen« dich schlafen lassen oder wieder Randale gemacht?
Seine berühmten, nächtlichen Strampelattacken sind ja mittlerweile legendär«, lachte Josie, wie Josephine Nussbaum von ihren Freunden genannt wurde.
»Wie kannst du nur um diese Zeit schon wieder so gut gelaunt sein? Das nervt. Schläfst du eigentlich nie?«
»Schlaf wird überbewertet. Acht Stunden nutzlos herumliegen behindert mich in meinem Tatendrang.«
»Sag nicht, du hast bereits Ergebnisse der DNA-Analyse?«
»Klar, dank Oxford Nanopore Minion.«
»Aha, schön, aber du sprichst leider in Rätseln.«
»Ein in den USA entwickeltes Gerät zur Sequenziertechnik, das nur noch etwa drei Minuten braucht um ein halbwegs sicheres Ergebnis zu liefern.«
»Echt jetzt?«
»Ja, allerdings sollten diese Ergebnisse anschließend nochmal überprüft und verifiziert werden. Ich nutze dieses Gerät seinem einem halben Jahr und musste meine Ergebnisse bisher niemals im Nachhinein revidieren. Die Kontrolluntersuchungen haben meine Resultate stets bestätigt.«
»Hm, ich hatte frühestens Übermorgen damit gerechnet. Und?
Gibt’s neue Erkenntnisse, oder ist alles beim Alten geblieben?«
»Beides, Schätzchen.«
»Wie bitte?«
»Bei Roy Schachner hat sich keine Übereinstimmung ergeben.«
»Mist, verdammter«, fluchte Hannah.
»Langsam, wart’s ab. Dafür habe ich einen anderen Treffer. Und du glaubst nicht, wer bei diesem Überfall dabei gewesen ist. Ist echt der Hammer.«
»Mach’s nicht so spannend. Also, um wen handelt es sich?«
»Um einen guten alten Bekannten. Ricky Buchner aus Markranstädt.«
»Oh, naja, eigentlich sollte ich jetzt überrascht sein. Aber irgendwie passt das wie die Faust aufs Auge. Klar, Schachner und Buchner kannten sich. Die gehörten zu dieser Gang von Jugendlichen, die im Westen von Leipzig gern immer mal wieder über die Stränge geschlagen haben. Allerdings hatten die meist nur große Klappe. Bis auf ein paar Diebstahldelikte und Kneipenschlägereien war da nichts Aufregendes dabei. Passt schon irgendwie ins Bild, dass Ricky bei der Sache mitgemacht hat, aber eine Waffe hat der niemals benutzt. Dafür war der Typ viel zu feige. Tja, und außerdem sieht er sich ebenso wie sein Kumpel Schachner bereits die Radieschen von unten an.«
»Und es gibt noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe DNA von einer dritten Person gefunden. Leider spuckt die Datenbank keinen Treffer aus. Schätze, der Kerl war niemals vom System erfasst worden.«
»Okay. Also suchen wir nach dem sogennanten unbekannten Dritten, haben aber nicht den geringsten Hinweis auf diese Person?«
»Nicht ganz. Wir wissen, dass es sich um einen Mann handelt, der damals etwa fünfundzwanzig Jahre alt war und wahrscheinlich irgendwo aus dem Umfeld von Buchner und Schachner stammte. Muss ich jetzt schon deine Arbeit machen, Schätzchen?
Das Gute ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen Verdächtigen anhand seiner DNA zu überführen. Also mischt einfach mal den früheren Bekanntenkreis dieser beiden Gangster auf und schickt mir DNA von diesen Burschen. Wir werden den Mörder finden, Hannah, wäre ja gelacht, oder?«
»Hast ja recht, Josie, entschuldige, bin heute morgen nicht gut drauf.«
»Ach, Stimmungsschwanken sind bei Schwangeren normal, mach dir mal keinen Kopf, Schätzchen.« »Wenn’s nur das wäre.
Jan soll zurück nach Afghanistan.«
»Häh? Soll das ein Witz sein?«
»Nein.«
»Was zum Henker soll der denn da? Die Truppen sind doch alle abgezogen. Macht ja sowas von keinen Sinn.«
»Er soll die Evakuierung Deutscher Staatsbürger koordinieren.
Er würde sich wie kein Zweiter mit den Gegebenheiten vorort auskennen, heißt es. Offiziell hat ihn die Bundeswehr zu einer Wehrübung eingezogen.«
»Du machst Scherze, oder? Wehrübung? Der junge Mann wird sechzig, hallo! Denke nicht, dass die ihn zwingen können, diesen Blödsinn mitzumachen.«
»Leider doch. Es sei denn, er wäre dienstunfähig.«
»Ist doch ’ne leichte Übung für mich, ihm eben mal ’ne amtliche Arthrose in den Kniegelenken zu bescheinigen.«
»Die haben sich ein Gesundheitszeugnis besorgt und wissen, dass er topfit ist.«
»Quatsch, das dürfen die gar nicht. Ärztliche Schweigepflicht.«
»Die Bundeswehr nicht, aber der Bundesnachrichtendienst. Denen sind keine Grenzen gesetzt. Die haben quasi einen Persilschein, die beschaffen sich alle relevanten Informationen wann immer die nur wollen. Ist alles gesetzlich abgesichert.«
»Egal, dann erleidet er eben einen Fahrradunfall oder stürtzt die Treppe hinunter. Was auch immer, da wird mir schon was einfallen.«
»Tja, da gibt es ein Problem, das du wohl nicht regeln kannst.«
»Du sprichst in Rätseln, Madame.«
»Na ja, ich hab das verdammte Gefühl, dass ihn diese Aufgabe reizt.«
»Oh, da ist also jede Menge Testosteron im Spiel. Hätte ich mir fast denken können. Nee, dagegen kann ich natürlich keine Bescheinigung ausstellen. Ich kann allerdings versuchen, den Cowboy zur Räson zu bringen und ihm ein paar Takte flüstern, dass er sich besser um seine schwangere Frau kümmern sollte.«
»Warten wir mal ab, was gleich passieren wird. Er soll um neun bei Waffel im Büro sein. Ist bereits auf dem Weg ins Präsidium.
Da wird er sicher erfahren, was genau geplant ist.«
»Die ticken doch alle nicht mehr ganz sauber. Kann doch nicht sein, dass der alte Mann seinen Kopf für die Dummheit dieser unfähigen Politiker hinhalten soll, die null Konzept haben, wie sie unsere Leute aus dem Krisengebiet schaffen können. Sollen die doch selber ihren runzligen Arsch riskieren, diese degenerierten Kopfakrobatiker«, schimpfte Josie.
Als Jan kurz vor neun die Treppe in den ersten Stock hochstieg, kamen ihm zwei Uniformierte entgegen. Ein junger Leutnant und ein kaum älterer Oberfeldwebel, der eine Aktentasche unterm Arm trug. Im Vorbeigehen grüßten sie kurz und knapp und verschwanden eilig Richtung Ausgang.
»Ah, na da werden Sie die beiden Boten ja noch getroffen haben.
Die haben gerade Ihren Marschbefehl zugestellt«, empfing ihn Polizeidirektor Wawrzyniak.
»Ja, die sind an mir vorbeigerauscht, als müssten sie noch die nächste Straßenbahn erwischen. Sehr ungewöhnlich, dass die Bundeswehr eine Abordnung schickt, um eine Einberufung zur Wehrübung auszuhändigen. Eine email hätt’s auch getan.«
»Das haben die vorab außerdem gemacht. Sie fliegen morgen um 6.50 Uhr ab Leipzig nach Frankfurt und von da aus direkt weiter nach Taschkent. Dort wird sie Oberstleutnant Greger in Empfang nehmen und Ihnen Ihre Aufgabe erklären. So steht’s hier jedenfalls.«
»Die haben’s ja verdammt eilig. Aber wie zu hören ist, brennt es auf dem Flughafen an allen Ecken und Kanten. Ich habe nur nicht die geringste Ahnung, wozu die ausgerechnet mich da unten brauchen.«
Waffel legte die Stirn in Falten. »Wenn Sie da auf keinen Fall mitmachen wollen, dann sagen Sie’s jetzt. Irgendeine Lösung werden wir schon finden. Eine Bescheinigung vom Gynäkologen zum Beispiel, dass es Hannah gesundheitlich nicht gut geht und Sie deshalb unbedingt bei ihr zu Hause bleiben müssen.«
Jan schüttelte den Kopf. »Nein, ich setze mich morgen früh in den Flieger und werde dabei helfen, unsere Leute aus Kabul herauszuholen und nach Hause zu bringen. Vielleicht stimmt es ja sogar, dass ich über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit den Taliban verfüge. Eines dürfen Sie nämlich auf gar keinen Fall tun.«
»Was denn nicht zum Beispiel?«, fragte Waffel achselzuckend.
»Schwäche zeigen.«
»Hm, das dürfte im Moment aber eher schwierig werden.«
»Ja und gerade deshalb müssen sie hart und unnachgiebig sein.
Die Taliban kennen keine Kompromisse, für die gibt es nur friss oder stirb. Und sie müssen es verstehen, denen Angst einzujagen, das lähmt sie wie eine zentnerschwere Bowlingkugel an den Fußgelenken.«
»Die sind am Drücker. Wovor sollten die Angst haben?«
»Vor Teufeln und Dämonen. Die Rache des »Black Dragon«
zum Beispiel, fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser. Die sind extrem abergläubisch und deshalb fest davon überzeugt, dass Allah den »Schwarzen Drache« schickt, um sie für ihre Sünden zu bestrafen. Und deren Sündenregister ist so dick wie das New Yorker Telefonbuch.«
»Also werden Sie diesen Einsatz duchführen, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe?.«
»Ja«, antwortete Jan kurz und bündig.
»Hm, wenn ich’s nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass Sie überzeugt von dieser Mission sind.«
»Nein«, widersprach er.
»Ja, was denn nun?«, fragte Waffel verwirrt.
»Ich werde meine Pflicht tun und dabei behiflich sein, Menschenleben zu retten. Ich verstehe meine Aufgabe als humanitären Einsatz. Punkt, aus!«
»Na, ich hoffe, Hannah sieht das ebenso. Meinen Respekt für diese Einstellung haben Sie jedenfalls. Also gut, dann bestätige ich Ihre Freistellung für die nächsten beiden Wochen und wünsche Ihnen viel Glück. Kommen Sie gesund und munter wieder nach Hause.«
Der eigentlich bereits pensionierte Polizeidirektor hievte seinen mächtigen Körper wie in Zeitlupe aus dem bequemen Schreibtischsessel. Waffel war fast zwei Meter groß und wog sicher zweieinhalb Zentner. Er schüttelte Jan die Hand mit einer Pranke groß wie eine Bratpfanne.
»Danke, Herr Polizeidirektor«, sagte Jan, nickte ihm kurz zu und verließ das Büro mit seinem Einsatzbefehl in der Tasche.
Als Hannah kurz nach zehn das Präsidium betrat, lief ihr auf dem Flur vor ihrem Büro Oberkommissar Krause über den Weg.
»Ach, auf ein Wort, Krause«, hielt sie ihn auf.
»Hannah, wie geht’s? Alles im grünen Bereich?«, deutete er auf ihren bereits sichtbar gewölbten Bauch.
»Ja, danke, uns geht’s prima. Aber sag mal, erinnerst du dich noch an einen gewissen Roy Schachner?«
Krauses Miene verdunkelte sich. »Als ob’s gestern war. Warum fragst du?«
»Na ja, beim losen Durchblättern der Akten ungelöster Fälle bin ich an dieser Sache hängengeblieben. Die mussten Schachner damals laufen lassen, weil es keine handfesten Beweise gegen ihn gab, oder?«
»Leider. Das Problem war, dass der DNA-Abgleich negativ war, es keine Schmauchspuren gab und seine Frau ihm obendrein ein Alibi verschafft hatte. Wir konnten den Kerl nicht festnageln, obwohl er einer der Täter war. Da gab es keine Zweifel.«
»Hm, ich erinnere mich. Was war mit seinen Komplizen? Es sollen insgesamt vier Männer an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein?«
»Laut Zeugenaussagen waren drei in der Tankstelle und einer saß draußen im Fluchtwagen. Sie waren maskiert und die Überwachungskamera war defekt. Die Kassiererin war sich absolut sicher, dass einer davon Roy Schachner war. Sie hatte ihn anhand seiner hohen, kratzigen Stimme, der ausgeprägten O-Beine und der damit verbundenen typischen Bewegungen erkannt. Sie stammte wie Schachner selbst aus Dölzig und kannte den Mann schon seit Kindesbeinen. Aber leider hat das dem Richter nicht ausgereicht«, zuckte Krause mit den Achseln.
»Und dann hast du den Kerl im Alleingang in die Mangel genommen?«
»Klar, schließlich handelte es sich bei dem Opfer um meine Nichte Elena. Ich wollte das Schwein nicht einfach ungestraft davonkommen lassen. Als ich ihn zur Rede gestellt hatte, ist die Sache leider aus dem Ruder gelaufen.«
»Und warum hat er dich daraufhin nicht angezeigt?«
»Als er am Boden lag, bin ich ausgerastet und habe gedroht, ihn umzubringen, wenn er die Tat nicht gestehen würde. Und sollte ich im Knast landen, würden sich die Kollegen um ihn kümmern.
Und das würde sicher hässlich werden. Er hat zwar nicht gestanden, hat mich aber auch nicht angezeigt. Schätze, er hat dann doch lieber den Schwanz eingezogen und sein Maul gehalten.«
»Verstehe«, nickte Hannah.
Plötzlich tauchte Oberkommissar Jungmann auf und lugte über seine Schulter. »Wird langsam wie man sieht. Ausgezeichnet, meine Liebe«, kommentierte er Hannahs Bauchansatz,
Jungmann und Krause, zwei die untrennbar zusammengehörten, wie Starsky und Hutch, Holmes und Watson oder, was es wohl noch am besten traf, Hubert und Staller. Die beiden hatten sich gesucht und gefunden. Dabei war es eine zeitlang schwierig gewesen, mit den beiden Intriganten und Dauernörglern auszukommen. Sie hatten sich in der Vergangenheit zuweilen als unkollegial, hinterhältig und bösartig erwiesen. Kurzum, die beiden waren absolute Kollegenschweine, die man am liebsten von hinten sah. Bis, ja bis Jan Krüger aus Hamburg hier auftauchte. Als sie versuchten, den Neuen zu mobben, mussten sie schmerzlich feststellen, dass sie sich mit dem Falschen angelegt hatten. Die beiden hatten ihn auf dem Flur zu den Toiletten aufgelauert und wollten ihn nach allen Regeln der Kunst einschüchtern, um ihn gefügig zu machen. Jan hatte sich die beiden gepackt und kurzen Prozess gemacht. Er hatte ihnen eine Abreibung verpasst, die sich gewaschen hatte. Die Narben an ihren Köpfen erinnerten sie fortan ständig an die Zeit als Oberarschlöcher, die sie damals waren. Mittlerweile hatten die beiden ihre Einstellung jedoch geändert. Heute waren sie das krasse Gegenteil von dem, was sie mal gewesen waren: Fleißig, kollegial und hilfsbereit. Eigentlich arbeiteten Jungmann und Krause bei der Sitte, waren aber aufgrund der Personalknappheit längst zu ständigen Mitgliedern der Mordkommission geworden. Ohne sie wären Hannah, Rico und Jan längst an ihre Grenzen gestoßen. Dafür waren sie den beiden Ur-Leipzigern sehr dankbar.
Wie sich Menschen derart zum Positiven verändern können, hatte Hannah gar nicht für möglich gehalten. Was so eine gesalzene Abreibung doch alles bewirken konnte.
Die ständigen Nachtschichten der beiden Fußballfans waren goldwert. Sie schoben klaglos Dienst auf stickigen, überheizten Krankenhausfluren, standen frierend in der Kälte vor der Wohnung irgendeines Verdächtigen oder saßen nachts stundenlang in den unbequemen Sitzen ihres uralten Opel Astras. Es war ihnen scheinbar egal. Sie taten es einfach. Dabei konnten sie ellenlang über Fußball diskutieren und zankten sich gewöhnlich wie Hund und Katze. Während Krause glühender Anhänger des Traditionsclubs Lokomotive Leipzig war, hatte Jungmann vor gut zehn Jahren seine Passion für den 2009 gegründeten Club Rasenballsport Leipzig entdeckt, der mittlerweile mit den Millionen der Firma Red Bull im Rücken in der Bundesliga spielte, während Lok in den Niederungen der Regionalliga hängengeblieben war. Die gegenseitig vorgebrachten Argumente waren stets schnell aufgebraucht. Nach kurzer Zeit wurde es gewöhnlich laut und es flogen die Fetzen. Jungmann bezeichnete Krause als stur und neidisch, als ewig Gestrigen eben, während Krause dem Kollegen regelmäßig seine Sympathien zu diesem Retortenclub vorhielt, der sich den Erfolg nicht erarbeitet, sondern mit den Millionen des österreichischen Milliardärs Dietrich Mateschitz erkauft hätte.
Was Fußball anbelangte, würden sich die beiden Mittfünfziger in diesem Leben wohl nicht mehr einig werden. Ansonsten jedoch waren sie ein Herz und eine Seele.
»Einer der drei in der Tankstelle war Ricky Buchner. Wusstest du das?«, fragte Hannah.
»Nein, aber ich hatte es vermutet. Woher weißt du das?«
»Wir haben die DNA, die ihr damals am Tatort sichergestellt habt, nochmal untersuchen lassen.«
»Und diesmal gab’s ’nen Treffer?«
»Ja, Buchners DNA war ja mittlerweile im System, nachdem er wegen eines Raubüberfalls sechs Jahre hinter Gitter gesessen hatte und letztes Jahr bei einem Zwist im Drogenmilieu ums Leben gekommen war.«
»Und gibt es auch Hinweise auf diese dritte, unbekannte Person?
Vermutlich war das ein härterer Bursche als diese beiden Lokalganoven Buchner und Schachner. Schätze, der hatte die Waffe dabei und hat abgedrückt. Wir konnten diesen Mann damals trotz aller Bemühungen nicht ermitteln und Schachner hat geschwiegen wie ein Grab«, konnte sich Krause erinnern.
»Na ja, sieht so aus, als wäre der Kerl, den wir suchen, ein Kumpel oder zumindest ein guter Bekannter von Buchner und Schachner gewesen. Die beiden haben schon zu ihrer Schulzeit den dicken Macker markiert. Ricky Buchner war eine Klasse über mir und Schachner ein oder zwei Jahrgänge unter mir. Die haben damals ’nen Haufen Mist gebaut, aber mit Schusswaffen hatten die nichts am Hut. Allerdings gab es da so einen Typen aus Leipzig, der in Markranstädt irgendwann 2005 oder sechs eine Spielhalle eröffnet und unterm Ladentisch Drogen verkauft hat. Ricky Buchner hing dauernd mit diesem Kerl ab. Möglich, dass auch Schachner damals dabei war. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß der Typ Strehlau, Norbert Strehlau. Als Buchner ein paar Jahre später Raubüberfälle auf Tankstellen und Kioske verübte, hatte er plötzlich immer ’ne Waffe dabei. Hans Bernstein war sicher, dass er die von Strehlau hatte. Der Bursche war ein echt schlimmer Finger, aber schlau genug, immer die anderen vorzuschicken.«
»Strehlau? Nie gehört. Der Name ist damals im Zusammenhang mit dem Raubüberfall nie gefallen. Wir haben vermutet, dass noch ein gewisser Günther Zingel dabei war. Die Zeugin wollte einen grauen VW Golf erkannt haben, das Nummerschild hatte sie allerdings nicht gesehen. Dieser Zingel fuhr so einen Wagen und er war ein ehemaliger Arbeitskollege von Schachner. Aber dem konnten wir auch nichts nachweisen. Der hatte den besagten Abend angeblich bei seiner Freundin verbracht und Nachbarn wollten den grauen Golf vor seinem Haus gesehen haben.«
»Ich kenne Zingel. Seine Eltern wohnen heute noch ganz in der Nähe von uns. Der alte Zingel hatte später auch eine Laube im Kleingartenverein und half meinem Vater bei der Taubenzucht.
Wenn mich nicht alles täuscht, arbeitet Günther Zingel am Flughafen. Den habe ich vor ein paar Jahren dort mal getroffen. Möglich, dass der sogar noch in Markranstädt wohnt.«
»Und Strehlau? Weisst du, was aus dem geworden ist?«
»Nein, aber ich werde mich mal umhören. Immerhin sind wir im Besitz der DNA des dritten Mannes, also sollten wir versuchen, Zingel und Strehlau aufzutreiben und ihnen die Wattestäbchen in den Rachen schieben. Den Rest erledigt Josie mit ihrer brandneuen Sequenziertechnik. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir bald wissen werden, wer deine Nichte Elena auf dem Gewissen hat, Krause.«
»Klingt gut, Hannah, danke. Meine Schwester hat den Tod ihrer Tochter bis heute nicht verwunden. Mein Schwager Sascha hat es nicht mehr ausgehalten und ist vor zwei jahren zurück nach Moskau gegangen. Die Familie existiert nicht mehr. Wäre natürlich für beide eine Erlösung, wenn wir den Mörder ihrer Tochter nach so langer Zeit finden und bestrafen könnten.«
Oberkommissar Krause hatte Tränen in den Augen. Sein Partner Jungmann klopfte ihm tröstend auf die Schulter.
»Ich fahre morgen Früh nach Markranstädt und höre mich mal um«, sagte Hannah.
»Ich komme mit«, schlug Krause vor.
»Nein, wir sollten vermeiden, unnötig Staub aufzuwirbeln. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Wenn wir wissen, wo wir diesen Strehlau auftreiben können, müsst ihr euch um den Kerl kümmerm, okay?«
»Gut, Hannah, halte uns bitte auf dem Laufenden«, sagte Jungmann.
Pünktlich um 11:05 Uhr hob die Maschine vom Frankfurt Airport Richtung Taschkent ab. Jan war in aller Frühe von Leipzig in die Mainmetropole geflogen und hatte nicht mal eine Stunde Aufenthalt, bevor er seinen Flug nach Usbekistan fortsetzen konnte.
Der geräumige Airbus war nur etwa zur Hälfte besetzt. Er hatte einen Fensterplatz genau über der Tragfläche ergattern können, eben dort, wo er am liebsten saß. Irgendwo hatte er mal gelesen, dass das Flugzeug dort am wenigsten auf Turbulenzen reagierte.
Außerdem verlieh ihm das Fenster das Gefühl, nicht eingesperrt zu sein und der Blick auf die glatten, stabilen Tragflächen beruhigte seine Nerven. Der Gedanke, in zehn Kilometern Höhe in einer geschlossenen Kabine ohne irgendeine Fluchtmöglichkeit eingepfercht zu sein und nur von einer wenige Zentimeter starken Bodenplatte vor dem Absturz in die Tiefe bewahrt zu werden, erwies sich nicht gerade als einladend. Angst vorm Fliegen hatte er nicht, aber ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, das immer dann auftrat, wenn er sich bewusst machte, dass er null Einfluss auf die Dinge unmittelbar um ihn herum hatte.
Als er es sich einigermaßen bequem gemacht hatte, kramte er seinen Discman hervor und setzte sich die Kopfhörer auf, um bei guter Musik zu entspannen. Im Augenwinkel bemerkte er, wie ein junger Mann, der neben ihm am Mittelgang saß, ihn fassungslos anstarrte. Klar, dachte Jan, so ein Ding hatte der wahrscheinlich nie zuvor gesehen. Der Discman musste ihm erscheinen, wie ein Fossil aus einer längst vergangenen Zeit. Schallplatten, Musikkassetten oder Compact Discs kannte der wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Der lud Musik aus dem Internet auf sein Handy, hörte sie eine zeitlang und löschte sie dann wieder, um nicht wertvollen Speicherplatz zu belegen. Naja, bei diesem seelenlosen, mechanischen Gedudel moderner Popmusik machte es wohl auch wenig Sinn, einen Song öfter als zweimal zu hören.
Klang ohnehin alles gleich, dachte er. Klar, er hätte auch sein iPhone benutzen und über Bluetooth mit kabellosen Ohrsteckern Musik hören können. Hannah hatte bei Amazon Music einige seiner Lieblingsalben und eine Reihe von Playlists heruntergeladen.
Aber dieser kalte, blecherne Sound vermochte in ihm keine Emotionen zu wecken. Da fehlte jeglicher musikalischer Tiefgang.
Klar, auch der Discman war klanglich keine Offenbarung, aber er konnte wenigstens Höhen und Tiefen einstellen und die dreistufige Loudness-Taste zur Hilfe nehmen, wenn ein Song zu wenig Dynamik ausstrahlte. Und die Sennheiser-Kopfhörer, die Hannah ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, hoben den Klang des Discmans nochmal auf ein anderes Niveau. Hören sich verdammt geil an, die Dinger, schmunzelte er und nickte dem jungen, dunkelhaarigen Burschen, den er nicht älter als Mitte dreißig schätzte, freundlich zu. Der hielt demonstrativ sein iPhone in die Höhe und lächelte. Ja, du mich auch. Hast eh keine Ahnung von guter Musik, dachte er, schloss die Augen und lehnte sich gemütlich in die Polster zurück.
Während das Album Second Life Syndrom der Polnischen Prog-Rocker Riverside lief, die seit geraumer Zeit zu seinen absoluten Favoriten gehörten, gab er sich seinen Gedanken hin.
Warum hatte Hannah nicht versucht, ihn davon abzuhalten, nach Kabul zu fliegen? Als er sich letztes Jahr dazu entschlossen hatte, seine ehemaligen Kameraden Johnny Henderson und Dean Morisson aus der Gewalt der Syrer zu befreien, hatte Hannah noch wütend protestiert und wollte mit aller Macht verhindern, dass er sich im Auftrag der CIA zum wiederholten Male in Lebensgefahr begab. Sie hatte auf Tom Bauer geschimpft wie ein Rohrspatz und Jan beschworen, nicht nach Syrien zu reisen. »Was kannst du als einzelner Mann erreichen, was die große CIA nicht mit ihrer Armee von Agenten und Soldaten schaffen kann? Du bist lebensmüde, weißt du das?«
Er wusste damals natürlich, dass sie recht hatte, vermochte es jedoch nicht tatenlos dabei zuzusehen, wie zwei seiner Kameraden und Freunde, dem Tod geweiht, von ihren eigenen Landsleuten im Stich gelassen worden waren. Diese Mission war brandgefählich, glich zuweilen einem Ritt durch das sperrangelweit geöffnete Höllentor, aber zusammen mit seinem kongenialen Partner Maynard Deville war es ihm gelungen, seine Freunde zu retten und zurück nach Hause zu bringen.
Vielleicht dachte sie, diesmal würde es sich lediglich um eine rein humanitäre Maßnahme handeln, die dazu auf ein paar Tage begrenzt sein würde. Schließlich war das Zeitfenster zur Evakuierung nur noch eine Woche geöffnet. Danach würden die Taliban den Flughafen schließen.
Ob diese fragile Vereinbarung des Westens mit den neuen Machthabern in Afghanistan auch solange Bestand haben würde, bezweifelte Jan stark. Er hatte oft genug erlebt, wie einzelne Stammesfürsten sich dem Willen der Talibanführer widersetzt hatten. Die Taliban waren keine organisierte, strukturierte Armee, wo Befehl und Gehorsam herrschte, sondern ein zusammengewürfelter Haufen von unzähligen Volksstämmen, deren Stammesfürsten gewöhnlich machten, was sie wollten. Sie hielten sich so gut wie nie an das, was die Talibanführer vorgaben.
Kurzum, die Taliban waren ein unberechenbarer, wilder Haufen von agressiven Kämpfern, die ein gemeinsames Ziel verfolgten, nämlich die ungläubigen, westlichen Besatzer aus ihrem Land zu vertreiben. Jetzt, wo dieses Ziel beinahe erreicht war, und ihr Feindbild kurz davor stand, zu erlöschen, würden die alten Grabenkämpfe zwischen Sunniten und Schiiten wieder entfacht werden.
Jan war vollkommen klar, dass die Gewalt in Kabul jederzeit wieder eskalieren würde, er fragte sich nur wann. Das dies geschehen würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Diese Mission war also alles andere als ungefährlich. Er musste damit rechnen, dass er zur Waffe greifen und kämpfen müsste, um den Flughafen solange gegen die Taliban zu verteidigen, bis der letzte Flieger gen Westen abgehoben hätte. Ihm stand eine schwierige Woche bevor, das war ihm bewusst.
Er war sicher, dass Hannah das nicht wusste und wahrscheinlich deshalb kaum protestierte, als er heute Morgen in Leipzig in den Flieger nach Frankfurt gestiegen war. Sie war in aller Frühe aufgestanden und hatte ihn zum Flughafen gefahren.
Bei der Verabschiebung umarmten und küssten sie sich. Hannah lächelte und wünschte einen guten Flug, als würde er irgendeine harmlose Dienstreise antreten. Er kam sich vor wie ein Handelsvertreter auf dem Weg in die Firmenzentrale, die irgendwo in einer europäischen Hauptstadt lag und nicht wie ein Soldat, der in ein Krisengebiet flog, um dort sein Leben zu riskieren. Jan ahnte, dass dieser Auftrag mindestens ebenso gefährlich sein würde, wie seine Mission in Syrien, obwohl er noch nicht wusste, mit welcher Aufgabe Oberstleutnant Greggersen ihn betrauen würde.
Plötzlich tippte ihm jemand auf die Schulter. Als er sich umdrehte, lächelte ihn eine Stewardess freundlich an und erkundigte sich, ob er etwas trinken wollte. Wollte er.
»Kaffee, bitte, schwarz, ohne Zucker und ein Wasser, medium, wenn möglich«, sagte er, nachdem er die Kopfhörer abgesetzt hatte.
Sein Sitznachbar hatte seinen Laptop aufgeklappt und nippte an einem Tomatensaft. Jan musterte ihn von der Seite. Lockige, schwarze Haare, braune Augen, dunkler Teint und einen Dreitagebart. Südländer, möglicherweise aus einem arabischen Land.
Er schätzte ihn auf Mitte dreißig und fragte sich, was der junge Mann wohl beruflich machte und was ihn nach Taschkent führte.
»Normalerweise schütte ich literweise Kaffee in mich hinein, aber im Flieger lasse ich das lieber. Ist zu umständlich, alle paar Minuten aufstehen zu müssen und sich in der Schlange vor den Toiletten einzureihen«, grinste er.
»Ist was dran. Vielleicht sollte ich auch auf Tomatensaft umsteigen.«
»Mit ’nem Schuss Tabasco schmeckt der gar nicht mal so schlecht. Sollten Sie mal probieren.«
»Später, für den Moment bin ich versorgt.«
»Reisen Sie geschäftlich nach Taschkent?«, wollte der junge Mann wissen.
»Ja und Sie? Was machen Sie?«, wich Jan mit einer Gegenfrage aus.
»Ich arbeite für eine IT-Firma in Frankfurt und besuche einen unserer Kunden in Taschkent«, antwortete der Mann geduldig.
»Macht man das nicht heutzutage online per Videokonferenz?
Ich meine, Taschkent ist ist ja nicht mal eben nebenan, oder?«
»Stimmt, da haben Sie recht. Aber es gibt halt immer noch Dinge, die man analog vorort regeln muss. Ich installiere in diesem Unternehmen eine neue Software und überarbeite anschließend die Homepage. Wird ein paar Tage dauern und lässt sich am besten direkt beim Kunden erledigen.«
»Verstehe«, nickte Jan, der das Gefühl nicht loswurde, dass der Typ an seiner Seite nicht die Wahrheit sagte. Er konnte es an seinen Augen ablesen. Das hatte er in all den Jahren als Polizist gelernt. Und er täuschte sich selten. Allerdings hatte er null Ahnung, warum der Typ ihn anlog. Vielleicht war er aber auch einfach nur zu neugierig gewesen. Er beschloss den Smalltalk zu beenden, bevor er jetzt lästige Fragen beantworten musste. Er nickte dem Mann freundlich zu, wandte sich ab und setzte sich wieder die Kopfhörer auf.
Nachdem Hannah Jan am Flughafen abgesetzt hatte, fuhr sie Richtung Markranstädt zu ihren Eltern. Als sie um kurz nach sieben die Wohnungstür im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in der Zwenkauer Straße aufschloss, saßen ihren Eltern gerade beim Frühstück.
»Guten Morgen«, rief sie laut in den Flur hinein, damit sich die beiden nicht erschreckten. Hannah besaß einen Haustürschlüssel für alle Fälle. Konnte ja sein, dass ihre Eltern sich mal ausgesperrt hatten, den Schlüssel verlegt oder verloren hatten oder aber, was Hannah natürlich nicht hoffte, ein medizinischer Notfall eintrat und sie die Tür nicht mehr öffnen konnten.
»Hannah?«, hörte sie ihre Mutter aus der Küche rufen.
»Ja, ich bin’s, keine Panik«, antwortete sie.
»Was verschafft uns die Ehre zu dieser frühen Stunde? Bist du etwa aus dem Bett gefallen?«, wunderte sich ihr Vater über ihren frühmorgendlichen Besuch.
»Setz dich. Wie geht’s dir? Möchtest du mit uns frühstücken?«, stellte ihre Mutter wie immer gleich mehrere Fragen gleichzeitig.
»Uns geht’s prima«, klopfte Hannah sachte mit der flachen Hand auf ihren Bauch. »Ein Kaffee wär’ nicht übel.«
»Was hast du auf dem Herzen, mein Schatz?«, fragte ihr Vater, der ahnte, dass dieser außerplanmäßige Besuch am frühen Morgen einen besonderen Grund hatte.
Hannah erzählte ihren Eltern, dass Jan eine Einberufung zur Wehrübung erhalten hatte und gerade nach Kabul geflogen war.
»Hm, das ist ungewöhnlich. In seinem Alter?«, bemerkte Peter Dammüller. »Ist er denn dazu verpflichtet?«
»Leider ja«, nickte Hannah. »Er ist Reserveoffizier und kann jederzeit zu einer Wehrübung einbestellt werden, es sei denn, er wäre aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage dazu.«
»Wusste ich nicht. Also ist er nicht freiwillig nach Afghanistan gereist?«, vermutete ihr Vater.
»Na ja, wie man’s nimmt. Er konnte nichts dagegen tun, also hat er sich mit der Situation angefreundet und betrachtet seinen Auftrag als humanitären Einsatz.«
»Tja«, kratzte sich ihr Vater am Kopf, »dann drücken wir fest die Daumen, dass alles gut gehen wird und er bald wohlbehalten zurückkehrt.«
»Macht euch keine Sorgen. Jan kann auf sich aufpassen.«