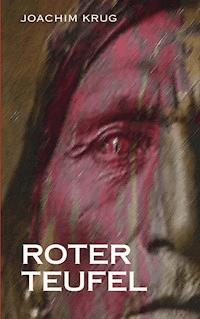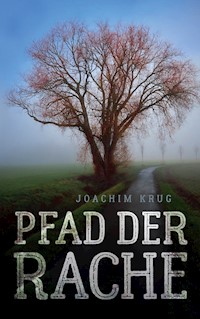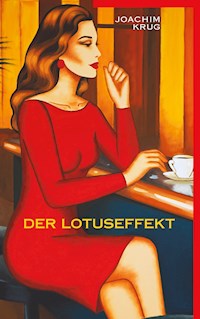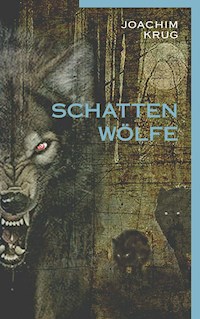
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jan Krüger kommt bei einem Autounfall ums Leben? Die Al Kaida glaubt jedoch nicht an seinen Tod und stellt Nachforschungen an. Dabei töten die Terroristen Jans Eltern, verletzen seine Freundin Hannah und entführen seine Schwester Sylvia. Währenddessen verübt die Al Kaida unter der Führung von Hassan Omar Bin Khalib einen brutalen Terroranschlag auf die Israelische Botschaft in Paris. Als Jan versucht, seine Schwester zu befreien, zieht sich Hassan in die Berge des Hindukusch zurück, wo die Al Kaida auf viertausend Metern Höhe ihr Hauptquartier errichtet hat. Die "Himmelspforte" gilt als unzugänglich und uneinnehmbar. Als Jan und seine Leute in das Lager vorzustoßen drohen, lockt Hassan seine Angreifer in einen Hinterhalt. Jan Krüger und Maynard Deville heften sich an die Spur der Männer. Eigentlich haben die beiden gegen die Überzahl der Mudschaheddin keine Chance, doch die wollen sie nutzen. In eisiger Dunkelheit, verfolgt von einem hungrigen Wolfsrudel, kommt es in den Bergen des Hindukusch zu einem zähen Ringen um Leben und Tod ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 999
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Winter in Hamburg. Kein Schnee, kein Regen, aber bitterkalt. Die Temperaturen lagen selbst tagsüber unter zehn Grad Minus. Der eisige Ostwind der letzten Tage hatte sich zwar etwas gelegt, trotzdem vermochte die Sonne am wolkenlosen, blauen Himmel über der Hansestadt niemanden so richtig zu erwärmen. Schon gar nicht an einem solch traurigen Tag.
An diesem Vormittag des 16. Februars bewegte sich eine Karawane von schwarz gekleideten Gestalten schleppend über die breiten Wege des Ohlsdorfer Parkfriedhofes. Kaum jemand sprach, die Blicke richteten sich ins Leere. Es war ein gutes Stück zu laufen, bis die Menschenmenge die Kapelle Nummer 13 im östlichen Teil des Friedhofes erreicht hatte. Hier im sogenannten Linne-Teil des Friedhofes lag der 1929 von Fritz Schumacher entworfene monumentale Rundbau in typisch norddeutscher Backsteinarchitektur. Das Bauwerk war 1996 umfassend restauriert worden. Die lediglich 151 Sitzplätze würden jedoch die zu erwartende Menge an Trauergästen nicht bewältigen können. Deshalb blieb das große Portal des Gebäudes geöffnet. Die Friedhofsverwaltung hatte auf dem Rasen davor Lautsprecher aufstellen lassen, um die Trauerfeier nach draußen zu übertragen. Aus allen Himmelsrichtungen strömten immer mehr Menschen durch einen der vier Haupteingänge des Parkfriedhofes zur Trauerhalle. Die meisten davon blieben davor stehen, um der Familie und den nächsten Angehörigen des Verstorbenen den Vortritt zu lassen. Nachdem diese die Kapelle betreten hatten, sorgte ein Gemeindehelfer dafür, dass vor allem ältere und gehbehinderte Trauergäste noch einen Platz in Inneren fanden.
»Entschuldigung, sind Sie Hannah?« Vor Hannah stand eine große, schlanke Frau Anfang vierzig mit Tränen in den Augen.
»Ich bin Sylvia, Jans Schwester.« Sie reichte ihr die Hand. »Meine Eltern und ich möchten Sie bitten, mit uns vorn in der Kapelle Platz zu nehmen.«
Hannah war irritiert. Woher kannte Jans Schwester ihren Namen? Die Frau bemerkte ihre Unsicherheit. »Mein Bruder hatte es nicht so mit Familie. Er hat nie viel von seinem Privatleben preisgegeben. Umso erstaunter waren wir, als er uns von Ihnen erzählt hat. Er hat Sie sehr geliebt, Hannah, glauben Sie mir. Meine Eltern würden sich freuen, wenn Sie uns die Ehre erweisen würden.«
Hannah hatte Mühe, sich zusammenzureissen. Rico Steding drückte fest ihren Arm und schob sie leicht nach vorn. Sie nickte ihm dankbar zu und folgte Jans Schwester in die Kapelle.
»Unglaublich, wie viele Menschen hier versammelt sind, fast wie bei einem Staatsbegräbnis«, bemerkte Polizeioberrat Wawrzyniak leise.
Neben ihm und seinem Begleiter Hauptkommissar Rico Steding von der Leipziger Mordkommission hatte sich eine größere Gruppe Uniformierter zusammengefunden. Sie trugen die Abzeichen der Hamburger Polizei. Ein kleiner, etwas älterer Beamter mit wirrem, grauem Haar hatte sich demonstrativ an deren Spitze gestellt. Seine Uniform war ein gutes Stück zu groß und voller knittriger Falten. Die Absätze seiner ausgelatschten Schuhe hatten bereits den Saum der zu langen Hose platt getreten. Er wirkte wie ein Schuljunge in Vaters zu großer Uniform. Wahrscheinlich hatte er sie schon lange nicht mehr getragen. Anzug und Figur hatten sich auseinandergelebt. Die vielen Abzeichen und Orden deuteten darauf hin, dass der Mann schon einige Dienstjahre auf dem Buckel hatte.
»Könnte dieser Wiswedel sein«, flüstere Rico. »Der Typ wollte Jan ans Leder. Er hatte vor, ihn wegen eines Doppelmordes anzuklagen. Hat sich krampfhaft um stichhaltige Beweise bemüht. Vergeblich. Und zum guten Schluss hat das BKA ihm den Fall weggenommen. Das bedeutete für ihn Frust hoch zehn. Seine Trauer wird sich wohl in Grenzen halten.«
»Anzunehmen«, stellte Horst Wawrzyniak fest.
»Hat jemand Hannah gesehen?«, hörte Rico plötzlich eine Frauenstimme hinter sich. »Ja, Chef, ich weiß, tut mir leid, aber ich hab 'ne halbe Stunde im Stau gestanden.« Frau Dr. Josephine Nussbaum hatte darauf bestanden, mit ihrem eigenen Wagen aus Leipzig anzureisen. Die elegant in schwarz gekleidete Gerichtsmedizinerin nahm nur ungern die Rolle als Beifahrerin ein. Die Narben an ihrem Körper erinnerten sie immer wieder daran, dass sie sich beim Autofahren besser nur auf sich selbst verlassen sollte.
»Ist mit reingegangen. Jans Familie wollte das so.«
»Aha, äh, wie das denn?«, wunderte sie sich, entnahm dann aber dem genervten Gesichtsausdruck ihres Vorgesetzten, dass jetzt keine weiteren Fragen erwünscht waren.
»Erklär ich dir später«, beendete Rico Steding das Thema.
Hannah saß zusammen mit Sylvia und Jans Eltern in der ersten Reihe. Die beiden kauerten zu einem Häufchen Elend zusammengekrümmt auf der harten Holzbank und drückten sich fest aneinander. Als Hannah ihnen die Hand reichte, um ihr Beileid auszudrücken, bemerkte sie, dass ihre schlaffen Gliedmaßen keinerlei Kraft mehr besaßen. Sie nickten ihr zu und bemühten sich um ein kurzes, kaum wahrnehmbares Lächeln. Zu Füßen eines riesigen weißen Holzkreuzes stapelten sich unzählige Kränze und Blumengebinde. Etwas verloren stand dazwischen eine kleine, schwarze Urne mit einem goldenen Kreuz auf dem Deckel. Seitlich davon hing ein großes Schwarz-Weiß Porträt von Jan. Er lächelte. Wieder schossen Hannah die Tränen in die Augen. Und das da drinnen sollte alles sein, was von diesem starken, liebenswerten Mann übrig geblieben war? Ein Häufchen Asche in einem kleinen, unscheinbaren Tongefäß? Unerträglich. Sie musste ihren Blick abwenden und sah hoch zur mächtigen Kuppel der Kapelle. Verdammt noch mal, lieber Gott, lass diesen Alptraum bald zu Ende sein. Lass mich aufwachen und alles ist wieder gut, dachte sie.
Seitlich des Altars wurde knarrend eine kleine Holztür geöffnet. Das nervige Geräusch zerriss die Stille. Ein großer, hagerer Geistlicher in einem schwarzen Talar mit weißem Rundkragen baute sich vor dem Altar auf. Allem Anschein nach war Jan evangelisch. So wie es unter alteingesessenen Hanseaten eben üblich war. Über seine Konfession hatte sie sich nie Gedanken gemacht. Warum auch? Mit Religion hatten beide nicht viel am Hut. Sie schon gar nicht. Zu DDR-Zeiten war alles, was mit Glauben und Kirche zu tun hatte, verpönt. Schlichtweg unerwünscht im sozialistischen Arbeiter–und Bauernstaat.
Der Pastor räusperte sich, um den Beginn seiner Trauerrede anzuzeigen. Totenstille. Hannah sah auf den Boden. Sie suchte sich einen Fixpunkt auf einer großen, unregelmäßig behauenen, braunen Bruchsteinplatte. Um sich herum blendete sie alles aus.
»Liebes Ehepaar Krüger, liebe Angehörige und Trauergäste. Durch einen tragischen Unfall wurde ein von uns allen geliebter und geachteter Mensch jäh aus dem Leben gerissen…« Mehr hörte sie nicht. Mehr wollte sie auch nicht hören. Sie senkte den Kopf und verschloss Augen und Ohren. Nichts sagen, nichts sehen, nichts hören. Ihre Gedanken entführten sie von diesem traurigen Ort weit weg zurück in die Zeit, die sie mit Jan verbringen durfte. Ihre Beziehung war intensiv, aber eben auch kurz. Unglaublich kurz sogar. Die Bilder in ihrem Kopf zeugten von glücklichen Tagen der Zweisamkeit. Sie lachten und weinten, sie redeten und schwiegen, sie liebten und stritten, sie erinnerten und vergaßen. Nie zuvor war sie so glücklich gewesen. Aber Glück war für sie scheinbar nicht vorgesehen. Das Leben hatte anscheinend einen anderen Plan für sie. Das Schicksal hatte ihr einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Hatte sie nicht wie alle anderen auch ein Recht darauf, glücklich zu sein? Verdammt nochmal, was soll das denn? Will der Kerl da oben mich eigentlich verarschen? In ihre grenzenlose Trauer mischte sich unendliche Wut. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf. Irgendwann und irgendwo her reichte ihr eine Hand ein Taschentuch. Während sie es dankbar annahm, standen die Menschen um sie herum langsam auf. Einige gingen nach vorn, um sich persönlich zu verabschieden. Die Meisten jedoch verließen still und leise die Kapelle. Die Familie Krüger hatte darum gebeten, von Beileidsbekundungen während und nach der Trauerfeier Abstand zu nehmen. Das wäre für die alten Leute wohl auch zu viel gewesen.
Die Urnenbeisetzung sollte in den nächsten Tagen in aller Ruhe und im engsten Familienkreis stattfinden. Draußen vor der Kapelle hatte sich eine Einheit der Bundeswehr formiert und feuerte Salut. Ein Musikzug der Hamburger Polizei war aufmarschiert und nahm Aufstellung. Hannah war entsetzt. Alte Kameradenwar wohl absolut das Letzte, was Jan sich bei seiner Beisetzung gewünscht hätte. Doch zu ihrer Überraschung hatten sie ihr Repertoire an die besondere Situation angepasst. Sie spielten Brothers In Arms von den Dire Straits. Zugegebenermaßen in einer etwas eigentümlichen Version. Mit Pauken und Trompeten. Aber die hatte durchaus Charme. Sehr gefühlvoll und emotional gespielt. Hannah lief ein Schauer den Rücken herunter. Plötzlich berührte sie eine Hand am Ärmel. Aus ihren Gedanken gerissen, sah sie sich um. Hinter ihr standen Thomas Ritter und Carl Georg Romminger. Sie trugen Uniform. Thomas beugte sich leicht nach vorn und flüsterte ihr ins Ohr. »Wir müssen reden, Hannah.«
Sie nickte, drehte sich um und folgte den beiden Männern. Ein paar Meter abseits der Kapelle hielten sie inne.
»Verdammt, Mädchen, was ist denn passiert? Wir haben nur gehört, Jan hätte einen Unfall gehabt?«
Hannah wischte sich die Tränen aus den Augen und putzte sich die Nase. Die kalte frische Luft hier draußen tat gut. »Schön, dass ihr gekommen seid«, begann sie. »Ja, es stimmt, Jan hatte einen Unfall. Er ist mit seinem Wagen bei Glatteis aus der Kurve getragen worden und hat sich mehrfach überschlagen. Das auslaufende Benzin hat sich entzündet und der Wagen ist in Flammen aufgegangen. Jede Hilfe kam zu spät.«
Tom Ritter schüttelte den Kopf. »Unglaublich. Und ihr seid sicher, dass Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden kann?«
»Wir wissen selbst nicht viel. Unsere Leute haben den Unfallort gesichert und später nach Spuren abgesucht. Sie schließen nicht aus, dass eine starke und breite Bremsspur aus entgegengesetzter Richtung etwas mit dem Unfall zu tun haben könnte. Vielleicht musste Jan einem Lkw ausweichen, dessen Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Aber bisher sind das alles nur Vermutungen. Zumal sich das Bundeskriminalamt eingeschaltet und die weiteren Ermittlungen übernommen hat.«
»Das BKA?«, fragte Carl Georg Romminger überrascht, »bei einem Verkehrsunfall? Das ist doch wohl kein Zufall, oder?« »Und der Tote konnte einwandfrei identifiziert werden?«, erkundigte sich Tom Ritter.
Hannah nickte. »Der Obduktionsbericht lässt keinen Zweifel. Das ging aus dem Schreiben des BKA an unsere Gerichtsmedizinerin eindeutig hervor.«
»Was denn? Das BKA hat auch die Obduktion durchführen lassen?« Tom kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
»Ja, sie haben uns mitgeteilt, dass ein begründeter Verdacht auf einen Terroranschlag bestände und sie deshalb in diesem Fall zuständig wären. Die Anordnung kam direkt vom Chef des Bundesnachrichtendienstes.«
Die beiden schüttelten den Kopf. Hannah zuckte mit den Schultern. »Wir konnten nichts dagegen unternehmen. Aber wir sehen uns den Unfallort mit absoluter Sicherheit noch mal genauer an. So leicht lassen wir in dieser Sache nicht locker.«
Unterdessen hatte sich Jans Schwester der abseits stehenden Dreiergruppe genähert. Sie war eine sehr elegante, gutaussehende Frau mit braunem, halblangem Haar, das zu einem Knoten gebunden war, was ihrem Gesicht eine gewisse Strenge verlieh. »Entschuldigen Sie, Hannah, aber meine Eltern und ich würden Sie gern noch zum Kaffeetrinken in kleiner Runde einladen. Wäre wirklich schön, wenn Sie dabei sein würden.«
»Gern, Sylvia, aber ich bin mit meinen Kollegen aus Leipzig gekommen und die wollen sicher gleich wieder zurückfahren.«
»Schade, aber dann vielleicht ein anderes Mal«, zeigte Sylvia Verständnis. »Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Rufen Sie mich doch in den nächsten Tagen an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal treffen könnten.«
Jans Schwester nahm Hannahs Karte und umarmte sie. Tom Ritter und Carl Georg Romminger reichten Sylvia die Hand. »Mein Name ist Tom, das ist Carl.« Er wies mit einer kurzen Handbewegung auf Rommel, wie er von seinen Freunden gerufen wurde. »Wir sind Jans Kameraden. Wir haben zusammen in Afghanistan gedient. Unser Herzliches Beileid.«
Sylvia bedankte sich bei den Männern und ging zu ihren Eltern zurück.
»Sollen wir noch irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Es gibt hier gleich in der Nähe ein kleines Bistro«, schlug Rommel vor.
»Wenn meine Leute nichts dagegen haben, gern«, antwortete Hannah.
Hatten sie nicht. Zusammen machte sich die kleine Gruppe auf den langen Rückweg zum Haupteingang an der Fuhlsbüttler Straße. Sowohl die Leipziger Delegation als auch Tom und Rommel hatten dort geparkt.
»Warum sind denn Tom Bauer und Steven Goldblum nicht hier?«, wollte Rommel wissen.
»Steven hat mich gestern Abend angerufen. Er ist in Washington. Irgendetwas ist da mit Chíef Broderick nicht in Ordnung. Der CIA-Chef ist erkrankt und auf unbestimmte Zeit nicht dienstfähig. Steven meinte, dass Tom Bauer zunächst kommissarisch die Geschäfte in Langley übernehmen wird. Er ist ja wohl ohnehin als Nachfolger vom Chief vorgesehen.«
»Welch riesiger Schritt auf der Karriereleiter. Das ist natürlich wichtiger, als die Beisetzung eines engen Freundes.« Rommel verbarg seinen Zynismus nicht.
Hannah schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Ich bin sicher, dass die beiden gekommen wären, wenn es nur irgendwie möglich gewesen wäre. Sie werden ganz sicher so schnell es eben geht nach Hamburg fliegen und sich von ihrem Freund verabschieden. Kein Zweifel. Tom und Steven haben Charakter. Heutzutage eine eher seltene Eigenschaft, vor allem in diesem harten Geschäft.«
»Habt ihr schon die Gelegenheit gehabt, den Unfallort genauer unter die Lupe zu nehmen?«, fragte Polizeioberrat Wawrzyniak, den alle hinter vorgehaltener Hand nur Waffel nannten, in Richtung Josephine Nussbaum, die mit ihren eleganten High-Heels auf dem sandigen Gehweg kaum vorankam. Josie hatte die seltene Gabe, sich grundsätzlich unangemessen zu kleiden. Wintermantel, Schal, Handschuhe und ein paar schwarze, flache Halbschuhe. So hatte sich Hannah der Kälte und vor allem dem Anlass nach angezogen. Josie dagegen trug ein hautenges schwarzes Kostüm, schwarze Seidenstrümpfe und schwarze Pumps mit zehn Zentimeter hohen Absätzen. Das Sahnestück ihres Outfits stellte jedoch ohne Zweifel ein großer, runder, mit breiter Krempe ausgestatteter, Damenhut dar, der als Zugabe noch mit einer übergroßen braunschwarzen Fasanenfeder geschmückt war. Der absolute Hammer. Während Tom und Rommel bei diesem Anblick leicht schmunzeln mussten, verzogen die Mitglieder der Leipziger Polizei keinerlei Miene. So war sie eben, ihre Josie. Kein Problem.
»Meine Leute waren gestern Nacht am Unfallort. Die Bremsspuren des Lkw sind relativ frisch. Könnten also durchaus was mit dem Unfallhergang zu tun gehabt haben. Und wir konnten feststellen, dass Jans Audi auf Sommerreifen unterwegs war, die kaum noch Profil aufwiesen. Sozusagen mit Slicks auf Glatteis.«
»Habt ihr den Wagen schon untersuchen können?«, hakte Waffel nach.
»Nee, Chef, den haben wir bisher noch nicht mal zu Gesicht bekommen. Den hat das BKA sofort nach Wiesbaden gebracht. Keine Ahnung, was das soll. Die Fotos zeigen ein vollkommen ausgebranntes Wrack. Ich frage mich, nach welchen Spuren die da noch suchen wollen. Es gibt keine. Alles zu einem Haufen Asche verbrannt.«
Plötzlich stieß Hannah Tom Ritter leicht ihren Ellenbogen in die Seite. Als er sie fragend ansah, nickte sie mit dem Kopf leicht nach rechts. Auf dem Parkplatz direkt vor dem Haupteingang stand eine schwarze Mercedes S-Klasse mit Münchener Kennzeichen. An der Beifahrerseite lehnte locker mit den Armen auf dem Dach aufgestützt, ein in schwarz gekleideter Mann mittleren Alters. Unverkennbar arabischer Herkunft. Tom entging nicht, wie sie der Kerl musterte. Er kannte diesen Blick. Genau so wurden sie angestarrt, wenn sie in Afghanistan auf Patrouille unterwegs waren. Sie wussten nie, ob diese Männer harmlose Afghanen waren, oder eben bewaffnete Kämpfer der Taliban. Jeden Moment mussten sie damit rechnen, dass diese Typen eine Kalaschnikow unter ihrem Kaftan hervorzogen und das Feuer auf sie eröffneten. In diesem verdammten Krieg konnte man nur schwer zwischen Freund und Feind unterscheiden. Es war vollkommen unmöglich, auch nur einem dieser Männer zu trauen. Zu viel Nähe konnte tödlich sein, erinnerte er sich.
»Die Drecksäcke wollen sich anscheinend direkt vor Ort von Jans Tod überzeugen. Ist wohl heute so ‘ne Art Feiertag für dieses Pack. Wir sollten rübergehen und dem Typ den Arsch aufreißen. Dann wird ihm sein Grinsen sicher schnell vergehen.«
Im gleichen Moment scherte Hannah nach rechts aus und steuerte auf den Wagen zu. Tom realisierte als Erster, was sie da vorhatte.
»Halt, Hannah, warte. Das macht doch keinen Sinn.«
Er griff nach ihrem Arm, aber sie riss sich los und marschierte weiter.
»Was wollt ihr hier, ihr feigen Schweine? Drecksgesindel, verpisst euch bloß.«
Sichtlich irritiert sah der Kerl die vollkommen aufgebrachte Frau auf sich zukommen. Er riss die Beifahrertür auf, sprang mit einem Satz in den Wagen und schrie etwas Unverständliches Richtung Fahrer. Dann rauschte der Mercedes dicht an ihnen vorbei vom Parkplatz. Die schwarz getönten Scheiben ließen keinen Blick ins Innere zu. Auf dem Asphalt blieb eine Spur verbrannten Gummis zurück.
»Komm, Hannah, lass gut sein. Die wollen auf Nummer sicher gehen und haben sich deshalb an Ort und Stelle selbst ein Bild machen wollen. Jetzt kehrt hoffentlich Ruhe ein. Wir sind schließlich nicht die Anti-Terror-Einheit des Bundesnachrichtendienstes. Ich denke, wir haben genug getan. Die Typen machen jetzt ihrem Chef Meldung und damit ist die Sache endgültig erledigt. Zur Hölle mit denen.«
»Was wollte Jan da eigentlich noch am späten Abend?«, fragte Rommel.
Die Gruppe hatte sich in einem kleinen Bistro nur ein paar hundert Meter vom Friedhof entfernt zwei kleine Tische zusammengestellt. Hannah sah Carl Georg Romminger an, den seine Kameraden in Afghanistan in Anlehnung an den Wüstenfuchs, den deutschen Generalfeldmarschall Erwin Rommel, nur Rommel nannten. Schon erstaunlich, wie gut sich der arme Kerl von den Ereignissen des letzten Jahres erholt hatte. Wäre Jan nicht gewesen, säße er heute wahrscheinlich immer noch im Gefängnis. Verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes. Ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Schön, dass es ihm wieder gut geht, dachte sie und beantwortete seine Frage: »Ich hatte von meinem Vater erfahren, dass letzten Sommer in Markranstädt ein ehemaliger Schulkamerad von mir eine Autowerkstatt eröffnet hat. Hat sich auf die Reparatur von Oldtimern spezialisiert. Jans Audi war ja bei der Attacke im Berliner Parkhaus heftig ramponiert worden. Er ist dann Montag nach Dienstschluss von Gohlis nach Markranstädt gefahren und wollte in Erfahrung bringen, ob es dort möglich war, den Wagen zu reparieren. Für ihn kamen ausschließlich Original Audi-Ersatzteile in Frage. Und die sind alles andere als leicht zu bekommen. Er muss ziemlich lange dort gewesen sein. Kurz nach 19 Uhr war er losgefahren. Der Unfall muss sich etwa gegen 23 Uhr ereignet haben.«
»Hast du dich nicht gefragt, wo er so lange bleibt?«, wunderte sich Josie.
»Ich war hundemüde. Bin schon kurz vor neun ins Bett und wollte noch lesen, während ich auf ihn gewartet habe. Aber irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Bis mich die Kollegen gegen drei Uhr morgens aus dem Schlaf geklingelt haben. Als Jan nicht neben mir lag, ahnte ich, dass etwas geschehen war.« Wieder traten ihr die Tränen in die Augen.
Josie legte ihr mitfühlend die Hand auf den Arm. »Ist okay,. die ganze Fragerei bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter.«
»Nein, Josie, schon gut«, war Hannah tapfer. »Wir müssen herausfinden, was da los war. Je eher, desto besser. Ich glaub einfach nicht an einen simplen Verkehrsunfall.«
»Ich auch nicht«, unterstützte sie Tom Ritter. »Jan wusste doch, dass er mit diesem Wagen ohne Winterbereifung bei Glatteis vorsichtig fahren musste. Der Audi Super 90 ist ein Oldtimer, ohne Servolenkung, Airbags oder ABS. Wahrscheinlich hatte der weder Sicherheitsgurte noch Kopfstützen. Kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen.«
»Eigentlich hätte er damit überhaupt nicht fahren dürfen. Die Oldtimer-Zulassung war bereits im Oktober letzten Jahres abgelaufen. Ich verstehe das alles nicht«, ergänzte Hannah.
»Hat außer dir noch jemand gewusst, dass er auf dem Weg nach Markranstädt war?«, fragte Waffel.
»Ja, natürlich. Er hatte kurz vorher mit dem Werkstattbesitzer Markus Unverricht telefoniert. Sie hatten sich dann für 20 Uhr verabredet. Sonst wusste wohl niemand davon.«
»Könnte ihm natürlich auch jemand gefolgt sein. Und während er in der Werkstatt war, haben sie die Sache mit dem Lkw arrangiert. Einer hat vor dem Betrieb Schmiere gestanden und gewartet, bis Jan zurückfuhr. Dann haben sie ihn in der S-Kurve von der Straße gedrängt.«
»Und vielleicht sogar noch das auslaufende Benzin entzündet, um auf Nummer sicher zu gehen«, ergänzte Rico Steding.
»So, oder so ähnlich könnte es gewesen sein. Aber vielleicht auch nicht. Möglicherweise hat er doch die Glätte auf der Fahrbahn unterschätzt und dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Ich bin dort schon oft langgefahren. Auch im Winter. Verdammt gefährliche Ecke. Da ziehen sie regelmäßig die Karren aus dem Graben.«
Die anderen am Tisch starrten Josie an. Hatte sie gerade was Falsches gesagt?
»Ich möchte nur nicht, dass wir uns jetzt in wilden Mutmaßungen verrennen. Es wäre von großem Nutzen, Chef, wenn ich mir mal den Wagen genauer anschauen könnte. Kriegen Sie das hin?«
»Ich werde gleich morgen früh sehen, was sich machen lässt. Mal sehen, ob der Oberstaatsanwalt was für uns tun kann. Ich glaube wir haben bei Oberdieck noch einen gut.« Waffel trank einen Schluck heißen Kaffee. »Ich denke, wir sollten langsam aufbrechen. Immerhin haben wir noch vier Stunden Fahrt vor uns.« Für Waffel eine unglaubliche Tortur. Er hasste Autofahren. Am liebsten fuhr er Straßenbahn, oder, bei schönem Wetter, mit seinem Fahrrad. Musste er tatsächlich mal Leipzig verlassen, nahm er die Bahn. Wie gern wäre seine Frau irgendwann mit ihm in den Urlaub geflogen. Konnte sie vergessen. Absolute Flugphobie. Wenn er nur so ein Ding sah, wurde ihm bereits schwindelig. In dieser Hinsicht war der ansonsten hartgesottene Chef ein echtes Weichei.
»Hat mich gefreut, meine Herren«, verabschiedete er sich von Tom und Rommel. »Schade, dass wir uns bei einem solch traurigen Anlass kennenlernen mussten. Vielleicht sieht man sich ja mal unter angenehmeren Umständen wieder. Kommen sie doch mal nach Leipzig. Eine wirklich wundervolle Stadt. Sie sind herzlich eingeladen.«
»Gern, Herr Wawzryniak. Hat uns ebenfalls gefreut, Sie mal getroffen zu haben«, gab Tom die Blumen zurück.
»Ach, was, sagen Sie ruhig Waffel zu mir. Tun die anderen doch auch«, zeigte sich der Chef jovial. Rico Steding schaute überrascht zu Hannah herüber. Über ihr trauriges Gesicht huschte der Anflug eines Lächelns.
New York, 16. Februar, 12:00 Uhr mittags.
Ein sonniger, ungewöhnlich warmer Wintertag. Die vielen Besucher am Ground Zero waren ihm lästig. Er brauchte diesen Trubel nicht. Schon gar nicht heute. Außerdem war er schon xmal hier gewesen. Dieser Ort faszinierte ihn. Auf eine bestimmte Art und Weise, die er sich selbst nicht erklären konnte. Immer, wenn er in die Staaten kam, führte ihn sein erster Weg zu dieser Großbaustelle im Zentrum von Manhattan. Dieses Loch mitten im Herzen New Yorks übte seit jeher eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 war schließlich ein Grund dafür gewesen, dass er bereitwillig seinen Dienst in Afghanistan angetreten hatte. Von diesem Tag an wollte er seinen Teil dazu beitragen, dass dem Terror in aller Welt ein für alle Mal das Handwerk gelegt wird. Ein hehres Ziel, aber leider auch ein nahezu unmögliches Vorhaben, wie sich später herausstellen sollte. Es war ein Kampf gegen Windmühlen, wusste er. Gegen einen unsichtbaren Gegner. Die Al Kaida operiert im Untergrund. Diese Terrororganisation ist hochmodern ausgerüstet und verfügt über ein weltweites kommunikatives und operatives Netzwerk. Zwar war es der CIA gelungen, in den letzten zwei Jahren gleich zwei ihrer Anführer zu töten, doch der Erfolg auf breiter Front war ausgeblieben.
Nach Osama Bin Laden und Sharif Tahir Al Fakri regierte in dieser kurzen Zeitspanne bereits der dritte Terrorchef. Doch um die große Politik sollten sich andere kümmern. Er war lediglich einer der vielen Soldaten, die Befehle empfingen und nach bestem Wissen und Gewissen ausführten.
Allmählich wurde es ihm zu eng innerhalb dieser unübersichtlichen, erdrückenden Menschenmenge. Er beschloss, die Liberty Street ein Stück westwärts zu laufen und die frische Luft am Hudson River zu genießen. Er ging vorbei am Pumphouse Park bis zum Yachthafen an der Esplanade. Er hatte gehört, dass der CIA- Boss Chief Broderick hier ein kleine, aber feine Motoryacht liegen hatte. An der Nordseite des Hafens erstreckte sich eine wunderschöne Plaza. Eine Art Promenade, die direkt bis ans Ufer des Hudson reichte. Vom Wasser her wehte eine sanfte, angenehme Brise herüber. Viel zu mild für diese Jahreszeit. Die frische Luft schmeckte salzig auf den Lippen. Unter den vielen hohen Bäumen verteilten sich überall einladende Parkbänke. Voll belaubt boten diese Bäume im Sommer einen willkommenen Schutz gegen die Hitze. An einem so schönen Wintertag wie heute ließ das blanke Geäst zur Freude der Spaziergänger die leuchtenden, warmen Sonnenstrahlen hindurchdringen. Mütter mit Kinderwagen, spielende Kids, ein paar Yuppies in der Mittagspause und viele ältere Menschen, die die herrlich frische Luft und die wohltuende, für diese Jahreszeit ungewöhnliche, Wärme genießen wollten, bevölkerten diesen wunderbaren öffentlichen Platz. Ein Bild, das ihm eigentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollte. Tat es aber nicht. Seine Gedanken waren weit entfernt an einem anderen Ort. An einem tristen Ort. Ein Ort voller trauriger und trauernder Menschen. Wieder überkamen ihn diese Zweifel. Sie nagten an ihm. War das der richtige Weg? Er wusste es nicht. Er zog seine Lederjacke aus und setzte sich auf eine Bank mit atemberaubender Aussicht auf den Hudson River. Gedankenverloren starrte er mit leerem Blick auf das ruhige Wasser.
»Hey, was soll denn das? Geben Sie mir sofort mein Buch zurück. Das ist ja unerhört.«
»Lass erst mal ‘nen paar Scheine rüberwachsen Opa, sonst geht dein Shakespeare gleich in Flammen auf.«
Abrupt aus seinen Gedanken gerissen, drehte er sich um. Auf der Bank hinter ihm hatten sich zwei zwielichtige Typen rechts und links neben einen alten Mann geflegelt und bedrängten ihn. Der eine von ihnen, ein kleiner, aber kräftiger, kahlköpfiger Farbiger mit allerlei Ketten und Ringen versehen, hielt ein Feuerzeug unter das Buch, das sie ihrem Opfer entrissen hatten. Der andere, ein etwas größerer, hagerer Puertoricaner mit langen, fettigen schwarzen Haaren und einem schmalen Oberlippenbart rempelte den alten Herrn mit der Schulter.
»Lass was springen, Opa. Du hast doch sicher ’nen paar Dollar für uns übrig. Komm, zeig mal, wo ist sie denn, die fette Brieftasche, he?«
Der schmierige Typ mit den öligen Zotteln versuchte dem alten Mann in die Brusttasche seines Mantels zu greifen.
»Jetzt lassen Sie das doch. Ich rufe die Polizei, wenn Sie mir nicht augenblicklich mein Buch zurückgeben und verschwinden.«
»Hilfe, Hilfe, hol doch einer die Cops. Die netten Jungs hier sollen mir einen runterholen und weigern sich«, äffte der kleine, dicke Farbige den hilflosen, alten Mann nach.
Weder die in der Nähe stehendgebliebene Schar der Neugierigen, noch andere Passanten kümmerten sich um diesen offensichtlichen Übergriff zweier Krimineller auf einen wehrlosen Mann. Sie taten so, als ginge sie das Ganze überhaupt nichts an. Wieso auch? Ärger hatten sie doch schon genug. Sollten doch die anderen eingreifen. Und überhaupt, was interessierte sie dieser alte Mann? Sollte er den Typen ein paar Dollar geben und die Sache wäre erledigt. Zivilcourage? Fehlanzeige. Offensichtlich nur irgend so ein dämliches Fremdwort. Genervt stand er auf, zog sich seine Lederjacke an und ging herüber zur Bank, um diesem Trauerspiel ein Ende zu setzen.
»Entschuldigung. Ich habe eine Bitte«, sprach er die beiden Provokateure betont höflich an.
»Was willst du denn? Verpiss dich, Weißbrot, oder willst du sterben? Wäre doch ein schöner Tag heute, um abzukratzen, oder?«
Da hat dieser Mistkerl verdammt recht, dachte er. Der Farbige griff mit der rechten Hand in seine Jackentasche und zog eine Pistole hervor. Eben nur soweit, dass man den braunen Holm der Waffe erkennen konnte. Das reichte erfahrungsgemäß schon, um unerwünschte Einmischer in die Flucht zu schlagen.
»Hört mal, ihr dreckigen Bastarde, ich habe heute keinen guten Tag. Um nicht zu sagen, einen richtigen Scheißtag. Und meine Laune tendiert im Moment stark gegen null. Ich sag’s euch zum letzten Mal. Gebt dem Mann sein Buch zurück und macht euch vom Acker. Und zwar so weit, dass ich euch nicht mehr sehen muss.«
Der Puertoricaner sprang auf und baute sich drohend vor ihm auf.
»Hey, Mann, bist du lebensmüde, oder was? Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier anlegst?«
»Ja, weiß ich. Mit zwei feigen Flachwichsern, die sich an alten Leuten vergreifen, weil sie nicht die Eier in der Hose haben, es mit richtigen Männern aufzunehmen.«
Das Maß war voll. Der kleine, dicke Farbige zog die Waffe und zielte direkt auf seinen Kopf. Beim Anblick der Pistole wichen die Menschen erschrocken zurück. Kinder schrien, Frauen kreischten. Der Puertoricaner war etwa genauso groß wie er, aber längst nicht so kräftig. In einem Anflug von Überlegenheit brachte er sich nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt in Angriffsstellung und grinste höhnisch.
»Jetzt geht dir wohl die Düse, Kumpel, he?«
Jan holte kurz aus und rammte dem hageren Kerl blitzschnell seine Stirn auf die Nasenwurzel. Ein deutlich vernehmbares Knacken und der Nasenrücken brach wie trockenes, morsches Geäst. Blut lief aus den Nasenlöchern und tropfte auf das Pflaster. Leider auch auf seine schöne Lederjacke. Von der Wucht der Attacke wurde der Puertoricaner zu Boden geschleudert. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte der Farbige mit offenem Mund auf seinen niedersinkenden Kompagnon. Genau der Bruchteil einer Sekunde, in der er unaufmerksam war. Deutlich zu lange. Ein kräftiger Schlag auf seine linke Hand und die Pistole segelte im hohen Bogen durch die Luft.
»Und jetzt? Womit willst du jetzt den dicken Macker markieren? Kommt noch was? Ich warte.«
Während sich sein Kumpel vor Schmerzen jammernd am Boden wälzte, versuchte der Farbige krampfhaft seine Optionen auszuloten. Er entschied sich für die Falsche. Statt zu verschwinden, bückte er sich nach seiner Waffe. Ein vehementer Kick ins Gesicht, ließ ihn die Bodenhaftung verlieren. Wie eine hilflose Schildkröte lag er rücklings mit blutender Lippe auf dem grauen Pflastersteinen der Plaza. Der alte Mann erhob sich von der Parkbank und steckte sein Buch in die Manteltasche. Von ein paar herumstehenden Schaulustigen brandete heftiger Applaus auf. »Endlich hat ‘s denen mal einer richtig gezeigt, diesem Ungeziefer. Die tyrannisieren hier schon seit ein paar Tagen die Leute. Und von den Cops ist weit und breit nichts zu sehen, wie immer.« Eine kräftige Farbige mittleren Alters machte ihrem Unmut Luft. Schwer zu sagen, ob sie die Mutter oder die Großmutter des Kleinen in der Kinderkarre war. Jan hob die Waffe der Gangster auf und steckte sie in seine Jackentasche. Währenddessen half der Puertoricaner, der sich inzwischen mühevoll wieder hochgerappelt hatte, seinem verletzten Kumpel auf. Mit gesenktem Blick und hängenden Schultern schleppten sie sich unter dem höhnischen Gelächter der Menschenmenge davon. Sie waren an den Falschen geraten. Berufsrisiko. Der alte Mann schüttelte Jan die Hand. »Ich bin ihnen was schuldig, junger Mann.«
»Ja, durchaus, Sir. Tun Sie mir einen Gefallen: Besorgen Sie sich ein Handy mit Notruftaste. Das kann hilfreich sein. Diese Kerle kommen wieder. Und wenn nicht diese, dann andere.«
»Ja, ja, wie recht Sie haben, guter Mann. Schlimme Zeiten, wirklich schlimme Zeiten. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch Helden. Aber leider viel zu wenige«, rief er laut und schaute dabei verärgert in die Menge, die sich um sie herum versammelt hatte. Die Botschaft kam an. Die Leute drehten sich peinlich berührt um und verschwanden.
»Darf ich Sie vielleicht zu einer Tasse Kaffee einladen?«, schlug der alte Mann vor.
»Nein, nein, vielen Dank. Machen Sie sich keine Mühe, Sir. Besser Sie gehen jetzt nach Hause, bevor diese Typen zurückkommen. Ich muss los, meine Zeit ist leider abgelaufen.«
Er klopfte dem alten Mann freundlich auf die Schulter, füllte seine Lungen noch mal mit der herrlich frischen Seeluft, steckte sich die Kopfhörer seines I-Pods in die Ohren und machte sich zusammen mit Lou Reed auf den Weg zurück zum Ground Zero.
Little Joe once never gave it away / everybody had to pay and pay/ a hustle here and a hustle there/ New York City is the place where/ they said hey Babe take a walk on the wild side/ I said hey Joe take a walk on the wild side.
Paris, 18. Februar, 07.50 Uhr morgens.
Noch trübten die letzten dunklen Fetzen der Morgendämmerung die Sicht. Vereinzelte Nebelschwaden lösten sich langsam aber sicher in Wohlgefallen auf. Ein weiterer milder Wintertag kündigte sich an. Die Temperaturen lagen leicht über dem Gefrierpunkt, würden aber bis Mittag fast die zehn Grad Marke erreicht haben. Schnee hatte es in diesem Jahr überhaupt noch nicht gegeben. Die letzten Niederschläge lagen schon etwa zwei Wochen zurück. Alles Folgen der globalen Klimaerwärmung? Oder doch eben nur ein außergewöhnlich lauer und trockener Monat Februar?
Als der rote Citroen Jumper von der Avenue Matignon nach rechts in die Rue Rabelais einbog, trat der Wachmann hinter der Schranke hervor und stoppte den Kastenwagen. »Was ist los Jungs? Ist’s etwa schon wieder soweit? Ihr wart doch erst kurz vor Weihnachten hier?«
Der Fahrer des Lieferwagens hatte die Seitenscheibe heruntergelassen. »Salut, Claude. Wir kommen nicht wegen der Wartung. Ein Heizkessel hat den Geist aufgegeben. Den müssen wir austauschen. Stehen wir denn nicht im Wachbuch?«
»Moment, mein Freund. Wir haben eben erst angefangen. Ich schau mal nach.«
Als sich Claude umdrehte und ins Wachhäuschen gehen wollte, um die Besucherliste der Israelischen Botschaft in der Rue Rabelais 3 zu checken, streckte sein Kollege Jean Pierre ihm bereits den erhobenen Daumen entgegen. Claude nickte ihm zu. »Geht klar, Hassan. Dann öffne mir mal das Tor zum Serail, Kumpel«.
Hassan stieg aus und schloss die Hecktür seines Kastenwagens auf. Die Kontrolle aller Fahrzeuge, die die Schranke passierten und auf dieser Straße zur Botschaft fuhren, war absolute Pflicht. Selbst der Wagen des Botschafters wurde sowohl bei der Ankunft als auch beim Verlassen gründlich gecheckt. Es gab keine Ausnahme. Auch nicht für den Installations-und Heizungsbau Kadir. Obwohl Hassan Kadir bereits seit acht Jahren für die Heizungsanlage im Botschaftsgebäude zuständig war und mehrfach im Jahr regelmäßig den Wartungsdienst erledigte, wurde er jedes Mal akribisch kontrolliert. Man kannte sich. Die Männer vom Wachdienst gingen freundschaftlich mit ihm um. Bei den Kontrollen gab es jedoch keinerlei Vertrautheit. Fahrlässigkeit würden ihre Vorgesetzten der Gendarmerie Nationale, die direkt dem Innenministerium unterstand, niemals dulden. Die Überwachungskameras zeichneten zudem alles auf, dessen waren sich Claude Amaral und Jean Pierre Le Fevre stets bewusst. Und aus diesem Grund gab es auch keine Nachlässigkeiten. Niemals. Die beiden Wachmänner würden selbst den Papst bis aufs Unterhemd filzen, wenn er das Bedürfnis hätte, seine israelischen Freunde in Paris zu besuchen.
»Mon dieu, mes amis. Wollt ihr hier eine Atombombe reinschmuggeln?«
Hassan und sein Mitarbeiter Djemal lachten. »Ja, aber wir dachten, ihr merkt das nicht«, scherzte der Handwerker. »Aber du kannst dich beruhigen, Claude, die ist nicht scharf. In diesem riesigen Paket befindet sich ein simpler Warmwasserkessel mit 500 Litern Kapazität. Also etwa doppelt so groß, wie dein Wasserspeicher zu Hause. Ach nee, hätt ich fast vergessen, ihr wascht euch ja noch mit Brunnenwasser auf dem Hinterhof.« Claude grinste. »Aber das härtet ab. Deshalb bin ich auch nicht so ein verweichlichter Araber wie du. Mach mal auf. Ich muss da mal ein Auge drauf werfen.«
Hassan und Claude stiegen zusammen auf die Ladefläche. Der Wachposten leuchtete mit der Taschenlampe in das riesige Paket. Dann klopfte er mit dem Griff der Lampe leicht gegen den Behälter. »Ach und das Wasser, das hast du wohl nicht mitgebracht, wie?«, flachste er, als er feststellte, dass der Behälter leer war.
»Ist nicht koscher. Die haben ihr eigenes«, meinte Hassan.
Jean Pierre, der zwischenzeitlich mit dem Langspiegel die Unterseite des Fahrzeuges überprüft hatte, kam mit dem Besucherbuch aus dem Wachhäuschen und reichte ihm einen Stift. Hassan zeichnete ab. Er bestätigte damit die Ankunftszeit und die Kontrollmaßnahmen. Diese Prozedur war bereits Routine. Nichts Neues für Hassan Kadir.
»Dann wollen wir mal sehen, ob ihr über Weihnachten zugenommen habt. Ein bisschen Winterspeck schadet allerdings nie.« Die Wachmänner tasteten die Handwerker vorschriftsmäßig von oben bis unten ab und durchsuchten sie nach Waffen.
»Alles sauber, wie immer«, rief Jean Pierre, der Hassans Mitarbeiter Djemal gefilzt hatte, zu seinem Kollegen herüber.
»Mit ‘ner Knarre kann man auch schlecht 'nen Kessel installieren. Aber wenn ihr eine braucht, ich weiß, wo ich günstig eine besorgen kann. Ohne Seriennummer natürlich, versteht sich.« Hassan lachte wieder laut los.
»Haut bloß ab, ihr Halunken und sorgt dafür, dass der Herr Botschafter heute Abend wieder ein warmes Bad mit seiner Gemahlin nehmen kann. Oder wer ist diese schlanke, gut gebaute Blondine, die wir immer da oben im Badezimmer sehen?« Diesmal lachten alle vier.
»Habt noch ’nen schönen Tag, ihr Spanner.« Hassan und Djemal stiegen in ihren Lieferwagen und fuhren um genau fünf Minuten nach acht die fünfzig Meter weiter unmittelbar vor das Botschaftsgebäude.
Vor dem Eingang wurden sie bereits von zwei bewaffneten, grimmig dreinschauenden Wachmännern in Empfang genommen. Jetzt hörte der Spaß auf. Die beiden Israelis verzogen keine Miene. Hassan und Djemal wurden ein weiteres Mal nach Waffen abgetastet. Einer der beiden Wachposten übernahm die Körpervisite, der andere sicherte ihn mit einer Uzi im Anschlag ab. Ohne ein Wort zu sprechen, forderten sie die beiden Heizungsbauer mit einer Handbewegung auf, ihr Material aus dem Wagen zu laden und zur Kontrolle bereitzustellen. Hassan blieb wie immer ruhig und gelassen, beobachtete aber, wie Djemal zunehmend nervöser wurde.
Die Israelis gingen weniger zimperlich mit dem neuen Wasserkessel um. Sie rissen die gesamte Verpackung herunter und verlangten dann von Hassan, den Kessel zu öffnen.
»Tut mir leid, Freunde. Dieser Warmwasserkessel ist ein geschlossenes System mit Anschlüssen für Zu- und Ablauf des Wassers. Da kann man nicht mal eben den Deckel abnehmen.« Er klopfte mit den Fingerknöcheln gegen das Aluminiumgefäß. »Ist absolut leer. Hören sie das?«
Die beiden Sicherheitsbeamten diskutierten kurz und heftig auf Hebräisch. »Warten sie«, hieß die Anweisung. Nach ein paar Minuten kam ein weiterer Wachmann aus dem Gebäude. Er hielt einen Schlauch in der Hand. Nach kurzer Absprache mit seinen Leuten führte er schließlich eine wasserdichte Endoskop Kamera durch die für den Wasserzulauf zuständige, im Durchmesser etwa fünf Zentimeter große Öffnung in den Warmwasserspeicher ein. Nachdem er das Innere des Behälters ausreichend beleuchtet hatte, gab er schließlich grünes Licht und verschwand wieder. »Okay, sie können passieren. Bitte hinterlegen sie am Empfang ihre Handys.«
Als die beiden ihre Werkzeugkästen hinter den Vordersitzen hervorholten, stürzte einer der Wachmänner auf sie zu. »Halt. Aufmachen.«
»Was soll denn das jetzt? Sollen wir den Kessel etwa mit bloßen Händen installieren, oder was?«, rief Djemal wütend.
»Hey, Junge, ganz ruhig«, beschwichtigte ihn Hassan. »Die Männer tun nur ihre Pflicht. Entschuldigen sie bitte, mein Kollege ist heute das erste Mal dabei. Er kennt die Abläufe noch nicht.«
Hassan stellte beide Werkzeugkoffer auf dem Gehsteig ab und öffnete sie. Beim Anblick der Zangen, Messer und Schraubenzieher sträubten sich den Israelis die Nackenhaare. Wieder diskutierten sie kurz auf Hebräisch. Hassan zuckte mit den Schultern. »Wir brauchen unser Werkzeug. Ohne geht es leider nicht. Aber wir können auch gern wieder heimfahren. Komm Djemal, wir laden wieder ein.« Hassan und Djemal hoben den Kessel an und wollten ihn in den Kastenwagen zurückstellen.
»Nein, kein Problem. Sie können passieren. Mit ihren Werkzeugkoffern natürlich.« Die Wachmänner zeigten sich einsichtig.
In der großzügigen Empfangshalle der Botschaft steuerten die Handwerker auf die junge Dame an der Rezeption zu und gaben ihre Handys ab. Hassan kannte das schon und hatte deshalb ein weiteres Gerät im doppelten Boden seines Werkzeugkastens deponiert. Für alle Fälle. Danach holten sie den Warmwasserkessel und trugen ihn die Treppe herunter in den Heizungskeller. Das gesamte Innere der Israelischen Botschaft war mit Kameras gesichert. Jedes Zimmer, jeder Flur, die Aufzüge, das gesamte Treppenhaus, jede noch so kleine Ecke des Gebäudes wurde von der Überwachungszentrale an der Rezeption ständig eingesehen und kontrolliert. Im Heizungskeller allerdings war keine Kamera angebracht. Ein fataler Fehler, wie sich noch herausstellen sollte.
Hassan Kadir hatte erst kürzlich seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert. Sein Großvater war Anfang der sechziger Jahre von Algerien nach Frankreich ausgewandert. Im Gegensatz zu vielen seiner Landleute war er eine ausgebildete Fachkraft und fand deshalb sofort Arbeit. Zunächst in Marseille, später in Lyon und seit 1968 in Paris. Omar Kadir eröffnete schließlich 1970 seinen eigenen Betrieb. Damals hatte er die Fünfzig bereits überschritten. Sein Sohn Yussuf übernahm das Geschäft 1985 und expandierte zu einem der größten und zuverlässigsten Handwerksbetriebe im Bereich Heizungsbau in Paris. Als er 2005 schwer an Tuberkulose erkrankte, musste Hassan für die Weiterführung des Familienunternehmens sorgen. Ein Problem, denn Hassan war eigentlich gelernter Tischlermeister und hatte sich gerade ein Jahr zuvor selbständig gemacht. Doch mit unglaublicher Energie und einem vorbildlichen Arbeitseifer schulterte er diese große Aufgabe. Er ließ sich zum Heizungsbauer umschulen und erwarb schließlich 2010 seinen Meisterbrief. Die Familie war stolz auf ihn. Im Hause Kadir spielte Religion eine eher untergeordnete Rolle. Hassan und seine beiden Söhne George und Gilbert besuchten unregelmäßig die Moschee und ließen auch schon mal ein Gebet ausfallen, wenn aus ihrer Sicht wichtigere Dinge anstanden. In Frankreich lebten im Jahr 2010 etwa fünf Millionen Muslime. Das entsprach sechs Prozent der Gesamtbevölkerung. Von den 3,5 Millionen ausländischen Zuwanderern stellten die Algerier mit rund 700.000 Menschen den absolut größten Anteil. Doch dazu zählten die Angehörigen der Familie Kadir schon längst nicht mehr. Alle Mitglieder der Familie besaßen einen französischen Pass. Die in Frankreich geborenen Ausländer erhielten mit Vollendung des 18. Lebensjahres automatisch die französische Staatsbürgerschaft..
Hassan, George und Gilbert Kadir fühlten sich als echte Franzosen. Alles wäre gut, wenn da nicht ein kleines Problem aufgetaucht wäre. Und dieses Problem schwebte über Hassan Kadir wie ein Damoklesschwert. Als er vor neun Jahren den Betrieb von seinem Vater übernahm, schrieb dieser schon länger rote Zahlen. So erbte er nicht nur das Geschäft, sondern auch dessen Schulden. Obwohl er hart arbeitete, gelang es ihm nicht, den Schuldenberg zu verringern. Die Firma stand vor dem Bankrott. Keinerlei Aussicht auf Rettung.
»Ich kenne da jemanden, der dir helfen kann«, hatte ihm ein guter Freund vorgeschlagen. Hassan zögerte nicht. Er nahm die Hilfe an. Ein in Frankreich lebender Syrer sollte sich als Retter erweisen. Er gab Hassan 250.000 €. Zinslos und in bar. Kein schriftlicher Vertrag, keine Empfangsbestätigung, nicht mal ein Handschlag unter Ehrenmännern. Nichts. Ohne jede Gegenleistung.
»Irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht aber auch erst in einigen Jahren, werde ich deine Dienste benötigen, Hassan. Möglicherweise werde ich viel von dir verlangen. Sehr viel womöglich. Das Geld gehört dir. Du zahlst es mir zurück, indem du irgendwann einen von mir gewünschten Gefallen ausführst. Ist das erledigt, sind deine Schulden getilgt.«
Hassan hatte keine Wahl. Er nahm an. Der Name seines selbstlosen Gönners: Tahir Sharif Al Fakri.
Jens Krüger war Hanseat durch und durch. Er war in Hamburg geboren, ging dort zur Schule und hatte während seines gesamten Berufslebens die Stadt niemals verlassen. Er war ein großer, schlanker Mann, mit vollem braunem Haar. Durchaus gutaussehend und attraktiv ähnelte er dem bekannten US-Schauspieler Gary Cooper. Von Haus aus religiös erzogen, war er ein konservativer Mann mit klaren Vorstellungen von Recht und Ordnung. Die Erfüllung seiner Pflicht stand bei ihm zeitlebens an erster Stelle. Danach kam die Familie und dann der HSV. Seine Frau Dörthe hatte er beim Fußball kennengelernt. Das war im August 1954. Allerdings nicht im großen Volksparkstadion, sondern bei den Hamburger Stadtmeisterschaften der städtischen Beamten auf einem Nebenplatz des altehrwürdigen Stadions am Rothenbaum. Jens Krüger gab einen passablen Linksaußen im Team der Stadtverwaltung-Mitte ab. Im Spiel gegen die Ortsverwaltung Barmbek-Uhlenhorst hatte er es mit einem äußerst rüden Verteidiger zu tun, der ihn laufend trat und festhielt. Am Spielfeldrand stand ein hübsches, blondes Mädchen, das diesen Treter auch noch anfeuerte und ihn dazu animierte, ständig unfair zu spielen. »Jetzt pack ihn dir doch, Fred. Der läuft dir ja schon wieder weg«, schrie sie. Jens war schnell, seine technischen Fertigkeiten allerdings überschaubar. Für den HSV reichte es jedenfalls nicht. Nicht mal für die Reservemannschaft.
Als die Mannschaften nach dem Spiel vom Platz gingen, schnappte er sich dieses Früchtchen. »Sind Sie eigentlich immer so forsch, junge Frau?«, raunzte er sie an. Ein halbes Jahr später waren sie verheiratet. Ach, das Spiel - das hatten sie mit 1:3 verloren. Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
Jens Krüger hatte nach seinem Realschulabschluss im Jahre 1947 im darauffolgenden Jahr eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Hamburg begonnen. In den ersten beiden Jahren nach dem Krieg half er seinen Eltern beim Wiederaufbau ihres zerbombten Hauses in Bramfeld und arbeitete in einer Molkerei, um ein paar Mark für Steine und Zement dazuzuverdienen. So ganz nebenbei machte er seinen Schulabschluss. Eine schwierige, aber lehrreiche Zeit. Nach seiner Ausbildung arbeitete er von 1951 an als Verwaltungsfachkraft lange Jahre beim Ordnungsamt, später im Schulamt und schließlich noch ein Jahr im Baudezernat der Stadt Hamburg-Mitte. Im Sommer 1956 kam ihr Sohn Jan zur Welt. Zu dieser Zeit bewohnte das Ehepaar Krüger zwei Zimmer im Dachgeschoss des elterlichen Hauses in Bramfeld. Nicht gerade luxuriös und immer unter der Aufsicht seiner Eltern. Als sich 1958 die Bundeswehr gründete, lockte sie gut ausgebildete junge Männer mit einem sicheren Arbeitsplatz und guter Bezahlung. Zum Ärger seines Vaters verpflichtete er sich gleich für zwölf Jahre. »Junge, wir haben doch gerade diesen schrecklichen Krieg hinter uns. Musst du denn wirklich unbedingt Soldat werden?«, war sein alter Herr wenig begeistert. Sein Frau Dörthe unterstützte ihn. Ihr Mann hatte einen krisenfesten Arbeitsplatz. Dies ermöglichte ihnen, ihr Leben zu planen. 1969 wurde ihr zweites Kind geboren. Dörthe brachte mit sechsunddreißig Jahren ein gesundes Mädchen mit dem Namen Sylvia zur Welt. Sie war knapp vierzehn Jahre jünger als ihr Bruder Jan und das Nesthäkchen der Familie. Bis Herbst 1970 blieb Jens Krüger in der Clausewitz-Kaserne in Hamburg-Nienstedten. Er bewohnte mit seiner Frau und seinen Kindern eine geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad im Haus der Standortverwaltung. Ein Privileg, von dem andere nur träumen konnten. Im Rang eines Oberstabsfeldwebels beendete er im Oktober 1970 seine aktive Dienstzeit. Mit fast Vierzig bekam er das Angebot auf Grund seiner Qualifikation als Verwaltungsfachkraft und aktiver Soldat die Stelle eines Personalreferenten bei einer der Standortverwaltungen (StOV) der Bundeswehr in Hamburg zu übernehmen. Wieder zögerte er keinen Augenblick. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1995 war er verantwortlich für die Einstellung, Personalführung und Betreuung der zivilen Arbeitnehmer und Auszubildenden des Standortbereiches der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in Hamburg-Iserbrook.
Dass ihr Sohn Jan nach erfolgreichem Abschluss der Polizeischule Hamburg zur Bundeswehr ging, konnten die Eltern nicht nachvollziehen. »Du wolltest doch unbedingt Kriminalkommissar werden. Woher kommt denn plötzlich dieser Sinneswandel?«, wollte sein Vater wissen. Als er sich dann auch noch 2001 für den Afghanistaneinsatz meldete, brachen sie kurzfristig aus Ärger darüber die Beziehungen zu ihm ab. Der Junge hatte sich zu ihrem Leidwesen zum Einzelgänger entwickelt. Ob Familie, Freunde oder Bekannte, jegliche sozialen Kontakte schienen ihm plötzlich gleichgültig zu sein. Sie machten sich große Sorgen um ihn.
Umso größer war die Erleichterung, als er unverletzt aus diesem unsinnigen Krieg am Hindukusch zurückkam. Als er 2003 bei der Bundeswehr ausschied, nahm er eine Stelle bei der Hamburger Polizei an. Es dauerte ein paar Jahre, bis er schließlich in den gehobenen Dienst aufrücken konnte und seine Uniform als Polizeiobermeister gegen Jeans und Jackett eines Kriminalkommissars eintauschen durfte. Das Verhältnis zu seinen Eltern hatte sich im Laufe der Jahre wieder normalisiert. Doch Familie war nach wie vor nicht sein Ding. Er ließ sich nicht oft in seinem Elternhaus blicken, aber er vermisste seine Schwester Sylvia, die inzwischen geheiratet hatte und nach Süddeutschland verzogen war. Jan schickte ihr regelmäßig Blumen zum Geburtstag, besuchte sie aber eher selten.
»Wie hältst du ’s bloß mit diesem Vollpfosten aus?«, fragte er sie immer wieder. Jan konnte ihren Ehemann nicht leiden. Das beruhte allerdings auf Gegenseitigkeit.
Jan hatte in all den Jahren nie eine feste Beziehung gehabt. Eine lose Affäre hier, ein Techtelmechtel da. Nichts von Dauer. Er hatte nicht ein einziges Mal eine Freundin mitgebracht, wenn er zu Besuch bei seinen Eltern war. Weder an Geburtstagen noch zu Weihnachten. Er war immer allein gekommen. Umso erfreuter waren Jens und Dörthe Krüger, als sie vor ein paar Monaten von Sylvia hörten, dass Jan in einer festen Beziehung lebte. Vielleicht würde er die Kurve ja doch noch kriegen, ihr Junge. Besser spät als nie. Sie brannten darauf, die Polizeihauptkommissarin Hannah Dammüller aus Leipzig endlich kennenlernen zu dürfen. Sie hofften sehr, dass Jan sie eines Tages mit nach Hamburg bringen und ihnen vorstellen würde. Dass sie sie dann erstmals bei einem solch traurigen Anlass sehen würden, hatte sie zutiefst getroffen. Hannah war wirklich eine hübsche, nette junge Frau. Eine Schwiegertochter, wie sie sich immer gewünscht, aber nie bekommen hatten. Das Schicksal hatte es eben anders gewollt.
Kurz vor zwei Uhr mittags war am Ground Zero noch mehr Betrieb, als zwei Stunden zuvor. Nicht nur er schien von diesem Ort fasziniert zu sein. Im Grunde war dieser Bereich immer noch eine einzige Großbaustelle, auch wenn die Rohbauten sich bereits kurz vor dem Abschluss befanden.
In der Militärsprache bezeichnet der Begriff Ground Zero die Explosionsstelle einer Atombombe oder Nuklearrakete über oder unterhalb der Erde, hatte er gelernt. Seit dem 11. September 2001 steht dieser Terminus auch für das durch einen Terroranschlag zerstörte World Trade Center im Herzen New Yorks.
Die vier neu errichteten voluminösen Tower rund um das World Trade Center Memorial waren fast fertig gestellt. Die Mehrzahl der Besucher drängelten sich jedoch vor dem Memorial Center in der Mitte der Anlage. In diesem Pavillon war ein Museum und eine Gedenkstätte für die 2.749 Opfer der Anschläge von 9/11 eingerichtet worden. An den Stellen des ehemaligen Nord- und Südturmes wurden genau nach deren Grundrissen große Wasserbecken gebaut. Um die Becken herum wurde das Areal umfangreich begrünt und zu einer sehenswerten, kleinen Parklandschaft gestaltet. Wirklich beeindruckend, dachte er, was Politiker, Stadtplaner, Architekten und Baufirmen hier in relativ kurzer Bauzeit geleistet hatten. Das Mahnmal im Herzen der Weltstadt New York war zu einer traurigen Sehenswürdigkeit geworden. Unzählige Touristen aus aller Welt pilgerten Jahr für Jahr zu diesem ehemaligen Ort des Schreckens. Für die Menschen, die dort ihre verstorbenen Angehörigen betrauern wollten, war dieser Hype natürlich nicht angenehm. Aber es gab auch eine Reihe echter Pilger, die mit Respekt und Demut den vielen Toten dieses hinterhältigen Terroranschlages gedachten. Was aber nichts daran änderte, dass er sich angesichts dieser Menschenmenge unwohl fühlte. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass in Afghanistan stets große Gefahr drohte, wenn irgendwo viele Menschen zusammenkamen. Diesen Umstand machten sich die Taliban oft zu Nutze, um aus solch einem Pulk von Leibern heraus anonym auf die ISAF-Soldaten zu feuern, ohne Gefahr zu laufen, selbst beschossen zu werden.
Um Punkt vierzehn Uhr sollte er in der Schlange vor dem Memorial Center stehen, um dort einen Mann zu treffen, der ihm einen Aktenkoffer aushändigen würde, in dem sich alle für ihn notwendigen Unterlagen befinden sollten. Ihm war geraten worden, nicht nach diesen Mann suchen. Dieser Mann würde ihn finden. Zehn Minuten später hatte sich immer noch nichts getan. Er war hundemüde. Vor genau zehn Tagen war er in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebrochen, ohne Gepäck, ohne Geld und Papiere und ohne zu wissen, was ihn erwarten würde. Einfach auf und davon. Nur mit dem, was er auf dem Leibe trug. Und das war nicht mal seine eigene Kleidung.
Man hatte ihn mit einem Hubschrauber auf die Air Base der US-Army nach Frankfurt geflogen. Dort verbrachte er die Nacht. Am nächsten Morgen flog er mit einer Maschine der Air Force nach Washington. Dort hatte ihn die CIA in Empfang genommen und zunächst in einem Appartement eines Mitarbeiters untergebracht. Man legte ihm nahe, sein Äußeres zu verändern. Die dunkelblonden mit grauen Strähnen vermischten Haare wurden kürzer geschnitten und dunkel gefärbt. Er hatte sich bereits einen Kinnbart im Anfangsstadium stehen lassen und eine große, schwarz gerahmte Brille zugelegt. Beim Blick in den Spiegel erkannte er sich selbst kaum wieder. Er wurde mit neuer Kleidung ausgestattet und für seinen neuen Reisepass fotografiert. Um es vorsichtig auszudrücken, wirkte er nun eine Spur seriöser als zuvor. Statt Jeans und Lederjacke trug er jetzt eine braune Stoffhose und ein dunkelblaues Jackett. Er bestand jedoch darauf, seine Lederjacke behalten zu dürfen und versprach, sie vorerst nicht zu tragen. Zähneknirschend stimmte sein »Herrenausstatter« von der CIA zu.
Der Plan sah vor, dass er von einem Mitarbeiter des Geheimdienstes nach New York gebracht werden sollte, um dort für einige Zeit anonym im Großstadttrubel unterzutauchen. Vorher sollte er von einem Experten der NSA seine neuen Papiere erhalten und anschließend ein auf seinen neuen Namen angemietetes Appartement in Manhattan beziehen. Von diesem Zeitpunkt an wurde eine Woche vollkommene Funkstille vereinbart. Erst danach sollte er ein neues Handy bekommen. Diese Maßnahmen waren notwendig geworden, nachdem die CIA erfahren hatte, dass die Al Kaida eine Großaktion gestartet hatte, um den Black Dragon endgültig zur Strecke zu bringen. Wahrscheinlich waren seine potentiellen Mörder bereits auf dem Weg nach Leipzig, als er gerade im Hubschrauber nach Frankfurt unterwegs war.
Nach reiflicher Überlegung und nach Abwägung aller zur Verfügung stehender Optionen gab es nur eine Lösung: Er musste von der Bildfläche verschwinden. Zumindest für eine bestimmte Zeit. Im schlimmsten Fall für immer. Andernfalls wäre er früher oder später ein toter Mann. Seine Jäger würden niemals aufgeben. Irgendwann würden sie ihn aufspüren und töten. Alles nur eine Frage von Ort und Zeit. Dass es einer solch höchst zweifelhaften Aktion bedurfte, bei der viele Menschen, die ihm nahe standen, getäuscht und verletzt wurden, machte ihm schwer zu schaffen. Doch wie man es auch drehen und wenden wollte, es gab keine Alternative zu dem, was nun geschehen würde.
Er stand kurz vor dem Drehkreuz des Eingangsbereiches des Gebäudes, als er hinter sich eine leise Stimme hörte. »Nicht umdrehen.« Im gleichen Moment drückte ihm jemand von hinten einen Griff in die Hand. Der Stimme nach zu urteilen, handelte es sich um einen älteren Mann. Er packte zu und hielt einen leichten Aktenkoffer in der Hand. Kurz vor Erreichen des Eingangs scherte er aus der Schlange aus und bewegte sich langsam und unauffällig zurück. Sein Blick ging stur geradeaus. Er versuchte gar nicht erst herauszufinden, wer ihm diesen Koffer übergeben hatte. Völlig egal. Er tauchte in der Menschenmenge unter. Ohne sich umzusehen, verschwand er in Richtung Liberty Street, um dort in ein Taxi zu steigen, das ihn ins Plaza an der 5 th Avenue bringen sollte. Ein Fünf-Sterne-Hotel. Luxus pur. Nach den Ereignissen der letzten Tage brauchte er jetzt eine warme Dusche, ein vernünftiges Bett und ein reichhaltiges Essen, um wieder einigermaßen klar denken zu können. Und vor allem brauchte er Zeit, um in Ruhe nachzudenken.
Paris, 18. Februar, kurz vor zwölf Uhr mittags.
Hassan und Djemal waren fast fertig. Sie nahmen die Heizungsanlage im Keller der Israelischen Botschaft in der Rue Rabelais wieder in Betrieb. Testlauf für den Warmwasserskessel. Das Sicherheitspersonal, das sie bei Betreten des Gebäudes noch genau kontrolliert hatte, schien das Interesse an den beiden verloren zu haben. Zwei Handwerker, die ihre Arbeit machten. Das ist alles. Keine Gefahr. Ein Fehler, ein schwerer Fehler, ein tödlicher Fehler. Hassan und Djemal mussten einige Male das Gebäude verlassen, um aus ihrem Lieferwagen zusätzliches Handwerkszeug und weitere Materialen zu holen. Spätestens beim dritten Gang nickten die bewaffneten Wachmänner nur noch und kümmerten sich höchstens noch beiläufig darum, was die Monteure da raus und rein trugen. Eine Nachlässigkeit, die Folgen haben würde. Schlimme Folgen. Als die Handwerker feststellten, dass sie unbehelligt ihrer Wege gehen konnten, schmuggelten sie das C4 ins Gebäude. Gut verstaut und versteckt in mehreren drei Zentimeter dicken und bis zu drei Meter langen Kupferrohren. Der Plastiksprengstoff konnte wie eine Knetmasse beliebig modelliert werden. Es war einfach, damit die Heizungsrohre vollzustopfen. Die Zünder hatten sie bereits vorher im Inneren ihrer Messgeräte verstaut. Für Laien unauffindbar. Die mit Sprengstoff gefüllten Rohre hatten sie im Heizungskeller installiert. An den Wänden des etwa dreißig Quadratmeter großen Raumes entlang hafteten jetzt mehrere Kilogramm C4. Die Zünder wurden installiert und auf Fernzündung per Handy programmiert. Zum Schluss kappten sie die Hauptgasleitung, verschlossen alle Fenster und beim Verlassen des Raumes auch die Stahltür. Hassan sperrte die Tür von außen zu und stopfte den Schlüssel in die Erde einer Topfpflanze, die den Aufgang zum Erdgeschoss schmückte. Unter dem Vorwand, die Heizungen in allen Stockwerken des Gebäudes zu überprüfen, lösten sie dort die Kupferrohre von den Heizkörpern. Das Gas strömte mit maximalem Druck, aber kaum hörbarem Zischen aus den Leitungen. Sie hatten in jedem der fünf Stockwerke zwei Räume boykottiert. Mehr war zeitlich nicht möglich, würde aber für ihre Zwecke absolut ausreichen. Jeden Moment konnte jemand den Gasgeruch wahrnehmen und Alarm schlagen. Langsam und ohne Hektik gingen Hassan und Djemal die Treppe herunter in den Eingangsbereich. Dort hatten sie bereits ihre Werkzeugkoffer deponiert. Hassan legte wie gewöhnlich seinen Stundenzettel auf die Theke der Rezeption. Die junge Frau dahinter nickte kurz freundlich und stand auf. »Einen Moment, meine Herren, ich lasse den eben abzeichnen.« Sie musste in den ersten Stock in das Büro des stellvertretenden Botschafters, der für die Liegenschaft verantwortlich war. Reine Formsache. Noch nie zuvor hatte es irgendwelche Beanstandungen gegeben. Die Rechnungen wurden stets prompt und ohne jegliche Abzüge beglichen. Hassan hatte immer gern hier gearbeitet. Alle waren freundlich und zuvorkommend. Die Kontrollen mussten sein. Das hatte nichts mit ihm persönlich zu tun. Sein Gewissen meldete sich zu Wort. Was tat er hier eigentlich, verdammt noch mal? Sollten all diese unschuldigen Menschen sterben? Nein, aber es gab keinen Ausweg. Nicht für ihn. Er hatte sich verkauft. Vor langer Zeit. Heute war der Tag, an dem er seine Schulden begleichen musste. Er hatte immer gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde. Vergeblich. Würde er versagen, wäre die Rückzahlung seines großzügigen Kredites, den er vor vielen Jahren von Tahir Sharif Al Fakri erhalten hatte, wohl das geringste Problem. Im Falle eines Scheiterns würden sie ihn und wahrscheinlich auch seine gesamte Familie auslöschen. Er biss sich so fest auf die Lippen, bis er Blut schmeckte. Djemal liefen bereits die Schweißperlen von der Stirn. Warum, verdammt noch mal, kam diese Frau denn nicht zurück? Da stimmte doch irgendwas nicht.
»Machen die heute Überstunden?«, fragte Jean Pierre.
Claude zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Scheint ‘ne größere Sache zu sein. So ’n Kessel auswechseln, das dauert eben.« Die Wachmänner hatten beobachtet, wie die beiden Handwerker mehrfach Material aus ihrem Lieferwagen geholt hatten.
»Eigentlich hätte die Security doch jeden einzelnen Schritt kontrollieren müssen, oder?«, stellte Jean Pierre fest.
»Klar, unsere Vorschriften verlangen das und wenn wir uns nicht daran halten, können wir am nächsten Tag stempeln gehen.« Aber Claude zeigte auch Verständnis für die israelischen Kollegen. »Die können schließlich nicht jedes Einzelteil überprüfen. Dann sind die mit ihrer Reparatur übermorgen noch nicht fertig. Außerdem kennen die Hassan doch schon seit Jahren. Was soll da schon groß passieren?«
Jean Pierre nickte, gab jedoch zu bedenken: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man darf sich in unserem Job zwar nie allzu sicher sein, aber in diesem Fall weiß man ja schließlich, wen man vor sich hat.«
»Kennst du diesen Hassan eigentlich schon länger?«, wollte Jean Pierre wissen.
»Ich bin jetzt seit acht Jahren hier. Seitdem kommt der Heizungsbau Kadir regelmäßig mindestens zweimal im Jahr zur Inspektion der Anlage. Meistens sogar öfter. Kleine Reparaturen fallen eben auch mal zwischen den Inspektionsintervallen an. Der Chef ist immer mit dabei gewesen. So ein fester Auftrag ist für einen Handwerker heutzutage goldwert.«
»Stimmt«, meinte Claude. »Auch wenn’s uns nicht reich macht, aber bei uns kommt am Monatsende regelmäßig die Kohle. Wissen wir manchmal gar nicht richtig zu schätzen. Wenn die keine Aufträge haben, können die ihren Laden früher oder später dicht machen. Feierabend.«
Jean Pierre saß im Wachhäuschen und blätterte im La Parisien. »Hast du das gelesen, Claude? Die vermuten, dass dieser neue Al Kaida-Führer ein Haus in Paris besitzt. Angeblich wohnt dieser Typ schon seit Jahren im 17. Arrondissement. Gar nicht weit von hier.«
»Hab ich mitgekriegt. Aber angeblich hat der mit den Terroristen nichts zu tun. Konnten ihm jedenfalls bis heute nichts nachweisen. Hat sich wohl gleich ein paar Anwälte besorgt, als dieses Gerücht aufkam. Immerhin ist er französischer Staatsbürger.«
»Hm, na ja, nicht jeder, der aussieht wie einer, ist auch einer. Terrorist, meine ich.«
»Wohl wahr. Dann dürften wir die Hälfte des Botschaftspersonals nicht reinlassen, wenn ‘s nach dem Aussehen ginge.« Jean Pierre schmunzelte und kicherte leise. »Der Botschafter sieht auch nicht gerade aus wie ein Schwede. Könnte auch gut und gern aus so ‘nem Schurkenstaat stammen. Iran, Syrien oder Libyen. Alles möglich, oder?«
»Aber er heißt eben nicht Osama Bin Laden, sondern Yossi Fischer. Wohl eher Deutscher als Araber«, erwiderte Claude.
Hassan konnte in Djemals Augen einen Anflug von Panik erkennen. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. »Bring doch schon mal die Kisten ins Auto«, wollte er seinen jungen Kollegen aus der Schusslinie nehmen. »Mach schon«, raunzte er ihn leise an. Als der sich nach den Werkzeugkoffern bückte, trat ein Wachmann vor und stellte seinen Fuß auf einen der Kästen. »Moment, Junge. Wir kontrollieren gleich alles zusammen, wenn ihr da fertig seid. Ist ein Abwasch.«
Plötzlich wurde auch Hassan ungeduldig. Instinktiv griff er in die Hosentasche und tastete nach seinem Handy. Der Code war bereits eingegeben, er musste nur noch die Enter-Taste drücken. Dass sollte geschehen, wenn sie die Rue Rabelais verlassen hatten und bereits auf die Avenue Matignon eingebogen waren. Dann wären sie in Sicherheit und könnten den Tatort unbehelligt und vor allem unverletzt verlassen. So die Theorie. Die Praxis sah anders aus. Wenn ihre Absicht entdeckt werden würde, müsste er an Ort und Stelle zünden. Es gab keine Alternative. Plötzlich hatte er Angst. Angst vor dem Versagen und Angst vor dem Tod. Er konnte nicht sagen, welches Gefühl ihm