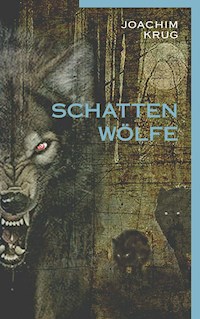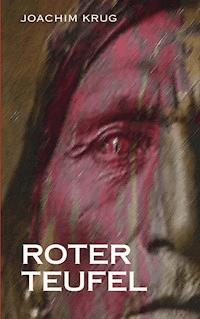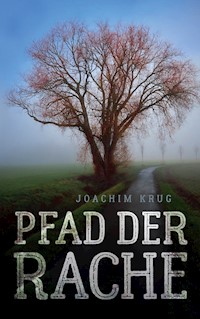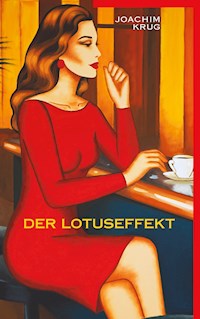9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Major Jan Krüger kämpft in Afghanistan als Scharfschütze gegen die Taliban. Zurück in Hamburg, setzt er seinen Dienst bei der Mordkommission fort. Am Tag seiner Versetzung nach Leipzig wird er plötzlich von zwei Unbekannten attackiert. Jan erfährt, dass der mächtige Taliban-Führer Al Fakri sich an ihm rächen will. Der plant als Vergeltung einen verheerenden Terroranschlag in Deutschland. In Leipzig beherrscht die Russenmafia um Oberst Gorlukov das Drogengeschäft und die Prostitution. Als der feststellt, dass Jan sich nicht von ihm kaufen lässt, will auch er ihn vernichten. Jan wird in einen Zweifrontenkrieg ungeahnten Ausmaßes verwickelt. Wer ist Jäger, wer Gejagter? Ein mörderisches Spiel beginnt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
»Ich glaube, wir haben ihn.« Ein Anflug von Unsicherheit in der Stimme des Anrufers war unüberhörbar.
»Was du glaubst, ist in der Moschee von Bedeutung, nicht aber bei der Observierung eines Ungläubigen. Da zählt nur das, was du siehst«, dröhnte die dunkle, sonore Stimme aus dem Handy. »Also, mein Bruder, was siehst du? Schau ganz genau hin und gib mir eine Antwort. Überlege aber gut, was du sagst. Allah verzeiht, die Organisation niemals. Das weißt du, Bruder.«
Abdullah zitterte am ganzen Körper und starrte mit angsterfülltem Blick auf seinen Nebenmann. Kalter Schweiß perlte ihm langsam über die Stirn ins Gesicht. Einzelne Tropfen bahnten sich ihren Weg bis herunter auf die Stoffsitze des schwarzen VW Golfs, den sie bei einem Autoverleih am Hamburger Flughafen zwei Tage zuvor, als französische Touristen getarnt, angemietet hatten.
Abdullah und Semih waren sich ziemlich sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben. Oder hatten sie sich vielleicht doch getäuscht? Absolut überzeugt waren sie noch nicht. Als sie den Kerl vor etwa acht Jahren das letzte Mal gesehen hatten, war er mit einem schwarzen Overall bekleidet und trug eine bis tief in die Stirn gezogene dunkle Wollmütze. Die hatte er zwar offensichtlich in der Hitze des Gefechts verloren, aber in dieser stockdunklen Nacht versteckte sich sein rußgeschwärztes Gesicht hinter einem schier undurchdringlichen Schleier tiefster Finsternis.
Der Meister würde Männer schicken, die ihre Mission übernehmen und den Mann töten sollten. Sie selbst waren allenfalls die Spürhunde, deren Aufgabe darin bestand, den Feind ausfindig zu machen. Allerdings würde es sehr schwierig werden und großen Aufwand erfordern, ohne Aufsehen zu erregen, unentdeckt ein Killer-Kommando nach Deutschland einzuschleusen. Der kleinste Fehler in der Planung und die Operation wäre zum Scheitern verurteilt.
Abdullah war als Chefscout dafür verantwortlich, dass sämtliche Vorbereitungen präzise ausgeführt wurden. Den Rest erledigten dann die für diese Spezialaufgabe ausgebildeten Kämpfer der Al Kaida. Einen Misserfolg dieses wichtigen Unternehmens würde man allein ihm anlasten. Denn er wäre derjenige, der sich getäuscht hätte. Er müsste für diesen unverzeihlichen Fehler seinen Kopf hinhalten. Die zu erwartende Strafe würde hart sein, sehr hart. Abdullah musste damit rechnen, einen Fehltritt mit seinem Leben zu bezahlen.
Semih saß unsicher und zweifelnd, die Stirn tief in Falten gelegt, am Steuer des geparkten Golfs. Er zuckte mit den Schultern. Auch er war sich nicht sicher. Wie konnte er auch? Diese Westeuropäer sahen doch alle gleich aus. Obendrein trug der Kerl auch noch eine Sonnenbrille und eine schwarze Kappe, unter der lediglich ein paar blonde Strähnen hervorragten. Sie konnten sein Gesicht nicht eindeutig erkennen.
»Wir werden die Sache noch mal überprüfen und melden uns, sobald wir uns absolut sicher sind«, meinte Abdullah kleinlaut und wartete sichtlich nervös auf die Antwort des Meisters.
»Besser ist es, mein Bruder. Bedenke jedoch, dass wir in Eile sind. Wir müssen diesen Bastard seiner gerechten Strafe zuführen. Das verlangen Allah, die Organisation und das Gesetz. Dieser Ungläubige hat nicht nur meinen einzigen Sohn getötet, sondern auch viele tapfere Kämpfer Gottes. Wie lange soll es noch dauern, bis wir diese Verbrechen endlich gesühnt haben? Wie lange noch, frage ich dich?«, beschwor ihn der Meister ungeduldig. »Macht uns keine Schande, meine Brüder. Erfüllt eure Aufgabe, so wie es Allah von euch verlangt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Die Verbindung endete mit einem deutlich vernehmbaren Knacken, das sich anhörte, als hätte der Meister gerade den ersten Warnschuss abgefeuert, der ihre Köpfe nur knapp verfehlt hatte. Der Schreck fuhr ihnen in die Glieder. Auf ihren Schultern lastete Druck, schwer wie eine Tonne Blei. Nervös sahen sich Abdullah und Semih in die Augen. Beide hatten Angst. Sie mussten Ergebnisse liefern und zwar schnell. Sie hatten schon viele Male miteinander gearbeitet und dabei immer ihre Aufgaben zur Zufriedenheit des Meisters erfüllt. Doch dieses Mal waren sie unsicher. Eine plausible Erklärung dafür hatten sie im Moment allerdings nicht. Schließlich zählten sie weit und breit zu den besten Männern, wenn es darum ging, die Feinde der Organisation aufzuspüren.
Abdullah und Semih operierten gewöhnlich in ganz Europa und nutzten dafür all ihre neugewonnenen Freiheiten. Sie konnten alle Grenzen ohne Zwischenfälle passieren und sich an jedem Ort problemlos aufhalten, ohne angehalten oder kontrolliert zu werden. Das Schengener Abkommen hatte es möglich gemacht.
Beide Männer stammten aus dem gleichen, kleinen Dorf in der Nähe von Damaskus. Doch schon in den siebziger Jahren waren sie mit ihren Eltern nach Frankreich ausgewandert. Hier konnten sie regelmäßig die Schule besuchen und später sogar studieren. Ihre Eltern fanden Arbeit, ihre Geschwister bekamen Ausbildungsplätze. Das bedeutete ein besseres Leben für sie und ihre Familien. Die beiden Männer waren stolz auf ihre gute Schulbildung und darauf, als Immigranten in Paris an der Sorbonne studiert zu haben. Für Kinder von Einwanderern war dies beileibe keine Selbstverständlichkeit. Sie wurden von ihren Eltern stets streng gläubig nach den Gesetzen des Korans erzogen und waren von den Lehren der Heiligen Schrift zutiefst überzeugt.
»Wir müssen näher an diesen Kerl ran. Los, fahr weiter, ich werde versuchen, ihn soweit ranzuzoomen, bis wir ein eindeutig erkennbares Foto von ihm schießen können.«
Ihr Zielobjekt verließ gerade das Hamburger Polizeipräsidium. Langsam und gemächlich schlenderte er mit beiden Händen in den Taschen die Treppe herunter. Das überdimensionale Teleobjektiv seiner hochwertigen Kamera beseitigte schließlich jeden Zweifel.
»Das ist er«, war sich Semih jetzt sicher. Blond, groß und schlank. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ein echter Athlet, muskulös und, was sie trotz seiner legeren Kleidung erkennen konnten, immer noch durchtrainiert. Die Art, wie er sich bewegte, geschmeidig wie eine Katze, absolut lässig. Seine Widersacher konnten den Eindruck gewinnen, der Mann wäre vollkommen harmlos und könnte kein Wässerchen trüben. Doch Abdullah und Semih wussten es besser. Dieser Mann glich einer Klapperschlange, immer wachsam und auf der Lauer. Jederzeit bereit, seine Beute blitzschnell mit einer einzigen zielgenauen Attacke zu erlegen. Er war unberechenbar, handelte durchdacht und logisch, stets in der Lage, vorherzusehen, was im nächsten Moment geschehen würde. Nur eines unterschied ihn von diesem giftigen, bei Gefahr mit dem Schwanz rasselnden, Reptil: Er warnte seine Opfer nicht, bevor er sie tötete.
Abdullah war Kämpfer der radikalislamischen Taliban in Afghanistan und hatte mit ansehen müssen, wie dieser Ungläubige viele seine Kameraden umbrachte. Dieser Mann war ein perfekter Nahkämpfer, offensichtlich unbesiegbar. Über zehn Jahre war es jetzt her, dass Abdullah und seine Leute ihn in einer stockdunklen Novembernacht dermaßen in die Enge getrieben hatten, dass ein Entkommen absolut unmöglich erschien. Doch selbst fünf schwer bewaffnete Mudschaheddin vermochten diesen einen Ungläubigen nicht zu töten. Vier seiner besten Männer mussten diesen Kampf mit ihrem Leben bezahlen. Einen von ihnen hatte er mit einem einzigen gezielten Fausthieb gegen das Brustbein getötet. Ein Schlag wie mit einem Vorschlaghammer, dessen Präzision und Wucht selbst aus größter Bedrängnis heraus für seinen Gegner tödlich war. Das Geräusch des zerberstenden Knorpels würde Abdullah nie mehr vergessen. Selbst als bereits eine Kugel tief in seiner Schulter steckte und er eine klaffende Wunde von einem Messerhieb am Rücken erlitten hatte, kämpfte dieser Wahnsinnige unbeirrt weiter, als fühlte er keinerlei Schmerz. Abdullah war der einzige Überlebende, seine Kameraden fanden den Tod. Der Mann war nicht von dieser Welt. Er schien unbesiegbar, er war der Teufel, kein Zweifel. Nie wieder hatte Abdullah ihn nach dieser Nacht aus der Nähe gesehen. Seine Feinde im Kampf Mann gegen Mann zu besiegen, war jedoch nur eine Variante seiner hartgesottenen militärischen Ausbildung. Was diese Bestie noch viel gefährlicher machte, war seine Fähigkeit, lautlos, unerkannt und aus weiter Entfernung mit diabolischer Präzision zu töten. Als würde Luzifer persönlich den Abzug betätigen.
In dieser stockfinsteren Nacht im Herbst war Abdullah mit zwei seiner Kameraden auf Patrouille unterwegs in den Bergen des Hindukusch in der Nähe von Kundus. Eigentlich reine Routine, doch heute sollte sich etwas Außergewöhnliches ereignen. Mit dem Infrarot-Nachtsichtgerät beobachteten sie eine Gruppe amerikanischer Soldaten, die gerade damit beschäftigt war, einen Nachschub-Konvoi zusammenzustellen. Dieser sollte scheinbar möglichst im Schutz der Dunkelheit Waffen, Munition und Sprengstoff in die Einsatzgebiete der ISAF-Truppen transportieren.
Hier oben in den Bergen wehte ein eisiger Wind. Der feinkörnige Sand wirbelte zu hohen Fontänen auf und erschwerte den Männern die Sicht. Ein feiner Regen aus winzigen, gelben Sandkörnern vermischte sich mit dem Dunkel der Nacht zu einer einzigen schwarzen Wand und hinterließ auf den Infrarotgeräten einen dicken Grauschleier, der sich wie ein Grabtuch über die karge Wüstenlandschaft legte. Eine geradezu gespenstische Atmosphäre, die für Abdullah und seine Kameraden allerdings nichts Ungewöhnliches darstellte. Ein Naturschauspiel, wie es eben in den Höhen des Hindukusch in den Herbst- und Wintermonaten oft vorkam. Doch diese Männer mit ihrer wettergegerbten, ledernen Gesichtshaut waren an die widrigen Bedingungen in diesem unwirtlichen Gebiet gewöhnt. Nichts erschien in dieser Nacht wirklich bedrohlich. Abdullah, Karim und Ali Mehmet befanden sich unerkannt in sicherem Abstand zum Feind und hatten daher nicht das Geringste zu befürchten. Ali Mehmet machte Bericht über Funk ans Hauptquartier der Taliban. Sie suchten fieberhaft nach einer günstigen Gelegenheit, den Konvoi auf der Strecke in einen Hinterhalt zu locken und zu vernichten. Würde das gelingen, wäre das ein weiterer großer Erfolg im Kampf gegen die verhassten, feindlichen Invasoren. Abdullah nahm, zufrieden mit seiner Entdeckung, das Nachsichtgerät herunter. Plötzlich vernahm er ein kurzes, dumpfes Geräusch, gefolgt von einem grellen, hochfrequenten Pfeifton, der sich wie eine Kreissäge durch die Dunkelheit der Nacht fräste. Er schnellte herum und erschrak. Sekundenbruchteile später fiel sein starrer Blick auf Ali Mehmets zerschmetterten Kopf, der zerplatzt war wie eine reife Melone. Blut, Gehirnmasse und Knochensplitter mischten sich mit dem aufwirbelnden Sand zu einer Melange aus organischen Materialen, die sich weitläufig über dem trockenen Sandboden verteilten. Für einen kurzen Augenblick glaubte er, das blanke Entsetzen in Ali Mehmets Blick zu erkennen, bevor dieser mit einem fast tennisballgroßem Loch in der Schädeldecke zu Boden sackte, als wäre er vom Blitz getroffen worden. Er war auf der Stelle tot. Geistesgegenwärtig zerrte Abdullah seinen getroffenen Kameraden hinter den Jeep, wo Karim bereits in Deckung gegangen war.
»Verdammt, wo kam das her? Wir hätten doch irgendwas sehen müssen, aber da war nichts«, beteuerte Karim. Zwischen ihrem Standort in mehr als tausend Metern Höhe und den talabwärts am Straßenrand haltenden Amerikanern lagen mindestens drei Kilometer. Dazwischen gab es nur Sand und ein paar vereinzelte, niedrige Sträucher.
Abdulllah spähte vorsichtig mit seinem Infrarot-Feldstecher hinter dem Schutz bietenden Jeep hervor. In einer Entfernung von etwas mehr als fünfhundert Metern konnte er beim besten Willen niemanden entdecken. Selbst in der Dunkelheit vermochte sich auf diesem felsigen, nur spärlich bewachsenem Gelände niemand derart zu verbergen, dass er nicht mit dem Fernglas entdeckt worden wäre. Trotzdem bestand überhaupt gar kein Zweifel daran, dass Ali Mehmet von einem Scharfschützen erwischt worden war. Allerdings musste der aus der geradezu unglaublichen Entfernung von weit mehr als tausend Metern nachts und bei Sandsturm diesen gezielten Schuss abgegeben haben. Unmöglich, dachte Abdullah. Noch nie zuvor hatte er, der selbst als hervorragender Schütze galt und sich mit dieser Art Waffen bestens auskannte, gehört, dass die Sniper der US-Army aus einer solchen Entfernung schossen, geschweige denn trafen. Achthundert, vielleicht tausend Meter waren möglich, aber auch nur bei Tageslicht, Windstille und guten Sichtbedingungen. Seines Wissens verfügten die Amerikaner nicht über eine solche Waffe, mit der man einen derart unglaublichen Schuss abfeuern konnte.
Das Scharfschützengewehr M 40 hatte eine Reichweite von maximal tausendfünfhundert Metern. Theoretisch. Praktisch war es unter diesen schwierigen klimatischen Bedingungen nur für etwas mehr als die Hälfte geeignet. Dieser Sniper musste aber fast zweitausend Meter entfernt gewesen sein, ansonsten hätten sie den Schützen durch ihr Infrarot-Nachtsichtgerät, das mit einem hochwertigen Zoom ausgerüstet war, mit Sicherheit entdeckt.
Abdullah legte den Toten auf die Ladefläche seines Jeeps, immer auf der Hut, die Deckung nicht zu verlassen, und raste zurück ins Hauptquartier.
Schon seit drei Tagen wurde Jan beobachtet. Zwar wechselten seine Verfolger mehrfach Fahrzeug und Standort und versuchten, durch wiederholtes Austauschen ihrer Kleidung Verwirrung zu stiften. Doch ob im vornehmen Sakko mit Schlips und Kragen oder nur mit einfachem T-Shirt und Jeans bekleidet – er war sicher, dass es stets die Gleichen waren. Es handelte sich eindeutig um Südländer aus dem arabischen Raum: Schwarzhaarig, Bart, dunkler Teint. Doch wer waren diese Männer? Was wollten sie von ihm?, zermartere er sich den Kopf.
Ein Polizist macht sich im Laufe seiner Dienstzeit viele Feinde. Jan hatte so einige Gesetzlose zur Strecke gebracht und war in der Wahl seiner Mittel nicht immer zimperlich gewesen. Wenn er als Polizist zur Waffe griff, dann jedoch nur in Notwehr. Offiziell jedenfalls. Der Papierkram, den ein Beamter über sich ergehen lassen musste, wenn er von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hatte, war ihm einfach zu wider. Allerdings hatte er dabei bereits bedauerlicherweise zwei Menschen getötet. Er war jedoch niemals verurteilt worden und die Gerichte hatten ihm jedes Mal die absolute Notwendigkeit seines Handelns bestätigt. Zudem wurde er selbst bei Schusswechseln von zwei Kugeln getroffen, die ihn um ein Haar getötet hätten. Eine hatte ihm knapp oberhalb des Herzens die linke Schulter durchschlagen, die andere hatte seinen rechten Oberschenkel getroffen, gefährlich nahe an der Hauptschlagader.
Wollten sich diese Männer für einen dieser Toten rächen? Oder forderten sie Vergeltung für einen inhaftierten Vater, Bruder oder Freund?
Auf dem Weg zu seinem Auto hatte es leicht angefangen zu nieseln. Der Wind wehte ihm einen Schwall feinster Regentropfen ins Gesicht. Jan wusste, dass es in Hamburg keine bestimmte Jahreszeit brauchte, um zu regnen. Es regnete einfach immer. Das würde er auch als bleibenden Eindruck mitnehmen, wenn er seiner Heimatstadt eines Tages den Rücken kehren würde.
Er hatte in den letzten zehn Dienstjahren dreimal das Revier gewechselt, sowohl freiwillig als auch unter Zwang. Entweder hatte er selbst eine neue Herausforderung gesucht, oder seine Vorgesetzten hatten darauf gedrängt, ihn zu versetzen, weil es fortwährend Differenzen gab. Dabei galt Jan Krüger als einer der erfolgreichsten Ermittler in der langen und ereignisreichen Geschichte der Hamburger Mordkommission. Es war ihm gelungen, einige äußerst schwierige Fälle aufzuklären, an denen sich einige seiner Kollegen schon seit Jahren die Zähne ausgebissen hatten. Das rief natürlich Neider auf den Plan.
Jan galt als typischer Einzelgänger und seine Methoden waren oft umstritten, führten aber mit großer Regelmäßigkeit zum Ziel. Eben diese Erfolge waren es, die ihm oftmals Probleme bereiteten. Seine Vorgesetzten waren nicht immer fair mit ihm umgegangen. Selten hatte er auf seinen Stationen Kollegen kennengelernt, denen er blind vertrauen konnte. Er hatte hohe Ansprüche an sich selbst und hasste es, wenn ihm Fehler unterliefen. In seinen Augen gab es nicht so viele Kriminalbeamte, die seinen Vorstellungen von erfolgreicher Polizeiarbeit gerecht werden konnten. In diesem Wissen arbeitete er lieber allein. Der Vorteil war, dass er mit niemandem lange diskutieren musste, was als Nächstes zu tun war. Er tat es einfach, ohne dass ihm jemand in die Quere kam. Jan wusste, dass dies einer der Gründe war, warum ihn viele Kollegen und Vorgesetzte am liebsten von hinten sahen. Ihm kam dieser Ruf des störrischen und unnahbaren Einzelkämpfers allerdings sehr recht. Er wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. An engen persönlichen Kontakten war er ohnehin nicht interessiert. Jedenfalls was sein Berufsleben betraf. Vielleicht war er aus diesem Grund auch nie verheiratet gewesen, hatte keine Kinder – jedenfalls keine, von denen er wusste – und hielt den Rest seiner Familie lieber auf Distanz. Ein Anruf zum Geburtstag seiner Eltern, gelegentlich ein Kurzbesuch bei seiner Schwester Sylvia, mit der er sich noch am besten verstand. Das war’s schon. Ihr nutzloser, versoffener Ehemann war da eher ein rotes Tuch für ihn. Jan hatte Robert mehrfach eindringlich gewarnt, die Finger vom Alkohol zu lassen. Würde er erfahren, dass der Typ seine Schwester oder die Kinder auch nur einmal geschlagen hätte, würde er ihm alle Knochen im Leib brechen. So blieb es meist bei ein paar Blumen für eine nette Bekannte oder eine Freundin, wenn er gerade mal wieder eine seiner unverbindlichen Kurzbeziehungen pflegte.
Jan hatte den größten Teil der Strecke zu seinem Wagen zurückgelegt, den er ein gutes Stück entfernt in einer Seitenstraße abgestellt hatte. Es war verdammt schwierig, in der Stadtmitte einen Parkplatz in der Nähe des Präsidiums zu finden. Meistens war er gezwungen, morgens mehrfach ums Karree zu fahren, bis er endlich einen fand. Als Ermittler der Mordkommission hatte er zwar Anspruch auf einen Dienstwagen, mit dem er auch einen Stellplatz auf dem Innenhof des Präsidiums hätte beanspruchen können, doch er benutzte lieber seinen eigenen Wagen. Jan liebte Oldtimer, schraubte daran herum, wann immer er Zeit dafür hatte. Einen Neuwagen zu kaufen, kam für ihn gar nicht in Frage. Er hasste diese Fließbandmassenware wie die Pest. Er liebte seinen seesandfarbenen Audi Super 90, Baujahr 1971, mit dem legendären Solex Fallstrom-Registervergaser über alles. Das Fahrzeug befand sich in Topzustand und wurde ausschließlich mit Originalersatzteilen nachgerüstet. Der wassergekühlte Vierzylinder-Motor leistete immerhin neunzig Pferdestärken In den Siebzigern ein Rennwagen, war er für heutige Verhältnisse eher bescheiden motorisiert. Immerhin reichte das schon für satte 163 km/h Spitze. Er hatte viel Glück gehabt, dass er eines der letzten Fahrzeuge mit Lenkradschaltung ergattern konnte, denn erst die sorgte für das richtige 70er-Jahre Feeling. Natürlich war so ein Auto nicht ganz unauffällig und deshalb musste er, wenn es dienstlich notwendig war, auf eines dieser ungeliebten Dienstfahrzeuge zurückgreifen. Denn es erwies sich nicht als Vorteil, wenn diejenigen, die er verfolgte, seinen Oldtimer schon von weitem erkannten. Selbst im dichten Verkehr wäre der so leicht auszumachen, wie ein Diamant im Kiesbett.
Als er sich seinem Auto in Sichtweite näherte, beschloss Jan, diesen Typen, wer immer sie auch waren, vorsichtshalber aus dem Wege zu gehen. Per Handy rief er sich ein Taxi. Er benutzte dafür sein privates Gerät, das er neben seinem Diensttelefon immer bei sich trug. Dieses Handy hatte er nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr und kurz vor seiner Rückkehr aus Afghanistan von seine amerikanischen Freund, Thomas Bauer, der für die Central Intelligence Agency in Langley arbeitete, als Abschiedsgeschenk bekommen. Dieses High-Tech-Gerät der modernsten Generation galt als absolut abhörsicher und alarmierte ihn sofort durch ein nervendes, rotes Blinkzeichen, wenn jemand versuchte, es anzupeilen, um herauszufinden, wo er sich gerade aufhielt. Mit diesem kleinen Spielzeug war Jan in der Lage, jederzeit über Satellit und der Hilfe seines Freundes von der CIA die Standorte von Mobiltelefonen weltweit zu ermitteln. Es war somit im Besitz einer Art von technischem Wunderwerk, über das außerhalb der Geheimdienste keine zivile Einrichtung verfügte. Auch die Polizei nicht. Jan musste Tom Bauer hoch und heilig versprechen, niemals mit irgendjemandem über dieses Gerät zu reden, woran er sich natürlich hielt.
Im selben Moment, als Jan auflegte, durchschoss es ihn plötzlich heiß und kalt. Zum ersten Mal überhaupt meldete sich das rote Licht an diesem Mobiltelefon. Klar und deutlich blinkte das Warnsignal im Sekundentakt. Ein Zufall? Wohl kaum, dachte er. Wahrscheinlich versuchten seine Verfolger herauszufinden, wo er sich im Moment aufhielt. Jetzt wusste er jedenfalls, dass der Alarm auch tatsächlich funktionierte. Jan steckte das Handy in die Tasche. Langsam und möglichst unauffällig ließ er die Seitenstraße, in der sein Oldtimer stand, links liegen. Stattdessen lief er zügig, aber ohne Hast, Richtung Busbahnhof. Statt auf ein Taxi zu warten, empfahl ihm die freundliche Dame in der Zentrale, den nächsten Taxistand aufzusuchen. Auf Grund des miesen Hamburger Schmuddelwetters und mehrerer größerer Veranstaltungen in der Hansestadt, hätte er ansonsten bis zu einer halben Stunde warten müssen. Definitiv der falsche Moment, um Zeit zu verlieren. Jan war angespannt, blieb jedoch äußerlich gelassen. Er versuchte sich, so normal, wie möglich, zu verhalten. Dann aber bemerkte er anhand der Spiegelbilder in den Schaufenstern der anderen Straßenseite, dass der schwarze Golf schräg hinter ihm bleibend, langsam seine Verfolgung aufnahm. Wer waren diese Typen, die über die Technik verfügten, sein CIA-Handy anzupeilen? Offensichtlich schienen sie technisch ähnlich gut ausgerüstet zu sein, wie der amerikanische Geheimdienst. Auf diese Frage konnte es nur wenige Antworten geben: Entweder gehörten diese Typen dem Geheimdienst eines anderen Landes an, oder aber, er mochte es nicht mal laut denken, es waren Terroristen. Ihre konspirative Vorgehensweise und ihr Erscheinungsbild taten ein Übriges, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Jan war sich unsicher. Hatte er etwa Vorurteile oder sprach seine jahrelange Erfahrung im Umgang mit den Taliban aus ihm? Auf jeden Fall waren diese Typen nicht koscher, das stand fest. Ein Satz seines Freundes Tom Bauer schoss ihm durch den Kopf: »Auf die Dauer lässt sich überhaupt nichts geheim halten. Jede verschlüsselte Botschaft, jede verschleierte Identität, am Ende werden immer Mittel und Wege gefunden, die eine Aufklärung ermöglichen.«
Der musste es wissen, schließlich war er mittlerweile einer der ranghöchsten Offiziere des Geheimdienstes.
Jan hatte Thomas Bauer vor knapp zehn Jahren in Afghanistan kennengelernt. Thomas, Enkel deutscher Einwanderer, war damals offiziell als Presseoffizier nach Kabul und Kundus entsandt worden, um dort den Einsatz der amerikanischen Medien zu koordinieren. Seine eigentliche Aufgabe bestand jedoch darin, verdeckte Operationen der Central Intelligence Agency vorzubereiten und deren Durchführung zu überwachen. Dafür musste er vor Ort nur die besten Leute rekrutieren, um erfolgreich operieren zu können.
Jan musste lächeln, als er sich an die erste Begegnung mit Tom erinnerte. Als er eines Tages, wie gewohnt, im Feldlager der Bundeswehr in Kundus kurz nach Sonnenaufgang mit seinem MacMillan-Scharfschützengewehr die obligatorischen täglichen Schießübungen absolvierte, fiel ihm von hinten ein Schatten auf sein Visier. Er ließ sich nicht irritieren, blieb ruhig liegen und presste das noch kalte Holz des Gewehrschaftes fest an Schulter und Wange. Seine Atmung arbeitete ruhig und kontrolliert. Dann bewegte er langsam und gleichmäßig den Abzug. Kurz vor Erreichen des Druckpunktes verharrte er einen kurzen Moment, presste die restliche Luft aus seinen Lungen und zog den Abzug durch. Jan schoss einem fünfhundert Meter entfernten Pappkameraden zehnmal hintereinander im schnellen Einzelfeuer mitten ins Gesicht.
»Unbelievable, what the fuck are you doin’ there?«, Thomas Bauer stand das blanke Entsetzen im Gesicht. Nie zuvor hatte er Vergleichbares gesehen. Jan war stinksauer, dass ihn jemand während seiner Schießübungen störte. Hier hatte niemand etwas zu suchen. Außerdem verletzte dieser Kerl gerade die strengen Sicherheitsvorschriften. Obwohl er äußerst ungehalten war, blieb er nach außen ruhig und gelassen. Er sicherte in aller Seelenruhe seine Waffe, legte sie vor sich auf den Boden und nahm seine Ohrenschützer ab.
»Kann ich was für Sie tun?«, fragte er den Unbekannten dann doch spürbar gereizt und fixierte ihn dabei mit ernstem Blick. Jan mochte es gar nicht, bei seinem morgendlichen Ritual unterbrochen zu werden. Wer hatte diesen Typen überhaupt hier hereingelassen, fragte er sich.
»Oh, sorry«, antwortete Thomas, »Tut mir leid, ich wollte Sie nicht von Ihrem Training abhalten.« Weiter kam er nicht.
»Haben Sie aber«, konterte Jan unhöflich.
»Mein Name ist Thomas Bauer, US-Army-Pressedienst.« Tom reichte ihm die Hand. »Ich hätte Sie gerne gesprochen, Major. Können wir uns nach Ihrem Training kurz drüben im Casino unterhalten? Ich warte dort auf Sie.«
»Worum geht’s?«, fragte Jan noch immer leicht ungehalten.
»Das sollten wir unter vier Augen besprechen, Major. Ich möchte Sie bitten, mir ein paar Minuten ihrer wertvollen Zeit zu opfern, denn die Sache ist erstens wichtig und zweitens«, er verfiel in einen Flüsterton, »streng geheim.«
Jan musterte den Amerikaner immer noch argwöhnisch, stimmte dann aber zu: »Gut, ich bin in zehn Minuten bei Ihnen.«
Als er das Casino betrat, sah er Thomas Bauer im intensiven Gespräch vertieft mit einem anderen Soldaten, der leicht nach vorn gebeugt am Tisch saß und aufmerksam zuhörte. Er registrierte sofort, dass es sich bei diesem Mann um einen hochdekorierten Offizier der US-Army handelte. Als die beiden Jan kommen sahen, erhoben sie sich sofort respektvoll, um ihn zu begrüßen.
»Schön, dass Sie sich ein wenig Zeit für uns nehmen, Herr Major«, sagte Thomas Bauer in fließendem, fast akzentfreiem Deutsch und lenkte Jans Aufmerksamkeit auf seinen Landsmann. »Darf ich vorstellen: Colonel Terry James, Oberbefehlshaber der US-Army in Afghanistan.«
Colonel James reichte Jan seine kräftige, fleischige Hand und nuschelte, als hätte er eine heiße Kartoffel im Mund, in einem kaum verständlichem Südstaatenakzent: »It’s a pleasure to meet you, Major.«
Jan, der nur erahnen konnte, was der Colonel eben gesagt hatte, hielt nicht viel von übertriebener Höflichkeit und antwortete mit einem etwas distanzierten, einfachen Hallo. Was wollte solch ein mit Lametta behängter Marine von ihm?, rätselte er. Alle drei setzten sich.
»Major, um es kurz zu machen, wir brauchen Ihre Hilfe«, kam Thomas Bauer unmittelbar zur Sache. »Wie Sie sicher schon längst bemerkt haben, wird die Lage hier für unsere Soldaten von Tag zu Tag gefährlicher. Selbstmordattentäter, Heckenschützen, Landminen, Sprengstoffanschläge, all diesen Dingen und mehr sind die Männer nahezu schutzlos ausgeliefert. Während unsere Leute Hemmungen zeigen, ihre Waffen einzusetzen, um nicht Unschuldige zu verletzten oder zu töten, schießen die Taliban wahllos und ohne Vorwarnung fernab jeglicher Skrupel auf unsere Soldaten. Das große Problem ist, dass es uns einfach nicht gelingt, diese hinterhältigen Attacken wirkungsvoll zu unterbinden. Wir wollen den Gegner bekämpfen, aber es erweist sich als verdammt schwierig, Freund von Feind zu unterscheiden. Unsere Männer haben hier tagtäglich das Gefühl, Phantomen hinterherzujagen. Hinter der Fassade eines einfachen Mannes kann sich jederzeit ein Kämpfer der Taliban verstecken.«
Thomas Bauer machte eine Pause. Er sah Jan an, als suchte er in seinen Augen nach Verständnis.
»So kann das jedenfalls nicht weitergehen. Die Idee ist, dass wir fortan nicht mehr untätig abwarten, bis sie uns attackieren, sondern ab sofort selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Aus diesem Grund haben wir vor, demnächst streng geheim in einer relativ kleinen, aber schlagkräftigen Eliteeinheit in die Offensive zu gehen. Dafür brauchen wir natürlich erstklassig ausgebildete Kämpfer, die mit der Unterstützung der Geheimdienste in verdeckten Operationen gezielt Jagd auf die Anführer der Taliban machen sollen. Kurzum: Wir müssen versuchen, diese Terroristen mit ihren eigenen Waffen schlagen«, kam Thomas Bauer schließlich zum Ende.
»That’s true«, fügte Colonel James hinzu, »this is our only chance.« Offenbar hatte der Colonel den Ausführungen Bauers, die ausnahmslos in Deutsch gehalten waren, folgen können.
Als Jan ihn darauf fragend ansah, griff Tom Bauer erklärend ein.
»Der Colonel versteht ganz gut Deutsch und ist auch durchaus in der Lage, ein paar Sätze zu formulieren.«
Terry James, der die Fünfzig bereits deutlich überschritten hatte, hob entwaffnend seine Arme. Er wirkte dabei wegen seiner Körperfülle und seiner etwas zu eng anliegenden Uniform wie ein Michelin-Männchen.
»Sorry, natürlich, but ich habe lange schon nicht Deutsch gesprochen. I hope, dass ich noch kann«, radebrechte er.
»Sie müssen sich nicht entschuldigen, Sir. Ich denke hier ist Englisch die Amtssprache«, warf Jan ein und lächelte das erste Mal ein wenig. Die beiden Männer waren ihm durchaus nicht unsympathisch, sollten aber jetzt doch endlich zur Sache kommen.
»Wir haben die Zustimmung des Nato-Generalsekretärs erhalten, länderübergreifend die besten Soldaten für einen solchen Einsatz zu rekrutieren. Und Sie, Major, sollen dabei eine Schlüsselposition einnehmen.«
Jan zog erstaunt die Augenbrauen hoch, hörte zunächst aber weiter zu, was Thomas Bauer zu sagen hatte.
»Ihnen wird eine Gruppe von fünfzehn erstklassigen Scharfschützen unterstellt, die Sie leiten und weiter ausbilden sollen. Sie sind dann fortan für die operativen Einsätze der Sondereinheit Sniper, so der Codename, verantwortlich.«
Wieder machte er eine kleine Pause, um dann süffisant hinzuzufügen: »Wir haben uns erlaubt, bereits eine Vorauswahl von geeigneten Männern zu treffen, die alle für diese Aufgabe in Frage kommen. Selbstverständlich obliegt Ihnen die endgültige Auswahl der besten fünfzehn Leute, denen Sie dann den letzten Schliff verpassen sollen. Was halten Sie davon, Major?« Offensichtlich hatte Tom Bauer seine Ausführungen beendet. Zufrieden lehnte er sich in seinem Korbsessel zurück und trank einen Schluck seines mittlerweile lauwarmen Kaffees.
»Sir, bei allem Respekt, Sie wissen, dass ich als Kommandeur einer Nachschubeinheit der Bundeswehr in Kundus nicht für Kampfeinsätze vorgesehen bin?«, klärte Jan die beiden Männer auf.
»Das wissen wir, aber diesen Posten werden Sie in Zukunft nur noch auf dem Papier bekleiden, Major. Jetzt gibt es hier für Sie Wichtigeres zu tun. Wir werden diesen Terroristen endlich klarmachen, dass wir über Mittel und Wege verfügen, uns gegen unsere Feinde erfolgreich zur Wehr zu setzen. Es wird Zeit, dass wir diesen Typen kräftig in den Allerwertesten treten. Nur so können wir das Leben unserer Soldaten vor Ort schützen.«
Thomas Bauer merkte, dass Jan immer noch nicht gänzlich überzeugt war. »Ich werde Ihnen Ihre Entscheidung ein Stück weit leichter machen, Herr Major.«
Er richtete sich in seinem Korbsessel kerzengerade auf, machte eine kurze Pause, atmete einmal tief ein und sagte: »Sie haben keine Wahl, Sir, ihr Marschbefehl ist bereits unterschrieben.«
Als Jan den Taxistand erreicht hatte, war er schon leicht durchnässt. Er steuerte auf einen alten Mercedes zu, der in der Reihe ganz vorn stand und klopfte kurz an die Scheibe. Ein älterer Herr mit grauem Haarkranz und einem dicken, schwarzen Schnauzer unter der Nase nickte ihm kurz zu, beugte sich zur Beifahrertür und öffnete. Jan stieg ein.
»Was ein Sauwetter, schickt man nicht mal ‘nen toten Hund auf die Straße«, scherzte der Fahrer und sah Jan fragend an. »Wo soll’s denn hingehen?«
»Fahren Sie mich bitte ins Radisson«, gab Jan kurz an.
»Geht klar, Chef«, setzte der Mann sein Taxi in Bewegung.
Der Wagen ordnete sich in den dichten Verkehr auf der Reeperbahn ein und kam zunächst nur im Schritttempo voran. Der Regen war jetzt heftiger geworden, prasselte auf Dach und Fenster des maroden Taxis, in dem es aber überraschender Weise trocken blieb.
»Gleich flutscht es wieder besser«, beschwichtigte der Taxifahrer, »dann drehen diese schaulustigen Gaffer ihre Hälse wieder in Fahrtrichtung.«
Aus dem Mann sprach jahrelange Berufserfahrung. Jan sah sich kurz um. Drei Fahrzeuge lagen zwischen ihm und dem schwarzen Golf seiner Verfolger, die sich wohl doch nicht so leicht abschütteln ließen. Als er sich ein zweites Mal umdrehte, reagierte der Fahrer, der offensichtlich Jans Unruhe im Rückspiegel beobachtet hatte. Mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht fragte er: »Na, ist’s die Ehefrau oder die Geliebte?«
»Weder noch«, antwortete Jan, »wohl eher die gehörnten Ehemänner.«
Der Taxifahrer stieß einen dreckigen, herzhaften Lacher aus. »Soll ich die Flaschen abhängen, is’ gar kein Problem?«
»Nein«, sagte Jan, »aber Sie können mir trotzdem einen Gefallen tun.«
»Der Kunde ist König, klar doch, Mann.«
Jan reichte dem netten, älteren Herrn zwei zusammengerollte fünfzig Euro-Scheine nach vorn. Viel Geld, aber gut angelegt, dachte er.
»Der eine ist für die Fahrt, der andere für den kleinen Gefallen.«
»Oh, sehr großzügig, aber für ‘ne sexuelle Gefälligkeit bin ich wohl schon ‘n bisschen zu alt«, witzelte der Fahrer.
Obwohl Jan angespannt war, musste er lachen. Er beschloss, dem freundlichen Taxifahrer reinen Wein einzuschenken.
»Ich habe hier ein Handy, das geben Sie bitte im Radisson an der Rezeption ab. Fragen Sie nach einfach Patrick Hagen. Machen Sie das ruhig auffällig, da gibt es zwei Herren, die das genauso mitbekommen sollen.«
»Ist das alles? Dafür zwei Fuffis, a la boneur.«
»Nein, eine Bitte hab ich noch. Versuchen Sie sich da vorn vor den grauen Sprinter zu setzen und verlangsamen Sie dann kurz die Geschwindigkeit, damit ich aus dem Wagen springen kann. Fahren Sie dann möglichst unauffällig weiter.«
»Mann, das ist ja wie im Tatort, echt spannend, Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar«, war der Fahrer aufgeregt, ohne zu ahnen, dass er gerade voll ins Schwarze getroffen hatte.
Er tat, um was Jan ihn gebeten hatte. Als das Taxi vor dem Sprinter einscherte, sprang Jan aus dem Wagen und duckte sich nach wenigen Metern zwischen zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen. Nur ein paar Sekunden später fuhr der schwarze Golf langsam an ihm vorbei. Aus nur knapp drei Metern Entfernung zeigte sich deutlich das Profil des Beifahrers. Der Mann starrte mit grimmig entschlossenem Blick durch die von den Scheibenwischern bearbeitete Frontscheibe. Dieser Typ war einwandfrei arabischer Herkunft: Dunkler Teint, schwarzer Schnauzer, umgeben von einem grauschwarzen Dreitagebart und eine Hakennase wie ein ägyptischer Pharao. Oberhalb seiner großen, fleischigen Ohren thronte ein graumelierter Haarkranz, vereinzelnd noch mit schwarzen Borsten durchsetzt. Jan mochte es nicht mal denken, aber genauso stellte man sich im Allgemeinen einen Terroristen vor. Dieser Mann entsprach zu hundert Prozent dem in den westlichen Medien nur allzu gern verbreiteten Klischee eines terroristischen Bombenlegers. Jan war sich natürlich darüber im Klaren, dass Vorurteile völlig fehl am Platz waren. Während seines Afghanistaneinsatzes war er vielen Männer begegnet, die so aussahen, wie dieser Fremde. Dabei handelte es sich in der Regel um friedliche, nette Menschen, die obendrein noch unglaublich gastfreundlich waren.
Aber nicht das Profil dieses Mannes schien ihm gefährlich, es war dieser Blick, den er nur allzu genau kannte. Ein Blick, aus dem purer Fanatismus triefte und der eine Art von Entschlossenheit ausdrückte, seine Feinde ohne Rücksicht auf das eigene Leben zu bekämpfen.
Abdullahs Ziel war es, die Ungläubigen zu töten, auch wenn dabei die Gefahr bestand, jederzeit selbst getötet zu werden. Für seinen Glauben zu sterben, bedeutete für einen wahren Kämpfer Gottes die Erfüllung. Im Paradies warteten auf ihn zur Belohnung schon tausend Jungfrauen und das uneingeschränkte Wohlwollen Allahs. Den Märtyrertod zu sterben, würde ihm und seiner Familie für immer den Ruhm und den Respekt aller Gläubigen einbringen. Etwas Wunderbareres konnte Abdullah sich kaum vorstellen. Aber dieses Glück würde ihm wohl niemals zuteilwerden. Schließlich war er nur ein kleiner, unbedeutender Scout. Töten durften die anderen. Zeit, das zu ändern, dachte Abdullah.
Nachdem der schwarze Golf vorbeigefahren war, rief Jan mit seinem Diensthandy im Radisson an.
»Jan Krüger hier, bitte geben Sie mir Herrn Hagen. Es ist dringend.«
»Moment, er steht gerade neben mir«, antwortete die Dame von der Rezeption.
»Hagen«, meldete sich sein Freund.
»Jan hier, hör mir bitte genau zu, es ist wichtig, wir haben nur ein paar Minuten Zeit.«
Patrick Hagen, ein kleiner, rundlicher Endvierziger von knapp 1,70 Meter geballter Energie, war einer seiner besten Freunde. Fünfzehn Zentimeter kleiner hätte er ein perfektes Double für Danny De Vito abgegeben.
Jan konnte ihm vertrauen. Er hatte ihm schon mehrfach geholfen, durch die ein oder andere kleine Finte, seine Arbeit wirksam zu unterstützen. Jans aufgeregte Stimme signalisierte ihm sofort, dass Gefahr im Verzug war.
»Okay, ich höre«, verstand Patrick prompt.
»Gleich kommt ein Taxifahrer ins Hotel und übergibt dir in meinem Auftrag ein Handy. Dieses Gerät wird von zwei zwielichtigen Typen angepeilt und verfolgt. Und die sind gerade auf dem Weg ins Radisson. Sie werden kurz nach dem Taxifahrer eintreffen und nach mir fragen. Unter irgendeinem harmlosen Vorwand werden sie mich dringend sprechen wollen, werden sie behaupten. Kannst du veranlassen, dass jemand, dem du vertraust, dieses Handy in die 335 bringt und es dort unter einer Matratze versteckt, so dass sie es nicht sofort finden? Wenn die Luft rein ist, schickst du die Typen hoch und erzählst denen, dass ich gerade nach oben gegangen wäre. Sie werden dich bitten, nicht auf dem Zimmer anzurufen, weil ihr Besuch natürlich eine freudige Überraschung sein soll. Diesen Wunsch erfüllst du ihnen, selbstverständlich nach Erhalt einer kleinen Aufmerksamkeit. Halt einfach deine Hand auf. Sie müssen nicht unbedingt erfahren, dass du der Chef bist, capito?«
Patrick schaltete wie immer, schnell. Er war kein Typ, dem man alles zweimal erklären musste.
»Alles klar. Wo bist Du jetzt?«
»Ganz in der Nähe. Ich komme rein, sobald diese Typen den Fahrstuhl betreten haben. Leg mir bitte die Karte von 333 griffbereit auf den Tresen, ich muss damit sofort die Treppe hoch. Und was auch passiert, Patrick, sorg dafür, dass niemand die Polizei ruft.«
»Du wirst mir doch nicht meine Zimmer versauen, oder?«
»Ich kümmere mich darum, dass wieder sauber gemacht wird, mach dir keinen Kopf.«
»Okay, Jan, der Taxifahrer kommt gerade rein.«
»Dann los, mein Lieber, und schon mal Danke. Bist echt ‘n super Kumpel.«
Jan klappte sein Handy zu und betrat das Radisson von hinten durch den Lieferanteneingang. Der Eingang zur Küche bot ihm einen perfekten Überblick über das Foyer. Momentan herrschte dort wenig Betrieb. Ein älteres Ehepaar checkte gerade ein. Ein Page trug ihre Koffer zum Lift. Im Wartebereich saßen zwei Männer in dunklen Anzügen mit aufgeklappten Laptops und diskutierten gestenreich und lautstark, ohne Rücksicht auf andere Gäste in ihrem Umfeld zu nehmen.
Jan beobachtete den Taxifahrer im Gespräch mit Patrick. Er bedankte sich gerade bei dem Mann, der umgehend das Hotel wieder verließ. An der Eingangstür kamen ihm auf der anderen Seite der Drehtür die beiden verdächtigen Kerle entgegen. Jan konnte keinen Blickkontakt zwischen den Männern und dem Taxifahrer ausmachen. Jetzt sah er die beiden Typen zum ersten Mal direkt vor sich. Der Kleinere war der, den er auf dem Beifahrersitz bereits deutlich gesehen hatte. Er war höchstens 1,65 Meter groß, aber von stämmiger, kräftiger Statur. Jan schätzte sein Alter auf Anfang vierzig. Der andere dagegen war groß und hager. Er hatte einen schwarzen Wuschelkopf und einen flaumigen Kinnbart. Er war um einiges jünger, vielleicht Ende zwanzig. Beide trugen zerknitterte, schwarze Anzüge und weiße Hemden, allerdings ohne Krawatte. Der Ältere von beiden hatte sein Hemd weit aufgeknöpft, so dass seine dicke, silberne Halskette besser zur Geltung kam. Sie steuerten zielstrebig auf die Rezeption zu. So wie Jan erkennen konnte, lief alles nach Plan. Patrick beugte sich zu den beiden Männern vor und schien mit ihnen im Flüsterton zu sprechen. Sie schoben ihm unauffällig einen Schein über den Tresen und gingen zum Fahrstuhl. In dem Moment, als sich die Tür des Lifts öffnete, spurtete Jan sofort vor zur Rezeption, griff die Zimmerkarte von 333 und rannte im Sprint in Richtung Treppe.
»Gut gemacht, mein Freund«, rief er Patrick zu und nahm im Zweischritt-Rhythmus die Stufen in die dritte Etage. Jetzt kam ihm seine Ortskenntnis zugute. Er musste die Tür zum Flur der dritten Etage nur einen Spalt öffnen, um den gesamten Gang einsehen zu können. Die beiden Männer waren vor Zimmer 335 in Stellung gegangen. Während der ältere der beiden an die Tür klopfte und deutlich vernehmbar »Room-Service« rief, stand der Jüngere mit gezogener Waffe hinter ihm. Sie warteten einen Moment. Als keine Antwort kam, wiederholte der Mann sein Anliegen. Jan befürchtete, dass möglicherweise gleich andere Gäste auf der Bildfläche erscheinen würden wenn die beiden nicht gleich in das Zimmer eindrangen. Doch dann machte sich der Ältere mit einem Gegenstand an der Zimmertür zu schaffen und hatte offensichtlich Erfolg. Nun zog auch er eine Waffe und beide schlichen vorsichtig in die 335.
Als sie im Zimmer verschwunden waren, lief Jan so schnell er konnte zur 333, die von der Treppe aus vor der 335 lag. Der flauschige Teppichboden des Etagenflurs dämpfte seine Schritte. Die hundertfünf Kilogramm Körpermasse, die trotz seiner sechsundfünfzig Jahre immer noch vorwiegend aus Muskeln bestand, glitt fast lautlos über den Flur der dritten Etage. Die Männer hatten die Tür zur 335 mittlerweile hinter sich geschlossen. Jan öffnete langsam und so leise es möglich war, die Tür zur 333 und zog sie danach wieder vorsichtig hinter sich zu. Jetzt nur keine unnötigen Geräusche verursachen, dachte er. Jan hoffte, dass die Männer das Handy noch nicht gefunden hatten und horchte mit angelegtem Ohr an der Zwischentür zur 335. Die beiden direkt nebeneinander liegenden Zimmer wurden auch als Junior-Suiten vermietet. Er hatte diese Räume fast ein Jahr lang bewohnt. Die 335 hatte er ausschließlich als Schlafzimmer genutzt. Hätte er sich allerdings von seinem schmalen Polizistengehalt niemals leisten können, wenn Patrick ihm nicht einen Sonderpreis gemacht hätte. War Jan mal wieder knapp bei Kasse, was häufiger vorkam, als ihm lieb war, ließ sein Freund auch schon mal eine Rechnung unter den Tisch fallen. Von seinem Verdienst als Polizeioberkommissar, der es gerade mal auf die magere Gehaltsstufe A 12 brachte, wäre der ständige Aufenthalt in einem Fünf-Stern-Hotel wohl kaum zu bezahlen gewesen. Wäre er, wie einst geplant, Rocksänger oder Filmstar geworden, hätte er sich regelmäßig die gesamte dritte Etage des Radisson mieten können. So wie Udo Lindenberg seit vielen Jahren die komplette obere Etage des Weißen Schlosses an der Alster, wie man das Hotel Atlantic Kempinski an der Außenalster im Volksmund nannte, bewohnte.
Jetzt konnte Jan die Männer leise miteinander reden hören. Wenn er sich nicht täuschte, sprachen sie französisch miteinander. Anscheinend suchten sie hektisch das Zimmer ab. Jan hatte seine 45er im Anschlag und öffnete mit der linken Hand ganz behutsam die Zwischentür. Jegliches Knarren und Knacken in den Türangeln konnte jetzt tödliche Folgen haben. Die beiden Typen standen mit dem Rücken zu ihm am Fenster und fingen gerade an, das Bettzeug herunterzureißen. Als der Jüngere mit Schwung die Matratze des Bettes anhob, fiel ihnen das Handy direkt vor die Füße. Als er das Telefon aufheben wollte, spannte Jan den Hahn seiner Waffe. Das deutlich vernehmbare Klicken ließ die Männer augenblicklich erstarren. Erschrocken drehten sie sich zu ihm um und starrten überrascht in die Mündung seiner Waffe. Der jüngere Mann stieß ein paar undefinierbare Laute aus. Jan glaubte, dabei ein langgezogenes »Meeerde!« herauszuhören.
Der Ältere von beiden richtete augenblicklich seine Pistole auf ihn und verzog dabei sein Gesicht zu einer wütenden Grimasse. Jan atmete einmal kurz und tief ein, dann drückte er ab. Seine 45er feuerte mit ohrenbetäubendem Lärm ihr Projektil in Richtung des Angreifers. Der Schuss traf ihn genau zwischen die Augen. Mit einem rauchenden Loch in der Stirn sackte er in sich zusammen. Mit weit offenem Mund starrte sein Kompagnon auf den am Boden liegenden Partner. Stocksteif, wie paralysiert, schien er zu keiner Regung imstande. Jan hatte direkt nach dem Schuss den Hahn erneut gespannt und wartete auf eine Reaktion seines verbliebenen Gegenübers. Regungslos hielt er seine Waffe in der linken Hand. Er stand da wie versteinert. Eine Attacke war in diesem Moment nicht zu erwarten. Irgendwoher kannte Jan dieses Verhalten. Der junge Mann starrte ihn an, als hätte er den Leibhaftigen vor sich. Es schien zunächst, als wollte er die Flucht ergreifen.
Jan war klar, dass eine Festnahme nicht in Frage kam. Wie sollte er diesen Vorgang seinen Vorgesetzten erklären? Die Sache würde eine Menge Staub aufwirbeln. Die Medien würden sich darauf stürzen, wie die Geier auf ihre Beute und via Internet wüsste bald die ganze Welt von diesem Vorfall. Die Terroristen bekämen seine Identität, sein Konterfei und seinen Aufenthaltsort praktisch auf dem Silbertablett serviert. Aber sollte er jetzt etwa einen Mann, der unfähig schien, sich zu wehren, kaltblütig erschießen? Das käme einer Exekution gleich, eine Alternative, die er nie und nimmer in Betracht ziehen würde. Oder doch?
Jans Bedenken wurden unmittelbar darauf zerstreut. Sein Widersacher hatte anscheinend die Fassung wiedererlangt. Seine deutlich erkennbare Verwirrtheit wechselte übergangslos in rasende Wut. Hysterisch schrie er: »This is for you, Black Dragon«, und stürmte mit seiner Waffe im Anschlag auf Jan zu. Er schaffte aber nicht mal anderthalb Meter, als er von der Wucht des Geschosses zurückgeschleudert wurde und rücklings zu Boden krachte. Der Schuss traf ihn oberhalb der Stirn, direkt am Haaransatz. Er hatte, als er auf Jan zustürzte, seinen Kopf nach vorn geneigt, wie ein wilder Stier, der gerade im Begriff war, seinen Peiniger auf die Hörner zu nehmen. Jan war sich bewusst, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Die Schüsse waren dermaßen laut gewesen, dass irgendjemand sicher gleich die Polizei verständigen würde. Ihm war klar, dass er keine große Angst haben musste, Spuren zu hinterlassen. Da er in dieser Suite eine Zeit lang gewohnt hatte, waren seine Fingerabdrücke ohnehin überall zu finden. Man würde es als puren Zufall ansehen, dass nun aus diesen von ihm bewohnten Räumen ein Tatort geworden war. Die Projektile in den Köpfen der toten Terroristen konnten zwar eindeutig einer 45 er zugeordnet werden. Doch da es sich um seine private, nicht registrierte Waffe handelte, und er die noch nie zuvor in einem Einsatz benutzt hatte, würde auch diese Spur ins Leere führen. Blieben nur noch ein paar Leute, die ihn auf dem Weg zur Treppe gesehen haben könnten. Doch die waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, als dass sie sich an ihn erinnern würden. Patrick und sein Personal würden schweigen. Auf seine Freunde konnte er sich verlassen, obwohl die Angelegenheit mehr als heikel war.
Beim Durchsuchen der Kleidung der Toten fand Jan lediglich die Autoschlüssel. Er nahm sie an sich und verließ, ohne zurückzublicken, die 335 in Richtung Treppe. Sein Weg führte ihn direkt herunter in die Tiefgarage. Noch war von der Polizei nichts zu sehen und zu hören. Er musste auf jeden Fall den schwarzen Golf durchsuchen, in der Hoffnung, dort Hinweise auf die Identitäten der beiden Männer zu finden.
Der Regen hatte inzwischen nachgelassen, der Verkehr hatte sich normalisiert und floss wieder halbwegs normal. Jan beschloss, die drei Kilometer zurück zum Polizeikommissariat völlig unauffällig zu Fuß zurückzulaufen. Als er gerade mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte, schossen aus Richtung Präsidium zwei Streifenwagen mit Sirene und Blaulicht die Reeperbahn herunter. Die Autofahrer bildeten brav eine Gasse. Jan blieb stehen und schaute sich mit dem Rücken zur Straße die Auslagen eines Kaffee-Shops an. Er staunte nicht schlecht: Dort konnte man jetzt sogar schon Autos kaufen. Groß aufgemacht hing das Werbeplakat eines knallroten Smarts im Fenster. Für nur 9.999 € war er in allen Farben zu haben. Angeblich mit satten fünfunddreißig Prozent Nachlass zum Listenpreis. »Smart to go? Na, dann…«, schüttelte Jan erstaunt den Kopf und setzte den Weg zu seinem Auto fort.
Black Dragon, hatte der Mann in gebrochenem Englisch gerufen. This is for you, Black Dragon. Schwarzer Drache? Was hatte das zu bedeuten? Jan konnte sich keinen Reim auf diesen Begriff machen. Hatten die Typen ihn vielleicht verwechselt? Wenn ja, dann hatten sie sich nachhaltig mit dem Falschen angelegt, dachte er.
Jan musste sich wegen der tödlichen Schüsse keine Gewissensbisse machen. Die Situation war mehr als eindeutig. Hätten sie ihn zuerst erwischt, wäre er jetzt wahrscheinlich tot und nicht diese beiden unbekannten Franzosen arabischer Herkunft. Oder hatte die Sache vielleicht etwas mit Afghanistan zu tun? Wohl kaum, schließlich lag sein letzter Einsatz in dem Krisengebiet mehr als zehn Jahre zurück, dachte er.
»Warum in aller Welt kommen die dann erst jetzt auf die Idee, mich aus dem Weg zu räumen?«, flüsterte Jan leise vor sich hin, während er sich mit den Jacken der Attentäter, die er aus dem schwarzen Golf mitgenommen hatte, nach dem langen Fußmarsch vom Radisson zurück in seinen Audi setzte.
Er hatte kaum Zeit gehabt, den Wagen der Terroristen ausgiebig zu durchsuchen. Die Kollegen hätten jede Sekunde eintreffen können und er durfte auf gar keinen Fall seine Fingerabdrücke am Fahrzeug hinterlassen. Er hatte die Türen des Golfs per Funk-Fernbedienung entriegelt. Danach stülpte er sich seine Jackenärmel über die Hände, öffnete die hintere linke Tür und fischte umständlich die beiden Kleidungsstücke vom Rücksitz, ohne etwas zu berühren. Anschließend warf er die Tür ins Schloss und verriegelte sie wieder. Die Jacken und die Wagenschlüssel nahm er mit.
An seinem Oldtimer angekommen, durchsuchte er sämtliche Taschen der Kleidungsstücke und fand diverse Papiere in den Brustinnentaschen. Darin befanden sich unter anderem zwei Reispässe. Jan schaute kurz hinein und erkannte beide Männer wieder. Er startete den Motor und bog in die Hauptstraße ein. Alle Hindernisse waren beseitigt. Die Straße war jetzt frei, es regnete nicht mehr und seine Probleme schienen für den Moment gelöst.
Jan fuhr in seine Wohnung, duschte kurz, suchte seine gepackten Sachen zusammen und verschwand so schnell wie möglich aus Hamburg. Unterwegs beschloss er, Tom Bauer anzurufen und ihn über die Vorfälle in Kenntnis zu setzen. Er musste jetzt mit jemandem reden, dem er vertrauen konnte. Vorausgesetzt, dass die Pässe keine Fälschungen waren, kannte er jetzt die Identitäten der Männer, die gerade versucht hatten, ihn zu töten. Tom sollte diese Typen durch die Computer der CIA abchecken lassen. Wenn die beiden jemals nur mit einer Zigarettenkippe den Champs-Elysees verschmutzt oder sich ein Ticket für den Louvre gekauft hatten, Tom würde es herausfinden. Jan erhoffte sich, durch diesen Anruf ein paar Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Eigentlich kaum vorstellbar, dass die Computer in Langley nichts über diesen Abdullah und seinen Freund Semih ausspucken würden.
Das Anti-Terror Netzwerk des US-Geheimdienstes war nach 2001 mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ausgebaut und modernisiert worden. Dass da noch irgendjemand auf diesem Planeten unerkannt durchschlüpfen konnte, war nahezu ausgeschlossen. Eine ganze Armada von Mitarbeitern überwachte Tag und Nacht via Spionagesatellit und Internet den gesamten Globus. Weltweit konnte kein Telefonat mehr geführt werden, ohne dass die Amis nicht hätten mithören können, auch in Deutschland nicht. Diese bittere Erfahrung hatte die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gerade erst machen müssen. Die Amerikaner machten eben auch vor ihren Verbündeten nicht halt. Dank der ausgeklügelten Spionagetechnik der Geheimdienste, konnten die Aktivitäten von Freund und Feind beobachtet und ausgewertet werden. Egal, ob ihn China ein Sack Reis umfiel oder der Pabst im Vatikan boxte, für alle galt dasselbe: Big brother is watching you, dachte Jan.
Mittlerweile erwiesen sich selbst die eigenen vier Wänden nicht mehr als sicher. Die CIA verfügte über Technologien, von denen der Bundesnachrichtendienst nur träumen konnte. Die US-Regierung investierte jährlich Milliarden von Dollar in die neusten und modernsten Überwachungssysteme. Der 11. September 2001 sollte und durfte sich unter keinen Umständen wiederholen. Endlich war alles möglich und nichts mehr konnte ausgeschlossen werden. Die Wörter geht nicht existierten in der Welt des amerikanischen Geheimdienstes nicht mehr. Die Arbeit der NSA und der CIA zeichnete sich fortan durch absolute Perfektion aus. Oder vielleicht doch nicht?
»Hallo Tom, Jan hier«, begann er sein Telefonat, »habe leider keine guten Nachrichten für dich. Kann es sein, dass ihr irgendwas nicht mitbekommen habt?«
»Scheiße gelaufen«, meldete sich Thomas Bauer aufgeregt. »Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Dass diese zwielichtigen Typen hinter dir her waren, haben wir leider erst vor ein paar Minuten erfahren. Wir hatten bisher lediglich die Information, dass zwei Al Kaida-Scouts von Paris nach Hamburg unterwegs waren, um eine oder mehrere Personen zu observieren. Im Grunde nichts Ungewöhnliches.«
»Warum hast du mich nicht sofort informiert?«, wollte Jan wissen.
»Uns fehlten bisher detaillierte Hinweise auf die Intention dieser Aktion. Wir wussten nur, dass sie eine Person oder eine Organisation mit dem Decknamen »Black Dragon« ausfindig machen sollten.«
»Und da seid ihr nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen, dass ich dieser Jemand sein könnte?«, entgegnete Jan entrüstet.
»Nein, solange wir mit dir zusammenarbeiten, bist du niemals mit diesem Namen in Verbindung gebracht worden. Bis vor wenigen Minuten nahmen wir an, dass »Black Dragon« der Deckname für eine geplante Aktion der Al Kaida in Deutschland sein könnte und diese Franzosen lediglich die Lage sondieren sollten. Solange die Al Kaida keine Kämpfer vor Ort hat, geschieht im Normalfall dort gar nichts. Aus dieser Erfahrung heraus sahen wir keine Veranlassung, dich zu kontaktieren und zu warnen«, erklärte Tom.
»Die Typen haben mein Handy angepeilt und wollten mich dann in meinem ehemaligen Hotelzimmer fertig machen. Etwas ungewöhnlich für Scouts, meinst du nicht auch?«, fragte Jan sarkastisch.
Tom atmete einmal tief durch und ließ sich Zeit mit seiner Antwort.
»Bis jetzt war der Ablauf bei der Planung von Terroranschlägen der Al Kaida immer gleich. Zuerst schicken sie ihre Spürhunde, die dann mit Hilfe von Schläfern oder Bruderorganisationen, die ihnen vor Ort helfen, die Anschläge vorbereiten. Ist die Vorarbeit geleistet, werden die eigentlichen Attentäter gezielt eingeschleust, führen die Anschläge aus und verschwinden genauso schnell wie sie gekommen waren.
»Aber diesmal haben sie es sich scheinbar anders überlegt«, war Jan immer noch sauer. »Kann es sein, dass ihr da was unterschätzt habt?«, wollte er wissen.
»Nein, Jan, wir beurteilen die Lage rund um die Uhr. Wenn es sein muss jede Minute aufs Neue. Diese beiden Männer wurden bisher ausschließlich als Beobachter eingesetzt. Sie konnten bis heute nicht ein einziges Mal mit irgendwelchen Terroranschlägen der Al Kaida in Verbindung gebracht werden. Sie haben in keinem Fall eine aktive Rolle gespielt. Wenn du so willst, waren das absolut unbeschriebene Blätter.«
Jan konnten die Antworten seines Freundes nicht zufriedenstellen. Noch befand sich ausreichend Adrenalin in seinem Blut.
»Aber genau diese Vorgehensweise ist es doch, die diese Terroristen so unberechenbar macht. Sie rekrutieren immer wieder aufs Neue Frauen und Männer, die bis dato überhaupt nichts mit dem Terror zu tun hatten. Offensichtlich scheint mittlerweile die Mehrheit aller radikalen Muslime bereit zu sein, sich für den Dschihad zu opfern. Eine gefährliche Entwicklung, wenn du mich fragst«, stellte Jan fest.
Tom versuchte ruhig zu bleiben und seine vermeintliche Gelassenheit auf Jan zu übertragen.
»Das Auskundschaften von Orten und Observieren von Personen durch das Terrornetzwerk der Al Kaida ist ein Vorgang, der sich tagtäglich auf der ganzen Welt zigfach wiederholt. Auch in Deutschland verzeichnen wir jeden Tag eine Reihe von Aktivitäten dieser Art. Mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, dass uns fast nichts mehr entgeht. Die totale Kontrolle werden wir jedoch niemals erlangen. Es braucht manchmal etwas Zeit und Geduld, bis unsere Experten eine Lage realistisch einschätzen können. Es ist nicht immer einfach, zu entscheiden, wann wir eine Lage als so ernst einstufen, dass wir Alarm auslösen. Wenn wir jedes Mal reagieren würden, wenn sich in deiner Nähe etwas Verdächtiges ereignet, müsste ich dich wahrscheinlich täglich anrufen. Die Aufgabe der CIA ist es aber nicht, Hysterie zu verbreiten, sondern im Einzelfall zu entscheiden, ob eine Lage gefährlich werden kann, oder nicht. Und in der schnellen Analyse von Sachverhalten sind wir gut, Jan, glaub’s mir. Fehlerfrei sind wir aber selbstverständlich nicht. So, und nun erzähl mir was, was ich noch nicht weiß.«
Jan sah ein, dass Tom recht hatte. Gewisse Dinge konnte man weder voraussehen noch verhindern. Aber aus welchem Grund hatten diese Männer auf eigene Faust gehandelt? Dafür gab es sicher eine Erklärung, die er im Moment aber noch nicht gefunden hatte. Jan schilderte Tom dezidiert den Ablauf des heutigen Tages und nannte ihm dann die Namen und Daten der Attentäter, wie sie in ihren Pässen nachzulesen waren. Er fotografierte die Pässe mit seinem Handy und mailte sie nach Langley.
»Wir überprüfen das jetzt schnellstens und geben dir umgehend Bescheid. Wahrscheinlich sind die tatsächlich hinter dir her. Du hast viele ihrer Kämpfer getötet. Möglicherweise ist es denen jetzt gelungen, deine Identität zu enttarnen. Du weißt doch, nichts lässt sich ewig geheim halten. Jetzt wissen wir aber genau, woran wir sind und können dementsprechend reagieren. Wenn dieses Gespräch beendet ist, machst du dich umgehend auf den Weg zu deiner neuen Dienststelle nach Leipzig. Unser kleines Spielzeug versenkst du am besten in der Elbe, dann sind unsere Freunde ’ne Weile mit der Suche beschäftigt. Ich sorge dafür, dass du schnellstens Ersatz erhältst. Pass auf dich auf, mein Freund.«
Tom beendete das Gespräch, noch ehe Jan sich verabschieden konnte. Bevor er Hamburg verließ, stoppte er seinen ockergelben Audi mitten im dichten Verkehr auf der Köhlbrandbrücke. Der starke Wind hier oben blies ihn fast von der Straße. Laut hupend schoss ein riesiger Containerlaster haarscharf an ihm vorbei. Der Sog des Fahrtwinds hätte ihn fast zu Boden geschleudert. Nachdem er die SIM-Karte entnommen hatte, beugte er sich halsbrecherisch über das Brückengeländer, um sicherzustellen, dass sich nicht gerade einer der unzähligen Lastkähne unter der Brücke hervorbewegte. Dann warf er das CIA-Handy im hohen Bogen in die Elbe. Den Akku beließ er im Gerät, so konnten sich seine »neuen Freunde« noch etwas mit der Ortung beschäftigen. Jan sprang in seinen Wagen und gab Vollgas. Noch so eine gefährliche Situation wollte er jetzt nicht provozieren. Er verließ Wilhelmsburg und fuhr an der Anschlussstelle Waltershof auf die A 7 Richtung Hannover. Von dort aus ging es weiter Richtung Hannover und Göttingen, wo er am Dreieck Drammetal auf die A 38 nach Leipzig abbog.
Jan gab seinem in die Jahre gekommenen Audi die Sporen. Mit 150 Stundenkilometern surrte der Motor wie ein Kätzchen und sorgte für den Antrieb des Oldtimers, der souverän über die wenig befahrene Autobahn 38 gen Osten glitt. In knapp zwei Stunden würde er in Leipzig ankommen. Ein neues Kapitel im Leben des Polizeioberkommissars Jan Krüger stand unmittelbar bevor. Trotz der zuletzt schrecklichen Ereignisse freute er sich darauf. Auf der Fahrt nach Leipzig fand er ausreichend Zeit ausgiebig nachzudenken. In den vergangenen Jahren war er sporadisch immer mal wieder im Auftrag von Tom Bauer für die CIA tätig gewesen. Jedoch hatten sich diese Aufgaben lediglich auf die Überprüfung oder Observation von einigen wenigen verdächtigen Personen beschränkt. Er musste in keinem Fall aktiv eingreifen. Dazu fehlte ihm allerdings auch die offizielle Legitimation. Jan drehte das Radio für die Nachrichten lauter:
»Heute am späten Nachmittag wurden von der Hamburger Polizei zwei unbekannte Männer in einem Hotel tot aufgefunden. Wie die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden diese Männer offensichtlich von bisher unbekannten Tätern erschossen. Noch gibt es keinerlei Hinweise zu dieser Tat. Die Identität der Männer, die wahrscheinlich aus dem arabischen Raum stammen, ist bisher noch ungeklärt. Die Hamburger Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Das Wetter…« interessierte Jan nicht mehr.
War ohnehin immer dasselbe. Er glaubte nicht, dass er mit dieser Sache in engere Verbindung gebracht werden konnte. Irgendwelche Spuren am Tatort, die Jan zuzuordnen waren, ließen sich schließlich leicht erklären. Möglicherweise gäbe es dazu noch ein paar Fragen. »Wenn überhaupt«, sagte Jan leise vor sich hin.
Er lauschte mit großer Freude dem seidenweichen Lauf seines Audi-Motors, der in seinen wesentlichen Bestandteilen noch aus dem Originaltriebwerk des Jahres 1971 bestand. Er hatte den Wagen direkt nach seiner Rückkehr aus Afghanistan einem Rentnerehepaar abgekauft, in deren Besitz sich dieses Auto seit über dreißig Jahren befunden hatte. Der Audi hatte original nur etwa 120.000 Kilometer gelaufen und befand sich für dieses Alter in einem Top Zustand. Bis auf die ein oder andere kleine Roststelle war dieser Super 90 tadellos gepflegt. Die alten Herrschaften wollten nur noch tausend Euro für dieses motorisierte Kleinod haben. Da das Auto locker noch das Dreifache wert war, zahlte Jan freiwillig das Doppelte. Andernfalls hätte er ein schlechtes Gewissen gehabt. Schließlich wollte er die Unwissenheit und Gutmütigkeit dieser alten Leute nicht schamlos ausnutzen. So waren am Ende beide Parteien mit dem ausgehandelten Deal glücklich.
Natürlich erwies sich der Verbrauch mit rund zwölf Litern Superbenzin nicht mehr unbedingt als zeitgemäß. Ein gleichstarker neuer Audi A4 mit einem modernen Vier-Zylinder Diesel schluckte nicht mal die Hälfte. Das war Jan aber herzlich egal. Der Charme seines Oldtimers war ihm wichtiger, als ein paar Tankstellen später zu halten. Dass ihn die Tankwarte natürlich immer freundlich begrüßten, weil sie ihn öfter sahen, als andere Kunden, konnte er auch noch verkraften. Um das original 70er Jahre Feeling noch zu steigern, schob er eine Doors-Kassette ins Kassettenfach. CDs und Mp3s zeugten aus seiner Sicht von totaler Stillosigkeit und hatten mit Retro überhaupt nichts zu tun. Zu Hause hörte er Schallplatten. Echtes Vinyl war immer noch unschlagbar, der Sound klar und unverfälscht. Seine Sammlung umfasste mindestens fünftausend Langspielplatten, vornehmlich Rockmusik aus den Siezigern.
»Girl ya gotta love your man, girl ya gotta love your man, take him by the hand, make him understand…riders on the storm«, zelebrierte Jim Morrison, während Jan jedes einzelne Wort mitsang. Wären diese schrecklichen Ereignisse des Tages nicht gewesen, er würde jetzt vor Glückseligkeit nur so vor sich hin träumen, sich bei der langen Fahrt auf der Autobahn total entspannen, wo andere im Stress und voller Hektik im Wettlauf gegen die Zeit ihren nächsten Termin ansteuerten.
»There’s a killer on the road, his brain is squirmin’ like a toad...« Doch so sehr er darum bemüht war, abzuschalten, die vielen unbeantworteten Fragen tauchten unvermittelt wieder auf, nagten an ihm, ließen ihm keine Ruhe.
»Black Dragon« hatten sie ihn genannt. Seine Einheit hatte überwiegend im Schutze der Dunkelheit operiert. Jan hatte seine Männer akribisch darauf trainiert, mit Hilfe von Infrarot-Zieleinrichtungen zu schießen, bis sie es in Perfektion beherrschten. Ihr Tarnzeug bestand aus einem schwarzen Overall, dunkelbraunen Stiefeln, schwarzen Handschuhen und Wollmützen.
Während der Operation »Anaconda«, die im März 2002 im Shali-Kot-Tal und im Arma-Gebirge südlich von Zormat in Zusammenarbeit mit britischen, kanadischen und amerikanischen Elite-Soldaten durchgeführt wurde, gingen Jan und seine Männer, vorwiegend von ihm ausgewählte Einzelkämpfer der deutschen Kommando Spezialkräfte (KSK), auf »Jagd«. Dazu bildeten sie jeweils kleine Gruppen, um effektiver handeln zu können. Sie erhielten ihre Marschbefehle, kundschafteten aber auch auf eigene Faust. Sie waren permanent mit der Leitstelle verbunden, die über alle nur erdenklichen technischen Hilfsmittel verfügte.
Während die Sniper der US-Army und der Briten mit dem üblichen M 40 Scharfschützengewehr ausgerüstet waren, bevorzugten Jan und seine Männer das kanadische Modell McMillan Tac-50. Mit diesem Gewehr hatte der kanadische Corporal Rob Fuslong einige Wochen vorher aus einer Distanz von unglaublichen 2430 Metern einen feindlichen MG-Schützen punktgenau liquidiert. Als Munition diente ihm eine 12,7 x 99 mm Patrone, auch 50 BMG genannt. Die Durchschlagskraft dieses Geschosses war enorm. 35 mm Panzerstahl stellte auf eine Entfernung von fünfhundert Metern kein ernsthaftes Problem dar. Bei einem Menschen richtete diese Munition selbst auf einer Distanz von über tausendfünfhundert Metern noch verheerenden Schaden an.
Die Verstecke der Taliban wurden mit Hilfe von Drohnen und Satelliten aufgespürt. Ein Black Hawk, der ihnen größtmögliche Bewegungsfreiheit in unwegsamen und unzugänglichen Gebieten garantierte, brachte sie im Schutze der Dunkelheit so nah wie möglich an ihren Einsatzort. Von da an pirschten die Männer sich lautlos an ihre Gegner heran. Um sicher zu treffen, mussten sie bis auf etwa fünfhundert bis achthundert Meter an den Feind herankommen. Hatten sie das geschafft, konnten sie ihre tödlichen Geschosse zielsicher abfeuern, ohne vorher entdeckt zu werden. Danach blieb ihnen immer noch ausreichend Zeit und Vorsprung, um sich