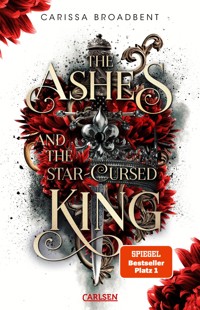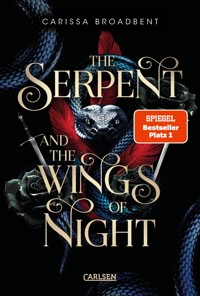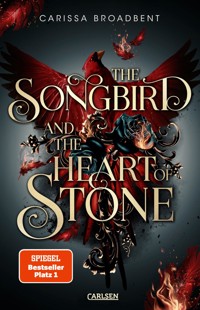14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cove
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine ehemalige Sklavin, die für Gerechtigkeit kämpft. Ein Krieger, der den Glauben daran längst verloren hat. Und eine dunkle Magie, die ihre Schicksale untrennbar miteinander verknüpft. Tisaanah hat das Unmögliche geschafft: Nach Jahren der Unterdrückung hat die Sklavin ihre Freiheit mit Gold erkauft – nur um nach einem Blutbad aus ihrer Zwangsheimat Threll fliehen zu müssen. Ihre einzige Hoffnung liegt im Mitternachts-Orden, einer mächtigen Organisation von Magieanwendern. Dort will sie ihre magischen Fähigkeiten schulen, um eines Tages zurückzukehren und die verbliebenen Sklaven zu befreien. Die Aufgabe, sie auszubilden, fällt Max zu. Er ist ein ehemaliger Soldat mit einer dunklen Vergangenheit und einer Abneigung gegen den Orden – und gegen sie. Anfangs können die beiden einander kaum ertragen, doch je mehr sie von den Wunden des anderen erfahren, desto stärker werden die Bande, die sie verbinden. Gemeinsam müssen sie sich gegen Intrigen und Vorurteilen behaupten, während die Schatten eines Krieges immer näher rücken. Doch der Orden hat eigene Pläne – und Tisaanah könnte der Schlüssel sein. Sie findet sich in einem Netz aus Verrat, Machtspielen und Geheimnissen wieder, und ihr wird klar: Der Kampf um ihre Freiheit war erst der Anfang. War of Lost Hearts Daughter of No Worlds ist der Auftakt einer mitreißenden New-Adult-Romantasy-Trilogie voller düsterer Magie, emotionaler Tiefe und verbotener Gefühle. Ein episches Abenteuer mit faszinierenden Charakteren, erbarmungslosen Intrigen und einem unvergleichlichen Sog – perfekt für Fans von Sarah J. Maas und Raven Kennedy. //Alle Romane der »War of Lost Hearts«: -- Band 1: Daughter of No Worlds -- Band 2: Children of Fallen Gods – erscheint im Frühjahr 2026 -- Band 3: Mother of Death and Dawn – erscheint im Herbst 2026//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carissa Broadbent
The Fallen and the Kiss of Dusk
Aus dem Englischen von Heike Holtsch
Eine ehemalige Sklavin, die für Gerechtigkeit kämpft. Ein Krieger, der den Glauben daran längst verloren hat. Und eine dunkle Magie, die ihre Schicksale untrennbar miteinander verknüpft.
Tisaanah hat das Unmögliche geschafft: Nach Jahren der Unterdrückung hat die Sklavin ihre Freiheit mit Gold erkauft – nur um nach einem Blutbad aus ihrer Zwangsheimat Threll fliehen zu müssen. Ihre einzige Hoffnung liegt im Mitternachts-Orden, einer mächtigen Organisation von Magieanwendern. Dort will sie ihre magischen Fähigkeiten schulen, um eines Tages zurückzukehren und die verbliebenen Sklaven zu befreien.
Die Aufgabe, sie auszubilden, fällt Max zu. Er ist ein ehemaliger Soldat mit einer dunklen Vergangenheit und einer Abneigung gegen den Orden – und gegen sie. Anfangs können die beiden einander kaum ertragen, doch je mehr sie von den Wunden des anderen erfahren, desto stärker werden die Bande, die sie verbinden. Gemeinsam müssen sie sich gegen Intrigen und Vorurteilen behaupten, während die Schatten eines Krieges immer näher rücken.
Doch der Orden hat eigene Pläne – und Tisaanah könnte der Schlüssel sein. Sie findet sich in einem Netz aus Verrat, Machtspielen und Geheimnissen wieder, und ihr wird klar: Der Kampf um ihre Freiheit war erst der Anfang.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Widmung
Vorbemerkung
Glossar
Nachwort der Autorin
Danksagung
Viten
Für meine »Writing on the Wall«-Crew.Dieses Buch ist für euch, ohne euch würde es nicht existieren.
VORBEMERKUNG
Liebe Leser*innen,
dieser Roman enthält folgende potenziell triggernde Inhalte:
Sklaverei
Folter
Emotionaler und körperlicher Missbrauch
Erwähnung von Menschenhandel zu sexuellen Zwecken
Gespräche über sexualisierte Gewalt
Trauer und Verlust geliebter Menschen
Sexuelle Handlungen
Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freund*innen oder suche dir professionelle Hilfe.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Carissa und das Cove-Team
PROLOG
Am Anfang stehen zwei Seelen, die auf einmal ganz allein sind.
Einschätzen. Entscheiden. Handeln.
Der junge Mann ließ diese Worte in seinem Kopf nachhallen wie einen zweiten Herzschlag.
Er sträubte sich gegen den Gedanken, dass er hier seinen Tod finden könnte. Sogar noch, als er auf einer Blutlache ausrutschte, über Leichen stolperte und im Geiste die vielen Männer und Frauen zählte, die ihm in diese Stadt hineingefolgt waren, ihm aber nicht wieder hinausfolgen würden. Sogar noch, als dieser ungebetene Gedanke immer wahrscheinlicher wurde.
Er war einundzwanzig Jahre alt. Er hätte nicht mehr sagen können, in wie vielen Schlachten er schon gekämpft hatte. Aber das hier? Das war keine Schlacht. Das war ein Massaker.
Einschätzen. Entscheiden. Handeln.
Er presste sich mit dem Rücken gegen eine Hauswand und spähte um die Ecke in eine Gasse. Die Straßen waren gesäumt von gedrungenen, schiefen Häuschen, die sich aneinanderzulehnen schienen. Verängstigte Gesichter spähten daraus hervor. Mütter zerrten ihre Kinder durch die Türen, außer Reichweite des tödlichen Tanzes von Stahl und Magie und Feuer.
In der Tiefe seiner Gedanken lachte die Stimme leise in sich hinein.
Halt die Klappe, befahl er ihr und stürzte sich wieder in den Kampf. Er raste durch die Straßen, raunte den Flammen etwas zu, um sie anzulocken. Und sie fügten sich gehorsam, wanden sich um seine Hände und schlängelten sich an seinen Armen empor. Er riss sie aus den Häusern heraus und von den Straßen herunter, fort von zarter Haut und zerbrechlichen Knochen.
Aber es waren zu viele. Sie verschlangen seine Kraft und seine Konzentration. Und so konnte er nicht einmal mehr ausweichen, ehe ein scharfer Schmerz seinen Rücken durchzuckte. Warmes Blut mischte sich mit stechendem, salzigem Schweiß.
Handeln, handeln, handeln.
Er biss die Zähne zusammen, wirbelte herum und setzte instinktiv zum Gegenangriff an, bevor die Rebellin einen weiteren Treffer landen konnte. Ihr Körper schlug auf dem Boden auf, die Gliedmaßen merkwürdig verdreht. Er sah ihr nicht ins Gesicht, war dankbar, dass es hinter einer Mähne brauner Locken verborgen war.
Als habe der Geruch frischen Blutes sie geweckt, sprang die Stimme in seinem Inneren wieder an. {Töte es!},zischte sie und warf sich gegen die Oberfläche seiner Gedanken, kratzte mit ihren Klauen daran wie an einer Tür.
Nein …
Er zögerte den Bruchteil einer Sekunde zu lang. Etwas traf ihn mit voller Wucht, warf ihn in der Gasse zu Boden. Sein Instinkt übernahm. Schon zogen seine Hände die Klinge, hielten sie dem Angreifer an die Kehle, ehe er auch nur den Kopf wenden konnte, um zu sehen, wer dort stand.
»Wag es ja nicht, mich zu töten«, raunte eine vertraute Stimme ihm ins Ohr. »Hier sind Hunderte Rebellen, die das nur zu gerne übernehmen würden.«
Diese Stimme. In diesem Augenblick war sie das Schönste, was der junge Mann jemals gehört hatte.
Er stieß ein lautloses Seufzen aus, ließ den Dolch sinken und drehte sich um. »Wo zum Teufel hast du gesteckt?«
Mit unerschütterlichem, stählernem Blick sah die junge Frau ihn an. Ihre Iris waren so hell, dass sie mit dem Weiß ihrer Augäpfel verschwammen, sodass nur die beiden dunklen Stecknadelköpfe ihrer Pupillen ihn abschätzend anzustarren schienen. Ihre Wangen waren von Ruß und Blut verschmiert, ihre weißen Zöpfe schmutzig und verfilzt. Ein Mantel hing ihr um die Schultern, der einst blau gewesen war. Doch jetzt waren so viele rote Spritzer darauf, dass er fast violett wirkte, auch die Mondsichel an ihrem Revers hatte sich mit Blut vollgesogen.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals. »Wie viel davon ist deins?«
»Wie viel davon ist deins?« Die Frau packte ihn an den Schultern und drehte ihn um.
»So schlimm?«
»Ziemlich schlimm.«
»Na, wundervoll«, murrte er, denn er hatte gehofft, die Wunde wäre nicht so tief, wie sie sich anfühlte.
Sie drehte ihn wieder zu sich um, hielt aber noch immer seine Arme gepackt, ihr Gesicht nur Zentimeter von seinem entfernt. »Du blutest ziemlich stark. Merkst du das nicht?«
Nicht mehr. Er schüttelte den Kopf. Dabei schien der Boden in Schieflage zu geraten, als wäre die Welt ein kenterndes Schiff. Er stellte sich das Sonnensymbol auf seinem Rücken vor, gespalten von der Klinge, die ihm den Rücken aufgeschlitzt hatte, stellte sich vor, wie die beiden Hälften mit ihm davonschwebten, sich im Himmel endgültig voneinander trennten …
»Hey.« Mit den Fingern schnippte sie vor seinem Gesicht herum. Sie sah wütend aus, aber er wusste, dass es nur eine Maske war, hinter der sie ihre Angst verbarg. Genau wie damals, als sie sich zum ersten Mal in den Wald gewagt hatten. Sie waren noch Kinder gewesen und stundenlang umhergeirrt, bis …
»Wach. Auf.« Dieses Mal rüttelte sie ihn kräftig durch. »Bleib bei mir.«
Etwas griff über den Rand seiner Gedanken hinweg – ihre Präsenz strich kurz darüber und ihre Magie streckte sich nach seinem Geist aus.
»Lass das«, knurrte er.
Die Stimme lachte wieder in sich hinein, flüsterte etwas Hässliches, weit entfernt.
»Ich mache mir nur Sorgen.« Sie zog sich wieder zurück, doch die Furche zwischen ihren Augenbrauen vertiefte sich. »Ich war im Westen der Stadt. So viele Tote.«
So viele Tote.
Der junge Mann blinzelte das Bild der kleinen Gesichter weg, die aus zerbrochenen Fenstern gestarrt hatten.
»Wir müssen den Rückzug antreten«, sagte er. »Hier sind viel zu viele Stadtbewohner. Ich kann das Feuer unterwegs abziehen.«
»Ihre Anführer sind hier. Rückzug ist keine Option. Die Gelegenheit ist zu günstig.«
Beinahe hätte er gelacht. Bitter, hässlich und freudlos. »Gelegenheit? Nein, das hier ist –«
»Es war ihre Entscheidung, das hier loszutreten, in einer ihrer Städte«, spie sie die Worte geradezu aus. »Wenn sie unbedingt in ihre eigenen Betten scheißen wollen, dann können sie sich auch reinlegen.«
Es traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Er war sich nicht sicher, ob es an ihrer Hartherzigkeit lag oder an seinem Blutverlust, doch plötzlich wurde ihm übel.
»Das sind immer noch Zivilisten«, gab er zurück. »Rebellion hin oder her. Es sind Menschen.«
»Wir können immer noch etwas tun.«
»Ich wüsste nicht was.«
»Wir haben dich«, flüsterte sie, hob eine Hand und hielt sie neben seinen angespannten Kiefer. »Wir haben dich.«
Ihm wurde kalt, durch und durch. Er stand da, die Lippen leicht geöffnet, doch er fand keine Worte, die stark genug gewesen wären, um seinen Abscheu zum Ausdruck zu bringen. »Auf gar keinen Fall.« Mehr brachte er nicht zustande.
Ihr Mund wurde zu einer schmalen Linie. Hätte er darauf geachtet, dann hätte er vielleicht bemerkt, wie ihre sanften Finger zu seiner Schläfe wanderten und ihm Strähnen seines schwarzen Haars aus dem Gesicht strichen.
»Wir haben keine Wahl«, flüsterte sie. »Bitte.«
»Nein. Wir sind mitten in einer Stadt. Und …«
Und was? Und so vieles. Viel zu viel, um es in Worte zu fassen. Allein der Gedanke jagte ihm unzählige Eissplitter durch die Adern.
»Es tut mir leid«, sagte er leise. »Aber die Zerstörung wäre … Und ich …«
Es war das vermutlich erste Mal, dass er sich gegen das Interesse der Orden stellte. Aber er konnte an nichts anderes mehr denken als an diese Gesichtchen hinter den Fenstern.
Einen Moment lang sah sie aus, als wolle sie weiter in ihn dringen, aber dann veränderte sich ihr Ausdruck, wurde weicher. Ihre Lippen verzogen sich zu einem traurigen Lächeln. »Dieses weiche Herz wird dich irgendwann noch das Leben kosten.«
Vielleicht, dachte der junge Mann.
{Wahrscheinlich}, flüsterte die Stimme.
Langes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Dann sagte sie schlicht: »Ich bin deine befehlshabende Offizierin.«
Beinahe zweifelte er an seinem Verstand, fragte sich kurz, ob er richtig gehört hatte. »Du bist … was?«
Gelächter huschte durch seine Gedanken, verspottete die Furcht, die sich um sein Herz schloss.
»Targis ist tot. Ich habe es gesehen.« Ihre hellen Augen sahen zu ihm hoch. Flammen spiegelten sich in dem feuchten Film darüber – der alleinige Verräter ihrer Gefühle. »Da er nicht mehr da ist, bin ich jetzt deine befehlshabende Offizierin. Und ich befehle dir, deine Fähigkeiten auszuschöpfen.«
Ihre Worte rissen ihn entzwei, es fühlte sich an, als hätte ihm jemand das Rückgrat aus dem Körper gerissen. »Nura …«
»Ich befehle es dir.«
Erst jetzt bemerkte er ihre Hand an seiner Schläfe. Spürte, wie ihre Magie tiefer griff, in seine Gedanken hinein, bis zu der Tür, die er zugeknallt hatte, zugenagelt, verriegelt …
»Nein.«
Nur dieses eine Wort konnte er herauspressen, zittrig und keuchend, alle anderen erstarben ihm in der Kehle, während sie immer tiefer in seinen Geist eindrang.
Dabei hatte sie ihm geschworen, genau das niemals zu tun.
Mit allen verbliebenen Kräften stemmte er sich gegen seine mentalen Mauern, doch so stark wie sie würde er auf diesem Gebiet niemals sein. Ihre Magie wurde aus der Welt der Gedanken und Schatten geboren, während seine eher den unverborgenen Mächten und dem Licht zugewandt war. Vor allem jetzt, da ihm mehr und mehr Blut den Rücken hinunterrann und diese Kreatur in seinem Inneren sich so verzweifelt herauskämpfen wollte.
»Hör auf …« Ein Schwall aus Schmerz nahm ihm kurz die Sicht. Er spürte, wie sie die Tür aufzwang, sie aus den Angeln hob und beiseitewarf.
Ihre Lippen formten die Worte »Tut mir leid«, aber sollte sie sie laut gesagt haben, dann konnte er es nicht hören.
{Wie süß}, flüsterte die Stimme und klang so nah und so echt, dass ihm eine Gänsehaut über das Ohr lief. {Du gibst dir immer so viel Mühe.}
Fick dich.
Seine Finger spreizten sich. Dann ballte er die Hände zu Fäusten und entließ eine Kakofonie aus lautem Knacken.
Hätte er sprechen können, dann hätte er gesagt, dass er ihr das hier niemals – niemals – vergeben würde.
Doch er konnte nicht sprechen. Er konnte nichts tun, als sich immer wieder gegen seine eigenen mentalen Mauern zu werfen, wieder und wieder, in dem verzweifelten Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen.
Auch dann noch, als sie immer weiter aus seiner Reichweite glitt.
Auch dann noch, als er die Fäuste öffnete und geblendet wurde von Feuer, Feuer, Feuer.
AUF DER ANDEREN SEITE DES MEERES
Das kleine Mädchen war erstaunt, wie ruhig alles ablief.
Die Sklavenhändler waren mitten in der Nacht gekommen und hatten ihr kleines Dorf aus einem tiefen Schlummer gerissen. Wie bei den meisten Mitgliedern ihrer Gemeinschaft drehten sich auch ihre Albträume um genau diesen Moment. Irgendwann war er zu einer allgegenwärtigen Bedrohung geworden, die immer in ihrem Hinterkopf lauerte.
Doch die Wirklichkeit war anders als die Albträume.
In ihrer Vorstellung war es immer viel lauter gewesen – da waren mehr Schreie, mehr Rufe, mehr Kampfgeräusche. Doch die Männer mit den breitkrempigen Hüten und ihre Söldner hatten zuallererst die jüngsten und stärksten Männer überwältigt, sie in ihren Betten gefesselt, sodass sie gar nicht erst Schwierigkeiten machen konnten. Und selbst diejenigen, die sich wehrten, machten dabei erstaunlich wenig Geräusche. Kaum mehr als gedämpftes Ächzen und das Scheppern stumpfen Stahls auf Stahl war von ihren Kämpfen zu hören, die erschreckend schnell mit einigen letzten, zitternden Atemzügen endeten.
Die Mutter des Mädchens, die Anführerin der Dorfgemeinschaft, hatte kein Wort mit ihr gesprochen, nachdem sie von Hufgetrommel und dem Weinen der Frauen geweckt worden waren. Nur eine ruhige Hand auf der Schulter des Kindes spendete ein wenig Trost. Als sie hinausgegangen waren, hatte sie nur einen Blick auf ihr Dorf werfen müssen – auf ihr Volk oder was davon noch übrig war nach dieser blitzartigen Zerstörung –, ehe sie mit den Sklaventreibern in Verhandlungen trat.
Das Mädchen war kaum älter als dreizehn, trotzdem wusste sie, dass ihre Mutter nur versuchte, ihr Volk vor dem Schlimmsten zu bewahren. Sie wusste auch, dass es nichts bringen würde. Abgesehen von ihrer Mutter, die ein paar knappe Anweisungen flüsterte, sprach niemand ein Wort.
Bis das Mädchen vortrat, zu einem der Sklaventreiber hochsah, in seine dunkel aufblitzenden Augen, und sagte: »Für mich bekommt ihr einen besseren Preis.«
Die Worte schlüpften ihr über die Lippen, ehe sie selbst richtig begriff, was sie da tat. Der Sklaventreiber sah nicht so angsteinflößend aus, wie sie ihn sich vorgestellt hätte. Er war klein und ziemlich dick. Sein langer Ledermantel war zerknittert und spannte über seinen massigen Schultern, und er spannte noch ein wenig mehr, als er sich herunterbeugte, um sie genauer anzusehen. Sie wusste, dass er ihre ungewöhnliche Erscheinung musterte: ihre Haut und ihre Haare, die fast vollständig weiß waren, jeder Farbe entzogen, bis auf einige Flecken, die sich über ihren Körper zogen und von ihrer eigentlichen Hautfarbe zeugten, und ein paar dunkle Strähnen, die sich unter das silbrige Haar mischten. Ein Auge war grün, das andere weiß.
Sie hörte, wie ihre Mutter hinter ihr einen Schritt machte, als wolle sie sie aufhalten.
Doch sie drehte sich nicht um.
»Für mich bekommt ihr einen besseren Preis«, wiederholte sie. Es kostete sie alle Kraft, mit fester Stimme zu sprechen. Sie konzentrierte sich auf das wabbelnde Kinn des fetten Sklavenhändlers. Ein Tentakel ihres Geistes streckte sich nach seinem aus, lauschte auf einen Nachhall seiner Gedanken. Seine Gier lag wie beißender Schweiß in der Luft.
»Wenn du vollständig wärst, vielleicht«, brummte er. Dabei nahm er eine ihrer weißen Strähnen zwischen die Finger, dann hob er ihr Kinn an, drehte ihr Gesicht und betrachtete den braunen Fleck, der sich über ihre rechte Wange zog. »Aber das hier …«
»Was ist los?« Ein weiterer Sklavenhändler kam dazu, er knautschte seinen schwarzen Hut in der einen Hand, während er sich mit der anderen den Schweiß von der Stirn wischte. Dieser Mann war dünn, hatte knubblige Gelenke und eingefallene Wangen. Wie lustig die beiden nebeneinander aussahen. Der Dicke und der Dünne. Der Große und der Kleine. Wie Witzfiguren. Nicht wie Monster.
»Sieh dir die hier mal an.«
»Sie ist fragmentiert. Keine echte Valtain. Und sowieso zu jung für eine Hure.«
Der fette Sklavenhändler zuckte mit den Schultern. »Da gehen die Meinungen auseinander.«
Selbst mithilfe ihrer Magie nahm das Mädchen nur selten auch nur einen Hauch der fest verzurrten Emotionen ihrer Mutter wahr. Bei diesen Worten jedoch traf sie eine Mischung aus Wut und Panik wie ein Donnerschlag.
Doch noch immer drehte sie sich nicht um.
»Sie ist wertlos«, sagte der dünne Sklavenhändler. »Sie müsste schon vollständig sein.«
Worte verhedderten sich in der Kehle des Mädchens. Schon wandten die Männer sich von ihr ab, sahen hinüber zu ihren Söldnern, die am Dorfeingang Männer in Eisen legten. Panisch öffnete sie die Hände und ein Schmetterling aus Licht flog ihr aus den Handflächen, schlug mit den Flügeln und flatterte dem dicken Sklaventreiber ins Gesicht.
»Seht«, sagte sie verzweifelt. Ein weiterer Schmetterling. Und noch einer. »Ich bin eine Beschwörerin. Damit kann ich auf einer Bühne auftreten. Ihr bekommt einen guten Preis für mich. Mehr als in den Minen.«
Die beiden Sklavenhändler sahen zu, wie die Schmetterlinge sich in die Lüfte schwangen und vor dem hell leuchtenden, silbernen Mond verschwanden. Sie sahen sich an, stimmten sich wortlos ab.
»Sie wird mal ziemlich hübsch, irgendwann«, sagte der Fette bedächtig. »Jung, aber … kauft man unreifes Obst auf dem Markt?«
Der dünne Sklaventreiber verschränkte die Arme vor der Brust und musterte sie so eindringlich, dass sie das Gefühl hatte, Ameisen würden ihr die Wirbelsäule hochkrabbeln.
»Sie kann auch kochen. Sie ist sauber. Und sehr gehorsam«, ertönte die Stimme ihrer Mutter hinter ihr. Plötzlich war es viel schwieriger, nicht die Nerven zu verlieren.
Jetzt standen beide Männer mit verschränkten Armen da. Das kleine Mädchen sah zwischen ihnen hin und her.
»Na schön.« Der Dünne ließ die Arme sinken und stülpte sich den Hut wieder auf den Kopf. »Nehmt sie mit. Wir verkaufen sie in En-Zaheer an irgendeinen eitlen Pfau.«
»Wartet!«, rief das Mädchen, als der Sklavenhändler sie am Arm packte. »Meine Mutter muss auch mitkommen.«
Der Mann stieß ein höhnisches Geräusch aus, als wolle er sich nicht einmal zu einer Antwort herablassen.
»Bitte. Ich brauche sie. Sie …«
Die Augen des dünnen Mannes leuchteten auf und das Mädchen spürte, wie sein Ärger gerann wie saure Milch. Er öffnete den Mund, doch ehe er etwas sagen konnte, packte ihre Mutter sie an den Schultern.
»Sie ist jung und hat Angst«, erklärte sie hastig. »Sie weiß nicht, was sie sagt. Ich weiß, dass ich nicht mitkommen kann.«
Ihre Mutter drehte das Mädchen zu sich herum, die Hände noch immer fest auf ihren Schultern. Zum ersten Mal, seit dieser furchtbare Albtraum begonnen hatte, gestattete das Mädchen sich, ihrer Mutter in die Augen zu sehen. Sie hatten eine leuchtend bernsteingrüne Farbe, genau wie das rechte Auge des Mädchens. In diesem Bruchteil einer Sekunde prägte sie sich das vertraute Gesicht ihrer Mutter ein – die hohen, königlichen Wangenknochen, die dunklen Brauen über ihrem durchdringenden, festen Blick. Sie hatte ihre Mutter noch nie richtig verängstigt oder erschüttert gesehen. Und das änderte sich auch an diesem Tag nicht.
»Keiner von uns kann dir an den Ort folgen, an den du jetzt gehst, Tisaanah. Aber du hast alles, was du brauchst, um zu überleben. Und, hör mir gut zu: Nutze es.«
Das Mädchen nickte. Tränen brannten in ihren Augen.
»Sieh niemals zurück. Und lass dir niemals einreden, du solltest nicht vortreten und sagen: ›Ich verdiene das Leben.‹«
»Du verdienst das Leben«, wimmerte das Mädchen. Die Minen waren ein Todesurteil. Das wusste jeder.
Ein Anflug von Zweifel und Bedauern huschte über die Züge ihrer Mutter. »Nein«, sagte sie und wischte dem Mädchen die Tränen aus den Augenwinkeln, ehe sie fließen konnten. Das war alles. Als letzten Abschied drückte sie ihrer Tochter nur die Lippen auf die Stirn.
Dann richtete sie sich auf und hob das Kinn. Sie sah von einem Sklaventreiber zum anderen, dann auf ihr Volk, das mit Seilen gebunden und in Ketten gelegt in einer Reihe dastand. Nie hatte sie mehr wie eine Königin gewirkt, nobel und atemberaubend, obwohl sie in diesem Moment die Hände ausstreckte, um sich ebenfalls fesseln zu lassen.
Der fette Sklavenhändler nahm das kleine Mädchen mit, zerrte sie zu einem Wagen, während der dünne Mann das ganze Dorf abführte. Das Mädchen saß zwischen Getreidesäcken und Kisten voll billiger Händlerware, den Rücken gegen die rauen Bretter gedrückt. Bald waren ihre Freunde und ihre Familie nur noch silbrig schimmernde Silhouetten in der Ferne – eine lange Reihe, aufrecht, die Köpfe hocherhoben und die unverkennbare Gestalt ihrer Mutter vorneweg.
Hinter ihnen brannte das Dorf in grellorangen Flammen.
Sie hätte niemals gedacht, dass es so schnell gehen würde – so ruhig. In nicht einmal einer Stunde hatte sich ihr ganzes Leben verändert, war über Nacht zerfallen wie einer ihrer schimmernden Schmetterlinge.
»Keine Tränen für deine Mutter, was?« Einer der Söldner warf ihr einen Blick über die Schulter zu und stieß die Luft durch die Nase aus. »Kaltherzig.«
»So sind die alle«, bemerkte der Sklaventreiber sachlich. »Nicht besonders sentimental.«
Das ist eure Schuld, wollte das kleine Mädchen schreien. Ihr habt euch geweigert, sie mitzunehmen. Sie wollte brüllen, sie wollte schluchzen. Sie wollte sich auf den schmutzigen Boden dieses Wagens fallen lassen, wollte mit ihren nutzlosen Fäusten auf dem Holz herumhämmern, wollte weinen bis zur Erschöpfung.
Doch stattdessen blieb sie ganz still, drückte den Rücken durch und hob das Kinn, mimte die steinerne Stärke ihrer Mutter. Sie biss sich so fest auf die Unterlippe, dass ihr der Geschmack von Eisen warm über die Zunge floss. Der Kuss ihrer Mutter brannte sich in ihre Stirn ein.
Du hast alles, was du brauchst, um zu überleben, hatte sie gesagt. Das Mädchen besaß nichts als das verschwitzte Nachthemd an ihrem Leib, doch sie war sich ihrer Waffen bewusst. Auf dieser langen, dunklen Fahrt in die Stadt zählte sie sie, wieder und wieder. Sie hatte ihre ungewöhnliche Erscheinung, die eines Tages vielleicht begehrenswert wäre. Sie konnte gut zuhören und lernte schnell. Sie hatte ihre Magie – silberne Schmetterlinge und hübsche Trugbilder, ja, aber viel wichtiger war: Sie konnte erspüren, was andere von ihr wollten.
Und das Wertvollste war das Geschenk, das ihre Mutter ihr gemacht hatte: die Erlaubnis, zu tun, was auch immer nötig wäre, um zu überleben. Ohne Entschuldigung, ohne Reue. Also würde sie alles tun, was nötig wäre, nur eines nicht: weinen.
KAPITEL EINS
ACHT JAHRE SPÄTER
Eins, zwei, drei …
Ich musste noch immer mitzählen.
Denn leider war ich eine miserable Tänzerin. Falls es so etwas wie Talent überhaupt gab, ich besaß es ganz sicher nicht. Jedenfalls nicht fürs Tanzen. Doch Talent – das hatte ich begriffen – war ohnehin zweitrangig. Es ließ sich wettmachen durch lange Nächte und frühes Aufstehen, blutende Füße und manisch eingeprägte Schrittfolgen.
Wozu brauchte man Talent, wenn man bereit war, rohe Gewalt anzuwenden? Und dazu war ich mehr als bereit, trotz meiner schmächtigen Erscheinung und des harmlosen Lächelns unter meinen Rehaugen.
… vier, fünf, sechs …
Drehung.
Und – Feuer.
Ich lächelte den Kaufmann an, der vor mir saß, öffnete die Handflächen und ließ blaue Flammen zwischen meinen Fingern hervorzüngeln. Esmaris’ Gästen entschlüpften entzückte »Ooohs« und »Aaahs«. Mehrere Hundert Personen tummelten sich in der großen Marmorhalle, alle in ihre feinste Kleidung gehüllt. Viel Goldfaden und fließender, durchscheinender Chiffon. Viel Weiß. Reiche Leute liebten weiße Kleidung, vielleicht, weil sich damit zur Schau stellen ließ, dass sie sich eine kleine Sklavenarmee leisten konnten, die dafür sorgte, dass sie auch weiß blieb.
All die weiß gekleideten Körper wandten sich nun mir zu, ganz hingerissen, als ich einen Schwall meiner durchsichtigen Schmetterlinge auf das Publikum losließ. Vier Dutzend flatterten hinauf zur hohen Decke und verschwanden, verpufften zu kleinen blauen Rauchwölkchen.
Alle bis auf drei.
Diese drei Schmetterlinge flatterten zu drei Männern im Publikum, umkreisten ihre Köpfe und streiften ihre Wangen, ehe auch sie verschwanden.
Die drei Männer zuckten zusammen, als die Schmetterlinge sich ihnen näherten, dann lachten sie mehr oder weniger begeistert auf, als sie merkten, dass die Berührung sich nur wie ein Lufthauch anfühlte. Die Blicke der drei waren die ganze Zeit fest auf mich geheftet und mir war klar, dass sie nur auf eine Gelegenheit warteten, mir Münzen zuzuwerfen.
Ich konzentrierte mich auf den jüngsten, einen Kaufmann, der höchstens ein paar Jahre älter sein konnte als ich. Neureich und noch jung. Also musste er sich beweisen. Ich machte ein paar Tanzschritte auf ihn zu, streckte verführerisch die Finger nach ihm aus und damit auch die Tentakel meines Geists – um auf seine Gedanken zuzugreifen, seine Vorlieben zu erspüren. Wie sich herausstellte, interessierte er sich kein bisschen für mich, sondern viel mehr für Serel, einen von Esmaris’ besser aussehenden Leibwächtern, der in einer Ecke der Halle stand.
Nicht weiter schlimm. Er musste mich ja nicht flachlegen wollen, um mir dienlich zu sein. Eigentlich machte es das sogar leichter – er würde seine Männlichkeit beweisen wollen, seine Begierde für eine spärlich bekleidete Tänzerin wie mich statt für einen spärlich bekleideten Wächter wie Serel. Und er würde ganz sicher nicht nach dem Tanz mit mir allein sein wollen.
Die Harfe klimperte weiter, doch ich hätte die Musik überhaupt nicht gebraucht. Ich spulte nur meine einstudierten Tanzschritte ab. Meine Füße bewegten sich automatisch weiter, während ich dem Kaufmann meine Arme um den Hals schlang.
»Ich habe hier wohl etwas vergessen«, schnurrte ich, strich mit den Fingerspitzen an seiner Wange entlang und beschwor einen weiteren glitzernden Schmetterling herauf. »Er mag Euch. Würdet Ihr ihn gern behalten?«
Der junge Mann lächelte. Er sah gut aus, hatte braune Locken und große bernsteinfarbene Augen, die von beneidenswert langen Wimpern umrandet waren.
Er und Serel würden ein hübsches Paar abgeben.
»Liebend gern«, antwortete er und starrte mich ein wenig zu eindringlich an, doch seine Gedanken verrieten mir, dass er an dem Schmetterling überhaupt kein Interesse hatte. Dafür umso mehr daran, mit all den unvorstellbar reichen und unheimlich erfolgreichen Menschen in diesem Raum mithalten zu können – sogar mit Esmaris selbst. Er hob eine Hand, als wolle er den leuchtenden Schmetterling entgegennehmen, doch ich machte eine Drehung und lächelte ihn kokett an.
»Und was gebt Ihr mir dafür?«
Über die Schulter des jungen Mannes erhaschte ich einen Blick auf Esmaris. Seine leuchtend rote Kleidung stach in dem Meer aus Weiß hervor. Er hatte es gar nicht nötig, seinen Reichtum und seinen Status durch seine Kleidung zu demonstrieren. Auch ohne das leuchtende Rot hatte er etwas an sich, das ihn von der Menge abhob. Eine gelassene, gebieterische Haltung, als erwartete er, dass die Welt sich ihm beugte. Was sie für gewöhnlich auch tat.
Gerade unterhielt er sich mit einem seiner Gäste und sah etwas gelangweilt aus. Seine Haare – schwarz, aber von Grau durchzogen – waren zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden, wobei er sich eine ungezähmte Strähne immer wieder hinters Ohr streichen musste. Mitten in der Bewegung hob er den Kopf und unsere Blicke trafen sich, nur für den Bruchteil einer Sekunde, dann wandte er sich ungerührt wieder seinem Gast zu.
Gut. Eigentlich war er nicht besitzergreifend, aber Vorsicht war besser als Nachsicht.
»Meine Bewunderung hast du bereits«, sagte der junge Kaufmann und ich musste mich schwer beherrschen, um nicht die Augen zu verdrehen.
»Die ist in der Tat einiges wert«, säuselte ich. »Aber dieses Schätzchen hier auch, nicht wahr?« Mit bebenden Flügeln saß der Schmetterling auf meiner Fingerspitze. Ich schloss ihn in meiner Hand ein, und als ich sie wieder öffnete, lag dort eine kleine gläserne Version meines Trugbilds. Einen Moment lang betrachtete ich sie ebenfalls bewundernd, sogar ein wenig stolz. Diesen Trick hatte ich noch nicht lange im Repertoire.
Der Mann hob die Augenbrauen und ich spürte die Wellen seiner Überraschung, die sich zwischen uns ausbreiteten.
»Für Euch.«
»Das ist ja unglaublich.« Das gefällige Lächeln des Mannes wurde breiter und zu einem richtigen Grinsen. In diesem ehrfürchtigen Blick konnte ich erahnen, wie er als Kind ausgesehen haben mochte, bezaubert von einem Zirkusakrobaten oder einer glänzenden Kugel. Als unsere Blicke sich wieder trafen, spürte ich kurz eine aufrichtige Verbindung zwischen uns.
Dann zog er ein paar Münzen aus der Hosentasche. »Für dich.« Er nahm den gläsernen Schmetterling aus meiner Hand und legte fünf Goldmünzen an seine Stelle.
Fünf.
Goldmünzen.
Einen Moment lang blinzelte ich sprachlos darauf hinunter. Ich war nicht dämlich – natürlich gab es einen Grund dafür, dass er die Münzen vor aller Augen so laut in meine Hand klimpern ließ. Das war verwegen, fast schon dreist – mir Geld zuzustecken, ohne auch nur einen um Erlaubnis bittenden Blick auf Esmaris zu werfen, vor allem bei dieser Summe. Viele wollten nicht, dass ihre Sklaven überhaupt Geld besaßen, und vor allem nicht, dass dieses Geld von anderen Männern kam. In beiden Fällen war Esmaris recht freigiebig, aber mit fünf Goldmünzen tanzte man wirklich gefährlich nah am Abgrund jedweder Schicklichkeit.
Eintausendundzwei.
Ich hatte nicht erwartet, die Summe an diesem Abend zu erreichen, auch nicht am nächsten oder übernächsten. Ich konnte mich glücklich schätzen, wenn ich eines von Esmaris’ Festen mit zehn Silbermünzen verließ.
Eintausendundzwei. Eintausendundzwei.
»Ich danke Euch«, presste ich hervor und vergaß ganz, ihn weiter kokett anzusehen. Ich schloss die Hand um die fünf Goldmünzen, machte mir genüsslich ihr Gewicht bewusst und ließ sie in den winzigen seidenen Geldbeutel an meiner Hüfte gleiten. »Danke.«
Der Mann lächelte und nickte mir zu, nicht ahnend, was er da gerade für mich getan hatte.
Freudige Erregung sprudelte in mir auf. Einen Moment lang verlor ich mich ganz darin. Dann klimperte die Harfe lauter, beinahe hätte ich meinen Einsatz verpasst.
Am liebsten hätte ich einen Luftsprung gemacht, ein paar Pirouetten gedreht und laut gelacht. Aber meine Vorstellung würde noch mehrere Stunden dauern. Also begann ich wieder zu zählen.
Eins, zwei, drei, vier …
Ehe ich mit einer Drehung davonwirbelte, ließ ich meine Fingerspitzen noch einmal über die Wange des Kaufmanns gleiten und fuhr ihm durch die bewundernswert dicken Locken. Dabei schenkte ich ihm mein breitestes Lächeln. Während ich über den marmornen Boden glitt, fing Serel aus seiner Ecke meinen Blick auf und legte den Kopf schräg, stellte mir eine wortlose Frage. Zur Antwort grinste ich ihn nur an. Vielleicht würde er verstehen.
Eintausendundzwei.
Eintausend Goldmünzen waren der Preis für meine Freiheit.
KAPITEL ZWEI
Eintausend.« Serel wiederholte die Zahl, die schon die ganze Nacht in meinem Kopf umhergeisterte, und stieß einen bewundernden Pfiff aus. Er fuhr sich mit der Hand durchs blonde Haar, strich es sich aus dem Gesicht. »Du hast es geschafft. Wie hast du das nur gemacht?«
»Acht Jahre«, murmelte ich. Mehr zu mir selbst, denn ein Teil von mir konnte es immer noch nicht glauben. »Acht Jahre Arbeit.«
Ich verschränkte die Hände über dem Bauch und blinzelte zur Decke hoch. Serel und ich lagen vollkommen erschöpft auf dem Boden meiner bescheidenen Schlafkammer. Die Feier hatte erst in den frühen Morgenstunden geendet, und obwohl Serel sich natürlich am liebsten in sein eigenes Zimmer zurückgezogen hätte, um ins Bett zu kriechen, hatte ich ihn in mein Zimmer geschleppt. Ich musste es irgendjemandem erzählen und Serel war der Einzige, dem ich wirklich vertraute.
In dieser Nacht würde ich kein Auge zutun, das wusste ich bereits. Ich war so aufgeregt, dass meine Hände auch jetzt, Stunden später, immer noch zitterten. Einfach unerträglich, dass ich nicht noch in dieser Nacht mit Esmaris sprechen, den Haufen Gold auf seinem Schreibtisch abladen und ihm den Rücken kehren konnte. Womöglich hatte er erst in ein oder zwei Tagen Zeit für eine private Unterredung mit mir.
»Mir hat er nie gesagt, dass ich mich freikaufen könnte«, murrte Serel.
»Ich habe ihn gefragt.«
»Das war ja klar.«
»Na ja … eigentlich habe ich es eher verlangt.«
»Das war ja so was von klar.«
Ich gluckste leise. Damals war ich ungefähr ein Jahr in Esmaris’ Besitz gewesen. Ich hatte mich so reich gefühlt, als ich zum ersten Mal auf einem seiner Feste aufgetreten war und mir hier und da ein Gast ein paar Silbermünzen zugeworfen hatte. Im Laufe des Jahres sparte ich sie alle, bis ich die stolze Summe von fünfzig Silbermünzen zusammenhatte – eine ganze halbe Goldmünze. Für mich, ein kleines Dorfmädchen, das nur den direkten Handel kannte, war das eine unvorstellbare Summe gewesen. Sobald ich die fünfzigste Münze in Händen hielt, marschierte ich zu Esmaris, häufte ihm die Münzen in die Hände und verkündete, dass ich mich zurückkaufte. »Das ist sicher ausreichend«, sagte ich und achtete darauf, viel selbstbewusster zu klingen, als ich mich fühlte. Ich hatte bereits gelernt, dass im Leben alles inszeniert werden musste.
Jeder andere hätte mich für diese Nummer wahrscheinlich auspeitschen lassen. Erst rückblickend war mir peinlich bewusst geworden, welches Glück ich gehabt hatte, dass Esmaris mich schon immer wirklich gemocht hatte. Er hatte auf mich hinuntergesehen, ein leises Lächeln auf den Lippen, doch mit demselben stechenden Blick wie immer.
»Du bist viel mehr wert als fünfzig Silbermünzen, Tisaanah«, hatte er gesagt.
»Dann fünfundsiebzig«, entgegnete ich und er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Du bist eintausend Goldmünzen wert«, sagte er schließlich. »Das wäre der Preis für deine Freiheit.«
Damals konnte ich mir einen solchen Reichtum nicht einmal vorstellen. Selbst all die Jahre später fiel mir das noch schwer – auch jetzt noch, wo ich ihn tatsächlich besaß.
In den folgenden Jahren behielt ich den Sklavenhandel im Auge. Ich fand heraus, dass eintausend Goldmünzen für mich ein viel zu hoher Preis waren. Echte Valtain, mit makellos weißer Haut und vollständig silbrigem Haar, wurden mitunter für neunhundert verkauft.
Ich konnte noch so hart an meiner Magie und meinen Tanzschritten arbeiten, ich war und blieb nun einmal fragmentiert. Das eine grüne Auge und die Flecken goldbrauner Haut senkten meinen Wert beträchtlich. Doch meine Freiheit war mein höchstes Ziel, und wenn Esmaris eintausend Goldmünzen dafür wollte, tja, dann würde ich die eben besorgen müssen.
Und irgendwie hatte ich das ja auch geschafft.
»Er sah gut aus«, überlegte Serel laut. »Dieser Gast. Du hättest ihm später persönlich danken sollen.« Er fing meinen Blick auf und zwinkerte grinsend.
Ich schnaubte. »Das war doch alles nur Theater. Er hat sich viel mehr für dich als für mich interessiert.«
»Im Ernst?« Serel setzte sich ruckartig auf. »Warum hast du mir das nicht früher erzählt? So etwas passiert sonst nie!«
»In so etwas willst du dich doch nicht verwickeln lassen.«
»Doch, will ich!«
»Na schön. Tut mir leid. Ich war ein wenig abgelenkt.« Ich drehte den Kopf, um ihm in die müden blauen Augen zu sehen. »Aber zumindest weißt du jetzt Bescheid, falls er noch einmal hier auftaucht.«
»Der wird bestimmt nicht noch mal eingeladen, nach dieser Vorstellung«, sagte er wehmütig. Was vermutlich auch besser so war, das wussten wir beide, obwohl keiner es laut aussprach. Für unseresgleichen war es ein enormes Risiko, mit einem von den Reichen anzubändeln. Das hatte ich einst auf die harte Tour gelernt; belohnt worden war ich mit einem gebrochenen Herzen und zehn Peitschenhieben auf die hinteren Oberschenkel. Ich konnte noch immer jeden einzelnen Hieb an den Narben abzählen.
Aber sollte man Serel jemals mit einem wohlhabenden Mann erwischen? Tod. Keine Frage.
Eine Weile schwiegen wir. Ich dachte schon, Serel wäre schließlich doch weggedämmert, da fragte er leise: »Und jetzt? Die Orden?«
Ich nickte. »Die Orden.«
»Ehrlich gesagt«, flüsterte er, »hätte ich nie gedacht, dass du es wirklich schaffst.«
Ich auch nicht, wollte ich sagen, aber die Regeln, die ich mir selbst auferlegt hatte, gestatteten es mir nicht, Unsicherheiten laut auszusprechen.
»Ich bin stolz auf dich, Ti. Wenn es irgendjemand verdient hat …«
»Du hast es genauso verdient. Wir alle.«
Verdient. Wie ich dieses Wort hasste, obwohl ich mich schon so lange daran klammerte.
»Wir schaffen das schon.« Das klang so schlicht, so sachlich.
Ich setzte mich auf und schlug die Beine unter, betrachtete ihn, wie er dort lag, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Es fiel ihm immer so leicht, stets vom Guten im Menschen auszugehen. Anfangs dachte ich, das sei nur eine Maske, die er sich aufsetzte, so wie ich in meine Rolle als kokette Tänzerin schlüpfte und mir Selbstbewusstsein antrainiert hatte, bis es zu einem widerwilligen Teil meiner selbst wurde. Doch schon bald erkannte ich, dass vom Guten auszugehen tatsächlich sein Lebensmotto war. Obwohl seine Geschichte genauso blutig gewesen war wie meine.
Von Anfang an sah ich diese Güte in ihm. Ich hatte Esmaris auf einer kurzen Geschäftsreise in eine Nachbarstadt begleitet und hinter ihm gesessen, während Sklaven in langen Reihen über den Marktplatz geführt wurden. Ein einziges Grauen. Der Schmerz und die Furcht, die in der Luft lagen, waren unerträglich, bohrten sich mir in die Glieder, als würde ich den schlimmsten Tag im Leben Dutzender Menschen auf einmal erleben – und obendrein äußerst lebhaft auch noch einmal meinen eigenen.
Doch durch den Wirrwarr all dieser Emotionen fing Serel meinen Blick auf. Er war stehen geblieben, um ein junges Mädchen zu trösten – jünger, als ich es gewesen war, als ich so dagestanden hatte wie nun sie –, und obwohl er sich dafür einen wütenden Schrei und einen fiesen Hieb von einem der Sklaventreiber einhandelte, schenkte er dem Kind ein aufrichtiges Lächeln. Serel war hochgewachsen und muskulös, aber ich sah nur seine großen wasserblauen Augen, seine sanften, zierlichen Gesichtszüge, die fast kindlich wirkten.
Hätte Esmaris ihn nicht erstanden, dann hätte irgendeine Söldnerfraktion ihn gekauft. Er wäre zu einem der Männer geworden, die meine Familie aus den Betten gezerrt hatten, in jener Nacht vor all den Jahren. Und das konnte ich nicht zulassen.
»Was ist mit dem da?«, hatte ich Esmaris zugeflüstert. »Genau so jemanden habt Ihr doch gesucht.«
Sollte Esmaris misstrauisch gewesen sein, weil ich mich so für diesen gut aussehenden jungen Mann interessierte, ließ er sich nichts anmerken. Er dachte einen Moment nach, dann hob er die Hand und Serel gehörte ihm.
Die folgende Nacht verbrachte ich in Esmaris’ Bett, als erwartete er eine Entschädigung dafür, dass er meiner Bitte nachgekommen war. Aber das war es wert, denn Serel wurde schnell zum besten Freund, den ich je gehabt hatte – sowohl vor als auch nach meiner Versklavung.
Jetzt betrachtete ich meinen Freund mit einem Kloß im Hals, plötzlich übermannt von meinen Gefühlen. Kurz kam mir der Gedanke, ihm das Geld zu geben – seine Freiheit zu kaufen. Er war ein so viel besserer Mensch als ich. Er hatte es mehr verdient.
»Ich komme zurück, ja?«, flüsterte ich. »Um euch alle zu befreien. Dann habe ich Beziehungen und Mittel …«
Er streckte die Hand aus und tätschelte mir das Knie, als wüsste er, welche Schuldgefühle mir die Eingeweide zuschnürten. »Das weiß ich doch.«
SCHLIESSLICH KONNTE DER ARME SEREL kaum noch die Augen offen halten und ging in sein eigenes Zimmer, um endlich ein wenig zu schlafen. Auch ich war völlig erschlagen, trotzdem war an Schlaf nicht zu denken. Also schritt ich auf und ab.
Eine etwas schwindelerregende Angelegenheit, denn mein Zimmer war nur wenig größer als mein Bett. Aber immerhin war es sauber und ordentlich, ich hatte ein paar schöne Möbel und sogar ein wenig Zierwerk. Auf den Regalbrettern standen die kleinen Geschenke, die Esmaris mir manchmal von seinen Reisen mitbrachte. Meine wahren Schätze jedoch stammten alle von Ara.
Ara, eine Insel, Tausende Meilen entfernt und die Heimat der Zwillingsorden: des Ordens der Mitternacht und des Ordens der Morgendämmerung.
Ara, der Ort, an den ich mich begeben würde, sobald ich mir meine Freiheit erkauft hätte.
Dieser Gedanke – vielleicht auch das rastlose Auf-und-ab-Gehen, die Erschöpfung oder alles zusammen – löste ein schummriges Gefühl in mir aus. Ich ließ mich auf die Knie fallen und zog eine abgewetzte Holzkiste hervor, die ganz unten in meinem Bücherregal stand. Darin lagen ein paar Kleinigkeiten (ein Stein von Aras Strand, ein paar Fetzen Papier mit kreisförmigen Kritzeleien) sowie mehrere Bücher. Ich nahm das mit dem blauen Einband heraus, ganz schlicht, bis auf die glänzenden geprägten Insignien des silbernen Mondes und der goldenen Sonne.
Die Symbole der Orden.
Ich schlug das Buch auf und blätterte durch die Seiten, ließ die Fingerspitzen über die Bilder gleiten, die erhabene Tinte, die noch unvertraute Schrift, las im Flüsterton die aranischen Worte. Bei einer großen Abbildung über zwei Seiten hielt ich inne. Sie zeigte die Gründer des Ordens der Mitternacht und des Ordens der Morgendämmerung, Rosira und Araich Shelaene. Blaue und violette Wirbel umgaben Rosira, rahmten ihr weißes Haar vor der Silhouette des Mondes ein, Feuer umzüngelte Araich. In der Mitte, wo die Seiten gebunden waren, trafen sich ihre Handflächen.
Rosira repräsentierte die Valtain, Beschwörer mit weißer Haut und weißem Haar, die den Orden der Mitternacht bildeten. Und Araich stand für die Solarie, keine Valtain, aber ebenfalls Beschwörer, die sich zum Orden der Morgendämmerung zusammenschlossen. Ihre magischen Kräfte ergänzten und widersprachen sich gleichzeitig, wie zwei Seiten derselben Medaille.
Das Buch und meine anderen kleinen Schätze von Ara waren Geschenke von Zeryth Aldris, einem hochrangigen Mitglied der Orden, der auf seinen Reisen immer mal wieder für ein paar Tage in Esmaris’ Anwesen zu Gast war. Er hatte mich von Anfang an fasziniert. Noch nie hatte ich jemanden kennengelernt, der aussah wie ich selbst, obwohl seine Haut – im Gegensatz zu meiner – vollständig farblos war, genau wie sein Haar; er war durchweg Valtain. Wie ein verlorener Welpe lief ich ihm hinterher, aber er war immer freundlich und schien Gefallen daran zu finden, meine Neugierde zu stillen. Stundenlang hörte ich ihm zu, wenn er mir in gebrochenem Thereni Geschichten von den Orden und ihrer Vergangenheit erzählte.
Im Laufe der Tage, die Zeryth bei uns verbrachte, beobachtete ich auch, wie er sich unter Esmaris’ noble Herrschaften mischte. Ich sah, wie andere ihn anlächelten, sich ihm unterordneten, ihm mit demselben furchtsamen Respekt begegneten, den viele nur Esmaris selbst entgegenbrachten.
Da wurde mir etwas klar: Als Mitglied des Ordens der Mitternacht verfügte Zeryth über ganz eigene Mittel und Wege. Er erhielt Unterstützung und genoss Schutz. Und vor allem besaß er Macht.
All das brauchte ich, damit das Opfer meiner Familie nicht umsonst gewesen war. Damit ich etwas werden konnte.
»Könnte auch ich Mitglied bei den Orden werden?«, hatte ich Zeryth später gefragt und auf meine Hände hinuntergeschaut, auf die sandfarbenen Flecken, die sich über zwei meiner Finger zogen.
»Selbstverständlich«, hatte er geantwortet und mir ein strahlendes Lächeln geschenkt, bei dem mein vierzehnjähriges Selbst dahingeschmolzen war. »Fragmentiert oder nicht, du bist immer noch eine Valtain.«
Mehr Ermutigung brauchte ich nicht.
Von jenem Tag an verschrieb ich mich ganz diesem Ziel. Geradezu besessen fand ich mehr über die Orden heraus. Nachts lernte ich flüsternd Aranisch, brachte mir so viel wie möglich ihrer merkwürdigen, frustrierend komplizierten Sprache bei. Im Laufe der Jahre kam Zeryth immer wieder zu Besuch und jedes Mal brachte er mir kleine Geschenke von den Orden mit und ließ meine unaufhörlichen Fragen über sich ergehen.
Er hatte mir versprochen, dass er mich, wenn ich es nach Ara schaffte, den Orden vorstellen würde. Hoffentlich war er bereit, sein Versprechen einzulösen.
Ich erschauderte. Meine Hände über den vergilbten Seiten zitterten.
Nein. In dieser Nacht würde ich keinen Schlaf mehr finden, das war sicher.
Also wartete ich, bis sich die Dämmerung durch meine Vorhänge stahl. Ich sah mir noch einmal alle Bücher an, die Zeryth mir geschenkt hatte. Ich wiederholte jeden aranischen Satz, den ich kannte, und übte neue, bis sie sich auf meiner Zunge etwas vertrauter anfühlten. Ich füllte mein Hirn mit Plänen, bis kein Platz mehr war für Angst oder Unsicherheit.
Stunden. Es blieben nur noch ein paar Stunden, bis sich alles, was ich kannte, ändern würde.
Hoffentlich waren sie auf mich vorbereitet.
Und hoffentlich auch ich auf sie.
KAPITEL DREI
Man sollte meinen, nach all den Jahren hätte Esmaris’ Ehrfurcht einflößende Wirkung auf mich ein wenig nachgelassen. Acht Jahre hatte ich bei ihm verbracht und ich hatte ihn in durchaus kompromittierenden Stellungen gesehen – vermutlich öfter als jeder andere. Und trotzdem erstarrte ich manchmal noch in seiner Gegenwart, denn es kam mir immer so vor, als würde sogar die Luft sich vor ihm verneigen.
Einen solchen Augenblick erlebte ich jetzt.
Ich betrachtete seine Silhouette. Er stand hinter dem Schreibtisch vor dem Fenster seines Arbeitszimmers und hatte mir den Rücken zugewandt. Genau wie am Abend zuvor auf der Feier trug er Rot, dieses Mal eine Jacke aus dunklem burgunderfarbenem Brokat. Die Hände hatte er vor dem Bauch gefaltet, seine Schultern waren breit und kantig. Dieser Mann wahrte stets Haltung.
Er sah mich nicht an.
Ich redete mir ein, dass es keinen Grund gab, nervös zu sein. Das hier war ein simples Geschäft. Mehr nicht. Und auch nicht weniger. Serel stand auf seinem Posten vor der Tür, er war Esmaris’ Lieblingsleibwächter, während ich mich an das kurze, aufmunternde Lächeln klammerte, das er mir geschenkt hatte, ehe ich Esmaris’ Arbeitszimmer betreten hatte.
Trotzdem waren meine Hände schweißnass.
Sag doch etwas, dachte ich.
»Eintausend.« Als habe er meine Gedanken gehört. Doch noch immer drehte er sich nicht um. »Das ist beachtlich.«
»Deutlich mehr als die fünfzig Silbermünzen, die ich Euch beim ersten Mal geboten habe«, gab ich leichthin zurück, wobei mein Lächeln in meinem Tonfall mitschwang, zu meiner Erleichterung jedoch kein Anzeichen meiner Angst.
»In der Tat.« Endlich drehte sich Esmaris um und fixierte mich mit einem stechenden Blick aus seinen dunklen Augen. Seine ewig widerspenstige grau melierte Haarsträhne hing ihm vor einem dieser dunklen Augen. Das einzig Unbändige an ihm, denn ansonsten war seine Erscheinung – angefangen bei der Passform seiner Kleidung über den sorgfältig gestutzten Bart bis zu den glatt nach hinten gebundenen Haaren – makellos wie immer. Mittlerweile musste er fast sechzig Jahre alt sein, doch er hatte sich gut gehalten, wirkte noch immer viel jünger.
Ich streckte einen vorsichtigen Fühler nach den unausgesprochenen Worten zwischen uns aus, spürte seiner Reaktion nach, seinen Gedanken. Er war immer so schwer zu lesen, steinern und unnachgiebig. Doch hin und wieder konnte ich einen Schimmer seiner Gefühlslage erhaschen, vor allem, wenn er zufrieden mit mir war.
Aber jetzt? Nichts.
»Tatsächlich habe ich eintausendundzwei«, fügte ich hinzu. »Aber die zwei lege ich gern obendrauf, da Ihr so viel für mich getan habt.« Damit befand ich mich gerade noch auf dem Grat zwischen Witz und Wahrheit, zwischen Koketterie und Dankbarkeit. So konnte ich ihm gleichzeitig schmeicheln und ihn daran erinnern, warum er mich so gern mochte.
Keine Reaktion. Etwas, das ich nicht aus allzu großer Nähe betrachten wollte, regte sich in mir. Ich war verletzt – ein ganz kleiner Teil von mir hatte ihn aus irgendeinem Grund beeindrucken wollen.
»Ist es da drin?« Er zeigte mit dem Kinn in Richtung des Beutels, den ich mitgebracht hatte und der jetzt zu meinen Füßen lag. Er war erstaunlich schwer. Wie sich herausstellte, waren eintausend Goldmünzen eine ganze Menge Metall.
»Ja.«
»Zeig es mir.«
Folgsam trug ich den Beutel zu seinem Schreibtisch und öffnete ihn. Sobald der Beutel die Tischplatte berührte, packte er ihn und drehte ihn um, schüttete alle Münzen auf den Tisch. Hätte ich die Augen geschlossen, dann hätte es vielleicht wie tausend Glöckchen geklungen. Einige Münzen rollten von der Tischkante und fielen zu Boden.
In quälendem Schweigen standen wir da, bis das Klimpern verklang.
»Soll ich dich jetzt auffordern, sie zu zählen?«, fragte er.
»Wenn Ihr das wünscht. Es fehlt nichts.«
»Das ist eine beachtliche Summe. Was hast du dafür gemacht?«
Was ich dafür gemacht hatte? Vielleicht hätte er besser fragen sollen, was ich dafür nicht gemacht hatte. Ich hatte getan, was ich tun musste. Was ich tun konnte. »Ich habe mich verdient gemacht, wann immer möglich«, antwortete ich.
Und das war jetzt der Lohn. Auf manches war ich nicht stolz, aber selbst das war es am Ende wert. Ein befriedigtes Lächeln zupfte an meinen Mundwinkeln.
»Und was«, zischte Esmaris, »soll das heißen?«
Sofort schwand mein Lächeln.
Verdammt.
»Ich habe von Euch gelernt«, sagte ich aalglatt und ging einen Schritt vor, »dass ein Geschäft nur –«
»Du hast für dieses Geld gehurt.«
Sein Abscheu – seine Wut – durchschnitt die Luft mit solcher Wucht, dass er mir genauso gut ins Gesicht hätte schlagen können. Was für ein hässliches Wort! Und wie er es mir entgegenspuckte, einen Moment lang war ich sprachlos.
So hatte ich es selbst nie ausgedrückt. Es traf mich härter als erwartet.
»Nein, ich …«
Nur ein Mal. Ich schob diese flüsternde Stimme beiseite. Ich bereute keinen Moment, was ich getan hatte.
»Ich bin nicht dämlich, das wissen wir ja wohl beide. Anders hättest du gar nicht an so viel Geld kommen können.«
»Ich habe es mir erarbeitet. Wo ich konnte. Ich habe getanzt, beschworen und Böden geschrubbt …«
Das war die Wahrheit. Ich hatte dafür geschuftet. Und nur einhundert dieser Goldmünzen stammten aus jener Nacht. Die restlichen hatte ich mir mit unzähligen Stunden Schweiß erarbeitet.
»Dafür hättest du höchstens etwas Kupfer bekommen. Aber das hier? Pah«, sagte er mit so viel Nachdruck, dass Speicheltröpfchen meine Wange benetzten. »Ich habe dir erlaubt, dir beim Tanzen ein paar Silbermünzen dazuzuverdienen. Aber ich habe dir niemals gestattet, für Geld zu huren. Mich derart zu beschämen.«
»Das hätte ich Euch niemals angetan«, antwortete ich und tat gekränkt.
»Für eintausend Goldmünzen hättest du fünfzehn Jahre brauchen müssen«, sagte er gehässig. »Vielleicht sogar zwanzig.«
Fünfzehn Jahre.
In dem Moment begriff ich, dass Esmaris nie gewollt hatte, dass ich seinen absurden Preis jemals würde zahlen können – zumindest nicht, bis entweder ich ihm zu alt geworden war oder er zu alt, um noch Verwendung für mich zu haben.
Sein Zorn pochte in meinen Ohren, meinem Kopf, unter meiner Haut, aber langsam wurde er von meinem eigenen verdrängt.
»Ich habe Euren Preis bezahlt. Damit könnt Ihr Euch eine richtige Valtain kaufen, wenn Ihr wollt. Eine schönere und talentiertere als mich.«
»Sklaven feilschen nicht. Und ich brauche dein Geld nicht«, schnarrte Esmaris. »Du vergisst, wer du bist.«
Ein Stein fiel mir in den Magen.
»Ist dir eigentlich klar, wie gut ich dich behandelt habe?« Er richtete sich auf, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Stille. Er erwartete eine Antwort, aber plötzlich wagte ich nicht, den Mund zu öffnen.
Ich brauche dein Geld nicht.
Ich hatte diesen einen Plan gehabt. Doch Esmaris hatte dem Tempel meines großen Ziels das Fundament weggerissen und jetzt würde jeden Moment meine Seele unter den Trümmern begraben.
»Ob dir das klar ist?!«
»Ja, Esmaris.«
»Und dennoch.« Er senkte kaum merklich die Stimme. »Und dennoch hast du all das getan, um mich zu verlassen.«
Und dann wurde es mir klar. Die Luft stank geradezu danach, eine verborgene Unterströmung floss unter Esmaris’ Wut dahin.
Er war gekränkt.
Wir starrten einander an. Ich bemerkte die kleine Furche zwischen seinen Augenbrauen, die seine sonst immer so gut kaschierte Verletzlichkeit verriet.
Das war der Mann, der mir so viele Narben zugefügt hatte, der mir die Freiheit genommen, mich gebrochen, verbogen und geschlagen hatte. Aber es war eben auch der Mann, der meine Lieblingsfarbe kannte, der nach einem Albtraum stundenlang mit mir wach geblieben war. Der an dem Tag, als ich meine Freiheit einforderte, mit einer merkwürdigen Art Stolz auf mich hinuntergelächelt hatte.
Ich stützte mich mit den Handflächen auf seinen Schreibtisch, wobei die kalten Goldmünzen an meiner schweißnassen Haut kleben blieben.
Und ich sagte nur ein einziges Wort: »Bitte.«
Er betrachtete mich lange und ich bekam kaum noch Luft.
Bitte, tu das für mich. Wenn ich dir jemals wichtig war. Bitte.
Doch dann spürte ich, wie eine Tür zugeschlagen wurde, wie eine Decke aus Eis sich über Esmaris’ aufkommenden inneren Konflikt legte.
»Runter von meinem Schreibtisch. Auf die Knie.«
Ich brauche dein Geld nicht.
Große Götter, was sollte ich nur tun?
»Auf die Knie.«
Ich gehorchte so hastig, dass meine Knie schmerzhaft auf dem glänzenden Holzboden auftrafen.
Ich brauche dein Geld nicht.
Seine Stimme und das Zersplittern meiner Ziele klangen so laut in meinen Ohren, dass ich nichts anderes mehr wahrnahm.
Ich hörte nicht, wie die Schritte von Esmaris’ Stiefeln sich durch den Raum entfernten und wieder zurückkehrten, wie er sich hinter mir aufbaute.
Ich brauche dein Geld nicht.
Ich hörte nicht das tödliche Schnalzen.
Doch selbst durch meine vernebelte Wahrnehmung spürte ich den Schmerz, der sich über meinen Rücken zog, mich entzweizureißen schien. Unwillkürlich keuchte ich auf, wimmerte.
Knall.
Zwei.
Knall.
Drei.
Und es hörte und hörte nicht auf.
Knall. Knall. Knall.
Fünf. Zehn. Zwölf. Sechzehn.
Ich brauche dein Geld nicht.
Was sollte ich nur tun?
Ich weigerte mich, zu schreien oder auch nur zu weinen, ich biss mir so fest auf die Unterlippe, dass ich Blut schmeckte. Genau wie in jener Nacht vor vielen Jahren – in der Nacht, als ich meine Familie, meine Mutter, verlassen musste, weil sie glaubte, dass ich zu Größerem fähig war. Größer sein könnte.
Knall.
Zwanzig.
Doch sie hatte sich geirrt, denn Esmaris würde mich umbringen.
Im Nebel meines schwindenden Bewusstseins verfestigte sich dieser Gedanke langsam zur Gewissheit.
Er würde mich umbringen, weil ich einen groben Fehler begangen hatte. Naiv war ich davon ausgegangen, dass seine verdrehte Zuneigung mir bei meiner Flucht helfen würde. Stattdessen würde sie mich jetzt das Leben kosten, denn wenn Esmaris etwas nicht besitzen konnte, dann vernichtete er es lieber.
Ich fragte mich, ob Serel all das wohl hören konnte, durch die massive Tür. Ob er versuchen würde, mir zu helfen? Hoffentlich nicht. Denn dafür würde auch er bestraft werden.
Knall.
Fünfundzwanzig.
Esmaris würde mich umbringen. Dieser Mistkerl.
Ein Feuer entbrannte in mir. Als ich das Zischen der Peitsche hörte, weil Esmaris zum nächsten Hieb ausholte, warf ich mich auf meinen ohnehin schon brennend schmerzenden Rücken.
»Wenn du mich umbringen willst«, spie ich aus, »dann wirst du mir dabei in die Augen sehen müssen.«
Esmaris hatte den Arm über den Kopf gehoben, schon durchschnitt die Peitsche die Luft, eine grausame, kaltherzige Furche der Verachtung saß über seiner Nase. Seine Jacke war über und über mit meinem Blut bespritzt, es verschmolz mit dem burgunderroten Brokat. Kurz zeichnete sich Zögern auf seinem Gesicht ab, dann wandte er den Blick ab.
»Sieh mich an!«
Ich hatte es bis hierhin geschafft, ich würde jetzt nicht einfach wie eine erstickte Kerze in der Nacht erlöschen. Wenn ich jetzt starb, dann würde ich ihn heimsuchen.
Sieh mich an, du Feigling. Sieh mir in die Augen, in die Augen des jungen Mädchens, das du vor acht Jahren kennengelernt hast. Das junge Mädchen, das du gerettet und dann gebrochen hast.
Doch Esmaris schien nur noch weiter in seinem Hohn zu versinken, als könne er seine Schuldgefühle zum Schweigen bringen, indem er mich auslöschte.
Knall.
Sechsundzwanzig. Ich riss die Arme hoch, um mein Gesicht zu schützen, doch ich blinzelte nicht einmal, obwohl der Riemen mir beinahe die Nasenspitze abriss.
»Sieh. Mich. An.«
Jede Nacht wirst du meine Augen in der Dunkelheit sehen, jedes Mal, wenn du deine schließt, jedes Mal, wenn du das Mädchen ansiehst, das meinen Platz einnehmen wird …
Siebenundzwanzig. Meine Unterarme brannten. Dunkelheit kroch in mein Sichtfeld.
SIEH MICH AN.
Und dann hörte alles auf.
Mit einem Ruck senkte Esmaris den Kopf. Sein Arm erstarrte in der Bewegung. Sein Blick traf meinen, als hätte ich ihn mit einem Faden an meinem Finger auf mich gezogen, als hätte ich mit unsichtbaren Händen nach ihm gegriffen und ihn gezwungen, mich anzusehen.
Vollkommen verwundert begriff ich, dass ich seinen Geist im Griff hatte. Und für den Bruchteil einer Sekunde sah ich, spürte ich Verletzlichkeit in seinem Blick.
Es gab Millionen Momente, die ich in diesem Wimpernschlag in seinen Augen hätte sehen können. Momente, die ich mit einem Kerkermeister verbracht hatte, mit einem Liebhaber oder einem Vater, vielleicht auch mit einer verzerrten Kombination aus alldem.
Vielleicht hätte ich auch etwas empfinden können.
Doch ich dachte nur, wie zerbrechlich er sich in meinem unsichtbaren Griff anfühlte. Wie süß seine Angst auf meiner Zunge schmeckte, als ihm klar wurde – uns beiden klar wurde –, dass ich zu so viel mehr fähig war, als Schmetterlinge heraufzubeschwören.
Seine Angst verwandelte sich in Wut. Er entriss seinen Arm meinem Griff und hob die Peitsche, der Riemen durchschnitt die Luft …
Und ehe ich wusste, was ich tat, zog ich mit aller Kraft an diesem Faden zwischen uns.
Ein markerschütterndes Knacken erfüllte die Luft. Ich krümmte mich, erwartete die Peitsche, doch der Schmerz blieb aus.
Lautes Rumpeln. Ich öffnete die Augen und sah, wie Esmaris über einen Stuhl stolperte und vor mir auf die Knie fiel.
Dann kippte er vornüber. Hastig setzte ich mich auf, damit er nicht auf mich fiel. Beinahe hätte seine ausgestreckte Hand meine Wange gestreift, doch sie bekam nur eine Handvoll meiner langen silbrigen Haare zu fassen, packte zu mit einer Kraft, die aus dem Rest seines Körpers bereits gewichen war.
Benommen ließ ich mich zu Boden reißen. Instinktiv legte ich ihm haltsuchend die Hand auf die Brust.
Sieh mich an, hallte mein Befehl noch immer wider.
Wir gehorchten beide. Ich blinzelte nicht, wandte nicht den Blick ab, sah zu, wie der Zorn aus seinen Zügen tröpfelte und nichts als Traurigkeit zurückließ, die mir noch tiefer ins Fleisch schnitt als seine siebenundzwanzig Hiebe.
»Tisaanah …«
Serels Keuchen hörte ich kaum. Ich hob den Kopf und da stand mein Freund in der Tür. Die Hand am Heft seines Schwerts, starrte er mich entsetzt an.
Ich musste ein ziemlich eindrucksvolles Bild abgegeben haben: blutüberströmt und mit zerfetztem Rücken, den toten Körper des mächtigsten Mannes in Threll in meinen Armen haltend.
KAPITEL VIER
Gute Götter,was hat er dir angetan?« Serel legte mir die Hände auf die Schultern.
Ich antwortete ihm nicht. Noch immer sah ich in Esmaris’ leblose Augen. Sie starrten durch mich hindurch, an mir vorbei.
»Sieh mich an, Tisaanah.«
Sieh mich an. Sieh mich an. Sieh mich an.
Warme, schwielige Finger hoben mein Kinn an. Serels große wasserblaue Augen waren das genaue Gegenteil von Esmaris’ und ihr Anblick wirkte auf meine Seele wie ein Atemzug frischer Luft.
Das Einzige, was mir zu sagen einfiel, war: »Er ist tot.«
Serel warf einen Blick auf Esmaris. Er fragte nicht, was passiert war. Vielleicht sagten ihm der Haufen Goldmünzen auf dem Schreibtisch, mein Blut, die Peitsche und das Krachen, das ihn auf den Plan gerufen hatte, schon alles, was er wissen musste. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper, als er auf den Leichnam hinuntersah. Manchmal vergaß ich, dass mein wundervoller, sanftmütiger Freund mit dem Tod sehr vertraut war.
»Kannst du aufstehen?«
Ich nickte, rührte mich aber nicht. Esmaris’ Finger krallten sich noch immer in meine Haare. Mit zitternden Fingern löste ich seine Hand. Sie war so warm, dass ich glaubte, er würde jeden Augenblick wieder zupacken.
Ich hatte ihn getötet.
Ich hatte Esmaris getötet.
Ich!
Eine Welle der Angst überrollte mich, vertrieb alle Luft aus meiner Lunge.
Serel half mir auf. Unwillkürlich wimmerte ich, als der Schmerz in meinem Rücken aufflammte. Tränen stachen mir in die Augen, doch ich weigerte mich, sie überquellen zu lassen.
»Ich weiß«, murmelte Serel mit gepresster Stimme. »Ich weiß.«
»Was soll ich denn jetzt machen?«, fragte ich erstickt.
Ich hatte immer einen Plan, immer ein Ziel. Selbst in den finstersten Augenblicken meines Lebens hatte ich Möglichkeiten abwägen können. Jetzt konnte ich nicht einmal mehr klar denken. Oder atmen.
Ich würde niemals meine Freiheit wiedererlangen.
Esmaris war tot.
Alle würden sich denken können, dass ich ihn umgebracht hatte.
Man würde mich hinrichten.
Genau wie …
Ich sah Serel an. »Du solltest nicht hier sein. Sie werden es herausfinden, sie –«
»Schhh«, machte er, ein leises, tröstendes Geräusch. Mit zusammengepressten Lippen sah er von Esmaris zu mir, dann auf die Peitsche.
Denk nach, Tisaanah, herrschte ich mich selbst an. Denk nach. Das hier kann nicht, darf nicht das Ende sein.
Aber meine Gedanken waren nur noch Brei. Esmaris’ Augen hatten sich in meinen Geist eingebrannt, der Moment, in dem er stürzte, das Flüstern von Verrat, das in seinem Blick gelegen hatte.
Ich war so geistesabwesend, dass ich gar nicht mitbekam, wie Serel sein Schwert zog und es Esmaris in die Brust rammte. Das Geräusch riss mich zurück in die Gegenwart. Ein brechreizerregendes, feuchtes Knirschen, das ich – und das wusste ich schon in diesem Moment – nie wieder vergessen würde.
»Serel, was …?«
»Das Blut könnte von ihm sein. Jeder hätte ihn umbringen können. So weiß niemand, wer es war.« Serel zog die Klinge aus Esmaris’ Leichnam und ein Schwall Blut ergoss sich über den Boden.
Ich würgte und schluckte beißende Galle hinunter. Serel hob die Peitsche vom Boden auf, wickelte den Lederriemen um den Griff und hängte sie an ihren Platz im Schrank zurück, als wäre sie nie herausgenommen worden.
In meinem Kopf fügten sich langsam die Puzzleteilchen zusammen. Ich begriff, was er da tat. Was wir da taten.
Ich packte Serel am Handgelenk, meine Fingernägel gruben sich in seine Haut. »Das ist gefährlich. Du solltest nicht hier sein.«
»O doch. Wir bringen das hier in Ordnung.« Er schenkte mir ein Lächeln, das trotz meines blutüberströmten Rückens und des Leichnams zu unseren Füßen vollkommen ungekünstelt und echt wirkte. Einfach unglaublich. Dann musterte er mich von Kopf bis Fuß. »Deine Kleidung … Du musst dir etwas anderes anziehen. Warte hier, ich gehe schnell in dein Zimmer.«
Ich sah an mir hinunter. Ich war praktisch nackt. Die zerfetzte Seide meines Kleids wurde nur noch von wenigen Fäden zusammengehalten. Blut lief mir über den Rücken und die Beine hinunter.
»Ich habe ein paar Sachen hier. In seinem Schrank.«
Was ich nicht sagte: Bitte, bitte, bitte lass mich nicht mit ihm allein.