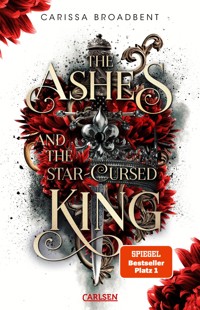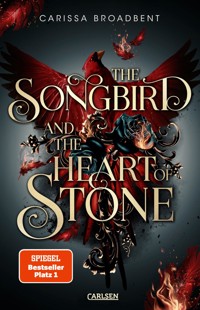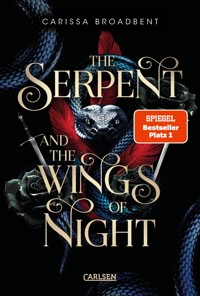
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vertraue keinem, gib niemals auf und hüte immer – immer – dein Herz! Du bist Beute in einer Welt von Raubtieren. Jeden Tag muss Oraya ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kejari: ein legendäres Turnier, das von Nyaxia veranstaltet wird – der Göttin des Todes. Damit Oraya überhaupt den Hauch einer Chance hat, muss sie ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen: Raihn. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind ihres Vaters. Doch am meisten Angst macht Oraya nicht das Kejari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Raihn hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich – wie eine düstere Vorahnung - ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Raihn versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein, in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe. Crowns of Nyaxia The Serpent and the Wings ist der erste Band einer Serie voller dramatischer Action, grandioser Twists und einer starken Heldin mit großen Gefühlen. Die New Adult Romantasy ist kein Standalone und spielt in einer düsteren Welt mit tödlichen Kreaturen, lauernden Gefahren und prickelnden Beziehungen. Idealer Stoff für Fans von Vampirromanen und Fantasy Romance. Knisternd, dunkel, fesselnd – der TikTok-Bestseller Erfolg von Carissa Broadbent!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Carissa Broadbent
The Serpent and the Wings of Night
Aus dem Englischen von Heike Holtsch und Kristina Flemm
Vertraue keinem, gib niemals auf und hüte immer – immer – dein Herz! Du bist Beute in einer Welt von Raubtieren.
Jeden Tag muss Oraya ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kejari: ein legendäres Turnier, das von Nyaxia veranstaltet wird – der Göttin des Todes.
Damit Oraya überhaupt den Hauch einer Chance hat, muss sie ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen: Raihn. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind ihres Vaters. Doch am meisten Angst macht Oraya nicht das Kejari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Raihn hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich – wie ein düstere Vorahnung - ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Raihn versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein, in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe.
Crowns of Nyaxia
The Serpent and the Wings ist der erste Band einer Serie voller dramatischer Action, grandioser Twists und einer starken Heldin mit großen Gefühlen. Die New Adult Romantasy ist kein Standalone und spielt in einer düsteren Welt mit tödlichen Kreaturen, lauernden Gefahren und prickelnden Beziehungen. Idealer Stoff für Fans von Vampirromanen und Fantasy Romance.
Knisternd, dunkel, fesselnd – der TikTok-Bestseller Erfolg von Carissa Broadbent
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Buch lesen
Vorbemerkung
Glossar
Triggerwarnung
Nachwort der Autorin
Danksagungen
Viten
VORBEMERKUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Carissa und das Carlsen-Team
PROLOG
Damals ahnte der König noch nicht, dass seine größte Liebe sein Untergang sein würde – auch nicht, dass beides in Gestalt eines kleinen, hilflosen Menschenkindes in Erscheinung treten würde.
Wie ein Häufchen Elend lag sie verlassen in all der Verwüstung da, die einzige Sterbliche im Umkreis von 100 Meilen, die noch lebte. Die Kleine war mindestens vier Jahre alt, allenfalls acht – schwer zu schätzen, so schmächtig wie sie war, selbst nach menschlichen Maßstäben. Ein schwächliches, kleines Etwas mit glattem schwarzem Haar, das ihr in die großen, grauen Augen hing.
Irgendwo in der Nähe, unter verkohlten Balken und Trümmern lag wahrscheinlich ihre bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Familie begraben. Vielleicht hatte man die geschundenen Körper auch einfach irgendwo liegen lassen und nächtliche Jäger hatten sie sich geholt. Solche wie die, die sich dem kleinen Mädchen gerade näherten und es so aufmerksam ins Visier nahmen wie ein Habicht ein wehrloses Kaninchen.
Mehr waren die Menschen in dieser Welt ja auch nicht – nur Beute, Ungeziefer, oder beides zugleich.
Die drei geflügelten Männer landeten ein Stück vor der Kleinen, mit einem Lächeln auf den Lippen angesichts dieses unverhofften Glücksfalls. Sofort versuchte sie sich von den Trümmern zu befreien. Wen sie da vor sich hatte, erkannte sie sofort an den spitzen Zähnen und den schwarzen, ungefiederten Flügeln. Vielleicht kannte sie sogar die Uniformen, in sattem Purpurrot, der Farbe des Hiaj-Königs der Nachtgeborenen. Vielleicht hatten die Männer, die ihr Elternhaus niedergebrannt hatten, die gleichen Uniformen getragen.
Doch sie konnte nicht weglaufen. Ihre zerrissene Kleidung hatte sich hoffnungslos in den Trümmern verfangen und um die Steinbrocken wegzuschieben, dafür war sie zu schmächtig.
»Was haben wir denn da? Ein kleines Lämmchen.« Die Männer näherten sich. Als einer nach ihr greifen wollte, fauchte die Kleine ihn an und schnappte mit ihren winzigen, stumpfen Zähnchen nach seinen Fingern.
Der Soldat zog mit einem zischenden Laut die Hand zurück, seine beiden Begleiter lachten nur.
»Ein Lämmchen? Wohl eher eine Schlange!«
»Oder eine Natter«, spöttelte der andere.
Der Soldat, den das Mädchen gebissen hatte, rieb sich die Hand und wischte ein paar dunkelrote Tropfen ab. Dann ging er auf die Kleine zu. »Was auch immer«, knurrte er. »Die schmecken sowieso alle gleich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ihr Bastarde, ich jedenfalls habe Hunger nach der langen Nacht.«
In dem Moment senkte sich ein Schatten über die Männer.
Alle drei erstarrten. Mit gesenkten Köpfen verbeugten sie sich ehrfürchtig. Ein kühler Luftzug umwehte ihre in Dunkelheit getauchten Gesichter, und rasiermesserscharfe Flügel streiften die Kehle eines der Soldaten.
Der Hiaj-König sagte kein einziges Wort. Das brauchte er auch nicht. Seine Anwesenheit reichte, um die Krieger verstummen zu lassen.
Er war nicht der stärkste der Vampire. Auch nicht der erbittertste Kämpfer oder der weiseste Gelehrte. Aber wie es hieß, war er von der Göttin Nyaxia selbst gesegnet, und alle, die ihm jemals begegnet waren, schworen, dass dem so war. Macht strömte aus jeder seiner Poren, und mit jedem seiner Atemzüge blies einem der Tod ins Gesicht.
Schweigend sahen seine Soldaten zu, wie er über die Trümmer des kleinen Häuschens stieg.
»Die Rishan sind aus dieser Gegend vertrieben worden«, wagte einer der Männer nach einer Weile zu sagen. »Unsere Leute sind nach Norden gezogen und …«
Der König hob eine Hand, und sogleich verstummte der Soldat.
Dann ging er vor der Kleinen in die Hocke. Wütend funkelte sie ihn an. Noch so jung, dachte er. Ihr Leben hatte gerade erst begonnen und war nichts im Vergleich zu den Jahrhunderten seines Daseins. Und dennoch starrte sie ihn voller Wut an, aus Augen, die so hell und silbrig schienen wie der Mond.
»Habt ihr sie hier gefunden?«, fragte der König.
»Jawohl, Sire.«
»Stammt die Wunde an deiner Hand von ihr?«
Kaum verhohlenes Feixen der beiden anderen Soldaten.
»Jawohl, Sire«, lautete die verschämte Antwort.
Offenbar dachten die Soldaten, der König wolle sich über sie lustig machen. Aber nein. Das Ganze hatte rein gar nichts mit ihnen zu tun.
Er streckte die Hand nach der Kleinen aus und sie schnappte nach ihm. Er ließ es geschehen – zog seine Hand nicht zurück, nicht einmal, als sich ihre Zähnchen, so winzig sie auch waren, in seinen knochigen Zeigefinger bohrten.
Ohne mit der Wimper zu zucken, sah sie ihm in die Augen. Mit wachsendem Interesse begegnete er ihrem Blick.
Das war nicht der Blick eines verängstigten Kindes, das keine Ahnung hatte, was es tat.
Es war der Blick eines Wesens, dem bewusst war, dass es den Tod höchstpersönlich vor sich hatte, und das dennoch den Mut besaß, ihm ins Gesicht zu spucken.
»Eine kleine Schlange«, sagte der König mehr zu sich selbst als zu seinen Soldaten.
Die Soldaten brachen in Gelächter aus. Doch das ignorierte er. Das hier war alles andere als ein Witz.
»Bist du ganz allein?«, fragte er ruhig.
Das Mädchen antwortete nicht. Solange ihre Zähne in seinem Fleisch vergraben waren, konnte sie ja auch gar nicht sprechen.
»Du brauchst mich nicht zu beißen«, sagte er. »Ich werde dir nichts tun.«
Doch die Kleine hörte nicht auf ihn, sondern blickte ihm weiter in die Augen, während schwarzes Blut von ihrem Kinn tropfte.
Die Mundwinkel des Königs verzogen sich zu einem Lächeln. »Richtig so. Du solltest mir nicht trauen.«
Er befreite seinen Finger, dann zog er das um sich schlagende Kind vorsichtig unter den Trümmern hervor. Selbst sein erbitterter Widerstand war stumm. Und erst als er es vom Boden aufhob – bei der Göttin, die Kleine war so leicht, dass er sie mit einer Hand hochheben konnte –, bemerkte er ihre schweren Verletzungen, die blutgetränkte, zerrissene Kleidung. Der süßliche Duft stieg ihm in die Nase, als er sie an seine Brust drückte. Sie war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren, doch auch dagegen wehrte sie sich, stemmte sich mit ihrem ganzen Körper dagegen.
»Ganz ruhig, kleine Schlange. Dir wird nichts geschehen.«
Er strich der Kleinen über die Wange, und sie wollte ihn schon wieder beißen, doch ein Funke von Magie strömte durch seine Fingerspitzen. Gegen den traumlosen Schlaf, der ihr dadurch eingeflüstert wurde, konnte sich selbst dieses kleine Biest nicht wehren.
»Was sollen wir mit ihr machen, Sire?«
Der König schritt an den Soldaten vorüber. »Nichts. Ich werde sie mitnehmen.«
Sekundenlanges Schweigen. Obwohl die Soldaten hinter ihm standen und er sie nicht sehen konnte, spürte der König geradezu die verwirrten Blicke, die sie einander zuwarfen.
»Wohin denn?«, fragte einer von ihnen schließlich.
»Nach Hause«, antwortete der König.
Das Kind schlief – und hielt mit seiner kleinen Faust den seidenen Stoff des königlichen Gewandes fest umklammert. Selbst im Schlaf kämpfte es noch immer gegen ihn an.
Nach Hause. Er würde das Kind mit nach Hause nehmen.
Denn der König der Hiaj-Vampire – Eroberer des Hauses der Nacht, gesegnet von der Göttin Nyaxia und einer der mächtigsten Männer, die jemals den Boden dieses und des nächsten Reiches betreten hatten – erkannte in dem Kind einen Teil seiner selbst wieder. Und wenn er das Kind betrachtete, regte sich etwas Warmes, Bittersüßes in seiner Brust. Etwas, das gefährlicher als Hunger war.
Hunderte Jahre später würden Geschichtsschreiber und Gelehrte auf jenen Moment zurückblicken. Auf diese eine Entscheidung, die eines Tages ein ganzes Reich zu Fall bringen würde.
Was für eine unverständliche Entscheidung, würden sie einander zuraunen. Warum hat er das getan?
Ja, warum?
Vampire wissen doch besser als jeder andere, wie wichtig es ist, ihre Herzen zu schützen.
Und Liebe, so muss man wissen, ist schärfer als jede Klinge.
KAPITEL EINS
Am Anfang war es bloß Training. Nur zum Spaß, um etwas fitter zu werden. Weil ich mir damit etwas beweisen wollte. Wann es zu einem Sport wurde – zu meinem inneren Aufstand –, wusste ich nicht mehr.
Manchen mag es leichtsinnig erscheinen, dass ich ausgerechnet nachts auf die Jagd ging, obwohl ich als Mensch gegenüber meiner Beute dann deutlich im Nachteil war. Aber die anderen gingen nachts auf die Jagd, also tat ich es auch.
Den Dolch fest umklammert, presste ich mich mit dem Rücken gegen die Wand. Es war eine warme Nacht, eine dieser Nächte, in denen die Glut der Sonne nach Anbruch der Dunkelheit noch in der stickig feuchten Luft hing. Wie eine dichte, faulige Wolke umwehte mich der Gestank nach verdorbenen Essensresten im Müll auf den Straßen, ja, auch das, aber ebenso nach verrottendem Fleisch und säuerlich riechendem Blut. Hier in den von Menschen bewohnten Bezirken im Herrschaftsgebiet des Hauses der Nacht machten sich die Vampire keine Mühe, hinter sich aufzuräumen.
Eigentlich sollte diese Schutzzone innerhalb der Grenzen des Königreichs für Menschen als sicher gelten – obwohl sie gegenüber den Nachtgeborenen als minderwertig galten. Aber angesichts dieser zweiten Tatsache verlor die erste nur allzu oft an Bedeutung.
Der Mann war ein Hiaj, seine Flügel hatte er dicht am Rücken zusammengefaltet. Offenbar hielt er nicht viel von Magie, sonst hätte er sie nämlich einfach verschwinden lassen können, um sich die Jagd leichter zu machen. Vielleicht ging es ihm aber auch genau um die Wirkung, die die Flügel auf seine Beute hatten. Manche waren solche Angeber und legten es darauf an, dass man Angst vor ihnen hatte.
Vom Dach aus beobachtete ich, wie der Mann sein Zielobjekt anvisierte – einen kleinen Jungen, etwa zehn Jahre alt, obwohl er eindeutig unterernährt und schmächtig wirkte. Der Junge spielte im eingezäunten, staubigen Hof eines Lehmhauses und trat einen Ball vor sich her. Er merkte nicht, dass ihm der Tod auflauerte.
Nachts allein nach draußen zu gehen war so schrecklich dumm von diesem Jungen. Andererseits wusste ich besser als jeder andere, wie es war in ständiger Gefahr aufzuwachsen. Vielleicht hatte die Familie in den letzten zehn Jahren Abend für Abend darauf geachtet, dass die Kinder im Haus blieben. Und dann reichte es, wenn die Eltern nur ein einziges Mal nicht aufpassten, weil sie mit etwas anderem beschäftigt waren und vergessen hatten, den Jungen wieder reinzuholen. Oder das Kind war trotzig und weigerte sich, zum Essen zu kommen. An nur einem einzigen Abend in einem ganzen Leben.
So etwas passierte oft.
Heute Abend würde jedoch nichts passieren.
Sobald sich der Vampir bewegte, bewegte ich mich auch.
Ich ließ mich vom Dach herunter auf das Kopfsteinpflaster gleiten. Nahezu lautlos, aber Vampire haben ein unfehlbares Gehör. Mit eiskaltem Blick drehte der Mann sich um und entblößte grinsend das scharf schimmernde Elfenbein seiner Zähne.
Hatte er mich erkannt? Manchmal erkannten sie mich. Aber bei diesem hier ließ ich es gar nicht erst so weit kommen.
Mittlerweile war es schon Routine. Eine Strategie, die ich in Hunderten solcher Nächte perfektioniert hatte.
Zuerst die Flügel. Zwei Schlitze, in jeden Flügel einen – das reichte, um ihn am Wegfliegen zu hindern. Bei Hiaj-Vampiren ging das ziemlich einfach. Die membranartige Haut war hauchdünn wie Papier. Manchmal geriet ich auch an Rishan-Vampire. Das war dann eher eine Herausforderung, denn ihre gefiederten Flügel waren nicht so leicht aufzuschlitzen. Doch ich hatte meine Technik schon verfeinert. Diese Maßnahme war notwendig, damit sie dicht bei mir auf dem Boden blieben, deshalb machte ich das immer zuerst. Nur ein einziges Mal beging ich den Fehler, nicht als Erstes die Flügel aufzuschlitzen, und diese Lektion hätte ich fast mit dem Leben bezahlt.
An Stärke konnte ich es nicht mit ihnen aufnehmen, also musste ich auf Präzision setzen. Kein Raum für Fehler.
Der Vampir gab ein Geräusch irgendwo zwischen schmerzhaftem Keuchen und wütendem Knurren von sich. Mein Herzschlag wurde zu einem rasanten Trommeln, mein Blut pulsierte dicht unter der Haut. Konnte er es riechen? Mein ganzes Leben lang hatte ich versucht, das Rauschen meines Blutes zu unterdrücken. Aber in diesem Moment kam es mir gerade recht. Es machte sie verrückt. Und dieser Trottel hier war nicht mal bewaffnet. Trotzdem stürzte er sich auf mich, als könne ihm nichts in der Welt etwas anhaben.
Das gefiel mir – es gefiel mir immer richtig gut, wenn sie mich unterschätzten.
Die eine Klinge jagte ich in seine Flanke, unterhalb der Rippen. Die andere in den Hals. Das brachte ihn noch nicht um, aber es ließ ihn taumeln.
Ich stieß ihn gegen die Wand, ein weiterer Stich legte ihn lahm. Ich hatte die Schneiden mit Dhaivinth eingerieben – einem Mittel, das lähmend wirkte. Die Wirkung war stark, aber nur von kurzer Dauer. Sie würde nur für ein paar Minuten anhalten, aber mehr brauchte ich gar nicht.
Er verpasste mir mit seinen rasiermesserscharfen Fingernägeln bloß ein paar Kratzer im Gesicht. Mehr schaffte er nicht, bevor seine Bewegungen erlahmten. Und als ich sah, dass seine Augenlider flatterten, so als wolle er sich mit aller Kraft wach halten, stach ich zu.
Du musst richtig fest zustoßen, um durch das Brustbein zu kommen.
Fest genug, um den Knochen splittern zu lassen und eine Schneise zu seinem Herzen freizulegen. Vampire waren mir in jeder Hinsicht überlegen – ihre Körper muskulöser, ihre Bewegungen schneller, ihre Zähne schärfer.
Aber ihre Herzen waren genauso weich wie meins.
Jedes Mal, wenn ich ihnen in den Brustkorb stach, hörte ich wieder die Stimme meines Vaters.
Sieh hin, kleine Schlange, flüsterte Vincent mir ins Ohr.
Und ich schaute nicht weg. Damals nicht, und jetzt auch nicht. Ich wusste, was ich in der Dunkelheit wieder vor mir sehen würde: das Gesicht eines hübschen Jungen, den ich einst sehr geliebt hatte, und seinen Gesichtsausdruck, als mein Messer in seine Brust glitt.
Vampire waren die Kinder der Göttin des Todes. Deshalb schien es fast absurd, dass sie den Tod ebenso fürchteten wie wir Menschen. Ich beobachtete sie jedes Mal ganz genau, sah die Angst in ihren Gesichtern, wenn ihnen bewusst wurde, dass er sie holen würde.
Was das betraf, waren wir gleich. Letzten Endes sind wir alle elende Feiglinge.
Vampirblut war dunkler als Menschenblut. Fast schwarz, so als hätte das Blut all der Menschen und Tiere, das sie sich einverleibt hatten, ihr eigenes Blut im Laufe der Jahrhunderte Schicht für Schicht verdunkelt. Als ich den Vampir losließ, war ich von oben bis unten damit besudelt.
Ich trat einen Schritt von seinem toten Körper zurück. Erst in dem Moment sah ich, dass die Familie mich anstarrte – ich war leise vorgegangen, aber nicht so leise, dass sie mich nicht bemerkt hätten – zumal sich das Ganze vor ihrer Haustür abgespielt hatte. Die Mutter hielt den Jungen nun fest in ihren Armen. Ein Mann und ein weiteres Kind waren bei ihnen, ein kleines Mädchen. Sie wirkten abgemagert, die einfache Kleidung zerschlissen und fleckig von langen Arbeitstagen. Alle vier standen sie da in der Tür und blickten mich an.
Ich erstarrte, wie ein Hirsch, der im Wald von einem Jäger gestellt wird.
Seltsam, dass gar nicht der Vampir, sondern diese halb verhungerten Menschen mich von einer Jägerin zur Gejagten machten.
Vielleicht lag es daran, dass ich in der Gegenwart von Vampiren wusste, was ich war. Doch als ich diese Menschen sah, verschwammen die Konturen und wurden unscharf – so als sähe ich ein Zerrbild meiner selbst.
Vielleicht war ich selbst ja das Zerrbild.
Sie waren so wie ich. Und dennoch konnte ich keinerlei Gemeinsamkeiten entdecken. Hätte ich den Mund aufgemacht und mit ihnen gesprochen, wären uns die Laute, die jeder von uns hervorbrachte, vermutlich fremd vorgekommen. Mir kamen diese Menschen vor wie Tiere.
Die hässliche Wahrheit lautete, dass ein Teil von mir sie abstoßend fand. Ebenso abstoßend wie all meine eigenen menschlichen Schwächen. Doch ein anderer Teil von mir – der sich vielleicht noch daran erinnerte, dass ich einst selbst in einem solchen Haus gewohnt hatte – sehnte sich danach, mich näher an sie heranzuwagen.
Was ich natürlich nicht tun würde.
Nein, ich war kein Vampir. Das war mir absolut klar, in jeder Sekunde an jedem Tag. Aber ich war auch keine von ihnen.
Etwas Kaltes traf mich an der Wange. Ich strich darüber und meine Finger wurden nass. Regen.
Das Prasseln durchbrach die Stille, in der wir alle den Atem angehalten hatten. Die Frau ging einen Schritt auf mich zu, so als wolle sie etwas sagen. Aber da war ich schon verschwunden in der Dunkelheit.
ICH KONNTE NICHT WIDERSTEHEN, einen Umweg zu nehmen. Normalerweise hätte ich direkt meine Gemächer in den Westtürmen des Palasts angesteuert. Stattdessen hielt ich mich bergauf Richtung Osten, sprang über die Gartenmauern und lief weiter zu den Gesindehäusern. Ich schlüpfte durch das offene Fenster oberhalb eines verwilderten Busches mit blauen Blüten, der silbrig im Mondlicht schimmerte. Kaum hatte ich mit meinen Stiefeln die Holzdielen berührt, fluchte ich lautstark, weil ich beinahe auf einem spiegelglatten Stück Stoff ausgerutscht wäre.
Das darauf folgende Gelächter klang wie das Krächzen einer Krähe, mündete aber sogleich in einem Hustenanfall.
»Seide«, krächzte die alte Frau. »Die beste Falle, die man kleinen Dieben stellen kann.«
»Deine Bude ist ein verficktes Chaos, Ilana.«
»Ach was!« Sie kam aus einer Ecke hervor und musterte mich mit zusammengekniffenen Augen. Dann holte sie tief Luft, nahm einen rasselnden Zug von ihrer Zigarre und blies den Rauch durch die Nase aus. Sie war in ein Gewand aus gewelltem Chiffon in allen möglichen Farbtönen gehüllt. Das schwarz-grau gesträhnte Haar türmte sich beeindruckend über ihrem Kopf auf. Goldene Ohrringe baumelten an ihren Ohrläppchen, und die faltigen Augenlider waren in grau-blauen Schattierungen und mit reichlich Kajal geschminkt.
Das Zimmer wirkte ebenso farbenfroh und chaotisch wie sie selbst – Kleidung, Schmuck und Stoffbahnen in leuchtenden Farben lagen überall herum. Wegen des Regens schloss ich das Fenster, durch das ich in den Wohnraum geklettert war. Ilanas Behausung war winzig, aber wesentlich schöner als die Lehmhäuser der heruntergekommenen Slums, in denen die Menschen wohnten.
Sie musterte mich noch einmal von Kopf bis Fuß und strich sich über den Hals. »Von so einer triefenden Ratte wie dir lasse ich mir gar nichts sagen.«
Ich blickte an mir hinunter und wurde blass. Erst jetzt, im warmen Licht der Laternen, fiel mir auf, was für einen Anblick ich bot.
»Kaum zu glauben, dass sich darunter ein so hübsches Mädchen verbirgt, Oraya«, fuhr sie fort. »Aber wild entschlossen, sich so unattraktiv wie möglich zu geben. Da fällt mir etwas ein! Ich habe nämlich was für dich. Hier.«
Mit ihren von Arthritis knotigen Händen durchwühlte sie einen unübersichtlichen Stapel aus Stoffen und warf mir quer durch das Zimmer ein Stück zu. »Fang!«
Ich fing es auf und faltete es auseinander. Die Lage Seidenstoff war fast so lang wie ich und aus einem leuchtenden Violett, mit einem goldenen Faden eingefasst.
»Da musste ich direkt an dich denken.« Ilana lehnte sich an den Türrahmen und paffte an ihrer Zigarre.
Ich fragte sie gar nicht erst, woher sie diesen Schal hatte. Ungeachtet ihres Alters waren ihre Finger keineswegs weniger flink, sodass schon mal etwas daran »kleben« blieb.
»Behalt ihn lieber. So etwas trage ich gar nicht. Das weißt du doch.«
Tagein, tagaus trug ich nur schwarze, schlichte Kleidung, um möglichst wenig aufzufallen und mich frei bewegen zu können. Ich trug nichts Buntes (weil es ungebetene Aufmerksamkeit erregt hätte), nichts Weites (weil mich damit jemand hätte packen können) und nichts Enges (weil es mich beim Kämpfen oder Fliehen eingeschränkt hätte). Meistens war ich ganz in Leder gekleidet, selbst in drückender Sommerhitze. Leder bot Schutz und war unauffällig.
Klar, manchmal hätte ich auch gern mal etwas Hübsches angezogen. Aber ich lebte unter Raubtieren. Mein Überleben stand an erster Stelle.
Ilana grinste spöttisch. »Ich weiß ganz genau, dass dir so etwas sehr wohl gefällt, du kleine Ratte. Auch wenn du zu viel Angst hast, damit herumzulaufen. Was für eine Schande! Die Jugend wird tatsächlich an die jungen Leute verschwendet. Schönheit übrigens auch. Die Farbe würde dir gut stehen. Von mir aus kannst du damit aber auch nackt in deinem Schlafgemach herumtanzen.«
Stirnrunzelnd warf ich einen Blick auf die Stapel bunter Stoffbahnen. »Machst du das etwa?«
»Nicht nur das«, gab sie augenzwinkernd zurück. »Erzähl mir jetzt bloß nicht, dir geht es nicht genauso.«
Ilana war noch nie in meinen Gemächern gewesen, doch sie kannte mich gut genug, um zu wissen, dass es mir ähnlich ging. Eine der Schubladen meiner Kommode hatte ich tatsächlich mit lauter bunten Schätzen vollgestopft, die ich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Alles viel zu auffällig, als dass ich es in diesem Leben jemals hätte tragen können. Aber im nächsten vielleicht, davon konnte ich zumindest träumen.
Ganz gleich, wie oft ich es ihr zu erklären versuchte, Ilana konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich so vorsichtig war. Mehr als einmal hatte sie mir klargemacht, dass sich das Thema Vorsicht für sie erledigt hatte – »Schluss damit!«, verkündete sie jedes Mal.
Ehrlich gesagt konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie die alte Schrulle so lange überlebt hatte, aber ich war dankbar dafür. Die Menschen, denen ich im Morgengrauen in den Slums begegnet war, waren kein bisschen so wie ich, und die Vampire um mich herum noch viel weniger. Einzig und allein Ilana verharrte irgendwo dazwischen, so wie ich.
Wenngleich auch aus ganz anderen Gründen.
Ich war in dieser Welt aufgewachsen. Ilana hingegen war vor zehn Jahren freiwillig hierhergekommen. Als junger Teenager war ich fasziniert von ihr gewesen. Ich hatte ja nur wenige andere Menschen zu Gesicht bekommen. Damals war mir gar nicht bewusst gewesen, dass Ilana auch als Mensch irgendwie … speziell war.
Ilana strich sich abermals über den Hals. In dem Moment fiel mir auf, dass die Farbe des Tuchs, das sie in der Hand hielt, eigentlich gar nicht Rot war, jedenfalls nicht ursprünglich. Ich ging einen Schritt näher an sie heran, und da sah ich die Wunden an ihrem Hals – drei mal zwei nebeneinander. Und den Verband an ihrem Handgelenk, unter dem sich noch Nyaxia weiß wie viele weitere verbargen.
Offenbar veränderte sich mein Gesichtsausdruck, denn sie lachte abermals auf.
»Großes Festmahl heute Abend«, sagte sie. »Habe gutes Geld damit gemacht. Damit, dass attraktive Männer an meinem Hals gesaugt haben. Mein jüngeres Ich wäre begeistert gewesen.«
Ich konnte mir nicht mal ein schwaches Grinsen abringen.
Ich hatte keine Ahnung, wie Ilana so lange überlebt hatte. Die meisten freiwilligen Blutverkäufer – und von denen gab es nicht viele – überlebten diesen Job kaum ein Jahr lang. Schließlich wusste ich nur allzu gut, wie es mit der Selbstbeherrschung von Vampiren bestellt war, wenn der Blutdurst sie überkam.
Über manches würden Ilana und ich uns wohl niemals einig werden.
»Ich werde eine Zeit lang nicht hier sein«, sagte ich, um das Thema zu wechseln. »Das wollte ich dir nur schon mal sagen, damit du dir keine Sorgen machst.«
Ilana erstarrte. Selbst bei dem gedämpften Licht konnte ich erkennen, dass sie um zwei Nuancen blasser wurde. »Dieser Bastard! Du machst es also.«
Ich wollte diese Diskussion jetzt nicht führen, obwohl ich wusste, dass ich nicht darum herumkommen würde.
»Du solltest dir überlegen, ob du nicht lieber für eine Weile aus der Stadt verschwindest«, fuhr ich fort. »In die Menschenbezirke vielleicht. Ich weiß, das gefällt dir ganz und gar nicht, aber immerhin wäre da …«
»Ach, Quatsch!«
»Es ist das Kejari, Ilana. Dann ist es hier für dich nicht sicher. Für keinen Menschen außerhalb der Schutzzone.«
»›Schutzzone‹. Diese Slums! Ich bin doch nicht ohne Grund von da weggegangen. Dieser Gestank nach Elend.« Sie kräuselte die Nase. »Nach Elend und Pisse.«
»Aber da ist es sicher.«
Welche Ironie darin lag, war mir durchaus bewusst, da ich gerade erst mit Blut besudelt von dort gekommen war.
»Ach was! Sicherheit ist überschätzt. Was hat man denn dann noch vom Leben? Willst du etwa, dass ich verschwinde, wenn das größte Ereignis des Jahrhunderts direkt vor meiner Tür stattfindet? Nein, Herzchen. Kommt überhaupt nicht infrage.«
Ich hatte mir vorgenommen, die Ruhe zu bewahren – weil ich wusste, dass Ilana nicht auf mich hören würde. Dennoch war mir die Enttäuschung anzumerken.
»Du bist leichtsinnig. Es geht doch nur um ein paar Monate. Vielleicht sogar nur um ein paar Tage. Wenn du dich wenigstens von der Eröffnung fernhalten würdest …«
»Leichtsinnig!«, empörte sich Ilana. »Hat er dir das in den Mund gelegt? Bezeichnet er dich so, wenn du etwas tust, das nicht seiner Kontrolle unterliegt?«
Ich biss die Zähne zusammen und stieß den Atem aus. Ja, Vincent würde mich als leichtsinnig bezeichnen, wenn ich mich ohne triftigen Grund weigerte, mich zu schützen. Und damit hätte er sogar recht.
Die Menschen lebten zwar in Slums, doch zumindest standen sie dort unter einem gewissen Schutz. Aber hier? Ich wusste nicht, was mit Ilana und den anderen Menschen im Zentrum der Stadt passieren würde, sobald das Kejari begann. Vor allem, mit denen, die ihr Blut verkauften.
Ich hatte Geschichten darüber gehört, was man bei solchen Turnieren schon mit Menschen gemacht hatte. Was davon stimmte und was übertrieben war, wusste ich nicht, aber mir hatte sich fast der Magen umgedreht. Manchmal wollte ich Vincent danach fragen, aber mir war klar, dass er denken würde, es ginge mir um mich selbst. Und ich wollte nicht, dass er sich noch mehr Sorgen um mich machte, als er es ohnehin schon tat. Außerdem … wusste er ja gar nicht, wie nahe Ilana und ich uns seit ein paar Jahren standen.
Es gab so einiges, was Vincent nicht wusste. Dass ich in mancher Hinsicht nicht mit seiner Vorstellung von mir übereinstimmte. Ebenso gab es einiges, worin Ilana und ich uns niemals einig sein würden.
Dennoch hätte ich nicht gewusst, was ich ohne die beiden machen würde. Ich hatte hier ja keine Familie. Alle, die zusammen mit mir in dem Haus gewesen waren, in dessen Trümmern Vincent mich gefunden hatte, waren tot. Wenn es noch irgendwelche entfernten Verwandten gab, wurden sie irgendwo gefangen gehalten, wo ich keinen Zutritt hatte. Jedenfalls nicht, bevor ich dieses Kejari gewinnen würde. Aber ich hatte Vincent, und ich hatte Ilana, und sie waren zu all dem geworden, was ich mir unter einer Familie vorstellte. Selbst, wenn die beiden nicht jeden der widersprüchlichen Teile in mir verstanden.
Jetzt, da die Gefahr, Ilana zu verlieren, plötzlich viel zu greifbar wurde, umklammerte die Furcht mein Herz und wollte es nicht mehr loslassen.
»Ilana, bitte!« Meine Stimme klang sonderbar erstickt. »Bitte, geh fort von hier!«
Ilanas Gesichtsausdruck wurde milder. Sie drückte ihre Zigarre in einem überquellenden Aschenbecher aus und kam so dicht an mich heran, dass ich die Falten um ihre Augen herum hätte zählen können. Mit ihrer ledrigen Hand streichelte sie mir die Wange. Sie roch nach Rauch und nach zu penetrantem Rosenparfum – und nach Blut.
»Du bist so lieb«, sagte sie. »Kratzbürstig, aber lieb. Süß und sauer. So wie … wie eine Ananas.«
Unwillkürlich zuckten meine Mundwinkel. »Wie eine Ananas?«
Was für ein komisches Wort. So wie ich sie kannte, hatte sie sich das selbst ausgedacht.
»Aber ich bin es müde, Herzchen. Müde, Angst zu haben. Ich habe die Schutzzone verlassen, weil ich wissen wollte, wie es hier ist, und daraus wurde genau das Abenteuer, das ich erwartet hatte. Jeden Tag setze ich mein Leben aufs Spiel. Genau wie du.«
»Aber deshalb musst du doch nicht gleich leichtsinnig sein.«
»Irgendwann wird es zu einer Rebellion, sich keine Gedanken mehr darüber zu machen. Ich weiß, dass du das ebenso gut weißt wie ich. Auch wenn du alles Bunte in die hinterste Ecke deiner Kommode verbannst.«
Sie warf einen kritischen Blick auf meine blutverschmierte Kleidung. »Selbst wenn du es in die dunklen Gassen der Außenbezirke verbannst.«
»Bitte, Ilana. Nur für eine Woche. Es muss ja gar nicht für das ganze Kejari sein.« Ich gab ihr den Schal zurück. »Hier, behalt dieses auffällige Ding erst mal und gib es mir wieder, wenn du zurückkommst. Ich verspreche dir, dann werde ich es tragen.«
Sie schwieg eine ganze Weile, dann nahm sie den Seidenschal und steckte ihn in die Tasche ihres Gewandes. »Gut. Morgen früh verschwinde ich.«
Ich stieß einen erleichterten Seufzer aus.
»Und du. Du sture kleine Ratte …« Sie nahm mein Gesicht in beide Hände. »Du musst vorsichtig sein. Aber ich werde dir jetzt keinen Vortrag darüber halten, was er von dir verlangen wird …«
Ich befreite mich aus ihrem erschreckend festen Griff. »Er wird gar nichts von mir verlangen.«
»Schwachsinn!« Ich war gerade noch rechtzeitig zurückgewichen, denn sie stieß dieses Wort so spöttisch aus, dass mir Speicheltropfen entgegenflogen. »Ich will nicht mitansehen, wie du eine von ihnen wirst. Das wäre …« Sie presste die Lippen aufeinander und sah mich forschend an, mit quälend emotionalem Blick. »Es wäre furchtbar langweilig.«
Es war nicht das, was sie hatte sagen wollen, und das wusste ich auch. Aber so war das eben zwischen Ilana und mir. All die schonungslose Aufrichtigkeit, all die raue Zärtlichkeit lagen in dem verborgen, was wir nicht offen aussprachen. So wie ich nicht aussprechen würde, dass ich an dem Kejari teilnehmen wollte, würde sie nicht aussprechen, dass sie Angst um mich hatte.
Dennoch erschrak ich, als ich sah, dass sie den Tränen nahe war. Erst in dem Moment wurde mir bewusst, dass sie außer mir niemanden hatte. Ich hatte immerhin Vincent, aber sie war ganz allein.
Ich warf einen Blick auf die Uhr und stieß erneut einen Fluch aus.
»Ich muss los«, sagte ich hastig und ging zurück zum Fenster. »Trink dich nicht tot, du alte Hexe.«
»Und du, spieß dich nicht mit dem Stock in deinem Hintern auf«, gab sie zurück, wischte sich über die Augen und vertrieb damit die letzten Anzeichen von Verletzlichkeit.
Verrücktes altes Weib, dachte ich voller Zuneigung.
Ich riss das Fenster auf und ließ mir den sommerlichen Regen ins Gesicht prasseln. Unwillkürlich hielt ich inne – etwas Gewichtiges lag mir auf der Zunge, Worte, die ich nur ein einziges Mal ausgesprochen hatte, gegenüber jemandem, der sie wesentlich weniger verdient hatte.
Doch Ilana hatte sich schon in ihre Schlafkammer zurückgezogen. Also schluckte ich herunter, was ich hatte sagen wollen, und tauchte wieder ab in die Dunkelheit.
KAPITEL ZWEI
Wenn es einmal angefangen hatte zu regnen, dann schüttete es richtig. So war es immer im Haus der Nacht. Vincent mit seinem scharfen, trockenen Humor witzelte oftmals, dass man in diesem Land keine halben Sachen machte. Entweder die Sonne setzte uns mit unaufhörlicher Hitze zu oder sie verschwand voll und ganz hinter rötlich grauen Nebelwolken. Entweder die trockene Luft war so glühend heiß, dass man das sichere Gefühl hatte, man würde bei lebendigem Leib geröstet. Oder sie war so kalt, dass einem die Gelenke knackten. Die Hälfte der Zeit verbarg sich der Mond hinter dichtem Nebel, aber wenn er sich zeigte, schimmerte er wie poliertes Silber in so intensivem Licht, dass die Sanddünen in der Ferne fast aussahen wie der wogende Ozean – so, wie ich mir das offene Meer vorstellte.
Im Königreich der Nachtgeborenen regnete es nicht oft, aber wenn, dann wurde daraus ein Wolkenbruch.
Als ich schließlich im Palast ankam, war ich völlig durchnässt. Der Weg über die Seitentreppe war riskant, auf den rutschigen Steinstufen stand das Wasser. Es war nicht das erste und sicher auch nicht das letzte Mal, dass ich diesen Weg bei strömendem Regen nahm. Als ich endlich viele Stockwerke über dem Boden in meinem Schlafgemach ankam, schmerzten meine Muskeln vor lauter Anstrengung.
Mein Haar war triefnass. Als ich es auswrang, tropfte es nur so auf die samtbezogene Bank unter dem Fenster, an dem ich stand und den Horizont betrachtete. Draußen war es noch immer so heiß, dass sich die Feuchtigkeit in einer silbrigen Wolke über der Stadt erhob. Von hier oben hatte man eine ganz andere Aussicht als von den Dächern im menschlichen Außenbezirk der Stadt. Dort sah man nichts als Lehmblöcke, wie auf einem Gemälde in Braunschattierungen. Doch hier, mitten in Sivrinaj – auf dem königlichen Territorium der Nachtgeborenen, offenbarte sich formvollendete Ästhetik, so weit das Auge reichte.
Vor meinem Fenster erstreckten sich Gebäude in endlos symmetrisch geschwungenen Linien. Die Nachtgeborenen bezogen die Inspiration für ihre Architektur von Himmel und Mond – metallüberzogene Kuppeln, polierter Granit, in schmeichelndes Silber gefasstes Buntglas. Mondlicht und Regen ließen die weite Fläche schimmern wie Platin. Die Landschaft war so flach, dass ich hinter den gewaltigen Stadtmauern von Sivrinaj sogar noch die weit entfernten Dünen erkennen konnte.
Durch ihr ewiges Leben hatten die Vampire alle Zeit der Welt, die düstere, bedrohlich anmutende Schönheit ihrer Architektur zu vervollkommnen. Über das Haus des Schattens am gegenüberliegenden Ufer des Elfenbeinmeers hatte ich gehört, dass dort alle Gebäude konstruiert waren wie Dolche und von jedem Palast mit blutverziertem Efeu umrankte Türme aufragten. Manche hielten das für die erlesenste Art der Architektur, doch nach einem Blick auf das Haus der Nacht von meinem Fenster aus hätte das meiner Ansicht nach niemand mehr behaupten können. Selbst bei Tageslicht war die Aussicht, die hier außer mir ja niemand sah, einfach spektakulär.
So leise wie möglich schloss ich das Fenster, und kaum hatte ich es verriegelt, hörte ich auch schon ein Klopfen an meiner Tür. Zwei Mal, ruhig, aber dennoch gebieterisch.
Scheiße!
Aber was für ein Glück, dass ich nicht ein paar Minuten später zurückgekommen war. Nachts den Palast zu verlassen war riskant, aber ich hatte einfach nicht anders gekonnt. Dafür war ich viel zu angespannt und dagegen hatte ich etwas unternehmen müssen.
Hastig zog ich meinen Mantel aus und warf ihn auf einen Stapel Kleidung in der Ecke. Dann schnappte ich mir meinen Morgenrock und zog ihn fest zu. Das würde immerhin reichen, um die Blutspritzer auf der Kleidung darunter zu verdecken. Ich lief zur Tür und öffnete sie. Ohne zu zögern, kam Vincent herein.
Mit ungerührtem, kritischem Blick sah er sich um. »Diese Unordnung hier!«
Jetzt konnte ich nachempfinden, wie Ilana sich gefühlt haben musste. »Ich hatte Wichtigeres im Kopf, als aufzuräumen.«
»Eine ordentliche Umgebung ist wichtig für einen klaren Verstand, Oraya.«
Ich war mittlerweile dreiundzwanzig und noch immer wollte er mich belehren.
Mit gespieltem Erstaunen tippte ich mir an die Stirn, als hätte er mir gerade eine bahnbrechende neue Theorie über das Universum verkündet. »Ach wirklich?«
Vincent kniff seine mondlichtsilbrigen Augen zusammen. »Du bist eine freche Göre, kleine Schlange.«
Wenn er mich so betitelte, klang er immer besonders liebevoll. Sicher kam es nicht von ungefähr, dass sowohl Ilana als auch Vincent ihre Zuneigung hinter barschen Worten verbargen. Denn ansonsten hatten sie absolut nichts gemeinsam. Aber vielleicht lag es an diesem Ort, der auf uns alle offenbar die gleiche Wirkung hatte. Vielleicht lehrte uns dieser Ort, Liebe hinter einer rauen Schale zu verbergen.
Doch diesmal zog sich bei seinen Worten mein Brustkorb zusammen. Komisch, dass man manchmal einen Grund braucht, damit die Angst an die Oberfläche gespült wird. Und ich hatte Angst, auch wenn ich sie niemals offen gezeigt hätte. Denn ich wusste, auch Vincent hatte Angst. Das sah ich daran, wie sein spöttisches Lächeln erstarb, als er mich anblickte.
Manche mochten glauben, dass Vincent rein gar nichts fürchtete. Auch ich hatte das lange geglaubt. Während ich aufwuchs, hatte ich ihn ja als Herrscher erlebt – und mitbekommen, wie er bedingungslosen Respekt von einer Gesellschaft verlangte, die eigentlich vor gar nichts Respekt hatte.
Offiziell war er mein Vater. Zwar floss nicht sein Blut durch meine Adern und ich verfügte auch kaum über Magie oder war gar unsterblich. Aber wir besaßen dieselbe Skrupellosigkeit. Denn die hatte er mir eingeimpft, Nadelstich für Nadelstich.
Doch als ich erwachsen wurde, verstand ich allmählich, dass Skrupellosigkeit nicht gleichzusetzen ist mit Furchtlosigkeit. Ich hatte immer Angst, und Vincent auch. Der Mann, der sonst vor nichts Angst hatte, hatte Angst um mich – seine menschliche Tochter, die er in einer Welt aufgezogen hatte, die darauf ausgerichtet war, zu töten.
Bis zu dem Kejari. Einem Turnier, durch das sich alles ändern konnte.
Bis ich es gewonnen hatte und frei sein würde.
Oder es verloren hatte und verdammt sein würde.
Vincent schloss für einen Moment die Augen und in stillschweigender Übereinkunft sprachen wir nicht weiter darüber. Er musterte mich von Kopf von Fuß, als fiele ihm jetzt erst auf, wie ich aussah. »Du bist ganz nass.«
»Hab gerade ein Bad genommen.«
»Vor dem Training?«
»Ich wollte mich entspannen.«
Das stimmte allerdings, nur dass ich mich auf ganz andere Art entspannt hatte als mit einem Lavendelbad.
Doch meine ausweichende Begründung reichte, um Vincent nur allzu deutlich vor Augen zu führen, was uns bevorstand. Er verzog den Mund und fuhr sich mit der Hand durch sein blassblondes Haar.
Eine verräterische Geste. Bei ihm die einzige. Etwas lastete ihm auf der Seele. Konnte sein, dass es um mich ging und um meine Einführung an diesem Abend, oder es ging um …
Ich konnte mich nicht zurückhalten.
»Was ist los?«, fragte ich leise. »Ärger mit den Rishan?«
Er schwieg.
Mir wurde flau im Magen. »Etwa mit dem Haus des Blutes?«
Oder mit beiden?
Er schluckte schwer und schüttelte nur den Kopf. Und diese kaum merkliche Bewegung bestätigte meine Befürchtung.
Ich hätte ihm gern noch mehr Fragen gestellt, aber seine Hand glitt hinunter zu seiner Hüfte, und da fiel mir auf, dass er seinen Stoßdegen bei sich hatte.
»Wir müssen uns an die Arbeit machen. Das ist wichtiger als diese ermüdenden Zankereien. Um irgendwelche Feinde wird man sich immer Gedanken machen müssen, aber dir bleibt nur noch dieser Abend. Also los!«
VINCENT WAR ALS TRAINER ebenso unerbittlich wie als Herrscher, minuziös und gründlich. Daran hatte ich mich längst gewöhnt, und dennoch war ich auf so viel Intensität nicht gefasst. Mit seinen schnellen Hieben ließ er mir keine Zeit zum Denken oder Zögern. Er nutzte nicht nur seine Waffe, sondern auch seine Flügel und seine geballte Stärke – sogar seine Magie, die er bei unseren Trainingseinheiten nur selten anwandte. Es schien, als wolle er mir unmissverständlich vorführen, wie es sich anfühlte, wenn der König der nachtgeborenen Vampire jemanden tot sehen wollte.
Doch eigentlich hatte sich Vincent mir gegenüber nie zurückgehalten. Selbst als ich noch klein war, hatte er mich niemals vergessen lassen, dass mir der Tod beständig auflauerte. Jede Unachtsamkeit wurde mit seiner Hand an meiner Kehle beantwortet – indem er zwei Finger in meine Haut grub, anstelle spitzer Eckzähne.
»Du bist tot«, sagte er dann. »Versuch es noch mal.«
Diesmal ließ ich es nicht so weit kommen. Nach dem Kampf auf meinem nächtlichen Ausflug schrien meine Muskeln geradezu vor Erschöpfung, doch ich wich jedem Stoß aus, befreite mich aus jedem Griff und parierte jeden Hieb. Und irgendwann, nach scheinbar endlosen, anstrengenden Minuten hatte ich ihn an die Wand gedrängt und stieß ihm mit dem Zeigefinger in die Brust – so als wäre es einer meiner Dolche.
»Damit wärst du jetzt tot«, sagte ich keuchend.
Der allmächtigen Mutter sei Dank, denn ich hätte keine weitere Sekunde dieser Trainingseinheit überstanden.
Vincents Mundwinkel verzogen sich zu einem stolzen Grinsen, aber nur für einen kurzen Moment. »Mir bleibt immer noch die Möglichkeit, Asteris einzusetzen.«
Asteris – eine der wirkungsvollsten magischen Gaben der nachtgeborenen Vampire, und eine der seltensten. Pure Energie, die, wie es hieß, direkt den Sternen entzogen wurde, konnte sich in Form eines blendenden, schwarzen Lichts als absolut tödlich erweisen. Vincent war im Umgang damit ein Meister wie kein anderer. Ich hatte selbst einmal gesehen, wie er damit ein ganzes Gebäude voller Rishan-Rebellen dem Erdboden gleichmachte.
Im Laufe der Jahre hatte Vincent mir auch beizubringen versucht, wie ich selbst Magie erzeugen konnte. Ein paar kleine Funken bekam ich mittlerweile hin. Aber das war vergleichsweise lächerlich gegen die todbringende Wirkung, wenn Vampire Magie anwandten – ganz gleich ob sie dem Haus der Nacht oder einem der anderen Häuser angehörten.
Bei dem Gedanken wurde mir flau im Magen, denn er machte mir einmal mehr bewusst, wie sehr ich den Kriegern unterlegen war, gegen die ich antreten würde. Sogleich verdrängte ich diesen Anflug von Unsicherheit. »Asteris würde dir auch nicht mehr helfen, wenn ich dich gerade getötet hätte.«
»Wärst du dafür schnell genug? Bis zum Herzen vorzudringen, ist dir immer schwergefallen.«
Du musst richtig fest zustoßen, um durch das Brustbein zu kommen.
Angesichts dieser unangenehmen Erinnerung kniff ich die Augen zu.
Ich hatte meinen Finger noch immer gegen seine Brust gepresst. Denn ich war mir nie ganz sicher, wann ich eine solche Trainingseinheit hinter mir hatte. Deshalb ließ ich erst nach, wenn das Training für beendet erklärt wurde. Er stand nur ein paar Zentimeter von mir entfernt – nur ein paar Zentimeter entfernt von meiner Kehle. Nie, niemals ließ ich einen anderen Vampir so nah an mich heran. Der Geruch meines Blutes war für sie überwältigend. Selbst wenn Vampire dem widerstehen wollten – und bei den meisten war das nicht der Fall –, bestand die Gefahr, dass sie sich nicht unter Kontrolle hatten.
Diese Lektion hatte Vincent mir eingeimpft. Niemals jemandem vertrauen. Niemanden zu nah heranlassen. Immer das Herz schützen.
Und als ich mich einmal nicht daran hielt, hatte ich bitter dafür büßen müssen.
Aber nicht bei ihm. Niemals bei ihm. Unzählige Male hatte er meine blutenden Wunden versorgt, ohne auch nur die geringsten Anzeichen von Versuchung zu zeigen. Er hatte über mich gewacht, wenn ich schlief. Hatte mich beschützt, als ich am verletzlichsten war.
Das hatte es mir leichter gemacht. Mein ganzes Leben hatte ich in Angst verbracht, mit dem stetigen Bewusstsein meiner Schwäche und Unzulänglichkeit. Doch immerhin hatte ich diesen einen sicheren Hafen.
Vincent sah mir in die Augen.
»Sehr gut.« Er schob meine Hand weg. Ich ging an den Rand des Rings und zuckte zusammen, als ich mir das Blut aus einer Wunde an meinem Arm abwischte, die er mir zugefügt hatte. Er warf nur einen kurzen Blick darauf.
»Damit musst du bei dem Turnier im Ring vorsichtig sein«, sagte er. »Mit blutenden Wunden.«
Ich zog die Nase kraus. Bei der Göttin, er machte sich Sorgen. Mich auf etwas so Grundlegendes hinzuweisen. »Ich weiß.«
»Noch vorsichtiger als sonst, Oraya.«
»Ich weiß.«
Ich trank einen Schluck Wasser aus meiner Feldflasche und kehrte Vincent den Rücken zu, um die Fresken zu betrachten. Die Wandbemalung war schön und schrecklich zugleich – Vampire mit rasiermesserscharfen Zähnen, die unter silbernen Sternen ein Blutbad heraufbeschworen. Die Szene erstreckte sich über die gesamten Wände des Raums. Der private Trainingsraum war allein Vincent und seinen hochrangigsten Kriegern vorbehalten, und die Motive an den Wänden waren noch abscheulicher, als sie es selbst an einem von Speichel, Blut und Schweiß getränkten Ort hätten sein sollen. Der Boden war bedeckt mit elfenbeinfarbenem Sand aus den Dünen, der jeden Monat ausgetauscht wurde. Eigentlich war es nur ein Gemälde, denn die fensterlosen Wände waren rund und vollständig mit dieser Szene bemalt – ein Panorama aus Tod und Eroberung.
Die abgebildeten Figuren waren Hiaj-Vampire, mit fledermausartigen Flügeln in Schattierungen von milchig blass bis kohlschwarz. Zweihundert Jahre zuvor waren hier die gefiederten Flügel der Rishan abgebildet gewesen. Denn der rivalisierende Nachtgeborenen-Clan befand sich in stetigem Streit um den Thron des Hauses der Nacht. Seit die Göttin Nyaxia vor über zweitausend Jahren Vampire erschaffen hatte – manche behaupteten sogar, es sei noch viel länger her –, bekämpften sich die beiden Clans immer wieder. Und jedes Mal, wenn sich das Blatt wendete, mit jeder neuen Blutlinie auf dem Thron, änderte sich das Fresko – Flügel wurden gemalt und übermalt, gemalt und übermalt, dutzendfach im Laufe der Jahrtausende.
Ich warf einen Blick über die Schulter zu Vincent. Er trug seine Flügel noch sichtbar hinter dem Rücken. Was er selten tat. Normalerweise ließ er sie verschwinden, außer bei diplomatischen Anlässen, bei denen die Notwendigkeit bestand, seine Macht als Hiaj-König zu demonstrieren. Seine Flügel waren so lang, dass sie fast den Boden berührten, und schwarz – so tiefschwarz, wie es in der Natur gar nicht vorkam, so als hätte seine Haut das Licht absorbiert und erlöschen lassen. Noch auffälliger waren allerdings die roten Adern. Wie karmesinrote Rinnsale verzweigten sie sich, bis sie an den Rändern und den unteren Spitzen wieder zusammenliefen. Wenn Vincent die Flügel ausbreitete, sahen sie aus, als wären sie von Blut eingefasst, so leuchtend rot, dass sie selbst in der unerbittlichsten Finsternis noch zu erkennen waren.
Das Tiefschwarz war ungewöhnlich, aber es kam schon mal vor. Das Karmesinrot hingegen war einzigartig. Alle Hiaj- und Rishan-Thronfolger trugen zwei Zeichen – das Rot an den Flügeln und ein Erbmal am Körper. Doch das Mal wurde erst sichtbar, wenn der vorherige Herrscher starb. Bei Vincent befand es sich am Halsansatz: ein kunstvoll verschnörkeltes Ornament aus einem geflügelten Vollmond, das sich oberhalb der Schlüsselbeine bis fast in seinen Nacken schlängelte, in so kräftigem Rot wie eine frische, blutende Wunde. Ich hatte es nur selten zu Gesicht bekommen. Meistens hielt er es verborgen unter Jacketts mit hohem Kragen oder fest gewickelten schwarzen Seidenschals.
Vor einigen Jahren hatte ich ihn einmal gefragt, warum er es nicht öfter zeigte. Darauf hatte er mir nur einen ernsten Blick zugeworfen und vage geantwortet, den Hals zu entblößen sei unklug.
Eigentlich war diese Antwort keine Überraschung. Schließlich wusste Vincent ganz genau, dass hinter jeder Ecke Thronräuber lauerten, sowohl vor als auch hinter den Mauern seines Reichs. Der Thron eines jeden neuen Königs, ob Hiaj oder Rishan, stand gewissermaßen auf einem Berg Leichen. Da war Vincent keine Ausnahme.
Als ich mich wieder zu ihm umdrehte, sagte er leise: »Bald ist Vollmond. Möglicherweise bleiben dir noch ein paar Tage, aber es kann jederzeit so weit sein. Du musst darauf gefasst sein.«
Ich trank noch einen Schluck Wasser, aber trotzdem hatte ich den Geschmack nach Asche im Mund. »Ich weiß.«
»Man weiß nie, womit es anfängt. Sie gestaltet es gern … unerwartet.«
Sie. Mutter von Nacht, Schatten, Blut – Mutter aller Vampire. Die Göttin Nyaxia.
Jeden Augenblick konnte sie den Tribut fordern, den das Haus der Nacht ihr zu Ehren jedes Jahrhundert zollte. Ein barbarisches Turnier mit fünf Wettkämpfen innerhalb von vier Monaten, aus dem nur einer als Sieger hervorgehen und sich den wertvollsten Preis der Welt sichern konnte: ein einzigartiges Geschenk der Göttin selbst.
Vampire aus ganz Obitraes würden anreisen, um an dem Kejari teilzunehmen, angelockt von der Aussicht auf Ehre und Reichtum. Dutzende der stärksten Krieger aller drei Häuser – des Hauses der Nacht, des Hauses des Schattens und des Hauses des Blutes – würden im Kampf um diesen Anspruch ihr Leben lassen.
Höchstwahrscheinlich auch ich.
Sie würden um Macht kämpfen. Ich hingegen ums Überleben.
Vincent und ich sahen einander an. Seine Haut war grundsätzlich bleich, fast so silbrig wie seine Augen, doch nun wirkte er geradezu kränklich blass.
Seine Angst machte meine eigene unerträglich, aber ich kämpfte dagegen an, indem ich mir ein Versprechen gab. Nein. Ich hatte mein Leben lang dafür trainiert. Ich würde das Kejari überleben. Ich würde es gewinnen.
So wie Vincent vor mir. Zweihundert Jahre zuvor.
Er räusperte sich und straffte die Schultern. »Zieh dir etwas Anständiges an. Und dann werfen wir einen Blick auf deine Mitbewerber.«
KAPITEL DREI
Vincent hatte gesagt, das hier sei ein Festessen, eine Art Empfang für diejenigen, die für das Kejari angereist waren. Aber das war maßlos untertrieben. Es war die reinste Völlerei.
Doch wenn nicht jetzt, wann sonst? Das Kejari fand nur jedes Jahrhundert statt, und es auszurichten war für das Haus der Nacht die größte Ehre überhaupt. Während des Turniers würde Sivrinaj Gäste aus allen Regionen von Obitraes willkommen heißen, aus allen drei Häusern. Auch in diplomatischer Hinsicht war es ein bedeutendes Ereignis, besonders für den Adel des Hauses der Nacht und des Hauses des Schattens. Die Vertreter des Hauses des Blutes hingegen waren nicht ganz so gern gesehen – von den Blutgeborenen war aus gutem Grund niemand eingeladen worden –, doch niemals hätte sich Vincent die Gelegenheit entgehen lassen, sich vor der High Society der Vampire in Szene zu setzen.
Den Bereich des Palasts, wo der Empfang stattfand, betrat ich so selten, dass ich schon fast vergessen hatte, wie beeindruckend er war. Die hohe Deckenkuppel bestand vollständig aus nachtblauer Bleiverglasung und war übersät mit golden leuchtenden Sternen. Mondlicht schien herein und warf Lichtstreifen auf die versammelte Menge. Ein halbes Dutzend langer Tische war als festliche, lange Tafel gedeckt worden, auf der nun, nach ein paar Stunden, noch die Reste eines bombastischen Festmahls übrig waren.
Vampire aßen alle möglichen Speisen, einfach des Genusses wegen. Doch sie brauchten Blut, um zu überleben – von Menschen, von anderen Vampiren oder von Tieren. Längst kalt geworden standen die Speisen noch auf den Tischen und von den Tellern und Tischdecken tropfte das Blut nur so herunter.
Mir fielen die Bisswunden an Ilanas Hals und Handgelenken wieder ein, und ich fragte mich, welche der Blutflecken von ihr stammten.
»Alle haben schon gegessen.« Vincent bot mir seinen Arm und ich hakte mich bei ihm ein. Er führte mich an der Wand entlang. Dabei wirkte er ganz lässig und entspannt, doch ich wusste, jede Geste war kalkuliert – mir seinen Arm hinzuhalten und mich so zu positionieren, dass ich an der Wandseite ging. Ersteres rief allen Anwesenden ins Gedächtnis, dass ich seine Tochter war. Letzteres diente dazu, mich von denen abzuschirmen, die sich im Blutrausch zu etwas hinreißen lassen könnten, was sie anschließend bitter bereuen würden.
Aus naheliegenden Gründen erlaubte Vincent mir normalerweise nicht, an solchen Festlichkeiten teilzunehmen. Ein Mensch in einem Ballsaal voll hungriger Vampire war für alle Beteiligten keine gute Idee. Das war uns beiden klar. Bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen ich mich doch in der Gesellschaft von Vampiren befand, erregte ich immer unverhohlene Aufmerksamkeit. Auch an diesem Abend. Als Vincent den Saal betrat, richteten sich zunächst alle Blicke auf ihn, doch dann sogleich auf mich.
Ich biss die Zähne aufeinander und all meine Muskeln spannten sich an.
Diese Situation fühlte sich absolut falsch an. So sehr im Rampenlicht zu stehen. So vielen Bedrohungen ausgesetzt zu sein, auf die ich achten musste.
Nach dem Essen hatten sich die meisten der etwa hundert Gäste zur Tanzfläche bewegt und tanzten nun oder unterhielten sich, während sie an ihren Gläsern mit Rotwein oder Blut nippten. Ein paar der Gesichter kannte ich aus Vincents Hofstaat, viele hatte ich jedoch noch nie gesehen. Die Vertreter des Hauses des Schattens trugen eng anliegende Kleidung aus schweren Stoffen. Bei den Frauen waren es reich verzierte Korsagen und figurbetonte Seidenkleider, bei den Männern steife, kurze Jacketts – ganz anders als die weich fließenden Seidengewänder des Hauses der Nacht. Mir fielen auch ein paar Unbekannte auf, die zwar zum Haus der Nacht gehörten, aber nicht in der Stadt wohnten. Vermutlich kamen sie von den weiter entfernten Außenbezirken ganz im Westen der Wüste oder den im Knochenmeer gelegenen Inseln, die zum Herrschaftsgebiet des Hauses der Nacht gehörten.
»Ich achte schon die ganze Zeit auf verbundene Wunden an den Händen.« Vincent sprach leise und mit gesenktem Kopf, damit niemand außer mir ihn hörte. »Einige haben ihren Blutzoll schon entrichtet.«
Den Blutzoll an Nyaxia – um die Teilnahme am Kejari zu besiegeln. Meine Gegner.
»Lord Ravinthe.« Vincent wies mit dem Kopf in Richtung eines aschblonden Mannes, der am anderen Ende des Ballsaals in ein angeregtes Gespräch vertieft war. Als er lebhaft gestikulierte, sah ich an seiner Hand etwas Weißes – einen tiefrot getränkten Verband, der die entsprechende Wunde verdeckte.
»Ist lange her, dass ich mit ihm gekämpft habe«, sagte Vincent. »Sein rechtes Knie macht ihm zu schaffen. Er kann es gut verbergen, aber es verursacht ihm starke Schmerzen.«
Ich nickte und speicherte die Information ab, während Vincent mich weiter durch den Saal führte. Auf Außenstehende wirkten wir vermutlich, als würden wir lässig umherschlendern. Mit jedem Schritt wies er mich jedoch auf weitere Wettbewerber hin und erzählte mir alles, was er über sie und ihre Schwächen wusste.
Eine schlanke, blonde Frau mit markanten Gesichtszügen.
»Kiretta Thann. Ich bin vor langer Zeit einmal auf sie getroffen. Schwach als Schwertkämpferin, aber stark in Magie. Hüte deine Gedanken, wenn du in ihrer Nähe bist.«
Ein großer, dicker Mann, der mich sofort ins Visier genommen hatte, als wir den Saal betraten.
»Biron Imanti. So blutrünstig, wie ich noch niemanden sonst erlebt habe.« Angewidert verzog Vincent den Mund. »Er wird sich auf dich stürzen, aber so unbedacht, dass es ziemlich leicht für dich sein dürfte, es gegen ihn zu verwenden.«
Die erste Runde durch den Ballsaal hatten wir hinter uns gebracht und sogleich machten wir eine weitere. »Ich habe noch ein paar andere Leute gesehen. Ibrihim Cain. Und …«
»Ibrihim?«
Vincent runzelte die Stirn. »Viele machen nur bei dem Kejari mit, weil sie glauben, sie hätten keine andere Wahl.«
Ich erspähte Ibrihim ganz hinten im Saal. Er war ein junger Vampir, nicht viel älter als ich, und auffallend zurückhaltend. Als hätte er meinen Blick gespürt, hob er seinen schwarzen Lockenkopf und sah mich mit einem zaghaften Lächeln an, das an den Stellen, wo ihm die Eckzähne fehlten, sein verstümmeltes Zahnfleisch entblößte. Neben ihm stand seine Mutter, die so aggressiv war wie ihr Sohn sanft – denn sie war die Ursache seiner Verletzungen.
Die Geschichte war so alltäglich wie tragisch: Vor etwa zehn Jahren, als Ibrihim im Teenageralter war, hatten seine Eltern ihn überwältigt, ihm die Eckzähne gezogen und sein linkes Bein so zertrümmert, dass er hinkte. Ich muss damals etwa dreizehn Jahre alt gewesen sein. Ibrihims Gesicht war ein einziger Bluterguss gewesen, bis zur Unkenntlichkeit vollkommen entstellt. Ich war schockiert und konnte gar nicht verstehen, warum Vincent es nicht war.
Was ich damals noch nicht wusste, war, dass Vampire in ständiger Angst vor ihren eigenen Familienmitgliedern lebten. Ihre Unsterblichkeit machte die Erbfolge zu einer blutigen Angelegenheit. Selbst Vincent hatte seine Eltern und seine drei Geschwister umgebracht, um auf den Thron zu kommen. Um der Macht willen töteten Vampire ihre Eltern und verstümmelten ihre eigenen Kinder, damit diese nicht das Gleiche taten. Das bekräftigte ihren Anspruch in der Gegenwart und sicherte ihnen die Zukunft. Die Linie würde fortbestehen … aber erst dann, wenn sie dazu bereit waren.
Immerhin würde Ibrihim durch das Kejari die Chance bekommen, seine Würde zurückzuerlangen, oder im Kampf sterben. Aber …
»Er glaubt doch nicht etwa, dass er gewinnen wird?«, raunte ich Vincent zu.
Vincent warf mir einen Seitenblick zu. »Genau das Gleiche denken alle hier vermutlich auch über dich.«
Damit lag er gar nicht falsch.
Ein erdrückender Duft nach Lilien umwehte uns.
»Da seid Ihr ja, Sire. Ihr wart plötzlich verschwunden, ich war schon beunruhigt!«
Vincent und ich drehten uns um. Jesmine kam auf uns zu und warf dabei gekonnt ihr wogendes aschbraunes Haar über die Schulter. Sie trug ein leuchtend rotes Gewand, das, wenn auch lässig geschnitten, eng an ihrem üppigen Körper anlag. Im Gegensatz zu den meisten der anderen Hiaj-Vampire hier hatte sie ihre Flügel ausgeklappt – sie waren schiefergrau und wurden vom Faltenwurf ihres tiefen Rückenausschnitts umrahmt wie ein Gemälde. Das Dekolleté war ebenfalls tief ausgeschnitten, sodass es den Blick auf eine marmorierte weiße Narbe freigab, die genau über ihrem Brustbein nach oben verlief.
Beides stellte sie immer gern zur Schau – sowohl das Dekolleté als auch die Narbe. Und das konnte ich ihr auch nicht verdenken. Objektiv betrachtet war ihr Dekolleté echt beeindruckend, und die Narbe … Wie es hieß, hatte Jesmine eine Pfählung überlebt. Wenn mir so etwas passiert wäre, hätte ich nicht einen verfluchten Tag ausgelassen, um diese Narbe zu präsentieren.
Vincents Mundwinkel zuckten. »Immer im Dienst. Aber das kennst du ja selbst.«
Jesmine hob ihr blutrotes Glas. »Allerdings«, säuselte sie.
Hol mich doch die verdammte Sonne!
Ich wusste nicht so recht, was ich von der neuen Kommandeurin über Vincents Leibgarde halten sollte. Sie war erst vor Kurzem auf diesen Posten befördert worden. Eine Frau in einer so hohen Position war selten im Haus der Nacht – nur drei Frauen hatten es in den letzten tausend Jahren so weit gebracht, weshalb ich das schon aus Prinzip eigentlich begrüßte. Aber ein gesundes Misstrauen war mir mein Leben lang anerzogen worden. Vincents vorheriger Kommandeur, ein zotteliger, mit Narben übersäter Mann namens Thion, hatte zweihundert Jahre lang in seinen Diensten gestanden. Ich mochte ihn nicht, aber zumindest wusste ich, dass er loyal war.
Doch als Thion erkrankte und schließlich starb, war seine hochrangigste Generalin die naheliegende Wahl für die Nachfolge gewesen. Eigentlich hatte ich auch gar nichts gegen sie, aber ich kannte sie nicht besonders gut, und von daher würde ich ihr ganz sicher nicht trauen.
Vielleicht duldete ich aber auch bloß niemanden neben mir, denn Vincent schien sie zu mögen.
Er beugte sich ein Stück vor. »Du siehst hinreißend aus«, raunte er ihr zu.
Sogar sehr zu mögen.
Unwillkürlich kam mir der Hauch eines spöttischen Zischens über die Lippen, woraufhin Jesmine mich aus ihren amethystfarbenen Augen anstarrte. Da sie noch neu am Königshof war, betrachtete sie mich mit unverhohlener Neugier und nicht mit genervtem Unmut wie alle anderen aus Vincents engem Kreis der Vertrauten.
Ihr Blick wanderte langsam an mir hinauf. Sie musterte meine Statur, meine Lederkleidung und schien sich jeden einzelnen meiner Gesichtszüge genau einzuprägen. Hätte ich es nicht besser gewusst, wäre mir dieser Blick lüstern vorgekommen. Eigentlich schmeichelhaft, hätte es nicht allzu oft bedeutet, dass man mir an die Kehle wollte.
»Guten Abend, Oraya.«
»Hallo Jesmine.«
Ihre Nasenflügel blähten sich leicht auf – eine kaum merkliche Regung, die mir jedoch sofort auffiel. Ich machte einen Schritt zurück und meine Hand glitt hinunter zu meinem Dolch. Auch Vincent hatte Jesmines Reaktion registriert und schob sich unauffällig zwischen uns.
»Dann gib mir mal ein Update über das Haus des Blutes«, sagte er zu Jesmine und bedeutete mir mit einem Blick, dass ich verschwinden sollte. Ich zog mich zurück in Richtung des Torbogens, möglichst weit weg vom Gedränge.
Hier konnte ich etwas aufatmen, denn es war eine einigermaßen sicherere Entfernung zu den Gästen. Aber eben nur einigermaßen.
Wenn man jung ist, kann Angst geradezu lähmend sein, und wenn sie ständig präsent ist, vernebelt sie einem die Sinne. Doch da die Angst zu meinem stetigen Begleiter wurde, betrachtete ich sie mittlerweile wie eine weitere Körperfunktion, die man regulieren musste – wie Puls, Atem, Schwitzen, Muskeln. Mit den Jahren hatte ich gelernt, alles Physische von meinen Emotionen abzukoppeln.
Als ich mich an den Türrahmen lehnte und die Gäste beobachtete, spürte ich den bitteren Geschmack von Neid. Diejenigen, auf die Vincent mich hingewiesen hatte, weil sie auch am Kejari teilnehmen würden, sah ich mir ganz genau an. Außer Ibrihim, der still an der langen Tafel saß, schienen die anderen sich keine Sorgen zu machen, sondern tanzten, tranken und flirteten den ganzen Abend lang. Würden sie, wenn der Morgen graute, umschlungen von einem, zwei oder drei Partnern tief schlafend keinen Gedanken daran verschwenden, ob sie überhaupt noch so lange lebten, dass sie wieder aufwachten?
Oder würden auch sie schließlich wach liegen und an die Decke starren, während der tödliche Hauch der Göttin schon über ihre Haut strich?
Ich richtete meinen Blick auf das andere Ende des Saals.