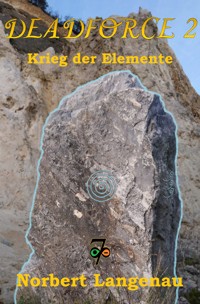2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Deadforce
- Sprache: Deutsch
Julian kann endlich seinen Traum leben und Magie studieren. Doch schon bald wird ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn erneut ist das Kaiserreich Anthem Gows auf seine Hilfe angewiesen. Zusammen mit seinem besten Freund Severin macht sich Julian auf, einen lange vergessenen Bund zwischen Völkern wiederherzustellen. Das ist auch dringend nötig, denn nur gemeinsam können sie sich gegen die enorme Macht der Yash'Asharr, der Echsenwesen behaupten, die schon bald Erudicor, die größte Stadt der Welt angreifen wollen. Auf ihren Abenteuern müssen Julian und Severin viele Prüfungen meistern und lernen so, dass man mithilfe seiner Freunde selbst Unmögliches schaffen kann. Als eigenständiges Abenteuer, für das kein Vorwissen aus vorangegangenen Büchern notwendig ist, eignet sich dieses Epos besonders für Liebhaber von Fantasy. Empfohlen nur für Erwachsene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1179
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Norbert Langenau
Deadforce 3
Völkerbund
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung
Prolog
Kapitel I: Julians Erwachen
Kapitel II: Ein schwarzer Tag
Kapitel III: Die Geschichte der zwei Lisas
Kapitel IV: Aufbruch
Kapitel V: Ein erneutes Treffen
Akt I – Zwerge
Kapitel VI: Das Fest der nördlichen Magie
Kapitel VII: Der Fluch der Zwerge
Kapitel VIII: Tiefer und tiefer hinab
Kapitel IX: Von Angesicht zu Angesicht
Kapitel X: Ewige Dankbarkeit
Akt II – Orks
Kapitel XI: Orkisches Temperament
Kapitel XII: Der Terrorist des Nordens
Kapitel XIII: Familienangelegenheiten
Kapitel XIV: Lehrstunde in der alten Sprache
Akt III – Elfen
Kapitel XV: Die Hauptstadt der Elfen
Kapitel XVI: Die List
Kapitel XVII: Das blutige Bankett
Akt IV – Trolle
Kapitel XVIII: Ankunft in Arkhenthal
Kapitel XIX: Eine andere Dimension
Akt V - Menschen
Kapitel XX: Der Kaiser von Ganredlah
Kapitel XXI: Ostwärts
Kapitel XXII: Am Rabenberg
Kapitel XXIII: Rebellion!
Akt VI – Dunkelelfen
Kapitel XXIV: Der General
Kapitel XXV: Die Geschichte vom Dunkelschmied und der Feuerbardin
Kapitel XXVI: Severins Wunsch
Kapitel XXVII: Requiem für einen Helden
Kapitel XXVIII: Vorabend der Schlacht
Finale – Die Schlacht des neuen Völkerbundes
Epilog – Der aufziehende Sturm
Anhang
Impressum neobooks
Einleitung
Sehet, all ihr Echsen und erzittert! So doch vor euch ein Wesen steht, erhaben und vollkommen, der Eine, euch alle zu beherrschen. Echsenkaiser soll er sein und ob seiner mächtigen Schritte erbebt die Welt. Er wird lange und grausam regieren, doch auch er, der Allerhöchste, wird nicht ewig verweilen. Da die Sterne voraussagen, eines Tages mag er sterben. Durch die Hand eines Kinds des Schicksals wird er sein Ende finden, er, der die freie Welt versklavt.
– Auszug aus der Caecht-Prophezeiung, geschrieben von Istulbir, dem Echsenweisen
Aus den Gesängen von Yahrgrim
Freundschaft
Was bin ich, wenn nicht eine Last?
Zugleich eine Prüfung, die du mir auferlegt hast,
hohles Gelächter und bittere Tränen,
wer von uns beiden wird sich denn grämen?
Wer hört den Ruf des Freundes noch,
„hilf mir, mein guter Freund“,
wer dient schon unterm eisern’ Joch,
auf dass er's alsbald bereut?
Doch nicht nur Schmerz soll uns verbinden,
ist die Freundschaft doch mannigfaltig behaftet,
in gemeinsamen Momenten können wir leicht erblinden,
die Freude viel mehr als mein Herz verkraftet.
So stehen wir vereint, Seite an Seite,
und halten uns gegenseitig den Rücken frei,
und egal was da kommen mag, in allen Zeiten,
höchstens das Schicksal könnte uns reißen entzwei.
Denn du bist mein Freund und ich bin der deine,
gemeinsam trotzen wir selbst den höchsten Bergen,
und ganz am Ende ruhen beinander unsere Gebeine,
zum Schluss, wenn wir beide schließlich sterben.
Prolog
Es stürmte. Ein unheimlich starker Regen rasselte an jenem Abend auf das unbekannte Fleckchen Land nieder, auf welchem eine Gestalt in schwarzem Gewand eilends lief. Plötzlich erhellte ein Blitz die finstere Umgebung. Dabei war es noch gar nicht so spät, erst kurz nach 19 Uhr. Wir schrieben gerade Ende März im Jahr 983. Elonius, der auf dem Weg zu einer sehr wichtigen Zusammenkunft war und sich schon enorm verspätete, hastete, so schnell es seine Beine erlaubten, über einen gepflasterten Steinweg, der zwischen abgeernteten Feldern entlang verlief. Als ihm eine Windböe den Regen ins Gesicht peitschte, zog er sich die Kapuze noch tiefer in ebenjenes.
„Verdammt, die anderen werden schon durchdrehen, weil sie so lange auf mich warten müssen. Was Jack wohl sagen wird? Da vorne ist immerhin schon der Berg. Nicht mehr...nicht mehr lange.“
Elonius keuchte vor Erschöpfung, doch er durfte jetzt nicht nachlassen. Immerhin würde heute Abend etwas geschehen, das die Welt für immer veränderte. Doch dafür brauchte es alle von ihnen. Alle sieben. Er nahm zu Recht an, dass die anderen sechs sich längst versammelt hatten und auch schon lange bereit für den Beginn des Rituals waren. Nur er ließ noch auf sich warten. Doch auch wenn er sich schuldig fühlte, war es gar nicht seine Schuld, dass er zu spät kam.
Elonius hatte seine Reise genau geplant und sich von der nächstgelegenen Stadt, genannt Daìb, eine Kutsche organisiert, die ihn zu jenem Berg kutschieren sollte. Wie er in weiser Voraussicht kalkuliert hatte, würde die Fahrt etwa 7 Stunden und 30 Minuten in Anspruch nehmen. So blieb ihm noch eine halbe Stunde Zeit, um den Treffpunkt zu erreichen. Um zehn Uhr morgens war die Kutsche losgefahren und stetig ostwärts gereist. Alles lief gut, bis sie dem Ziel schon ziemlich nahe kamen. Dann ging alles den Bach runter. Mit einem abrupten Abstoppen der Kutsche kam diese zum Stillstand und Elonius wurde unsanft in der Kabine herumgeworfen. Als er sie verließ, um nachzusehen, was denn das Problem war, fiel ihm auf, dass eine Horde von Reitern auf mächtigen Rössern den Wagen umstellt hatte. Die Kutscher, ein altes, sehr freundliches Ehepaar, das alles, ja sogar ihre Arbeit zusammen unternahm, war brutal niedergemetzelt worden und die Pferde, welche einst die Kutsche zogen, lagen in Einzelteilen neben ihnen. Alle Reiter grinsten den einsamen, schmächtigen Mann finster an, der da aus der Kutsche gestiegen war. Schließlich begann einer, besonders groß und besonders grimmig dreinblickend, zu reden:„Wohin so eilig, Reisender? Wollt Ihr nicht lieber unsere Gesellschaft genießen? Wenn wir schon dabei sind, könnt Ihr uns auch gleich all Eure Habe überlassen und ich würde es schnell machen, wenn Euch etwas an Eurem Leben liegt.“
Da konnte Elonius nicht mehr an sich halten.
„Wenn mir etwas an meinem Leben liegt? Denkst du etwa, den beiden Kutschern lag nichts an ihrem Leben? Oder womit haben sie es verdient, so brutal geschlachtet zu werden? Was haben sie euch getan, ihr dreckigen Banditen? Nichts bekommt ihr von mir, höchstens den Tod!“
Alle Reiter lachten dreckig, einige spuckten aus. Einer warf Elonius etwas an den Kopf, was sich als verschimmelte Karotte herausstellte. Der Anführer antwortete gelassen:„Du kleiner Wurm glaubst, du wärst stark? Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Malimo, der Ochse und einer der tödlichsten Anführer unseres großen Volkes, der Hunnen. Zeig uns gefälligst etwas Respekt, denn wir sind die Herren dieser Lande.“
„Als ich zuletzt nachgesehen habe, gehörten diese Lande zu Ganredlah und der Herr von Ganredlah war Aloisius Rabenkrang. Entweder haben sich die Zeiten also geändert oder Ihr redet einen Haufen Dünnschiss, Herr Reiter. Ihr verlangt nach Respekt? Glaubt nicht, dass ihr von irgendwem etwas anderes als Verachtung und Hass bekommt, so wie ihr die Leute behandelt. Ich weiß, was man sich über die Hunnen erzählt. Überall, wo ihr herumzieht, bleibt nichts am Leben. Nur Feuer und Leichen bleiben zurück, um von grausamen Geschichten zu erzählen.“
Malimo der Ochse stieg vom Pferd, ging mit großen Schritten auf Elonius zu und türmte sich schließlich vor ihm auf. Verächtlich blickte er auf sein Gegenüber hinab und sagte:„Tote erzählen keine Geschichten, du Dummbeutel. Deshalb wird auch nie jemand deine Geschichte erfahren, wie ich dich in zwei Hälften gerissen habe und du geschrien hast wie ein kleines Mädchen! Ha ha ha!“
Alle stimmten in das Gelächter ein, doch in Elonius’ Augen funkelte etwas auf. Ein Funke, den man niemals erwecken sollte, denn aus diesem Funken ging Vernichtung hervor. Elonius, die einzig hagere Gestalt in einer Gesellschaft wahrer Hünen, ballte seine rechte Faust und sie wurde glühend heiß, bis er sie schließlich öffnete und ihr ein Inferno entströmte. Malimo, eben noch felsenfest und standhaft vor Elonius stehend, sprang nun von einem Bein aufs andere, während er versuchte, einzelne Flammen auf seinem langen Bart, welcher ihm über den Bauch ragte und am Ende zu einem Pferdeschwanz gebunden war, mit seinen Händen zu löschen. Doch Elonius zögerte nicht. Er war schon dabei, den nächsten Angriff zu entfesseln, eine Feuerwelle die alle Reiter ringsum erwischte, ihre Pferde aufflammen ließ und sie alle zu Boden schickte, denn die Pferde wurden wild, nahmen Reißaus und warfen die Reiter restlos ab. Einige von ihnen besaßen schon an vielen Stellen Brandwunden, doch schienen sie widerstandsfähig zu sein. Das half ihnen allerdings auch nichts, als plötzlich aus Flammen geformte Speere durch die Luft sausten und einen Hunnen nach dem anderen durchbohrten. Elonius war in seinem Element und zeigte diesen Wichtigtuern, was passierte, wenn sie sich mit ihm anlegten. Mit einem der Sieben. Malimo hatte indessen seinen Körper erfolgreich vor den Flammen gerettet und zog nun eine zweischneidige Axt, mit der er weit ausholte. Während er weiter Flammenspeere herumflitzen ließ, sprang Elonius elegant zur Seite, ließ Malimo mit der Axt in den Boden hauen und schickte eine konzentrierte Ansammlung von Flammen direkt auf dessen Hände. Der Hunnenanführer ließ die Axt los, schrie auf und blies sich auf die verbrannten Hände. Sofort darauf wollte er den Hänfling packen und ihm mit bloßen Fäusten das Leben aus dem Körper prügeln. Doch er erwischte ihn nicht. Denn Elonius war viel zu schnell, viel zu geschickt und viel zu gut in dem, was er tat. Von den anderen Hunnen blieben kaum noch welche übrig und allmählich erkannten selbst die dümmsten unter ihnen, dass es keinen Sinn hatte, dieses Individuum weiter zu bekämpfen. Es würde nur zum vollständigen Tod ihrer Sippe führen. Also suchten sie das Weite, sehr zum Ärger ihres Anführers.
„Wo wollt ihr hin? Elendes Pack, kämpft gefälligst!“
Elonius stellte sich vor Malimo und obgleich er um einen Kopf kleiner war, schien er nun ihn zu überragen. Der Hunne blickte ihn finster an.
„Was glaubst du, wer du bist? Du einfältiger Wurm spielst ein wenig mit deiner Magie und tötest meine Männer. Denkst du, das beeindruckt mich? Dieses Land wird immer den Hunnen gehören. Wir tun, was wir wollen, nehmen uns, was wir wollen und töten, wen wir wollen. Der Weg des Hunnen ist es, das zu tun, was man will, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Deshalb zerquetsche ich dich nun, du schwächliches Insekt.“
Malimo hob beide Fäuste und ließ sie auf Elonius niedersausen. Er verfehlte. Denn das akrobatische Insekt war seinem groben Angriff mit Leichtigkeit ausgewichen und starrte ihm aus sicherer Entfernung ebenso finster entgegen.
„Der Weg des Hunnen. Dann spiele ich jetzt auch mal Hunne und sage, ich töte dich ohne auf dich Rücksicht zu nehmen. Passt doch ganz gut, findest du nicht?“
„Wage es nicht, dich über mein Volk lustig zu machen, du Wurm!“
„Genug, halt die Fresse.“, sagte Elonius gleichgültig.
Dann entfesselte er einen mächtigen Schwall von Flammen aus beiden Händen und verbrannte Malimo das Gesicht, während dieser laut seiner eigenen Bezeichnung von vorhin „wie ein kleines Mädchen“ schrie. Als Elonius fertig war, fiel das ganze umliegende Gebiet in einen Zustand absoluter Stille. Nicht einmal die Insekten und Vögel wagten es, einen Laut von sich zu geben. Langsam wurde es dunkel und die Sonne stand schon sehr tief am Horizont. Elonius aber war nun gezwungen, zu Fuß den restlichen Weg zurückzulegen. Missmutig brach er schleunigst auf. Im Vorbeigehen tippte er dem auf die Knie gefallenen Leichnam Malimos kurz auf die Schulter und sagte:„Das war wohl nichts. Für einen Hunnen ziemlich erbärmlich. Und die sollen bedrohlich sein? Was für eine Enttäuschung.“ Die Leiche fiel hintenüber zu Boden und alles, was man von Malimos einstigem Gesicht noch sehen konnte, war der blanke Schädel, von dem das Feuer jegliches Fleisch geschmolzen hatte.
Als er seinen Weg fortsetzte, dachte sich Elonius zu seinem Sieg:„Vielleicht sind meine Flammen nicht so stark wie die von Madeleine, aber verdammt nochmal, sie sind noch immer ausreichend, um mit diesen Schwächlingen fertigzuwerden.“
Zurück in der Gegenwart lief Elonius noch immer durch den plötzlich aufgezogenen Sturm, der ihm ebenso wie die Erschöpfung in seinen Beinen zu schaffen machte. Doch er hatte keine Wahl, er konnte nicht nachlassen. Vielleicht hatten die Hunnen ihn aufgehalten und ihn seiner schnellen Eskorte beraubt, doch er würde die anderen erreichen, auch wenn er danach zusammenbrach. Auch wenn sie durchaus vernünftig waren und ihn aufgrund der Umstände bestimmt unbehelligt ließen, hatte er ein wenig Angst vor Jacks Reaktion. Jack war niemand, den man leichtfertig erzürnen konnte. Gerade an solch einem bedeutenden Tag konnte man das noch weniger wagen, denn heute sollte sich schließlich die Welt verändern. Die Vorfreude auf das, was sie heute noch zusammen bewerkstelligen würden, schenkte Elonius neue Kraft und er kämpfte sich den Berghang hinauf, der leicht zu besteigen war und auf den der gepflasterte Pfad führte. Es roch nach nassem Gras. Er konnte diesen Geruch nicht ausstehen.
„Verdammter Regen!“, ließ er sich vernehmen, obgleich es niemand hörte.
Nach einer Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, erreichte er schließlich die Höhle, auch wenn es eher ein in den Berg gebauter Tempel war. Dunkle Blöcke aus schwarzem Marmor formten einen Gang, der Elonius zu einem großen Raum führte. Er hatte sein Ziel erreicht. Dort warteten schon alle sechs anderen. Jedoch waren sie sichtlich von seiner Verspätung betroffen. Zwei spielten miteinander Karten, einer schlief in der Ecke, zwei weitere saßen beisammen und flüsterten, doch der Letzte, ohne jeden Zweifel Jack, ging nervös auf und ab. Als der durchnässte und ausgelaugte Elonius schließlich zu ihnen trat, hoben sie alle die Köpfe und blickten ihn ungläubig an. Die schlafende Gestalt mit einem Strohhut sprang auf und sah sich um. Als er erkannte, dass der letzte der Sieben endlich eingetroffen war, sprintete er sofort zu ihm und patschte ihm mit seinen unförmigen Händen auf den Rücken.
„Gut, dich zu sehen, Elonius.“, sagte er erfreut. „Ich wusste, du würdest noch auftauchen.“
„Vielen Dank, Chen.“, gab Elonius zurück. „Es ist gut, endlich hier zu sein.“
„Gut?“, ertönte eine angespannte Stimme von weiter hinten. „Gut?!“
Mit einem Satz war Jack bei den anderen und machte sich vor Elonius groß. Diesmal allerdings wurde er selbst klein und versuchte nicht, sich wie bei den Hunnen zu behaupten.
„Wir warten jetzt schon geschlagene anderthalb Stunden auf dich. Was ist deine Entschuldigung für eine so unangebracht große Verspätung? Los, rede!“
„Ich hatte meine Reise perfekt geplant, doch dann griffen Hunnen meine Kutsche an, töteten alle und umzingelten mich. Nachdem ich mich ihrer entledigt hatte, legte ich den restlichen Weg zu Fuß zurück, was leider länger dauerte. Glaub mir, Jack, es tut mir leid. Ich wollte nichts lieber als pünktlich sein. Ich lief, so schnell es meine Beine vermochten. Doch schneller ging es nicht.“
Keiner sagte etwas. Alle warteten auf Jacks Antwort. Dazu kam es jedoch nicht, denn plötzlich hallte eine lachende Frauenstimme durch den Raum. Madeleine hatte aufgehört, mit Pietr zu flüstern und hatte sich zu den anderen gesellt. Pietr war ihr schließlich auch gefolgt.
„Du erlebst immer die ganzen Abenteuer. Dabei hatte ich so sehr gehofft, selbst von Hunnen attackiert zu werden. Es gibt doch um die 43 Sippen, warum gerate ich da an keine einzige und du schon? Meine Reise hierher war total langweilig. Alles verlief ohne Komplikationen. Sag schon, Elonius, wie waren die Hunnen? Waren sie groß? Waren sie gefährlich?“
„Gefährlich, pah.“, gab Elonius gelangweilt von sich. „Wenn die gefährlich sind, dann bin ich ein Gott. Vielleicht können sie die normalen Bürger ermorden, weil die sich nicht anständig zu wehren wissen, aber sobald sie jemanden wie mich treffen, der sich ein wenig verteidigen kann, kratzen sie ab wie die Fliegen. Langweilig.“
„Och, das ist aber schade. Ich hätte so gerne eine richtige Herausforderung.“, gab Madeleine enttäuscht von sich.
„Nun gut...“, begann Jack, „Wenn dem so ist, scheint mir das wohl eine ausreichende Begründung. Wer hätte schon ahnen können, dass die Hunnen gerade deine Kutsche angreifen. Aber sei's drum, Hauptsache du hast sie zum Teufel gejagt.“
„Ein paar haben überlebt und sind geflohen. Die werden sicher überall die Geschichte erzählen, wie ich sie aufgemischt habe. Die armen Schwächlinge. Also, wollen wir loslegen? Ich bin bereit.“
„Nein, bist du nicht.“, sagte Jack und lachte. „Aber ich mag deine Entschlossenheit. Ruhe dich noch ein wenig aus, trockne deine Kleidung. Danach werden wir mit dem Ritual beginnen. Es ist nun ohnehin nicht mehr relevant, wann genau wir beginnen, solange es noch heute passiert.“
So genossen alle noch ein wenig die Ruhe vor dem Sturm. Elonius saß an einem Feuer, welches ohne jeden Zweifel Madeleine gemacht hatte. Die anderen setzten ihre Tätigkeiten von vorhin fort, bis auf Jack, der sich nun den Kartenspielern anschloss. Nach geraumer Zeit war es schließlich soweit und sie konnten ihr Ritual beginnen. Dazu löschten sie das Feuer und ließen den Raum im rötlichen Licht spezieller, schwarzer Kerzen nur ein wenig ausleuchten. Sechs von ihnen, darunter auch Elonius, stellten sich in einem Halbkreis auf. Nun trugen sie alle ihre schwarz glänzenden Gewänder und ihre markanten Elfenbeinmasken mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Die Maske von Elonius strahlte Freude aus, denn sie lächelte einfach. So fühlte er sich nun auch, denn der kleine Zwischenfall mit den Hunnen hatte weiter keinen Schaden angerichtet. Jack war nicht ausgerastet und die anderen schienen sogar mehr von seinem Kampf mit den Hunnen erfahren zu wollen. Er hatte ihnen zugesichert, seine Erlebnisse nach dem Ritual in voller Länge zu erzählen. Jack stellte sich nun vor die anderen und begann eine Ansprache.
„Meine lieben Freunde, heute ist es wieder einmal so weit. Erneut haben wir uns hier zusammengefunden, um etwas sehr Wichtiges zu tun. Etwas, das dringend getan werden muss. Etwas, das die Welt maßgeblich verändern wird. Wir erinnern uns nur ungern daran, wie uns vor zwei Jahren dieser verdammte düstere Magier, dieses Geschwür, lächerlich gemacht hat. Nicht nur, dass er es nicht vollbringen konnte, die Schlacht von Erudicor für sich zu entscheiden, es kam noch viel schlimmer. Damals dachte ich, ich gebe ihm noch eine Chance. Das, meine Freunde, war ein großer Fehler. Denn wie ihr alle wisst, maßte er sich an, uns alle und die Welt ebenfalls zu vernichten, indem er den verdammten Krieg der Elemente heraufbeschwor. Eines muss ich ihm lassen, Eier hatte er. Der ließ sich von niemandem etwas sagen und tat immer nur, was ihm im Sinn stand. Aber ein so einfach gestrickter Geist hat auch seine Schwächen. Immerhin wurde er schließlich getötet. Ein Äthergeborener. Was das bedeutet, wisst ihr ja, Freunde. Nie zuvor hat jemand einen Äthergeborenen getötet. Bisher war nicht einmal bekannt, dass dies möglich ist. Doch dieser Held, wie hieß er noch gleich, Julian, der hat allen gezeigt, dass man einen Äthergeborenen töten kann. Nun aber, zwei Jahre später, da versammeln wir uns, um der Welt endlich zu zeigen, was wir vermögen. Denn mit dem damaligen Desaster und seinen Folgen hat man uns zum Glück nicht assoziiert, aber dennoch blieben wir im Untergrund verborgen und niemand erfuhr von unserer Macht. Viel schlimmer noch, dieser düstere Magier hat uns lächerlich gemacht. Er hat uns herausgefordert, indem er den Krieg der Elemente entfesselte und uns damit auch um ein Haar tötete. Doch das war sein letzter Versuch. Nun ist er tot. Nun sind wir an der Reihe. Lasst uns der Welt zeigen, zu was wir imstande sind.“
Unter Jubelrufen der anderen ging Jack zu einem behelfsmäßig aufgebauten Pult, auf dem er einen schweren Wälzer platziert hatte. Dabei handelte es sich um das Dunkle Manifest, eines der ältesten und gefährlichsten Bücher der Existenz. Das schwarze Leder, in das es eingebunden war, wurde auf der Vorderseite von einer seltsamen Fratze verziert, die einen mit grünem und orangem Auge sowie spitzen Zähnen in verschiedenen Farben, hauptsächlich Graustufen, schelmisch angrinste. Jack fuhr vorsichtig mit den Fingern über die Augen der Fratze und sprach, woraufhin die anderen sofort einstimmten:
Kein Rechtschaffner soll dies Siegel brechen
Keine reine Seele sich daran versuchen
Darum schwöre ich als Unreiner zu sprechen
Und Wissen im Namen des Bösen zu suchen
Nachdem sie diesen Vers im Chor rezitiert hatten, leuchteten die Augen der Fratze kurz auf und das Buch schlug sich von selbst auf. Es wusste genau, welche Seite die Jünger benötigten. Jack las aufmerksam den Text und zog dann einen gekrümmten Dolch mit sehr spitzer Schneide.
„Meine Freunde, nun müssen wir alle etwas von uns geben, um das Ritual zu beginnen. Ihr wisst, was zu tun ist.“
Jack stach sich mit der Dolchspitze in jeden Finger seiner linken Hand. Als das Blut langsam herausquoll, hielt er die Hand über eine schlanke Karaffe aus Silber und ließ es hineintropfen. Dann reichte er den Dolch weiter an Pietr, der nun selbst an der Reihe war. So wiederholten alle diesen Vorgang, bis es getan war.
„Gut, sehr gut.“, sagte Jack. „Nun muss es verbrannt werden. Elonius, Madeleine, wärt ihr so freundlich?“
„Aber immer doch.“, sagte Madeleine motiviert.
„Mit Freuden.“, antwortete Elonius.
Sie stellten sich gegenüber voneinander neben der Karaffe auf, jeder je eine Hand an dem silbernen Behältnis. Dann konzentrierten sie sich, erhitzten die Karaffe und schließlich kochte das Blut im Inneren, verdampfte langsam und dann war alles restlos verbrannt. Ein unangenehmer Geruch lag nun in der Luft, doch genau das gehörte zum Ritual dazu.
„Nun kommen wir zur Beschwörung. Bitte wiederholt während des gesamten Vorgangs im Chor immer und immer wieder folgenden Satz:’Leyshevret alambroven ses dollojuristera!’ Ich werde die Beschwörung vorlesen. Egal, was mit mir passiert, unterbrecht es nicht und wiederholt weiter diesen einen Satz. Es muss so getan werden oder es funktioniert nicht. Alles Gute, meine Freunde.“
„Alles Gute, Jack.“ gaben alle zugleich von sich.
Dann begann Jack, zu lesen, während die anderen in perfektem Chor den Satz wiederholten. „Leyshevret alambroven ses dollojuristera!“, sprachen sie, tief und skandiert.
„Große Valerie, Schrecken des vergangenen Zeitalters. Höre uns an, denn wir beschwören dich wieder zurück ins Reich der Lebenden. Kehre zu uns zurück und setze deine Aufgabe fort, alle zu töten, die schuldig sind. Lasse deinen gewaltigen Zorn frei und entfessle ihn...“
Weiter kam Jack jedoch nicht mehr, denn während der winzige Tempel im Inneren des Berges zu beben begann, stieg sein Körper plötzlich in die Luft. Im letzten Moment schnappte er sich das dunkle Manifest und las weiter vor.
„...entfessle ihn auf dieser Welt und der nächsten und jeder Welt, die gesäubert gehört. Lasse alle Negativität vergehen und bringe uns den endlosen Frieden. Kehre zu uns zurück, Valerie und morde in unserem Namen!“
Jack stieg weiter in die Luft, während die anderen weiterhin ihren Satz wiederholten und das rötliche Licht der Kerzen wurde immer schwächer, drohte, zu erlöschen. Ein kaltes, zutiefst unangenehmes Gefühl durchdrang alle sieben versammelten Jünger und Jack fiel ohne Vorwarnung zu Boden. Mit einem Schlag erloschen alle Kerzen zugleich und eine Druckwelle breitete sich von der Mitte des Raums aus, wo sich das Pult und der gefallene Jack befanden. Nun war alles totenstill und keiner konnte irgendetwas sehen. Dann aber starrte Jack in zwei leicht rot funkelnde, große Augen. Er konnte es kaum glauben. Es hatte funktioniert. Madeleine erschuf Feuer in ihren Händen und leuchtete den Raum aus. Da staunten alle, denn die Beschwörung war tatsächlich geglückt. Vor ihnen stand eine Gestalt, von schwarzen Schatten umschlungen, die selbst das helle Licht von Madeleines Flammen nicht durchdringen konnte. Am Kopf trug die dünne Frau mit dem wallenden, blonden Haarschopf eine rabenschwarze Maske, die stilistisch wie ein Schnabel geformt war und auf Höhe der Augen zwei große, durchsichtige, rote Scheiben besaß, durch die man wohl sehen konnte. Das war Valerie, die erste und beste Serienmörderin der Existenz. Sie hatte im zweiten Zeitalter gelebt, doch das war schon vor sehr langer Zeit gewesen. Nun aber war sie im späten dritten Zeitalter wieder zurück in die Welt der Lebenden geholt worden. Die Jünger hatten ihre Beschwörung erfolgreich abgeschlossen und nun besaßen sie eine nahezu allmächtige Waffe.
Valerie stand da und sagte nichts. Jack erhob sich vom Boden, straffte sich und stellte sich aufrecht vor Valerie.
„Valerie, wir sind diejenigen, die dich gerufen haben und wir sind von nun an deine Gebieter. Ab jetzt sollst du nur noch die töten, die wir dir als Ziel nennen. Niemanden sonst, hast du verstanden?“
Valerie nickte.
„Gut, dann schnapp dir dein Messer und mach dich bereit, denn es gibt eine Menge zu tun. Dein erstes Ziel ist...“
Währenddessen versammelte der Echsenkaiser Yashurion Krahr'Zhun in seinem Kaiserreich Selvunia, dem bevölkerungsreichsten Land Europas, sein Volk in der Hauptstadt Sigyllsburg. Der Großteil der Echsen, die sich auf dem riesigen Versammlungsplatz am Fuße eines altertümlichen Steintempels versammelten, bestand aus Kriegern, doch waren auch einige Echsen unter ihnen, die nicht so viel mit Kämpfen am Hut hatten. Immerhin war es ein großes Ereignis, wenn der Kaiser sprach und das wollte niemand verpassen. Nairog, ein einfacher Echsenkrieger, saß auf der großen Treppe von Khish'Adum, deren marmorne Stufen den Tempelvorplatz mit dem erhöht angrenzenden Marktplatz verbanden, und wartete auf seine Partnerin Tumva. Doch die beiden hatten ein Geheimnis. Eines, das nur sie selbst wissen durften und das nie an jemand anderes Ohren dringen durfte, denn ihr Leben hing davon ab. Sie waren Spione für Kaiser Theron von Anthem Gows und da die beiden Kaiserreiche direkt nebeneinander lagen, war nicht auszuschließen, dass der Kaiser womöglich geplante feindselige Handlungen gegenüber seinem Nachbarland verkünden würde. Daher hielten sich die beiden eingeschworenen Spione, die ihren Dienst nun schon einige Jahre sehr gut verrichteten, bereit. Zumindest einer von beiden. Nairog beobachtete jede noch so kleine Bewegung, die am Tempel vor sich ging. Die unzähligen Wachen, bestehend aus großen und stark gepanzerten Alligatoren, die langsam Stellung bezogen, ebenso der Echsenweise Chadmeiros, dessen ausgezehrter, alter Körper sich mühsam über den steinernen Boden schleppte. Der uralte Waran stützte sich auf seinen Stab, einen verkrüppelten, gewundenen Ast mit einem dicken Knoten am oberen Ende, der eine besonders gute Auflagefläche für die knöchernen Hände des Warans bot. Wenn Chadmeiros kurz den Kopf hob und um sich blickte, konnte man die unzähligen Falten an seinem ohnehin schon faltigen Hals entdecken, die durch sein hohes Alter noch vervielfacht wurden. Mit schwachen Augen versuchte er, irgendetwas in der Ferne zu erblicken und obgleich etwas geschwächt war sein Blick ebenso gnadenlos wie seine wahre Gesinnung. Nairog blickte ihm direkt in die Augen, doch der Echsenweise schien seinen Blick nicht zu erwidern.
„Gut.“, dachte Nairog. „Der Alte wittert wohl etwas, aber er kann es nicht einordnen. Wenn wir uns bedeckt halten, wird er nie dahinter kommen.“
Ebenso wie alles, was sich am Tempel tat, behielt der Spion auch den Himmel im Auge. Denn der immer stärker werdende Wind, der von Westen, vom Meer, heranwehte, brachte immer mehr Wolken mit. Ob es wohl nachher regnen würde? Regen erschwerte eine schnelle Flucht, jedoch begünstigte er eine leise und unentdeckte Flucht, da alle zu beschäftigt damit waren, sich selbst trocken zu halten. Man sollte meinen, dass der Regen den Yash'Asharr, dem Echsenvolk nichts ausmachte, doch da mochte man sich irren. Denn über die Jahrtausende hinweg, die ihnen ihre Evolution erlaubt hatte, sich an andere humanoide Völker anzupassen, lernten auch sie die Vorzüge fester Bauten mit einem Dach über dem Kopf zu schätzen. Nun wussten sie, dass sie sich nicht einfach den Gezeiten ausliefern mussten. Sie konnten sich schützen und das taten sie auch. So waren sie über die Zeit hinweg verweichlicht und reagierten nun schon fast so empfindlich auf Regen wie Gla-Bogga, denen es nicht gefiel wenn ihr Fell nass wurde, oder gar Menschen. Mit einem tiefen Seufzer hoffte Nairog auf das passende Wetter für welche Art Flucht ihnen auch immer bevorstehen würde. Laut oder leise. Chadmeiros war wieder im Tempel verschwunden. Vom Kaiser bisher keine Spur. Die Vorbereitungen für eine solche Ansprache des Echsenkaisers zogen sich immer ewig in die Länge. Alle wollten, dass alles perfekt war, denn ansonsten würde es den Zorn des großen Yashurion Krahr'Zhun wecken und das konnte nie etwas Gutes verheißen. Schließlich war er einer der fünf Kaiser, die auf der Welt die Vormachtstellung besaßen und auch sicherlich nicht der schwächste unter ihnen. Unten in der Menge konnte Nairog sehen, wie einige der Echsen ihre Kinder auf ihre Schultern setzten, damit diese auch etwas sehen konnten. Die Kleinen jubelten vor Aufregung und waren vor Freude kaum zu bändigen.
„Wie früh sie einem schon diesen Schwachsinn vom großen Kaiser einbläuen, der uns alle beschützt und eines Tages die Welt für uns erobert.“, dachte Nairog spöttisch. Er hatte vor langer Zeit gelernt, seine nüchterne Weltansicht für sich zu behalten. Denn in Selvunia duldete niemand Kritik am Kaiser oder seinem Tun. Das wurde für gewöhnlich per Todesstrafe geahndet und da er seinen Kopf behalten wollte, dachte sich Nairog seinen Teil und schwieg einfach. Es machte das Leben in Selvunia wesentlich einfacher. Immerhin konnte er sich mit Tumva austauschen. Seiner Spionpartnerin, die wie üblich lange auf sich warten ließ. Dabei wollte sie sich nur eine Ratte am Spieß vom Marktplatz holen. Was sie so lange aufhielt? Plötzlich tippte jemand Nairog auf die Schulter. Er blickte um sich und wollte schon anfangen, über die Verspätung zu schimpfen, da sah er, dass ihm ein patrouillierender Wächter entgegenblickte.
„Was ist?“, fragte Nairog schroff.
„Du sitzt hier mitten im Weg, Bursche. Beweg dich zum Rand der Treppe, damit hier alle ungehindert auf und ab spazieren können.“
„Das ist doch wohl ein Witz? Als ob sich hier jetzt noch irgendjemand herumtreibt, wenn doch gleich die große Rede beginnt. Wer nicht längst hier ist, dem kann man ohnehin nicht mehr helfen.“
„Mir gefällt dein Ton nicht, Kerl. Wie heißt du?“, fragte der Wächter gereizt.
„Tuhreem.“, log Nairog. Er musste einen falschen Namen benutzen, sonst hätte man ihn wiedererkennen können.
„Noch nie gehört.“, gab der Wächter unbeeindruckt von sich. „Unter welchem Heerführer dienst du?“
„Bataillon des roten Alligators, dritte Division, fünfzehnter Zug unter Hauptmann Rachaviir. Denn werdet Ihr ja wohl kennen.“
„Ist nicht meine Aufgabe, alle namhaften Leute in der Armee zu kennen. Aber wie’s der Zufall so will, habe ich schon des Öfteren von Rachaviir gehört. Der ist zuverlässig. Scheinst mir in Ordnung zu sein. Aber versuch mal, etwas freundlicher zu reagieren. Du benimmst dich, als wärst du auf einem Begräbnis, so düster ist die Stimmung hier bei dir.“
„Fragt sich nur, wessen Begräbnis es sein wird, wenn der Kaiser seine Pläne enthüllt.“, dachte Nairog. Antworten aber tat er mit folgenden Worten:„Ich werde mich bemühen.“
Der Wächter ging seiner Wege. Kurz darauf schlug jemand Nairog gegen die Schulter und durch die Wucht wäre er fast vornüber von der Stufe gefallen. Ehe er reagieren konnte, saß schon Tumva neben ihm. Sie konnte zuweilen etwas ungestüm sein.
„Was hast du denn schon wieder angestellt? Der Wächter unterhielt sich etwas zu lange für meinen Geschmack mit dir.“
„Ach, der war nur mürrisch drauf, weil er bei so einem großen Ereignis Wache schieben muss und nicht all seine Aufmerksamkeit auf die Rede des Kaisers richten kann. Er hat nach Sündenböcken gesucht, die er bestrafen kann, um seinem Ärger Luft zu machen. Ich habe ihn gekonnt abgewehrt.“
„Gute Arbeit.“, gab Tumva von sich und biss ein Stück ihrer Ratte vom Stiel ab. Den Kopf. Nairog hatte sich nie viel aus Nagern am Stiel gemacht, deshalb war das für ihn auch nicht gerade der schönste Anblick. In der anderen Hand hielt Tumva jedoch einen kleinen Leinensack, den sie Nairog vor die Nase hielt.
„Ich hab uns Knusperschnecken mitgenommen. Magst du?“
„Da sag ich nicht nein.“ Nairog griff tief in den Sack hinein und zog mit einem Mal gleich drei der bis zur Grenze der Verbrennung gebratenen Schnecken heraus. Er steckte sich die erste in den Mund und genoss das Geräusch, welches die knuspernde Speise beim Kauen von sich gab. Tumva sah sich um, dann stupste sie Nairog mit der Schulter an.
„Sieh mal, da oben beim Tempel treibt sich Chadmeiros herum.“
„Das habe ich schon gesehen. Er war vorhin schon da, bis er kurzzeitig im Tempel verschwand. Der Kaiser selbst ist aber noch immer nicht erschienen.“
„Wahrscheinlich legt er wieder sein besonderes Prunkgewand an, das er zu solchen Anlässen gerne trägt.“ Tumva kicherte. Im Gegensatz zu Nairog nahm sie die Dinge nicht so ernst, sie machte sich eher im Stillen darüber lustig.
„Hach, in was für einem unglaublichen Reich wir doch leben dürfen, nicht wahr, Nairog?“, sagte sie träumerisch, wobei sie es keinesfalls positiv meinte.
„In der Tat.“, gab Nairog nüchtern, doch auch ein wenig amüsiert zurück. Dann wurde er wieder ernst. „Schade, dass Kuhteech heute nicht hier sein kann.“
„Ja, das stimmt. Er war wirklich eine tolle Echse. Es hat ihn viel zu früh erwischt.“ Tumva senkte den Kopf. Kuhteech war der dritte Spion gewesen. Vor weniger als einem Jahr hatte man ihn bei einem waghalsigen Einbruch in den Burgfried des Kaisers erwischt, wo er nach allerlei Aufzeichnungen zu Angriffsplänen oder zur Eroberung der Welt Ausschau hielt. Leider war er nicht so unbemerkt eingedrungen, wie er dachte. Nairog und Tumva hatten es ihm ausreden wollen, doch er hatte nicht auf sie gehört. Dafür zahlte er mit seinem Leben, das ihm nicht mit einem schnellen Stoß der Hellebarde von einem der Wächter, sondern langsam unter ewigen Qualen im Folterkeller genommen wurde. Es schmerzte die beiden, an ihren verstorbenen Kameraden zu denken. Doch zugleich war es auch eine Warnung.
Sei immer auf der Hut. Und blicke niemals zurück.
Als sie des dritten Spions gedachten, merkten sie nicht einmal, dass sich der Kaiser nun endlich zeigte. Wie von Tumva richtig vermutet, trug er ein prächtiges Prunkgewand, bestehend aus einem goldenen Brustharnisch, der mit lila Verzierungen geschmückt war, sowie einem purpurnen Umhang, der über seinen drei Meter großen Körper bis zum Boden hinabfiel. Doch auch eine edle Kampfhose aus goldenen Kettengliedern sowie zwei große, mächtige Handschuhe, an denen einige funkelnde Edelsteine eingearbeitet waren, gehörten dazu. Auf seinem Haupt thronte die Krone des Echsenkaisers, einst von den Echsenweisen kurz nach Entstehung ihres Volkes geschaffen, um den Einen und nur den Einen zu krönen, der sich als würdiger Echsenkaiser hervortun würde. Schließlich war diese Ehre Yashurion Krahr'Zhun zugefallen und man musste sich nicht fragen, warum. Es war sonnenklar. Denn die riesige, alles überragende Echse von drei Metern Größe und einer Fülle, die selbst ein ausgewachsenes Nashorn erblassen ließ, machte einen grimmigen, Furcht einflößenden und erhabenen Eindruck. Man konnte förmlich spüren wie unter jedem Schritt dieses Riesen die Erde minimal erbebte. Jetzt gerade schritt der Echsenkaiser mit zwei Stiefeln aus purem Gold einher, die sein Prunkgewand vervollständigten. Wobei es eher eine Rüstung war, doch da er Rüstungen liebte und sie ständig trug, waren sie für ihn wie Kleidung aus Stoff für gewöhnliche Leute. Eine Sache erlaubte sich Yashurion jedoch, die sich kaum jemand erlauben konnte. Er trug eine Rüstung aus richtigem Gold. Dabei wusste jedes Kind, dass man das nicht durfte, denn sonst beschwor man den Zorn der goldenen Ritter herauf. Diese Relikte aus einer längst vergangenen Zeit, der düstersten Epoche die es bisher in der Geschichte gegeben hatte, waren absolut tödliche Kämpfer und es war fraglich, ob man sie überhaupt töten konnte. Jedoch hatte man ähnliche Zweifel einst auch bei der Sterblichkeit von Äthergeborenen geäußert, bis Julian allen bewiesen hatte, dass man sie töten konnte. Die Goldritter waren vor langer Zeit mitsamt ihrem Reich untergegangen, doch bis heute sollten sich irgendwo auf der Welt noch welche von ihnen herumtreiben. Ihnen wurde nachgesagt, dass sie, von erhabenem Stand und mit unvorstellbarer Macht gesegnet, sich anmaßten, als einzige eine reine Goldrüstung tragen zu dürfen. Wenn es jemand anderes wagen sollte, so würde dieser Jemand bestimmt bald von einem der Ritter heimgesucht und blickte anschließend seinem sehr baldigen Ende entgegen. So gut wie jeder hielt sich an jene Regel, um vergangene Schrecken nicht unnötig aufzuscheuchen. Yashurion hingegen brauchte keine Angst zu haben, durch einen der goldenen Ritter getötet zu werden. Denn er besaß ein Geheimnis, das ihm zum Vorteil gereichte. Auf diese Weise konnte er herausfordernd seine prunkvolle Rüstung zur Schau stellen und dennoch konnte ihm kein Haar gekrümmt werden. Nun richtete er sich auf und überblickte die riesige Versammlung von Echsen. Der gesamte Tempelvorplatz war restlos überfüllt und auch an den Verbindungsstraßen zu anliegenden Plätzen drängten sich noch unzählige Yash'Asharr. Sogar die große Treppe von Khish'Adum, auf der auch Nairog und Tumva saßen, diente noch einigen weiteren Echsen als Sitzplatz. Die unten in der Menge patrouillierenden Echsenwächter waren nicht zu beneiden, denn sie mussten sich möglichst vorsichtig durch die anderen hindurchbewegen, um niemanden mit ihren Waffen zu verletzen. Das war bei einer so dicht aneinandergedrängten Menge wahrlich nicht einfach. Der Wind wurde stärker. Dann vernahm man die Stimme von Yashurion Krahr'Zhun, dem großen Echsenkaiser.
„Meine geliebten Echsen, ich grüße euch! Willkommen sei jeder und jede einzelne von euch. Es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das macht mich stolz, über ein so solidarisches Volk zu herrschen, das fest und entschlossen zu seinem Reich und seinem Kaiser steht. Umso mehr wird es euch freuen, zu hören, dass ich heute Großes zu verkünden habe. Und Großes soll bald vollbracht werden.“ Der Kaiser pausierte kurz, ging ein paar Schritte hin und her. Die Menge hing ihm gebannt an den Lippen. Alle hielten den Atem an. Alle außer Nairog, der sich genüsslich eine weitere Knusperschnecke gönnte. Nun, in dieser Stille drang das knackende und rasselnde Geräusch beinahe über den gesamten Platz bis hin zum Kaiser. Gerade, als Nairog den Blick des Kaisers auf sich spürte, schlug ihm Tumva auf den Rücken und mit einem Mal spuckte er die Schnecke aus. Wieder wurde es totenstill. Schließlich fuhr der Kaiser fort.
„Hört mich an! Die Welt ist im Wandel. Lange Zeit lebten alle in Frieden, doch dieser Frieden wurde nun schon vor über zwei Jahren gebrochen. Viele von euch mögen sich gefragt haben, warum ich nicht handelte. Immerhin gab es kaum einen Grund, nicht in andere Länder einzufallen, das Ihre zu dem Unseren zu machen, sie zu erobern. Doch lasst euch eines gesagt sein, eine erfolgreiche Eroberung mag sorgfältig geplant sein. Nun, da der Frieden nicht mehr währt und so wie ich das sehe wird er es auch so schnell nicht wieder, da wird es Zeit, allen zu beweisen, welches das wahre Kaiserreich ist, das Europa dominiert. Das ist nämlich nicht dieses einfältige Anthem Gows mit diesem Möchtegern-Kaiser Theron von Rommelshoff. Nein, das wahre Herrscherreich dieser Zeit kann nur Selvunia sein. Wir besitzen jetzt schon die größte Bevölkerung und die größte Landmasse Europas. Also was hält uns davon ab, uns noch mehr davon zu holen? Es wird Zeit, dass wir das tun, was uns vorherbestimmt ist. Wir sind dazu bestimmt, die herrschende Rasse zu sein. Warum wohl betrachten uns alle schon als das zweitgefährlichste Volk dieser Welt? Das wird nicht nur auf irgendwelchen Gerüchten basieren. Nein, sie fürchten uns und das völlig zu Recht. Vielleicht mögen die Dunkelelfen noch immer als gefährlicher gelten, doch sobald Europa uns gehört, holen wir uns Rasta-Varte und dann sind alle Dunkelelfen dahin und die Welt wird vor den Yash'Asharr erzittern!“
Die Menge tobte und jubelte. Alle Krieger reckten ihre Fäuste in die Höhe, begleitet von einem lauten, knappen Kriegsschrei. Auch das einfache Volk ließ sich hinreißen, mitzumachen. Nur zwei Echsen dachten nicht daran, in den allgemeinen Beifall einzustimmen. Nairog und Tumva, die sich nun einfach still verhielten und abwarteten, ob noch weitere Einzelheiten folgten.
„Nun kommt eine Zeit, da wir alle sehr hart arbeiten, unser Bestes geben müssen. Denn ab dem morgigen Tag wird jeder Soldat und jede zur Ausbildung fähige Echse nur noch Tag um Tag trainieren und sich für den Kampf vorbereiten. Verbessert Euch in allen Bereichen und werdet zu tödlichen Kriegern. Fünf Monate lang sollt ihr dies tun und danach marschieren wir mit einer Streitmacht, die die Welt noch nie sah nach Nordosten. Nach Erudicor, zur goldenen Stadt. Dann wird Kaiser Theron sehen, dass er keine Chance gegen uns Echsen hat und er wird vor Angst auf Knien um sein Leben betteln. Betteln soll er! Barmherzig wie ich bin, werde ich ihm einen schnellen Tod gewähren, wenn ich ihn mit meiner Faust zerquetsche. Ihr wisst, was zu tun ist, Echsen! Ab morgen gebt alles! Schickt eilends Boten in alle Winkel des Reichs und sagt ihnen, sie sollen ihre Krieger in Form bringen und anschließend hierher nach Sigyllsburg schicken. Fünf Monate. Beschämt mich nicht, meine geliebten Echsen. Gebt euer Bestes, um diesen bevorstehenden Kampf in den ersten von vielen Siegen zu verwandeln. Ich zweifle nicht an unserem Sieg. Doch so oder so, ob wir gewinnen oder verlieren, danach wird die Welt eine andere sein.“
Der Kaiser wandte sich von der Menge ab und verschwand im Inneren des Tempels. Die Menge jubelte noch einige Zeit weiter. Nairog und Tumva war jeglicher Jubel schon längst vergangen, obgleich sie ohnehin nie gejubelt hatten. Für die beiden bedeutete diese Nachricht, im Gegensatz zu allen anderen Echsen, nichts Gutes.
„Was sollen wir tun, Nairog?“, fragte Tumva.
„Du hast ihn gehört. Fünf Monate. Wir müssen so schnell wie möglich den Kaiser davon in Kenntnis setzen. Heute Nacht müssen wir aus Sigyllsburg fliehen, es geht nicht anders.“
„Denkst du, eine lautlose Flucht bietet sich an?“
„Ich wollte es ursprünglich vom Wetter abhängig machen, doch mir scheint, dass die Dringlichkeit uns keine Wahl lässt. Wir werden so schnell wir können verschwinden müssen. Wenn sie uns verdächtigen, sagen wir, wir sind Kuriere, die die Nachricht zur Ausbildung des Heeres weitergeben sollen. Wie wollen die schon wissen, wann genau die Kuriere losgeschickt werden. Sie könnten genauso gut jetzt schon unterwegs sein.“
„Ja, ich denke du hast Recht, Nairog. Mir wäre trotzdem bei einer leisen Flucht wohler. Da kann weniger passieren.“
„Ich weiß, doch denk an seine Worte. Fünf Monate. Um sich auf eine so gewaltige Armee vorzubereiten, ist das praktisch nichts. Kaum vorzustellen, was passieren würde, wenn wir es nie zum Kaiser schaffen würden. Sie müssen gewarnt werden. Sonst sterben sie alle. Ganz Erudicor.“
„Unser Leben für das unzähliger Unschuldiger. Das klingt nach einem gerechten Tausch.“, sagte Tumva düster.
„Sei nicht so pessimistisch, niemand sagt, dass wir sterben. Wenn überhaupt, muss zumindest einer von uns überleben. Egal, was geschieht.“
„Sollen wir uns langsam auf den Weg zum Stadtrand machen? Es wird immerhin bald dunkel und dann können wir sofort von hier verschwinden.“
„Lass uns gehen.“
So marschierten sie durch die leergefegten Straßen von Sigyllsburg. Wenn alle Echsen auf einem Fleck versammelt waren und der Rest der Stadt leer, wirkte sie beinahe schon unheimlich. Als könnte jeden Augenblick hinter einer Ecke irgendein seltsames Wesen hervorkriechen und sie angreifen. Da die beiden Spione um jeden Preis irgendeine Begegnung mit Wachen vermeiden wollten, war es für sie noch um einiges schlimmer, in immer mehr zunehmender Dunkelheit durch die stillen Straßen zu gehen. Jeder Schritt schien unendlich widerzuhallen. Einmal glaubte Tumva, sie höre außer ihren Schritten noch die einer dritten Person. Also blieben sie stehen und lauschten. Doch da war nichts zu hören. Als sie ihren Weg fortsetzten, blieben sie einige weitere Male abrupt stehen und wandten sich um. Niemand war zu sehen. Dennoch fühlten beide das unbehagliche Gefühl, nicht allein zu sein. Mit diesem Gefühl im Magen bewegten sie sich weiterhin fort in Richtung der Stadtgrenze. Sigyllsburg war keineswegs eine kleine Stadt, im Gegenteil gehörte sie zu den größten Städten Europas, neben Erudicor und Londoriya. Deshalb erwies sich der Marsch bis zur Stadtgrenze vom zentral gelegenen Tempelplatz als längeres Unterfangen. Nach einer knappen Stunde, die sie möglichst schnellen Schrittes gewandert waren, erreichten sie schließlich die Stadtgrenze und somit auch das Stadttor. Die letzte Bastion. Wenn sie hier durchkamen, sollte sie nichts mehr aufhalten. Gemächlich, aber dennoch raschen Schrittes, wie es für Kuriere üblich war, näherten sie sich dem Tor und den es versperrenden Wachen.
„Halt, wohin des Wegs?“, fragte einer sofort.
Tumva übernahm das Reden, sie war darin deutlich besser als Nairog.
„Geehrte Wachen, ich bitte euch, uns rasch durchzulassen, da wir die eilige Kunde des Kaisers in die fernen Winkel des Reichs tragen müssen. Das Schicksal eines Kuriers ist grausam, da er sich stets sputen muss und wir sind davon nicht ausgeschlossen.“
„Soso, zwei Kuriere also. Wie lange ist die große Ansprache des Kaisers jetzt her? Ich konnte die Jubelrufe noch vor ungefähr einer Stunde hören. Ungefähr so lange benötigt man doch vom Tempelplatz hierher. Wollt ihr mir sagen, ihr seid sofort darauf losgeschickt worden? Wusstet ihr etwa schon im Voraus davon?“
Tumva wirkte irritiert, deshalb übernahm nun Nairog das Sprechen.
„Hört zu, wenn wir schon vorab mit Informationen versorgt werden, um unseren Auftrag auszuführen, geht euch das wohl kaum etwas an. Ihr seid Wächter, die für Sicherheit sorgen und nicht Kuriere behindern sollen.“
„Alles schön und gut. Aber wir müssen auch unsere Pflicht erfüllen und verdächtige Personen genau begutachten. Und es scheint mir ziemlich verdächtig, dass ihr beide so schnell nach der Ansprache des Kaisers die Stadt verlassen wollt. Man könnte fast meinen, ihr seid Spione, die die Pläne unseres großen Kaisers an fremde Herrscher ausplaudern wollen.“
„Spione? Wir? Macht Euch nicht lächerlich.“, gab Nairog unbeeindruckt von sich.
„Wir sind doch keine Spione. Oder denkt Ihr, dass wir dann mit Euch sprechen würden?“, fügte Tumva hinzu. Doch der Wächter blieb hartnäckig.
„Ja, das wäre wohl der Dreistigkeit zu viel. Allerdings ist die Ausrede, ein Kurier zu sein, doch geradezu die perfekte Rechtfertigung für einen schnellen Gang und ein rasches Verlassen der Stadt. Das scheint mir etwas zu glatt zu laufen.“
„Hört zu, wir sind Kuriere, verdammt.“, beharrte Nairog.
„Dann habt ihr gewiss auch die Briefe mit dem kaiserlichen Siegel, die euch als solche ausweisen können.“, konterte die Wache. Die Spione erstarrten.
„Schon gut, schon gut.“, hallte eine Stimme von der Straße zu ihnen herüber. Scheinbar war doch jemand den beiden gefolgt.
„Ich denke, das ist alles ein großes Missverständnis.“, sprach eine schmächtige Gestalt in einer braunen Kutte, nicht größer als einen Meter. Als die Wachen die kleine Echse erblickten, verbeugten sie sich tief.
„Reichskanzler Arbaarveugel, was führt Euch denn hierher ans Nordtor?“, fragte der Wächter.
„Ich wollte diese beiden nicht der berühmten Dickköpfigkeit der Stadtwachen ausgeliefert lassen. Wie es scheint, komme ich gerade zur rechten Zeit. Wie war das noch gleich, ihr wolltet ihre Briefe mit dem kaiserlichen Siegel begutachten? Nun, wie es der Zufall will, waren diese beiden Dummköpfe etwas zu schnell beim Handeln und haben darüber das Nachdenken vergessen. Sie ließen ihre Briefe auf dem für sie vorgesehenen Tisch liegen. Ihr müsst sie entschuldigen, denn sie sind noch neu bei den Kurieren. Aber wie ihr selbst seht, liefern sie keine schlechte Zeit ab. Vom Tempelplatz zum Nordtor in nicht mal ganz einer Stunde. Schon eine beachtliche Leistung. Hier, eure Briefe, ihr Narren. Nächstes Mal kontrolliert alles, bevor ihr blindlings davonlauft.“
Reichskanzler Arbaarveugel überreichte Nairog und Tumva zwei Briefe mit dem echtem Siegel des Kaisers, die sie etwas verwirrt aber dankbar für diese glückliche Fügung annahmen. Unisono bedankten sie sich:„Vielen Dank, Reichskanzler Arbaarveugel.“ Dann fügte Tumva noch hinzu:„Zuweilen fehlt uns wirklich die Fähigkeit, mitzudenken.“
„Ja, wir alten Schussel. Wie konnten wir nur die Briefe vergessen.“, gab Nairog von sich. Er war sichtlich nervös und das passte gar nicht zu seinem Charakter.
Die Wachen entspannten sich und für sie war nun alles in Ordnung.
„Bitte, wenn das so ist, nehmt meine untertänigsten Entschuldigungen an, edle Kuriere und durchschreitet sogleich freien Fußes das Nordtor, wann immer es euch beliebt.“
„Danke, das wissen wir zu schätzen.“, sagte Tumva und lächelte. Dann verabschiedeten sie sich gebührend vom Reichskanzler, doch dieser bestand darauf, sie noch vor die Stadt zu begleiten. Also durchquerten sie zu dritt das Nordtor und verließen Sigyllsburg. Als sie endlich außer Hörweite der Wächter waren, wandten sich beide Spione sofort zum Reichskanzler um. Mit fragenden Blicken sahen sie ihn an.
„Was wollt ihr von mir? Habe ich euch nicht gerade das Leben gerettet?“, fragte Arbaarveugel, etwas unwohl.
„Warum habt Ihr das getan?“, brachte schließlich Tumva heraus.
„Du meinst, warum ich euch, zwei Spionen half, die Stadt zu verlassen, um die Warnung eines bevorstehenden Angriffs rechtzeitig nach Erudicor zu bringen, damit sich Kaiser Theron gebührend vorbereiten kann?“
„Ja.“
„Das ist doch ganz einfach, Kindchen. Wie es der Kaiser selbst sagte: Egal ob wir gewinnen oder verlieren, die Welt wird danach eine andere sein. Ich aber will, dass wir verlieren. Das geschieht ohnehin nur, wenn der Kaiser stirbt und ich habe da so ein Gefühl, dass es in dieser bevorstehenden Schlacht durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegt. Danach können wir das Reich der Yash'Asharr endlich zu dem machen, was es schon immer hätte sein sollen. Ein friedlicher Ort, wo alle im Einklang miteinander leben und nicht ständig an Krieg und Eroberung denken. So eine ungesunde Denkweise. Es gibt jene, die so denken wie ich und wie ihr euch denken könnt, bin ich der Ranghöchste in diesem Reich mit so einer Einstellung. Einst war da noch Istulbir, der sich immer für ein besseres Dasein der Echsen eingesetzt hatte, bis der Kaiser selbst ihn verbannte für das Verfassen der Prophezeiung, die von seinem Tod sprach. Ich aber bin froh, dass ich euch helfen konnte. Schon an der großen Treppe von Khish'Adum habe ich euch belauscht und euch zu folgen war gar nicht so einfach, doch zum Glück bin ich der magischen Künste ein wenig mächtig. So teleportierte ich mich einfach, wenn ihr zu weit vorausmarschiert wart. Ach und eines noch: Auch wenn ich es nicht gerade gutheiße, was ihr da esst, so spart euch diesen Reiseproviant lieber gut auf. Ihr werdet ihn noch brauchen. Lebt wohl, ich muss nun zurück zum Kaiser.“
„Vielen Dank für alles, Reichskanzler Arbaarveugel. Lebt wohl.“, verabschiedete sich Nairog.
„Danke nochmals und lebt wohl. Doch warum billigt ihr nicht die Knusperschnecken, die sind doch köstlich?“, fragte Tumva.
Arbaarveugel nahm seine Kapuze ab und beide Spione erstarrten erneut. Denn eine einen Meter große Schnecke blickte sie mit ihren Stielaugen an. Außer zwei kleinen Klauenhänden, mit denen sie einfache Tätigkeiten sowie grundlegende Magie ausführen konnte, besaß sie nichts weiter als den Körper einer Schnecke. Doch sie hatte kein Haus, also handelte es sich um eine Nacktschnecke.
„Noch immer sind wir Schneckenstämmigen unter den Yash'Asharr Ausgestoßene. Mit dem Tod des Kaisers lässt sich das hoffentlich ändern. Geht nun, ihr dürft nicht noch mehr Zeit verlieren.“
Dann zog er sich die Kapuze wieder über und verschwand mit einem Teleportzauber. Die beiden Spione brauchten noch ein bisschen, um all das zu verarbeiten. Deshalb gingen sie vorerst nur sehr langsam weiter, versuchten sich zu sammeln.
„Dass der Reichskanzler eine Schnecke ist und dazu noch auf unserer Seite. Unglaublich.“, sagte Nairog.
„Ja, kaum zu glauben. Scheinbar gibt es sie doch. Die Gegner des Kaisers, die ihn nicht billigen. Aber sie müssen wohl im Untergrund leben, so wie wir.“
„Natürlich, du weißt doch, dass jegliche Infragestellung des Kaisers mit dem Tod bestraft wird. Da können sie ja wohl kaum ihre Meinung frei äußern. Schließlich ist Selvunia eine Diktatur und keine Demokratie. Eine verdammt tyrannische Diktatur noch dazu.“
„Ja. Aber Nairog, denk doch mal nach. Wenn der Kaiser wirklich bei seinem Angriff stirbt, kann sich Selvunia von Grund auf ändern.“
„Das hoffe ich, Tumva. Hoffentlich dürfen wir es eines Tages miterleben.“
Die beiden machten sich auf den Weg und durchstreiften die Nacht. Sich auszuruhen konnten sie sich nicht erlauben. Noch nicht. Wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, so konnten sie womöglich in einer verlassenen Höhle oder in einem dichten Wald rasten, wo keine wandernden Einheiten sie aufspüren konnten, die durchs ganze Kaiserreich patrouillierten. Das Wetter blieb trocken, ideal für eine leise Flucht. Nicht, dass es jetzt einen Unterschied machte, denn die beiden Spione waren die einzigen Lebewesen im Umkreis von einigen Kilometern. Sie marschierten durch bergiges Gelände und versuchten, sich stets nordöstlich zu halten, um möglichst schnell zur Grenze nach Anthem Gows zu gelangen und diese alsbald zu überqueren. Dann würden sie in Sicherheit sein. Doch bis dahin konnte jeder Schritt in ihr Verderben führen. Als sie so lange Zeit voranschritten, still und nachdenklich nebeneinander, ab und an einen Blick über die Schulter werfend, um sicherzustellen, dass sie noch immer allein waren, da blickte Tumva Nairog an. Er bemerkte es und fragte, was ihr auf dem Herzen lag.
„Glaubst du, dass Kaiser Theron uns aus der Spionage entlässt? Immerhin bringen wir ihm eine Information von unschätzbarem Wert. Das sollte doch genug sein, um unsere Schuld ihm gegenüber abgetragen zu haben. Ich kann das nicht mehr, Nairog.“
Mit einem Seufzer antwortete er:„Wem sagst du das? Ich bin es auch schon lange leid. Diese ständige Nervosität. Das erhöhte Erregungsniveau, da man ständig achtsam sein muss. Auf Dauer macht das einen echt kaputt. Weißt du, Tumva, ich hoffe, dass der Kaiser uns entlässt. Wenn er es aber nicht tut, dann gehe ich freiwillig in den Kerker zurück. Immer noch besser als ständig sein Leben zu riskieren. Dort unten verfaulst du nur, aber du bekommst regelmäßig zu essen und stirbst nicht eines Tages, weil du nicht aufgepasst hast.“
„Aber der Kerker kann auch nicht die Lösung sein. Mit dieser Information kaufen wir unser Leben zurück, Nairog. Du wirst schon sehen. Wir verhandeln einfach. Die Information gegen unsere Freiheit.“
„Darauf wird sich der Kaiser wohl kaum einlassen. Eher foltert er uns, um uns die Information zu entlocken.“
„Nein, das würde er nicht tun. Er ist nicht wie Yashurion. Ihm wohnt eine gewisse Ehre inne.“
„Lass uns nicht mehr darüber reden.“
Schweigend gingen sie weiter.
„Tumva?“, fragte Nairog schließlich.
„Ja, Nairog?“
„Für den Fall, dass sie uns doch erwischen, will ich, dass du mir etwas versprichst.“
„Und was?“
„Versprich mir, dass du weiterläufst und niemals zurückblickst.“
„Wie, ich soll dich einfach zum Sterben zurücklassen? Das kannst du vergessen. Wir schaffen es beide oder keiner von uns.“
„Einer muss es schaffen und wenn, dann musst du es sein. Ich werde so oder so kein erfülltes Leben haben, frei oder nicht. Aber du, dir liegt noch alles offen. Du kannst dein Glück noch finden. Deshalb sollst du leben.“
Tumva stiegen Tränen in die Augen. „Sag nicht sowas. Wie kannst du dir nur anmaßen, zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben soll? Das liegt gar nicht in unserer Hand. Verlange nicht von mir, den einzigen Freund, den ich jemals hatte, aufzugeben. Verlange nicht, dass ich dir beim Sterben zusehe. Das will ich nicht und werde ich nicht, also Schluss damit.“
Nairog fühlte sich schlecht. In Tumvas bebender Stimme hatte er das unfehlbare Zeichen dafür gespürt, dass er zu weit gegangen war. Dabei dachte er doch nur an sie. Sein eigenes Leben kümmerte ihn nicht, aber Tumva besaß noch eine Lebensfreude, die aus ihrem Inneren ausging. Sie konnte noch so viel erleben. Ihn hingegen kümmerte nur noch eine Sache: Dass sie überlebte. So gingen die Stunden dahin, bald wurden sie etwas schläfrig. Bei der Region, die sie derzeit durchwanderten, war das nicht die beste Reaktion ihrer Körper. Denn um sie herum gab es nun nichts als felsige Klippen und tiefe Schluchten. Wenn sie den falschen Weg einschlugen, mussten sie etliche Kilometer in eine andere Richtung marschieren, um eine Schlucht zu überqueren, weil es da nur eine einzige Brücke gab. Bei einer anderen mochte es mehrere Brücken geben, doch drei davon wurden bewacht, zwei waren zerstört und die letzte musste man erst einmal finden. Dieses steinige Ödland setzte ihnen nicht sonderlich zu, aber ihre Körper verloren immer mehr an Kraft. Auch die Knusperschnecken, die sie sich sorgsam aufsparten, halfen da nicht viel. Was sie nun vor allem benötigten, war Wasser. Zuvor hatten sie noch ab und zu einen kleinen Bach oder einen kleinen Teich oder auch eine Pfütze von abgestandenem Regenwasser entdeckt. Nun aber war alles in der näheren Umgebung ausgetrocknet und es schien sich in der Ferne immer weiter in derselben Manier fortzusetzen. Als sie endlich alle vier notwendigen Schluchten überwunden hatten und dieses grässliche Fleckchen Land, das als die Schlangenschluchten bekannt war, hinter sich ließen, trat eine angenehme Wendung ein. Nun gab es nur noch eine einzige Schlucht, stetig zu ihrer Rechten, während sie links von einem hohen Bergkamm abgeschirmt waren. Es gab also nur einen einzigen Weg und dem mussten sie nur immer weiter folgen. An der Grenze zu Anthem Gows waren sie noch lange nicht. Das würde noch drei weitere Tage dauern, wenn sie den Großteil des Tages marschierten und nur sehr wenig schliefen. Doch die Frage war, ob sie das noch lange durchhielten. Obgleich der enge Weg eine nette Abwechslung bot, da sie nicht sonderlich nachdenken mussten und so leicht vor sich hindösen konnten, so bot er auch eine große Gefahr, falls ihnen eine Patrouille entgegenkam. Denn dann würden sie sich nicht so leicht wieder herauswinden können. Sie besaßen zwar die Briefe mit dem kaiserlichen Siegel, die sie von Reichskanzler Arbaarveugel bekommen hatten, doch es war nicht auszuschließen, dass die Wachen der Patrouille noch etwas mehr nachhaken würden. Vielleicht fragten sie sie aus, wie sie hießen, wo sie wohnten und noch vieles andere. Zu ihrem Glück begegneten sie aber niemandem außer einem alten Kaufmann, der mit seinem Wagen durchs Land zog. Die graubraune Kröte in einem schlichten grauen Gewand war froh, jemandem zu begegnen, der keine Patrouille darstellte und die Spione fühlten genauso. Als er sich eine Weile mit ihnen unterhalten hatte und sie auch ihn überzeugten, dass sie Kuriere des Kaisers waren, bestand er darauf, ihnen zwei große Krüge mit frischem Wasser zu schenken, um ihnen ihre Reise zu erleichtern. Die Spione konnten ohnehin nicht verbergen, wie durstig sie mittlerweile waren und so nahmen sie nach einigem Hin und Her das Wasser dankend an. Der freundliche Händler gab ihnen sogar zwei Weidenkörbe mit, die sie sich mit Seilen um den Bauch befestigten und dann am Rücken wie einen Rucksack trugen. Darin transportierten sie nun das Wasser. Weil sie sich etwas schuldig fühlten, boten sie dem Händler als kleinen Austausch ein paar Knusperschnecken an. Er lehnte dankend ab und sagte, er mache sich nichts aus solchen Speisen. Der weitere Weg an der Schlucht entlang, die kein Ende zu nehmen schien, verlief ruhig und durch das Wasser bekamen sie wieder neue Kraft. Der ganze Tag verlief weiterhin gut und die endlose Schlucht, die einige Kilometer neben dem großteils geraden, sich manchmal krümmenden Weg entlanglief, folgte den Spionen auf Schritt und Tritt. Am Abend aber zogen Wolken auf und schon bald ließ ein Platzregen den ganzen Landstrich im Nass der Regentropfen erglänzen. Nairog war nicht sonderlich begeistert, Tumva zwar auch nicht, aber ihr machte es weniger aus. Gerade als der immer noch felsige Boden durch den Regen am glitschigsten und rutschigsten war, begab es sich, dass den Spionen eine besonders enge Stelle bevorstand, maximal einen Meter breit. Dort mussten sie sich vorsichtig entlangtasten und hielten sich so gut sie konnten an der Bergflanke zu ihrer Linken fest, doch sie bot nicht viel Halt, außer an Stellen, wo kleine Pflanzen wuchsen. Nairog rutschte aus, stolperte vorwärts und versuchte mit aller Kraft, sich wieder zu fangen. Es gelang ihm und er blieb kurz auf der Stelle stehen. Hinter ihm folgte Tumva, die sich geweigert hatte, vorauszugehen. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Nairog streckte ihr die Hand entgegen und Tumva wollte sie sogleich ergreifen. Da setzte ein unerwarteter Windstoß ein und stieß Tumva ein wenig zurück, doch durch den Wasserkrug auf ihrem Rücken reichte es aus, dass sie das Gleichgewicht verlor. Schnell ruderte sie mit den Armen und versuchte, sich wieder aufzurichten, doch dabei rutschte sie aus und fiel sogleich in die Schlucht hinab. Als Nairog das sah, zögerte er keinen Augenblick und warf sich auf den Boden direkt an der Klippe. Den Arm so weit ausgestreckt wie er konnte schnappte er sich Tumvas Arm und hielt sie fest. Durch den plötzlichen Ruck löste sich der Weidenkorb vom Seil und stürzte nun mitsamt dem Wasserkrug in die Tiefe. Tumva war völlig verängstigt und sah gehetzt um sich.
„Hilf mir, Nairog!“, schrie sie in Todesangst. „Bitte zieh mich hoch.“
„Ganz ruhig, Tumva. Ich hab dich und ich lasse dich nicht los. Um nichts auf der Welt. Jetzt musst du mir vertrauen. Ohne Weiteres kann ich dich nicht einfach hochziehen, dafür ist es viel zu rutschig. Zunächst möchte ich, dass du mit deiner zweiten Hand versuchst, dich an etwas festzuhalten. Bemühe dich, eine möglichst trockene Stelle zu finden.“
Tumva tastete die Klippe ab und tatsächlich fand sie eine winzige Nische, in die der Regen bisher nicht gedrungen war. Sie bot gerade so genug Platz, damit Tumva ihre Hand hineinlegen und sich daran festhalten konnte. Dabei spürte sie die Erde an ihren Fingern. Zweifellos hatte einst ein Stein diese Nische besetzt, doch irgendwann war er einfach herausgebrochen, womöglich als etwas Schweres den Weg überquert hatte.
„Ich habe eine Stelle, an der ich mich festhalten kann.“, sagte Tumva.
„Gut, dann halt dich nun kurz mit beiden Händen dort fest. Ich muss mich aufrichten und standhaft positionieren, damit ich nicht auch hinabstürze. Dafür kann ich dich aber nicht länger festhalten. Vertrau mir.“
„Ich vertraue dir.“, gab Tumva als Antwort und ließ Nairogs Hand los. Dann hielt sie sich lediglich in der kleinen Nische fest und wartete darauf, dass ihr Freund sich aufrichtete. Als Nairog seine Stiefel so fest er konnte in den Boden eingrub, der trotz allem noch aus Fels bestand, streckte er wieder den Arm nach Tumva aus, diesmal im Stehen. Sie reckte ihren Arm in die Höhe und versuchte, seine Hand zu ergreifen, doch sie war etwas zu weit entfernt. Da spürte sie erneut die Angst.