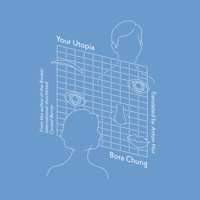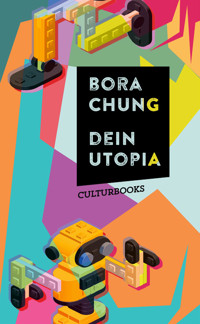
Dein Utopia: Dystopische Kurzgeschichten über Technologie, Unsterblichkeit und den Verlust der Menschlichkeit E-Book
Bora Chung
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wer Stephen King oder Haruki Murakami liebt, ist mit Bora Chung ganz blendend bedient.« Denis Scheck »Technologie trifft auf die Absurdität der menschlichen Existenz – und wie von Bora Chung gewohnt, tut sie das auf die erstaunlichste Art und Weise.« Book Riot Was bedeutet es, Mensch zu sein, in einer zunehmend von Technologie durchdrungenen Welt? In »Dein Utopia« versammelt Bora Chung eindringliche, verstörend schöne Geschichten über eine Zukunft, die längst begonnen hat, erzählt von KI-gesteuerten Autos und empfindsamen Aufzügen, von utopischen Heilsversprechen und Bürokratien, die sogar die Unsterblichkeit verwalten. Mit düsterem Witz und scharfem Blick lotet die preisgekrönte Autorin von »Der Fluch des Hasen« aus, was sein könnte, spielt mit unseren Erwartungen an das Morgen und beleuchtet dabei immer auch die Ängste, Absurditäten und Widersprüche unserer Zeit – überraschend, visionär und voller erzählerischer Kraft. »Im Kern geht es in diesen schrägen und überraschenden Erzählungen um Einsamkeit und Isolation in einer von Technik dominierten Gesellschaft – doch Chung ist eine viel zu komplexe Autorin, um die Ursachen dafür allein der Technologie zuzuschreiben. Sie spielt mit unseren Erwartungen an die Zukunft, lotet aus, was möglich sein könnte, und greift dabei wie gewohnt auf Elemente verschiedenster Genres und literarischer Traditionen zurück. Und das alles wird keinen Moment langweilig.« Chicago Review of Books
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
In »Dein Utopia« versammelt Bora Chung eindringliche, verstörend schöne Geschichten über eine Zukunft, die längst begonnen hat, erzählt von KI-gesteuerten Autos und empfindsamen Aufzügen, von utopischen Heilsversprechen und Bürokratien, die sogar die Unsterblichkeit verwalten.
Mit düsterem Witz und scharfem Blick lotet die preisgekrönte Autorin von »Der Fluch des Hasen« aus, was sein könnte, spielt mit unseren Erwartungen an das Morgen und beleuchtet dabei immer auch die Ängste, Absurditäten und Widersprüche unserer Zeit – überraschend, visionär und voller erzählerischer Kraft.
»Wer Stephen King oder Haruki Murakami liebt, ist mit Bora Chung ganz blendend bedient.« Denis Scheck
Über die Autorin und die Übersetzerin
Bora Chung, geboren 1976 in Seoul, ist Autorin von mehreren Romanen und Kurzgeschichtensammlungen. Sie übersetzt zeitgenössische Literatur aus dem Russischen und Polnischen ins Koreanische, unterrichtete an der Yonsei-Universität u. a. Science Fiction Studies. Chungs deutschsprachiges Debüt »Der Fluch des Hasen« (CulturBooks, 2023) stand auf der Shortlist für den International Booker Prize, und »Dein Utopia« war für den Philip K. Dick Award nominiert.
Bora Chung
Dein Utopia
Storys
Inhaltsverzeichnis
Das Institut zur Erforschung der Unsterblichkeit
»Ich glaube, ich habe einen Stalker«, vertraute mir vor zwei Monaten eine ältere Kollegin an, mitten während der Vorbereitungen für unsere Jubiläumsfeier. Offensichtlich hatte ein Mann im Institut angerufen und behauptet, er sei jemand, der aus der gleichen Gegend käme wie sie; ein sehr enger Freund, der für die Nationalversammlung kandidiere. Dann hatte er sich nach ihrer Telefonnummer erkundigt. Natürlich kam es unserer scharfsinnigen Mitarbeiterin am Empfang sofort verdächtig vor, dass sich jemand als sehr enger Freund bezeichnete, aber nach der Handynummer fragen musste, und als der Mann auch noch von seinen politischen Ambitionen sprach, gefolgt von einer Flut irrwitziger Wahlversprechen, die unmöglich einzulösen wären, fiel sie ihm kurzerhand ins Wort. Sie teilte ihm mit, die Kollegin sei im Augenblick nicht an ihrem Platz und sie selbst nicht autorisiert, persönliche Informationen wie Telefonnummern an Fremde herauszugeben. Trotzdem erklärte sie sich aus Höflichkeit bereit, eine Nachricht aufzunehmen. Dies führte jedoch nur zu einem Bombardement von »Ich versuche es später noch einmal«-Telefonanrufen, die die Mitarbeiterin am Empfang von ihrer Arbeit abhielten. Zugegeben, in dem Institut hatte sie normalerweise nicht so viel Arbeit, von der sie abgehalten werden konnte, aber zu dieser Zeit ging es am Empfangstresen wie in einem Taubenschlag zu. Alle waren hektisch mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier beschäftigt. Umso ärgerlicher, dass diese unablässigen Telefonanrufe, die normalerweise eine Abwechslung zu der Eintönigkeit und Terminleere gewesen wären, ausgerechnet zu diesem höchst ungelegenen Zeitpunkt erfolgten.
Wenn Sie sich fragen, was das Institut zur Erforschung der Unsterblichkeit eigentlich tut – nun, genau das, was die Bezeichnung vermuten lässt, wir erforschen die Unsterblichkeit und versuchen, sie zu erreichen. Im Jahre 1912, kurz nachdem Korea mit Waffengewalt von Japan annektiert worden war, wurde das Institut mit dem naiv klingenden Wahlspruch eröffnet: »Unser Land mag am Boden liegen, aber wir werden für immer leben.« Jetzt, achtundneunzig Jahre nach der Gründung, war dies Anlass für eine gebührende Feier. Ich habe keine Ahnung, warum man sie auf diesen Jahrestag legte und nicht den neunzigsten, fünfundneunzigsten oder hundertsten wählte. Auch meine Arbeitskollegen im Institut können es nicht sagen, und ich zweifle daran, dass es die Mitglieder des Vorstands wissen. Jedenfalls, ich bin auf der untersten Stufe der Hierarchie, und meine Aufgabe ist es, zu erledigen, was man mir aufträgt, und wenn es Erledigungen im Zuge einer geplanten Jubiläumsfeier sind, dann ist eben das meine Arbeit.
Auch wenn ich ganz unten in der Hackordnung stehe, die Geringste der Geringen, so gaukelt mein Titel – Teammanagerin – etwas anderes vor. Er ist allerdings nur der Anfang einer ganzen Reihe hochtrabender Titel, die bis zur Institutsleitung reichen. Die Vorstandsmitglieder stehen auf der höchsten Stufe und bekleiden Positionen wie Direktor und Geschäftsführer, gefolgt von einer Flut von stellvertretenden Direktoren und Managern auf verschiedenen Ebenen, bis runter zu mir, die ich keinen einzigen Mitarbeiter unter mir habe, nicht einmal einen Praktikanten. Warum wir diese Art von Titeln haben, die eher in Wirtschaftsunternehmen gebräuchlich sind, und nicht »Senior Researcher« oder »Project Manager«, entzieht sich ebenfalls meiner Kenntnis. Ich tue, was man mir aufträgt, und ich verwende die Visitenkarten mit dem Titel, den man mir gegeben hat. Es steht mir nicht zu, dies zu kritisieren.
Das ist zwar alles schön und gut, vor allem, wenn ich meinen monatlichen Scheck erhalte, aber das Problem ist: Ohne Praktikanten muss man all die lästigen kleinen Dinge selbst erledigen, die man sonst delegieren könnte. Unter anderem völlig idiotische Sachen wie zum Beispiel den Filmstar B dazu zu bringen, dass er zu unserer Firmenfeier kommt.
Wer ist dieser Filmstar B? Tatsächlich sieht er gut aus, ist ein guter Schauspieler, ziemlich bekannt, und hat sogar einen Preis gewonnen. Aber was hat er mit unserem Forschungsinstitut und dessen achtundneunzigjährigem Jubiläum zu tun? Absolut gar nichts, außer der Tatsache, dass er vor langer Zeit, noch bevor er ein großer Star wurde, einmal in einem Science-Fiction-Streifen mitgespielt hat, in dem es um Unsterblichkeit ging. Der Film fiel grandios durch, sodass sich heutzutage kaum jemand mehr an den Titel erinnert und die beteiligten Schauspieler ihn wahrscheinlich gern aus ihrem Lebenslauf streichen würden. Aber es war nun einmal ein Film über Unsterblichkeit, und unter den Festgästen würden eine Menge Ärzte, Professoren und Doktoren sein, weswegen man dachte, dass ein Filmstar die Atmosphäre auflockern und dem Institut mehr Glanz verleihen würde. Also wurde beschlossen, Herrn B einzuladen.
Im Grunde genommen keine schlechte Idee, aber wie das mit Vorschlägen immer so ist, sie überleben selten eine Vorstandsabstimmung, bei all den Direktoren, Geschäftsführern und Managern des Instituts, von denen jeder seine eigene Vorstellung von Unsterblichkeit hat, weswegen erst lang und breit über das Wesen derselben diskutiert werden muss, bevor etwas vorwärts geht. Das koreanische Wort für Unsterblichkeit ist eine Mischung aus »lange Jugend« und »ewiges Leben«. Bedeuten lang und ewig tatsächlich dasselbe? Natürlich nicht, weil »ewig« länger dauert als »lang«. Deswegen hinkt der Vergleich von »langer Jugend« und »ewigem Leben«, und die Gegner fanden, dass ein Schauspieler, der in einem Film über »lange Jugend« mitgespielt hat, nicht gut zu den Zielen des Instituts passt. Als wir jedoch nach Filmen mit einer strikteren Ausrichtung auf »ewiges Leben« suchten, fanden wir praktisch keine aus Korea. Der Gedanke, ein Schauspieler wie Hugh Jackman würde sich dafür hergeben, zur Feier des achtundneunzigsten Jubiläums des Instituts für die Erforschung der Unsterblichkeit nach Korea zu kommen, ist völlig abwegig. (Es entspannten sich auch Diskussionen darüber, ob es in dem Film The Fountain mit Hugh Jackman um Unsterblichkeit oder um Wiederauferstehung geht, oder eigentlich um ein Paralleluniversum; aber als wir beschlossen, alle zusammen den Film anzusehen, um dies entscheiden zu können, begannen die Vorstandsmitglieder bereits nach einer Viertelstunde zu schnarchen, was das Unterfangen witzlos machte.) Als Alternative stand noch eine russische Filmtrilogie zur Debatte, die ein ziemlicher Erfolg an den Kinokassen gewesen war und eine unaussprechbare Auszeichnung erhalten hatte. Da jedoch niemand im Institut russisch sprach, wurde auch dieser Vorschlag verworfen.
Also kamen wir wieder zurück auf Schauspieler B. Als mich niemand anderes als der Vorstandschef – kein Direktor, kein Vize und kein Manager – in sein Büro bestellte, eilte ich mit klopfendem Herzen dorthin. Er gab mir eine Haftnotiz mit einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer und sagte, dass so ein berühmter Filmstar bestimmt einen dichtgedrängten Terminplan hätte, weshalb ich ihn zeitnah anrufen und festnageln sollte. Sein Assistent habe schon einmal angerufen, sei aber mit einem »Wir werden darüber nachdenken« abgefertigt worden. Dies seien die Kontaktdaten des Agenten, ich sollte ihn anrufen und die Sache unter Dach und Fach bringen. Dann gab er mir genaue Instruktionen, eine Art Drehbuch, was ich am Telefon sagen sollte. Ich sollte mich als Leiterin der Forschungsabteilung eines großen Pharmaunternehmens ausgeben und erklären, wie sehr wir es zu schätzen wüssten, wenn der Schauspieler unsere Achtundneunzigjahrfeier mit seiner Gegenwart beehren würde. Ich sollte höflich, aber bestimmt sein und hervorheben, dass wir eines der führenden Pharmaunternehmen seien und ich eine Abteilungsleiterin. Sie würden daraus ableiten können, wie viel Respekt wir ihnen entgegenbrachten, und vielleicht sogar denken, dass wir einen Werbespot mit dem Schauspieler planten, was sie davon abhalten würde, direkt abzusagen.
Natürlich waren wir kein Pharmaunternehmen, aber immerhin als Forschungsinstitut ein Ableger eines solchen, doch Werbung machten wir keine. Aber der Schauspieler konnte unmöglich wissen, dass der Werbeetat komplett von der Zentrale verwaltet wurde, ohne Einflussmöglichkeit durch das Forschungsinstitut, und ich hatte schließlich eine Aufgabe. Ich tat also mein Bestes, was jedoch nur dazu führte, dass Bs Manager mich komplett ignorierte und abblockte.
Achtunddreißig Mal rief ich an, sandte zweiundzwanzig SMS und sogar fünfzehn wirklich höfliche E-Mails, doch nicht ein einziges Mal erhielt ich eine Antwort. Zunächst war ich besorgt, dann wütend und zum Schluss gab ich auf. Ich dachte mir: So oder so, es kommt, wie es kommen soll. Selbst wenn ich nur ganz unten in der Hierarchie stand und es für mich bis ans Ende aller Tage keine Möglichkeit gab, in dieser Firma aufzusteigen, so hatte ich es doch immerhin all die Jahre geschafft, den Job zu behalten, und es ärgerte mich, dass ich plötzlich mit einem Hindernis konfrontiert war, das nichts mit meiner Büroarbeit oder Recherchetätigkeit zu tun hatte, sondern mit so etwas Idiotischem wie einem Manager, der sich weigerte, meine Telefonanrufe entgegenzunehmen. Es war so unglaublich unfair.
Als ich am Empfang des Instituts saß, mit meinem Handy herumspielte und überlegte, ob ich es noch einmal mit einer SMS versuchen sollte, da ein weiteres nicht angenommenes Telefonat meinen Stolz nur noch mehr verletzen würde, hörte ich plötzlich eine Stimme.
»Entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte sagen, wo sich das Büro von Kim Se-Gyeong befindet?«
Der Mann war sehr höflich, sprach in ruhigem Tonfall, und als ich aufblickte und in seine Augen sah, kam mir sein Gesicht irgendwie bekannt vor, auch wenn ich es nicht zuordnen konnte.
»Wissen Sie, auf welchem Stockwerk Kim Se-Gyeongs Büro ist? Ich stamme aus der gleichen Stadt wie sie, heiße Pak Hyeok-Se und kandidiere für die Nationalversammlung …«
Ich dachte Oh, das ist der Stalker und war drauf und dran, dies laut auszusprechen, konnte mich aber gerade noch bremsen. Fieberhaft durchsuchte ich mein Hirn nach einer Antwort, doch dort herrschte völlige Leere. Ich starrte den Mann einfach nur an, und er sprach weiter.
»Ich war sehr gut mit Kim Se-Gyeong befreundet, unsere ganze Kindheit und Jugend lang. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe auch eine Verbindung zum Institut. Als Kandidat für die Nationalversammlung arbeite ich Tag und Nacht an Verbesserungen für dieses Land und an einer guten Zukunft für meine Mitbürger. Wenn Sie mich als Ihren Abgeordneten in die Nationalversammlung wählen, werde ich dafür sorgen, dass jeder in Korea ewig lebt, und das würde das Institut für die Erforschung der Unsterblichkeit zur führenden Einrichtung des Landes machen …«
Jeden im Land unsterblich machen? Ich hatte schon alle möglichen absurden Versprechungen von Politikern gehört, aber das hier war die Krönung. Dennoch war meine Neugier geweckt, rein wissenschaftlich gesehen, und sie trieb mich dazu, mehr über seine Räuberpistole hören zu wollen.
Es brach aus mir heraus: »Aber wie genau möchten Sie die Unsterblichkeit für alle denn erreichen?«
Ich bin mir sicher, dass ich die einzige Person seit Jahren war, die konkretes Interesse an seinen unglaubwürdigen Wahlversprechungen zeigte. Aufgeregt sprach er mit erhobener Stimme weiter, seine Augen funkelten vor Begeisterung.
»Das 21. Jahrhundert ist das Technologiezeitalter, nicht wahr? Meine erste Aufgabe wird sein, all unsere technischen Hilfsmittel zu nutzen, um Sonnenstrahlen zu bündeln und so auf die Erde zu richten, dass unsere Vorfahren wieder zum Leben erwachen. Die Theorie wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Russen entwickelt, wurde aber damals angesehen als dass es nicht in die Realität umgesetzt werden könnte.«
Wurde angesehen? Als dass es nicht? Schrieb er nun auch noch die Grammatik neu? Mir waren Leute suspekt, die Dinge mit solchen überflüssig komplizierten Passivkonstruktionen in die Länge zogen, aber ich konnte die Flut nicht stoppen, die nun über mich hereinbrach.
»Natürlich könnten unsere Vorfahren, die uns schon lange verlassen haben und nur noch Skelette sind, angesehen werden als schwer zum Leben zu erwecken, aber diejenigen, die gerade erst gestorben sind und deren Körper noch in annehmbarem Zustand sind, sollten nicht so schwer wiederzubeleben sein, würde ich meinen. Unsere toten Vorfahren zurückzubringen und sie auf den Weg zur Unsterblichkeit zu bringen, kann angesehen werden als eine Form von Ehrung der Vorfahren und außerdem den Traditionen unseres Landes, die Ahnen zu respektieren, zugutekommen, und es ist auch ein Weg, die wegen des Rückgangs der Geburtenzahlen rapide abnehmende Bevölkerungszahl hoch zu halten oder gar zu vergrößern und …«
»Entschuldigen Sie«, unterbrach ich ihn. Wahlversprechen waren das eine, aber wenn ich die Formulierung angesehen werden noch ein einziges Mal hören würde, müsste mein Verstand als nie wieder normal funktionierend angesehen werden. »Ich muss zurück in mein Büro. Ich werde Kim Se-Gyeong sagen, dass Sie da waren.«
Unglücklicherweise für mich und meinen Fluchtversuch ließ das Wort Büro sein Gesicht erstrahlen.
»Sie gehen in Ihr Büro? Ich werde Sie begleiten. Also ist Kim Se-Gyeong heute anwesend?«
»Nein. Meine Kollegin, ich meine, Kim Se-Gyeong, ist heute nicht hier. Außendienst, wissen Sie …«
So plötzlich, wie sich seine Miene erhellt hatte, verdüsterte sie sich nun.
»Oh, sie ist wieder nicht da? Sie muss wirklich sehr beschäftigt sein. Wo arbeitet sie denn zurzeit so angestrengt?«
»Also …« Aus Verzweiflung begann ich zu improvisieren. »Tatsächlich werden wir am Forschungsinstitut eine Jubiläumsfeier haben, und wir möchten den Filmstar B zum Fest einladen, schaffen es aber nicht, Kontakt herzustellen … Ich denke also, dass sie im Büro seines Managers ist und dort ihr Glück versucht, aber ich glaube nicht, dass es besonders gut läuft …«
»Ach ja?«
Natürlich war das eine Lüge, aber sein Gesicht wurde so ernst, dass ich mir Sorgen machte. Und, wen wunderte es, er begann, mich wegen dieser Sache zu löchern.
»Warum muss die Verhandlung als nicht gut laufend angesehen werden? Ist es eine Sache des Geldes? Terminüberschneidungen?«
»Ähm, ich weiß es selbst nicht genau …« Es ist eine Tatsache, dass Leute die verrücktesten Sachen sagen, je ängstlicher sie werden, aber in diesem Fall würde ich die wiederholte seltsame Verwendung von angesehen werden dafür verantwortlich machen, dass ich völlig aus der Bahn geworfen war. »Es war wohl so … als meine Kollegin ihn das erste Mal im Büro seines Managers aufsuchte, nannte sie ihn nur ›Herr B‹ anstatt ›Hochgeschätzter Herr B‹ und … also …«
»Wie bitte? Wegen so einer Lappalie hat er die Einladung abgelehnt?«
Er sah so wütend aus, dass ich zurücknehmen wollte, was ich gerade gesagt hatte, aber es war zu spät. Während ich noch zögerte, fieberhaft überlegend, was ich als Nächstes sagen sollte, verhärtete sich das Gesicht des Mannes und er sagte: »Also gut. Ich werde etwas unternehmen. Sie sagen also, Kim Se-Gyeong sei im Büro des Managers, ist das richtig?«
»Jaaa …«
Natürlich saß meine Kollegin in aller Ruhe in ihrem Büro im dritten Stock, über Aufgaben brütend, die das Jubiläum betrafen und rein gar nichts mit Unsterblichkeit zu tun hatten, und keiner von uns hatte eine Ahnung, wo sich das Büro des Managers von B überhaupt befand. Aber der Mann schien zufrieden, und zu meiner großen Erleichterung verabschiedete er sich und verschwand. Kurz danach hatte ich die ganze Angelegenheit vergessen.
Erst einen Monat später wurde ich wegen der Wahlen wieder daran erinnert. Es stellte sich heraus, dass der Kerl mit den vollkommen unglaubwürdigen Wahlversprechen, der behauptet hatte, für die Nationalversammlung zu kandidieren, der Kerl, der meine Kollegin so eifrig gesucht hatte, ohne zu sagen warum, wirklich auf der Wahlliste für die Nationalversammlung stand und, noch unverständlicher, dass er tatsächlich zum Abgeordneten gewählt worden war.
Bei genauerer Betrachtung spielte es für mich keine Rolle, ob der Mann Abgeordneter war oder nicht. Allerdings ereignete sich etwas, das mich sehr wohl betraf: Eine Woche nach der Wahl rief Bs Manager in unserem Büro an. Überraschenderweise nahm er die Einladung zur Jubiläumsfeier an. Herr B käme gerne, sie müssten nur noch Ort und Uhrzeit wissen. Es bestand kein Zweifel, dass es sich bei dem Anrufer um eben jenen Manager handelte, den ich achtunddreißig Mal vergeblich versucht hatte, telefonisch zu erreichen, und seine Versicherung, B käme gerne, klang nicht wirklich aufrichtig. Meine angestaute Verzweiflung entlud sich, indem ich mich grundlos vor dem Telefon verbeugte und ihm entschuldigend Zeit, Ort und Anfahrtsmöglichkeiten erläuterte, bis mir der Manager nach kurzer Zeit ins Wort fiel, weil er keine Geduld mehr für ein Gespräch mit jemandem wir mir hatte. »Dann sehen wir uns dort«, sagte er knapp. Obwohl er mich abrupt abgewürgt hatte, fühlte ich mich erleichtert, wie in einem guten Traum. So saß ich einfach eine ganze Weile da und starrte benommen auf den Hörer. Der Stalker meiner Kollegin, der tatsächlich gewählt worden war, hatte meine Lügen geglaubt (genau genommen war es ja nicht komplett an den Haaren herbeigezogen gewesen) und nach der Wahl aus Zuneigung zu ihr seine Stalker-Fähigkeiten eingesetzt, um Schauspieler B, dessen Manager und vielleicht sogar den Agenturchef mit seinem politischen Einfluss von Angesicht zu Angesicht einzuschüchtern. Ein paar Andeutungen, ein paar Drohungen, und B war bereit gewesen, bei seinem Leben zu schwören, zu der Feier zu kommen. Ich war etwas verschnupft, dass ich all das nicht vorher gewusst hatte und bei dem Telefongespräch dem arroganten Manager gegenüber so unterwürfig aufgetreten war. Nachdem er meine Anrufe achtunddreißig Mal ignoriert und erst die Arschkriecherei einem Abgeordneten der Nationalversammlung gegenüber zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hatte.
Trotz einiger Körnchen Sand im Getriebe kamen unsere Vorbereitungen für das Jubiläum mit kleineren und größeren Fortschritten voran. Nachdem ich B nun erfolgreich zu seiner Teilnahme verpflichtet hatte, musste ich als Nächstes Einladungen und Plakate erstellen. Diese Handlangertätigkeiten blieben an mir hängen, da ich ein kleines Licht war und nicht in der Position, den Oberen etwas abzuschlagen. Ohne weitere Erklärungen hatten sie lediglich gesagt: »Sie sehen aus, als könnten Sie so etwas verfassen.« Erst später wurde mir schmerzlich bewusst, dass all die Einladungen und Plakate außerhalb des Instituts verteilt werden würden und damit zu auf echtes Papier gedruckten, unwiderruflichen Beweisen wurden. Mit anderen Worten: Wenn ich meine Arbeit gut machte, würde kein Hahn danach krähen, wenn ich aber einen Fehler beging, würde es die ganze Welt erfahren. Ich hatte nicht das kleinste bisschen Entscheidungsbefugnis, aber eine Menge Verantwortung, und meine öffentliche Demütigung war mehr oder weniger vorprogrammiert. Und so kam es dann schließlich auch.
Das Ganze spielte sich ungefähr so ab: Man trug mir auf, einen Entwurf mit dem Titel »Einladungsbrief« zu schreiben, und so tat ich mein Bestes, um die prägnanteste und höflichste Einladung zu verfassen, zu der ich im Stande war. Die Vorstandsmitglieder warfen einen Blick darauf und reichten sie an die Spitze zum Vorstandsvorsitzenden weiter. Das Direktionsbüro gab sie dann mit seinen Kommentaren an mich zurück:
»Schreiben Sie nicht ›Brief‹, schreiben Sie ›Worte‹.«
Also änderte ich die Überschrift in »Worte der Einladung«. Vorstandsmitglied A gab noch die Anweisung:
»Ändern Sie ›Einladung‹ in ›einladend‹.«
Ich änderte es also in »Einladende Worte«. Dann trug mir Vorstandsmitglied B auf:
»Ändern Sie ›Worte‹ in ›Brief‹.«
Das konnte ich nicht ändern.
»Verzeihen Sie, aber der Vorstandsvorsitzende wollte das so …«
»Oh wirklich? Dann lassen Sie es, wie es ist.«
Genau drei Minuten und zwanzig Sekunden später rief mich C an:
»Ändern Sie ›einladend‹ in ›Einladung‹.«
Ungefähr so ging es zwischen den Vorstandsmitgliedern A, B, C, D, E, F und G hin und her. Ich brauchte mehr als eine Woche, nur um zu klären, ob es sich um eine Einladung oder um eine einladende Formulierung handeln sollte, bevor ich schließlich vom Titel zum Haupttext übergehen konnte. Gleich bei der ersten Zeile gab es eine Debatte darüber, ob es sich um eine Gründung oder eine Einrichtung des Instituts handelte. Schließlich kam der Befehl aus dem Büro des Vorstandschefs, dass es »Errichtung« heißen sollte, und damit konnte ich zur nächsten Zeile übergehen. Besagte Einladung war übrigens eine halbe Seite lang. Anfangs war es zwar ein wenig nervig, aber ich war auch dankbar, dass die Vorstandsmitglieder, die eine höhere Position bekleiden, sich um jedes einzelne Wort kümmerten und mir, einer einfachen Angestellten, so viel Aufmerksamkeit schenkten. Doch nachdem ich etwa zehn Mal zwischen »einladend« und »Einladung« – mit oder ohne Artikel – hin und her gewechselt hatte, war ich kurz davor, mir den letzten Entwurf in den Mund zu stecken, um daran zu ersticken.
Doch was blieb mir anderes übrig? Es ist nun mal so, dass ich als einfache Angestellte weisungsgebunden bin, was mich in die Zwickmühle brachte, gleichzeitig etwas tun und unterlassen zu sollen, wenn Vorgesetzter A »Hüh« und Vorgesetzter B »Hott« sagte. Mein Interesse gilt der Erforschung der Unsterblichkeit und egal, ob es sich nun um einen Einladungsbrief oder einladende Worte handelte – das Schreiben ist nicht mein Fachgebiet. Als Mitarbeiterin im Institut und Gehaltsempfängerin muss ich, trotz aller Widrigkeiten, alles erledigen, was mir aufgetragen wird. Allerdings hatte ich trotzdem das Gefühl, alles im Griff zu haben, auch wenn der Einladungstext hunderte Male zwischen den Vorstandsmitgliedern hin- und hergeschoben wurde, weil ich, so lästig es auch war, die Änderungen selbst vornahm. Wer allerdings wirklich zu leiden hatte, nachdem die Einladung endlich fertig war und nun die Plakate gestaltet und abgenommen werden mussten, war die Grafikdesignerin.
Sie war eine Schulfreundin eines Cousins des Mannes einer Kollegin von jemandem, den ich bei einem Vertragspartner aus der Zentrale kannte, also quasi eine Bekannte über vier Ecken. Da wir immensen Zeitdruck hatten, sah ich mir ihre Arbeitsreferenzen und ihr Portfolio noch nicht einmal an, bevor ich sie engagierte. Während ich in unnötige Debatten und ergebnislose Sitzungen verstrickt war, hatte ich plötzlich festgestellt, dass die Jubiläumsfeier unmittelbar bevorstand. Es war höchste Zeit, die Einladungen drucken zu lassen, um sie mit der Bitte um Zusage an die VIPs schicken zu können. Allerdings dauerte es einige Zeit, meine Bekannte bei dem Vertragspartner aus der Zentrale anzurufen, die wiederum ihre Kollegin bat, ihren Mann zu fragen, damit dieser seinen Cousin anrief, der dann seine Freundin die Grafikdesignerin fragte. Ganz zu schweigen davon, wie lange es brauchte, bis der Rückruf der Grafikerin über all diese Ecken bei mir ankam. Dies führte schließlich dazu, dass ich die Grafikdesignerin an einem Freitag anrief und ihr sagte, dass ich unter allen Umständen bis Montag die Druckvorlagen in die Druckerei geben musste, was bedeutete, dass sie das Wochenende durcharbeiten müsste – die ganze Zeit hatte ich Angst, sie würde mir sagen, dies sei völlig unmöglich.
Zu meiner Überraschung erklärte sich die Grafikerin umstandslos einverstanden. Und nicht nur das. Ich hatte ihr den Auftrag erst am Freitag erteilt, und schon am Samstag rief sie mich an, um mir mitzuteilen, dass sie fertig sei. Ich fand, es sah alles perfekt aus und die Vorlage könnte an die Druckerei weitergeleitet werden. Also schickte ich sie an den Vorstandsvorsitzenden und den gesamten Vorstand. Das war Samstagabend.
Ich erhielt keine Rückmeldung bis Sonntagabend, als die Anrufe begannen.
– Vorstandsmitglied F: »Rücken Sie das Institutslogo etwas nach links.«
Ich verschob es.
– Vorstandsmitglied G: »Rücken Sie das Institutslogo etwas nach oben.«
Ich verschob es.
– Vorstandsmitglied D: »Setzen Sie ›Einladende Worte‹ linksbündig.«
Ich setzte es linksbündig.
– Vorstandsmitglied A: »Setzen Sie ›Einladende Worte‹ rechtsbündig und rücken Sie das Institutslogo nach rechts.«
Ich setzte es rechtsbündig und verschob es.
– Vorstandsmitglied C: »Ich trug Ihnen auf, ›Einladende Worte‹ in ›Einladungsbrief‹ zu ändern. Warum haben Sie das nicht getan?«
Ich hatte diesem Kerl bereits gesagt, dass der Vorstandsvorsitzende höchstpersönlich schon vor längerer Zeit »Brief« in »Worte« geändert haben wollte, also warum mischte er sich da jetzt wieder ein? Aber ich konnte einem Vorstandsmitglied natürlich nicht sagen, er solle sich aus der Sache raushalten, weswegen ich ihm alles noch einmal erklären musste.
– Vorstandsmitglied E: »Entfernen Sie das Hintergrundbild.«
Ich entfernte das Hintergrundbild.
– Vorstandsmitglied A: »Warum haben Sie das Hintergrundbild entfernt? Es ist doch gut. Fügen Sie es wieder ein.«
Es gab noch weitere Anordnungen, aber dafür reicht der Platz hier nicht.
Die Position des Institutslogos oder die Ausrichtung des Textes konnte ich mit Photoshop selbst lösen, aber als ich versuchte, den Hintergrund zu entfernen, verschwanden auch Text und Logo. Mir blieb nichts anderes übrig, als am Sonntagabend die Designerin anzurufen. Die Grafikerin war so nett, alles zu verändern, um das wir sie baten, aber nach meinem sechsten Telefonanruf fragte sie:
»So wie ich es sehe, wird das mit den Änderungen so weitergehen, bis wir es morgen in den Druck geben … Glauben Sie nicht, es wäre besser, Sie kämen zu mir ins Atelier, anstatt mich jedes Mal anzurufen?«
Also machte ich mich mitten in der Nacht auf den Weg zum Atelier der Grafikerin. Es war gemütlich, der Duft ihres Kaffees war verlockend, und obendrein hatte sie zwei lebhafte, verschmuste Katzen, die die Arbeitsumgebung angenehm machten. Aber die arme Grafikerin musste mit ansehen, wie ich alle drei Minuten mit Telefonanrufen bombardiert wurde, während sie das Logo nach rechts oder links schob und den Text nach oben oder unten versetzte. So ging es weiter, bis das graue Licht des anbrechenden Tages durchs Fenster fiel. Schließlich fragte sie mich:
»Geht es bei Ihrer Arbeit immer so zu?«
Beim Anblick ihrer fahlen Haut und der geröteten Augen nahm ich mir fest vor, alles daranzusetzen, dass die Grafikerin die größtmögliche Bezahlung erhielt, die wir uns leisten konnten, auch wenn ich selbst zwar Gehalt bezog, aber zahlreiche unbezahlte Überstunden leistete. Muss ich es noch erwähnen: Die gegensätzlichen Anweisungen von oben wiederholten sich auch bei der Erstellung des Posters. Dazu kam, dass einer der Abteilungsleiter in letzter Minute den Vorschlag einbrachte, in den fünf größten Tageszeitungen eine Anzeige zu schalten, den er, ohne die Genehmigung des gesamten Vorstands einzuholen, direkt ins Büro des Vorstandsvorsitzenden schickte. Diesem gefiel der Vorschlag sofort, weswegen ich am Montag um drei Uhr morgens einen Anruf erhielt, in dem es hieß, die Anzeige müsse bis spätestens neun Uhr bei den Zeitungen eingereicht werden. Bis spätestens sechs Uhr müsse ich den Entwurf vorlegen. Ich musste also die Grafikerin mitten in der Nacht wecken und sie bitten, innerhalb von drei Stunden eine Anzeige zu entwerfen und zu schicken. Tatsächlich schickte sie mir sogar zwei Entwürfe nach nur zwei Stunden und vierzig Minuten, und einer davon wurde vom Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Die Anzeige erschien dann in den fünf größten Tageszeitungen nicht etwa auf der Titelseite, sondern unter ferner liefen ab Seite acht. Aber je mehr dieser Details ich erzähle, desto stärker kocht meine Verärgerung wieder hoch, daher lasse ich es dabei bewenden.
Saßen all die Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Teamleiter einfach da und drehten Däumchen, während ich die arme Grafikerin mit diesen fruchtlosen Unterfangen quälte? Nein, sie rannten in ihrer eigenen Hölle im Kreis. Das Institut plante eine Art Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Unternehmenszentrale – etwas, das mit Unsterblichkeit zu tun hatte. Natürlich kam diese Initiative nicht von ganz oben, sondern das Institut war die treibende Kraft. Daher herrschte in der Zentrale im Wesentlichen die Haltung: Wir zahlen bereits für diese Sache, warum belästigt ihr uns dann noch damit? Mit anderen Worten, es herrschte komplettes Desinteresse, was bedeutete, dass das Institut jedes Mal auf einen riesigen Berg an Missbilligung stieß, wenn es die Zustimmung für den Gebrauch der Räumlichkeiten oder des Zubehörs benötigte, um eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die eines Pharmakonzerns würdig war. Die Tatsache, dass Manager und Geschäftsführer eines Forschungsinstituts, noch dazu das eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes, so ein Arbeitspensum bewältigen mussten, war absurd, aber was sollten sie machen? Wie bereits erwähnt, hatten wir keine Praktikanten, und ich, das Mädchen für alles, saß in einem Grafikdesignatelier herum und schob Logo und Text auf einem Plakat hin und her. Wir waren nun einmal nur ein Forschungsinstitut und keine profitable Vertriebsniederlassung, was bedeutete, dass wir für das rauschende Fest mit dem kleinen Budget zurechtkommen mussten, das uns die Zentrale gnädig zugeteilt hatte. Wir konnten also nur davon träumen, die organisatorischen Arbeiten an externe Dienstleister zu vergeben.
Schließlich kam der Tag, an dem die Jubiläumsfeier und die Gedenkausstellung endlich stattfanden, ein Tag, der ohne das Blut, den Schweiß und die Tränen der Mitarbeiter des Instituts sowie der armen Grafikdesignerin, die ohne ihr Zutun in den ganze Schlamassel hineingezogen worden war, nicht möglich gewesen wäre. Die Einladungen, Plakate sowie Pressemappen für die fünf größten Tageszeitungen waren rechtzeitig fertiggestellt, und ich hatte mit einem Mal nichts mehr zu tun. Also ging ich in den Veranstaltungssaal zur Generalprobe, die zwei Tage vor der Feier stattfand, und traf dort Kim Se-Gyeong, die ältere Kollegin, die gestalkt worden war. Wir arbeiteten zwar beide im dritten Stock des Instituts, waren aber so beschäftigt mit der Veranstaltungsorganisation gewesen, dass wir uns schon eine Weile nicht mehr unterhalten hatten. An diesem Tag hatten wir endlich Zeit, gemeinsam zum Mittagessen zu gehen, wo ich ihr von meiner größten Sorge, dem Stalker, erzählte, aber zu meiner Überraschung schien sie vollkommen unbeeindruckt.
»Ist schon in Ordnung. Es hat sich herausgestellt, dass er auf unserer Seite ist.«
»Was? Wie meinst du das?«
Meine Kollegin grinste. »Es ist so lang her, dass du es anscheinend vergessen hast.«
Was vergessen? Sie musste mein fragendes Gesicht bemerkt haben, denn sie erklärte:
»Er hat mal kurz für das Institut gearbeitet, es ist schon eine Weile her.«
»Wirklich?«
»Wenn ich es dir doch sage. Vielleicht war er gerade weg, als du zu uns stießt. Aber ich glaube, es gab eine Überschneidung von etwa zwei Monaten. Erinnerst du dich wirklich nicht an ihn?«
Wenn das zu meiner Anfangszeit gewesen war, dann lag es wirklich schon weit zurück. Als ich nun darüber nachdachte, fiel mir jemand ein, der kurz nach meinem ersten Arbeitstag das Institut verlassen hatte. War mir sein Gesicht deshalb so bekannt vorgekommen?
»Dann stimmt es also, dass er aus der gleichen Gegend kommt wie du? Warum hat er dich gestalkt?«
»Er stammt tatsächlich aus demselben Ort wie ich. Ich glaube, wir sind manchmal zusammen wandern gegangen und dabei sogar einmal einem Tiger begegnet.«
»Was hat es denn mit seinem äußerst seltsamen Wahlversprechen auf sich?«, fragte ich immer noch skeptisch.
Die Kollegin lächelte und erklärte es mir zuvorkommend. »Das ist eine Theorie, die Ende des 19. Jahrhunderts in Russland aufgestellt wurde. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Typen. Er war eine Art Philosoph, und die Idee stellte damals eine Sensation dar. Ich glaube, er hat immer noch fanatische Anhänger in Russland.«
Die Energie der Sonne zu bündeln, um unsere Vorfahren wieder zum Leben zu erwecken, ihnen damit Unsterblichkeit verleihen, und solche Dinge nicht nur zu glauben, sondern fanatischer Anhänger dieser Idee zu sein – Russland muss ein sehr seltsames Land sein. Meine Kollegin lachte angesichts meines argwöhnischen Blicks erneut.
»Dieser ehemalige Kollege hatte schon immer eine komödiantische Ader, glaubt aber wirklich an die Unsterblichkeit. Nur geht es ihm nicht um die Grundlagenforschung, sondern darum, die Idee in der Realität umzusetzen, und genau da unterscheiden wir uns. Trotzdem muss er irgendwie erfahren haben, dass diese Feier zu unserem achtundneunzigsten Jubiläum stattfindet. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um alte Freunde zu treffen, ein paar Hände zu schütteln und zu sehen, ob es etwas gibt, bei dem er helfen kann.«
Dann hätte er das von Anfang an sagen sollen. Warum hatte er sich Kim Se-Gyeong herausgepickt und sich wie ein Stalker verhalten?
Aber meine Kollegin schien die ganze Angelegenheit nicht weiter zu stören.
»Also«, setzte sie hinzu, »er war wirklich hilfreich. Er hat sich um die verfahrene Geschichte mit dem Schauspieler gekümmert. Bei der Gedenkausstellung wird eine externe Referentin dabei sein, und auch sie hat er für uns besorgt.«
»Warum lädt man eine externe Referentin ein?«
»Sie hält Vorträge über Unsterblichkeit und beleuchtet das Thema aus drei verschiedenen Blickwinkeln: der Medizin, der Religion und der Philosophie.«
Das wäre doch auch etwas, was unsere Geschäftsführer oder Manager machen könnten, dachte ich kurz. Doch bei näherer Betrachtung erschien es mir einfacher, externe Referenten einzuladen, da es unangenehm wäre, jemanden ohne zusätzliche Bezahlung um drei Vorträge zu bitten. Gut, meine Kollegin wirkte zufrieden, also beschloss ich, ebenfalls zufrieden zu sein. Da wir zurück zur Arbeit mussten, beendeten wir schnell unser Essen. Zwei weitere Tage vergingen ohne Zwischenfälle, und schließlich war der Tag des Jubiläumsfestes gekommen.
Die Feierlichkeiten begannen um achtzehn Uhr, doch der Veranstaltungsraum war bereits am Morgen gut gefüllt. Wir benutzten einen Saal im Untergeschoss der Firmenzentrale, der gewöhnlich dunkel und trostlos wirkte. Aber durch die extra für das Ereignis installierte helle Beleuchtung und die vielen Gäste erschien der Raum ziemlich festlich. Vor allem als der Filmstar B eintraf, hob das die Stimmung ungemein. Der Schauspieler erweckte nicht den Anschein, als wolle er wirklich dort sein, aber als Pak Hyeok-Se, vermeintlicher Stalker und Abgeordneter der Nationalversammlung, hinzutrat, um ihm die Hand zu schütteln, verflüchtigte sich beim Anblick von Bs gequälter Miene mit einem Mal all der Stress, den ich während der Vorbereitungen gehabt hatte.
Anwesend war außerdem eine außergewöhnlich schöne Frau mit hüftlangen glatten Haaren, die Eindruck auf alle Anwesenden machte. Ich nahm an, sie sei ebenfalls Schauspielerin oder zumindest in der Unterhaltungsbranche tätig, aber offenbar war sie die Referentin, die Pak Hyeok-Se engagiert hatte. Sogleich gesellte sich dieser zu ihr und begann etwas Smalltalk, um sicherzugehen, dass sie sich wohlfühlte. Doch die Referentin schien gelangweilt und verstimmt darüber, von so vielen Fremden umgeben zu sein. Sie streifte eine Weile durch den Ausstellungsbereich, interessierte sich aber wohl wenig für die Exponate.
Jedenfalls war die Ausstellung recht ansehnlich geworden. Als zum ersten Mal davon die Rede gewesen war, hatte ich mich gefragt, wie sie um alles in der Welt die Flächen mit Gegenständen zu füllen gedachten, die mit Unsterblichkeit zu tun hatten. Doch tatsächlich gab es dort eine Fülle von Objekten: Gemälde, Fotos, Bücher, DVDs und andere interessante Dinge. Darunter auch einige abstrakte Gemälde eines unbekannten Künstlers, der Kleckse mit Titeln wie »Kein Tod« oder Ähnlichem produziert hatte. Es waren aber auch andere Werke dabei, die den religiösen Aspekt von Unsterblichkeit oder Auferstehung beleuchteten, sowie eine Dokumentarfilmserie über Kaiser Quin Shi Huang und seine Suche nach dem Kraut der Unsterblichkeit (aus dem Privateigentum des Vorstandsmitglieds, das darauf beharrt hatte, den Schauspieler B einzuladen, da »lange Jugend« und »ewiges Leben« dasselbe seien). Als ich mich in dem fein herausgeputzten Saal umsah, stellte ich fest, wie besessen die Menschheit vom ewigen Leben war und dass diese Obsession von Beginn der Geschichtsschreibung an bis heute andauerte, was einerseits hochinspirierend und andererseits auch irgendwie bemitleidenswert war – eine komplizierte Mischung von Emotionen.
Die Bücher, CDs und DVDs befanden sich in Vitrinen, und da wir uns keine Aushilfskraft leisten konnten, war ich mit dem Verkauf der Souvenirs betraut: schöne Flaschen mit unserem Institutslogo darauf, die angeblich »Unsterblichkeits-Elixier« enthielten, zu fünftausend Won das Stück.
»Das ist nicht wirklich ein Unsterblichkeitstrank, oder?«, fragte ich den Manager, der neben mir am Tisch mit den Souvenirs saß.
Er grinste: »Ich glaube, nur zwei von den fünfzehnhundert enthalten das echte Zeug.«
»Aber glauben die Leute wirklich, was auf dem Etikett steht, und kaufen den Mist?«
»Niemand glaubt so etwas in diesen aufgeklärten Zeiten. Ich denke, die Flaschen werden vor allem von Vertragspartnern gekauft oder Leuten aus der Firmenzentrale, die uns aus Höflichkeit etwas Kleingeld zukommen lassen wollen.«
Bedenkt man, dass sie alle nur »höflich« sein wollten, kam im Laufe des Tages durch den Verkauf doch eine stolze Summe von dreihunderttausend Won zusammen, geschuldet womöglich der Tatsache, dass die Flaschen mit dem Etikett äußerst niedlich aussahen (wofür wir die arme Gestalterin drei Nächte hatten durcharbeiten lassen, um das Motiv nach links zu verschieben, dann wieder nach rechts und so weiter).
»Ich bin so froh, dass sie sich verkaufen.«
»Das sollten Sie besser auch. Wir müssen dringend alle Flaschen an den Mann bringen, um die Produktionskosten der Souvenirs zu decken und die Grafikerin bezahlen zu können.«
Ich war überrascht. »Haben wir sie immer noch nicht bezahlt?«
Statt einer Antwort zeigte der Manager nach draußen. Im Eingangsbereich waren Bedienstete vom Catering-Service dabei, Essen anzuliefern und ein Buffet aufzubauen.
»Es sieht so aus, als hätten wir unser knappes Budget von der Zentrale aufgebraucht. Wir werden auch weiterhin die Flaschen verkaufen, solange der Vorrat reicht, und die Grafikdesignerin in Raten bezahlen.« Dann holte der Manager bedächtig den Umschlag mit den Verkaufserlösen hervor, entnahm das Geld und zählte die zahlreichen Tausend- und Fünftausend-Won-Scheine. »Das sind zweihundertachtundneunzigtausend Won. Überweisen Sie das bitte jetzt gleich, und morgen werden wir dann mit den weiteren Einnahmen die nächste Rate bezahlen.«
Ich dachte, er machte einen Scherz, aber dem war nicht so. Ich war noch nie in meinem Leben so beschämt. Auch hatte er nicht erklärt, wie er bei seiner Zählung auf eine Summe gekommen war, die mit »achttausend« endete, obwohl die Flaschen doch fünftausend Won kosteten, aber ich war zu verstört, um nachzufragen.
***
Bald wurde es Abend, und die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen. Der Festakt war, wie zu erwarten, ziemlich langweilig. Einige Leute aus der Firmenzentrale und ehemalige Vorstandsvorsitzende traten ans Pult und hielten Reden, die alle mit »Meine liebe Institutsfamilie …« begannen, und es verlangte wirklich Unsterblichkeit, sie bis zum Ende durchzustehen. Die VIPs, die ebenso ungeniert eingenickt waren wie die Firmenvertreter oder Vorgesetzten, dösten auf ihren Plätzen, ohne dass dies Folgen hatte.
Als der Form genüge getan war, verkündete der derzeitige Vorstandsvorsitzende endlich: »Nun lasst uns in die Eingangshalle gehen und das Bankett genießen!« All die eingeschlummerten VIPs waren urplötzlich auf den Beinen und begaben sich schnurstracks in Richtung Buffet. Nachdem auch die Geschäftsführer und Manager den Raum verlassen hatten, war es meine Aufgabe, die Lichter zu löschen und die Tür hinter mir zu schließen. Abschließen konnte ich den Veranstaltungssaal jedoch nicht, da alle Mitarbeiter des Instituts ihre Sachen in einer Ecke abgelegt hatten und ich allein im Besitz eines Schlüssels war. Ich wollte nicht alle zehn Sekunden vom Essen weggeholt werden, nur um jemandem die Tür zu öffnen, der seine persönlichen Gegenstände holen wollte.