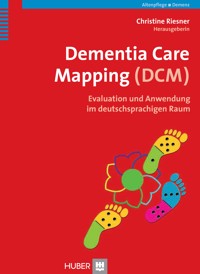
Dementia Care Mapping (DCM) E-Book
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dementia Care Mapping (DCM) gehört zu den bekanntesten Evaluationsintrumenten für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Es ist ein zentrales Arbeitsmittel person-zentrierter Pflege. Das vom 'Who is who' der deutschsprachigen DCM-Szene verfasste Werk beschreibt die aktuelle Entwicklung, Anwendungen und Perspektiven von DCM im deutschsprachigen Raum. Es zeigt anschaulich den 'Fussabdruck', den DCM in der person-zentrierten Pflege hinterlassen hat. Aus dem Inhalt · DCM im Kontext von Konzepten zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz · DCM-Instrument und Methode · Dementia Care Mapping und der Einfluss von Umgebungsfaktoren auf das Wohlbefinden · DCM im Krankenhaus – Erfahrungen in Deutschland im internationalen Kontext · DCM in der Tagespflege – ein Erfahrungsbericht · Angehörige von Menschen mit Demenz im DCM-Prozess beteiligen · DCM unter ökonomischer Betrachtung · Vernetzung von DCM-Partnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
[1]Christine Riesner (Hrsg.)
Verlag Hans Huber
Dementia Care Mapping (DCM)
Programmbereich Pflege
Beirat
Angelika Abt-Zegelin, Dortmund
Jürgen Osterbrink, Salzburg
Doris Schaeffer, Bielefeld
Christine Sowinski, Köln
Franz Wagner, Berlin
[2][3]Christine Riesner (Herausgeberin)
Dementia Care Mapping (DCM)
Evaluation und Anwendung im deutschsprachigen Raum
Unter Mitarbeit von
Christian Müller-Hergl
Beate Radzey
Iris Hochgraeber
Christine Riesner
Renate Kirchgäßner
Detlef Rüsing
Milena von Kutzleben
Johannes van Dijk
Lieseltraud Lange-Riechmann
Claudia Zemlin
Stefan Ortner
Maria Zörkler
Tina Quasdorf
Verlag Hans Huber
[4]Christine Riesner (Hrsg.) Dr. rer., Dr. rer. medic., BScN, MSEN, MScN, DCM Strategic Lead Germany
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE)
in Kooperation mit der Universitהt Witten/Herdecke
Standort Witten
Stockumer Str. 12
DE-58453 Witten
Tel.: +49 23 02 926 175
Fax: +49 23 02 926 318
Web: http://www.dzne.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Jürgen Georg, Andrea Weberschinke
Bearbeitung: Swantje Kubillus
Herstellung: Daniel Berger
Titelillustration: pinx. Winterwerb und Partner, Design-Büro, Wiesbaden
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Verfasser haben größte Mühe darauf verwandt, dass die therapeutischen Angaben insbesondere von Medikamenten, ihre Dosierungen und Applikationen dem jeweiligen Wissensstand bei der Fertigstellung des Werkes entsprechen.
Da jedoch die Pflege und Medizin als Wissenschaften ständig im Fluss sind, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, übernimmt der Verlag für derartige Angaben keine Gewähr. Jeder Anwender ist daher dringend aufgefordert, alle Angaben in eigener Verantwortung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen oder Warenbezeichnungen in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Lektorat Pflege
z. H.: Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
Fax: 0041 (0)31 300 4593
http://verlag-hanshuber.com
1. Auflage 2014
© 2014 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95344-1
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75344-7)
ISBN 978-3-456-85344-4
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
[5]Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort der deutschen Herausgeberin
1.
DCM im Kontext von Konzepten zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Christian Müller-Hergl
1.1
Einleitung
1.2
Pflegequalität, Subjektivität und wertorientierte Entwicklung
1.3
Lebensqualität als multidimensionales Konstrukt
1.4
Von der Selbstbekundung zur Fremdeinschätzung
1.5
Beobachtung
1.6
Es gibt keine «Cadillac-Version»
1.6.1
Sind Selbstauskünfte unhinterfragbar?
1.6.2
Um was geht es bei der Erhebung von Lebensqualität
1.7
Personsein
1.8
Entwicklung einer wertorientierten Pflegekultur
1.8.1
Wie man lebt, nicht (nur), wie es geht
1.9
Fazit
2.
DCM – Instrument und Methode
Christine Riesner
2.1
Einleitung
2.2
Hintergrund – Dialektik der Demenz
2.2.1
Maligne Sozialpsychologie und Personsein
2.2.2
Positive Personenarbeit und Wohlbefinden
2.3
DCM – Das Instrument
2.3.1
DCM – DieVerhaltenskategorien
2.3.2
DCM Wohlbefinden
2.3.3
DCM – Sozialpsychologie und Beziehungsqualität
2.4
DCM – Die Methode
2.5
Ethik
2.6
Psychometrische Untersuchungen zu DCM
2.6.1
Diskussion der psychometrischen Untersuchungen von DCM
2.7
Einsatzgebiete von DCM
2.8
Zusammenfassung und Ausblick
3.
[6]Biografie, psychobiografisches Pflegemodell nach Böhm und DCM
Claudia Zemlin und Beate Radzey
3.1
Einleitung
3.2
Theoretischer Zugang zu Biografie und person-zentrierter Pflege
3.2.1
Biografisches Arbeiten und Erinnerungspflege in der Altenhilfe
3.2.2
Die Biografie eines Menschen im psychobiografischen Pflegemodell
3.2.3
Grundlagen des Modells
3.3
Praxisbeispiel eines trägerinternen Implementierungsprozesses
3.3.1
Einführung
3.3.2
Ausgangssituation
3.3.3
Neuausrichtung auf person-zentrierte Pflege und Einführung von DCM
3.3.4
Einführung des psychobiografischen Pflegemodells
3.3.5
Die Verknüpfung der beiden Ansätze
3.3.6
Kitwoods und Böhms Ansatz: Was verbindet sie?
3.3.7
Konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklungen
3.3.8
Ergebnisqualität: DCM-Ergebnisse und Mitarbeiterhaltung
3.4
Fazit
4.
Der Einfluss von Umgebungsfaktoren auf das Wohlbefinden
Beate Radzey
4.1
Einführung
4.2
Theoretische Konzepte zur Konzeptualisierung von Mensch-Umwelt-Beziehungen
4.3
Die Bedeutung der Umgebungsbedingungen
4.3.1
Ausgewogenheit sensorischer Umweltstimuli
4.3.2
Vermeidung akustischer Überstimulation
4.3.3
Licht für besseres Sehen
4.3.4
Licht am Tag für besseres Schlafen in der Nacht
4.3.5
Vermeidung von Blendung
4.3.6
Gerüche schaffen Atmosphäre
4.3.7
Thermische Behaglichkeit
4.4
Anregungen und Handlungsmöglichkeiten bieten
4.4.1
Wohnküchen
4.4.2
«Aktivitätsecken»
4.4.3
Bewegungsraum
4.4.4
Freibereiche
4.5
Räumlich-soziales Verhalten
4.5.1
Respektieren des persönlichen Raums
4.5.2
Stresserleben durch eine zu große soziale Dichte
4.5.3
Sitzordnung und Position im Raum
4.6
Sich vertraut und heimisch fühlen
4.6.1
Gestalterische Assoziationen an Häuslichkeit
4.6.2
Möglichkeiten zur Entwicklung bedürfnisorientierter Nutzungsund Verhaltensmuster
4.6.3
Die Bedeutung von «Lieblingsplätzen»
4.7
[7]Person-zentrierte Pflege und Milieutherapie als sich ergänzende Rahmenkonzepte
4.8
Ausblick
5.
Erfassung des Erlebens von Menschen mit Demenz durch DCM und Interviews – Ergebnisse und Erfahrungen am Beispiel eines Betreuungsangebotes
Iris Hochgraeber
5.1
Einleitung
5.2
Hintergrund
5.3
Ziel und Fragestellung
5.4
Methodik
5.4.1
Untersuchungsfeld
5.4.2
Erhebung und ethische Aspekt
5.4.3
Analyse
5.5
Ergebnisse
5.5.1
Teilnehmende Personen
5.5.2
DCM-Erhebungen
5.5.3
Interviews
5.6
Diskussion
5.7
Limitationen der Studie
5.8
Fazit
6.
DCM im Krankenhaus – Erfahrungen in Deutschland im internationalen Kontext
Detlef Rüsing und Claudia Zemlin
6.1
Einleitung
6.2
Demenz im Krankenhaus
6.2.1
Die Situation von Menschen mit Demenz im Krankenhaus
6.2.2
Projekte und Studien zur Verbesserung der Versorgung in der Akutversorgung
6.3
DCM im Krankenhaus
6.3.1
Dementia Care Mapping – Instrument und Methode
6.3.2
Anwendung der DCM-Methode im Krankenhaus
6.3.3
DCM – Studien zur Anwendung in Krankenhäusern
6.4
Fazit
7.
DCM in der Tagespflege – Ein Erfahrungsbericht
Tina Quasdorf und Milena von Kutzleben
7.1
Einleitung
7.2
Tagespflege als ein Angebot der teilstationären Versorgung für Menschen mit Demenz
7.3
Die Tagespflege am Turm in Sprockhövel als beispielhaftes Setting für eine DCM-Beobachtung
7.4
Ergebnisse
7.4.1
Gruppenbezogene Ergebnisse – Darstellung im Tagesverlauf
7.4.2
Zusammenfassung der Daten
7.4.3
[8]Tagesverlauf
7.4.4
Psychologische Bedürfnisse
7.4.5
Diskussion und Zwischenfazit
7.5
Fallbeispiel I – Herr A
7.5.1
Zusammenfassung der Daten
7.5.2
Tagesverlauf
7.5.3
Psychologische Bedürfnisse
7.5.4
Diskussion und Zwischenfazit
7.6
Fallbeispiel II – Frau B
7.6.1
Zusammenfassung der Daten
7.6.2
Tagesverlauf
7.6.3
Psychologische Bedürfnisse
7.6.4
Diskussion und Zwischenfazit
7.7
Reflexion der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und des Feedbackgesprächs
7.8
Diskussion und Fazit
8.
Die DCM-Evaluation ist zu lang – geht es auch kürzer?
Johannes van Dijk und Claudia Zemlin
8.1
Einleitung
8.2
Gründe dafür, dass DCM nicht angewendet wird
8.2.1
Potentiell interessierte Einrichtungen, die DCM nicht einsetzen
8.2.2
Einrichtungen, die DCM anfangen und damit später wieder aufhören
8.3
Was kostet DCM?
8.4
Zeitbedarf für eine Beobachtung über sechs Stunden
8.5
Können mit weniger Zeitaufwand ausreichend gute Ergebnisse erzielt werden?
8.6
Erfahrungen mit Kurz-DCM
8.6.1
Kurz-DCM in der Stunde vor dem Mittagessen
8.6.2
Untersuchungsergebnisse von sieben Kurz-DCM-Modellen
8.6.3
Parallelmappings
8.6.4
Ein positives Praxisbeispiel von Kurz-DCM
8.6.5
Schriftliche Befragung der Mitarbeiter zur Einschätzung von Kurz-DCM
8.6.6
Wenn aus Voll-DCM nur ein Teil benutzt wird
8.7
Empfehlung zu Einsatzmöglichkeiten von Kurzmappings
9.
Angehörige im DCM-Prozess beteiligen
Stefan Ortner
9.1
Einleitung
9.2
Angehörige in den DCM-Prozessaufbau integrieren
9.2.1
Aufbau des DCM-Prozesses mit Angehörigen
9.2.2
Organisation von Feedbackgesprächen im DCM mit Angehörigen
9.2.3
Der Ablauf des Angehörigenfeedback
9.3
Die Teilnehmenden des Angehörigenfeedback, ihre Rollen und Anliegen
9.3.1
Die Vertreter des Pflegeteams
9.3.2
Die Angehörigen und ihre Anliegen
9.3.3
Die Beobachter als Moderatoren und Advokaten des dementen Bewohners
9.3.4
[9]Die Beobachter als Moderatoren: Konflikte und verdeckte Anliegen
9.4
Die Beobachter als Advokaten: Perspektiven differenzieren
9.5
Die Dynamik der Öffnung im Angehörigenfeedback
9.6
Zugang zum biografischen Verstehen im Angehörigenfeedback
9.7
Abschluss
10.
DCM in innovativen Versorgungsformen – Das Beispiel häuslicher Tagespflege
Maria Zörkler und Renate Kirchgäßner
10.1
Einleitung
10.2
Ausgangssituation
10.3
Die Erprobung qualitätsgesicherter häuslicher Tagespflege
10.3.1
Zufriedenheit der Gäste und Angehörigen
10.3.2
Zufriedenheit und Belastungserleben der Betreuungspersonen
10.3.3
Wohlbefinden der Gäste
10.4
Fazit und Ausblick
11.
DCM unter ökonomischer Betrachtung
Lieseltraud Lange-Riechmann
11.1
Einleitung
11.2
Ökonomie und die Zufriedenheit aller Betroffenen
11.2.1
Nachweis der Zufriedenheit
11.3
Ökonomische Effizienz für Unternehmen und Organisationen
11.3.1
Personalkosten und die Weiterentwicklung einer Dienstleistung in Unternehmen
11.4
Veränderungen von Hierarchien
11.5
Humankapital
11.6
Bedeutung von Wissensmanagement für die ökonomische Effizienz in Unternehmen
11.7
Marketingaspekt von DCM im Unternehmen
11.8
Preisfindung
11.9
Gesellschaftliche Verantwortung
11.10
Zusammenfassung
12.
Vernetzung von DCM-Partnern
Lieseltraud Lange-Riechmann
12.1
Einleitung
12.2
Das Implementierungsprojekt
12.3
Der Landkreis Minden-Lübbecke
12.4
Das Projekt
12.4.1
Projekt-Evaluation
12.5
Case- und Caremanagement
12.6
Umsetzung in die Praxis
12.6.1
Bewertung der Umsetzung in die Praxis
12.6.2
Finanzierung
12.7
SWOT-Analyse
12.7.1
SWOT-Analyse des Unternehmens
12.7.2
SWOT-Analyse aus Sicht der Mapper
12.8
[10]Zusammenfassung
12.9
Ausblick
Deutschsprachige Literatur, Adressen und Links zum Thema «Demenz»
Adressenverzeichnis
MitarbeiterInnenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
[11]Dementia Care Mapping – Erfahrungen und Anwendung in deutschen Versorgungskontexten
Demenz – eine der großen Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft. Nach derzeitigen Schätzungen leben bis zu 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, mit der Diagnose Demenz. Vor dem Hintergrund der Tatsachen, dass die Ursachen für das Entstehen der Erkrankung immer noch unklar sind und eine effektive Therapie demnach auf sich warten lässt, kommt insbesondere psycho-sozialen Interventionen sowie einem person-zentrierten Betreuungsansatz eine herausragende Rolle zu. Genau hier setzt die vorliegende Publikation an.
Dementia Care Mapping (DCM), eine seit 1998 international erfolgreich eingesetzte Beobachtungsmethode, die die Möglichkeit bietet, den Alltag eines Menschen mit Demenz abzubilden. DCM geht auf die theoretischen Ausführungen von Kitwood zur person-zentrierten Pflege zurück. Mit Hilfe dieser Methode gelingt es, detaillierte Auskunft darüber zu erhalten, welche Vorlieben oder Abneigungen eine Person hat oder wie Pflege und Betreuung erlebt wird. DCM setzt damit unmittelbar am Erleben der von Demenz betroffenen Person an und räumt dem Wohlbefinden einen zentralen Stellenwert ein. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, ein individuell angepasstes Angebot anbieten zu können und somit auch die Qualität von Pflege und Betreuung zu erhöhen.
Dementia Care Mapping bedient zwei Ergebnisebenen: Erstens, das Wohlbefinden des Menschen mit Demenz, verstanden als Ergebnis für eine person-zentrierte Pflege und Betreuung. Gleichwohl sei angemerkt, dass noch Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Generalisierbarkeit der Aussagen sowie der Frage danach, ob eine quantitative Zusammenfassung aller auf das Wohlbefinden ausgerichteter Fragen methodisch hinreichend abgesichert ist. Zweitens, die detaillierte Abbildung des Alltags mit konkreten Hinweisen auf das Verhalten und Erleben von Pflege und Betreuung sowie der Beziehungsqualität. Hierbei handelt es sich um quantitative wie auch qualitative Daten, die gehaltvoll für die Praxis und den Pflegeprozess sind.
Dementia Care Mapping verbindet Praxisanforderungen sinnvoll mit Forschungsfragen: Es wird von den Praktikern geschätzt, da es wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung von Pflege und Betreuung liefert. Es wurde aus der Praxis heraus entwickelt und fand dann Einzug in die Pflegeforschung. Es ist in der Pflegeforschung international akzeptiert. Gleichwohl handelt es sich um eine sehr komplexe Beobachtungsmethode, die sowohl personal- als auch zeitintensiv ist. Bedingt durch ihren Anspruch personzentrierte Pflege und Betreuung nicht nur zu erfassen, sondern auch deren Umsetzung im Alltag zu befördern, geht mit einer Implementierung ein Sinneswandel einher, d. h. weg von einer vorwiegend funktionalen, hin zu einer den Anforderungen der Person mit Demenz orientierten Alltagsgestaltung.
Der Herausgeberin ist es gelungen, Autorinnen und Autoren zu gewinnen, um die Vielzahl der unterschiedlichen DCM Anwendungsgebiete zusammenfassend darzustellen. Somit verdeutlichen die einzelnen Beiträge in diesem Buch einerseits, wie Dementia Care Mapping in[12] verschiedenen Betreuungs- und Pflegesettings (u.a. stationäre Pflege, Tagespflege, Krankenhaus) eingesetzt werden kann. Andererseits werden theoretische und methodische Herausforderungen von Dementia Care Mapping erläutert. Somit bedient diese Publikation sowohl Anforderungen der Praxis als auch der Forschung und stellt einen wertvollen Beitrag für die weitere Diskussion hinsichtlich noch offener Fragen und Anwendungsbereiche dar.
Witten, 1. Oktober 2013
Prof. Dr. Martina Roes
[13]Vorwort der Herausgeberin
Die personzentrierte Pflege bei Demenz und das Dementia Care Mapping (DCM) sind in Deutschland schon viele Jahre bekannt. Erste DCM Basiskurse, in denen das Kodieren, Analysieren und Feedback-Geben mit DCM erlernt werden, fanden seit dem Jahr 1998 statt. Seit diesen Anfängen wird DCM in der Praxis und in wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten behandelt oder es werden Evaluationen mit DCM durchgeführt. Wohlbefinden für Menschen mit Demenz hat sich zu einem wesentlichen Qualitätsmerkmal guter Demenzpflege entwickelt und auch dies hängt mit Kitwoods Theorie person-zentrierter Pflege und dem DCM Instrumentarium zusammen.
In der (Demenz) Versorgung wird die Auseinandersetzung um wissenschaftlich und/oder praktisch nutzbare Assessment-Instrumente fortlaufend geführt. Die Anforderungen an ein Assessment können sich je nach Praxis- oder wissenschaftlicher Nutzung unterscheiden. Die Frage der Adaptierbarkeit in einen Praxiskontext ist beispielsweise eher ein Kriterium für die Praxisanwendung. Dieser Aspekt soll später noch einmal aufgegriffen werden. An dieser Stelle ist es wichtig, festzuhalten, dass DCM unter Beteiligung der Praxis für die Praxis entwickelt wurde. Es sind hierfür viele Stunden für Feldversuche, Diskussionen mit Praktikern und Assessment-Anpassungen verwendet worden. So ist ein komplexes Instrumentarium entstanden, welches auch wissenschaftlichen Anforderungen der Validität und Reliabilität standhält, aber seine volle Kapazität erst in der Praxisentwicklung entfalten kann.
In Deutschland sind bisher hauptsächlich aus dem Englischen übersetzte Werke zu Kitwoods Theorie personzentrierter Pflege und DCM erhältlich. Das vorliegende Buch stellt die erste Sammlung von Erfahrungen mit Themen der personzentrierten Pflege unter Verwendung von DCM in Deutschland dar. Es enthält Beiträge, die sich, wie DCM selbst, in der Verbindung zwischen Praxis und Wissenschaft bewegen. Beispielsweise wird eine eher wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung um Konstrukte der Lebensqualität bei Demenz und DCM im ersten Kapitel geführt. Die Theorie personzentrierter Pflege und ihre Konzepte, das Assessmentinstrument DCM mit seinen Konstrukten und psychometrischen Eigenschaften und die DCM Methode wird in Kapitel 2 bearbeitet. Eine wissenschaftliche Qualifizierungsarbeit beschäftigt sich mit dem Erleben von Menschen mit Demenz in niedrigschwelligen Betreuungsangeboten in Kapitel 5. Evaluationen der Praxis werden mit verschiedenen Fragestellungen in mehreren Kapiteln behandelt. Erkenntnisse zu Versorgungsthemen durch die DCM Anwendung, wie z.B. die Einbeziehung Angehöriger, den Einfluss des Milieus auf das Erleben von Menschen mit Demenz oder den Einsatz von DCM im Krankenhaus finden in weiteren Kapiteln statt. Eine praxisnahe Auseinandersetzung mit Fragen der Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten für die DCM Anwendung wird in Kapitel 8 geführt und Kapitel 11 befasst sich mit der ökonomischen Analyse von DCM Einsätzen. Die Darstellung der Netzwerkarbeit unter Verwendung von DCM wird in Kapitel 12 besprochen. Es ist also zusammenfassend ein umfangreiches Werk entstanden, in dem viele Anwendungen und Erfahrungen mit DCM und personzentrierter Pflege[14] in Deutschland zusammengeführt wurden. Darin besteht auf der abstrakteren Ebene der Wert dieses Werks, denn es zeigt, dass DCM heute auch in Deutschland zum Versorgungsalltag bei Demenz gehört. Auf einer detaillierteren Ebene ist ein facettenreiches Bild gelungener Ansätze, interessanter Erkenntnisse und zukunftsweisender Fragen zur Gestaltung des Alltags für Menschen mit Demenz entstanden, die sowohl praktische Impulse setzen als auch zu weiterer wissenschaftlicher Auseinandersetzung anregen.
Das Thema der Implementierung von DCM wurde in dieser Publikation nicht intensiv behandelt, denn hierzu stehen viele wissenschaftliche Erkenntnisse noch aus. In einer DCM Implementierungsstudie besteht ein häufig verwendetes Design in der Schulung von Mitarbeitern in personzentrierter Pflege und in der Anwendung der DCM Methode bestehend aus einer Einführung, der DCM Anwendung, des anschließenden Feedbacks und danach erfolgenden Erstellung eines Handlungsplans. Teilweise wird zusätzlich die Veränderung der Haltung und Einstellung der Mitarbeitenden zu Menschen mit Demenz (Attitudes to Dementia Questionnaire ADQ) oder die personzentrierte Umgebung (PCAT) erfasst. Die Ergebnisse dieser Studien stellen eine wichtige Basis für die Praxisimplementierung dar, allerdings sind viele Fragen hier noch nicht beantwortet. So ist die Frage nach Kriterien für das Bereitsein der Organisation (organizational readyness) für eine erfolgversprechende DCM Implementierung noch offen. Ebenso ist unklar, wie engmaschig DCM angewendet werden sollte, um eine Verbesserung im Hinblick auf person-zentrierte Pflege erreichen zu können. Fragen beispielsweise nach den Grundanforderungen an einen DCM-Ergebnisbericht und an einen DCM-Handlungsplan schließen sich an. Hier werden gegenwärtig in verschiedenen Ländern Studien durchgeführt, deren Ergebnisse das Wissen zur DCM Anwendung vermehren werden.
Wuppertal, 1. Oktober 2013
Dr. Christine Riesner
[15]1. DCM im Kontext von Konzepten zur Lebensqualität von Menschen mit Demenz
Von Christian Müller-Hergl
1.1 Einleitung
Ziel dieses Kapitels ist es, DCM im Kontext der Diskussion um Lebensqualität und ihre Darstellung zu verorten. In Abgrenzung zu Befragungen von Menschen mit Demenz und Einschätzungen seitens der Angehörigen oder Professionellen soll der besondere Beitrag von DCM zur Qualitätsdiskussion herausgearbeitet werden. Die ausgeprägte Verknüpfung von Prozess und Ergebnis lässt Anknüpfungspunkte für die Verbesserung der Praxis besonders deutlich werden. Daraus begründet sich der Anspruch des DCM-Verfahrens, in besonderer Weise zur entwicklungsbezogenen Evaluation von Einrichtungen beizutragen.
1.2 Pflegequalität, Subjektivität und wertorientierte Entwicklung
Pflegequalität entwickelt sich an dem Anspruch, die Bedürfnisse und Erwartungen der Klienten möglichst zu erfüllen. Dazu gehört auch, nicht nur die Werte und die Lebensgeschichte eines Menschen zu kennen, sondern auch zu wissen, wie er die Krankheit erlebt und was diese für ihn unter den konkreten Lebensbedingungen, beispielsweise einer stationären Einrichtung, bedeutet (Holst/Hallberg, 2003). Für Menschen mit Demenz ergibt sich die besondere Herausforderung, dass Erinnerung und Urteilsfähigkeit, Sprache und Einsicht beeinträchtigt sind. Dennoch liegen inzwischen viele Belege dafür vor, dass Menschen mit leichter und mittelschwerer Demenz über ihre Erfahrungen – auch mit der Pflege – berichten können (van Baalen et al, 2011).
Die Beziehung von Pflege- und Lebensqualität ist komplex: Pflegequalität ist eine notwendige, nicht aber hinreichende Voraussetzung von Lebensqualität. Erstere kann ausgezeichnet ausfallen, ohne dass eine hohe Lebensqualität resultiert (Edelman et al., 2005). Andererseits wird in der Regel die Lebensqualität als Teilaspekt der Pflegequalität betrachtet: So gilt sensorische Überstimulation als Mangel in der Pflegequalität aber auch als Mangel der Lebensqualität.
Für viele Klientinnen und Klienten, gerade mit Demenz, ist subjektiv die klinische, funktionale Pflege weniger wichtig, sie verbinden psychosoziale Zuwendung und sinnvolle Betätigung mit Lebensqualität (vgl. Müller-Hergl, 2010). Dies gilt weniger für das sehr späte Stadium der Demenz im Kontext palliativer Pflege, bei der eher die Durchführung der Pflege als möglicher Hinweis auf Lebensqualität gilt (Volicer et al., 2000). Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz sind insgesamt eher zufrieden mit Umwelt und Komfort, weniger zufrieden mit Aktivitäten, Privatheit, Individualität und bedeutsamen Beziehungen: die Lebensqualität, insbesondere in Hinblick auf emotionales Wohlbefinden, nimmt mit der Schwere der Demenz eher ab (Abrahamson et al., 2012). Insgesamt nimmt das Thema Lebensqualität in betonter[16] Weise die Erfahrungswelt der Person in den Blick – es geht weniger um «health care» sondern darum, sein eigenes Leben sinnvoll zu gestalten (Rubinstein, 2000; Uman et al., 2000). Die WHO (1997) definiert Lebensqualität als «the individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value system in which they live, and in relationship to their goals, expectations, and standards». Damit lässt sich die Frage nach der Lebensqualität nicht loslösen von Fragen, wie Menschen und Familien das Leben mit Demenz erfahren und bewältigen.
Lebensqualität als Teil der Pflegequalität sollte nicht als Glasperlenspiel betrachtet werden: zum einen geht es darum, Defizite der Institutionen und Hospitalisierungsfolgen, insbesondere eine übermäßige Funktionalisierung des Alltags unter Vernachlässigung der psychosozialen Bedürfnisse aufzudecken; zum anderen ist ein gezielter und präziser Beitrag zu einer wertorientierten Entwicklung von Dienstleistungen zu erbringen, um Zufriedenheit (in der Regel bezogen auf extern festgelegte Dimensionen), Wohlbefinden (subjektives Erleben und Bewerten) und Freude zu steigern, Teilhabe zu sichern und individuell bereichernde Gelegenheiten zu schaffen sowie Vermeidung belastender Situationen zu ermöglichen (Cummins/Lau, 2003).
1.3 Lebensqualität als multidimensionales Konstrukt
Lebensqualität stellt ein multidimensionales Konstrukt dar: bestimmte Faktoren wie gesundheitliche Versorgung und materielle Sicherheit, Wahrung der Rechte sowie Umweltbedingungen, aber auch Anzahl und Qualifizierung der Professionellen sind eher am objektiven Ende des Lebenskontextes verortet und können an allgemeinen beziehungsweise kulturell eingegrenzten Standards überprüft werden (sozialnormative Kriterien). Dies entspricht in der Terminologie Veenhovens (2000) der ökonomischen, ökologischen und kulturellen «livability» der Umwelt (in etwa: Lebenswürdigkeit). Davon zu unterscheiden sind die für die konkrete Person spezifischen Interessen und Bedürfnisse, die individuellen Diagnosen und das Verhalten (bei Veenhoven [2000] die Lebensfähigkeit der Person mit den Dimensionen der körperlichen[17] und geistigen Gesundheit sowie dem Wissen und den Fertigkeiten der Person). Es folgen die persönlichen und subjektiven Erfahrungen und die Bewertung des eigenen Lebens im Kontext der objektiven Faktoren und Kontexte (evaluative Komponente). Letzteres entspricht der subjektiven Einschätzung des Lebens nach Veenhoven (2000): Zufriedenheit, Affekte und Stimmungen sowie allgemeine affektive und kognitive Einschätzungen des Lebens.
Tabelle 1-1: Lebens- und Pflegequalität (eigene Darstellung Müller-Hergl, C.)
Konzepte der Lebensqualität
Konzepte der Pflegequalität
Würde
Gesundheit
Privatheit
Mobilität, Stürze
Interaktion und Kommunikation mit Angehörigen und Professionellen
Ernährung
Milieu
Inkontinenz
Beziehungen zu Freunden, Familie, anderen Klienten
Lebensqualität (beispielsweise Fixierungen, sensorische Unterstimulation, Aktivitätsmangel)
Selbstachtung, Selbstwert
Hautzustand
Affekt und Stimmung
Medikation, insbesondere psychotrope Drogen
Engagement und tätig sein
Sensorik (zum Beispiel Hören, Sehen)
Lebenssituation
physisches Wohlbefinden
Tabelle 1-2: Objektive und subjektive Faktoren der Lebensqualität (eigene Darstellung Müller-Hergl, C.)
Eher objektive Aspekte der Lebensqualität
Eher subjektive Aspekte der Lebensqualität
Verhaltenskompetenz
Affekte, Stimmungen
Gesundheit (z. B. Depressivität) und funktionaler Status
Zufriedenheit mit Familie, Freunden, Versorgung
Umgebung, Milieu
Spiritualität
sozioökonomischer Status
Selbstbestimmung, Autonomie
Die objektiven Faktoren der Lebensqualität weisen eine große Ähnlichkeit mit den oben genannten Konzepten der Pflegequalität auf (s. Tabelle 1-1).
Alle drei – die subjektive, die evaluative sowie die objektive Dimension – sind anhand unterschiedlicher Instrumente und Verfahren einzuschätzen. International hat sich die Unterscheidung von Lawton behauptet, zwischen den objektiven Kriterien, der Verhaltenskompetenz und der interpersonellen Umgebung, sowie den subjektiven Kriterien: psychologisches Wohlbefinden und wahrgenommener Lebensqualität zu unterscheiden. Den letzten Dimensionen, insbesondere dem psychologischem Wohlbefinden, wird die entscheidende Bedeutung für die Bestimmung der Lebensqualität zugemessen (‹ultimate outcome measure›) mit den anderen Dimensionen als Determinanten (Lawton et al., 2000; Lawton, 2001). Umstritten und diskutiert wird, ob es sich bei diesen Dimensionen um definierende Faktoren, Prädikatoren oder Indikatoren der Lebensqualität handelt (Ready/Ott, 2003) (s. Tabelle 1-2).
In umfassenden Reviews wurden folgende acht Dimensionen der Lebensqualität im Sinne einer Konsensdefinition identifiziert: emotionales Wohlbefinden, interpersonale Beziehungen, materielles Wohlbefinden, persönliche Entwicklung, körperliches Wohlbefinden, Selbstbestimmung, soziale Teilhabe und Wahrung der Rechte der Person (Schalock, 2000; Wang et al., 2010). Zusammengefasst machen sie das Gesamtkonstrukt «Lebensqualität» aus.
Lebensqualität verändert sich mit der Zeit, ist abhängig von den kulturell geprägten Umgebungen, wozu auch die Pflegekultur gehört, den individuellen Interessen, Vorlieben und Neigungen sowie den konkreten Rahmenbedingungen.
1.4 Von der Selbstbekundung zur Fremdeinschätzung
Nur die Person selbst, die eine Dienstleistung entgegennimmt, kann beurteilen, ob diese ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht (Brod et al., 1999). Es besteht heute Konsens darüber, dass das Ergebnis der Pflege nicht nur an der objektiven Pflegequalität der Einrichtung, sondern an der Zufriedenheit und dem Wohlbefinden der Klienten gemessen werden muss (Sloane et al., 2005). Je mehr die Demenz allerdings zunimmt, desto eher ist es eine Herausforderung, im Kontakt mit Menschen mit Demenz durch Befragungen deren Zufriedenheit und Wohlbefinden zu ermitteln (Brooker und Woolley, 2007; 2007a; Sloane et al., 2005). Sie haben[18] Mühe, gezielte Fragen zu verstehen und zu beantworten oder relevante Situationen zu erinnern. In der Regel gelten massive Einbrüche im Sprachverständnis als Anzeichen für die Grenzen der Befragbarkeit (Streiner/Norman, 2003).
Eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu umgehen, besteht darin, anstelle der Kranken die Angehörigen (beispielsweise QOL-AD: Logsdon et al., 2002) oder professionell Pflegende (beispielsweise QUALIDEM: Ettema et al., 2007) zu befragen; allerdings entsprechen deren Einschätzungen nicht unbedingt denen der Kranken selbst (Thorgrimsen et al., 2003). In der Regel schätzen Angehörige und Professionelle die Lebensqualität der Person schlechter ein als diese selbst.
Mögliche Gründe für eine positivere Bewertung der Lebensqualität könnten – auf Seiten der Person mit Demenz – ein Anpassungsprozess an die resultierenden Einschränkungen, eine Relativierung und Anpassung von Lebenserwartungen und Ansprüchen bilden (Banerjee et al., 2009) sowie das Bemühen darstellen, den Angehörigen nicht zur Last zu fallen und sie durch ein positives Selbstbild zu entlasten (Steeman et al., 2007). Demenz überfällt die Personen nicht bei Nacht, sondern stellt einen langsamen Prozess dar mit vielen Gelegenheiten, sich einzustellen und anzupassen. Damit stellt Demenz einen Übergangsprozess dar mit dem Ziel, die Veränderungen in das eigene Lebenskonzept zu integrieren. Menschen streben nach einer Balance in ihrem Leben, die eine notwendige Bedingung für psychologisches Wohlbefinden darstellt. Erfolgreiche Anpassung an die Auswirkungen der Krankheit führt auch zu einem Gefühl relativen Wohlbefindens, das deutlich höher ausfällt als Fremdeinschätzungen. Psychologisches Wohlbefinden ist also der Level der Anpassung an die wahrgenommenen Auswirkungen der Krankheit für das eigene Leben (Ettema et al., 2007).
Angehörige andererseits überschätzen das Bedürfnis der Älteren nach Ruhe, Routine und Kontrolle und unterschätzen den Wunsch nach Abwechslung, Herausforderungen und persönlichem Wachstum (Conde-Sala et al., 2010). Die Personen interessieren sich für ihre soziale Umgebung und die Bewahrung ihrer Identität und Würde, die Familien sorgen sich primär um Sicherheit, gute Pflege und psychologisches Wohlbefinden, wobei sie letzteres mit dem Fehlen herausfordernden Verhaltens verbinden (Whitlatch et al., 2009). Je größer die verwandtschaftliche Entfernung, desto schlechter wird die Lebensqualität der Person mit Demenz eingeschätzt. Partner liegen in ihren Einschätzungen näher an den Selbstbekundungen der Betroffenen als Töchter oder Söhne (Conde-Sala et al., 2009). Professionelle weisen in der Regel eine noch größere Diskrepanz in den Einschätzungen zu denen der Patienten auf, insbesondere wenn hohe Abhängigkeit und herausforderndes Verhalten die Wahrnehmung der Lebensqualität bestimmen (Hoe et al., 2006); Professionelle in der Rolle der Bezugspflegenden weisen geringere Differenzen auf, da sie die Person und ihr Umfeld besonders gut kennen (Gräseke et al., 2012). Dieser Befund ist allerdings deutlich zu relativieren: Die Einschätzungen der Professionellen bezüglich Lebensqualität scheinen sich insgesamt an funktionalen Parametern zu orientieren. Eine Gruppe von Bewohnern mit Demenz beispielsweise zeigte nach einer Intervention eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens. Im Gegensatz zu externen Einschätzenden und Angehörigen konnten Professionelle jedoch keinen Unterschied in der Lebensqualität erkennen (Clare et al., 2013).
Obwohl beide Einschätzungen – die der Angehörigen und die der Professionellen – insgesamt näher beieinander sind als jede der beiden zu den Einschätzungen der Person selbst (Crespo et al., 2012), weisen in anderen Studien Einschätzungen beider eine insgesamt doch niedrige Übereinstimmung auf. Die Frage stellt sich, ob alle drei Auskünfte (die der Person, der Angehörigen, der Professionellen) tatsächlich komplementär zu verstehen sind (Gomez-Gallego et al., 2012). Aufgrund der logischen Unterschiede zwischen Introspektion in die eigene[19] Verfassung und Beurteilung durch einen anderen anhand des Verhaltens ist eine vollständige Deckungsgleichheit der Ergebnisse unwahrscheinlich: Befinden zeigt sich nur eingeschränkt im Verhalten und ist mit diesem nicht identisch. Unterschiede können auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der Beurteilung eines Menschen durch einen externen Beobachter oder Einschätzenden negative Informationen insgesamt schwerer wiegen als positive (Epstein et al., 1989).
Diese als «discernability gap» oder «disability paradox» bekannte Differenz beschreibt, dass ein hoher Grad an subjektiver Zufriedenheit mit objektiven Einbrüchen bezüglich Kognition, Gesundheit und Verhalten einhergehen kann – eine Differenz, die auch bei alten Menschen ohne Demenz festzustellen ist. Der Grund eher niedriger Beurteilungen der Lebensqualität durch Dritte könnte am Belastungserleben der Angehörigen liegen, insbesondere im Frühstadium der Demenz, wenn die Anpassung an ein Leben mit Demenz noch nicht erfolgt ist (Conde-Sala et al., 2013) oder aber in späteren Phasen, wenn die hohe Abhängigkeit der Personen und ihre zunehmende Apathie zu Buche schlägt (Conde-Sala et al., 2009). Bei professionell Pflegenden kann es an der Arbeitszufriedenheit, den ständigen Unterbrechungen antizipierter Arbeitsschritte, am herausfordernden Verhalten (beispielsweise hohes Bindungsbedürfnis der Person mit Demenz) und an der gesteigerten Abhängigkeit der Klienten liegen, dass die Unterschiede zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung groß ausfallen (Mittal/ Rosen, 2007).
1.5 Beobachtung
Eine andere Alternative zur Befragung besteht in der direkten Beobachtung, beispielsweise mit DCM. Die person-zentrierte Hintergrundtheorie von DCM geht davon aus, dass das Erleben und das Verhalten von Menschen mit Demenz und damit auch die Entwicklung und der Verlauf der Krankheit selbst von der unmittelbaren physischen, sozialen und psychischen Umgebung abhängen. Oft wird Erleben und Verhalten zu wenig auf das Hier und Jetzt, auf die konkrete physische, psychische und soziale Umgebung bezogen (Innes/Surr, 2001). Idealerweise sollte die Sichtweise und das Erleben des Klienten im Kontext der routinisierten Tagesabläufe eingebettet und aus diesem heraus verstanden werden (Townsend-White et al., 2012). Betrachtet man Erleben und Verhalten isoliert, was zum Beispiel quantitativ durch Zählung der Affekte beziehungsweise retrospektiv, zusammenfassend aus der Wahrnehmung der Professionellen in Form eines Fragebogens geschieht, dann wird zu wenig aufgedeckt, wie das Erleben und Verhalten im Laufe eines Tages konkret zustande kommt. Es fehlt der Zusammenhang zwischen Prozess und Ergebnis.
Der große Vorteil von Beobachtungen ist der Fokus auf dem Mikrokosmos des sozialen Lebens, der Blick auf die marginalen, nicht verallgemeinerbaren, oft verborgenen Elemente der Praxis: «… der Fokus der Aufmerksamkeit liegt auf den Einzelnen und deren immer wieder sich verändernden Beziehungen und nicht auf der zeitlosen, homogenen, kohärenten, und strukturierten Natur der Untersuchungsgruppe.» (Angrosino, 2005: 741; englischer Originaltext: «[…] the focus being on individuals and their ever changing relationships rather than on … homogeneous, coherent, patterned, and […] timeless nature of the supposed group». Übersetzung Christian Müller-Hergl.) Es geht demnach um die Beziehung von Kontext und Affekt in einer zeitlichen Perspektive: hier wird dann beispielsweise deutlich, dass Personen mit mehr Interaktion mehr Freude, aber auch mehr Ärger zeigen, dass strukturierte Zeit mit ausgeprägteren Affekten zusammenhängt, zugleich aber an Personen mit schwerer Demenz gleichsam vorbeilaufen. Mahlzeiten stellen für viele Personen Höhepunkte des Tages dar, der frühe Nachmittag ist für Menschen mit schwerer Demenz oft die aktivste Zeit des Tages, die Person und Persönlichkeit der Professionellen ist mit der wichtigste Faktor für das Entstehen oder Reduzieren[20] von Wohlergehen, und Eins-zu-eins-Situationen gehen mit dem höchsten Wohlbefinden einher (Lawton, 2001; Wood et al., 2009; Vasse et al., 2010; Cohen-Mansfield et al., 2010). Viele Befunde lassen keine Generalisierung zu, sondern tragen zur Vermehrung spezifischer Aufmerksamkeit in den kleinen, aber für das Wohlbefinden wichtigen Dingen des Alltags bei: beispielsweise Geschirr nicht abzuräumen, weil dies lange anhaltend und wiederholt von Klienten gestapelt wird; immer wieder für genügend Krümel auf den Tischen Sorge tragen, weil dies dazu einlädt, diese aufzupicken; Personen erlauben, sich, wenn ein Delir ausgeschlossen ist, kriechend fortzubewegen (sichere kinästhetische Grundposition), weil sie dann weniger Unruhe zeigen.
1.6 Es gibt keine «Cadillac-Version»
Jedes Verfahren hat seine Stärken und Schwächen, keines kann als Goldstandard gelten
und für sich in Anspruch nehmen, die finale «Cadillac-Version» der Lebensqualität darzustellen. An die Stelle eines «Goldstandards» treten objektive und subjektive Daten unterschiedlicher Quellen und Perspektiven auf dem Hintergrund unterschiedlicher Theorien. Daher gilt es, bei der Frage nach der Lebensqualität die Zielrichtung und den Standpunkt des Fragenden zu verdeutlichen.
Da die Möglichkeit entfällt, Wahrnehmungen und Deutungen des externen Beobachters durch eine verbale Ebene abzusichern, weil die beobachtete Person nicht ständig gefragt werden kann, ob der Interpretation des beobachteten Verhaltens zugestimmt wird, werfen reine Beobachtungsverfahren die Frage auf, wie sich die Subjektivität des Beobachters kontrollieren (validieren) lässt, um Projektionen entgegen zu wirken (Lawton et al., 2000). Dies erfordert einen höheren Trainingsaufwand und Methoden, die durch Regelwerke und Erhebung der Inter-Rater-Reliabilität die Qualität der Ergebnisse sichern. Dies gilt natürlich gleichermaßen bei der Befragung Dritter wie beispielsweise der Professionellen. Auch hier muss validiert werden, ob die Einschätzungen übereinstimmen, das heißt reliabel sind.
Was also spricht für die Beobachtung? Liegt bei Menschen mit Demenz eine geringe Introspektionsfähigkeit auf dem Hintergrund mangelnder Fähigkeit zur Selbstvergewisserung und umfassender Einbrüche im sprachlichen Bereich vor (Held, 2013), dann kann das Wohlbefinden eher durch Beobachtung ermittelt werden. Demenz verstanden als dissoziativer, diskontinuierlicher Bewusstseinszustand wirft auch die Frage nach Belastbarkeitsgrenzen für Befragungen auf: die Ergründung des Willens, das Anbieten von Auswahlmöglichkeiten und Befragungen zur Befindlichkeit können Angst und Leiden auch verstärken.
Was dagegen spricht für die Befragung? Die Arbeiten von Clare et al. (Clare, 2002; Clare/Wilson, 2006; Clare et al., 2011) haben ergeben, dass das Konzept von «Bewusstsein» und «Selbstbewusstsein» komplex und vielfältig ausfällt und Personen bezüglich Belangen, die sie unmittelbar und persönlich betreffen, bis weit in die schwere Demenz hinein befragbar sind. Eine differenziertere Betrachtung der Einsichtsfähigkeit einer Person mit Demenz könnte verhindern, dass Einbrüche in einer Dimension auf alle Bereiche generalisiert und damit wichtige Bereiche, in denen Einsicht weiterhin besteht, übersehen werden. Es gilt demnach, an den individuellen Ausdrucksformen und Ausdrucksmöglichkeiten der Person mit Demenz Anschluss zu finden und ein dafür passendes Repertoire von Methoden anzusetzen. Kate Allen (2001) hat Wege aufgewiesen, dies mit einem reichhaltigen Mix unterschiedlicher Möglichkeiten (indirekte Befragung, Arbeit mit Bildern und Objekten) zu bewerkstelligen.
Beobachtung und Befragung schließen einander nicht aus und können einander ergänzen. Nicht zuletzt hängt die Wahl der Methode von den Kompetenzen und Belastbarkeitsgrenzen der Person mit Demenz ab. Zudem ist die Fragestellung von Belang: Wird eher eine Momentaufnahme des Wohlbefindens angestrebt oder[21] eine Einsicht, wie sich das Befinden über einen bestimmten Zeitraum hinweg entwickelt?
Für Beobachtungen könnte als best practice gelten, Kontakt zur beobachtenden Person aufzunehmen und danach zu fragen, wie es ihr geht.
1.6.1 Sind Selbstauskünfte unhinterfragbar?
Soweit vorhanden, sind Selbstauskünfte zunächst als nicht hinterfragbar anzunehmen (Brod et al., 1999) beziehungsweise es macht sprachlogisch keinen Sinn, dies zu bezweifeln. Dennoch sind die Auskünfte im Kontext zu lesen: je höher die Abhängigkeit von anderen, desto schlechter schätzen Personen mit Demenz ihre Lebensqualität ein (Andersen et al., 2004). Bei Abhängigkeit, insbesondere bei Immobilität, ist demnach eher mit negativer Einschätzung der Lebensqualität zu rechnen. Ähnliche Befunde betreffen das Ausmaß der Depressivität, die Einsicht in die eigene Situation, die psychiatrische Komorbidität (insbesondere Persönlichkeitsstörungen, paranoide Übertragungen, neuropsychiatrische Symptome) sowie die Faktoren Multimorbidität, Multichronizität und Polypharmazie (Pfeifer et al., 2013; Sousa et al., 2013). All dies sind Faktoren, die das Urteil der Person deutlich beeinflussen und die in der Bewertung der Selbstauskünfte berücksichtigt werden müssen – ohne sie damit zu entwerten.
Um die Beziehungen zwischen der Einsicht einer Person, zwischen möglicher Depressivität und den Selbstbekundungen zur eigenen Lebensqualität zu deuten, bedarf es einer fachlichen Auseinandersetzung. Hier ist einerseits festzuhalten, dass Einbrüche in den kognitiven Funktionen und Tätigkeitseinschränkungen in den Selbstbekundungen betroffener Personen nicht unbedingt zu geringerer Lebensqualität führen. Dennoch werden Möglichkeiten, die eigenen kognitiven Funktionen zu verbessern, mit einer höheren Lebensqualität in Verbindung gebracht (Banerjee et al., 2009). Dies legt die Frage nahe, welche sozial bedingten Hintergrundfaktoren — zum Beispiel familiäre Modelle, Selbstkonzepte, lebensgeschichtlich gewonnene Haltungen – die Einschätzungen der Personen bestimmen könnten.
Dies könnte folgendermaßen interpretiert werden: Vor dem Hintergrund negativer Einstellungen zum Altern werden Einbrüche im Gedächtnis als sehr belastend wahrgenommen, wobei nicht der objektive Schweregrad der Gedächtniseinbussen, sondern deren subjektive Bewertung ausschlaggebend ist. Diese Wahrnehmung und Bewertung führt dazu, Altern (mit Demenz) als fortlaufenden psychosozialen Verlust zu erleben und die eigene Lebensqualität negativ zu bewerten. Lebensqualität wird demnach nicht nur durch eine Einschätzung der gegenwärtigen Lebenslage und Umstände, sondern durch fortbestehende Haltungen zum Altern vor dem Hintergrund von persönlichen Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften bestimmt. Diese schlagen sich insbesondere in der Stimmung und in Bewertungen der Affektivität nieder (Gomez-Gallego et al., 2012).
Daher wird die Übernahme gesellschaftlich erzeugter negativer Stereotypien in das Selbstbild als einflussnehmend auf die Selbsteinschätzung negativer Lebensqualität diskutiert und dies scheint auch umgekehrt zu gelten: je positiver die Haltung zum Altern, desto höher die Anpassungsfähigkeit an veränderte Lebensumstände und Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen. Es steigt dann die Wahrscheinlichkeit, trotz gesundheitlicher Einbrüche in Form von kognitiven und tätigkeitsbezogenen Kompetenzeinbrüchen die Lebensqualität hoch einzuschätzen (Trigg et al., 2012; Banerjee et al., 2009). Zusammenfassend gibt es eine Reihe von distalen und proximalen Kontexten, die eher mit einer hohen Selbsteinschätzung der Lebensqualität einhergehen sowie Kontexte, die dies eher weniger wahrscheinlich machen.
Auf diesem Hintergrund mag es paradoxerweise nicht abwegig sein, zu fragen, ob Informanten – wenn sie in eigener Sache Auskunft geben – per se die einzig legitime oder gar die beste Quelle darstellen. Dass nur ich wissen[22] kann, wie es mir geht ist durchaus kompatibel mit der Aussage eines anderen, ich würde mich bei mir nicht gut auskennen. Beides sind Aussagen unterschiedlicher logischer Ebenen und damit nicht im Widerspruch. Für die Frage, wie das Wohlbefinden einer Person zu verbessern sei, mögen Einschätzungen und Urteile anderer genauso wichtig und relevant sein wie die Selbstauskunft.
1.6.2 Um was geht es bei der Erhebung von Lebensqualität
Das Abwägen von Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Ansätze biegt den Spaten zurück auf den Zweck und die Funktion der Erhebung von Lebensqualität:
Geht es darum, ein Minimum von Lebensqualität zu sichern und bestimmte Parameter festzusetzen, die sich an Durchschnittswerten orientieren, die für ein Land ermittelt wurden (Becker et al., 2011)? Dann mag es der Person mit Demenz immer noch subjektiv schlecht gehen, aber es geht ihr unter Umständen nicht besser als der faktorengleichen Vergleichsbevölkerung, das heißt «es geht ihr – den Umständen entsprechend – (landesspezifisch) gut» (Variante: «Warenkorb der Sozialhilfe»).
Oder geht es darum, Daten zur Lebensqualität für Forschungszwecke zu generieren, beispielsweise um die Lebensqualität verschiedener Populationen zu vergleichen, Wirkungen spezifischer Interventionen festzustellen, die Bedeutung von Alter und Geschlecht, von Herkunft und Ethnizität, von verschiedenen Subtypen der Demenz, von verschiedenen Versorgungssettings auf die Einschätzung der Lebensqualität zu erforschen? Ein weiteres Beispiel für solche Fragen könnte sein, ob und inwiefern sich die Beziehungsqualität zwischen Professionellen oder Pflegenden Angehörigen und der Person mit Demenz auf die Selbsteinschätzungen der Personen mit Demenz auswirkt (Banerjee et al., 2009). Solcherlei quantitative Erhebungen können zur Folge haben, energischer gegen Depressivität anzugehen, segregative Einrichtungen zu favorisieren, für verschiedene Grade der Demenz unterschiedliche Pflegekonzepte zu entwickeln (Variante: Interventionsforschung).
Die Fragestellung kann auch lauten: welches Potential, welche Entwicklungsmöglichkeiten kann der Einzelne mit welcher Form der Assistenz unter den Lebensbedingungen, in denen er sich vorfindet, noch realisieren? Wie können Professionelle in ihrem Lernprozess unterstützt werden, sich in die Lage und Situation der Person zu versetzen, die oft minimalen Anzeichen von Interesse, Freude oder Ärger zu erkennen und ihre Wahrnehmungsfähigkeit für die Signale der Personen zu erhöhen (Lawton et al., 2000a)? Hier ginge es nicht nur um die Feststellung der Lebensqualität als Ist-Zustand, sondern um die prozess-eröffnende Frage: welche Art von Daten helfen dabei, Lebensqualität weiter zu entwickeln? Wie kann die Res mit dem Modus, das Outcome mit dem Prozess verknüpftwerden? – (Variante: entwicklungsbezogene Evaluation).
Insgesamt fehlt es an Studien, welche die Konsequenzen von Einschätzungen und Erhebungen von Lebensqualität und Wohlbefinden für die Entwicklung von Dienstleistungen beschreiben (Ready/Ott, 2003).
In Hinblick auf die verschiedenen Instrumente der Erfassung von Lebensqualität und Wohlbefinden, deren Zwecke und Hintergrundtheorien ist also zu fragen: Erfassen die verschiedenen Instrumente ein und dasselbe Konstrukt, lassen sich die Ergebnisse verschiedener Instrumente gut kumulieren beziehungsweise ergänzen sie sich, stellt jedes Instrument ein unabhängiges, eigenständiges Konstrukt von Lebensqualität her (Edelman et al., 2005; Crespo et al., 2012)? Ob sich die so gewonnenen Daten unterschiedlicher Methoden aggregieren lassen und ein kohärentes Gesamtbild erzeugen, ist eher eine häufig vorzufindende Forderung und ein Anspruch, welche bisher kaum eingelöst wurden (Lawton, 2001; Sloane et al., 2005). Anstelle einer «Cadillac-Version» tritt ein bunter Reigen verschiedener Instrumente[23] für verschiedene Zwecke, Ziele und Fragestellungen.
Es geht um die Frage, worum es bei der Erhebung von Lebensqualität und Wohlbefinden geht. Dies könnte bezüglich DCM heißen: Warum ist es wichtig, nicht nur punktuell, zustandsbezogen oder retrospektiv zu wissen, wie es einer Person geht, sondern wie sie lebt? Wieso lassen sich nach DCM diese beiden Fragen – wie es einem geht und wie man lebt – nicht unabhängig voneinander beantworten? Hierzu ist es wichtig, auf die DCM zugrundeliegende Hintergrundtheorie zu schauen, um zu verdeutlichen, auf welche Frage genau DCM eine Antwort geben möchte.
1.7 Personsein
Personsein wird als soziales Konstrukt aufgefasst, das in günstigen Umgebungen trotz gesundheitlicher Einschränkungen genährt und gehalten, andererseits aber auch gekränkt und zerstört werden kann. Kitwood bezieht sich auf die ethologische Handlungstheorie der sozialen Positionierung nach Rom Harre, ergänzt durch Theoriebestandteile von Steven Sabat und Post (Baldwin/Capstick, 2007). Der Begriff des Wohlbefindens (well-being) erfuhr in Kitwoods Denken verschiedene Wandlungen, bezog sich aber durchgehend auf die Erhaltung des Selbst beziehungsweise der Person mit zentralen psychologischen beziehungsweise wahrnehmungsbezogenen Bedürfnissen als Mediatoren. Wohlbefinden denkt Kitwood primär innerhalb interpersonaler Bezüge zu anderen und weniger als isolierten Zustand, Befindlichkeit oder Merkmal des Einzelnen (Brooker, 2005a: interdependenter Begriff des Wohlbefindens). Je eher es gelingt, die für das Personsein maßgeblichen personalen Bezüge herzustellen und den darin implizierten Bedürfnissen wechselseitig gerecht zu werden, desto höher ist das Wohlbefinden.
Wird aber die Person von anderen, die sich nicht als dement verstehen, einseitig als «dement» positioniert, hat dies Folgen für deren Einordnung des Verhaltens beispielsweise als demenzielles Symptom. Die Qualität der auf dieser Einschätzung resultierenden Interaktion wäre dann, das Verhalten zu kontrollieren und die Person zu beruhigen anstatt das dahinter liegende Bedürfnis zu eruieren.
Viele der affekt- und emotionstheoretischen Modelle zur Einschätzung von Lebensqualität und Wohlbefinden gehen zurück auf die an Jeremy Bentham anknüpfende utilitaristischhedonistische, zumeist positivistische Ethik, welche die Richtigkeit und moralische Güte einer Handlung an den Affekten Freude und Glücksgefühl – und nicht etwa an Sinnerfüllung, Geborgenheit, Verantwortung für andere, Teilhabe – festmacht. Eine genügende Anzahl positiver Emotionen – möglichst vieler Menschen – reichen aus, um Handlungen zubegründen, welche diese Emotionen zuverlässig reproduzieren. Innere Beweggründe und objektive Bedürftigkeit, Konzepte wie Würde und Haltung spielen für die Bewertung keine Rolle. Im Unterschied dazu geht Kitwood eher von objektiven psychologischen Bedürfnissen aus, die für alle Menschen gleich fundamental sind, im Rahmen der Demenz aber in besonderer Schärfe in den Mittelpunkt treten. Er nennt Tätigsein, Teilhabe, Bindung/Beziehung, Trost und Wohlbehagen (comfort) sowie Identität. An anderer Stelle werden noch genannt «handelnd wirksam werden» (agency) sowie Hoffnung. Diese objektiven psychologischen Bedürfnisse werden zusammengefasst in dem zentralen Bedürfnis nach Liebe, sprich Anerkennung, welches Personsein ermöglicht und «nachnährt» (Baldwin/Capstick, 2007). Kitwood knüpft dabei an verschiedene Konzepte der Genese des Selbst an; von der Psychoanalyse, der Tiefenpsychologie, der Bindungstheorie bis zur person-zentrierten Psychotherapie. Werden diese Bedürfnisse erfüllt, dann ist dies ein Indikator für Wohlbefinden und Lebensqualität, da die Erfüllung mit Person- und Selbsterhalt einhergeht.
[24]Wird Personsein prozesshaft vorgestellt (Müller-Hergl, 2009; Held, 2013), dann gehen Akte der Akzeptanz und Anerkennung konstitutiv in das mit ein, was es heißt, eine Person zu sein und auch zu bleiben. Wir können den einzelnen und sein Befinden nicht unabhängig von seinen Kontexten und von uns, als Teilnehmenden an seiner/ihrer Lebenswelt verstehen. Wohlbefinden bestünde damit zumindest zum Teil in der Erfüllung von Bedürfnissen, die mit wechselseitigen Konstitutionsprozessen von gelingendem oder gebrochenem Personsein einhergehen. Folglich gehört zur Verbesserung des Wohlbefinden einer Person mit Demenz die Reflexion und das Feedback darüber, wie Menschen mit und ohne Demenz in bestimmten Kontexten kommunizieren, interagieren und einander interpretieren (Purves, 2006; 2011). DCM zeigt hier einen über einen mehrstündigen Zeitraum hinweg im Lebenskontext des Klienten sich entwickelnden Tagesprozess. Es liefert damit eine subjekthafte, nicht aber willkürliche Prozessbeschreibung, wie Wohlbefinden entsteht, vergeht, ermöglicht wird, blockiert, unterstützt und verhindert wird. Objektive Aspekte der Umgebung kommen durchaus in den Blick, allerdings weniger als abstrahierte Merkmale wie beispielsweise Anzahl der Kontakte pro Woche, durchschnittliche Helligkeit, durchschnittlicher Bewegungsradius, sondern als konkrete Merkmale vorgefundener Situationen, wie beispielsweise irritierend laute Fernseher oder entspannende Musik. Da DCM den Prozess beschreibt, wie konkret Personsein gehalten oder fallen gelassen wird, besteht eine hohe Nähe zwischen Theorie und Instrument (Beavis et al., 2002).
1.8 Entwicklung einer wertorientierten Pflegekultur
Dementia Care Mapping stellt ein Beobachtungsinstrument dar, um das Leben von Menschen mit Demenz in einer stationären oder teilstationären Einrichtung durch einen externen Beobachter in einer zeitlichen Perspektive einzuschätzen. Der Beobachter hat die Aufgabe, sich in die beobachteten Personen einzufühlen und das Leben möglichst aus der Perspektive der beobachteten Personen auf vier Beobachtungsebenen in einem Rhythmus von 5 Minuten abzubilden. Ziel dieser Beobachtung ist es festzustellen, in welchem Ausmaß Menschen mit Demenz personenzentriert gepflegt und betreut werden. Die Beobachtungen und deren Auswertung nach vorgegebenen Schritten bilden die Grundlage für eine umfassende mündliche und schriftliche Rückmeldung an das Team mit dem Ziel, gute Praxis zu festigen, schlechte Praxis zu verändern und zu dem Nichtveränderbaren eine möglichst positive Haltung einzunehmen. Dieser Prozess – auch DCM-Methode genannt – sollte in regelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr durchgeführt werden und damit dem Team Gelegenheit für eine kritische Revision der eigenen Praxis bieten (Brooker, 2004). DCM dient somit als Vehikel, sich von einer aufgaben- und funktionsorientierten Pflege weg und zu einer personzentrierten, bedürfnisorientierten Pflege hin zu bewegen (Brooker, 2005a).
Damit wird deutlich: Wohlbefinden (als zentraler Teil des Konzeptes von Lebensqualität) wird weniger gemessen, als verhandelt – in Form einer kommunikativen Validierung zwischen dem Beobachter und den Professionellen, dem Team; weniger festgestellt als im gemeinsamen Diskurs erarbeitet. Diese Prozesshaftigkeit und Vorläufigkeit auch in dem, was das Ergebnis einer DCM-Beobachtung ausmacht, stellt die besondere Qualität des Verfahrens dar, die es von anderen Instrumenten zur Einschätzung von Lebensqualität unterscheidet. Es werden keine «abgeschlossenen» Aussagen und «geschlossenen Diskurse» – in Form von Messdaten – erzeugt, sondern ein offener und vorläufiger Diskurs über Daten und Entwicklung gesucht. Dies bedeutet nicht, dass der Beobachter seine Beobachtungen nicht vertritt und gut begründet; er nimmt aber Ergänzungen entgegen, rechnet mit der Perspektivität und Selektivität eigener Beobachtungen und strebt an, über[25] Wirklichkeit mit dem Team übereinzukommen. Angestrebt wird ein Lernprozeß, in dem versucht wird, anhand der Beobachtungen einer externen Person die eigenen Annahmen über die Lebensqualität eines Klienten zu reflektieren (Triangulierung): dies könnte man auch als einen Beitrag zur «verstehenden Diagnostik» begreifen (Buscher et al., 2012). Der eigentliche Adressat ist der reflektierende Praktiker vor Ort; sind die für Personen mit Demenz verantwortlichen Professionellen. Es gilt, Impulse für die wertorientierte Entwicklung der Pflegekultur zu setzen.
1.8.1 Wie man lebt, nicht (nur), wie es geht…
Dementia Care Mapping schließt andere Verfahren wie beispielsweise offene, halb-strukturierte oder standardisierte Befragungen nicht aus, hält sie für möglich, wichtig und begrüßt sie sogar (Übersicht: Ready/Ott, 2003). Als Instrument der entwicklungsbezogenen Evaluation tritt es nicht wirklich in Konkurrenz zu Verfahren, welche die Perspektive der Angehörigen, der Professionellen erkunden oder die Selbstauskunft erfragen. DCM vertritt den Standpunkt, dass die Form der teilnehmenden Beobachtung durch eine externe Person eine bestimmte Datenqualität liefert, die sich für die Weiterentwicklung der Pflege und Betreuung besonders gut eignet, weil es die Wahrnehmung und Haltung der Beteiligten verändert (Edelman et al., 2004). Umgekehrt wird hier allerdings auch die Auffassung vertreten, dass quantitative Erhebungen und zumeist auch Selbstauskünfte (Ausnahme: Allen, 2001) zur Lebensqualität wenig Potential aufweisen, das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu steigern und zur personzentrierten Entwicklung der Pflegekultur beizutragen.
Die Verankerung von Indikatoren von Wohlbefinden im Kontext des Tagesverlaufes erleichtert es, Ansatzpunkte für die Verbesserung von Wohlbefinden konkret und praxisnah zu entwickeln und zu implementieren. Wohlbefinden wird situations- und ablauforientiert, eng an den Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten entlang festgestellt und somit Veränderungsoptionen zugeführt. Überspitzt könnte es heißen: es geht nicht primär um Wohlbefinden als Zustand des Einzelnen, sondern um die Einbettung dieser Frage in eine andere: wie Menschen mit Demenz leben. Diese etwas andere Perspektive auf das, was DCM beantwortet, entschärft zum Teil das Problem, ob DCM (ähnlich auch Befragungen) «wirklich» das Wohlbefinden («an sich»?) abbildet (Edelman et al., 2004). Die Beobachtungen, die Verschriftlichung, das Feedback erfolgen in der Absicht, Potentiale der Person und des Kontextes für Veränderung aufzuspüren.
Gründe für die Tauglichkeit von DCM als Instrument für die Praxisentwicklung könnten zusammenfassend sein:
Befragungen werden oft durch «erwünschte Antworten», die Person des Interviewenden, den Grad der kognitiven Beeinträchtigung, reduzierte Erwartungen, den Grad der Krankheitseinsicht, das Verlangen nach «verlässlichen Items» beeinflusst (Gebert/Kneubühler, 2001).
Viele Instrumente zur Lebensqualität wurden eher für die Forschung als für die Praxis entwickelt, bieten wenig Information über die subjektiven Erfahrungen der Person beziehungsweise nehmen zu wenig den Standpunkt der Person ein (Innes/Surr, 2001).
Entwicklungen geschehen in der Regel durch Irritation und Wahrnehmungsveränderungen sowie Veränderungen im Selbstbild und Reflexion der beruflichen Aufgabe. DCM bietet die Chance, das eigene pflegerische Selbstbild in der Rolle mit einem Fremdbild abzugleichen. Diese Möglichkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung die Lebensqualität erheben. Insbesondere die Einschätzung durch «pen and pencil»-Verfahren (Ankreuzen vorgegebener[26] Einschätzungsbögen) bietet wenig Potential und konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen.
DCM greift aus dem multidimensionalen Gesamtspektrum der Lebensqualität (Selai/Trimble, 1999) die Ebene des psychischen und sozialen Wohlbefindens auf, mit den Aspekten von Affekt, Engagement, Aktivitäten, Interaktion und Kommunikation. Aspekte, die mit physischer Gesundheit, Milieu, Sicherheit etc. verbunden sind, werden nur im Bedarfsfall, das heißt als Merkmale des konkreten Kontextes, der konkreten Situation erfasst.
1.9 Fazit
DCM ist weder eindeutig nur ein Instrument zur Abbildung von Pflege- noch von Lebensqualität; der Begriff des Wohlbefindens ist weniger in einem positivistisch-affekttheoretischen Hintergrund verortet, sondern verankert den Begriff in den interaktiven Prozessen zwischen Umwelt und Menschen. Es bildet einen Zustand im Kontext seines Vorkommens ab. Seine jeweiligen Konstrukte von Wohlbefinden sind nicht endgültig oder abgeschlossen, sondern eher vorläufig als «Verhandlungsangebot» an das Team mit dem Ziel, Entwicklungspotentiale für beide Seiten – die beobachteten Klienten und die Professionellen – offen zu legen. DCM rechnet mit Überformungen des Urteils von Professionellen, Angehörigen und auch von Menschen mit Demenz im Sinne von Hospitalisierungsfolgen beziehungsweise familiären Dynamiken, ohne damit deren Urteil und Einschätzungen gering zu achten: vielmehr wird damit gerechnet, dass positive Entwicklung sehr häufig durch Triangulierung der Binnenperspektiven der Beteiligten angetrieben werden. DCM scheut nicht davor zurück, die Subjektivität des Beobachters als mögliche Erkenntnisquelle zu nutzen, versucht aber, die Subjektivität durch Regeln, Verfahrensanweisungen, Inter-Rater-Konkordanzen in einem verantwortbaren Bereich zu halten. Es nutzt quantitative und qualitative Methoden, um eine möglichst reichhaltige, differenzierte und nuancierte «Geschichte» über den beobachteten Tag zu erzeugen. DCM rechnet mit der wahrnehmungsverändernden Kraft solcher «Geschichten», wenn sie den Beteiligten einleuchten, sie sich darin wiederfinden, gewürdigt und angeregt erfahren. «Gute Geschichten» über die Bewohner erlauben, einen guten Weg zwischen blockierender Bestätigungssucht und leichter Kränkbarkeit der Professionellen zu finden.
DCM leistet damit einen einzigartigen Beitrag zur Entwicklung der Pflegekultur, trägt dazu bei, die Entwicklung der Pflege und Betreuung eng entlang der Bedürfnisse der Personen voranzutreiben.
Literatur
Abrahamson K., Clark D., Perkins A., Arling G. (2012). Does Cognitive Impairment Influence Quality of Life Among Nursing Home Residents? The Gerontologist, 52, (5), 632–640.
Allen K. (2001). Communication and Consultation. Exploring ways for staff to involve people with dementia in developing services. Bristol: Joseph Rowntree Foundation and The Policy Press.
Andersen C. K., Wittrup-Jensen K. U., Lolk A., Andersen K., Kragh-Sorensen P. (2004). Ability to perform activities of daily living is the main factor affecting quality of life in patients with dementia. Health and Quality of Life Outcomes, (21), 2–52.
Angrosino M. (2005). Recontextualizing observation: ethnography, pedagogy and the prospects for a progressive political agenda. In: The Sage Handbook of Qualitative Research, 3rd. ed., Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds). Thousand Oaks, CA: Sage, 729–745.
Baldwin C., Capstick A. (2007) (eds.). Tom Kitwood on Dementia. A Reader and A Critical Commentary. Maidenhead: Open University Press.
Banerjee S., Samsi K., Petrie C. D., Alvir J., Treglia M., Schwam E. M., del Valle M. (2009). What do we know about quality of life in dementia? A review of the emerging evidence on the predictive and explanatory value of disease specific measures of health related quality of life in people with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, (24), 15–24.
Beavis D., Simpson S., Graham I. (2002). A literature review of dementia care mapping: methodological considerations and efficacy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 725–736.
[27]Becker S., Kaspar R., Kruse A. (2011). H.I.L.DE. Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen. Bern: Verlag Hans Huber.
Brod M., Stewart A. L., Sands L., Walton P. (1999). Conceptualization of quality of life in dementia: The dementia quality of Life instrument (DqoL). The Gerontologist, (39), 25–35.
Brooker D. (2004). What is Dementia Care Mapping? In: Brooker D., Edwards P., Benson S. (eds). Dementia Care Mapping. Experience and insights into practice, Hawker Publications, 11–15.
Brooker D., Surr C. (2005). Dementia Care Mapping: Principles and Practice, University of Bradford.
Brooker D. (2005a). Dementia Care Mapping: A Review of the Research Literature. The Gerontologist, 45 (Special Issue 1), 11–18.
Brooker D., Woolley R.J. (2007). Enriching opportunities for people living with dementia: The development of a blueprint for a sustainable activity-based model. Aging & Mental Health, 11(4), 371–384.
Brooker D. J., Woolley R. J., Lee D. (2007a). Enriching opportunities for people living with dementia in nursing homes: An evaluation of a multi-level activity-based model of care. Aging & Mental Health, 11(4), 361–370.
Buscher I., Reuther S., Holle D., Bartholomeyczik S., Vollmar H.C., Halek M. (2012). Das kollektive Lernen in Fallbesprechungen. Pflegewissenschaft, 3, 168–178.
Clare L. (2002). Developing awareness about awareness in early-stage dementia. Dementia, 1(3), 295–312.
Clare L., Wilson B. A. (2006). Longitudinal assessment of awareness in early-stage Alzheimer’s disease using comparable questionnaire-based and performancebased measures: a prospective one-year follow-up study. Aging & Mental Health, 10(2), 156–165.
Clare L., Markova I. S., Roth I., Morris R. G. (2011). Awareness in Alzheimer’s disease and associated dementias: Theoretical framework and clinical implications. Aging & Mental Health, 15(8), 936–944.
Clare L., Whitaker R., Woods R. T., Quinn C., Jelley H., Hoare Z., Woods J., Downs M., Wilson B.A. (2013). AwareCare: a pilot randomized controlled trial of an awareness-based staff training intervention to improve quality of life for residents with severe dementia in long-term care settings. International Psychogeriatrics, 25(1), 128–139.
Cohen-Mansfield J., Thein K., Dakheel-Ali M., Marx M.S. (2010). Engaging nursing home residents with dementia in activities: The effects of modelling, presentation order, time of day, and setting characteristics. Aging & Mental Health, 14(4), 471–480.
Conde-Sala J.L., Garre-Olmo J., Turro-Garriga O., Lopez-Pousa S., Vitalta-Franch J. (2009). Factors related to perceived quality of life in patients with Alzheimer’s Disease: the patient’s perception compared with that of caregivers. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24, 585–594.
Conde-Sala J.L., Garre-Ormo J., Turro-Garriga O., Vilalta-Franch J., Lopez-Ponsa S. (2010). Quality of Life of Patients with Alzheimer’s Disease: Differential Perceptions between Spouse and Adult Child Caregivers. Dementia and Cognitive Disorders, 29, 97–108.
Conde-Sala J.L., Rene-Ramirez R., Turro-Garriga O., Gascon-Bayarri J., Juncadella-Puig M. (2013). Factors associated with the variability in caregiver assessment of the capacities of patients with Alzheimer Disease. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 26(2), 86–94.
Crespo M., de Quiros M. B., Gomez M. M., Hornillos C. (2012). Quality of life of nursing home residents with dementia: a comparison of perspectives of residents, family and staff. The Gerontologist, 52, 56–65.
Cummins R. A., Lau A.L. D. (2003). Community integration or community exposure? A review and disussion in relation to people with an intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, 145–157.
Edelman P., Fulton B. R., Kuhn D. (2004). Comparison of Dementia-Specific Quality of Life Measures in Adult Day Centres. Home Health Care Services Quaterly, 23(1), 25–42.
Edelman P., Fulton B. R., Kuhn D., Chang C.H. (2005). A comparison of three methods of measuring dementia-specific quality of life: perspectives of residents, staff and observers. The Gerontologist, 45 (Special Issue 1), 27–36.
Epstein A.M., Hall J.A., Tognetti J., Son L.H., Contant L.J. (1989). Using proxies to evaluate quality of life. Can they provide valid information about patient’s health status and satisfaction with medical care? Medical Care, 27, 91–98.
Ettema T. P., Dröes R. M., de Lange J., Mellenbergh G. J., Ribbe M.W. (2007). QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument – validation. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 424–430.
Gebert A., Kneubühler H.U. (2001). Qualitätsbeurteilungen und Evaluation der Qualitätssicherung in Pflegeheimen. Bern: Verlag Hans Huber.
Gomez-Gallego M., Gomez-Amor J., Gomez-Garcia J. (2012). Determinants of quality of life in Alzheimer’s disease: perspective of patients, informal caregivers, and professional caregivers. International Psychogeriatrics, 24(11), 1805–1815.
Gräseke J., Fischer T., Kuhlmey A., Wolf-Ostermann K. 2012). Quality of Life in dementia care – differences in quality of life measurements performed by residents with dementia and by nursing staff. Aging & Mental Health, 16 (7), 819–827.
Held C. (2013). Was ist ‹gute› Demenzpflege? Demenz als dissoziatives Erleben – Ein Praxishandbuch für Pflegende. Bern: Verlag Hans Huber.
Hoe J., Hancock G., Livingston G., Orrell M. (2006). Quality of life of people with dementia in residential[28] care homes. British Journal of Psychiatry, 188, 460–464.
Holst G., Hallberg I.R. (2003). Exploring the meaning of everyday life, for those suffering from dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 18, 359–365.
Innes A., Surr C. (2001). Measuring the well-being of people with dementia living in formal care settings: the use of Dementia Care Mapping. Aging & Mental Health, 5(3), 258–268.
Lawton M.P., Van Haitsma K., Perkinson M. (2000). Emotion in People with Dementia: A Way of Comprehending Their Preferences and Aversions. In: Lawton P.M., Rubinstein R.L. (eds). Interventions in Dementia Care: Toward Improving Quality of Life. New York: Springer, 95–119.
Lawton M.P., Van Haitsma K., Perkinson M., Ruckdeschel K. (2000a). Observed Affect and Quality of Life in Dementia: Further Affirmations and Problems. In: Albert S.M., Logsdon, R. G. (eds). Assessing Quality of Life in Alzheimer’s Disease. New York: Springer, 95–110.
Lawton P.M. (2001). Quality of Care and Quality of Life in Dementia Care Units. In: Noelker L. S, Harel Z. (eds). Linking Quality of Long-Term Care and Quality of Life. New York: Springer, 136–161.
Logsdon R. G., Gibbons L.E., McCurry S. M., Teri L. (2002). Assessing Quality of Life in Older Adults with Cognitive Impairment. Psychosomatic Medicine, 64, 510–519.
Mittal V., Rosen J. (2007). Perception Gap in Quality-Of Life Ratings: An Empirical Investigation of Nursing Home Residents and Caregivers. The Gerontologist, 47(2), 159–168.
Müller-Hergl C. (2009). Patientenverfügungen, Demenz und der community view. In: Schnell M. (Hrsg) Patientenverfügungen. Begleitung am Lebensende im Zeichen des verfügten Patientenwillens – Kurzlehrbuch für die Palliative Care. Bern: Verlag Hans Huber, 255–264.
Müller-Hergl C. (2010). Was machen wir denn mit den Männern? Pflegen: Demenz, 15, 28–32.
Pfeifer C., Drobetz R., Frankhauser S., Mortby M. E., Maercker A., Forstmeier S. (2013). Caregiver ratings bias in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease: impact of caregiver burden and depression on dyadic rating discrepancy across domains. International Psychogeriatrics, 7, 1–11 (ahead of print).
Purves B. A. (2006). Family voices: analyses of talk in families with Alzheimer’s disease or a related disorder. University of British Columbia, Vancouver.
Purves B. A. (2011). Exploring positioning in Alzheimer Disease through analyses of family talk. Dementia, 10(1), 35–58.
Ready R.E., Ott B.R. (2003). Quality of Life Measures in Dementia. Health and Quality of Life Outcomes, 1, (11), 1–11.
Rubinstein R.L. (2000). Resident Satisfaction, Quality of Life, and «Lived Experience» as Domains to be Assessed in Long-Term Care. In: Cohen-Mansfield J., Ejaz F.K., Werner P. (eds), Satisfaction Surveys in Long-Term Care. New York: Springer, 13–28.
Schalock R.L. (2000). Three decades of quality of life. In: Wehmeyer M.L., Patton J.R. (eds). Mental Retardation in the 21st Century: Pro-ed, Austin TX, 335–356.
Selai C., Trimble M.R. (1999). Assessing quality of life in dementia, Aging & Mental Health, 3(2), 101–111.
Sloane P.D., Zimmerman S., Williams C.S., Reed P.S., Gill K. S., Preisser J. S. (2005). Evaluating the quality of Life of Long-Term Care Residents with dementia. The Gerontologist, 45 (Special Issue I), 37–49.
Sousa M. F., Santos R. L., Arcoverde C., Simöes P., Belfort T., Adler I., Leal C., Dourado M. C. (2013). Quality of Life in dementia: the role of non-cognitive factors in the ratings of people with dementia and family caregivers. International Psychogeriatrics, 25 (7), 1097–1105.
Steeman E., Godderis J., Grypdonk M., de Bal N., de Casterle B. D. (2007). Living with dementia from the perspective of older people: Is it a positive story? Aging & Mental Health, 11(2), 119–130.
Streiner D.L., Norman G.R. (2003). Health Measurement Scales – a practical guide to their development and use. Oxford University Press.
Thorgrimsen L., Selwood A., Spector A., Royan L., de Madariga Lopez M., Woods R.T., Orrell M. (2003). Whose quality of life is it anyway? The validity and reliability of the Quality of Life – Alzheimer’s Disease (QoL-AD) Scale. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 17 (4), 201–208.
Townsend-White C., Pham A.N. T., Vassos M. V. (2012). A systematic review of quality of life measures for people with intellectual disabilities and challenging behaviours. Journal of Intellectual Diasability Research, 56(3), 270–284.
Trigg R., Watts S., Jones R., Tod A., Elliman R. (2012). Self-reported quality of life ratings of people with dementia: the role of attitudes to aging. International Psychogeriatrics, 24(7), 1085–1093.





























