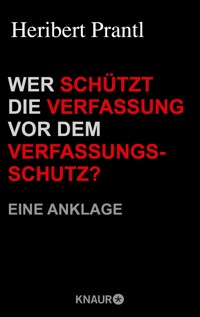17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten
Alle reden vom Krieg, vom Frieden reden zu wenige: Die weißen Tauben sind müde. Heribert Prantl begründet, warum wir eine neue Friedensbewegung, eine neue Entspannungspolitik und keinen dritten Weltkrieg brauchen – es wäre der letzte. Und er denkt darüber nach, wie die Zähmung der Gewalt, wie Entfeindung gelingen kann, wie wir Frieden lernen.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Kultur des Friedens – in dem Bewusstsein, dass der Weg zum Frieden kein Sommerspaziergang ist, sondern ein Höllenritt sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten
Alle reden vom Krieg, vom Frieden reden zu wenige: Die weißen Tauben sind müde. Heribert Prantl begründet, warum wir eine neue Friedensbewegung, eine neue Entspannungspolitik und keinen dritten Weltkrieg brauchen – es wäre der letzte. Und er denkt darüber nach, wie die Zähmung der Gewalt, wie Entfeindung gelingen kann, wie wir Frieden lernen.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Kultur des Friedens – in dem Bewusstsein, dass der Weg zum Frieden kein Sommerspaziergang ist, sondern ein Höllenritt sein kann.
»Es gab keine Zeitenwende, und es gibt sie nicht. Es war und ist dieser Begriff der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben und dem Entsetzen darüber Ausdruck zu geben. Und es ist dies das Schlüsselwort für die Rückkehr der Politik ins Militärische.
Zeitenwende? Die einzige Zeitenwende, die diesen Namen verdienen würde, wäre der Augenblick, in dem die Gezeiten der Gewalt ein Ende hätten, der Menschheitstraum sich erfüllte und der ewige Friede einkehrte. Wie kommt man dieser Zeitenwende näher?
Das Buch versucht, sich ihr anzunähern und zu beschreiben, wie die Zähmung der Gewalt, wie eine Entfeindung gelingen kann. Es fragt, ob sich Sicherheit in der Stärke des Verteidigungsbündnisses erschöpft.
Wie soll es jemals eine Lösung geben, wie soll Frieden werden, wie soll Frieden werden im Nahen Osten, wie soll Frieden werden in der Ukraine? Jedenfalls nicht mit einfachen Antworten. Jedenfalls aber auch nicht ohne die einfachen Worte. Es geht nicht ohne das Gespräch. Darauf haben all diejenigen beharrt, die festgehalten haben am Dialog, da, wo er kaum mehr möglich scheint.
Die Zukunft steht nicht fest. Sie ist nicht vorherbestimmt. Sie ist veränderbar. Der entscheidende Moment ist immer: jetzt. Und der Ort, etwas zu verändern, ist hier.«
Zum Autor:
Foto: © Nina Tenhumberg
Heribert Prantl, Jahrgang 1953, Dr. jur., gelernter Richter und Staatsanwalt, ist Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, war Mitglied der Chefredaktion und 25 Jahre lang Leiter der innenpolitischen Redaktion und der Meinungsredaktion. Er wurde unter anderem mit dem Geschwister-Scholl-Preis, dem Kurt-Tucholsky-Preis, dem Erich-Fromm-Preis, dem Theodor-Wolff -Preis und dem Brüder-Grimm-Preis ausgezeichnet. Heribert Prantl ist Honorarprofessor an der juristischen Fakultät der Universität Bielefeld.
HeribertPrantl
Den Frieden gewinnen
Die Gewalt verlernen
Unter Mitarbeit von Silke Niemeyer
wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 2024
Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-31489-7V001
www.heyne.de
Für Franz Gasteiger
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Lob der Apokalyptik: Sie enthüllt, was passiert, wenn es einfach immer so weitergeht. Sie ist ein Augenöffner
Kapitel 2
Die Verfassung und der Frieden: Friedenstüchtig. Wie das Grundgesetz wurde, was es nicht ist
Kapitel 3
Die Dilemmata der Gewaltlosigkeit. Ihre Kraft, ihre Ohnmacht, ihre Instrumentalisierung
Kapitel 4
Frieden lernen. Weil der Mensch ein Mensch ist. Von der Zähmung der Gewalt und von der Entfeindung
Kapitel 5
Die weißen Tauben sind müde. Warum wir eine neue Friedensbewegung, eine neue Entspannungspolitik und keinen dritten Weltkrieg brauchen; es wäre der letzte
Kapitel 6
Die Friedenswette. Im Westen was Neues: Warum negativer Pazifismus positiv ist
Kapitel 7
Gewalt und Gebet. Am Anfang war der Mord. Die Mythen und Erzählungen der Bibel prägen das kollektive kulturelle Gedächtnis des Westens
Anhang
Anmerkungen
Vorwort
Dieses Buch über Krieg und Frieden ist angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entstanden. Es ist ein Buch über Gewalt, ihre Ursachen und über die Versuche, ihr Einhalt zu gebieten. Es ist ein Buch über die Zeitenwende, die keine ist. Es handelt vom Krieg als gebrochene Zeit, als Bruchstelle von Leben und Tod: Die Bruchstelle des 24. Februar 2022, des Tages also, an dem der Überfall auf die Ukraine begann, hat Risse ins Weltgefüge, ins demokratische und ins wirtschaftliche Gefüge getrieben. Diese Risse setzen sich fort und verästeln sich im privaten Lebensgefüge vieler. Sie verbinden sich mit den Rissen, die Corona hinterlassen hat, verlängern und vertiefen sie und zeichnen das gegenwärtige kollektive Empfinden. Stabilität? Gibt es nicht mehr. Das Lebensgefühl ist ein Lebensunsicherheitsgefühl, und der zu ihm gehörige Begriff heißt »Zeitenwende«. Dieses Wort ist im Jahr 2022 von der Gesellschaft für deutsche Sprache sogar zum »Wort des Jahres« gekürt worden – zu Recht, misst man es an der Quantität seines Gebrauchs, zu Unrecht, misst man es an der Qualität seiner sachlichen Aussage.
Denn: Es gab keine Zeitenwende, und es gibt sie nicht. Es war und ist dieser Begriff der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben und dem Entsetzen darüber Ausdruck zu geben. Und es ist dies das Schlüsselwort für die Rückkehr der Politik ins Militärische. Zeitenwende? Es gab und gibt nur Gezeiten, es gab und gibt die ewige Ebbe und Flut, die Ebbe und Flut von Gewalt und Terror. Und es gibt die Abbrüche und Umbrüche, die diese Gezeiten in der politischen und wirtschaftlichen Geologie hinterlassen. Die einzige Zeitenwende, die diesen Namen verdienen würde, wäre der Augenblick, in dem die Gezeiten der Gewalt ein Ende hätten, der Menschheitstraum sich erfüllte und der ewige Friede einkehrte. Wie kommt man dieser Zeitenwende näher? Das Buch versucht, sich ihr anzunähern und zu beschreiben, wie die Zähmung der Gewalt, wie eine Entfeindung gelingen kann. Es fragt, ob sich Sicherheit denn in der Stärke des Verteidigungsbündnisses erschöpft.
In Sicht ist diese Entfeindung nicht, im Gegenteil. Es gibt Tage, an denen ist die Flut der Gewalt höher denn je, da ist sie aberwitzig hoch, da verschlingt sie, in provozierender Absicht, auch noch die letzten Mikrogramm Humanität. So ein Tag war der 7. Oktober 2023, der Tag, an dem die antisemitisch-islamistische Terrororganisation Hamas mit grenzenloser und sorgfältig berechneter Grausamkeit in Israel einfiel. Ja, berechnet. Und berechnend. Der Massenmord war akribisch vorbereitet in seiner Durchführung und kalt kalkuliert in seinen Folgen. Die Täter haben tausendfach gemordet und vergewaltigt, und das in einem kleinen Land, in dem danach fast jeder Opfer, deren Angehörige oder Bekannte kennt. Sie haben Kinder und Babys geschlachtet; sie haben ihre Gräueltaten mit Bodycams und Helmkameras gefilmt; und die Täter hinter den Tätern haben diese Filme in rasender Eile geschnitten, ins Netz gestellt und die Angehörigen der Opfer damit grausam gequält. Das 10/7-Attentat des Jahres 2023 in Israel war ein Attentat von der furchtbaren Potenz, wie es das 9/11-Attentat in New York und Washington im Jahr 2001 war. Es sprengte freilich auch noch die gespenstische Anonymität, die 9/11 hatte; der Hamas-Terror in Israel war nämlich ein Horror von provokativer Individualität, er stellte die einzelnen Gräueltaten an einzelnen Menschen mit grausam berechnender Absicht in Ton und Bild zur öffentlichen Schau. Die Täter wollten nicht nur Terror verbreiten, sie wollten ihren Hass auf alles Jüdische ins Schaufenster der Welt stellen sowie ihre Abscheu auf die demokratisch tolerante Lebensart, die die tanzenden, leicht bekleideten, zumeist linkem Milieu entstammenden Opfer verkörperten. Ins mörderische Kalkül gehörte, das muss man verstehen und das macht so fassungslos, dass Israel genau so reagieren würde, wie es reagiert hat. Ich frage mich, ob eine israelische Regierung, nicht nur eine mit rechtsradikalen Ministern wie die gegenwärtige, sondern jedweder Couleur, es sich hätte leisten können, auf eine militärische Gegenreaktion zu verzichten. Wie sonst sollte sie ihrer traumatisierten Bevölkerung zeigen, dass der Staat noch da ist?
Die Hamas hat den tausendfachen Tod von Männern, Frauen und Kindern in Gaza in mörderischer und selbstmörderischer Absicht einberechnet. Warum? Um Israel dadurch weltweit zu einem Paria-Land zu machen. Einberechnet und willkommen war auch, dass der Antisemitismus Fahrt aufnehmen würde und jüdische Bürger in aller Welt sich nicht mehr würden sicher fühlen können. Ob man so weit gehen kann, dass der Terrororganisation in ihrem gewaltstrotzenden Nihilismus sogar willkommen war, dass gleichzeitig der antimuslimische Rassismus Auftrieb bekommt? Jedenfalls ist genau dies der Lawineneffekt der Gewalt, den die Täter sich wünschen.
Der Staat Israel verdankt seine Existenz der internationalen Moralität. Wenn, so das perfide Kalkül der Hamas-Terroristen, dieser Staat Israel bei der Reaktion auf den Terror jedes Maß verliert, verliert er das Fundament, auf das er sich gründet. Der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, von Gegengegengewalt und Gegengegengegengewalt, also die unaufhörliche Potenzierung von Anschlag und Vergeltung, soll in einem großen Schlachten in Nahost eskalieren, bei dem Israel untergeht. Das darf nicht geschehen. In den Anschlägen der von Iran gesteuerten Milizen und der Huthi sowie den militärischen Reaktionen der USA wird bereits sichtbar, wie die Funken der Gewalt überspringen und wie groß die Gefahr eines Flächenbrandes ist.
Die gordische Situation in Israel und Gaza zeigt, wie Gewalt funktioniert – so nämlich, dass man den immer dickeren, immer größeren Knoten nicht einmal mehr durchschlagen kann. Der Knoten ist größer als das Schwert. Wenn es gelänge, den Knoten wenigstens zu lockern, wäre dies ein prototypisches und exem-plarisches politisches Wunder. Die Welt bräuchte dieses Wunder und sitzt ratlos vor dem Knoten.
Ich habe dieses Buch lange vor dem Hamas-Attentat, unter dem Eindruck des Ukrainekriegs zu skizzieren begonnen. Ich habe mich zunächst gefragt, welche Anleitung und welche Weisung das Grundgesetz gibt, ich habe untersucht, wie friedenstüchtig unsere Verfassung ist. Ich habe mich gefragt, ob und wie man Frieden lernen kann, und bin diesen Lernversuchen in Geschichte und Gegenwart nachgegangen. Ich habe mich nicht erst mit Blick auf das islamistisch-antisemitische Attentat vom 7. Oktober 2023 damit beschäftigt, welche Bedeutung Glaube und Religion dabei haben. Sie waren und sie sind beides: Kriegstreiber und Friedenskraft. Das habe ich zum Anlass genommen, mich mit dem Gewalterbe des Christentums zu befassen, das den Westen und darin auch meine eigene Biographie prägt.
Eine der schockierendsten Gewaltgeschichten der Bibel ist die Erzählung von der Sintflut, weil Gott hier selber zum Mörder an seiner ganzen Welt wird. Weil die Gewalt der Menschen überbordend wird, entfesselt Gott die Naturgewalt, die sich gegen die Menschen kehrt und sie vernichtet. Auch wenn man darin in Zeiten der menschengemachten Klimakatastrophe erstaunliche Hellsichtigkeit entdeckt: Man ist entsetzt, und man muss entsetzt sein über diesen Gott, der sich gebärdet wie ein fundamentalistischer Massenmörder, der die Welt gut und rein haben will. Es ist dies ein Wahn und ein Muster, das unendlich vielen Gewaltexzessen zugrunde liegt: Die gerechte Sache, die Gewalt und Mord und Krieg legitimiert – das ist für den Inquisitor die reine Lehre der heiligen Katholischen Kirche, für den Mullah der islamistische Gottesstaat, für die RAF-Terroristin die Überwindung des Kapitalismus, für den Nazi das eigene wahre Volk. Die Kraft der Sintfluterzählung liegt darin, dass sie diesem totalitären Denken den Garaus macht. Sie erzählt nämlich von einer Umkehr des gewalttätigen Gottes, der sich vom beleidigten Fundamentalisten, für den die Welt sehr gut sein muss, in einen Realisten verwandelt. Für diesen erwachsen gewordenen Gott darf sie mangelhaft sein und trotzdem bestehen. Der Gott wird zu einem Gott, der Kompromisse schließt und die zweitbeste der Welten akzeptiert. Und die menschliche Gewalt ist, anders als die Gezeiten des Meeres, keine Naturgewalt. Es liegt an uns, sie zu bändigen.
Bei der Beschäftigung mit dem Pazifismus und den Dilemmata der Gewaltlosigkeit bin ich nicht nur auf Jesus von Nazareth, auf Mahatma Gandhi und Martin Luther King gestoßen. Bei der Beschäftigung mit dem Attentat vom 7. Oktober 2023 in Israel ist mir immer wieder der Mann eingefallen, auf den ich in meinen frühen Journalistenjahren eine Laudatio halten durfte: Uri Avnery. Es war am 1. September 1997. Er war ein Prophet. Seine Rede war eindringlich, als wollte er den Naturgewalten gebieten. 73 Jahre war er damals alt, es war bei der Verleihung des alternativen Aachener Friedenspreises. Er warb für den Frieden im Nahen Osten, er tat es mit aller Inbrunst und mit zorniger Weisheit. Er warb, wie er es schon so oft getan hatte, für die Verständigung mit den arabischen Nachbarn und mit den Palästinensern, er warb für gegenseitigen Gewaltverzicht, er warb für den Abzug Israels aus den besetzten Gebieten; er warb für das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und für Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt. Er zitierte den zwei Jahre vorher von einem jüdischen Fanatiker ermordeten Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin mit dem Satz: »Verhandlungen führen, als gäbe es keinen Terror«. Dieser Satz hat sich mir eingebrannt – weil er paradox weitergeht: »... und den Terror bekämpfen, als gäbe es keine Verhandlungen«.
Seit dem 10/7-Terrorangriff der Hamas auf Israel frage ich mich, ob und wie Uri Avnery heute diesen Satz zitieren würde. Würde er angesichts des hemmungslosen antisemitischen Vernichtungswillens, der sich da ausgetobt hat, immer noch behaupten, man könne verhandeln, als gäbe es keinen Terror? Oder würde er alles daransetzen, den Terror zu bekämpfen, bevor überhaupt wieder ans Verhandeln gedacht werden kann? Uri Avnery, der israelische Sisyphos, Friedensaktivist, Veteran, Politiker, Journalist und Schriftsteller, wäre wenige Tage vor diesem Massaker hundert Jahre alt geworden; er ist 2018 im Alter von fast 95 Jahren in Tel Aviv gestorben. Als ich ihm 1997 die Laudatio bei der Verleihung des alternativen Friedenspreises in Aachen halten durfte, kam ich gerade aus den Sommerferien zurück. Ich hatte mit meinen Kindern am Meer Sandburgen gebaut – und zur Vorbereitung auf die Laudatio die Bücher von Uri Avnery gelesen; das hat gut zusammengepasst. Wir haben gebuddelt und Türme und Mauern aufgehäuft, und wie das halt im Sand so ist: Dann geht die Flut darüber, und vom stolzen Bauwerk bleibt nur ein kleiner Sandhügel übrig. Der Friedensidee im Nahen Osten ergeht es wie den Sandburgen. Die Wellen der Gewalt und die nachfolgende Gischt der Politik spülen darüber hinweg, jeden Tag, Jahr für Jahr – und trotzdem hat Uri Avnery nie aufgegeben, trotzdem hat er immer und immer wieder neu an seinem israelisch-palästinensischen Versöhnungsmodell gebaut. Als einst Golda Meir verkündete, es gebe überhaupt kein palästinensisches Volk, hat Avnery den israelisch-palästinensischen Staatenbund proklamiert. Als Jassir Arafat der Haupt- und Erzfeind Israels war, hat Avnery ihn im bombardierten Beirut besucht. Uri Avnery war stolz, als die israelische Friedensbewegung kurzzeitig von Hunderttausenden getragen wurde. Und Avnery hat es ausgehalten, als diese Friedensbewegung keine Bewegung mehr war, sondern nur noch ein Häuflein, geschmäht und verachtet. Er hat Verhaftungen und Mordaufrufe ertragen. Wie hält er das aus, habe ich mich damals gefragt und darauf die Antwort gegeben: »Weil sein Glaube an die Idee von einer gemeinsamen israelisch-arabischen Region stark genug ist, um Berge, Raketenstellungen und vielleicht sogar einen Netanjahu zu versetzen.« Netanjahu war auch schon damals, 1997, israelischer Ministerpräsident.
Nahost-Politik: Hoffnungen waren in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen und wurden wieder weggeschwemmt oder erschossen. Friedensnobelpreise wurden verteilt und nicht eingelöst. Die amerikanischen Friedensvermittler kommen und gehen bis heute. Die arabischen Diktatoren spielen die üblichen Spiele mit den Palästinensern. Woran Avnery immer festhielt, die Idee von zwei Völkern in zwei Staaten, das findet auch heute Befürworter bis hin zu US-Präsident Biden. Wie sonst sollte eine Lösung aussehen? Aber die Spielräume, diesen Plan zu verwirklichen, sie sind noch enger geworden als zu Avnerys Zeiten.
Wie soll es jemals eine Lösung geben, wie soll Frieden werden, wie soll Frieden werden im Nahen Osten, wie soll Frieden werden in der Ukraine? Jedenfalls nicht mit einfachen Antworten. Jedenfalls auch nicht ohne die einfachen Worte. Es geht nicht ohne das Gespräch. Darauf haben all diejenigen beharrt, die festgehalten haben am Dialog, da, wo er kaum mehr möglich scheint: Das sind die Vereine, die ihre Städtepartnerschaften mit Russland weiterführen. Das sind Schriftsteller aus verfeindeten Völkern, die sich schreiben, wie einst Romain Rolland und Stefan Zweig im Ersten Weltkrieg. Das sind israelisch-palästinensische Friedensprojekte, die weitermachen mit ihrer Arbeit. Exemplarisch für diesen befriedenden Dialog ist die Korrespondenz zwischen dem Orientalisten und muslimischen Deutsch-Iraner Navid Kermani und dem Soziologen und jüdischen Israeli Natan Sznaider. In ihrem Büchlein, das sie im Oktober 2023 gemeinsam veröffentlichen, stellen sie fest: »Wir erinnerten uns an die wirklichkeitsschaffende Kraft der Gewalt, die nur noch Schmerz und Trauer hinterlässt, aber auch daran – und das war das Wichtigste vielleicht für uns [...] –, dass man selbst in der Sprachlosigkeit noch sprechen kann, und sei es ohne Worte. Sei es nur, dass man den anderen atmen hört.«1
Wann wird aus dem Atmen ein Aufatmen?
Von Walter Benjamin stammt die Feststellung: »Dass es ›so weiter‹ geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene … Die Rettung aber hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe.« Der Poet und Sänger Leonard Cohen hat einen schmerzlich schönen Song auf diesen Riss gedichtet: »There is a crack, a crack in everything / That’s how the light gets in / You can add up the parts, / but you won’t have the sum.« Die Zukunft steht nicht fest. Sie ist nicht vorherbestimmt. Sie ist veränderbar. Der entscheidende Moment ist immer: jetzt. Und der Ort, etwas zu verändern, ist hier: hier, wo der Riss ist. In diesem Buch suche ich nach diesem Riss.
Kapitel 1
Lob der Apokalyptik
Sie ist ein Augenöffner. Sie enthüllt, was passiert, wenn es einfach immer so weitergeht. Von der Falschheit des Begriffs Zeitenwende und von der Rückkehr der Politik ins Militärische
Es hat etwas Schreckliches auf sich mit dem Frieden. Er entfaltet seine Magie vor allem im Krieg; im Frieden verliert er sie wieder. So wird dann der gewonnene Frieden zu seinem eigenen Feind. Das ist seine Schwäche. Auch die Bilder vom Frieden leiden an dieser Schwäche. Ästhetisch ist der Friede nicht besonders attraktiv. Die Darstellungen des Friedens sind öde, fade und farblos. Sie gewinnen ihre Attraktivität im Kontrast nur zu den furiosen Schreckensbildern von Krieg und Katastrophe. Und das Reden vom Frieden ist so oft blutleer; es ist ein ritualisiertes Reden.
Bert Brecht hat versucht, dagegen zu schreiben. Sein Schreiben hatte Kraft, aber wenig Wirkung. Die Remilitarisierung schon wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er nicht aufhalten. »Das große Karthago«, so schrieb er 1951, »führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.« Das klingt agitatorisch, ist aber die Wahrheit. Und im Ernst der Lage ist Agitation besser als Apathie. Europa erginge es in einem dritten Weltkrieg so wie Karthago, schlimmer noch. Die apokalyptischen Reiter sind nämlich heute atomar bewaffnet.
28,4 x 39,6 Zentimeter. Mehr brauchte Albrecht Dürer nicht, um die apokalyptischen Reiter loszulassen; mehr brauchte er nicht, um Krieg und Mord, um Seuchen und Hunger, um Teuerung und Tod darzustellen. Auf so kleiner Fläche inszeniert er im Jahr 1498, auf einem Holzschnitt, den großen Weltuntergang. Es ist eine Zeit der großen Aufbrüche und Umbrüche; 1492 hat Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. 1494 ist in Nürnberg die Pest ausgebrochen. Für das Jahr 1500 ist das Weltende angekündigt. Entdeckungsfieber und Endzeitstimmung liegen in der Luft. Kräfte ballen sich zusammen, die sich wenig später im Gewitter der Reformation entladen. Dürer offenbart seinem Publikum eindringlich die tödliche Wirklichkeit, die destruktive Kraft, den gewalttätigen Charakter dieser Transformation. Sie ist bei ihm nichts, das man unter Kontrolle hat, nichts, das man beherrscht und gestaltet. Sie ist ein Sturm, der Verwüstungen anrichtet und gewaltsam über die Menschen walzt. Wer in Dürers düsterem Kunstwerk den Geist eines dunklen Mittelalters mit seinen Höllenängsten und religiösen Verblendungen am Werk sieht, irrt. Dürer ist ein großer Desillusionierer, Realist und Aufklärer, der seinen Zeitgenossen die Augen für den Ernst der Lage öffnet.
Seine vier apokalyptischen Reiter sind endzeitliche Gestalten aus dem letzten Buch der Bibel, also der Offenbarung des Johannes. Diese Schrift wird Apokalypse genannt; sie ist eine Widerstandsschrift, entstanden am Ende des ersten oder Beginn des zweiten Jahrhunderts in einer Welt entfesselter Gewalt, rätselhaft und nur mühevoll zu entschlüsseln. Es ist eine Trost- und Widerstandsschrift in der Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich. Es handelt sich um eine monumentale Endzeitvision, die in Extremen schwelgt, zwischen kriegerischen Visionen vom Weltuntergang und zartesten Bildern von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. In dieser Offenbarung wird ein Buch, versiegelt mit sieben Siegeln, geöffnet. Die ersten vier Siegel lassen nacheinander die apokalyptischen Reiter hervortreten, die das endzeitliche Gericht über die Erde bringen. Der erste reitet auf einem weißen Pferd und hat einen Bogen. Ihm wird der Sieg gegeben. Der zweite reitet auf einem feuerroten Pferd, er hat ein großes Schwert; ihm ist die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, sodass die Menschen einander umbringen. Der Reiter auf dem dritten, dem schwarzen Pferd hält eine Waage in der Hand, auf der der Weizen und die Gerste ausgewogen werden; er bringt die Teuerung und damit den Hunger in die Welt. Die Öffnung des vierten Siegels schließlich macht die Bahn frei für den Reiter auf dem fahlen Ross. Dessen Name ist »Tod«, und die Hölle zieht mit ihm einher.
Albrecht Dürers Reiter rasen vom linken Bildrand auf ihren Rossen heran, unaufhaltsam in ihrem Furor: Es sind drei martialische, muskulöse Krieger mit Bogen, Schwert und Waage; der vierte ist kleiner, aber nicht weniger angsteinflößend im Vordergrund; er ist ein schmächtiges, giftig grinsendes Männlein auf einem halb verhungerten Klepper. Er ist der Tod, der mit seinem Dreizack die niedergetrampelten Menschen in den Schlund der Hölle kehrt. Das Höllenmonster, erst auf den zweiten Blick erkennbar, reißt am unteren linken Bildrand sein schreckliches Maul auf und verschlingt die Opfer. Flucht ist sinnlos. Keiner entkommt. Keiner überlebt.
Außer: die Betrachter. Wir, die das Bild anschauen und uns in seinen Bann ziehen lassen, kommen davon, so gerade noch. Die apokalyptischen Reiter sind um Haaresbreite an uns vorbeigejagt. Es ist, als würden wir das Dröhnen der Hufe hören, den Dampf der Rosse atmen und den Staub schlucken, so nah sind wir dem Geschehen. Wir sind die verschonten Zuschauer des Terrors, die am Spielfeldrand des Krieges stehen, vom Schrecken gepackt und von der Einsicht: Es hätte auch uns treffen können. Wir sind entronnen. Für dieses Mal.
Der ukrainische Schriftsteller Serhij Wiktorowytsch Schadan hat einen der Menschen sichtbar gemacht, die dieser Tage direkt neben dem Schlachtfeld stehen und warten, dass das Gefecht vorüber ist. Als er 2022 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche entgegennahm, sprach er zu Beginn seiner Dankesrede von diesem Menschen und setzte ihm ein Denkmal: »Seine Hände sind schwarz und abgearbeitet, das Schmieröl hat sich in die Haut gefressen und sitzt unter den Nägeln. Menschen mit solchen Händen wissen eigentlich zu arbeiten und tun es auch gern. Was sie arbeiten, ist eine andere Sache.« Die andere Sache ist die: Der kleine, stille und besorgt dreinblickende Mann arbeitet hinter den Linien. Er ist der Fahrer einer besonderen Einheit. Seine Aufgabe führt ihn, wenn das Töten und Sterben vorbei ist, auf das Leichenfeld. Aber davon redet er nicht. Er redet von der Technik. »›Ihr seid doch Freiwillige‹, sagt er, ›kauft uns einen Kühlschrank.‹ […] Wir verstehen nicht. ›Aber wenn du ihn brauchst, dann fahren wir zum Supermarkt, du suchst dir einen aus, und wir kaufen ihn.‹ ›Nein‹, erklärt er, ›ihr habt mich falsch verstanden: Ich brauche ein Fahrzeug mit einem Kühlschrank. Einen Kühlwagen. Um die Gefallenen abzutransportieren. Wir finden Leichen, die schon länger als einen Monat in der Sonne gelegen haben. Wir schaffen sie mit einem Kleinbus weg, da kriegst du keine Luft mehr.‹ Er spricht über die Leichen – seine Arbeit –, ruhig und gemessen, ohne Wichtigtuerei und auch ohne Hysterie. Wir tauschen unsere Nummern.«2 Serhij Schadan führt seine Zuhörer, ähnlich wie Albrecht Dürer seine Betrachter, an den Rand des Leichenfeldes; er gibt ihnen eine Vorstellung vom Unvorstellbaren, präziser gesagt, von der Unvorstellbarkeit des Krieges; nicht durch eigene Anschauung, sondern durch den stillen Mittelsmann, der selbst erst aufs Spielfeld des Krieges tritt, wenn die Kämpfer fort sind. Unvorstellbar – diese Beschreibung des Krieges gehört hier nicht in eine Reihe mit den redundanten, sich übertrumpfenden und darum wohlfeilen Adjektiven, die zu gebrauchen mittlerweile fast als moralisches Gebot gilt, wenn vom ukrainischen Krieg zu reden ist: »der brutale Angriffskrieg«, »das barbarische Massaker« und in der Steigerung der Steigerung: »der unvorstellbar brutale Angriffskrieg« und »das unvorstellbar barbarische Massaker«. Solches Doppelgemoppel ist Wortreichtum bei gleichzeitiger Sinnarmut, es will vielsagend sein und ist nichtssagend. Es ist dies ein Den-Mund-zu-voll-Nehmen, das weder Information noch Erkenntnis vergrößert, noch das Gesagte nachdrücklicher macht. Bleibt allein die eitel ängstliche Selbstaussage: Hört her, ich habe es begriffen, und ich habe die Moral auf meiner Seite. Die routinierte Redundanz wirkt nicht einmal mehr empört; sie wirkt verlogen, denn sie suggeriert das Gegenteil dessen, was sie betonen will, nämlich man könne sich durchaus einen harmlosen Angriffskrieg und ein humanes Massaker vorstellen.
»Unvorstellbar« meint, dass die Sprache selbst und damit die Fähigkeit, über das Geschehen zu reden, es zu verstehen und sich kollektiv darüber zu verständigen, im Krieg an ihre Grenze kommt oder gar gänzlich abbricht. Mag sein, dass die Vorliebe für Pleonasmen ein Symptom dafür ist. Noch einmal Serhij Schadan: »Genau dieses Gefühl ist es, das dich vom ersten Tag des großen Krieges an begleitet – das Gefühl der gebrochenen Zeit. [... Es geht] um die Sprache. Darum, wie genau und zutreffend die Wörter sind, die wir verwenden, wie markant unsere Intonation, wenn wir über unser Dasein an der Bruchstelle von Leben und Tod sprechen. Inwieweit reicht unser Vokabular – also das Vokabular, mit dem wir gestern noch die Welt beschrieben haben [...]?«
Die nüchterne, unaufgeregte Beschreibung des kleinen besorgten Mannes mit den ölverschmierten Händen gibt eine Ahnung vom Leben an der Bruchstelle; und sie gibt auch eine Ahnung von der Unvorstellbarkeit. Er hat seinen Kühlschrank bekommen. So geht Wunscherfüllung in Zeiten des Krieges. Der kühle Pragmatismus, der karge Realismus, sie verstören mehr, als jedes Pathos es vermöchte. Anders als Dürers apokalyptische Reiter ist Schadans Kühlschrankfahrzeug, das über das Leichenfeld rumpelt, kein mythisches Bild, sondern eine Realmetapher. Aber beide machen sie das Unvorstellbare vorstellbar, beide klären auf über den Schrecken des Krieges, indem sie das Reale und die Groteske ineinanderfließen lassen. Dürers »Tod« ist eben nicht das konventionelle klapprige Skelett mit Stundenglas und Sense. Er zeichnet ihn realistischer als bärtigen alten Mann, als ausgemergelten Körper mit leerem Blick und freudlosem Lachen. Er ist eine lebendige Leiche, doch kein Auferstandener.
Krieg als gebrochene Zeit, als Bruchstelle von Leben und Tod: Die Bruchstelle des 24. Februar 2022 hat Risse ins Weltgefüge, ins demokratische, ins wirtschaftliche Gefüge getrieben, die sich fortsetzen und verästeln im privaten Lebensgefüge vieler. Sie verbinden sich mit den Rissen, die Corona hinterlassen hat. Das Leben verliert seine Stabilität, die innere Unsicherheit nimmt zu. Der zu diesem Lebensunsicherheitsgefühl gehörige Begriff heißt »Zeitenwende«. Es gab aber keine Zeitenwende, und es gibt sie nicht. Es gab und gibt nur Gezeiten, also die ewige Ebbe und Flut von Gewalt und Terror. Und es gibt die Folgen, die diese Gezeiten in der politischen und wirtschaftlichen Geologie hinterlassen. Von ihr werden die Zeiten bestimmt, die Zeiten Dürers, die Zeiten Brechts und unsere Zeiten. Es gab auch im Februar 2022 keine Zeitenwende, obwohl der Überfall Putins auf die Ukraine immer wieder so genannt wird. Es war und ist dies der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben und dem Entsetzen darüber Ausdruck zu geben. Und es ist dies das Schlüsselwort für die Rückkehr der Politik ins Militärische.
Eine echte Zeitenwende wäre es, wenn die Gezeiten der Gewalt ein Ende hätten. In der christlichen Tradition ist Christi Geburt die Verheißung dieses großen Friedens: »In terra pax.« In der Weihnachtslegende verkünden die Engel auf den Feldern von Bethlehem den Frieden auf Erden. Es ist dies ein allumfassender Friede, der viel mehr ist als Waffenstillstand. Die Legende ist entstanden in einer Zeit, die nicht weniger gewalttätig war als die Zeit Dürers oder die gegenwärtige Zeit. Damals hielt das römische Imperium Jerusalem besetzt, es plünderte das Land, terrorisierte die Bevölkerung und schlug Widerständler ans Kreuz. Die vom jüdischen Messianismus und jüdischer Prophetie geprägte Botschaft des Jesus von Nazareth, der Glaube an seine Auferstehung und an ein ewiges Leben drehten das alte Weltbild um. Sie lautet so: Diese Welt mit ihrer Gewaltordnung ist endlich; sie ist dem Untergang geweiht, der Mensch aber hat ein ewiges Leben. Die Geburt des Lehrers dieser Lehre wurde zu einem Wendepunkt der Zeitrechnung: Man teilt die Geschichte ein in eine Zeit vor Christus und in eine Zeit nach Christus. Weihnachten feiert diesen Wendepunkt, der die Vision einer echten Zeitenwende enthält.
Die Geschichte von der Zeitenwende ist freilich keine Geschichte im Sinn von Historie, sie ist nicht einfach eine uralte Fake News. Sie ist auch keine Prophezeiung für die Zukunft. Und sie verbirgt kein politisches Programm. Sie ist eine Legende; das heißt übersetzt: das, was zu lesen ist, was immer und immer wieder vorzulesen ist, um beharrlich Hoffnung auf das endgültige Ende der Gewalt zu buchstabieren. Diese Botschaft ist nicht von gestern, sie ist für heute. Sie ist und bleibt Utopie. Wo sie Hoffnung und Widerstandskraft entfaltet, da kann sie helfen, die Gezeiten zu zähmen. Aber diese Hoffnung ist gegenwärtig dünn. Im Augenblick ist das Gegenteil der Fall; und dazu trägt nicht zuletzt der antiutopische Begriff der Zeitenwende bei.
An den Bruchstellen von Leben und Tod reißt die vulgärapokalyptische Grundstimmung ein, dass die Welt angesichts von Pandemien, Inflation, Hungersnöten, Krieg und drohendem Klimakollaps nicht zu retten ist. Diese Zeitansage ist nicht ganz neu, Weltuntergangsankündigungen und schwarzseherische Hysterien sind so alt wie die Welt, zum Millennium hatten sie zum Beispiel Hochkonjunktur. Genauso alt und berechtigt sind die den Weltuntergangsängsten kongruenten Beruhigungen, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Die gegenwärtig grassierende Angst ist ein Phänomen der offenen, säkularisierten Gesellschaften Europas, die in den letzten Jahren erleben, wie sich Krise auf Krise türmt, während die politische Gestaltungskraft immer ohnmächtiger wirkt und der religiöse Trost immer löchriger. Die Veränderungen sind nicht mehr schleichend, sondern stampfend, und sie betreffen in ihren Auswirkungen nicht mehr nur diejenigen, die am Rand der Gesellschaft vor sich hin krebsen, sie sind bei denen angekommen, die mittendrin sind, sie sind angekommen bei den Gesetzten und bei den bislang Unbekümmerten und stressen sie gewaltig. In einer groß angelegten wissenschaftlichen internationalen Studie wurden zehntausend junge Leute nach ihren Zukunftsvorstellungen befragt. Mehr als die Hälfte von ihnen meint, die Menschheit sei dem Untergang geweiht, zwei Drittel ängstigen sich so, dass es ihr alltägliches Leben überschattet. Zu dieser Verschattung gehört, dass der Wunsch, Kinder zu bekommen, signifikant abnimmt.3 Das Gefühl ist verbreiteter denn je:
There’s a crack in everything.
Der Poet und Sänger Leonard Cohen hat einen schmerzlich schönen Song auf den Riss in allem gedichtet. Zehn Jahre lang hat er an dem Stück gearbeitet und es am Ende schlicht »Anthem« genannt, »Hymne«. Man fragt sich, warum er es nicht »Lament« genannt hat, »Klage«, wenn man ihm zuhört, denn seine Bestandsaufnahme über den Zustand der Welt ist niederschmetternd.
Ah, the wars they will be fought again
The holy dove, she will be caught again
Bought and sold, and bought again
The dove is never free.
Die Kriege werden kein Ende nehmen. Die Friedenstaube wird wieder eingefangen, gekauft und verkauft und wieder gekauft (siehe dazu Kapitel 5, »Die weißen Tauben sind müde«). Die Friedenstaube ist niemals frei. Cohen lässt keine Chance auf die Hoffnung, dass die rissige Welt jemals heil wird. Trotzdem: Er nennt sein Stück Anthem. Es ist kein Lamento, es ist ein Loblied auf den »Crack in everything«, und darin ist er ein echter Apokalyptiker. Echte Apokalyptiker sind im Gegensatz zu Vulgärapokalyptikern eben keine hoffnungslosen Weltuntergangspropheten. Sie sind Dialektiker: Da ist ein Riss, ein Riss in allem – »that’s how the light gets in«! Die Risse im Gehäuse der Geschichte sind nicht allein destabilisierend und destruktiv, nicht allein Anlass, die Hoffnung aufzugeben. Die Risse im Gebäude der Geschichte sind es, wodurch Licht reinkommt. Sie sind die Ritzen, durch die Hoffnungsschimmer einfallen. Der jüdische Songschreiber Leonard Cohen ist darin verwandt mit dem jüdischen Philosophen Walter Benjamin, vielleicht nicht von ungefähr, denn es ist das Judentum, das die Apokalyptik zur Blüte gebracht hat. Beide verabschieden die Vorstellung, dass die Geschichte ein linearer Lauf der Ereignisse, eine »Kette von Begebenheiten« ist, eine Reihung von Fortschritten, die einer kontinuierlich auf den anderen folgen und irgendwann in einer Katastrophe enden. Von Walter Benjamin stammt die Feststellung: »Dass es ›so weiter‹ geht, ist [Hervorhebung H.P.] die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende sondern das jeweils Gegebene … Die Rettung aber hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe.«
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in
You can add up the parts,
but you won’ t have the sum.
Der Riss ist die Stelle, wo die Veränderungen ansetzen müssen. Hier und jetzt, genau da, wo der Riss ist. Dieses Hier und Jetzt will bemerkt und ergriffen werden; man kann es bisweilen im Nachhinein mit Ort und Datum benennen – zum Beispiel den Tisch in Moskau, an dem 1955 über die Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen verhandelt wurde. Konrad Adenauers und Nikita Chruschtschows Leute, Verhandlungsstrategen, die mit allen Wassern gewaschen waren, hatten sich vollkommen festgefressen. Der deutsche Kanzler ergriff das Wort und wollte Chruschtschow die Verbrechen der Roten Armee in Deutschland um die Ohren hauen. Da fiel der mitgereiste Carlo Schmid seinem Kanzler ins Wort: »Ich möchte vorausschicken, dass im Namen des deutschen Volkes am russischen Volke Verbrechen begangen worden sind wie vielleicht noch nie in der Weltgeschichte. Ich rufe darum nicht die Gerechtigkeit an, sondern die Großherzigkeit des russischen Volkes. Und wenn ich das tue, denke ich in erster Linie nicht an die Menschen, die noch hier zurückgehalten werden, sondern an ihre Frauen, an ihre Kinder, an ihre Eltern. Lassen Sie Gnade walten.«4 Da war er, der »Crack«, durch den das Licht reinkam. Die Kriegsgefangenen kamen kurze Zeit danach nach Hause. Deutschland nahm volle diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion auf.
Ein anderer, der den Riss sah, durch den das Licht reinkommt, war der Schreiner Georg Elser mit seiner mutigen Tat: Er deponierte am 8. November 1939 eine selbst gebaute Bombe im Münchner Bürgerbräukeller. Sie verfehlte Hitler und die Nazi-Führungsspitze um ein Haar. Warum? Weil das Wetter schlecht war und Hitler früher zum Zug musste. Elser, ein unberechenbarer Einzelner, hätte den Lauf der Geschichte verändern können.
Es ist eine aufklärerische Einsicht, dass Krieg, Ungerechtigkeit und Gewalt nicht allein in der Boshaftigkeit einzelner mächtiger Menschen ihre Ursachen haben, sondern aus Verflechtungen, Strukturen und sich selbst nährenden Ordnungen wachsen, die Krieg, Ungerechtigkeit und Gewalt nachwachsen lassen wie Brennnesseln auf der Wiese. Aber: There’s a crack in everything, also auch darin. Es darf nicht vergessen werden, was einzelne Menschen vermögen, wenn sie den Riss erkennen, einen hellen Moment haben – und den nötigen Mut. Es sind Menschen wie Gustav Stresemann, Martin Luther King, Mutter Teresa oder Willy Brandt, die für diesen Mut den Friedensnobelpreis erhalten haben; und es sind Personen wie Mahatma Gandhi, die ihn nicht erhalten haben, obwohl sie ihn hätten erhalten müssen.