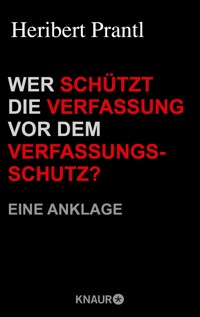19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Corona bewältigt ist, werden die alten Krisen noch lang nicht bewältigt sein, sie wurden sogar verschärft. Vielen Menschen wird klar, wie wacklig die Fundamente ihres Lebens sind – und wie wichtig es ist, sie zu stabilisieren. Nach seiner Streitschrift vom Frühjahr 2021 zur Verteidigung der Grundrechte gegen Corona geht es Heribert Prantl nun darum seine Denkanstöße zu bündeln und für eine gute Politik in Krisenzeiten zu werben: Wenn sowohl der Himmel offen ist als auch die Hölle, dann braucht es das Fegefeuer der Aufklärung, die Rückbesinnung auf die humanitären Werte. Ein Buch zu den anstehenden Wahlen, aber auch zu anstehenden Grundentscheidungen. Grundentscheidungen, die sich auf das Leben und Sterben des einzelnen Menschen auswirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Anna, Nina und Antonia. Und für Simon Daniel Alexander.
Inhalt
VORWORT
Geist und Gegenwart
EINE NEUE WACHSAMKEIT
Das All gehört allen
Die Natur als Rechtsperson
Hoffnung lässt die Welt nicht zum Teufel geh’n
Der braune und der grüne Deal
Die Lotterie des Lebens
Therapeutische Entschleunigung
Anders leben, anders reisen, anders bauen
Was man essen kann
Trauer ist Widerstand gegen das Verschwinden
Recht zum Leben, Recht zum Sterben
Die letzten Dinge
EINE NEUE POLITIK
Die Neugründung Europas
Wahlbeteiligung 91,1 Prozent
Menschen, die zum Vorbild werden
Eine Prise Plebiszit
Wählen ab 16
Wohl und Wahn
Verbotspolitik
Was eine Demokratie braucht
Ein Staat ohne Geheimdienst
Rinks & lechts
EINE NEUE GESELLSCHAFT
Die Antwort auf den Hass
Wo das Positive bleibt
Was den Staat human macht
Reichtum verpflichtet
Knickrig, mickrig, löchrig
Das Kindergefängnis sprengen
Demokratie und Sozialstaat gehören zusammen
Ein Anti-Egoismus-Jahr
Gleichberechtigung: Mission erfüllt?
Wer wen zum Altar führt
Recht queer: Schwule und lesbische Paare als Eltern
Formel der Gerechtigkeit: »m/w/d«
EINE NEUE HEIMAT
Wenn wir selbst Flüchtlinge wären
Medea heute
Christliche Heimatkunde
Insichnahme und Ansichnahme
Stadt, Land, Kuss
Wohnungsnot, Wohnungsgebot
Das Wohl der Schwachen
EINE NEUE ARBEITSWELT
1. Mai forever
Kerntruppe des modernen Staats
Digitale Klugheit
Synchronisation der Gesellschaft
EIN NEUES RECHT
Orwell und Orwellness
Warum trägt Justitia eine Augenbinde?
Der mörderische Tod
Legalize it
Abhängigkeit und Unabhängigkeit
Der Leuchtturm der Gerechtigkeit
EINE NEUE SICHERHEIT
Wahnsinn, einfach Wahnsinn
» … von deutschem Boden nur Frieden …«
Vertrauen wagen
Ein Impfstoff für den Frieden
Alles umsonst?
Bruder Esel
EINE NEUE KIRCHE
Die letzten Tage der Volkskirche
Heiliger Rebell
Sex und Segen
Das Magnifikat der frommen Frauen
Eine Korrektur fürs Vaterunser
NACHWORT
Das Fegefeuer als Staatsform
Editorische Notiz
Impressum
Vorwort: Geist und Gegenwart
Eine neue Ethik für die technologische und digitale Zivilisation
Die Probleme sind global, sie sind universal, und sie sind kolossal schwierig. Es geht nicht nur um das kleine Karo des Wer-mit-wem-Regierens in Deutschland, sondern um das Überleben angesichts weltweiter Großrisiken. Es geht darum, wie der Mensch in einer Welt der Unordnung, in einer chaotischen Welt, in einer sich aufheizenden Welt Leben und Ordnung finden kann. Es geht um die Schöpfung. Schöpfung ist nicht einfach ein anderes Wort für Natur. Schöpfung ist Chaosbewältigung, immer und immer wieder. Dazu braucht es kreative Kraft. Im Christentum heißt diese Kraft »Heiliger Geist«. Wenn man diese Kraft säkularisiert, ist sie der schöpferische Geist. Dieser Geist ist kein Zeitgeist, er ist die Geistes-gegenwart, die das Tohuwabohu beendet.
Vom Leben in einer chaotischen Welt
Mit dem Tohuwabohu beginnt schon die Bibel. Sie fängt ja nicht bei Adam und Eva an; sie beginnt vielmehr so: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war »tohû wa vohû«; »wüst und leer« hat Luther das aus dem Hebräischen übersetzt. War sie also ein Nichts, ein völlig leerer Raum, den Gott dann mit seinem Schöpfungswerk möbliert hat? Das meinen die Kreationisten, die dies irrtümlich für ein Protokoll über die Erdentstehung halten.
Es ist dies aber ein Mythos darüber, wie der Mensch in einer Welt der Unordnung, in einer chaotischen Welt Leben und Ordnung finden kann. Wüst und leer heißt präziser: verwüstet und entleert, chaotisch und lebensfeindlich. Das kann auch ein überfüllter Raum sein, angefüllt von Durcheinander. Mit »Irrsal und Wirrsal« hat Martin Buber das übersetzt und dabei schön die Lautspielerei der hebräischen Worte aufgenommen. Tohuwabohu ist Chaos, Verwüstung und nihilistische Ödnis; Tohuwabohu ist nicht eine ganz leere, sondern eine ganz verkehrte Welt. Tohuwabohu meint Verhältnisse, in denen man nicht leben kann.
Die Entwirrung der Wirrnis
In diese wirre Welt kommt dann, so sagt es die Schöpfungsgeschichte, Gottes Geist und sein Befehl: Es werde Licht! Man mag dies den Wahlspruch der Aufklärung in biblischer Lesart nennen. Es kommt Erleuchtung; Ordnung kommt in die Unordnung. Und zwar nicht am Nullpunkt der Zeit, sondern immer wieder und wieder. Das ist Schöpfung; sie ist nichts ewig Vergangenes, sondern etwas ewig Wiederkehrendes. Die Schöpfung beginnt nicht aus dem Nichts, sondern inmitten der Störung, der Unordnung, der Zerstörung und der Vernichtung. In dieser Geschichte am Anfang der Bibel taucht der Geist Gottes, der »Heilige Geist«, zum ersten Mal auf. Er ist die kreative Kraft, die im Chaos einen neuen Anfang setzt, er ist die Geistesgegenwart, die das Tohuwabohu beendet. Wir brauchen diese kreative Kraft, um die Klimakrise zu überleben. Wir brauchen sie, um den Menschen in Afghanistan zu helfen. Wir brauchen diese Kraft, um Frieden zu finden in einer Welt des Unfriedens.
Schöpfung ist also Chaosbewältigung. Die Schöpfungsgeschichte, die Ostergeschichte, die Pfingstgeschichte: Es geht immer darum, wieder aus der Destruktivität, aus der Todeszone zu kommen. In der Coronapandemie haben wir weltweite Unordnung erlebt, eine unzeitig-vorzeitige Begegnung mit dem Tod. Das Leben in der Coronazeit mit all ihren Beschränkungen war beschwerlich – es war Chaos für die einen, Ödnis für die anderen, bloße Störung der Normalität für die Dritten. Die Impfung brachte Hoffnung zurück, sie brachte und bringt die Menschen wieder aus der Gefahren- und Todeszone. Aber es ist noch viel kreativer Geist vonnöten, um das gestörte Zusammenleben neu zu ordnen.
Schöpfung ist Chaosbewältigung
Man würde sich wünschen, dass es auch eine Impfung gegen die Aggression in Afghanistan gäbe, auch eine Impfung gegen die Gewalt im Nahen Osten. Im Teufelskreis von Hass, Gewalt und Bedrohung gedeihen die Taliban und der IS, der Islamische Staat; in diesem Teufelskreis floriert die Hamas, in diesem Teufelskreis schärfen die jüdischen Israelis ihre nationale Identität, wächst der Funda-mentalismus. Eine Waffenruhe im Nahen Osten ist da ein winziger Hoffnungsschimmer. Der Schriftsteller David Grossman hat den Teufelskreis dort in einem SZ-Interview so beschrieben: »Beide Seiten, die palästinensische wie die israelische, wenden einander ihre dunkelste Seite zu. In dieser Situation absoluter Finsternis ist es nahezu aussichtslos, für Frieden zu werben, für die Option eines normalen Lebens, das wir kaum mehr kennen. Und es ist ebenso schwierig, Akteure zu finden, die den Friedensprozess wiederbeleben könnten.«
Was Grossman formuliert, ist die exakte Beschreibung von Tohuwabohu. Und was er dann weiterschreibt, was er selbst versucht – das ist Heiliger Geist, das ist schöpferischer Geist: nämlich, für Frieden zu werben und Akteure zu finden, die den Friedensprozess wiederbeleben könnten; und sei es nur dadurch, als Künstler »zarte, feine, empfindliche Dinge zu tun in einer Welt, die krank, indifferent, gewalttätig wird«. Es geht um den Versuch, Irrsal und Wirrsal zu ordnen. Schöpfung ist Chaosbewältigung – im Nahen und Mittleren Osten, in Afghanistan, in einem Europa, in dem Flüchtlinge Aufnahme finden wollen und sollen. Chaosbewältigung: Wer sich traut, dazu das Seine beizutragen, der spürt die Kraft des Geistes.
Die Finsternisse
In der Bildsprache von Pfingsten zeigt sich der Geist in Feuerflammen, die die Finsternis zerreißen. Die Finsternisse sind zahlreich. Es gab die Finsternis in der Coronapandemie; es gibt die Dauerfinsternis im Nahen, Mittleren und Fernen Osten, es gibt sie im Mittelmeer, wo die Geflüchteten ertrinken, es gibt sie in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Der Versuch, diese Finsternisse zu erhellen und Geisteskraft zu entzünden, hat nichts, aber auch gar nichts von Lagerfeuergemütlichkeit. Es ist ein wahres Fegefeuer. Es verursacht Schmerzen, Verluste und Opfer; es braucht unendliche Geduld, und es ist alles andere als gemütlich und gemächlich. Vor diesem Hintergrund habe ich das Buch »Himmel, Hölle, Fegefeuer« genannt, weil diese Begriffe die existenziellen Dinge, die brennenden und kollektiven Überlebensfragen bezeichnen, die Themen, in denen es um Leben und Tod geht, weil sie für das große Gelingen, das große Scheitern und das große Mühen dazwischenstehen.
Wem der Zeitgeist Freund ist
Das Mühen in Deutschland beginnt mit einer neuen Bundesregierung, nach den 16 Regierungsjahren von Angela Merkel. Nicht unbedingt der Heilige Geist, wohl aber der Zeitgeist ist ein Gast, den jede Partei bei ihrem Parteitag am allerliebsten hat. Er hat keine Titel, er hat keinerlei offizielle Funktion. Er wird nicht eigens begrüßt, er hat nicht einmal einen Platz in der ersten Reihe. Er hat genau genommen gar keinen Sitzplatz – und trotzdem spürt man es sofort, wenn er da ist. Dann strotzt die Partei vor Selbstbewusstsein, dann weiß sie, wofür sie steht und wofür sie streitet. Bei der SPD ist es lange her, fünfzig Jahre, dass der Zeitgeist gern und lange bei ihr war. Es waren die großen Zeiten von Willy Brandt. Und dann kam 1998 der Zeitgeist noch einmal zu den Sozialdemokraten – als Helmut Kohl abgewählt und Gerhard Schröder Kanzler wurde. Der Zeitgeist war eine Zeit lang Genosse, bei der Bundestagswahl 2021 erinnerte er sich daran. Aber er ist parteipolitisch nicht treu und nicht monogam. Das hat die FDP erfahren, als sie in noch neoliberalen Zeiten bei der Bundestagswahl von 2013 an der Fünfprozenthürde scheiterte. Auch die Grünen kennen das: Viele Jahre lang waren sie sich ganz sicher, dass der kritisch-aufgeklärte, der ökologische Zeitgeist ihr Freund ist; aber ein braves Pferd, das einen problemlos ans Ziel trägt, ist er nicht. Im Bundestagswahlkampf von 2017 machte er sich auf einmal rar, kehrte aber dann Anfang 2021 kurzzeitig so triumphal zurück, dass die Partei eine Kanzlerkandidatin aufstellte; als die Partei diesen Fehler machte, schreckte sich der Zeitgeist und zog sich wieder zurück. Der erwartete grüne, vom Zeitgeist getragene Triumph bei der Bundestagswahl 2021 blieb daher aus.
»Wir müssen anders miteinander reden« – Von der Mediation in der Politik
Das Zukunftsweisende am Abend der Bundestagswahl war nicht der »Auftrag zur Regierungsbildung«, den die Kanzlerkandidaten sowohl von SPD als auch von CDU/CSU für sich reklamierten. Das Zukunftsweisende war eine Feststellung, die der Diplomat und FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff in einer Fernsehdiskussion machte: »Wir müssen«, sagte er, »anders miteinander reden«. Das klang lapidar, ist es aber nicht. Das bezog sich auf die Kommunikation der Parteien untereinander, aber auch auf die Kommunikation dieser Parteien mit der Gesellschaft. Wenn es in Zukunft so ist (und es wird so sein), dass nicht mehr ein Duo, sondern ein Trio von Parteien die Regierung stellt, kann sich eine neue Dynamik (nicht nur) des koalitionären Suchens und Findens entwickeln. Aus Vorkoalitionsgesprächen der zwei kleineren Parteien miteinander kann sich eine Dynamik ergeben, die das von den jeweiligen Prozentzahlen beschriebene Kräfteverhältnis zur Kanzler-partei verändert und vergrößert.
Die neuen Viel-Parteien-Konstellationen verlangen nach Fähigkeiten, wie man sie aus der Mediation kennt, also aus den Verfahren zur friedlichen Konfliktlösung. Bei einer Mediation wird – so sieht es das Mediationsgesetz aus dem Jahr 2012 vor – der klassische Kampf ums Recht abgelöst durch das gemeinsame Suchen der Parteien nach dem für alle Beteiligten einigermaßen Verträglichen. Am Ende eines solchen Prozesses steht dann nicht ein streitiges Urteil, dem sich die Parteien unterwerfen müssen, sondern eine gemeinsam ausgehandelte Vereinbarung. In Scheidungs- und Familienkonflikten werden so gute Ergebnisse erzielt.
Der Mediationsgedanke spielt schon seit Jahrzehnten in Tarifkonflikten und Arbeitskämpfen eine befriedende Rolle: Ein Schlichter, oft ist es ein angesehener und erfahrener Alt-Politiker, versucht, verhärtete Positionen aufzuweichen und zusammenzubringen. Heiner Geißler hat als Schlichter bei Stuttgart 21 das Schlichtungsprinzip in die Politik getragen und in einer vorbürgerkriegsähnlichen Situation aus Kriegern wieder Bürger, und aus Feinden wieder Gegner gemacht. Stuttgart 21 war und ist ein verkehrspolitisches Großprojekt. Die Schlichtung zu Stuttgart 21 war ein demokratiepolitisches Lehr- und Großprojekt.
Es braucht Mediation in und zwischen den Parteien; es braucht auch Mediation in der Gesellschaft, um die Lösung der anstehenden Großprobleme, um die ökologisch-soziale Transformation voranzubringen. Mediation ist das Gegenteil von Machtspielen, und es ist dies auch etwas anderes als das Aussitzen von Konflikten und das Resignieren vor der Wirklichkeit; und es ist dies etwas anderes als ein sich irgendwie Arrangieren mit dem Zeitgeist.
Entspektakelung des Spektakulären
Zum Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel als CDU-Chefin und Kanzlerin gehörte, dass sie nach dem Zeitgeist haschte wie Spitzwegs Schmetterlingsfänger nach den bunten Faltern. Das gelang ihr meist ganz gut; das genügt aber künftig nicht mehr. Die Transformation der Gesellschaft schafft man nicht mit Zeitgeisthascherei. In der Ära Merkel mag das dem Publikum noch genügt und gefallen haben, weil Merkel dabei so bescheiden wirkte, nicht viel Gewese aus sich machte und gleichwohl mächtiges Selbstbewusstsein ausstrahlte. Deshalb gelangen ihr auch spektakuläre Kurswechsel ziemlich unspektakulär – etwa in der Atompolitik und der Wehrpolitik, aber auch in gesellschaftspolitischen Fragen wie der Homo-Ehe. Sie entspektakelte das Spektakuläre. Das war ihre Stärke. In der Flüchtlingskrise gelang ihr das nicht besonders gut, in der Coronapandemie wieder eher. Sie beherrschte auf diese Weise das Kunststück, die Macht zu erhalten, noch besser als ihr SPD-Vorgänger Gerhard Schröder, der an seiner Agenda 2010 auch deshalb scheiterte, weil er sie spektakelhaft inszenierte.
Zappelnder Zeitgeist
Macht ist, wenn es einem nichts ausmacht, dass man Fehler gemacht hat. Diese Macht hatte Merkel viele Jahre lang. Sie hatte die Kraft, ihre Partei auf falsche Wege zu zwingen – das begann mit dem sehr neoliberalen Parteiprogramm, das sie 2003 auf dem CDU-Parteitag von Leipzig verkündete. Merkel ließ es damals zu, dass ein Norbert Blüm von der Bühne gepfiffen wurde. Aber dieses Programm verband sich nicht mit ihr; es war lange so, als ob die Politik, die sie propagiert, nicht an ihr haften bleibt; das änderte sich erst mit der Flüchtlings- und mit der Coronapolitik. Sie verstand es lange, Diskussionen zu unterbinden, wenn die Wege sich als Irrwege herausstellten. Sie hat Fehler über Fehler gemacht und sich trotzdem eisern Respekt verschaffen können. Sie hat all ihre Konkurrenten von einst, sie hat Stoiber, Koch und Merz bezwungen: Sie hat Ruhe bewahrt, bis sich die Konkurrenten in ihrem mitunter zappelnden Ehrgeiz verfangen und aufgehängt hatten – und der Zeitgeist wieder bei ihr einzog. Sie schaffte es so, zur Inkarnation machtbewusster Bescheidenheit zu werden.
Vor ihrer ersten Kanzlerschaft, im Wahlkampf von 2005, hat sie alles auf eine Karte gesetzt, auf ein neoliberales Bündnis mit der Westerwelle-FDP – und verloren. Sie wurde trotzdem Kanzlerin, aber die einer großen Koa-lition. Schon vor ihrer Kanzlerschaft hatte sie Wolfgang Schäuble düpiert und ihn vom Amt des Bundespräsidenten ferngehalten: Schäuble wurde trotzdem die große Stütze ihrer ersten drei Kabinette. Sie hat es geschafft, dass stets sie von den Regierungsbündnissen, sei es mit der SPD oder der FDP, profitierte – und ihr jeweiliger Koalitionspartner von den Wählern abgestraft wurde. Die größte Leistung dieser ersten großen Merkel-Koalition war es wohl, dass die Deutschen trotz der globalen Finanzkrise nicht in Krisenstimmung gerieten. In der Coronakrise gelang ihr das nicht mehr so gut.
Webgestützte Moderne
Am Krisenmanagement damals, in der Finanzkrise, hatte der damalige SPD-Finanzminister Peer Steinbrück wesentlichen Anteil. Aber belohnt von den Wählern wurde nur Merkel. Die Übertragung des guten Grundgefühls mit Merkel auf ihre Partei, die CDU, hätte nicht so gut funktioniert, wenn Merkel nicht die Kohl-CDU verändert hätte: Sie hat deren Frauen- und Familienpolitik entstaubt, den Konservativismus der Partei gereinigt und die Altväterlichkeit der Christdemokraten beendet. So hat sie die Partei für die Sympathisantinnen und Sympathisanten von SPD und Grünen wählbar gemacht. Das hat Zeit gebraucht – Zeit, die eine unstete öffentliche Stimmung ihren CDU-Nachfolgern nicht gibt. Die öffentliche Zustimmung zu Personen und Parteien, die Abneigung gegen Personen und Parteien wechseln schnell; das ist ein Kennzeichen der webgestützten politischen Moderne. Die Wählerinnen und Wähler werden magnetisch angezogen vom Gewese, das um Themen, Parteien und Personen gemacht wird; sie sind aber auch bald wieder gelangweilt oder deren überdrüssig.
Das Thema, das nicht vergeht
Der Klimawandel freilich gehört nicht zu den Themen, die vergehen. Er wird das Megathema nach Corona sein und bleiben, sein und bleiben müssen. Er wird die Politik der kommenden Jahre und wohl Jahrzehnte prägen. Er ist ein Urthema der Grünen. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat den Grünen am 24. März 2021 mit dem spektakulären Beschluss zum Klimaschutzgesetz Hilfe geleistet. Darin finden sich Sätze, mit denen man ein grünes Regierungsprogramm schreiben könnte. Das haben die Karlsruher Verfassungsrichter natürlich nicht gemacht, um der grünen Partei einen Gefallen zu tun. Sie haben es getan, weil es ein kollektives ökologisches Hintergrundbewusstsein gibt, das auch in der Verfassung und in der Verfassungsinterpretation seinen Ausdruck findet – die Sorge um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Der Green Deal der Europäischen Union ist der respektable Versuch, das Prinzip Verantwortung, das der Philosoph Hans Jonas schon vor Jahrzehnten propagiert hat, in praktische Politik zu übersetzen. Wie wichtig das ist, zeigt die Flutkatastrophe vom Juli 2021. Sie war nicht einfach Folge eines heftigen Unwetters, wie sie leider im Sommer immer wieder vorkommen. Auch diese Flutkatastrophe war unter anderem Folge des Klimawandels. Dagegen helfen keine Sandsäcke. Was hilft? Es hilft der ökologische Umbau der Gesellschaft; das ist nicht einfach nur die Befriedigung eines volatilen Zeitgeists – es geht um die nachhaltige Antwort auf eine globale und umfassende Bedrohung. Es geht um eine neue Ethik, es geht darum, diese neue Ethik gesetzgeberisch zu begleiten. Dieses Vorhaben der Europäischen Union ist gut und mutig und zukunftsweisend; aber es umzusetzen, wird »verdammt hart«, wie Frans Timmermans, der EU-Kommissar für Klimaschutz, prognostiziert hat, wahrscheinlich wohl wissend, dass einiges utopisch ist. Doch es geht darum, Unheil abzuwenden.
Es ist beileibe nicht so, dass es spektakuläre Initiativen nur in Brüssel gibt. Es gibt sie auch anderswo, in Lateinamerika zum Beispiel. Die obersten Gerichte dort haben in aufsehenerregenden Entscheidungen unter anderem dem Fluss Atrato und dem kolumbianischen Amazonasgebiet eine eigene Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Die höchsten Richter in Kolumbien haben also die Natur, sie haben die Ökosysteme zum Rechtssubjekt erklärt. Könnten die Meere klagen, sie würden klagen über ihre Verschmutzung durch Plastikmüll, darüber, dass sie den Dreck nicht mehr schlucken können. Die Ökosysteme, die Natur als Rechtssubjekt. Es ist dies mehr als ein juristischer Kniff. Die neue Rechtsprechung von höchsten Richtern zeigt an, dass die herrschende Ethik im Begriff ist, sich zu wandeln.
Die Natur ist Subjekt mit eigenen Rechten
Die Natur ist da nicht mehr nur ein Objekt, das geschützt werden muss, sondern sie hat eigene Rechte, die sie – vertreten durch Menschen und Organisationen – einfordern kann. Das ist ein revolutionärer Ansatz, der das gewohnte Verfassungsdenken sprengt, in dem die Natur der rechtlichen Beherrschung durch die Rechtssubjekte und ihre Kapitalinteressen unterworfen ist. Die lateinamerikanische Rechtsprechung versucht, die Natur aus diesem Beherrschungsmechanismus zu befreien. Sie befreit die Natur aus der Einordnung als ein dem Menschen dienendes Objekt, sie macht sie zum Subjekt eigener Rechte. Darum geht es – nicht darum, dass die Natur absolut nicht mehr den Menschen dient und dienen soll. Menschen sind als Menschen darauf angewiesen, die natürlichen Ressourcen zu nutzen und auch zu verbrauchen. Aber das hat spätestens dort seine Grenze, wo Ausbeutung und Schädigung beginnen. Das ist gemeint, wenn es im ersten Kapitel der Bibel heißt: »Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan …« (Genesis 1,28). Dieser Satz aus Zeiten, in denen der Mensch die Beute von wilden Tieren und den Kräften der Natur wurde, erlaubte noch nie das rücksichtslose Zertrampeln von Lebensgrundlagen; heute, im Anthropozän, da der Mensch zur Bedrohung von Tier und Natur wird, erst recht nicht.
Eine politische Heimat für neues Denken und neues Tun
Es geht um neues Denken und neues Tun. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist keine Frage von gut oder böse, von fair oder unfair. Es ist dies eine Frage der Selbsterhaltung. Dazu gehören auch ungewöhnliche, spektakuläre rechtliche Ideen. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen braucht eine juristische Promotion – und eine politische Heimat.
Die Grünen bieten sich seit jeher als diese Heimat an. Werden sie so, angesichts der gestiegenen und umfassend erkannten Relevanz des Themas, doch noch zur Volkspartei – trotz ihrer bei der Bundestagswahl 2021 gestutzten hohen Erwartungen? Anders als einst die FDP, die zur Bundestagswahl 2002 mit diesem Anspruch, mit einem Wahlziel von 18 Prozent der Stimmen und mit dem Parteichef Guido Westerwelle als Kanzlerkandidat antrat, kokettiert die grüne Partei nicht mit einem solchen Anspruch. Das ist auch besser so. Volkspartei – das wäre ein Rückgriff, kein Vorgriff. Volkspartei ist ein nostalgischer Begriff, ein Attribut aus der bundesrepublikanischen Vergangenheit, aus der Zeit der VW-Käfer. Gewiss: Die Volksparteien von einst, CDU, CSU und SPD, nutzen ihn wie einen Adelstitel. Aber der Adel ist abgeschafft. Die Gesellschaft der Wirtschaftswunderzeit gibt es nicht mehr. Es war eine Gesellschaft mit ausgeprägten Loyalitäten zu Gewerkschaften oder Kirchen, welche wiederum in enger Beziehung zur SPD oder zur Union standen. Diese Klassen- und Kirchenmilieus sind zerfallen. Die alten Bindungskräfte sind schwach geworden. Die SPD hat das schmerzhaft erfahren, die CDU erfährt es gerade. Und beide sind, wie die Grünen auch, zu akademisiert und in Leitungsfunktionen zu elitär.
Volksparteien heute
Das Parteiensystem, dem die alten Volksparteien entstammen, sah so aus wie die klassische Kleinfamilie: CDU/CSU und SPD waren quasi Vater und Mutter der Republik, für das Wohl und Wehe der Familie verantwortlich. Und die Kinder (also die FDP, später auch die Grünen, noch später die Linken) kümmerten sich um ihre Hobbys und um ihre Freundinnen und Freunde. Dieses Familienbild stimmt nicht mehr. Die einst kleineren Parteien sind mittlere Parteien geworden; zu ihnen ist noch die AfD gekommen. Das einstige Drei- und dann Vierparteienland Bundesrepublik hat sich in ein Sechsparteienland gewandelt; neue Parteien wie die der »Freien Wähler« versuchen noch dazuzustoßen; diese Partei schaffte es zuletzt nicht in den Bundestag, erzielte aber in Bayern immerhin 7,5 Prozent. Sie wirbt um »bürgerliche Wähler«, die eine Alternative zur Union und zur AfD suchen. »Bürgerlich« freilich ist als Begriff so antiquiert wie der der Volkspartei und hat an Zuordnungsgehalt verloren; Bürger sind auch die Wähler anderer Parteien; bürgerlich sind sowohl die, die beim Discounter, als auch die, die im Naturkostladen einkaufen. Die Grünen versuchen, »neue« Bürgerlichkeit für sich zu reklamieren, wenn sie nach Wahlsiegen sagen, sie hätten »in der bürgerlichen Mitte gewonnen«. Dieses neue grüne Modewort soll die letzten Ängste vor den Grünen nehmen. So versöhnlich es daherkommt, so nichtssagend ist es geworden.
Der Trend geht weg von den bisherigen Großparteien; er geht auch weg von den kleinen Parteien; er geht hin zu mittelgroßen Parteien – die Wählerinnen und Wähler in allen Schichten der Gesellschaft finden. Insofern könnte man heute jede Partei, die ausreichend Zuspruch findet, als Volkspartei bezeichnen. Der Begriff taugt aber nicht mehr; er hindert nur die Ex-Volksparteien daran, sich neu zu finden. Er ist nostalgischer Ballast. Der Zeitgeist hilft den Grünen; ob sie das machtpolitisch nutzen können, ist eine Frage des parteipolitischen Geschicks. Die Grünen sind eine Mittelpartei mit mehr als mittleren Chancen. Sie sind die Blutgruppe Null der Politik. Die Zukunft heißt Klima; das Klima ist schlecht, und das ist prinzipiell gut für die Grünen. Sie haben mit dem Klimaschutz ein an alle Parteien anschlussfähiges Ziel.
Die Demokratie als Ort der Mühsal
Himmel, Hölle, Fegefeuer. Die deutsche Politik steckt im Fegefeuer, das zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Gewiss: Es ist ein Ort der Mühsal und Qual. Es ist eine Intermediärzone, ein Zwischenzustand, der von langer Dauer sein kann. Das Fegefeuer war und ist ein Ort der Besserung und der Läuterung. Es ist der richtige Ort, das Notwendige, also das Notwendende zu tun. Im Mittelalter war dieser Ort im Jenseits nach dem Tod angesiedelt. Heute ist er nicht mehr im Jenseits, aber jenseits einer Wirklichkeit, die auf die Illusion des »weiter so« setzt. Heute ist er im Diesseits. Wir leben in einer Zeit, in der sich mit dem Klimawandel die Hölle auf Erden ankündigt; es kann aber auch gelingen, am Heilwerden der Welt zu arbeiten. Die deutsche Politik kann ihren Teil zum Heilwerden beitragen.
Die Demokratie ist eine anstrengende Angelegenheit, sie ist, wie das Fegefeuer, ein Ort der Mühsal. Sie ist das Fegefeuer als Staatsform. Deswegen hat auch sie zuweilen und leider zunehmend einen schlechten Ruf. Aber sie ist der Platz zwischen Utopie und Tyrannei, der Ort, um die Welt zu entchaotisieren. Das Prinzip Verantwortung bewährt sich im Fegefeuer. Es findet den Pfad, trotz aller Wendungen des Zeitgeists, zur neuen Ethik für die technologische und digitale Zivilisation. Diese neue Ethik erfordert eine neue Wachsamkeit, einen neuen Begriff von Heimat, ein neues Verständnis von Sicherheit. Sie prägt eine neue Politik, eine neue Gesellschaft, eine neue Arbeitswelt, ein neues Recht. Die Kirche hat das Fegefeuer jahrhunderte-lang gepredigt. Jetzt braucht sie das Fegefeuer selbst, die katholische Kirche zumal. Sie braucht Läuterung, sie braucht Erneuerung. Dieses Buch ist der Versuch einer Pfadfinderei. Es versucht, mit Kolumnen und Kommentaren einen Pfad zu markieren.
Heribert Prantl, im Sommer 2021
… und mit großem Dank an das wunderbare Textarchiv der Süddeutschen Zeitung.
EINE NEUE WACHSAMKEIT
Himmel, Hölle, Fegefeuer, Tod und Gericht – ihr wisst nicht, wann sie kommen; der jüngste Tag werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, glaubte man einst und riet deshalb: Seid wachsam!
Heute heißt es dagegen: Seid achtsam! Die buddhistische Haltung der »Achtsamkeit« wurde von der Psychologie zur Linderung von Traumata, Angst und Schmerzen entdeckt. Sie lehrt, sich selbst und die Welt bewusst und freundlich wahrzunehmen, im Hier und Jetzt und ohne Wertung. Das ist gut. Seit Längerem ist die »Achtsamkeit« jedoch zum Allzwecktool geworden im Textbausteinkasten von politischen Redenschreibern, im Trainingsprogramm von Beratern und in der Werkzeugkiste jedwedes Seelenklempners. Zu ihr gesellt sich mit Vorliebe die »Nachhaltigkeit«. Jüngst ist eine Krimireihe auf den Bestsellerlisten, die den Achtsamkeitshype pa-rodistisch aufnimmt und empfiehlt: Achtsam morden.
»Achtsamkeit« ist zum wabernden Wortschleim geworden, der aus dem Inneren kommt, sich warm anfühlt und die Debatten verbal verklebt. Es sind die Debatten über die Klimapolitik, über die notwendige Transformation des Rechts, der Wirtschaft und des alltäglichen Lebens als globale Überlebensstrategie. Es sind die Debatten über die Selbstbestimmung, über das eigene Leben bei Geburt, Krankheit und Tod. Hier sollte der Rat weiter heißen: Seid wachsam! Wachsamkeit, die sich zusammentut mit Respekt und Behutsamkeit, ist die innere Haltung, die uns guttun wird, wenn es darangeht, das Recht neu zu formulieren, die Wirtschaft ökologisch und sozialverträglich umzubauen und getrost leben und sterben zu können.
Das All gehört allen
Warum man dem Kapitalismus im Himmel und auf Erden entgegentreten muss
Es hat sehr lange gedauert, bis Justiz und Gesellschaft gelernt haben, dass rasende Prahlsucht ein Verbrechen sein kann. Diese Erkenntnis ist aber noch nicht sehr weit gediehen, sie beschränkt sich auf den Straßenverkehr. Für Wirtschaft und Politik gilt sie noch nicht – im Gegenteil, dort wird sie gepriesen. Wenn alte Männer, weil sie unendlich viel Geld haben, sich im Weltraum ein Raketenrennen liefern, werden sie gefeiert. Wenn junge Männer, weil sie unendlich viel Testosteron haben, sich ein Autorennen liefern, werden sie bestraft. Die einen gelten als Visionäre, die anderen als Deppen. Letztere werden als Mörder bestraft. Die anderen werden als Wirtschaftsgenies belobigt – obwohl (oder gerade weil) sie einen destruktiven Kapitalismus in den Weltraum tragen. Gefährliche Angeber sind sie aber alle.
Wenn junge Leute in ihren aufgemotzten Autos mit irrwitziger Geschwindigkeit über den Ku’damm oder den Isarring rasen, wenn sie rote Ampeln überfahren und Menschen dabei zu Tode kommen – dann ist das nicht einfach nur, wie das lange gesehen wurde, eine Fahrlässigkeit mit tödlichem Ausgang. Es ist Mord mit bedingtem Vorsatz. Die Tatbestandsmerkmale sind niedrige Beweggründe und Heimtücke, und das rasende Auto ist dabei ein gefährliches Werkzeug. Die Berliner Strafrichter sagten in ihrem Urteil gegen die Ku’damm-Raser: selbstverliebt und rücksichtslos seien sie gewesen, ihre Fahrzeuge hätten sie förmlich vergöttert. Hochmütige Unvernunft, rasende Prahlerei, Hybris und Machtrausch: Diese Mischung ist tödlich, nicht nur auf dem Ku’damm.
Beihilfe zum Irrsinn
Wenn sich Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk ins All schießen lassen, weil sie sich das als Milliardäre leisten können und sie auf diese Weise Werbung machen für galaktische Geschäftsideen aller Art, dann kann man in Wirtschaftsmagazinen lesen: Das sei nicht nur ein Kräfte-messen der Milliardäre, das sei nicht nur ein Kick für Hochprivilegierte; das sei die »Zukunft der Ökonomie«. Solche Lobhudeleien sind Beihilfe zum Irrsinn. Es gilt auch hier und hier erst recht der Satz von Papst Franziskus: »Diese Wirtschaft tötet«. Sie macht den Weltraum zum Kolonisationsgebiet von Kommerzinteressen, sie bemächtigt sich des Himmels als Ressource. Der Großkapitalist Jeff Bezos will mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin den Mars kolonisieren und in weniger als zehn Jahren eine Million Menschen auf den Mars befördern. Die Menschheit soll dort, sagt er, eine gute Zukunft haben. Wäre es nicht gut, wenn die Menschheit erst einmal auf ihrem Planeten eine gute Zukunft hätte?
Die Ausbeutung des Weltraums
Elon Musk betreibt das Raumfahrtunternehmen SpaceX und schießt Hunderte von Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen – bisher sind es neunhundert; insgesamt zwölftausend Satelliten sind angeblich bis zum Jahr 2027 genehmigt, Anträge für weitere dreißigtausend Satelliten sollen schon vorliegen. Die Ausbeutung der Erde und die Zerstörung der Natur der Erde, die jetzt mit Klimaschutzabkommen und Green Deals gestoppt werden sollen, wird von Musk und Co im Weltraum ungeniert fortgesetzt. Der Himmel, der Ressource für die gesamte Menschheit sein soll, wird kommerzialisiert, um weltweit Internetzugänge anbieten zu können; 99 Euro soll der Anschluss pro Monat kosten, plus einmalige Kosten von 499 Euro für das Starterset.
Die Satelliten, die dieses Geschäft ermöglichen, kann man dann wie eine Lichterkette am Himmel bestaunen, weil die Satelliten bei der Umrundung der Erde immer wieder von der Sonne angestrahlt werden. Man wird in Zukunft womöglich mehr Satelliten als Sterne am Nachthimmel sehen. Das ist der Triumph des orbitalen Kapitalismus. Die Lebensdauer der Satelliten ist nicht sehr hoch. Die Erdumlaufbahn wird mit aktiven und mit ausgeglühten Satelliten vermüllt. Der Orbit als Müllhalde? Und: Sollte der Himmel nicht Allgemeingut sein? Sollte das All nicht allen gehören? Der Himmel auf Erden ist eine schöne Vision. Die Erde im Himmel ist die Hölle.
Die Meere als Mülldeponie
Würde der Plastikmüll in den Ozeanen leuchten – Jeff Bezos hätte ihn von oben, aus dem All, sehen können. Ob er leuchtende Augen bekommen hätte? Er hätte sich fragen können, wie hoch sein eigener Anteil ist, also der Anteil von Amazon. Der Amazon-Gründer muss sich aber nicht in den Weltraum schießen lassen, um die Antwort zu finden. Die Antwort steht, zum Beispiel, in den Berichten der Meeresschutzorganisation Oceana: Der Plastikmüll allein aus den Verpackungen des Internethandels wiegt demnach, aufs Jahr zusammengerechnet, neunhundert Millionen Kilogramm. Der Anteil von Amazon macht, sagt Oceana, 211 Millionen Kilogramm jährlich aus. Jeff Bezos’ Milliarden-Reichtum ist also mit einigen Millionen Tonnen Luftkissen, Folien und Schaumstoffchips gepolstert. Kurz vor seinem Weltraumflug konnte man lesen, Jeff Bezos sei der reichste Mann aller Zeiten: Er habe sein Privatvermögen an einem einzigen Tag im Juli 2021 um 8,4 Milliarden Dollar steigern können. In Interviews hat Jeff Bezos erklärt, im Weltraum und mit dem privaten Tourismus, für den er mit seinem Flug geworben hat, sehe er Lösungswege für die Probleme der Erde. Bezos hat sich freilich nicht näher darüber ausgelassen, wie zum Beispiel, die Lösung der Plastikprobleme aussehen könnte. Sein Amazon-Konzern kritisiert stattdessen die Zahlen und Berechnungsmethoden der Meeresschutzorganisation Oceana – und verweist beschwichtigend darauf, dass man doch das Gewicht der Versandpackungen »schon um mehr als ein Drittel reduziert« habe.
Neun Milliarden Tonnen Kunststoff
Jeff Bezos’ Konkurrent um Weltraumruhm und kommerzielle Geschäfte im All ist der britische Milliardär Richard Branson. Er kam mit seinem Weltraumflug am 11. Juli 2021 dem Konkurrenten Bezos um ein paar Tage zuvor. Branson ist um einiges älter als Bezos, er ist 1950 geboren. In diese Zeit fällt der Anfang der Massenproduktion synthetischer Materialien. Die umfassende Verwendung von Plastik begann mit der Entdeckung, dass sich ein Abfallprodukt der chemischen Industrie für die Produktion des Kunststoffs PVC eignet. Seit Anfang der 1950er-Jahre wurden weltweit neun Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt; über 75 Prozent sind heute Müll. Die Heinrich-Böll-Stiftung fasst die Situation so zusammen: »Bis heute ist kein Weg gefunden, damit so umzugehen, dass er (der Müll) keine Probleme verursacht«. Pro Jahr werden weltweit vierhundert Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Den größten Teil davon machen Einwegprodukte und Verpackun-gen aus. Viele Produkte des täglichen Bedarfs werden nur einmal und meist auch nur kurz genutzt, bevor sie auf dem Müll landen. Beinahe die Hälfte aller Erzeugnisse ist nach weniger als einem Monat Abfall.
Plastik ist die Pest der Meere
Pro Minute gelangt Plastik in der Größe einer Müllwagenladung ins Wasser. Die Meere sind zur globalen Deponie geworden. 2050 wird der Kunststoffmüll in den Ozeanen mehr wiegen als alle Fische zusammen. Nach Schätzungen der Umweltorganisation WWF kommen auf einen Qua-dratkilometer Meer bis zu 46 000 Teile Plastikmüll. Auf dem Boden der Nordsee wurden elf Kilo Müll pro Quadratkilometer ermittelt, hauptsächlich Plastik. Viele Kunststoffe enthalten gesundheitsschädliche Substanzen, die erst im Meer richtig freigesetzt werden. Eine Million Seevögel verenden pro Jahr, weil sie schwimmendes Plastik fressen. Hunderttausend Meeressäuger werden durch Plastik jährlich getötet. Die Tiere ersticken, erleiden tödliche Verstopfungen oder verhungern bei vollem Bauch. Es werden Wale gefunden, deren Mägen mit Plastik gefüllt sind. Plastik ist die Pest der Meere. Vor zwei Jahren hat die SZ der Plastikkrise das »Buch Zwei« gewidmet; dort findet sich eine Statistik darüber, wer am meisten Plastik exportiert: Es sind die USA, gefolgt von Deutschland.
Der junge Niederländer Boyan Slat hat ein Projekt namens The Ocean Cleanup ins Werk gesetzt; als 19-Jähriger brach er sein Raumfahrt-Ingenieurstudium ab, um die Meere vom Plastikmüll zu befreien. Damals hatte er einen Tauchurlaub gemacht, der ihm die Augen öffnete: Er sah unter Wasser keine schimmernden Fischschwärme und rosige Korallen, sondern tauchte durch vergammelte Flip-Flops und zerdrückte Cola-Flaschen. Auf der Crowd-funding-Plattform Kickstarter sammelte er Geld ein, ließ forschen, entwickelte zusammen mit der Technischen Universität Delft. Müllsammelkonzepte: Fangarme und Treibnetze sollen eine künstliche Bucht bilden, wie riesige Filter arbeiten und Plastik einsammeln, aber Fische passieren lassen. Das von den Müllsaugern gesammelte Plastik soll wiederverwertet werden. Das erste Wiederverwertungsprodukt von The Ocean Cleanup sind Sonnenbrillen. Aber: Nicht alle Meeresschutzexperten und Meeresbiologen sind begeistert. Es lasse sich, heißt es, überhaupt nicht vermeiden, dass man auch große Mengen an Biomasse abschöpft, die eigentlich in die Flüsse und das Meer gehört.
Sea Cleaners
Aber was tun? Gar nichts, weil ohnehin wenig auszurichten ist? Im Spiegel war im August 2020 von einer ernüchternden Hochrechnung eines Forscherteams zu lesen: Selbst wenn zweihundert Müllsammler à la Ocean Cleanup hundertdreißig Jahre lang rund um die Uhr auf den Weltmeeren unterwegs wären, könnten sie nur rund 45 000 Tonnen Müll von der Wasseroberfläche abschöpfen – fünf Prozent der Mengen, die auf den Weltmeeren zirkulieren. Effizienter, sagen diese Forscher, wäre es da, den Müll schon in den Flüssen abzufangen, bevor er ins Meer gelangt. Auch daran arbeitet Ocean Cleanup. Das Unternehmen hat ein Reinigungssys-tem für Fließgewässer entwickelt; Interceptor heißt eine in Flüssen verankerbare Sammelanlage, eine Art schwimmendes Fließband. Nach Angaben von The Ocean Cleanup sind tausend Flüsse, also etwa ein Prozent aller Flüsse, für etwa achtzig Prozent des Plastikeintrags verantwortlich – und sollen innerhalb von fünf Jahren mit Interceptors ausgestattet werden. Derzeit arbeiten neunzig Mitarbeiter für die Non-Profit-Organisation, die meisten am Hauptsitz Rotterdam. Ein anderes Meeresrettungsprojekt ist das des Extremseglers Yvan Bourgnon; er gründete 2016 die Umweltschutzorganisation The SeaCleaners. Ihr großes Projekt ist der »Manta«: ein 56 Meter langes und 26 Meter breites Segelschiff von der Anmutung eines Rochens, das nahezu emissionsfrei über das Wasser gleiten und Plastikmüll herausfischen soll. Der »Manta« wird den Müll nicht nur sammeln, sondern gewinnt direkt an Bord Energie, die wiederum das Schiff antreiben wird.
Was mehr bringt
Wenn man von Bezos, Branson und Musk Rettung dieser Art und umfangreiche Non-Profit-Projekte erwartet, kann man wahrscheinlich lange warten. Die Namen stehen für das Problem und nicht für die Lösung. Bevor man sich der Illusion hingibt, die drei reichen Weltraumsurfer könnten ihr weiches Herz für die Meere entdecken und ihre Weltraumanzüge gegen Spendierhosen austauschen, konzentriert man sich besser auf den Mikroeinfluss der vielen Einzelnen. Das bringt mehr gegen die Verseuchung mit Mikroplastik, und das verlangt: Müll vermeiden; politischen Druck machen, um den Müllexport zu unterbinden; informieren, informieren, informieren – und das Ganze dann noch mal von vorn und nicht aufhören damit. Die künftige Bundesregierung kann ja damit anfangen.
Fast zeitgleich mit den Meldungen über die Raketen-flüge von Richard Branson und Jeff Bezos wurde im Juli 2021 der neue Welternährungsbericht veröffentlicht; er fand nicht besonders viel Aufmerksamkeit. 811 Millionen Menschen hungern, sagt diese Statistik, es sind dies 161 Millionen mehr als im Jahr zuvor, im Jahr 2019. 811 Millionen Menschen sind unterernährt, also etwa ein Zehntel der globalen Weltbevölkerung; allein die sechs Nullen der Zahl stehen für Hunderttausende Menschen. Es hungern 811 Millionen und, wie man so sagt, ein paar Zerquetschte; es hungert ein Zehntel aller Menschen. Ein Zehntel: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun – und du bist die Zehn, du musst vergeh’n. In Afrika hat der Hunger am meisten zugenommen, die Unterernährungsquote dort liegt bei 21 Prozent und damit doppelt so hoch wie überall sonst. Wie kann das sein in einer Welt, in der es mehr als genug Nahrung gibt? Akut ist auch und vor allem Corona schuld. Die Pandemie raubt den Ärmsten ihre Jobs und verteuert die Lebensmittel.
Der Kapitalismus krallt sich den Himmel
Vom UN-Ziel der Agenda 2030, bis zu diesem Jahr den Hunger weltweit zu besiegen, ist die Realität immer weiter weg. Die Kollegin Christiane Grefe von der Zeit, eine kluge Expertin für Ökologie und Globalisierung, nennt zur Bekämpfung des Hungers drei Prioritäten. Erstens müssen die Wohlhabenden aufhören zu essen, als gäbe es kein Morgen. Zweitens müssen die Hilfsorganisationen mithilfe fester Budgets gestärkt werden; sie sollen nicht bei jeder Krise betteln müssen. Und drittens muss Schluss damit sein, weltweit den unterschiedlichen Landschaften und Kulturen die immer gleichen Gewächse und industriellen Methoden zu diktieren; es braucht eine neue Vielfalt an Getreiden, Früchten und Bäumen; diese Vielfalt kann auch dem Klimawandel besser trotzen. Und viertens, so füge ich hinzu, muss es verhindert werden, dass ein de-struktiver und tödlicher Kapitalismus sich auch noch in den Himmel krallt.
Sechs Milliarden Dollar
David Beasley, der Direktor des Welternährungsprogramms, hat Ende Juni 2021 einen Tweet verbreitet, in dem er zum wiederholten Male die Milliardäre dazu aufrief, sich zu melden, um die sechs Milliarden US-Dollar aufzubringen, die in diesem Jahr zusätzlich benötigt werden, um der Hungersnot entgegenzuwirken und weitere Hungertote zu vermeiden. Er schrieb an Branson, Musk und Bezos: »Ich bin so gespannt zu sehen, wer es zuerst in den Weltraum schafft! Aber ich würde lieber sehen, dass Sie sich zusammenschließen, um die 41 Millionen Menschen zu retten, die dieses Jahr auf der Erde verhungern werden! Es braucht dafür nur sechs Milliarden Dollar. Wir können das schnell lösen.«
Von sechs Milliarden war bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 auch die Rede, um alle Schäden zu beseitigen. Es geht natürlich nicht einfach nur darum, dass die ganz Reichen jetzt ganz große Spenden machen. Es geht darum, mit einer fundamentalen Umverteilungspolitik zu beginnen. Die Klimapolitik gehört dazu; sie ist, wenn es gut geht, der Treiber einer klugen Umverteilungspolitik. Nicht die Satelliten von Herrn Musk gehören in die Umlaufbahn. In die Umlaufbahn gehört eine Politik, die Natur und Lebensgrundlagen achtet und die Armut bekämpft.
Die Natur als Rechtsperson
Warum die Grundrechte auch für die Ökosysteme gelten sollten
Es war bei der ersten juristischen Staatsprüfung, mündlicher Teil. Prüfer war Professor Karl Firsching – ein schlaksiger alter Herr, Koryphäe des Internationalen Privatrechts, ehemaliger Handballspieler, wie man sich erzählte; und das war durchaus glaubhaft, weil er den »Schönfelder«, also das krass dicke und elend schwere Gesetzbuch, so am langen Arm schwang, als wolle er daraus nicht in der Vorlesung zitieren, sondern damit eine neue Wurftechnik ausprobieren. Dieser Herr also warf dem Prüfling zum Auftakt der Staatsprüfung eine scheinbar ganz leichte Frage zu: »Stellen Sie sich vor, Herr Prantl, Sie stehen auf einem hohen Turm und schauen runter. Was sehen Sie da?«
Die Ordnung der Welt
Mit der in der Juristerei immer richtigen Antwort »Das kommt darauf an …« gab er sich nicht zufrieden, auch nicht mit der Ergänzung »… wo der Turm steht«. Er schüttelte bei jedweder malerischen Beschreibung von Stadt und Landschaft unzufrieden den Kopf. »Juristen«, so sagte er dann, »malen nicht, sondern sie ordnen die Welt, sie teilen sie ein.« Diese grundlegende Einteilung war das Ziel seiner Frage. Juristisch betrachtet sehen sie nämlich, von wo immer sie auch herunterschauen, stets dies: »Rechtssubjekte und Rechtsobjekte«. Nun ist es allerdings so, dass man nicht alle Rechtssubjekte sehen kann: Sie sind nämlich nicht nur die natürlichen Personen, also die Menschen; Rechtssubjekte sind auch die juristischen Personen und Gesellschaften, Vermögens- und Kapitalmassen, die nicht auf zwei Beinen durch die Gegend laufen. Aber nur sie, die natürlichen und die juristischen Personen, sind Rechtssubjekte, nur sie können Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie herrschen über alles andere, also über die Rechtsobjekte. Die Rechtsobjekte sind die Güter, die der rechtlichen Beherrschung durch die Rechtssubjekte unterworfen sind: Häuser und Hunde, Autos und Straßen, Shoppingmalls, Baumärkte und Fabriken, Wiese, Wald und Wild, Flüsse und Fußgängerzonen. Die Rechtssubjekte sind also die Spieler der Rechtsordnung. Rechtsobjekte sind die Gegenstände, mit denen die Spieler spielen und handeln, die sie nutzen und benutzen, die sie vermieten, verkaufen und erwerben – mit denen sie also Geschäfte machen.
Den Amazonas befreien, den Rhein auch
Rechtssubjekte und Rechtsobjekte – mit dieser Einteilung beginnt das Einmaleins des Rechts. Eine spektakuläre von Gerichten in Lateinamerika entwickelte Rechtsprechung verändert dieses Einmaleins. Diese revolutionäre Rechtsprechung will die Natur, sie will das Ökosystem aus diesem Beherrschungsmechanismus befreien. Die höchsten Richter in Kolumbien haben daher dem Fluss Atrato und dem Amazonasgebiet eine eigene Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Die Natur ist also nicht mehr ein Objekt, das geschützt werden muss, sondern sie hat eigene Rechte, die sie, vertreten durch Menschen und Organisationen, vor Gericht oder durch das Gericht einfordern kann. Die Natur wird zum klageberechtigten Subjekt. Sie wird aus der Einordnung als ein dem Menschen dienendes Objekt befreit. Sie hat einen Anspruch auf Regeneration, Pflege und Erhaltung. Die Böden in den Flutgebieten des Rheins könnten dann gegen ihre Versiegelung klagen und die Wälder gegen ihre Abholzung. Das erinnert an den letzten Marsch der Ents in »Herr der Ringe«, das klingt schwärmerisch, das klingt esoterisch. Ist das der Einzug der verwelkenden blauen Blume der Romantik in die Juristerei? Also, in Abwandlung des alten Wandervogellieds »Wir wollen zu Land ausfahren«: … Es rauschen die Bäume, es klaget der Fluss?
Das ökologische Existenzminimum
Ob der Kandidat damals mit solchen Darlegungen die Staatsprüfung bestanden hätte, ist wenig wahrscheinlich. Es hätte da wohl auch der Hinweis darauf wenig geholfen, dass so ein neuer juristischer Blick in Lateinamerika auch dem Schutz der indigenen Minderheiten dient, die traditio-nell in enger Verbundenheit mit der Natur leben. Gleichwohl: Angesichts der handgreiflichen und in der Flutkatastrophe im Sommer 2021 tödlichen Auswirkungen des Klimawandels ist es Zeit, den Natur-, Umwelt- und den Klimaschutz neu zu denken. Womöglich reicht ja da der Green Deal hinten und vorne nicht, den soeben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel vorgestellt hat, vielleicht formuliert er nicht mehr als das ökologische Existenzminimum. Wie wäre es mit einer Grundgesetzformulierung, die der Natur ein Recht auf Existenz gibt und so lautet: »Die Grundrechte gelten auch für die Natur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.«? Wäre das die fulminante Fortschreibung des fulminanten Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts? Ein Eigenrecht der Natur!
Ein neues Naturrecht
Gegenwärtig ist es in Deutschland und der EU so, dass Klimaklagen, auch von Verbänden, nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn ein rechtswidriger Eingriff in Rechte der Rechtssubjekte, also in ihr Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit oder ihr Eigentum, nachzuweisen ist. Die Klagebefugnis scheint, so sagt es eine neue Ausarbeitung der Konrad-Adenauer-Stiftung über die »Natur als Rechtssubjekt«, nach wie vor »an die schädlichen Auswirkungen von Umweltbeeinträchtigungen auf den Menschen geknüpft zu sein«. Ist das aber nicht viel zu eng, zumal dieser Nachweis oft nur sehr schwer zu führen ist? Als 1986 eine Giftwelle, die vom Pharmakonzern Sandoz ausging, den Rhein hinunterschwamm und Millionen Fische starben, wurden nur die Schäden ersetzt, die »einem Anderen«, also einem geschädigten Rechtssubjekt, entstanden waren. Soll das so bleiben?
Nennen wir das Werben für ein »Eigenrecht der Natur« einen geschickten juristischen Perspektivwechsel, der die Natur davon befreit, den Kapitalinteressen zu dienen. Darum geht es – nicht darum, dass die Natur absolut nicht mehr den Menschen dient und dienen soll. Menschen sind als Menschen darauf angewiesen, die natürlichen Ressourcen zu nutzen. Aber das hat spätestens dort seine Grenze, wo Ausbeutung und Schädigung beginnen. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist erst spät ins Grundgesetz aufgenommen worden, er war ein Ergebnis der Beratungen in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern nach der Deutschen Einheit. Dieser Schutz ist noch unvollkommen geregelt. Er braucht eine juristische Promotion. Das ist das neue Naturrecht.
Hoffnung lässt die Welt nicht zum Teufel geh’n
Wie das Leben vom Eis befreit werden muss
Das berühmteste Frühlingsgedicht hat Goethe geschrieben. Es heißt Osterspaziergang, es beginnt mit der Zeile »Vom Eise befreit«; und es handelt vom erwachenden Leben, vom bunten Getümmel in der Natur und vom grünenden Hoffnungsglück. Es ist dies ein Gefühl, das sich weder an Ostern 2020 noch an Ostern 2021 einstellen mochte. Der Lockdown war wie ein immerwährender Winter, und die Warnungen davor, dass es noch kälter werden und noch schlimmer kommen könnte, lagen wie Eis auf dem Leben. Das Ostergefühl nach einem Jahr Corona war eine Mischung aus Müdigkeit, Gereiztheit und Ungeduld. Daran war und ist nicht einfach nur das Virus schuld, sondern auch der Umgang damit. Es gibt eine Lust am katastrophischen Denken; sie ist gefährlich, weil sie die Hoffnung zerstört, die nötig ist, um die Krise zu bewältigen. Der politisch-virologisch-publizistische Corona-Verstärkerkreislauf braucht daher einen Umkehrschub. Nach einer langen Coronazeit brauchen die Menschen nicht nur Biontech und Moderna, AstraZeneca und Curevac; sie brauchen auch Hoffnung. Stillstand ist kein Lebensprinzip.
Angela Merkel hat die »Osterruhe«, die sie zum Auftakt der Karwoche 2021 zusammen mit der Ministerpräsidentenkonferenz dem Land verordnet hatte, alsbald wieder zurückgenommen. Sie hat für die Verwirrung, die angerichtet wurde, um Verzeihung gebeten. Die Bitte um Entschuldigung, vor der man Respekt haben konnte, war ein Anlass, auf Hoffnung zu hoffen und darauf, dass Freiheit und Selbstverantwortung, bei aller Vorsicht, wieder den Wert erhalten, der ihnen gebührt. »Das Grundgesetz brauchen wir auch in der nächsten Krise noch, wenn Covid-19 hoffentlich schon längst wieder einfach nur ein Virus ist«: So hat das der Regensburger Gesundheitsrechtler Thorsten Kingreen formuliert. Es war und ist dies eine Werbung dafür, die Grundrechte in Krisenzeiten nicht schwach, sondern stark zu machen – und so gewappnet zu bleiben.
Es gibt eine Egozentrik der Hoffnungslosigkeit
Die Impfstoffe und die Impfungen sind trotz aller Probleme ein Anlass zur Hoffnung. Und selbst wenn es keinen Anlass zur Hoffnung gäbe, so gäbe es doch einen Grund dafür: Da, wo man jede Hoffnung fahren lässt, wird die Welt zur Hölle. »Lasst, die ihr hier eingeht, alle Hoffnung fahren«: Das steht, so beschreibt es Dante in seiner »Göttlichen Komödie«, in dunkler Farbe auf der Pforte zur Hölle. Dante nennt die Pforte zum Inferno den »Eingang zum verlor’nen Volke«. Hoffnung lässt die Welt nicht zum Teufel gehen.
Das ist aber nun kein Plädoyer dafür, Gefahren schönzureden, und auch nicht dafür, Covid-19 zu bagatellisieren. Die Kraft der Hoffnung steckt nicht in einem blinden Optimismus. Die Kraft der Hoffnung sieht die Gefahr; sie verweigert aber Unglück und Unheil den totalen Zugriff. Vielleicht rührte und rührt die grassierende Katastrophenverliebtheit aus der Tatsache, dass sie Quote bringt. Vielleicht folgt sie auch dem Motto: Wer sich keine Hoffnungen macht, wird auch nicht enttäuscht. Es gibt eine Egozentrik der Hoffnungslosigkeit, die fixiert ist auf das eigene Schlamassel, und die Optimismus fast als Beleidigung empfindet. Man könnte sich darüber freuen, dass – bei allen Mängeln, die es gibt – Tests mehr Sicherheit bringen und dass schon viele alte Menschen geimpft sind; aber es werden die Bilder aus Bergamo vom Frühjahr 2020 gezeigt und beschworen. Es gibt eine Schwarzseherei, die jede Zuversicht lächerlich macht. Man kann Zukunftslosigkeit so finster beschreiben, dass die Zukunft vor einem wegläuft. Man kann die Leiden der Zeit immerzu und in allen Facetten betonen und die Indizien des drohenden Untergangs präsentieren. »Greueln« nannte einst der Publizist und Historiker Sebastian Haffner ein solches Schwelgen in den Furchtbarkeiten der Zeit; er beschrieb es drastisch als einen masochistischen und moralischen Selbstmord. Das Katastrophalisieren führt zu Depression und Aggression.
Wie Noah in der Arche
Vielleicht hilft es, sich an den Mythos der Urkatastrophe und den Archetyp der Hoffnung zu erinnern: Noah in der Arche. Die Arche wird in Bilderbüchern oft als buntes Schiff mit allerlei lustigen Tieren gemalt, das auf den Wellenkämmen tanzt – als wäre es eine archaische Kreuzfahrt, gewürzt mit einer Prise Abenteuer. Aber man muss sich die Arche ganz anders vorstellen: als Kasten aus rohem Holz, in dessen dunklem Bauch die Insassen von den Fluten hin und her geworfen werden. Aus heiterem Himmel bricht die Katastrophe herein. Noah und die Seinen überleben, ja. Aber werden sie je wieder festen Boden unter die Füße bekommen? Warten. Ausharren.
Hundertfünfzig Tage im finsteren Bauch der Arche, und das Wasser schwillt an. Hundertfünfzig Tage – das ist eine biblische Zahl, die nicht messen, sondern die Unermesslichkeit des Schreckens ausdrücken will. Sie will sagen: Eine halbe Ewigkeit sind sie in dieser Zwischenwelt zwischen Tod und Leben. Und dann kommt der Tag, an dem der Regen aufhört. Man merkt es ja nicht sofort, wenn man so gefangen ist in der Gefahr. Noch einmal vierzig Tage dauert es, und dann ist der Augenblick da, dass Noah eine Luke öffnet und Ausschau hält. Aber noch ragen nur die Berggipfel aus dem Wasser. Da lässt Noah einen Raben hinaus, der fliegt aus und ein, denn er findet nichts, worauf er sich niederlassen kann. Und Noah lässt dann ebenso vergeblich eine Taube fliegen. Nach weiteren sieben Tagen noch einmal. Und als sie nun zurückkommt, hat sie einen Olivenzweig im Schnabel – das Leben ist wieder da. Diese Geschichte lehrt: Manchmal fühlt man sich verschluckt wie im Bauch der Arche. Man kann dann erwartungslos werden, resignieren, verstummen. Noah öffnet irgendwann die Luke der Arche und lässt eine Taube fliegen. Sie kommt mit der Hoffnung zurück.
Der braune und der grüne Deal
Vom Handel mit der Gerechtigkeit und der Natur
Ein Urteil des Landgerichts Erfurt aus dem Juli 2021 treibt mich um. Es ist ein Urteil, das vom Gericht mit den Angeklagten regelrecht ausgehandelt worden ist; so einen Handel nennt man Deal. So ein Deal ist nichts Neues mehr im Strafprozess, dort wird seit vier Jahrzehnten gedealt: Der Angeklagte gesteht, wenigstens teilweise, und erhält dafür die vereinbarte milde Strafe. Wirtschaftsstraftaten werden seit Langem so verhandelt, mittlerweile auch viele kleine Alltags- und Verkehrssachen. Das geht dann so: »Wenn das Fahrverbot wegfällt, gibt mein Mandant die Geschwindigkeitsüberschreitung zu«, erklärt der Anwalt. Der Richter akzeptiert das und erspart sich viele Stunden Beweisaufnahme. Wenn so in großen Wirtschaftsstrafprozessen verfahren wird, und dort ist das fast die Regel, erspart sich das Gericht Monate, vielleicht Jahre.
Die Risiken des Deals
Mir hat so ein Handel mit der Gerechtigkeit nie gefallen, weil ein Strafgericht kein Handelsgericht ist. Aber das Bundesverfassungsgericht hat diese Dealerei im Gerichtssaal mit höchsten Weihen versehen – und der Gesetzgeber hat den Deal ins Gesetz geschrieben. Es darf also gefeilscht, gekungelt und gepokert, es dürfen das (Teil-)Geständnis und der Deal vom Gericht, vom Staatsanwalt, dem Verteidiger und dem Angeklagten ausgetüftelt werden. Nur die Opfer sind da nicht beteiligt.
So war es auch bei dem Erfurter Urteil, das mich quält. Das Gericht in Erfurt hat freilich nicht irgendeinen Nullachtfünfzehn-Deal ausgehandelt, sondern mit angeklagten Neonazis – mit einer Truppe von gewaltbereiten und gewalttätigen Rechtsextremisten, die ein Dorf in Thüringen eingeschüchtert und terrorisiert und die dort, in Ballstädt, das war der Vorwurf, eine Kirmesgesellschaft überfallen haben. Darf der Staat mit Neonazis dealen? Durfte er die Angeklagten als Belohnung für zuvor ausgehandelte Teilgeständnisse, trotz der gezeigten Brutalität, mit Bewährungsstrafen davonkommen lassen – auch den Hauptangeklagten, trotz seiner einschlägigen Vorstrafen? Bewährungsstrafen für ein, wie das Gericht in der Urteilsbegründung feststellte, »überfallartiges Rollkommando«? Ist so ein brauner Deal ein guter Deal? Das Gericht reklamiert das Urteil als Erfolg für den Rechtsstaat. Einige der Angeklagten hätten sonst, ohne das Teilgeständnis, wegen Beweisschwierigkeiten freigesprochen werden müssen.