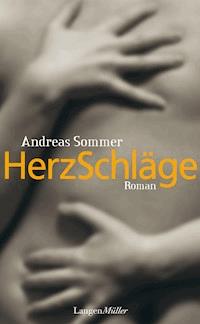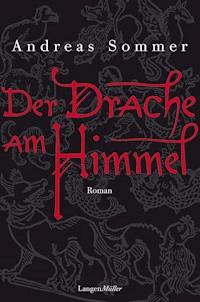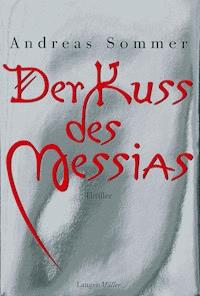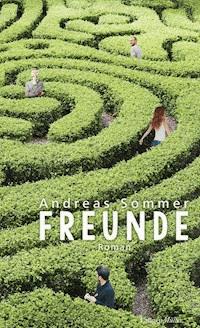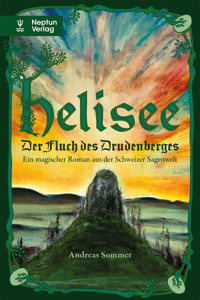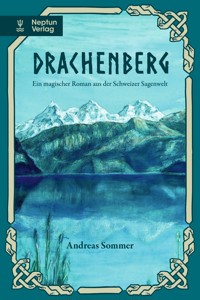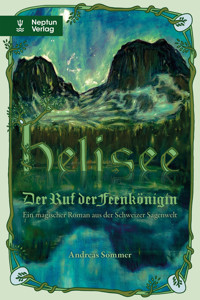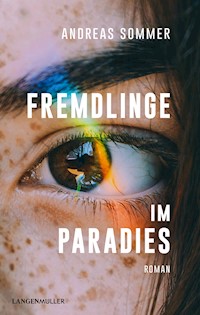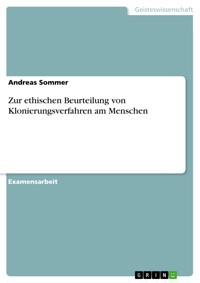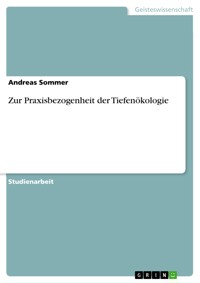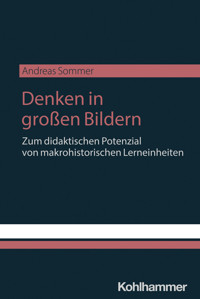
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben gegenwärtig im "Anthropozän", das uns als Polykrise gesamtgesellschaftlich herausfordert. Es bedarf übergreifender Perspektiven und Reflexionsebenen, wenn Lernende an die Gewordenheit der Gegenwart mit ihren globalen Problemlagen herangeführt werden sollen. Vor diesem Hintergrund muss im Geschichtsunterricht ein makrogeschichtlicher Blick auf den Menschen als Kulturwesen geworfen werden. Andreas Sommer geht der Frage nach, inwiefern übergreifenden kulturanthropologischen Reflexionsebenen beim historischen Lernen verstärkte Aufmerksamkeit zukommen sollte. Er untersucht, inwieweit sich das "Denken in großen Bildern" im schulischen Geschichtsunterricht, aber auch in der universitären Lehre nutzbar machen lässt. Mit seiner Studie zeigt er auf, welche positiven Effekte mittels makrohistorischer Perspektiven angebahnt werden können und wie historisches Denken zum Verstehen von "Welt'" beiträgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Editorial
Vorwort
Einleitung
1 Makrogeschichte aus geschichtsdidaktischer Perspektive
1.1 Makrogeschichte im Kontext weltgeschichtlicher Historiographiekonzepte
1.1.1 Das Anthropozän – De- und Rezentrierung des Menschen
1.1.2 Meistererzählungen im Spiegel innerer Kohärenz
1.1.3 Universalgeschichte und universelle Perspektiven auf ›Menschheit‹
1.1.4 Exkurs: Europa als »Big Picture«
1.1.5 Universalität als Orientierungsprinzip?
1.1.6 Menschheit im Fokus der Erdgeschichte: Big History
1.1.7 Die Verflechtungsperspektive: Globalgeschichte
1.2 Mikro- vs. Makrogeschichte? Reflektierende Betrachtungen
1.2.1 Generalisierung und Komplexität
1.2.2 Zum Verhältnis von Makro- und Mikrogeschichte
1.2.3 Historische Tiefenstrukturen
1.3 Zusammenfassung und weiterführende Überlegungen
2 Geschichtsdidaktische Theoriereflexion
2.1 Zur Wirkung von Geschichtsunterricht
2.2 Historisches Denken, Metakognition und »Denken in großen Bildern«
2.2.1 Historisches Denken – Ein Sinnbildungsprozess zwischen Kontingenzerfahrung und Orientierungsbedürfnis
2.2.2 Historisches Denken im Kontext von Makrogeschichte
2.2.3 Historisches Denken, reflektiertes Geschichtsbewusstsein und Makrogeschichte
2.2.4 Historisches Denken im (Unterrichts-)Gespräch: Ein metakognitiver Prozess?
2.2.5 (Historisches) Denken in großen Bildern
2.3 »Denken in großen Bildern«: Ein Zwischenfazit
2.4 Historisches Lernen als Orientierung in der Zeit
2.4.1 Makroperspektiven im Fokus historischer Orientierung
2.4.2 Historische Orientierung und historisches Denken im Geschichtsunterricht
2.5 Anthropologische Universalien aus geschichtsdidaktischer Perspektive
2.5.1 Kulturethnologische Perspektiven nach Christoph Antweiler
2.5.2 Exkurs: Historische Anthropologie bei Wiersing, Rüsen und Chakrabarty
2.5.3 Historisches Lernen aus kulturanthropologischer Perspektive: Eigene Überlegungen
2.6 Zusammenfassung
3 Konzeptionelle Bezüge
3.1 Globales Lernen, Globalgeschichte und »Denken in großen Bildern«
3.1.1 Globales Lernen in der Weltgesellschaft
3.1.2 Globalgeschichte im Geschichtsunterricht: aktueller Stand und weiterführende Überlegungen
3.2 Geschichtsunterricht im Mehr-Ebenen-System: Kühbergers Ansatz
3.3 Fazit
4 Zusammenführung der historiographischen und geschichtsdidaktischen Bezüge: Konzeptionelle Überlegungen und Zuschnitte
4.1 Begriffskonzeptionelle Annäherungen
4.2 Intention des Konzepts »Denken in großen Bildern«
4.3 Unterrichtskonzeptionelle Überlegungen
5 Erste empirische Annäherungen: Vorstudien zum »Denken in großen Bildern«
5.1 Auf dem Weg ins empirische ›Minenfeld‹
5.1.1 Pilotierungsphase 1: Globalgeschichte bei MiB-Studierenden
5.1.2 Auswertungsverfahren der ersten Vorstudie: deduktive und induktive Kategorien
5.1.3 Befunde der ersten Vorstudie
5.1.4 »Denken in großen Bildern«: Das Beispiel Frau Stech
5.1.5 Fazit zur ersten Vorstudienphase
5.2 Pilotierungsphase 2: Bili-Klasse neun, Bad Saulgau
5.3 Zusammenfassung der Vorstudienbefunde und weiterführende methodologische Überlegungen
6 Hauptstudie
6.1 Methodologische Überlegungen im Kontext geschichtsdidaktischer Theoriebildung
6.2 Design
6.2.1 Übersicht empirische Erhebungen
6.2.2 Zur Konzeption der Unterrichtssequenzen
6.3 Auswertung und Interpretation der Befunde
6.3.1 Themenmatrix
6.3.2 Befunddarstellung und Befundbeschreibung
6.3.3 Systematisierende Perspektiven: Ergebnisse der Hauptuntersuchung
7 Fazit aus den empirischen Erhebungen
7.1 Vergleich Vor- und Hauptstudie
7.2 Reflexion der Arbeitshypothesen
7.3 Curriculare Skizzen
8 Ein Modellvorschlag zum »Denken in großen Bildern«
8.1 Geschichtstheoretische und geschichtsdidaktische Anleihen für das Strukturmodell »Denken in großen Bildern«
8.2 Zusammenführung und Modellierung: Ansätze eines Strukturmodells zum »Denken in großen Bildern«
8.3 Geschichtsdidaktische Leerstellen und Diskussionsanregungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Forum historische Forschung: Geschichtsdidaktik
Herausgegeben von Andreas Hübner, Franziska Rein, Sabrina Schmitz-Zerres und Andreas Sommer
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/fhf-geschichtsdidaktik
Andreas Sommer
Denken in großen Bildern
Zum didaktischen Potenzial von makrohistorischen Lerneinheiten
Verlag W. Kohlhammer
Für Bea und Marei
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-046200-7
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-046201-4epub: ISBN 978-3-17-046202-1
Editorial
Die Professionalisierung und Institutionalisierung der Geschichtsdidaktik ist mittlerweile abgeschlossen. Dennoch muss sich die Disziplin weiterhin ganz grundsätzlichen Herausforderungen stellen. Neben den umfassenden sozio-kulturellen, medialen und ökologischen Transformationsprozessen sind es derzeit die vielschichtigen globalen Krisen, die den geschichtsdidaktischen Diskurs herausfordern. Die dadurch bedingte Veränderung von Forschungsparadigmen erfordert es, die Zielsetzungen, Praktiken, Prinzipien und Methodiken der eigenen Disziplin permanent zu hinterfragen und neu zu justieren. Im Fokus gegenwärtiger Transformationen in der Geschichtsdidaktik gilt es daher, neue Forschungs- und Diskurswege zu beschreiten, um angemessen, zeitgemäß und innovativ auf die Herausforderungen zu reagieren. Die Reihe Forum historische Forschung: Geschichtsdidaktik bietet Autor:innen, die sich auf diese Wege begeben, einen Platz. Zur Konzeption der Reihe gehört die Veröffentlichung von Monographien und Sammelbänden.
Eingedenk der komplexen Prozesse historischer Bildung sowie der vielseitigen gesellschaftlichen Gegebenheiten ist die Reihe inhaltlich und methodisch breit angelegt. Sie will nicht nur die Diversität des Diskurses in der Wissenschaftsgemeinschaft nachzeichnen, sondern auch neue disziplinäre Forschungsperspektiven initiieren und wesentliche Impulse über die Geschichtsdidaktik hinaus liefern. Damit verfolgt Forum historische Forschung: Geschichtsdidaktik gleichermaßen das Ziel, die Disziplin zu stärken und zu öffnen, um den Anforderungen an zeitgemäße Forschungsarbeiten gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund der transformativen Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft sehen die Herausgebenden in der Öffnung des geschichtsdidaktischen Diskurses das Potential, die Fachdisziplin weiterzuentwickeln. Problemstellungen und Forschungsfragen theoretischen, empirischen, pragmatischen und normativen Charakters sollen die Reihe ebenso prägen wie die Offenheit gegenüber inter- und transdisziplinären Ansätzen.
Die Herausgeber:innen
Vorwort
Dem Buch »Denken in großen Bildern« ging ein langwieriger Prozess des Forschens voraus. Ein exakt datierbarer Startpunkt lässt sich in der Rückschau kaum identifizieren. Er liegt in etwa im Jahre 2015, wo ich vom damaligen Dekan der Fakultät I an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (Herr Prof. Dr. Lothar Kuld) aufgefordert wurde, mir ›Gedanken‹ über ein mögliches Habilitationsthema zu machen. Zu dieser Zeit kam ich durch die Mitarbeit an einem Schulbuch mit globalgeschichtlichen Perspektiven in Berührung, die im Sommersemester 2016 in einem gleichnamigen Seminar mit Studierenden reflektiert wurden. Aus diesem thematischen Duktus wurde bei der Fakultät I ein Themenvorschlag eingereicht, der im November 2017 unter dem Titel »Globalgeschichte als metakognitives Geschichtslernen« auch genehmigt wurde. Mit diesem Titel ruhte die Arbeit am globalgeschichtlichen Habilitationsprojekt allerdings für eine ganze Weile; es galt andere (und in meinem damaligen Verständnis ›wichtigere‹) Projekte abzuschließen. Aus dieser vergangenen Perspektive hätte die Arbeit an meiner Habilitationsschrift auch gut und gerne weiter ruhen können, bestand doch aufgrund der hohen Deputatsverpflichtungen keine Aussicht, kontinuierlich an einem umfangreichen Forschungsvorhaben ›dranbleiben‹ zu können. Dass sich dieser Umstand änderte und ich in einer zweijährigen Deputatsreduktion mit neuem Elan und neuem Schwung forschen konnte, habe ich meinen beiden lieben Kollegen Herrn Prof. Dr. Waldemar Grosch und Herrn Prof. Dr. Dietmar Schiersner zu verdanken. Beiden habe ich nicht nur für ihren Einsatz bezüglich der Reduktion meiner Lehrverpflichtungen zu danken, sondern vor allem für ihr grenzenloses Vertrauen, ein scheinbar ausuferndes Forschungsvorhaben doch noch zu einem Abschluss zu bringen.
Mit einer Änderung des Titels, die sich aus einer vertiefenden theoriebasierten Einarbeitungsphase ergab, forschte ich ab April 2019 nicht mehr nur zu globalgeschichtlichen Perspektiven, sondern verlagerte meinen Fokus auf ›Makrogeschichte‹. Dazu konnte ich die empirischen Erhebungen für die Hauptstudie über das Jahr 2019 verteilen und wurde dafür an vier baden-württembergischen Realschulen gerne empfangen. Ich habe dafür ganz herzlich den folgenden Lehrkräften zu danken: Andrea Balle (RS Ravensburg), Christian Stumfol (RS Balingen), Florian Ruoß (Schulverbund Bad Saulgau) und Dieter Knitz (RS Weingarten).
Dieses Buch wurde nicht nur von mir als Autor geschrieben, mehrere Personen trugen als wissenschaftliche Hilfskräfte zum Voranschreiten des Forschungsprozesses bei und führten dieses Projekt schließlich zum Abschluss. Ich habe den folgenden Personen, die für die vorliegende Studie und damit auch für mich gearbeitet haben, unendliche Dankbarkeit entgegenzubringen: Johannes Walter, Julia Schiffler und Aylin Göktas.
»Schreiben ist eine gelegentlich unterbrochene Einsamkeit.«1 Ich habe meiner Familie in Radolfzell zu danken, dass sie mir diese Einsamkeit gewährte und mir den Rücken fürs Forschen und Schreiben freihielt. Insbesondere hat mir meine liebe Frau Andrea ein kontinuierliches Arbeiten in endlosen Homeoffice-Stunden ermöglicht, ihr gilt mein ganz besonderer Dank.
Weingarten im Herbst 2024
Endnoten
1Snyder 20227, S. 423.
Einleitung
»Mir san ned nur mir, mir san die Wolken und da Sand und mir san olle mitanand unterwegs auf unserm blaua Stoa« singt Sebastian Horn mit der bayrischen Band »Dreiviertelblut«. Diese Liedzeilen werden hier zitiert, weil sie in maximal planetarischer Perspektive auf Menschen und Menschheit blicken und damit auf den Nucleus der vorliegenden Studie verweisen: »Denken in großen Bildern«2 versteht sich als ein geschichtsdidaktischer Ansatz, der historisches Denken in umfassenden Raum-Zeit-Bezügen beschreibt. Die vorliegende Arbeit geht von der Prämisse aus, dass die gegenwärtigen globalen Krisen, die sich als ›Anthropozän‹ chiffrieren lassen, neue und das meint erweiterte Perspektiven auf die Felder Menschheit, Kultur und Welt evozieren.3 Es geht verkürzt darum, kulturelle Gewordenheit beim historischen Lernen im Fokus geschichtswissenschaftlicher Makrodarstellungen zu betrachten. Makroperspektiven rekurrieren auf zeitlich und räumlich umfassende Fragen und Reflexionsperspektiven, die sich aus der gesteigerten Globalität unserer Gegenwart legitimieren lassen. Aus diesen übergeordneten Makroebenen treten Individuen zwar in den Hintergrund, strukturelle Ebenen von Welt und Menschheit scheinen dagegen deutlicher zu Tage: Das von Horn besungene »Unterwegssein auf dem blauen Stein« verweist auf elementare und zugleich universelle Bereiche menschlichen Seins: Die Gestaltung menschlichen Lebens auf der Erde, die sich ganz allgemein in ihrer Kulturbezogenheit Ausdruck verleiht. Im Kern lassen sich aus diesem Makrofokus Fragen nach der Gewordenheit unserer (globalen) Gegenwart und nach uns selbst als Menschen stellen. Mit der Ventilation der Konzepte ›Menschheit‹, ›Kultur‹ und ›Welt‹ bahnt sich die vorliegende Studie einen schmalen Pfad durch ein posthumanistisch vermintes Sperrgebiet: ›Menschheit‹ kann auch vor dem Hintergrund des geologisch (noch) nicht ratifizierten ›Menschenzeitalters‹ keine universelle Erkenntnisgröße sein.4 Gleichwohl modellieren wir historisches Denken und Lernen im Fokus globaler Krisen und gehen dabei vom Ansatz einer ›Interessengemeinschaft‹ (vgl. Kapitel 8.2) »in einer volatilen Natur voller Extreme aus, der alle Menschen ausgesetzt sein werden«5 aus. Mit diesem Ansatz würden uns Posthumanist_innen des unreflektierten und überkommenen Anthropozentrismus' bezichtigen. Wir wissen, dass wir uns diesen Vorwürfen mit der vorliegenden Arbeit nicht entziehen können. In den Kapiteln 1.1.1 und 2.5 wird deshalb explizit der geisteswissenschaftliche Diskurs um ›Anthropos‹ aufgegriffen, um unser Strukturmodell historischen Denkens, das wir in Kapitel 8.2 evolvieren, darin zu vertäuen.
Die Studie »Denken in großen Bildern« versteht sich als propädeutisches Unterfangen, historisches Denken in erweiterten Raum-Zeit-Konstrukten zu ventilieren. Dabei geht es uns allerdings nicht um planetare Bezüge, die im anthropozänen Denken angelegt sind. Eine »geotrope Astronautik«6, die eine allzu anthropozentrische Hybris dezentriert, ist im Diskurs um das Anthropozän nicht nur angezeigt, sie ist zwingend geworden. Und dennoch folgt ihr die vorliegende Studie nicht. Unsere erhobenen Befunde und die daraus resultierenden theoretischen Bezugsebenen lassen die Modellierung historischen Denkens und Lernens in planetarer Perspektivität nicht zu. Wir modellieren Geschichtsunterricht vor dem Hintergrund anthropogener Prozessebenen, die Daniel Chernilo in seinem »anthropozentrischen Paradoxon« verdichtet: »Menschen haben sich als so erfolgreich erwiesen, die Natur zu verändern, dass sie jetzt Opfer ihres eigenen Erfolges werden.«7
In den Theorieüberlegungen zum »Denken in großen Bildern« geht es uns vor allem um das reflexive Potenzial umfassender kulturanthropologischer Perspektivität. Christoph Antweiler und andere Universalienforscher_innen8 bearbeiten seit geraumer Zeit Fragen nach kulturübergreifenden Ansätzen zumeist in interdisziplinärer Perspektive. Mit diesem übergreifenden Blick auf kulturelle Gemeinsamkeiten und ihrer historischen Genesen eröffnen sich nicht nur innovative, sondern im Kontext aktueller Gegenwartserfahrungen auch notwendige Forschungsfelder, die der Geschichtsdidaktik bislang verborgen blieben.
Die Studie »Denken in großen Bildern« nimmt die übergeordneten Perspektiven der Universalienforschung auf und projiziert sie auf das historische Lernen: Es stellt sich für uns die Frage, ob es im Geschichtsunterricht möglich ist, zu übergreifenden Blick- und Erkenntnismöglichkeiten auf die hier noch immer unspezifiziert gehaltenen Felder Menschheit, Welt und Kultur zu gelangen? In der vorliegenden Arbeit geht es neben der Analyse der Denkfiguren von Lernenden auch um die Etablierung eines geschichtsdidaktischen Ansatzes, der in einer eigenen Struktur historischen Denkens und Lernens modelliert werden soll: Unser Strukturmodell beschreibt historisches Denken in umfassenden Perspektiven und verweist damit auf die Möglichkeiten, Geschichtsunterricht so zu gestalten, dass auch in Zukunft ein gemeinsames »Überleben und gutes Leben«9 auf unserem »blaua Stoa« möglich sein kann. Wir wissen wie gesagt um die anthropozentrische Ausrichtung dieser aus den Nachhaltigkeitsdiskursen entlehnten Zukunftsperspektiven.10 Es geht uns mit dieser Studie allerdings um einen ersten Vorschlag einer didaktischen Modellierung, die historisches Lernen zwischen kulturgenetischen Bezugsebenen, dem Anthropozän als Gegenwartschiffre und ›Menschheit‹ als Interessengemeinschaft orchestriert. Unser Ansatz ist propädeutischer Natur, da anthropozäne Reflexionsebenen erst seit Kurzem Einzug in den geschichtsdidaktischen Diskurs gehalten haben.11 Des Weiteren ist es innerhalb einer limitierten empirischen Studie nicht leistbar, historisches Lernen vollumfänglich im Fokus unserer (ökologischen) Gegenwartskrisen zu modellieren.
Das hier vorgelegte Strukturmodell ist von geschichtswissenschaftlichen Makroperspektiven, dem Globalen Lernen sowie weiteren geschichtsdidaktischen Ansätzen wie der HISTOGRAPH-Gruppe beeinflusst. »Denken in großen Bildern« wird in der vorliegenden Studie als metareflexiver Prozess beschrieben: Dieser Prozess bezieht sich auf Denkstile, die im Fokus makrohistorischer Darstellungen umfassende Blickwinkel auf Welt und ›Menschheit‹ in ihren partikularen Kulturgenesen und in ihrem gemeinsamen Sein im Anthropozän werfen. »Denken in großen Bildern« ist damit in summa ein ontologischer Ansatz, der Betrachtungsperspektiven und Erkenntnisse möglich werden lassen soll, die innerhalb der gegenwärtigen Curricula des deutschsprachigen Geschichtsunterrichts kaum realisierbar sind.
Yuval Noah Harari – von dem in den kommenden Kapiteln noch verstärkt die Rede sein wird – hat kürzlich in einem Interview die Entdeckung von Teilen des Neandertaler Genoms in unserer Spezies als »eine der überwältigendsten Entdeckungen der vergangenen 10, 15 Jahre«12 bezeichnet. Auf die Frage, weshalb er diese Erkenntnis so aufregend fände, antwortet Harari wie folgt:
»Weil es den Blick auf uns als einzigartige Spezies verändert. Wir sehen uns gern an der Spitze der Natur, dabei sind wir den anderen Tieren näher, als wir denken. Wer heute von diversen Familien redet, sollte mal auf die ultimativ gemischten Gemeinschaften vor 50.000 Jahren schauen: Kinder eines Neandertal-Sapiens-Paares hatten zwei unterschiedliche Arten als Eltern. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet hätte, wenn Neandertaler überlebt hätten! Denken Sie nur an Politik oder Religion in einer Welt, in der mehrere Menschenarten nebeneinander und gelegentlich sogar gemischt leben!«13
Was in diesem Interviewausschnitt flankiert wird, lässt sich als biologistische Speziesgeschichte lesen, die in den bundesrepublikanischen Geschichtscurricula allenfalls eine Randerscheinung darstellt. Hararis unwirkliche Gegenwartsskizze zeigt allerdings, dass kontingente Blickwinkel Reflexionsprozesse katalysieren können, die historisches Denken auf Metaebenen forcieren. Solche Denkfiguren bergen Reflexions- und Erkenntnisebenen, die weit über die etablierten Curricula des institutionalisierten historischen Lernens hinausweisen. Der in diesem Buch vorgelegte Ansatz will allzu kleinschrittige und ›starr‹ anmutende Inhaltsebenen des Geschichtsunterrichts überwinden und globale Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart ermöglichen. Die ökologischen Krisen unserer Zeit zwingen ohnehin zur Abkehr von detailverliebten, auf Nationalstaaten zugespitzte Inhaltsebenen. Curriculare Inhaltsanalyse vor dem Hintergrund des Anthropozäns sollte sich zunächst an menschheitsgeschichtlich relevanten Übergängen, Schwellen und Transformationsprozessen orientieren.14 Vereinfacht geht das Strukturmodell »Denken in großen Bildern« der Frage nach, wie es Geschichtsunterricht ermöglichen kann, vor dem Hintergrund multipler globaler und planetarer Krisen »die Welt zu denken.«15 Unseren Überlegungen und Ansätzen ist – wie oben bereits klargestellt – ein anthropozentrischer Ansatz inhärent, weshalb wir vorliegender Studie einen propädeutischen Stellenwert hinsichtlich der Modellierung historischen Lernens im Anthropozän zuschreiben. Die geschichtsdidaktische Theorie und Pragmatik sind angehalten, Konzepte vorzulegen, mit denen sich die bisherigen anthropozentrischen Perspektiven des historischen Lernens etwa in der Kategorie des Planetaren überwinden lassen.16
Aus dem Blickfeld der Historiographie fokussiert unser Ansatz erweiterte Perspektiven auf Vergangenheit, die sich aus der Annales-Schule ableiten und Makroperspektiven auf Vergangenheit werfen. ›Makrogeschichte‹ ist konzeptionell allerdings gänzlich unbestimmt. Konzepte wie Big History, Universalgeschichte, Menschheits- und Globalgeschichte führen einen geschärfteren semantischen Fokus mit sich. Gleichwohl geht es nicht darum, ältere weltgeschichtliche Modelle zu forcieren, die etwa teleologisch und aus ›einem Guss‹ die Geschichte verschiedener Erdteile und -regionen aufzeigen und die von Schüler_innen in einem rein rezeptiven Modus ›gelernt‹ werden sollen. Solche Ansätze sind seit längerem zu Recht von der Geschichtsdidaktik zurückgewiesen worden.17 Sie erweisen sich auch für das hier angestrebte »Denken in großen Bildern« nicht als ertragreich. Es geht in der vorliegenden Studie vielmehr um Betrachtungs- und Frageperspektiven, die sich – wie oben bereits angezeigt – auf historiographischen Metaebenen bewegen und den Einzelnen in diese Geschichtsperspektive einweben. Wir werden deshalb in dieser Arbeit den Ansatz des metareflexiven Denkens zu entfalten haben. Verkürzt verstehen wir ›Makrogeschichte‹ als geschichtswissenschaftliche Metaforschung, die sich für ausgedehnte Räume und historische Tiefen interessiert. Damit werden Erkenntnisperspektiven möglich, die weit über eine quellenbasierte Geschichtsschreibung hinausweisen. Jürgen Osterhammel bezeichnet dieses epistemologische Ansinnen als »Höheren Wahnsinn«18, auch Bodo von Borries würde unser Vorhaben zwar als notwendig, aber ebenfalls als größenwahnsinnig deklarieren.19 Nichtsdestotrotz muss in unserer Gegenwart insbesondere das institutionalisierte historische Lernen Reflexionsperspektiven ermöglichen, die zukunftsweisende Themenfelder fokussieren. Wir gehen davon aus, dass globale und menschheitsumgreifende Blickfelder hierfür Voraussetzung sind und im Geschichtsunterricht längst etabliert sein sollten. Dieses Postulat ist nicht ganz neu. Die Integration globaler Perspektiven wurde und wird von einigen Geschichtsdidaktiker_innen seit längerem gefordert.20 Sie wurde jüngst in Anlehnung an das Konzept der ›Globalgeschichte‹ erneut in die geschichtsdidaktische Diskussion getragen.21 Globalgeschichtliche Ansätze rekurrieren in ihrem Kern auf räumliche Verflechtungsszenarien zwischen lokalen und globalen Ebenen. Lernende sollen – in einem hier sicherlich zu gerafft gewählten Duktus – historische Netzwerke erkennen und ihre gegenwärtige Verwobenheit in Globalisierungsprozesse reflektieren, um die Kompetenzen zu entwickeln, sich ›global‹ orientieren zu können und handlungsfähig zu werden. Die vorliegende Studie nimmt solche Überlegungen zwar auf, versucht aber mittels einer kulturanthropologischen Fokussierung historisches Denken auf umgreifendere Raumbezüge hin zu ventilieren. Historisches Denken und Lernen sollte, wie die Geschichtsdidaktik vor zwei Jahrzehnten bereits erkannte, den »Ausblick über den eigenen Tellerrand«22 ermöglichen. Wir greifen dieses Ansinnen erneut auf und erheben es für das historische Lernen im 21. Jahrhundert zum Postulat. Makrohistorischen Darstellungen – wie sie von Harari (2015), Diamond (2015), Scott (2017), Morris (2020) und neuerdings von Graeber/Wengrow (2022) vorgelegt wurden – beschreiben kaum historische Verflechtungsszenarien, es geht dort vielmehr um die Gewordenheit der gegenwärtigen Welt und ihrer Menschen mit einer auf Zukunftsszenarien ausgerichteten Perspektivität.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit Denkfiguren von Studierenden und Schüler_innen in der Auseinandersetzung mit makrohistorischen Darstellungen. Unser Ansatz geht dabei allerdings weniger von einer sich ökonomisch globalisierenden Gegenwart aus. Vielmehr will »Denken in großen Bildern« raumübergreifende und damit auch anthropologisch orientierte Reflexionsprozesse katalysieren, bei denen kultur- und menschheitsgeschichtliche Orientierung im Fokus des Anthropozäns möglich werden soll. Anthropozänem Denken sind – trotz posthumanistischer Kritik – anthropogene Bezugsebenen inhärent.23 Gemeint sind Perspektiven und Denkstile, die beispielsweise sowohl kultur- als auch naturübergreifend nach »Interdependenzen von Energieregimen und historischer Entwicklung«24 fragen. In den folgenden Kapiteln sprechen wir vielfach von ›kulturanthropologischer Orientierung‹; ein Konzept, das aus unseren empirischen Daten geniert wurde. Es geht verkürzt um die Frage, wie Lernende die materielle Gewordenheit ihrer Gegenwart in einer umfassenden kulturanthropologischen Perspektive reflektieren. Es wird die These vertreten, dass vor dem Hintergrund des Anthropozäns ›Kultur‹ und Kulturgenesen im Geschichtsunterricht eine verstärkte Aufmerksamkeit zukommen sollte. Dieses Ansinnen kann vielleicht wirklich als »Höherer Wahnsinn« deklariert werden, wenn man bedenkt, auf welch polymorphe Weise sich unsere Welt und die darin existierenden Kulturen darstellen. Harald Welzer hat deutlich gemacht, dass ein wesentliches Problem unserer krisenbehafteten Gegenwart darin bestünde, dass unser (westliches) Kulturmodell nicht danach frage, wie es zu unserem ressourcenverschlingenden Lebensstil kommen konnte und wie wir ihn beenden könnten.25 Es wird gegenwärtig lediglich diskutiert, so lässt sich dieser These beipflichten, dass sich etwas ändern müsse. In Welzers Perspektive zeigt sich dennoch eine didaktische Kernfrage: Wie lassen sich übergreifende kulturanthropologische Entwicklungsprozesse im Geschichtsunterricht darstellen und diskutieren? Es geht in summa darum, einen chronologisch gerafften und in historischen Tiefendimensionen schürfenden Blick mit Lernenden zu generieren. Dieser ›Blick‹ soll Lernenden auch ihre reflexive Verwobenheit in kulturanthropologische Entwicklungsdimensionen deutlich werden lassen. »Denken in großen Bildern« rekurriert demnach auch auf selbstreflexive Kompetenzebenen: Dieser Ansatz möchte neben den eben genannten historischen Tiefendimensionen Erkenntnisprozesse katalysieren, die Lernenden das eigene Involviertsein in Vergangenheitsprozesse offenlegt. Wir gehen im Gegensatz zu globalgeschichtlichen Ansätzen davon aus, dass Globalisierungskonzepte abstracta darstellen, mit denen sich ein »Denken in großen Bildern« im hier gemeinten Sinn nicht katalysieren lässt. Vielmehr geht es uns darum, Lernende an die Vorstellung einer historischen Menschheit(-sgemeinschaft) heranzuführen, die vor dem Hintergrund des Anthropozäns als ›Interessengemeinschaft‹ imaginiert werden kann. Was meint vor diesem Hintergrund das hier orthographisch umständlich dargestellte Konzept einer historischen Menschheit(-sgemeinschaft)? Unser Ansatz versteht in Anlehnung an Konzepte des Globalen Lernens26 ›Menschheit‹ als ab- und eingrenzbare Entität. In Anbetracht der gegenwärtigen Krisen und globalen Problemlagen ist ›Menschheit‹ mehr denn je in ihrer diversifizierten Gesamtheit künftig als Interessengemeinschaft zu adressieren.27 Die Geschichtsschreibung kennt diesen umfassenden, auf Menschheit gerichteten Blick seit längerem. ›Menschheitsgeschichte‹ – Erzählungen vom Werden des modernen Menschen28 – bleibt in der Historiographie allerdings recht unspezifisch und einseitig zugleich: Allzu häufig werden bei menschheitsgeschichtlichen Narrativen Bereiche der Ur- und Frühgeschichte ausgeblendet.29 Auch die generelle »Abendlandfixierung«30 des deutschen Historismus haftet diesen Darstellungen teilweise bis in die Gegenwart an. Aus dieser Perspektive ist zu fragen, was ,Menschheit' vor dem Hintergrund einer kaum zu überblickenden Partikularität ihrer Kulturgenesen überhaupt meinen kann und soll? In der vorliegenden Arbeit wird einem antiquierten Verständnis-Konzept von historiographischer Menschheit in einer fragwürdigen weltgeschichtlichen Perspektive nicht gefolgt.31 Wir plädieren auch nicht dafür, historisches Lernen auf ›Menschheitsgeschichte‹ hin zu projizieren. ›Menschheit‹ oder ›Menschheit(-sgemeinschaft)‹ wird in unserem Modell vielmehr als Reflexionsansatz verstanden, der von der Vergangenheit in die Gegenwart reichen soll. Menschen haben sich in der Vergangenheit wohl kaum als umgreifende anthropologische ›Gemeinschaft‹ definieren. Daher präferieren wir die etwas seltsam anmutende orthographische Darstellung ›Menschheit(-sgemeinschaft)‹, um den unterstellten Konnex mit gebotener Vorsicht anzuzeigen. Es geht beim »Denken in großen Bildern« im Kern darum, Menschheit in ihrer grundlegenden Kulturbezogenheit als selbstreflexives historisches Konzept in Bezug auf Gegenwarts- und Zukunftsperspektiven in den Blick zu nehmen. Dies scheint uns insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtig von Menschen massiv beeinflussten erdsystemischen Prozessebenen – dem Anthropozän – von großer Bedeutung für das historische Lernen.
Ein konzeptioneller Kernbereich von »Denken in großen Bildern« zielt wie auf den vorangegangenen Seiten bereits angedeutet auf kulturanthropologische Erkenntnisperspektiven. Dieser Ansatz generiert sich aus unseren empirischen Befunden, die deutlich werden lassen, dass Lernenden im Geschichtsunterricht Perspektiven auf Menschsein und Menschheit in ihrer Historizität fehlen. Bodo von Borries hat dieses Desiderat bereits vor über 30 Jahren beschrieben und wollte den Geschichtsunterricht anthropologisch-evolutionär ausgerichtet wissen.32 Auch Michele Barricelli sieht bereits seit längerem die Aufgabe eines integrativen Geschichtsunterrichts in »weltumspannende Räume vorzustoßen.«33 Wie oben bereits angedeutet, beschäftigt sich die Universalienforschung als Teildisziplin der Ethnologie mit solchen welt- bzw. kulturumspannenden Fragen. Wir werden in der vorliegenden Arbeit Christoph Antweiler vorstellen, der als Ethnologe Kulturen auf ihre gemeinsamen Schnittmengen beforscht. Antweiler verdichtet seinen Ansatz in der folgenden (vielleicht etwas plattitüdenhaften) Weise: »Menschen verschiedener Kultur leben nicht in verschiedenen Welten; sie leben verschieden in der Welt.«34 Solch umgreifende Perspektiven auf ›Menschheit und Welt‹ haben sich in den schulischen Curricula für das historische Lernen bislang kaum niedergeschlagen. Die vorliegende Studie will in diese Lücke vorstoßen und ventiliert historisches Lernen und Denken im Fokus eines umgreifenden (das meint ›welt- und menschheitsumspannenden‹) Raumverständnisses. Mit Lernenden muss – so unser weiteres vorläufiges Postulat – in einem auf globale Zukunft hin ausgerichteten Geschichtsunterricht ein umfassender selbstreferenzieller Blick auf Menschen als Kulturwesen geworfen werden. Diesen Ansatz erachten wir als reflexiven ›first step‹, der zu planetaren Denkstilen führen kann, mit denen sich anthropozentrische Hybris vielleicht dezentrieren lässt.
Wir werden in dieser Arbeit mit Jared Diamond und Marvin Harris feststellen, dass sich ›Kultur‹ in einem ganz allgemeinen Sinn als Problembewältigung im Fokus von Umweltbedingungen lesen lässt. Das ist eine kulturökologische Perspektive, die menschliches Handeln determiniert und auf äußere Faktoren wie Klimaprozesse und Ressourcenverfügbarkeit hin beschreibt. Neuere historiographische Ansätze versuchen diesen Determinismus zu durchbrechen und beschreiben Menschheitsgeschichte als Folge freier Handlungsabsichten.35 Wie auch immer dieser Diskurs weitergeführt werden mag, es muss im Geschichtsunterricht um die Reflexion von kulturökologischen Bedingungen und Umstände einer vergangenen und gegenwärtigen ›Menschheit‹ in globaler Perspektive gehen, wenn historisches Lernen in Zukunft in einen ernst gemeinten Sinnbildungsauftrag münden soll. Christoph Antweiler konstatiert, dass es zum Verstehen des Anthropozäns eines holistischen Kulturbegriffs bedürfe.36 Diesen Ansatz weben wir als Prozessanalyse historischer Tiefenstrukturen in unser Strukturmodell ein; es geht dabei verkürzt um Reflexionshorizonte, die sich über vergangene menschheitsübergreifende Kontinuitäten und Bruchlinien erstrecken und damit auch in unsere Gegenwart weisen.
Die oben ausgebreiteten kulturhistoriographischen Skizzen lassen vielleicht darauf schließen, dass große Teile dieses Buches aufgrund von historiographischen und geschichtsdidaktischen Theoriereflexionen generiert wurden; das ist richtig: Wir werden in zwei Großkapiteln die weiten Felder ›Makrogeschichte‹ und ›historisches Denken‹ aus geschichtsdidaktischer Perspektive beleuchten. Die Studie »Denken in großen Bildern« versteht sich aber auch als qualitativ angelegte Wirkungsstudie, weil sie in ihrem Kern dem didaktischen Potenzial von ›Makrogeschichte‹ nachspürt. Wir gehen im Fokus des Angebots-Nutzen-Paradigmas (vgl. Kapitel 2.1) davon aus, dass jeglicher Unterricht ›Wirkungen‹ erzeugt. ›Wirkung‹ generiert sich ganz allgemein aus einem Wechselverhältnis zwischen Angebot und Nutzen.37 Das Kuriosum der hier nachzuspürenden Wirkungen liegt jedoch darin, dass sie sich auf kognitiven Prozessebenen vollziehen, die verborgen bleiben. Mareike Kunter und Ulrich Trautwein modellieren diese ›unsichtbaren‹ Ebenen als »Tiefenstrukturen«, die für Lernwirksamkeitsprozesse zwar entscheidend, allerdings bislang wenig erforscht seien.38 Auch die Geschichtsdidaktik weiß, dass sich Denkleistungen lediglich in kommunikativen Settings wie Unterricht empirisch genähert werden kann.39 Innerhalb der vorliegenden Untersuchung nähern wir uns den Tiefenstrukturen von Geschichtsunterricht, indem wir versuchen kognitive Prozesse und Perspektiven von historisch Lernenden einzufangen. »Denken in großen Bildern« ist methodisch als Interventionsstudie angelegt. Bei diesem Studientypus geht es im Kern um eine theoriebasierte Konzeptentwicklung in Bezug auf unterrichtliche Strukturierung.40 Das heißt im vorliegenden Fall wurde für Lernende Unterricht konzeptioniert und evaluiert, der bewusst makrohistorische Perspektiven reflektiert. In einem weiteren Schritt werden unsere empirischen Erhebungen schließlich in eigene Theorieüberlegungen als Strukturmodell des »Denkens in großen Bildern« gegossen.
Qualitative Forschung ist immer ein offener Prozess.41 Dieses allgemeine methodologische Postulat meint, dass Fragestellungen und Perspektiven auf Phänomene der empirischen Wirklichkeit im Laufe eines Forschungsprozesses immer wieder moduliert werden müssen. Die vorliegende Darstellung ist das Destillat eines langwierigen Erhebungs- und Theoriereflexionsprozesses zu historischem Denken und Lernen: Erste empirische Erhebungen erfolgten im Sommersemester 2016 im Rahmen eines geschichtswissenschaftlichen Seminars zu globalgeschichtlichen Themenfeldern. Mittels offener Fragebögen sowie Einzel- und Gruppeninterviews sollten die teilnehmenden Studierenden ihr historisches Denken im Fokus von globalgeschichtlicher Perspektivität reflektieren. Aus diesem globalgeschichtlichen Setting, das als Experimentierfeld im Rahmen der klassischen Vorstudienerhebungen diente, wurden die beiden Themenfelder ›Out-of-Africa‹ und ›Zheng He‹ extrahiert, um damit in schulischen Kontexten Wirkungen zu erforschen. Die Auswahl dieser beiden Themenbereiche erfolgte aufgrund der aussichtsreichen Befundlage in der Vorstudie: In den Bewertungsnarrativen der Studierenden zeichnete sich deutlich ab, dass die Beforschten globalgeschichtliche Perspektiven als horizonterweiternd wahrnahmen und ihnen aus dieser Perspektivität Gegenwartsorientierung erst möglich wurde (vgl. Kapitel 5.1.5). Das hier skizzierte Themenspektrum benennt zugleich auch die limitierte Reichweite des empirischen Teils der vorliegenden Studie: Historisches Denken wurde von uns im Fokus der Themenfelder ›Out-of-Africa‹ und ›Zheng He‹ beforscht. Die Befunde der vorliegenden Studie sind immer im Korsett dieser beiden Themenfelder zu lesen. In empirisch ausgerichteten Folgestudien wäre der Ansatz des »Denkens in großen Bildern« fortzuführen, um historisches Lernen in den Diskursebenen des Anthropozäns zu konstitutionalisieren.
Trotzt der hier festgestellten Limitierungen lassen sich unsere Ausführungen in den folgenden übergreifendenden zentralen Fragestellungen lesen:
Auf welche Weise werden makrohistorische Ansätze von Lernenden rezipiert? Das meint spezifisch die Frage, wie makrogeschichtliche Narrative von Lernende bewertet und beurteilt werden.
Trägt makroperspektiviertes Lernen zu einem Perspektivwechsel im Sinne des eingangs erwähnten ›Blickes über den Tellerrand‹ bei?
Sind Schüler_innen einer neunten Mittelschulklasse überhaupt bereit und kognitiv in der Lage, ihre Perspektiven auf ›Geschichte‹ zu reflektieren?
Welche kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für das »Denken in großen Bildern« Voraussetzung?
Zusammenfassend: Welche didaktischen Potenziale beinhaltet Unterricht, der makrohistorische Darstellungen reflektiert?
Diese Leitfragen wurden zum Großteil zwar vor den empirischen Erhebungen generiert, dennoch sind wir – wie eben bereits angedeutet – innerhalb der vorliegenden Studie vom oben erwähnten qualitativen Paradigma der ›Offenheit‹ ausgegangen. Das meint, es wurde hier kein striktes hypothesenprüfendes Verfahren angestrebt, sondern der Forschungsprozess, der sich über einen Zeitraum von fast vier Jahren (April 2016 bis Dezember 2019) erstreckte, wurde modifiziert, sodass sich schließlich auch die Auswertungen der qualitativen Daten aus dem Material selbst ergab. Nur in einem solchen Forschungshabitus war es möglich, (weitgehend) authentische Sichtweisen und Urteile der Lernenden einzufangen.
Die vorliegende Arbeit geht in summa der Frage nach, wie sich historisches Denken in der Auseinandersetzung mit übergreifenden geschichtswissenschaftlichen Narrativen darstellt. Die Studie »Denken in großen Bildern« verfolgt damit die Spur möglicher Korrelationen zwischen makrogeschichtlichen Darstellungen und historischem Denken bei Lernenden. Dazu wird ein deskriptiver Ansatz gewählt: Es werden im Folgenden kognitive Prozesse im Kontext von Makrogeschichte beschrieben. Wie anhand der oben skizzierten Leitfragen ersichtlich werden soll, wird die Rezeption makrohistorischer Narrative in unterrichtlichen Kontexten beschrieben, um dann ein eigenes Strukturmodell historischen Lernens generieren zu können.
In summa zeigt die Anordnung und Ausgestaltung der einzelnen Kapitel, dass sowohl ein Großteil der vorliegenden Studie theoriereflektierende Ansätze als auch der Diskussion der erhobenen Befunde zukommt. Wir wissen, wie oben angezeigt, um die geringe Effektstärke einer Interventionsstudie; die überschaubare Zahl der Beforschten würde überdies keine repräsentativen Aussagen zulassen; das war und ist unser Anliegen ohnehin nicht. Die Intention der vorliegenden Studie liegt vielmehr darin, die geschichtsdidaktische Diskussion zum historischen Denken und Lernen solchermaßen zu katalysieren, dass Geschichtsunterricht im Fokus gegenwärtiger globaler Krisen Lernenden umfassendere Reflexions- und Erkenntnispotenziale ermöglichen kann. Historisches Lernen sollte – so die Maxime der Studie »Denken in großen Bildern« – einen Beitrag zu einem realistischen Kosmopolitismus leisten, der vielleicht eines fernen Tags in der menschheitsübergreifenden »Fähigkeit zur Reflexion«45 und »reflexiven Dezentrierung«46 als wesentliche Konstituenten anthropozänen Denkens mündet.
Endnoten
2Dieser Terminus ist der leitende Arbeits- und Konzeptbegriff der vorliegenden Studie. Er erscheint durchgängig in Anführungszeichen, da er von Christoph Kühberger bereits in die geschichtsdidaktische Diskussion getragen wurde, vgl. Kühberger 2012a, S. 133. In Kapitel 2.2.5 werden wir Kühbergers Ansatz ausführlich vorstellen.
3Horn/Bergthaller 20202, S. 13.
4Antweiler 2022, S. 251.
5Horn/Bergthaller 20202, S. 96.
6Hanusch/Leggewie/Meyer 2021, S. 48.
7Chernilo 2022, S. 64 f.
8Bei der schriftlichen Darstellung dieser Studie wird versucht, die gegenwärtig übliche Sprachform einzuhalten, bei welcher alle Arten von Geschlechtlichkeit Gleichberechtigung erfahren sollen.Des Weiteren wurde die schriftliche Darstellung dieser Studie größtenteils nach der Durchführung der Vor- und Hauptuntersuchung abgefasst. Daher war es möglich, Interviewausschnitte schon in den Theoriediskussionen der ersten Kapitel einzuweben, zumeist als Veranschaulichung der aus der Theorie abgeleiteten Erkenntnisse. Dieses Vorgehen entspricht nicht dem üblichen Ansatz empirischer Studien. Wir wollten uns diese Exemplifizierungschance allerdings nicht entgehen lassen. Aus diesem eben erwähnten postnarrativen Ansatz sind auch die Darstellungen der Befunde im Präteritum gehalten.
9Borries 2022, S. 441.
10Hübner/Sommer 2025 (i. E.)
11Vgl. Hübner/Roscher, S. 117, 126; Hübner 2022, S. 265–278.
12Zeitmagazin 38 (2022), S. 33.
13Ebd.
14Horn/Bergthaller 20202, S. 200–205.
15Kühberger 2012a, S. 153.
16Hübner/Sommer 2024, S. 8.
17Popp 2003, S. 69.
18Osterhammel 1998, S. 282.
19Borries 2021, S. 262.
20Unter einer überschaubaren Anzahl von Plädoyers, die den Einbezug globaler und/oder weltgeschichtlicher Perspektiven zu Beginn der 2000er Jahre unter dem Eindruck der fortschreitenden Globalisierung forderten, ist der folgende Sammelband als Grundlage anzuführen: Popp 2003.
21Bernhard/Popp/Schumann 2021, S. 18–32.
22Gies 2004, S. 43.
23Hamilton 2017, S. 65.
24Horn 2017, S. 3.
25Welzer 2021, S. 14.
26Vgl. die Konzepte »Weltgemeinschaft«, »Weltgesellschaft« und »Weltkollektiv« in: Lang-Wojtasik 2019, S. 23–29.
27Augé 2019; vgl. auch Antweiler 2022, S. 473.
28Parzinger 20165, S. 19.
29Ebd., S. 12.
30Osterhammel 2001, S. 465.
31Vgl. exemplarisch Alexander Demandt, der noch 2003 ein »Bild der Weltgeschichte (skizziert) wie es sich einem Mitteleuropäer heute darstellt.« Demandt 2003, S. 10.
32Borries 1990, S. 73.
33Barricelli 2009, S. 285.
34Antweiler 2011, S. 12.
35Graeber/Wengrow 2022, S. 230, 536–537.
36Antweiler 2022, S. 511.
37Rehm/Wilhelm/Reinhardt 2021, S. 11.
38Kunter/Trautwein 2013, S. 90.
39Zülsdorf-Kersting 2018a, S. 62.
40Waldis 2022, S. 299.
41Pohlmann 2022, S. 50.
42Schrenk 20196, S. 119. In einer früheren Auflage fehlen bei Friedmann ganze Kapitel, die sich mit übergreifenden Überlegungen zu ›Rassismus‹ und ›biokultureller Vernetzung‹ aus der Perspektive früher Menschheitsgeschichte auseinandersetzen, vgl. etwa die erste Auflage von 1997!
43Waldis 2022, S. 301.
44Ebd., S. 309.
45Antweiler 2022, S. 474.
46Chernilo 2022, S. 69.
1 Makrogeschichte aus geschichtsdidaktischer Perspektive
Wie hat sich das Leben früher Hominiden durch die Nutzung des Feuers verändert? Weshalb ist unsere Spezies, die Homo sapiens sapiens vor 200.000 Jahren aus Afrika ausgewandert? Warum sind die Neandertaler in Europa ausgestorben? Weshalb wurden unsere Vorfahren – einst geschickte Jäger_innen und Sammler_innen – sesshaft? Wie konnten sich antike Hochkulturen entwickeln? Was sind Grundstrukturen unserer modernen Gesellschaft? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich Yuval Noah Harari in seinem Weltbestseller Brief History of Mankind – Kizur Toldot Ha-Enoshut, der 2011 in Or Yehuda erschien. Was dieses Buch trotz seiner kontroversen Rezensionen so erfolgreich macht, darüber lässt sich reichlich spekulieren.47 Wir vermuten, dass Hararis Erfolg darin begründet liegt, universelle Fragen der Menschheitsgeschichte zu komprimieren und äußerst pointiert darzustellen.48 Zieht man die deutsche Übersetzung von Brief History of Mankind heran, dann wird bereits auf den ersten Seiten deutlich, dass Harari diverse historische Entwicklungsrichtungen in einem populärwissenschaftlichem Narrativ zusammenführt und ein Geschichtsbild der Menschheit entstehen lässt, das eine breite Leserschar offenkundig als ›triftig‹ einstuft: »Ja, so muss es wohl gewesen sein«, denkt sich vielleicht der bibliophile Zahnarzt oder die schon immer an Archäologie interessierte Abteilungsleiterin. Dieses sicherlich etwas zynisch imaginierte Klischee verweist weniger auf Hararis populärwissenschaftliches Narrativ als vielmehr auf unseren neidvollen Habitus, ein solches Buch nicht selbst vorgelegt zu haben. Denn, Harari publiziert keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Menschheitsgeschichte, sondern sein Publikationserfolg ergründet sich aus seinem erzählerischen Arrangement. Dieser Erfolg erklärt sich allerdings nicht nur anhand der oben angedeuteten Triftigkeits- oder auch Plausibilitätsprüfungen der Rezipient_innen, sondern der Autor vermengt, wie wir oben bereits angedeutet haben, die großen kulturanthropologischen Entwicklungslinien zu einem Gesamtbild der Menschheitsgeschichte, das im Hier und Jetzt mündet. Einem historiographischen Laienpublikum wird mithilfe dieser Lektüre sehr schnell klar, wie wir wurden was wir sind. Innerhalb des institutionalisierten historischen Lernens – damit sind Geschichtsdidaktik und schulischer Geschichtsunterricht gemeint – werden solche Gesamtbilder wie das von Harari als anthropozentrische ›Meistererzählungen‹ deklariert. Wir werden die geschichtsdidaktische Diskussion in Abschnitt 1.1.2 vorstellen. An dieser Stelle bleibt lediglich der Hinweis, dass Harari und andere Autor_innen mit großen, übergreifenden Narrativen erfolgreich arbeiten. Deren Leser_innenschaft scheint gleichsam über die Menschheitsgeschichte hinwegzufliegen, in den Cockpits sitzen die Autor_innen und sprechen während des Fluges über Bedingungen, Zustände und Prozesse, die zu diesen und jenen Entwicklungen geführt haben. Aus dieser »Flughöhe der Adler«49 werden Erkenntnis- und Reflexionsperspektiven möglich, die als »Augenöffner« oder als »Horizonterweiterung« von den von uns beforschten Studierenden und Schüler_innen bewertet werden.
Wir haben eingangs die großen Perspektiven aus Hararis Buch nicht als bloßes Präludium zu diesem Kapitels vorgestellt. Solche zeitlich und räumlich ausholenden Reflexionsperspektiven waren für die Seminar- und Unterrichtskonzeptionen, aus denen sich das empirische Material der vorliegenden Studie speist, leitend. Die Arbeit »Denken in großen Bildern« fokussiert die Wirkungsweisen jener historischen Zugriffsperspektiven, die wie Harari in seinem Bestseller großen Panoramen und Fragen der Menschheits- und der außereuropäischen Geschichte nachgehen. Es geht in dieser Studie vor allem darum, das Wirkungspotenzial von geschichtswissenschaftlichen Betrachtungsweisen zu beschreiben, die sich mit ihrer Leser_innenschaft auf Makroebenen begeben. Mit dem Terminus ›Makroebenen‹ tauchen wir zugleich in die schillernde Semantik weltgeschichtlicher Historiographie ein. Wir gebrauchen im Folgenden den recht unscharfen Begriff ›Makrogeschichte‹ für jene historiographischen Narrative, die Geschichte auf übergeordneten, umfassenden und übergreifenden Ebenen darstellen. Im Kern geht es dabei auch, aber nicht nur, um Menschheitsgeschichte. Gegenwärtig wird ›Menschheit‹ in den Geisteswissenschaften auch aus der Perspektive des Anthropozäns' modelliert. Es wurde eingangs bereits darauf hingewiesen, dass dem Anthropozän in der vorliegenden Arbeit eine sehr einseitige konzeptionelle Orientierung zufällt: Wir lehnen uns kaum an die großen makrohistorischen Perspektiven des anthropozänen Denkens, die etwa im Diskurs um das Planetare oder in humandezentrierenden Überlegungen ihren Ausdruck finden, an. Unser Fokus ist ›Anthropos‹ in seiner Kultur- und Menschengeschichtlichkeit. Im folgenden Abschnitt werden wir das Anthropozän unter diesen Prämissen aus geisteswissenschaftlicher Perspektive vorstellen.
In diesem ersten Großkapitel soll aufgezeigt werden, wie sich makroperspektivische Fragestellungen im Kontext der Geschichtswissenschaft darstellen, wie sie beforscht werden und wie sie vor allem innerhalb der Historiographie zu verorten sind. Das wissenschaftliche Streben nach begrifflicher Sicherheit und konzeptioneller Einordnung gestaltet sich im vorliegenden Fall als äußerst schwierig und gerät in Gefahr, in geschichtswissenschaftliche Begriffshuberei zu verkommen. Der Gegenstand, den es hier vorzustellen gilt, wurde bereits von Jürgen Osterhammel als »Vorschule [...] weltgeschichtlichen Denkens«50 umrissen, ohne ihn wirklich systematisieren zu wollen. In diesem eher charmant ausweichenden Duktus sind auch die nachfolgenden Seiten zu lesen, die die geschichtswissenschaftliche Zuordnung eines Teilbereiches der Studie »Denken in großen Bildern« wagen wollen, ohne Anspruch auf begriffsdogmatische Endgültig- und Zielgenauigkeit, da diese vielleicht gar nicht gegeben werden kann. In dieser Studie wollen wir vielmehr eine »scholastische Feinunterscheidung«51 der im Weiteren auszuführenden Konzepte, vor der Sebastian Conrad ausdrücklich warnt, vermeiden. Unser Fokus liegt in dieser Arbeit aufseiten der Didaktik, die sich immer schon historiographischer Konzepte bediente, um beispielsweise deren Relevanz für historisches Lernen zu analysieren. Gleichwohl – und das ist im Mindesten zu leisten – soll in diesem Kapitel die historiographische Makroperspektive, welche den empirischen Untersuchungen zugrunde liegt, vorgestellt werden.
1.1 Makrogeschichte im Kontext weltgeschichtlicher Historiographiekonzepte
1.1.1 Das Anthropozän – De- und Rezentrierung des Menschen
Die umfassendste aller makrohistorischen Perspektiven verdichtete sich im gegenwärtigen Diskurs um das Anthropozän, den wir in diesem Abschnitt skizzieren wollen. Im Folgenden wird das Anthropozän vor allem als geisteswissenschaftliches Reflexionskonzept ventiliert. Wie in der Einleitung bereits ausführlich dargelegt, wurde sich im empirischen Setting der vorliegenden Studie nicht mit planetaren Denkstilen, die dem Anthropozän-Konzept inhärent sind52 und die es von anderen makroskalierten Historiographieperspektiven wie etwa der Globalgeschichte unterscheidet, beschäftigt. Wir legen in dieser Arbeit in Kapitel 8 auch kein Strukturmodell zum historischen Lernen im Anthropozän vor. Lediglich Teilbereiche anthropozänen Denkens zeigen sich in den Befunden unserer empirischen Erhebungen. In den Interviews sprechen sich unsere Respondent_innen für die Implementierung kulturanthropologische Prozesse und menschheitsgeschichtlich orientierte Genesen in das historische Lernen aus. In summa wurde in der Studie »Denken in großen Bildern« historisches Lernen im und für das Anthropozän nicht empirisch fundamentiert. Unser Ansatz ist ein anderer: Das Anthropozän wird in der vorliegenden Studie als zeit- und raumumfassender Reflexionsansatz adressiert, dem makroskalierte Dimension inhärent sind und mit dem sich globale Transformationsprozesse vor allem ab der Mitte des 20. Jahrhunderts systematisieren lassen.53 Die Befunde der vorliegenden Studie zeigen, dass unsere Respondent_innen in der metareflexiven Auseinandersetzung mit den Unterrichtsthemen übergreifende und umfassende (kultur-)anthropologische Ebenen ansteuerten (vgl. Kapitel 6.3.2.1). Im Folgenden konzentrieren sich unsere Ausführungen deshalb auf ›Anthropos‹ in seinen kulturgenetischen Gefügen. In den weiteren Abschnitten wird aus dieser Perspektive ein anthropozentrischer Ansatz, wie ihn Clive Hamilton im Fokus des Anthropozäns vorlegt, interessant: Hamilton begegnet dem Vorwurf des ›Anthropozentrismus‹, den das Anthropozän forciere mit der These, dass es im Fokus des Anthropozäns eines Neuen Anthropozentrismus bedürfe, der den menschlichen Einfluss auf das Erdsystem historisch-genetisch modelliere. Hamilton weiß um de Partikularität ökonomischer Lebensweltausrichtungen und die darin verwobenen Verantwortlichkeiten für den gegenwärtigen planetaren Krisenzustand. Gleichwohl geht Hamiltons Ansatz von einer »world-making capacity« aus, die allen Menschen innewohnt und die sich im Kontext diverser historischer Konstellationen (Industrialisierung, Kapitalismus etc.) zerstörerisch Bahn bricht.54
Unser Modellvorschlag zum »Denken in großen Bildern« nimmt induktiv Anleihen aus Hamiltons Fokus und den erhobenen empirischen Befunden auf und ventiliert historisches Lernen in Bezug auf ›Menschen‹ und ›Menschheit‹ in den umfassenden makrohistorischen Perspektiven. Wir kontextualisieren unseren Ansatz in den folgenden Abschnitten mit den gegenwärtigen geisteswissenschaftlichen Diskursebenen um das Anthropozän. Es sei erneut darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit historisches Lernen im Anthropozän nicht allumfassend ventiliert werden kann. Der induktiv konzipierte empirische Forschungsteil dieser Studie lässt kaum umfassende Theoriebezüge zum Anthropozän zu, sondern kreist vielmehr um historiographische Perspektivenerweiterung und kulturanthropologisch orientierte Fragestellungen. Bezüge zum Anthropozän werden hier lediglich partikular vorgenommen.
Das Anthropozän kann als ambivalentes oder gar paradox anmutendes Konzept in Bezug auf Menschen und ›Menschheit‹ gelesen werden: Zum einen ist bereits seiner Semantik eine anthropozentrische Ausrichtung inhärent, die den Menschen ins Zentrum erdsystemisch perspektivierter Reflexionsprozesse stellt. Zum anderen halten Kritiker_innen vor allem im geisteswissenschaftlichen Anthropozändiskurs an einer »dezentralisierende Bedeutung des Menschen«55 im Kontext künftiger (Über-)Lebensperspektiven fest, die menschlichem Exzeptionalismus bewusst entgegenwirke.56 Insbesondere menschenüberwindende (planetare) Denkstile seien im Diskurs um ein potentielles Anthropozän angezeigt, wie noch zu zeigen sein wird. In der vorliegenden Arbeit wird diesen umfassenden Ventilationsebenen (auch erdsystemischen) Perspektiven57keinen Raum zugestanden. Wie bereits erwähnt, generieren sich die Theorieüberlegungen aus dem induktiv konzipierten empirischen Forschungsansätzen, die dieser Studie zugrunde liegen. Mit unseren Respondent_innen haben wir globale, auf Menschen und ›Menschheit‹ ausgerichtete Perspektiven generiert. Ein ins Planetare reichender Ansatz, der menschliche agency überwindet und damit dezentriert, wurde nicht verfolgt. Unser Strukturmodell »Denken in großen Bildern« fokussiert aus diesem empirischen Ansatz heraus Menschen in ihren partikularen Kulturgefügen (vgl. Kapitel 8.1). Im Folgenden wird der Diskurs um ›Anthropos‹ im Anthropozän vorgesellt, der von der Geschichtsdidaktik bislang kaum aufgegriffen und für das historische Denken und Lernen orchestriert wurde. Da das Anthropozän als Reflexionsebene des historischen Lernens bereits in die geschichtsdidaktische Diskussion eingeführt wurde,58 werden wir im Folgenden das ›Menschenzeitalter‹ lediglich aus der Perspektive jener Prämissen beleuchten, denen in unserer Modellierung ein entscheidender Stellenwert zukommt: Im Zentrum unseres Reflexionsinteresses stehen kulturgenetische Prozesse sowie ›Anthropos‹ im Fokus der gegenwärtigen globalen Krisen.
Vieles und Umfassendes wurde und wird zum ›Anthropozän‹ international publiziert. Die Fülle literarischer Titeleien, welche dieses »Catchword«59 nutzen, ist kaum zu überblicken. Demgegenüber wird der Diskurs um anthropozänes Denken auch innerhalb der Geisteswissenschaften geführt.60 In einem übergreifenden Duktus lässt sich das Anthropozän als eine global-planetare Reflexionsebene begreifen, die allerdings fast ausschließlich in westlichen Kulturräumen rezipiert wird. Beispielweise konnte das Anthropozän in Asien bislang nicht in den geisteswissenschaftlichen Diskurs vordringen.61 Wir werden bei der Beleuchtung des ambivalenten Menschen- oder Menschheitsverständnisses erneut auf die imaginative kosmopolitische Ebene des Anthropozän-Konzeptes zurückkommen. Zunächst lässt sich in aller Kürze ›Anthropozän‹ als Chiffre und als historische Bruchlinie lesen, die den Menschen als eigenständige geologische Kraft bestimmt. Die Beschreibung des Klimawandels ist im Kontext des Anthropozäns lediglich eine Form des Ausdruckes dieser anthropogenen Geokraft. Artensterben, das Verschwinden von Biomassen, der verschwenderische Umgang mit endlichen globalen Ressourcen und vieles mehr können unter dieses Konstrukt subsummiert werden. Es geht in summa um einen erdgeschichtlichen Zustand, für den es keine historischen Vorbilder gibt. Homo sapiens war zwar schon immer ein Kulturwesen, das in ökologische Systeme eingegriffen hat.62 Bis zur Entfesselung der fossilen Energieträger im Kontext der Industriellen Revolution63 hätte man dieses Eingreifen allerdings nicht als ganz eigene geologische Kraft deklariert. Im Kern verweist die Chiffre ›Anthropozän‹ auf einen grundlegenden Dualismus zwischen Natur und Kultur und zwingt uns deshalb unsere Beziehung zu diesen beiden Polen neu zu denken.64 Hier deutet sich eine ontologische Dimension an, die sich innerhalb der vorliegenden Studie nur punktuell vertiefen lässt: In verschiedenen Abschnitten wird von ›anthropologischer Orientierung‹ und ›kulturanthropologischen Erkenntnisperspektiven‹ gesprochen. Insbesondere wird in Kapitel 2.5.3 am Beispiel gegenwärtiger ressourcenverschlingender Lebensstile diskutiert, ob es auch beim historischen Lernen Erkenntnisperspektiven bedarf, die umfassend und zugleich reflexiv gedacht werden müssen. Kulturanthropologische Reflexion und Orientierung rekurriert beispielsweise auf die Dynamisierung von Kulturentwicklungsgefügen, die Einfluss auf erdsystemische Prozesse erlangen konnten. Diese Entwicklung zeichnet sich verstärkt ab den 1950er Jahren ab und wird von der Geschichtswissenschaft als great acceleration beschrieben.65 Gegenwärtig sind Lernende in diese komplexen Kulturentwicklungsgefüge involviert, ohne deren Genesen und Auswirkungen überblicken zu können.
Im Konzept des Anthropozäns können solche Perspektiven gebündelt werden: Anthropozänes Denken müsste zwingend zu ontologischen Fragen in einem Raum-Zeit-übergreifenden Duktus führen und – so unsere These – den und die Einzelne(n) zum Nachdenken über sich und ihre Gegenwart herausfordern. An dieser Stelle muss betont werden, dass kognitiven Erkenntnissen keine normativen Entsprechungen anhaften dürfen. Es geht uns in der Studie »Denken in großen Bildern« nicht um die Implementierung eines umweltpädagogischen Zeigefingers beim historischen Lernen. Dem Konzept des Anthropozäns – das soll im Folgeabschnitt deutlich werden – ist vielmehr das reflexive Potenzial inhärent über globalen Anthropozentrismus sowie über die Generierung und Etablierung von Kulturverhältnissen nachzudenken, die sich in einer grundlegenden Beziehungsebenen zum Planeten ›Erde‹ bündeln lassen. Es geht uns – vor allem in unserem Modellvorschlag in Kapitel 8 – um eine propädeutische Ebene anthropozänen Denkens, mit der sich kognitive Verstehens-, Erkenntnis- und Reflexionsprozesse, die wir als »Denken in großen Bildern« fassen, modellieren lassen. Der gegenwärtige geistes- und kulturwissenschaftlichen Diskurs um das Anthropozän rekurriert im Kern auf ambivalente Perspektivebenen,66 die im Folgenden skizziert werden:
A)
Ambivalenzebene ›Zeit‹: Kulminationspunkte von Tiefenzeit und Zeitgeschichte
Blicken wir aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive auf das Konstrukt des Anthropozäns, stellen sich interessante und zu gleich umwälzende Überlegungen in internationalen inter- und transdisziplinären Diskursen ein, die in diesem Kapitel kaum zu bündeln sind und hier deshalb lediglich skizziert werden: Das Anthropozän rekurriert auf geo-humane Vorgänge, die erst über lange Zeiträume spürbar werden. Die geologische Kraft von Menschen lässt sich daher nicht in mikrohistorischen Narrativen nachzeichnen, sondern ist in umfassend ausholenden Raum-Zeit-Perspektiven zu ventilieren. Dem steht entgegen, dass ein möglicher chronologischer ›Beginn‹ des Anthropozäns erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts anzunehmen wäre, da ab diesem Zeitraum anthropogene Prozesse beschleunigt würden, die über längere Zeiträume auch geologisch nachweisbar werden.67 Im Modell der great acceleration manifestieren sich dagegen zeitgeschichtlich ab den späten 1950er Jahren Konsumgesellschaften nach westlichem Vorbild, die als Verursachende bzw. Verantwortliche des anthropologischen Einflusses auf die erdsystemischen Vorgänge adressiert werden.68 Dipesh Chakrabarty hat schon vor längerer Zeit auf mögliche Fallstricke hingewiesen, die sich im Zusammenfallen der hier erwähnten und von den Geschichts- und Erdwissenschaften bislang separiert modellierten Zeitebenen.69 Für Chakrabarty erzwingt das Anthropozän eine Korrelation zwischen Zeit- und Speziesgeschichte.70 Es lässt sich aus diesen Überlegungen fragen, auf welchen Ebenen das Anthropozän narrativiert werden müsste, wenn geologische Zeiträume mit zeitgeschichtlichen Perspektiven korrelieren? Dieses Reflexionsfeld wurde von der Geschichtsdidaktik bereits aufgegriffen und ist künftig in einem interdisziplinären Fokus zu vertiefen.71
Es bleibt in diesem Abschnitt zunächst festzuhalten, dass das Anthropozän die Geschichtswissenschaften – insbesondere die Historiographie – und ihre Didaktik vor gewaltige Herausforderungen stellt: Geschichtswissenschaftliches Forschen und Narrativieren ging bisher – auch innerhalb der Umweltgeschichte – von einem anthropozentrischen Ansatz aus.72 Das Anthropozän fordert diese anthropogene Zentrierung heraus, indem sich geochronologische und zeitgeschichtliche Ebenen vor allem seit der »Petromoderne« vermengen.73 Modernes menschliches Handeln gereicht in zeitliche Tiefendimensionen, die historisches Denken, Vorstellen und Verstehen herausfordern.74 Wir haben es summierend mit einem tiefenzeitlichen entanglement zu tun. Dieses historiographische Konzept wird hier bewusst aus der Globalgeschichte entlehnt, da es historische Verwobenheiten meint: entangled history geht von einem grundlegenden Verflechtungsparadigma aus, das alle Kulturen und Zivilisationen durchzieht.75 Im Anthropozän kulminieren – folgt man dem Diskurs um dessen ›Beginn‹ – Zeit- und Tiefengeschichte und damit auch Menschen- und Naturgeschichte.76 Das Anthropozän lässt sich mittels multipler Narrative darstellen, die in der Gefährdung der Welt durch den Menschen münden.77 Damit wird es zu einem virulenten und nicht abgeschlossenen Reflexionsfeld78, dem sich auch das historische Lernen gerade zu öffnen beginnt.
B)
Ambivalenzebene ›Anthropos‹: Menschen und Menschheit im Anthropozän
Wir haben in den ersten Abschnitten dieser Studie den menschheitsgeschichtlichen Weltbestseller des israelischen Historiker Yuval Noah Harari vorgestellt. Unlängst hat Harari sein historiographisch-pädagogisches Anliegen in einem Interview in folgender Weise polemisch vorgetragen: »Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den israelischen Schulen liegt der Fokus auf der nationalen Geschichte der Juden und Israels. Ich möchte den Fokus ändern – wir sollten die Geschichte nicht aus der Perspektive eines bestimmten Landes betrachten, sondern aus der unserer Spezies.«79 Die Forderung nach Spezies- bzw. Menschheitsgeschichte ist für das historische Lernen nicht ganz neu,80 sie birgt aber ein diskurs- und erkenntnistheoretisches ›Gefahrenpotenzial‹, das Hannes Bajohr kürzlich zusammentrug und das sich ebenfalls in die grundlegende Ambivalenz des Anthropozän-Konzeptes integrieren lässt. Die Rede ist von Anthropos, von dem Menschen in universeller Perspektive. Der gegenwärtige Diskurs um Anthropos, der im Anthropozän-Konzept explizit adressiert wird, lässt sich hier in folgender Weise summieren: Das Anthropozän trage den von Posthumanist_innen dezentrierten und negierten ›Menschen‹ wieder in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Diskurs. Diese »Wiederkehr des Menschen«81 wirft zugleich auch Fragen des anthropozänen Denkens auf: Kann oder ›darf‹ vom Menschen im Kollektivsingular gesprochen werden? Wer waren die Treibenden der Industrialisierung und der great acceleration, die heute als Konstituenten des neuen geologischen Zeitalters diskutiert werden? Aus diesen Fragestellungen ergeben sich Verantwortungsparadigmen für die gegenwärtigen globalen Krisen, auf die das Anthropozän explizit rekurriert. Eva Horn und Hannes Bergthaller negieren aus dieser Perspektive einen allgemein-anthropogenen Zugriff auf das Anthropozän und plädieren für dessen soziogene Ausrichtung, um historische Entwicklungsprozesse und Perspektiven – insbesondere kapitalistische Gesellschaftsmuster greifbarer zu machen.82
›Menschheit‹ oder den Menschen kann es als universal-epistemologische Kategorie auch im Anthropozän nicht geben. Die Studie »Denken in großen Bildern« setzt sich mit diesen Prämissen auseinander und folgt ihnen: Menschen und ›Menschheit‹ stellen sich auch für uns als zu partikular und zu differenziert dar und entziehen sich universellen Erkenntnisperspektiven. Gleichwohl werden wir das Konzept der historischen Menschheit(-sgemeinschaft) in die geschichtsdidaktische Reflexion einführen. Eine Denkfigur, die sich weniger aus der ethnologischen Universalienforschung als vielmehr aus einer deterministischen Kulturbezogenheit aller Menschen, die sich in historisch-partikularen Clustern rekonstruieren lässt, speist (vgl. Kapitel 2.5.3). Dabei soll es keinesfalls um eine fragwürdige universelle Perspektive auf eine diversifizierte Menschheit gehen. Im Konzept des Anthropozäns zeigt sich allerdings eine anthropologische Dialektik, die auch für das historische Lernen vertiefend zu reflektieren ist: Das Anthropozän de- und rezentriert den Menschen in gleicher Weise. In Kapitel 2.5.2 werden wir dazu vertiefend Dipesh Chakrabarty folgen, der diesem anthropologischen Antagonismus mit den Konzepten ›Homo‹ und ›Anthropos‹ begegnet. Unser Ansatz adressiert ›Menschen‹ und ›Menschheit‹ einerseits aus der eben genannten Kulturbezogenheit des Menschen. Diese Kulturbezogenheit wird in unseren weiteren Überlegungen mit Clive Hamilton als anthropologische Universalität gedacht: »It is our world-making capacity that makes humans unique.«83 Damit dringen unsere Überlegungen zum anthropozentrischen Kern des Anthropozäns vor, der vor allem aus posthumanistischer Perspektive negiert wird. Wir folgen bei unseren weiteren Überlegungen neben Hamilton Daniel Chernilo, der feststellt, »dass wir eine umfassendere Vorstellung von Handlungsmacht (Agency) brauchen.«84 Chernilo überträgt »Handlungsmacht« auf die Fähigkeit menschlicher Reflexivität. Wir werden diesen Ansatz in Kapitel 8 erneut aufgreifen und in unseren Modellvorschlag einweben.
Andererseits ist dem Anthropozän die Frage nach Menschen und Menschheit als dominante Spezies inhärent, die in Kapitel 2.5.2 diskutiert werden soll. Im empirischen Setting der vorliegenden Studie haben wir mit unseren Forschungspartner_innen über ›Menschheit‹ als Ursprungsgemeinschaft im Fokus der Out-of-Africa-Theorie nachgedacht. Im Fahrwasser dieser Überlegungen wurden für die Lernenden grundlegende Fragen nach ›Menschen‹, ›Menschheit‹ sowie migrations- und kulturgenetischen Perspektiven virulent (vgl. Kapitel 6.3.2.7 und Kapitel 6.3.3). Aus diesem induktiven Fokus legitimieren sich unsere Bezugsebenen zum Anthropozän, das wir in der vorliegenden Studie als Reflexionsebene verstehen wollen, mit der sich die oben genannten thematischen Schlaglichter nicht als bloße Biologismen, sondern als kulturgenetische Prozessebenen fassen lassen.
In diesem Abschnitt bleibt festzuhalten, dass im Fokus anthropozänen Denkens posthumanistische Strömungen den Menschen in seiner möglichen Sonderstellung negieren und ihn dezentrieren.85 Chakrabarty plädiert aus dieser Denkfigur heraus für die Etablierung des »Planetaren«, dem er im Gegensatz zum »Globalen« eine umfassende und über das anthropozentrische »Globale« hinausweisende Dimension zuschreibt.86 Für die Studie »Denken in großen Bildern« ergeben sich aus diesen Ansätzen Bezugsebenen, die für unseren kulturanthropologischen Denkansatz grundlegend werden und ihn reflexiv vertäuen: Wir folgen in unserem Modellvorschlag zum »Denken in großen Bildern« einem anthropologischen Ansatz, der menschliche Hybris negiert, obwohl er Menschen in ihren historisch-kulturellen Konstellationen ins Blickfeld rückt. Wir können im Folgenden die Diskursrichtungen dieser »Negativen Anthropologie«87 nicht weiterverfolgen. Wir schließen uns stattdessen Katharina Block an, die in einem »reflexiven Anthropozentrismus« das Potenzial einer Humandezentrierung sieht. Diesem Ansatz ist eine historische Dimension inhärent, die für unseren eigenen Ansatz, dem »Denken in großen Bildern«, fruchtbar werden kann: Wozu der Mensch fähig ist, müsse nach Block in der Breite aller Kulturen und Epochen reflektiert werden. Es gälte menschliche ›Fähigkeit‹ in ihrer historisch bedingten Relationalität zu erfassen und damit der Dezentrierung des Human Vorschub zu leisten.88
Für unsere Überlegungen ist als weitere Ansatzrichtung zu fragen, ob ›Menschheit‹ als Totum im Anthropozän auch aus einer global agierenden Interessensperspektive heraus adressiert werden kann bzw. muss.89 Diese kosmopolitische Chiffre geht von »menschlichen Grundthemen und Basisproblemen aus, denen sich alle Kulturen stellen müssen.«90 In Kapitel 2.5.3 werden wir diesen Ansatz ausbreiten. Er wird in unser eigenes Konzept einer imaginierten historischen Menschheit(-sgemeinschaft) münden, die wir als Interessengemeinschaft modellieren (vgl. Kapitel 8.2). Im Kern rekurriert das Anthropozän auf anthropozentrische Reflexionsebenen, die danach fragen, »wie die Menschheit als kausale Wirkkraft im Erdsystem zu verstehen ist und wie Menschen über ihre eigene Rolle darin reflektieren.«91
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass der Nucleus des Epochen-Konzepts ›Anthropozän‹ um den ›Anthropos‹ kreist. Die anhaltenden Debatten um das ›Menschenzeitalter‹ zeigen, dass es darum geht Menschen und ›Menschheit‹ aus ihrer posthumanistischen Negation zu lösen und sie neu zu denken. Das Anthropozän-Konzept beschreibt erdsystemische Prozesse, die mit einem grundlegenden Kulturdeterminismus des Menschen und dessen Auswirkungen korrelieren. Es kann deshalb (aus interdisziplinärer Perspektive) gesagt werden, »dass es spezifische Eigenschaften des Menschen als ganz besonderem Tier und besonders die Effekte seiner Kulturfähigkeit sind, die diese Wirkmacht erst ermöglichen.«92 Es ist in besonderem Maße die zerstörerische Kulturbezogenheit der modernen Industrienationen, welche das Anthropozän adressiert. Dieser kulturellen Entwicklungsspur und den damit verwobenen anthropologischen Perspektiven folgende wir in der Studie »Denken in großen Bildern.« In summa geht es uns keineswegs um die Negation anthropogener Vielfalt, sondern vielmehr um Reflexionshorizonte und Denkansätze, die Menschen und eine partikulare ›Menschheit‹ in kulturgenetischer Perspektivität in ihr Zentrum stellen.
C)
Exkurs: Reflexion statt Normativität?
Gegenwärtig sind auf die globalen Krisen gerichtete – insbesondere auf den steigenden Ressourcenverbrauch – und menschheitsgeschichtlich angelegte Darstellungen in der populären Wissenschaftspublizistik zu verzeichnen. In Kapitel 2.2.3 werden wir auf Ian Morris und dessen energiebilanzierende Menschheitsgeschichte verweisen. Auch der Sozialpsychologe und Zukunftsvisionär Harald Welzer macht uns neuerdings bewusst, dass »in nur hundert Jahren mehr Energie verbraucht (wurde) als während der kompletten 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte davor.«93 Johannes Krause und Thomas Trappe sprechen in diesem Zusammenhang vom »Homo Hybris«, der die Herausforderungen des 21. Jahrhundert ganz entgegen seiner in den Genen festgeschriebenen raubbauhaften Naturnutzung zu meistern habe. Und vor allem unfähig sei, die Grenzen des ökonomischen Wachstums zu akzeptieren94 (vgl. Kapitel 2.5.3). Krause und Trappe geht es in ihrem paläogenetisch-anthropozentrischen Narrativ um nichts Geringeres als um die Rettung der menschlichen Zivilisation, die in ferner Zukunft möglicherweise als »kulturelle Leistung (begriffen werden könne und) [...] von der unsere Nachfahren vielleicht genauso ehrfürchtig berichten, wie wir heute über die ersten Höhlenmalereien der Steinzeitmenschen reden.«95 Dieser normative Anspruch scheint vor dem Hintergrund des Anthropozäns mehr als nur berechtigt, er ist vielleicht zwingend geworden. Dass es zum ›Verständnis‹ und zur ›Einsicht‹ dieser von Krause und Trappe proklamierten »kulturellen Leistung« der Reflexion historischer Tiefenperspektiven bedarf, steht außer Frage. Historisches Lernen und Denken kann vor dem Hintergrund des Anthropozäns nicht mehr nur in Perspektiven auf Menschen in ihrer quellengreifbaren Geschichtlichkeit verhaftet bleiben. Das Anthropozän provoziert einen geweiteten Fokus anthropologischer Fragen- und Perspektivenkomplexe und zwingt zu umfassende und vor allem systemische Perspektiven auf die Spezies ›Mensch‹ in ihrem Verhältnis zum Planeten Erde (vgl. Kapitel 2.5.2). In diesen umfassenden Fokus kann unser Strukturmodell kaum vordringen: In Kapitel 8.2 modellieren wir historisches Lernen im ›Universum‹ des historiographisch darstellbaren Anthropozäns in einem spezifischen Fokus auf ›Homo‹ und ›Anthropos‹, die wir in eigenen Vorstellungen von einer Menschheit(-sgemeinschaft) konzeptionalisieren (vgl. Kapitel 2.5.3).
Vor dem Hintergrund des oben skizzierten anthropozänen Denkens geht es in der Studie »Denken in großen Bildern« darum, Überlegungen zum historischen Lernen im Anthropozän, das auch auf kulturanthropologische Tiefendimensionen rekurriert, zu systematisieren und sie in einem Modellvorschlag der geschichtsdidaktischen Diskussion auszusetzen. Mit dem Entwurf eines Strukturmodells möchte die vorliegende Arbeit dem »selbstreferenziellen Beschwören des Eigenwertes und der Eigendignität empirischer Forschung«96 entkommen. Wir greifen damit an dieser Stelle jene Skepsis gegenüber empirischen Studien auf, die Wolfgang Hasberg bereits 2007 äußerte. Wozu ist qualitative Forschung, schon hinsichtlich ihrer geringen bis sich selbst ausschließenden Objektivierbarkeit ihrer Ergebnisse, nütze, als zur Fundierung einer Theorie für die unterrichtliche Praxis? Tatsächlich sehen wir hierin die Intention der Studie »Denken in großen Bildern«: Zum einen geht es uns darum, Thesen zu generieren und sie einer Prüfung an der empirischen Praxis auszusetzen. Zum anderen möchten wir in Kapitel 8 jedoch vor allem Theoriebildung für die unterrichtliche Praxis betreiben. Denn nur im Geschichtsunterricht, so unsere Hypothese, lassen sich mit jungen Menschen kulturhistorische Blickwinkel auf das Anthropozän werfen, die für ein vertiefendes Verstehen umfassender Zusammenhänge, Gegenwartsanalysen und Zukunftsperspektiven unverzichtbar sind.
Fragen, die das Anthropozän zur Positionierung des Menschen im (künftigen) Weltgeschehen stellt, provozieren normative Perspektiven, die sich (auch) um Verantwortlichkeiten des Menschen drehen, die Ökologie des Planeten zu erhalten.97 Nicht selten sind solche normativen Ansätze im Kern speziesistisch ausgelegt, da sie ›Nachhaltigkeit‹ in Korrelation nachfolgender (Menschen-)Generationen modellieren. ›Resilienz‹ wäre im Kontext des Anthropozäns das umfassendere Konzept, das mit dem Wissen über die erd-systemische Einbindung des Menschen korreliert.98 Am Beispiel von ›Resilienz‹ zeigt sich das eingangs bereist vorgestellte »anthropozentrische Paradoxon«99. Der hier nur angedeutete normativen Anspruch, der dem anthropozänen Denken inhärent ist, kann in dieser Studie nicht weiterverfolgt werden, er müsste von der Geschichtsdidaktik in Bezug auf das historische Lernen in Theorie und Pragmatik aufgegriffen werden. Daniel Chernilos anthropozentrisches Paradoxon verdeutlicht, dass im Fokus des Anthropozäns natur- und kulturgenetische Perspektivität sich wechselseitig bedingt und es beim historischen Lernen makroskalierter Blickwinkel bedarf. Das Anthropozän stellt in seiner Dialektik die Geschichtswissenschaften bzw. der Historiographie vor Herausforderungen: Geschichtswissenschaftliches Forschen war immer auf menschliche agency bezogen. In der geschichtsdidaktischen Diskussion müsste es im Fokus anthropozäner Denkfiguren verstärkt darum gehen, das oben erwähnte »Planetare« und damit die Dezentrierung des Menschen aufzugreifen. Anthropozänes Denken überträgt agency auf nicht-humane Ebenen.100 In der Studie »Denken in großen Bildern« lässt sich dieses speziesübergreifende Denken nicht weiter vertiefen. In den folgenden Abschnitten wird neben anderen makroskalierten Historiographieperspektiven das Konzept der Big History vorgestellt, das diesem Ansinnen in seinen großskalierten Erzählebenen nachzukommen versucht. Wir verfolgen in der Studie »Denken in großen Bildern« makrohistorische Narrativierungen in Bezug auf historisches Denken.
Das Anthropozän fordert Möglichkeiten des historischen Denkens, Verstehens und einer möglichen anthropologischen Ontologie heraus.101 In summa zielt das Anthropozän als Reflexionskonzept darauf, uns als Menschen reflexiv zu dezentrieren102