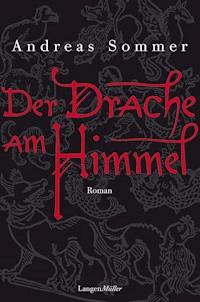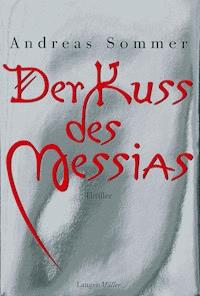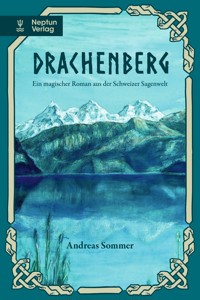14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verschworene Clique. Damals, in der Provence: Vier junge Menschen voller Ideale und mit verschiedenen Sehnsüchten stürzen sich ins Leben. Joël will Künstler werden, Gina Ärztin in der dritten Welt. Pio will als Lehrer und Bastian als Politiker die Welt verändern. Heute, Jahrzehnte später in der JVA, ziehen sie Bilanz: Während sie glaubten, ihr Leben zu gestalten, schlug das Schicksal ganz schöne Kapriolen, aus kleinen Geschehnissen entstanden große Veränderungen. Warum hatte die Umarmung des Dalai Lama völlig andere Auswirkungen als die chinesischen Schriftzeichen von Ai Weiwei? Besonders präsent ist jedoch der Fünfte im Bunde, der nicht mehr da ist: Vincenz. Sein Verlust schmerzt bis heute und hinterlässt Schuldgefühle. Wie konnte es nur so weit kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andreas Sommer
Freunde
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2016 LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung nach einem Entwurf von Julien Junghäni
Umschlagfotos: shutterstock
Satz und eBook-Produktion:
Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
www.Buch-Werkstatt.de
ISBN 978-3-7844-8258-3
Die Selbsttäuschung beherrscht
der Mensch noch sicherer als die Lüge.
DOSTOJEWSKI
Für Gina,
die als Einzige keine Änderungen am Manuskript verlangt hat.
Vorspann
»… ein Wendepunkt in meinem Leben?« Bastian verzieht das Gesicht, als sei Ginas Frage eine Zumutung.
Wir befinden uns in unserem kargen Bio-Labor. Vier Stühle um einen fleckigen Holztisch. Knapp über Kopfhöhe schweben unzählige blaue, graue, gelbe und weiße Notizzettel, mit Wäscheklammern an hin- und herlaufenden Plastikleinen befestigt; sie streichen einem unweigerlich übers Haar, wenn man umhergeht. Im vergitterten Fenster ein Rechteck blauen Himmels. Wir sind amtlich bewilligt beisammen in diesem Raum der Justizvollzugsanstalt Pottwyss.
Bastian knetet seine Nasenspitze wie immer, wenn er unentschlossen ist. »Doch … einen gab es! In diesem Blitzlichtgewitter … in Paris«, sagt er wie entrückt. »Der Dalai Lama zieht mich an seine Seite, umarmt mich, und schlagartig weiß ich: Ich bin zurück aus der Versenkung.« Bastian Grimm, Politiker, der Eloquenteste unseres Quartetts.
Danach ist es ein Gebot der Fairness, dass auch Gina, Joël und ich unsere Wendepunkte preisgeben.
»Meine Ankunft in Lissabon, als mich Staatspräsident Soares umarmte. So schlecht roch Mario, dass ich dachte: Liebe macht blind. Niemals hätte ich Tiego in seine Heimat folgen dürfen.« Das sagt die willensstarke, schöne Gina Bianchi, eingewanderte Italienerin, unsere Idealistin.
»Bei euren Wendepunkten muss wohl stets ein Promi dabei sein«, spottet Joël, der Künstler. Gina übergeht ihn: »Und dann, als mir vor der Spitalbaracke in Accra der Junge unter den Händen wegstarb. Nach dem Busunfall, als sie den schwer verletzten Fahrer verprügelten …«
Verlegen nestelt Joël an seiner Brille mit den rotgetönten Gläsern.
Um ihn aus seiner Beschämung zu erlösen, präsentiere ich meinen Wendepunkt: »Im Dschungel mit Geronimo. Als er mit ironischem Blick auf die Armbanduhr gesagt hat: ›Ich gebe euch zehn Jahre, um euren Banken ihre unseligen Geschäfte mit den Bösewichten dieser Welt abzugewöhnen.‹ Er meinte das Bankgeheimnis, und ich dachte etwas wie: Wette angenommen!«
Stimmt doch nicht, widerspricht es in meinem Kopf. Der entscheidende Augenblick kam viel später: Ich mit Lani in der Bar in Zürich, unter diesem riesigen Ventilator. Mein Gesicht im Spiegel unter den leuchtenden Likörflaschen blickt mich voller Verachtung an. Ich presse die Lippen zusammen, während mein Spiegelbild seine bewegt. Und ich glaube sogar zu hören, was es sagt: Lahmarsch! Verräter!
Bastian grinst: »Wette angenommen, nicht schlecht. Vom Dschungel in den Knast – mein Gott, Pio, wenn das kein schlüssiger Lebenslauf ist.«
Draußen nähern sich Schritte, von Gesetzes wegen selbstsicher. Gleich wird der Beamte seinen kontrollierenden Blick hereinwerfen.
»Ich will es hinter mich bringen«, seufzt Joël. »Wenn Wendepunkt meint, dass man eine Art Erleuchtung hat, dann hat es auch mich zwei Mal getroffen. Eva schießt auf ihrem Roller mit fliegendem roten Schal auf mich zu, und ich erkenne: diese Frau! Sie ist es!« Die Schritte im Korridor verhallen. »Die andere Wende geschah bei dir, Pio, in Brighton. Als ich mich auf die Zeichnungen deiner Zwillinge erbrach und sie danach minutiös kopierte, damit sie von dieser Schändung nie erfahren würden.«
Wir alle blicken Joël irritiert an, und Bastian ruft: »Ich kapituliere vor einem Schicksal, das sich solche Kapriolen leistet. Weil du Kinderzeichnungen vollgekotzt hast, bist du berühmt geworden?«
Überraschend steckt der Wachmann seinen Kopf doch zur Tür herein. »So ein Atomdings ist explodiert«, sagt er, grinst. »Keine Sorge, drüben in Japan, in Fujarama oder ähnlich. Schluss für heute, meine Herren! Die Dame ist natürlich mit gemeint.«
PREMIÈRE SAISON –
Der Dschungel ist nie still
I
Grattage! Unter der Sonne der Provence ist das Sklavenarbeit. Gratahsch mit weichem Schlusslaut.Stundenlang. Tagelang. Den Fäustel in der einen und den Meißel in der anderen Hand. Gina und Bastian stehen auf Leitern, Joël und ich auf einem Baugerüst. Vor uns die lange, drei Meter hohe Wand, eine gelbgraue Zumutung. Irgendwo in einer Ritze des Verputzes setzen wir den Meißel an, auf den wir den Fausthammer schlagen. Als Belohnung splittert ein klitzekleines Stückchen alten Mörtels weg. Das wiederholt sich hundert, zweihundert Mal. Unsere Finger sind wund, auch wenn wir mittlerweile mehrheitlich den Meißel treffen. Gott der Werktätigen, habe ein Einsehen!
Ich habe die dreihundert Jahre alte Ruine für siebzigtausend französische Francs erworben, knapp zwanzigtausend Schweizer Franken. »Geborgt«, habe ich auf Ginas Frage nach meiner Geldquelle gesagt – erleichtert und beschämt zugleich, als sie sich damit zufriedengab. Ich habe uns zu einer Art Fluchtburg verhelfen wollen; die Gläubiger wissen nichts von dieser Leihgabe …
Joël schnaubt triumphierend. Eben hat sich unter seinem Schlag ein Stück so groß wie eine Untertasse gelöst. »Paff! Habt ihr das gesehen?«
»Lass uns noch was übrig!«, ruft Bastian mit der Ironie der Verzweiflung. Gina hat nicht einmal hingeblickt, sie lässt sich nicht ablenken. Dazu ist sie zu eifrig und zu ehrgeizig. Sie schafft es sogar, abends noch für ihr Fernabitur zu lernen. Joël nennt sie ein Monster der Selbstdisziplin.
Ich habe Joëls Großtat gar nicht mitbekommen. Schweigend blicke ich hinaus in die wilde Garrigue, glücklich mit meiner Bidi. Die anderen halten mich ohnehin für wortkarg. In der nächtlichen Runde gestern hat Joël verkündet, warum ich bei »der gesamten Menschheit« sympathisch rüberkomme: »Pio, du bist ein Mensch, der wenig Erdoberfläche beansprucht! Deine Füße zum Beispiel: skandalös klein für deine eins neunzig. Ein schmales Gesicht hast du auch, sogar deine Ohren liegen eng an.«
»Stimmt, du bist der einzig wirklich Sympathische von uns, und deine Nase ist schön schmal«, hat Gina gemeint. Ich habe um Themenwechsel gebeten.
Wir vier sind »zertifizierte Revolutionäre«. Diese Klassifizierung stammt von Bastian, dem Studenten der Politologie. Er ist mittelgroß und wirkt jungenhaft, sein Gesicht ist eher rund. Überhaupt ist er ein Eher-Typ: das blonde Haar eher lang, der Mund eher breit, die Nase eher klein. Dennoch hat er eine männliche Ausstrahlung. Vermutlich liegt das an seinen eindringlich blauen Augen und an der eigenartigen Beherrschtheit um den Mund. Man bekommt den Eindruck, als müssten die Laute sich ducken, um hindurchzuschlüpfen, als schärfe er sie an den Zähnen. Doch er spricht mit angenehmer Stimme. Wenn uns die Ruine eine böse Überraschung beschert – wie vorgestern, als der Küchenboden einbrach –, sagt er bestimmt: »Mich als zertifizierten Revolutionär kann das nicht erschüttern.« Darin steckt natürlich Selbstironie, aber irgendwie fühlen wir uns immer noch als Teil der sandinistischen Revolution in Nicaragua.
Vor Kurzem erst sind wir vom dreimonatigen solidarischen Ernteeinsatz zurückgekehrt. Das Pflücken der Kaffeebohnen in der heruntergekommenen Plantage war härter als die verfluchte Grattage hier. Die Arbeitstage zogen sich brutale zehn Stunden hin, danach nächtliche Patrouillengänge, weil die Comandantes Überfälle durch die von der CIA unterstützten Contras befürchteten. Wir alle hatten Angst, auch wenn wir es aus Stolz oder Feigheit nicht zugaben. Schließlich hatten die jungen Sandinos, die mit uns schufteten, im Kugelhagel gestanden, hatten Genossen verbluten gesehen. Wir dagegen kamen aus der Schweiz, einem braven Land, das einem nur geordnete Lebensläufe zugestand. Joël wollte außerdem die schöne Genossin Gina beeindrucken, die mit Vincenz zusammen war. Und Vincenz war der King. Gut aussehend, intelligent, mutig, treu, visionär – er würde es der Welt noch zeigen! Einen ersten Beweis hatte er schon geliefert, indem er einen argen Ausbeuter souverän bloßstellte – den eigenen Vater notabene! Auch deswegen hatte Gina sich in Vincenz verliebt.
Grattage! Eintönige Maloche hat auch Vorteile, man kann die Gedanken schweifen lassen. Die Sonne brennt uns auf Kopf und Haut. Die Zikaden lullen uns mit ihrem irren Zirpen ein. Wir setzen an und schlagen und treffen und schlagen und denken an …
Gina sorgt sich um die Mohnhaupt von der Roten-Armee-Fraktion, die lebenslangen Knast gefasst hat. Sie leidet echt mit, was wir lange nicht begriffen haben. Vielleicht malt sie sich Schlag um Schlag einen Coup aus: nur Frauen! Mit Power und List die Mohnhaupt rausgeholt! Das alte Haus hier in diesem provenzalischen Winzerdorf wäre ein ideales Versteck.
Oder sie denkt an ihren Vater Pietro. Gestern ist ein Telegramm gekommen, dass er wegen einer Lungenentzündung ins Spital eingeliefert wurde. Gina liebt ihren Vater sehr. Ihre Mutter starb bei einem Unfall, als sie sieben war. Pietro, Einwanderer aus den Abruzzen, ist ein feiner Mensch und ein verlässlicher Mitdemonstrant. Als wir seinerzeit die ehemalige Villa Konrad Toblers, des Erfinders der famosen Toblerone, besetzt hielten und das Areal von Polizeigrenadieren abgeriegelt war, belieferte uns Pietro auf Schleichgängen mit Wein, Brot, Wurst und Äpfeln. Er kennt bestimmt zweihundert revolutionäre Lieder aus aller Herren Länder und kann sie jederzeit vorsingen. Und die Szene bewundert ihn seit seiner Heldentat am 21. August 1968, als der Warschauer Pakt im Morgengrauen die Tschechoslowakei besetzt hatte. Da ohrfeigte Pietro vor der Botschaft den russischen Militärattaché. Das ist bezeugt, auch wenn es nie öffentlich wurde. Drei Schläge mit verbaler Verdeutlichung: »Traditore! Maiale! Assassino!« Ob Gina mit sich ringt, nach Hause zu fahren?
Trifft der Fäustel den Meißel, splittert auch ein metallischer Ton. Nur selten ergibt sich ein übereinstimmender Takt, aber wenn, dann horchen wir auf. Gerade haben wir uns wieder in diesem gemeinsamen beglückenden Rhythmus zusammengefunden, als ihn Gina mit einem triumphierenden Schrei auflöst. Sie schlägt tatsächlich eine Pause vor.
Gina? Ihre Schönheit wird ihr manchmal zur Last, dann bemüht sie sich darum, unvorteilhaft auszusehen. Bindet das lange kastanienfarbene Haar zurück, schlüpft in einen weiten, graubeigebraungrünlichen Overall. Sie hat schnelle, dezidierte und beherrschte Bewegungen. So ist auch ihr Geist.
Bastian wird wohl von Vitoria träumen, die in Matagalpa auf ihre Ausreise wartet. Bei seiner Sehnsucht und der derzeitigen chaleur dürften das schwüle Träume sein, erhitzte Leiber, Lust und Versinken. Vitorias wegen schwand seine Faszination für Kaffee und Ortegas Revolution. Kaum waren wir auf der Plantage, verfiel er dieser unbändig lachenden schwarzhaarigen Sandinistin und ihrer exotischen Haut. Und sie hatte ein Einsehen. Bastian will sie allen Widerständen zum Trotz im Herbst in die Schweiz holen. Weder die Fremdenpolizei noch die skeptischen Frauen seiner WG in Bern können ihn bremsen. Sonst ist Bastian, der Eher-Mann, eher abwägend und eher unschlüssig, aber nicht bei Vitoria.
Auch Joël hängt seinen Gedanken nach. Mit seinen langen Haaren und dem weichen Gesicht gilt er als hübscher Kerl. Er gleiche dem jungen Brando, befand Bastian einmal. Das Urteil behagt Joël nicht, er will lieber interessant aussehen. Er hat sich angewöhnt, die Haare straff nach hinten zu binden, und neuerdings trägt er ein Brillchen mit rötlich getönten Gläsern aus Fensterglas. Dass wir das wissen, weiß er nicht. Seit ihm jemand gesagt hat, die rötlichen Gläser wirkten affektiert, hat er sich eine listige Antwort ausgedacht: »Ich habe stets die Morgenröte der Revolution vor Augen.« Im Übrigen wartet er darauf, dass seine Zukunft als erfolgreicher Künstler endlich beginnt. Die Welt liebt und lobt seine Bilder.
Joël mag sich jetzt vorstellen, dass sein Fausthammer von einem Versteigerer geschwungen wird – bei Sotheby’s, warum nicht. Die Bieter übertrumpfen sich. Die Kunstwelt staunt. Aufregung im Saal. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Ein neuer Rekordpreis für einen echten Joël Rauch!
Ich selbst träume nicht, sondern plane. Darin liegt mehr Ordnung. Für Balken, die hochgestemmt werden müssen, benötigen wir einen Flaschenzug. Wir müssen uns einen Betonmischer besorgen. Auch sollten wir uns endlich klar werden über den Zugang zur oberen Terrasse. Bastian behauptet, als Einziger unseres Quartetts würde ich glauben, dass man sein Schicksal steuern könne. Vermutlich hat er recht. Und Gina meinte einmal, während sie mir ins wirr gekrauste Haar fasste: »Erstaunlich, dass in deinem Kopf so viel Ordnung herrscht.« Da täuscht sie sich allerdings.
So könnte jeder für sich geträumt und fabuliert haben; was wissen wir denn dreißig Jahre später noch mit Gewissheit? Nicht auszuschließen ist auch, dass wir alle in derselben dunklen Gedankenwolke trieben: dass wir an den verlorenen Vincenz dachten.
II
Als wir fünf an einem Regentag im November 1982 in ›Findel‹, dem Flughafen von Luxemburg,die Aeroflot-Maschine nach Managua besteigen, beschleichen uns gewisse Zweifel an der Überlegenheit des Sozialismus. Alles wirkt schmuddelig, aus Rissen in den Sitzpolstern quellen braune Innereien. Joël bemüht sich, nicht an den Wartungszustand der Triebwerke zu denken, während er zunehmend hektisch versucht, die Gepäckklappe zum Einrasten zu bringen. Vincenz stopft zornig das Leselämpchen, das an einem Kabel über seinem Sitz baumelt, zurück in die Halterung. Als Einzige ist Gina heiter gestimmt. Die kyrillischen Schriftzeichen auf ihrer Gurtschnalle entzücken sie sogar: »He, Leute, echt russisch, dieser Kahn!« Sie hat zweifellos recht. Bastian summt vor sich hin, um gelassen zu wirken. Leider entdeckt er zwei Schrauben, die aus der Verkleidung stechen. Flugs greift er nach seinem Schweizer Taschenmesser mit Schraubenzieher. Ihm entgeht Ginas spöttischer Blick, als er beschwörend »Venceremos!« murmelt. Ich selbst setze auf das Prinzip der Fairness: Niemals kann Unheil auf einem Flugzeug liegen, das neunzig Brigadisten zum uneigennützigen Ernteeinsatz nach Nicaragua bringt.
Die Motoren heulen auf, und die Kabine vibriert wie unter Stromstößen. Was kann, klirrt oder scheppert. Aeroflot hebt ab. Sonnenlicht flutet die Kabine. Unfassbar, dass wir es geschafft haben: Wir fünf Freunde fliegen in das Land von Sandino. Somoza, dieser Teufel, ist weg und tot. Die Sandinisten bauen ein gerechtes Land auf, und wir werden dabei sein. Solidarität ist das ultimative Heilmittel für die kranke Welt. Lust am Abenteuer? Wir würden jeden zurechtweisen, der uns das unterstellen würde. Nein, wir haben einfach genug von den Vorschwätzern der linken Szene.
Besonders Gina sind Anführer suspekt. Auch Ortega wird nicht besser sein, meint sie. An die Macht kämen unvermeidlich die Machtmenschen, pflegt Pietro, ihr Vater, zu sagen. Ihr geht es einzig darum, etwas zu tun, was den Armen und Ausgebeuteten nützt. Handfest! Jetzt!
Es fühlt sich gut an, mit ihren vier besten Freunden auf dem Weg zu sein. Endlich einmal haben sie nicht nur geredet, sondern gehandelt. Gina mag alle vier, und die Vorstellung, dass man aus ihnen den idealen Mann zusammenfügen könnte, erheitert sie. Joël ist der unterhaltsame Glücksritter. Bastian bringt die Dinge zum Laufen. Mich schätzt sie als verlässlich und familientauglich ein. Und mit Vincenz schläft sie, weil er ein mutiges Herz hat und keiner dieser »Radarmänner« ist. »Ihr Kerle zapft mir die Freiheit ab! Ständig eure Lustblitze auf meinem Po.«
»Was erwartest du denn?«, hat Bastian erwidert. »Dass ich eine erotische Frau auf ihren Charakter und ihre Intelligenz reduziere?«
»Im Prinzip hast du recht«, hat Joël gesagt. »All die Bücher, die ich lesen könnte, wenn ich nicht andauernd den Frauen auf Po und so weiter gucken würde.«
Vor einigen Monaten hat Gina ihre engen Jeans entsorgt und eine fast diebische Freude an schlabbrigen Overalls entdeckt. Ihre hennaroten Haare bindet sie jetzt meistens zum Zopf.
III
»Aeroschrott ist gelandet«, spottet Joël, als das Flugzeug heftig rüttelnd in Managua aufsetzt. Nicht der versprochene Bus, sondern ein Laster bringt uns vom Flughafen weiter nach Matagalpa. Lange vier Stunden werden wir auf der Ladefläche durchgeschüttelt. Zwischen ruckelnden Köpfen formen sich unsere ersten Eindrücke vom Land: wuchernde Vegetation auf weiten Feldern, aufschießendes Gebüsch und immer wieder Hütten aus Brettern und Blech. Um die Behausungen sind kaum je Männer zu erblicken. Dafür winken uns halb nackte braunhäutige Kinder zu. Manchmal sind Tiere zu sehen, Bastian und ich können uns nicht einigen, ob es Ziegen oder Schafe sind. Bei einem Reittier, an dem ein niedliches Mädchen in lässiger Pose lehnt, stimmen wir allerdings überein: bloß ein Esel! Wir haben stolze Pferde erwartet wie auf jenem legendären Foto von Sandino und seinen Mitkämpfern.
Der sandinistische Comandante, der uns in Matagalpa begrüßt, muss lange auf uns gewartet haben, denn er legt los, noch bevor wir uns zum Halbkreis gefunden haben.
»Brüder und Schwestern, Genossen und Genossinnen aus Europa! Ihr seid mehr als eine Verstärkung. Ihr seid die neue Welt!« Mit seinem Béret erinnerte er uns ein wenig an Che. Ein Gewehr älteren Kalibers schwingt an seiner Hüfte, wenn er gestikuliert. »Satanás está muerta, der Satan ist tot«, ruft er. »Aber noch sind nicht alle Feinde besiegt. Contras und CIA kämpfen heimtückisch weiter. Und sie kennen nur diese Sprache!« Er tätschelt seine Waffe.
Einzig Vincenz spricht gut Spanisch; Gina als Seconda, Tochter eines italienischen Einwanderers, versteht es einigermaßen. Als Joël sie zum Übersetzen drängt, wendet sie ihm ein spöttisches Gesicht zu: »Er bietet dir einen Job auf einer Plantage des Volkes an.«
»Cannabis, hoffe ich?«
»Kaffee!«
Bereits in Managua sind wir in drei Gruppen aufgeteilt worden. Wir gehören zu den achtundzwanzig, die einer Plantage in den Bergen zugewiesen sind. Wir werden sie nach einer weiteren Rüttelfahrt noch an diesem Abend erreichen. Der Comandante hebt zu einem Lied an. Sein Blick lässt keinen Zweifel daran, dass er allgemeines Mitsingen erwartet. Dank Pietro kennt Gina als Einzige die Melodie und den Text des Refrains. Wir anderen schummeln uns durch, glücklich über jedes Wort, das wir verstehen und nachbeten können – Victoria! Revolución!
In der Nacht erreicht der Laster einen lehmgestampften Platz, erleuchtet vom flackernden Licht brennender Reifen. Um uns herum ist Dschungel, von einer Plantage ist nichts zu sehen. Doch da ist dieser stämmige Mann, der uns alle einzeln und mit nicht nachlassender Herzlichkeit umarmt. Ich höre noch jetzt seine raue Stimme: »Mi nombre es Geronimo. Bienvenido, mi amigo!« Das ist nicht nur so dahergesagt. Geronimo wird uns fünfen zu einem guten Freund. Zum Weinen ist das.
IV
Vincenz, der Sohn! Fils à Papa. So schätzen wir ihn ein, als er Anfang 1980, zwei Jahre vor Nicaragua, in unserer Szene auftaucht. Seinem Vater gehört das Bel Etage, dasführende Kaufhaus der Stadt in bester Lage, eine monopolytaugliche Adresse. Die Marquards gelten als reich, Hannes Marquard als konservativ, was wir mit reaktionär gleichsetzen. Er führt das Unternehmen in der dritten Generation.
Mag sein, dass wir Vincenz insgeheim um seinen Hintergrund beneiden. Bastian etwa kann sich Anspielungen nicht verkneifen: Vincenz’ Herz könne schlicht nicht authentisch links schlagen. Trotzdem wird er schnell beliebt. Stets gut gelaunt, bescheiden und hilfsbereit besorgt er noch um zwei Uhr nachts Stoffbahnen für die Transparente der Demo. Marcuse und die anderen hat er auch gelesen. Und seine Plattensammlung mit Protestsongs aus der ganzen Welt haut uns um. »Er hat ja auch mehr Kohle als wir«, kommentiert Bastian. Nachdem Vincenz Ginas Vater Pietro singen gehört hat, schenkt er ihm ein paar echte Raritäten, einfach so. Peat Bog Soldiers aus dem spanischen Bürgerkrieg in einer Live-Aufnahme mit Paul Robeson. Live auch Woody Guthrie mit Vigilante Man. Doch Vincenz geht mit seiner Freigebigkeit nicht hausieren. Nur weil Gina zufällig dahintergekommen ist, erfahren wir davon. Vinzenz’ Anspruch, man müsse dem Klassenfeind an Ausdauer überlegen sein, belachen wir zwar, doch dann kommt uns zu Ohren, dass er den Berliner Marathon in drei Stunden zwanzig gelaufen ist. Wir staunen. Das ist keiner, der es bequem will, Herkunft hin oder her. Dann sieht er auch noch gut aus. Groß gewachsen. Dichtes dunkles Haar. Ein Schwarm Sommersprossen unter den grünen Augen. Ein Makel ist vielleicht, dass seine Miene oft eine gewisse Verwöhntheit verrät. Doch als er uns eines Abends gesteht, sich manchmal für diesen Gesichtsausdruck zu hassen, sind wir entwaffnet.
Vom fabulösen Notto, seinem Gesellenstück in angewandtem Sozialismus, erfährt die Szene ebenfalls nur auf Umwegen. Doch von da an ist Vincenz ein Häuptling. Wer die Geschichte aufgedeckt hat? Die rundliche und radikale Mathilde, die damals im Lager des Kaufhauses arbeitete. Das Bel Etage wurde von Hannes Marquard nach einem schlichten Prinzip geführt: Das Geld bekommt der Boss! Er drückte die Löhne. Drängte ältere, müde Verkäuferinnen in den vorzeitigen Ruhestand. Überzog die Firma periodisch mit Effizienzprogrammen. Dabei muss ihm eine ehrwürdige Einrichtung, die auf den Firmengründer zurückging, ein Dorn im Auge gewesen sein: ein gemeinnütziger Hilfsfonds, den das Bel Etage mit mittlerweile dreißigtausend Franken pro Jahr alimentiert. Was damit gemacht, wer davon unterstützt wird, entscheidet ein kleines Gremium von Angestellten. Dem Patron schuldet es keine Rechenschaft. Arbeitskräfte in einer Notlage können also auf einen Zuschuss aus diesem Fonds hoffen. Die Belegschaft hat ihn schon in den Dreißigerjahren Notto, Abkürzung von Not-Topf, getauft. Peter W. spricht beim Notto vor, weil ihn eine Zahnarztrechnung um den Schlaf bringt. Lehrtochter Mirjam O. sieht keinen anderen Ausweg als einen diskreten Schwangerschaftsabbruch – Notto! Der Notto ist legendär. Er ist heilig. Da kappt Hannes Marquard den Zuschuss. Die Empörung ist gewaltig. Marquard bleibt stur. Das Gremium trifft sich nun zu geheimen Nachtsitzungen im Lager. Schließlich hat jemand eine Eingebung. Man wird den Notto selbst alimentieren, auf Kosten des Hauses. Die Lagerbewirtschaftung muss eben flexibler werden. Nicht mehr alles, was reinkommt, wird kleinlich erfasst. Und auf dem Schwarzmarkt werden für bestimmte Produkte interessante Preise gezahlt.
Vincenz besuchte in dieser Zeit – eben doch der Sohn! – eine Handelsschule in Montreux. Zu seinem Entsetzen stellt sich heraus, dass er kaufmännisches Talent hat, Marketing liegt ihm. Er ist ein glänzender Verkäufer mit frischen Ideen. Und in den Ferien jobbt er in der Buchhaltung des Bel Etage. Die Leute mögen ihn. Er ist zwar der Sohn des Patrons, aber offensichtlich ein Apfel, der ziemlich weit vom Stamm gelandet ist. Vielleicht bekommt er deshalb Wind von gewissen Aktivitäten unten im Lager. Uns hat er nie davon erzählt. Tatsache ist, dass er eines Nachts das Gremium belauscht und jäh vortritt.
»Seid ihr wahnsinnig!«, interveniert er laut Mathilde.
Die in flagranti ertappten Angestellten erstarren, sie sehen sich schon gefeuert oder vor Gericht. Luigi Pagano, der langjährige Nachtwächter, soll allerdings versucht haben, Vincenz zu beruhigen. Doch der ist in Rage: »Ich bin echt empört, wie schlecht ihr das organisiert! Jetzt habe ich euch eine halbe Stunde zugehört. Ihr habt ja keine Ahnung! So billig könnt ihr diese Dreiräder und Tagesdecken doch nicht anbieten. Ihr müsst das ganz anders aufziehen. Gebt mal die Listen her! Wie viel braucht ihr für diesen Notto?«
Als in der Szene durchsickert, wie Vincenz heimlich das Sparprogramm seines Vaters torpediert, ist ihm der Ruhm nicht mehr zu nehmen. Der Sozialismus ist dem Kapitalismus also doch überlegen! Solidarität schlägt Rendite! Die sozialistische Bewegung ist nun mal auf Bürgersöhne angewiesen, siehe Lenin, siehe Che. Hoch lebe Vincenz! Es könnte sein, dass Gina von da an den subversiven Rebellen mit anderen Augen betrachtet. Jedenfalls steigt sie kurz danach mit ihm ins Bett, sinnigerweise in der Bettenabteilung im 4. Stock. Bel Etage!
V
Zwölf Nägel für zwölf Brigadisten, um Hab und Gut daranzuhängen. Die rund zwei Dutzend Quadratmeter Lehmfläche der Hütte gehören uns gemeinsam, doch jeder hat seinen privaten Nagel … So werden unsere Rucksäcke in der Hütte zu hängenden Schränken. Man hatte uns schon vor der Abreise angewiesen, nur die nötigste Kleidung mitzunehmen, dafür gutes Schuhwerk, Teller, Besteck und Taschenlampen. Nützlich seien auch Taschenmesser. Diese wurden allerdings schon in Matagalpa eingesammelt, gleich nach der Rede des Comandante mit dem baumelnden Gewehr. Nur Bastian hat sein schönes Taschenmesser aus Schweizer Armeebeständen rechtzeitig in seiner Unterhose in Sicherheit gebracht. Vincenz und ich grinsen darüber, Gina jedoch ärgert sich: »Was bist du für eine Matschbirne! Kannst froh sein, wenn es nicht plötzlich aufklappt.« Für sie ist das Diebstahl am armen Volk Nicaraguas.
Dafür fassen wir am nächsten Morgen Macheten. An die ersten Tage erinnert sich keiner von uns gerne, sie waren brutal. Frühstück ist hier wörtlich gemeint: Im Morgengrauen gibt es zu dünnem Kaffee Bohnen und fade, salzlose Tortillas. Wieder ist es Bastian, der sich nach einer Woche dagegen auflehnt. Er protestiert bei Geronimo. Wir bekommen ihre kleine Auseinandersetzung mit.
Bastian: »Sogar Pappe schmeckt besser!«
Geronimo: »Wir sind ein armes Volk.«
Bastian: »So ein bisschen Salz kostet doch nicht die Welt.«
Geronimo: »Ohne Salz bleiben die Fladen länger essbar. Wir können es uns nicht leisten, etwas wegzuwerfen.«
Natürlich beschämt uns Geronimos Erklärung. Gleichzeitig wird uns bewusst, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Vielleicht kommen wir erst in diesem Augenblick richtig an – in der Dritten Welt, bei diesem geschundenen Volk, auf dieser von Dschungel und Konterrebellen bedrohten Plantage. Dass Geronimo einem dreizehnjährigen Indiojungen das Schießen mit einer Pistole beibringt, das ist nicht »schlicht kriminell«, wie wir gestern noch fanden. Die Mutter des Jungen, so erfahren wir, wurde von Somoza-Schergen vergewaltigt und ermordet, als er neun war. Unsere Wortwahl verändert sich. Das ewig gleiche Essen ist nicht mehr armselig, sondern vollwertig. Die militärischen Morgenappelle sind nicht mehr Scheiße, sondern tragisch: Ohne straffe Disziplin hätten die Sandinos den Sklavenhalter Somoza ja niemals besiegt.
Wir rackern täglich zehn Stunden. Dazu kommen die einstündigen Märsche zu den Kaffeefeldern und zurück. Als wir Macheten bekommen, stellen wir uns vor, wie wir damit die Kaffeebohnen von den Sträuchern schlagen. Ruckzuck, voll ist der Korb! Doch die Macheten dienen nur zum Freihauen der Pfade durch den Dschungel. Hier an den Berghängen des Hochlandes sind viele Plantagen lange vernachlässigt worden, jetzt müssen wir erst einmal an die eingewachsenen Sträucher herankommen. Dabei wäre das Schwingen und Schlagen ja eine befreiende Sache, wenn wir dabei nicht so ängstlich auf Wespennester und Schlangen achten müssten.
»Fatalismus ist eigentlich recht klug«, sagt Gina schon beim ersten Rückmarsch und haut rücksichtslos auf einen Dornbusch ein. Auch ich entdecke das bald, indem ich jeden Abend die Anzahl meiner Flohstiche in mein Tagebuch eintrage. Ob ich wohl den Rekord vom vorletzten Freitag übertreffe?
Als zu schwarzen Bohnen mit weißem Reis eines Abends auch noch rote Bete auf unsere Teller kommen, versetzt uns diese Trikolore in euphorische Stimmung. Schön sieht das aus. Rote Bete sind köstlich! Die Zukunft ist bunt! Wir werden Meister der Selbstsuggestion. Auch die nachts brennenden Autoreifen, die den Lehmplatz zwischen unseren Hütten beleuchten, stinken nicht, sie riechen nur streng.
Im Morgengrauen die Pfadfinderarbeit durch den Dschungel den Berghang hinauf, und die tägliche gute Tat ist schon getan. Beim ersten Kaffeestrauch das Körbchen an die Hüfte schnallen und den Ehrgeiz von der Leine lassen: Heute Abend will ich erwähnt werden!
Dieses Ritual konnten wir zu Beginn kaum ertragen. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass auf der abendlichen Versammlung die schlechtesten Pflücker bloßgestellt (die Sandinos sagen: ermahnt), die besten aber gelobt werden.
»Gina Bianchi hat heute großartige achtundfünfzig Kilo geerntet. Tritt vor, Genossin!« Tatsächlich gehört Gina häufig zu den Besten. An die Säcke, Genossen! Bastian meint, der Wettbewerb untergrabe die Solidarität. Umso verblüffter sind wir, als er eines Abends aufgerufen wird. Gleich drei Hornstöße gibt es für ihn, denn er hat den bisherigen Tagesrekord um zwei Kilo übertroffen. Er wird vom Chef des Camps umarmt, der auch die Geste imitiert, mit der ein Orden an die Brust gepinnt wird. »Genosse Grimm, achtundsechzig Kilo!« Zu Bastians Freude wird die Ehrung auch fotografisch festgehalten.
»Wir sind ganz und gar solidarisch mit dir«, lästert Joël danach. Bastian grinst verlegen: »Ich wollte es mir selbst beweisen. Dass ich es kann, wenn ich es will.« Der dabeistehende Geronimo lacht auf und ruft: »Yes, we can!« (Erst Jahrzehnte später, mit Barack Obama, wurde die Qualität dieses Ausspruchs offensichtlich …) Dann wendet er sich ab und marschiert davon. Tage später finden Gina und ich heraus, dass wir bei Geronimos Abgang das Gleiche herausgehört haben: Spott.
Geronimo lädt uns fünf in seine Hütte oben am Hang ein. Dort leben er und seine Frau, eine Misquito, mit ihrem dreijährigen Töchterchen. Auch die Nachbarn kommen, darunter eine junge Frau, Vitoria. Sie spricht, wie auch Geronimo, leidlich Englisch. Seine Einladung ehrt uns, das macht er sonst nicht. Warum er ausgerechnet an uns eine besondere Freude hat? Joël meint, wegen Gina. Aber es stellt sich heraus, dass wir das unserer Nationalität verdanken, Geronimo bewundert die Schweiz. Er hat viel gelesen über dieses »paraíso en la tierra«, wo Menschen durch Heben der Hände ihr Geschick bestimmen und dabei wohlhabend geworden sind. Naiv ist er nicht, er ist ein politischer Kopf. Aber wir fragen uns schon, welche Lektüren er intus hat.
»Wir Frauen konnten bis vor zehn Jahren nicht mal wählen«, sagt Gina.
Da verblüfft er uns. Er weiß um die Volksabstimmung zum Frauenstimmrecht und auch, dass zwei Drittel der Männer zugestimmt haben. »Nirgends sonst auf der Welt werden die Männer auf Idiotie überprüft. Und bei euch haben immerhin zwei von drei Männern die Prüfung bestanden.« Wir lachen. So kann man es auch sehen.
»Wir sind kein Paradies! Unsere Banken machen schweinische Geschäfte. Mit den Rassisten in Südafrika genauso wie mit eurem Somoza«, sagt Bastian.
»Ist mir bekannt. Aber bei euch kann das Volk alles ändern. In ein paar Jahren habt ihr diese Verbrecher abserviert. Es ist ja sehr freundlich, dass ihr uns bei der Ernte helft, ihr werdet auch jeden Tag besser.« Er lacht. »Aber wichtiger wäre, eure Banken in den Griff zu bekommen. Macht Revolution, aber eine kluge, also langsame. Revolutioniert die Gesetze. Das spart Blut. Ihr habt ein intelligentes System und braucht nicht euer Leben zu riskieren. Also los!« Er blickt auf seine Uhr: »Jetzt haben wir Ende 1982. Zehn Jahre gebe ich euch dafür.« Und er brüllt vor Lachen.
Wir sind hingerissen. Natürlich durchschaut er die Machtspiele in unserem Helvetien nicht. Aber in diesem Augenblick, an diesem Berghang im Dschungel, sind wir überzeugt, dass er recht hat. Wir mit unseren Flugblättern, unseren Theorien, sind einfach zu träge und zu brav. Er aber darf so reden. Er hat gekämpft. Er wurde verwundet. Sein Bruder ist im Kampf gefallen.
Bastian wird später sagen, in diesem Augenblick habe er sich für ein Leben in der Politik entschieden. Joël nimmt sich in dieser Nacht vor, nie, wirklich nie, harmlose und vor allem niemals bourgeoise Kunst zu machen. Vincenz umarmt Geronimo einfach. Mich selbst packt Zweifel, ja ein Ekel: Ich? Lehrer? Lebenslänglich in eine Schulstube verbannt? Und wozu? Um Kinder mit meiner Sicht der Welt zu impfen?
Und Gina? Sicher ist, dass sie eine Woche später erstmals davon spricht, das Abitur nachzuholen und Medizin zu studieren, um als Ärztin in die Dritte Welt zu gehen.
Große Pläne, heilige Einfalt – und doch waren wir nie besser. Leider lässt sich das Schicksal bestenfalls Vorschläge machen.
Mein Tagebuch datiert die Nachricht vom Überfall auf eine zwanzig Kilometer entfernte Plantage auf den 14. Januar. Die Contras haben einen fünfzehnjährigen Sandinisten niedergeschossen, um in den Besitz des kleinen Waffenlagers zu kommen, das jede Plantage zur Selbstverteidigung unterhält. Einigen von uns ist bei diesem Terrorakt ganz in der Nähe angst und bange geworden. Ich hingegen habe immer noch mehr Angst vor Schlangen als vor Contras. Die Contras können es sich einfach nicht leisten, dass ein Europäer getötet wird. So blöd kann die CIA, welche die Contras dirigiert, nicht sein. International wären die dann wirklich am Arsch!
Tage voller Anspannung, Nächte mit Alarmbereitschaft. Jetzt sind stets zwei Dreierpatrouillen unterwegs. Militärisches Gehabe sickert in unseren Alltag. Alles wird irgendwie straffer. Die Compagneros führen sogar die Schöpfkellen bei der Essensausgabe zackiger, findet Joël. Gerüchte gehen um. Unter den Studenten aus Managua, die vor zwei Wochen zu uns gestoßen sind, befänden sich Spitzel, heißt es.
Die andere Plantage habe um Hilfe gebeten. Nur von hier aus könne sie momentan erreicht werden. Unversehens läuft es auf uns hinaus. Es geht um eine Fahrt mit dem Toyota Cruiser, zwei Stunden hin, zwei zurück. Ein Überfall sei nicht zu befürchten. Nicht, wenn Erntehelfer aus Europa dort Freunde besuchten. Die Contras hätten noch nie Europäer attackiert. Es gehe vor allem um Medikamente, allenfalls noch ein, zwei Gewehre. Eine spontane Fahrt, von der niemand wissen soll … »Auch wir haben ja nur ein Gerücht vernommen«, spottet Vincenz.
Haben wir Angst? Oder sind wir eher geschmeichelt, sehen wir uns schon im anderen Camp jubelnd begrüßt? Dann hätten wir uns endlich einmal wirklich nützlich gemacht. Anderntags vernehmen wir, dass Geronimo allein fahren werde. Sind wir erleichtert? Möglicherweise. Doch wir geraten noch mehr ins Grübeln. Die Vermutung, dass wir mit unserem Status indirekt Geronimo schützen würden, ist nicht von der Hand zu weisen. Bastian und ich sind skeptisch, Joël und Gina wollen sich fügen. Vincenz gibt wenig preis. Einmal nennt er den Plan aberwitzig, ein andermal raffiniert. Doch wir glauben uns zu erinnern, dass er sich sonderbar benommen hat, sogar ein wenig hysterisch wirkte. Er sei sonst doch kein Angsthase, meint Gina. Seine Antwort irritiert uns: »Medikamente – dass ich nicht lache!«
Gina, Joël und ich wollen es schließlich wagen, Bastian und Vincenz scheinen noch unentschlossen. »Mal hypothetisch: Wenn wir drei fahren müssten, würdet ihr uns dann hängen lassen?« Ginas Frage löst bei Bastian Grinsen und bei Vincenz Empörung aus. Er beißt sich auf die Lippen. Doch dann sagt Bastian sehr sonor: »Wir sind keine Angsthasen, nicht wahr, Vinz?«
Vor allem Medikamente, ja. Leider auch etwas Munition und vier Gewehre. Aber eigentlich gehe es um die solidarische Geste, davon möchte uns Geronimo nun doch überzeugen. Noch vier Plätze gebe es. Und er blickt uns prüfend an. Gina, Joël und ich nicken. Vincenz und Bastian schauen sich an. »Ich habe es doch gesagt, wir lassen euch nicht im Stich. Einer von uns kommt mit. Wir zwei knobeln das einfach aus. Einverstanden, Vinz?«
VI
Wir kommen vor Mitternacht zum Wagen, um noch beim Einladen zu helfen, doch Geronimo sitzt bereits wartend am Steuer. »Setz dich neben mich!«, sagt er zu Vincenz, der das kürzere Hölzchen gezogen hat. An diese Aufforderung erinnern wir uns, weil Vincenz’ Antwort uns überrascht. »Natürlich sitze ich vorn«, sagt er barsch. Wir erklären es uns mit seiner Enttäuschung, den Kürzeren gezogen zu haben. Während der ersten halben Stunde blockt er alle Gesprächsversuche Geronimos unwirsch ab.
Wir wundern uns auch über die neue, flüchtig gezimmerte Abtrennung zum Laderaum, die keinen Einblick erlaubt.
Anfangs ist jeder noch mit sich selbst beschäftigt, aber wir kommen gut voran. Die Fahrpiste ist besser als erwartet, und Geronimos sorgsame Fahrweise und das unangestrengte Surren des Motors wirken wie Balsam. Unsere Anspannung löst sich etwas.
Geronimo kündigt eine Anhöhe an und ruft kurz darauf: »Salutschüsse!« Vincenz zuckt heftig zusammen. »Keine Tricks!«, schreit er.
»Hey! Estás histérica!« Geronimo lacht. »Nur ein paar Salutschüsse, wenn wir ankommen, das wäre doch was!« Er weist Joël, Gina und mich an, das Magazin des Gewehrs, das wir zur Selbstverteidigung mitführen, zu bestücken, unter der Rückbank sei ein Beutel mit Patronen. Schlagartig herrscht gedrückte Stimmung. Zwar beherrschen wir seit den Nachtwachen das Stopfen fast blind. Dennoch zögern wir. Wir glauben Geronimo die »Salutschüsse« nicht. Er will uns bloß nicht verraten, dass wir in gefährliches Gebiet kommen.
Gina ruft: »Hier ist kein Beutel!«
»Ach ja? Muss wohl im Laderaum sein«, sagt Geronimo.
Vincenz reagiert mit einem Fluch, den wir von ihm noch nie gehört haben. Geronimo tätschelt ihm wortlos die Schulter, hält an, steigt aus und geht nach hinten. Es dauert eine Weile, er scheint Schwierigkeiten mit dem Schlüssel zu haben. Wie groß muss unsere Angst gewesen sein, dass uns solche Bagatellen aufgefallen sind!
Plötzlich ist auch Vincenz draußen, weggetaucht, als hätte er sich fallen lassen. Eindeutiger ist das Rumpeln hinter uns: Geronimo wühlt sich durch die Ladung, zwanzig, dreißig Sekunden lang. Dann der unangenehme Knall, als er die Hecktür zuschlägt. Schon schiebt er sich auf den Fahrersitz. Und mit einem Sprung, an den wir uns alle übereinstimmend erinnern, ist auch Vincenz wieder auf seinem Platz.
Geronimo: »Was zum Teufel …«
Vincenz: »Pissen.«
Geronimo: »Besser als in die Hose.«
Vincenz: »Scheißkerl.«
Schweigend fährt Geronimo weiter. Nun hat uns Vincenz’ aufgeregtes Verhalten angesteckt. Misstrauisch beobachten wir von der Rückbank aus Geronimos Bewegungen. Sind sie hektischer? Verraten sie Angst? Keiner wagt, eine Frage zu stellen. Aber wir alle haben das Gefühl, nun fahre das Unheil mit.
Das ist natürlich so unsinnig wie abergläubisch. Gar nichts geschieht. Der Motor surrt gleichmäßig wie vorher. Auf gerader Piste geht es jetzt leicht abwärts. Die Scheinwerfer leuchten weit voraus. Und so erfassen sie weiter unten auch ein Huschen, als hätten die Büsche ihre Schatten verscheucht.
»Ich wusste es doch!«, schreit Vincenz noch, als dort unten ein Lichtblitz zuckt. Ein scharfer Knall. »Ich halte an, dann sofort raus!«, ruft Geronimo. Wieder ein Knall und noch einer, jetzt dumpfer und näher.
»Raus jetzt!« Geronimo hat den Wagen zum Stehen gebracht. Wir springen hinaus, werfen uns ins Gebüsch und wissen nicht, wer wo ist. »Hat jemand das Gewehr mitgenommen?«, ruft Geronimo von irgendwo.
»Das ist Verrat!« Es sei Vincenz’ Stimme gewesen, wird sich Joël erinnern. Ich höre etwas Ähnliches, doch glaube ich, Joëls Stimme auszumachen. Auch Gina vernimmt etwas, einen unterdrückten Fluch, und ordnet ihn mir zu. Und jemand habe gezischt: »Weg hier, weg hier, komm doch mit!«
Alle bilden wir uns ein, nach den Schüssen sei Stille eingetreten. Doch der Dschungel ist nie still. Als Einzige erspäht Gina unter dem Wagen hindurch einen robbenden Körper, meint mich zu erkennen. »Pass auf, die sehen dich!«, warnt sie. Doch die Gestalt, die geduckt hinter dem Wagen auftaucht und im Unterholz verschwindet, gleicht eher Geronimo. Noch erleuchten die Scheinwerfer jenes Gebüsch, aus dem sich der Schatten gelöst hat.
»Geronimo, bist du es?«, ruft Gina. Die Antwort ist ein zweifacher Knall und Scherbenklirren. Nun brennt nur noch im Innenraum des Wagens ein schwaches Licht. Uns allen hat sich dieses Bild eingeprägt. Für Joël war es wie das Versprechen, wir kämen heil davon. »Ich sah uns schon zum Wagen rennen und lospreschen«, offenbart er uns Jahre später.
Wir liegen zwanzig, dreißig Meter auseinander und wissen nicht, was bei den anderen los ist. Ich bin mir sicher, dass nichts genau zu erkennen war. Konturen habe man gut sehen können, widerspricht Gina. Aber wer von uns ist wo? Ist einer in Panik? Ist jemand entschlossen, zu kämpfen? Schleierhaft ist uns, warum niemand von uns das Surren des noch laufenden Motors wahrgenommen hat. Als eine Gestalt, fast nur ein Schattenriss, auf den Fahrersitz schnellt, schießt der Wagen sogleich ein paar Meter vorwärts. Etwas schlägt dumpf auf, etwas quietscht, dann rollt der Wagen aufreizend gemächlich davon. Die offen stehenden hinteren Türen wippen wie die Flügel eines lahmen Vogels. Gebannt blicken wir ihm hinterher. Sehen ihn weiter unten langsamer werden. Anhalten. Warten.
Nichts geschieht. Wir warten. Wendet er? Dann glauben wir eine Gestalt zu erkennen, die um den Wagen herumrennt. Ja, der Cruiser scheint wieder andersherum zu stehen. Hinter dem Wagen ein Huschen. Auf einmal bewegt sich der Wagen langsam auf uns zu.
Jetzt erst bemerken wir den gekrümmten Menschen auf der Straße, sehen den Cruiser näher kommen – und über den liegenden Körper rollen, unfassbar selbstverständlich darüber hinwegrollen. Später werden wir sagen: kaltblütig, gnadenlos, brutal. Doch in diesen Sekunden registrieren wir nur fassungslos, wie sich die roten Rücklichter entfernen. Vor uns ein bewegungsloser Haufen, wie ein großer Sack.
Wir wagen uns lange nicht aus der Deckung, gestehen uns später ein, beschämend lange gewartet zu haben. Aber wir sind übereingekommen, dass Geronimo sowieso nicht überlebt hätte. Er müsse sofort tot gewesen sein. Da sei kein Zucken, kein Laut mehr gewesen.
VII
»Diese Steinhaufen waren mal Kamine für die Seidenraupenzucht, sie dienten zum Ausräuchern«, erfahren wir von unserem Nachbarn Hubert – französisch Übeer. Er schaut neuerdings nicht nur vorbei, sondern bringt stets etwas mit, Ratschläge oder ein paar Flaschen kühles Bier. Er ist uns willkommen, unsere erste persönliche Verbindung zum Dorf. »Es ging uns gut. Bis dieses Nylon aufkam. Mon dieu! Sofort brachen uns die Aufträge weg. Über Nacht sind wir verarmt. Das nennt sich Fortschritt. Merde! Fortschritt ist, wenn die Kleinen zerstampft werden, compris!« Wir mögen seine herzhafte Art. Er ist stämmig und kraftvoll, und als wir hören, dass er im Herbst auf Wildschweinjagd geht, taufen wir ihn diskret Obelix.
»Es hat in der Garrigue draußen wirklich solche Biester?«
»Und ob!«
»Wie schmecken die denn?«
»Keine Ahnung! Ich fress die nicht.«
»Sie jagen sie doch!«
»Aber ich knall sie nicht ab. Ich habe ja auch keine Munition dabei.«
»Das ist ja abgefahren. Sie sind echt verrückt!« Gina und ihr lockeres Mundwerk. Wir warten gespannt, wie Obelix reagiert.
»Das versteht ihr nicht. Ihr seid zu jung«, sagt er.
»Jung, aber logisch! Ein Jäger, der nicht abdrückt, ist einfach nicht logisch!«
»He!«, mahne ich. – »Hör auf!«, sagt Joël.
»Schon gut. Wenn ich euch besser kenne, ergibt es sich vielleicht mal.« Er nickt uns zu und verschwindet. Und wird uns am nächsten Tag doch wieder kaltes Bier bringen.
An diesem Abend finden wir trotz weinseligem Fantasieren keine Erklärung für seine seltsame Jagdkunst. Es mag etwas mit einem Jagdunfall zu tun haben.
Aber eigentlich reden wir nur scheinbar darüber. Unser Gespräch hat ein unhörbares Echo. Wir bemerken und überspielen es. Hubert geht ohne Munition auf Jagd. Wieso war damals im Auto die Munition nicht zu finden? Obelix schießt nicht auf die Wildschweine. Wie oft haben wir die Contras als Schweine bezeichnet? Hubert knallt die Tiere nicht ab. Ob wir sie in jener Nacht abgeknallt hätten? Hubert versteckt sogar sein Gewehr vor ihnen. Nur Salutschüsse, hat Geronimo gesagt, dann greifen sie nicht an. Stimmt, die Contras haben uns nicht angegriffen.
Es gelingt uns das Kunststück eines doppelbödigen und dennoch heiteren Abends. Wir lachen viel und fühlen uns einander nahe. Vielleicht ist gemeinsames Verdrängen die süßeste Art der Verschworenheit. Erst als Gina einen Vorschlag macht, öffnet sich kurz der Abgrund: »Hört mal, Huberts Geheimnis enträtseln wir heute nicht mehr. Aber wir alle, wir könnten uns doch unser Geheimnis verraten.«
»Spinnst du jetzt auch?« – »Nicht in diesem Haus. Das haben wir uns geschworen!« – »Nica bleibt tabu.« Ein lauter Chor. Wir meinen, Gina ginge es um Vincenz.
»Flippt doch nicht gleich aus! Unsere Zukunft, meine ich.« Sie schüttelt den Kopf. »Wir verraten uns, wo wir in sieben oder zehn Jahren stehen wollen. Und schreiben es auf. Dann verstecken wir die Zettel irgendwo in diesem Gemäuer. Aber jeder muss total ehrlich sein.«
Wir sind so erleichtert, dass wir Ginas Idee augenblicklich lieben. Nur über die Modalitäten wollen wir diskutieren. Einzig Gina ist dafür, dass wir uns die Zettel vor dem Versiegeln vorlesen. Bastian ist besonders vehement dagegen. Er könne ehrlicher sein, wenn er nicht schon jetzt zu seinen Spinnereien stehen müsse. Wir einigen uns auf eine achtjährige Versiegelung. Das Versteck ist bald gefunden, ein Riss in einem Balken hoch oben.
Bastians Stift fliegt nur so über das Papier. Gina und ich grübeln, verwerfen, zerknüllen unsere Zettel und beginnen von Neuem. Und Joël verzieht sich. Wir hören von fern ein Rumoren, als ob er etwas wegstemmen würde. Dann steht er unvermittelt und aufgeregt wieder vor uns: Wir müssten mitkommen.
»Ich glaube, nebenan stirbt einer«, flüstert er, als er uns über den Dachboden führt. Und er zeigt auf die Leiter, die durch das zerstörte Dach sticht. »Dort oben muss doch ein Raum sein.« Er meint die Überreste des Turms, dessen Mauerwerk, von Rissen und Öffnungen durchsetzt, unser zweistöckiges Gebäude noch fünf, sechs Meter überragt.
Bereits auf der Leiter vernehmen wir das rachitische Keuchen, auf dem Dach können wir es orten. Es kommt aus einem schwarzen Riss, rund fünf Meter über uns. Das Luftholen ein japsendes Flehen, das Ausatmen ein qualvolles Röcheln. Wir kauern und horchen. Manchmal peinigend lange Aussetzer. Große Erleichterung beim nächsten Schnarcher. Wir versuchen uns zu beruhigen: »Ein gebrechlicher Landstreicher kommt dort nicht rauf.«
»Es wird ein sterbendes Tier sein.«
»Ein Hund? Eine Katze? Dann klettere ich hinauf!«, entfährt es Joël lauter als gewollt. Und schon bewegt sich der Riss, als wäre er nur ein Schatten, löst sich von der Mauer. Ein Aufblitzen wie ein flatterndes Tuch, bald dunkel, bald hell. Und jäh ein riesiger Vogel, der über uns wegzieht. Weiß die Unterseite seiner Flügel.
»Drei Meter, wahnsinnig!«, schreit jemand und meint die Spannweite.
»Eins fünfzig erreichen die schon. Diese Eulen nennen sie hier Grand Duc«, erkläre ich und stecke die Sprüche über meine Allwissenheit weg.
»Wir haben einen Grand Duc bei uns!«
»Eigentlich gehört die Ruine ihm.«
»Du bleibst le chef!«, ruft ihm jemand in die Nacht hinaus nach.
»Voilà! Grand Duc! Perfekt als Name für unser Haus!«
Weit nach Mitternacht holt Bastian eine Leiter und steigt mit unserer eingerollten und mit Draht versiegelten Zukunft hinauf zum Balken. Bevor wir unsere Schlafmatten aufsuchen, umarmen wir einander.
Ich habe Mühe, einzuschlafen. Am liebsten würde ich noch lange schnalzen und pfeifen. Warum, will mir nicht klar werden.
VIII
Ludger Leufke, der uns seit drei Wochen hilft, ist so tüchtig und diszipliniert, wie man es den Deutschen nachsagt. Um die fünfzig, dichtes kurzes Haar; in den harten Gesichtszügen wirken seine blassblauen Augen eigenartig lieb. Zudem hat er Bärenkräfte. Die Gittertore zum Hof, die er flicken will, hängt er wie nebenbei alleine aus.
Sogleich kommen wir rascher voran, Ludger sei Dank. Doch eigentlich müssten wir Franz Joseph Strauß danken, meint Joël. Weil dieser vorausblickende Staatsmann seinerzeit mit der atomaren Aufrüstung der Bundeswehr liebäugelte, hat Ludger den Wehrdienst verweigert und sich in die Schweiz abgesetzt. Bastian hat ihn bei einer Anti-AKW-Demonstration in Basel kennengelernt. »Komm vorbei, falls du ein wenig Abwechslung brauchst«, hinterließ er ihm vor unserer Abreise in die Provence. Und Ludger kam. Bald bewundern wir ihn, weil er alles kann. Er zimmert, verputzt und schweißt. Er führt uns körperliche Arbeit wie ein sinnstiftendes Ritual vor. Seine durchgezirkelten Bewegungen sind wie aristokratische Gesten – gelassen, sparsam und wirkungsvoll. In dem großen Raum, der einst der Seidenraupenzucht gedient hat, ersetzen wir modrige Balken und legen neue Ziegel. Wir roden den überwucherten Hof und verlegen eine neue Wasserleitung, zunächst nur zu einer Freiluftdusche auf der Terrasse. Zwei Tage lang können wir uns keinen größeren Luxus vorstellen: im Rotgold des Abendlichts raus aus den verschwitzen Klamotten und nackt unter die Dusche, so lange, wie es uns gelüstet. Nur ist das nicht wirklich lange, denn das Wasser, das wir aus der Grundwasserschicht pumpen, ist schweinekalt. Also konstruiert Ludger binnen zwei Stunden einen Durchlauferhitzer aus der zigfachen Schlaufe eines Kupferrohrs über dem Flammenring eines Campingkochers. So gewinnt das durchströmende Wasser zehn Grad an Wärme.
»Ideen hast du!«, begeistert sich Gina.
»Den Prototypen habe ich vor achtzehn Jahren in Sumatra gebastelt.«
»Was hast du in Sumatra gemacht?«
»Mein Menschenbild beerdigt.«
»Mach keine Witze!«, mault Joël.
Wir sind plötzlich alle hellhörig.
»Ich werde den Deubel tun, euch davon zu erzählen. Ihr seid zu jung dafür. Fragt mich in zehn Jahren wieder.«
Zu jung! Natürlich sind wir empört.
»Weil ihr noch Gläubige seid. Ihr glaubt noch an die Verwandlung der Welt in ein Paradies.«
Wir provozieren ihn mit Vermutungen, damit er endlich mit seiner Geschichte rausrückt: »Du musst dich nicht schämen, dass du dort einen Harem hattest. Oder hast du jemanden abgemurkst?«
»Vergesst meine dumme Bemerkung.« Das sagt er so entschlossen wie einer, der mal kurz ein Feuerchen ausstampft. Wir spüren, dass wir keine Chance haben. Doch für unergründliche Begebenheiten wird sich bei uns typisch Sumatra! einbürgern.
Ludgers Auftauchen hat eine Nebenwirkung: Hubert, unser Obelix mit dem seltsamen Jagdgebaren, kommt nicht mehr. Wir können nicht wissen, dass es an Ludgers Wagen mit dem deutschen Kennzeichen liegt. Jetzt, wo kühles Bier besonders nützlich wäre, um Ludger bei Laune zu halten, kommt keine Lieferung mehr.
Nach Ludgers Abreise spekulieren wir noch ab und zu über jene Insel, wo Ludgers Menschenbild im Boden liegen soll. Ein wenig machen wir uns darüber lustig: Ob er das Grab eigenhändig ausgehoben, ob er das Menschenbild vorher eingesargt hat? Doch natürlich vermissen wir ihn. Er hinterlässt uns Schraubzwingen, zwei Sägen, einen Lötkolben und die Ermahnung, nie mit minderwertigem Werkzeug zu arbeiten. »Wenn ihr beim Werkzeug knausert, verliert ihr zuerst Zeit und dann die Nerven.« Es ist seine einzige Belehrung, und wir nehmen sie an; er hat ja verflucht recht. Noch haben wir drei Wochen vor uns. Seine Spuren sind überall. Wenn wir durchs Gittertor gehen, erinnert uns sogar das ausbleibende Quietschen an ihn. Eines Abends schwören wir uns, ihn in exakt fünf Jahren, ausstaffiert mit Wein und Käse, aufzusuchen: Lieber Ludger, wir haben noch etwas gut bei dir, etwas aus Sumatra.
IX
Joël desinfiziert Ginas vom Zement angefressenen Finger. »Als ob ein Frettchen daran geknabbert hätte«, sagt er. Sie verzieht das Gesicht: »Gäbe es hier einen Boss, würde ich streiken.«
Bastian sticht die Merguez an. Das auslaufende Fett zischt unter dem Rost aus Baudrahtschlaufen, Marke Ludger Leufke. Rotwein aus der Cooperative, Tomatensalat mit hauseigenem Basilikum und Couscous stehen auf dem improvisierten Tisch: drei Holzbretter über Pappschachteln aus dem Carrefour. Wir selbst bieten ein verwegenes Bild. Struppig die Haare, tiefbraun Arme und Schultern. Alle tragen wir Tag für Tag dieselben ausgebleichten, schmuddeligen Sportleibchen.
»Sich selber ausbeuten ist dumm, aber wenigstens nicht gemein«, sagt Bastian. Es fallen noch mehr große Sätze: Ausbeutung ist ein Auslaufmodell. Die Zukunft wird solidarisch. Warum soll sie als Ärztin mehr verdienen als ein Arbeiter?, fragt Gina. »Studieren ist allein schon ein Privileg. Ich bekomme es ja gestiftet. Der Hilfsarbeiter oder der Rentner blechen für mein Studium. Ich wäre also bescheuert, denen später eine hohe Rechnung reinzuhauen!« Euphorische Sommernächte. Das unermüdliche Zirpen der Grillen. Bald haben wir die richtige Balance aus Trunkenheit und utopischem Geist. Große Zusammenhänge werden entlarvt: Ungerechtigkeit zerreißt jede Gesellschaft. Und zerrissene Gesellschaften werden böse. Dann führen sie Krieg.
Noch nie durften wir mit so viel Wohlbehagen eine ideale Welt entwerfen. En passant erfinden wir den fairen Welthandel und schaffen das Erben ab. Wieso sollen Privilegien auch noch weitergereicht werden? Hirnrissig ist das. Neue Karten, neues Spiel, gleiche Chancen. Das verlangt nach einer neuen Schule, einer kinderbefreienden Volksschule. Das mit den genetischen Prägungen ist eine bourgeoise Ausrede. Die gerechte Welt ist machbar. In dreißig Jahren werden Hunger und Armut weitgehend überwunden, Afrika und Südamerika blühende demokratische Kontinente sein. Und die UNO stark genug, um weltweit den Frieden zu sichern. Wir fühlen uns berechtigt, den Eigentümern dieser Welt die Stirn zu bieten, denn wir haben Schwielen an den Händen! Marx dagegen blieb, wie Gina spottet, sein Leben lang »ein von einem Engel und seiner Frau umsorgter Sesselfurzer«. Wie konnte er Kapital und Arbeit gleichwertig nebeneinanderstellen! Kapital allein ist eine Lachnummer. Eine Banknote stemmt keinen Balken zum First. Also ist die Arbeit der Herr und das Geld sein Diener!
Vielleicht bin ich der einzige Skeptiker in der Runde, Heilslehren waren mir immer suspekt. Wer die Menschheit retten will, opfert dafür unweigerlich Menschen – ob ich das auch vorgebracht habe? Die Menschheit besteht nun mal aus widersprüchlichen Individuen. Unser Herz mag für eine große Idee brennen, doch der Bauch will sich nur vollschlagen. Das gibt Streit. Also bitten sie den Kopf um Vermittlung. Das Herz sagt zum Kopf: Bring dem Bauch endlich bei, dass er ein genusssüchtiger Unhold ist. Der Bauch dagegen verlangt vom Kopf: Bring dieses verdammte sozialromantische Herz endlich zum Schweigen! Aber der Kopf versteht sie beide nicht, er hält sie für unbedarft. Was für klebriges Zeug sie absondern – Gefühle! Begierden! Er hat es lieber abstrakt. Logische Gedankenfolgen sind sein Höchstes. Kopf, Herz und Bauch bleiben also ziemliche Autisten …
Nein, ich habe nichts gesagt. Doch als Bastian mit dem Rest in der letzten Weinflasche nur das eigene Glas füllt, muss ich lachen.
X
Hubert, der munitionslose Jäger, steht eines Nachmittags wie selbstverständlich wieder im Hof und schwenkt einen Packen Bier. Wir sind ebenso überrumpelt wie erleichtert, unterbrechen unsere Arbeit und stoßen mit den Fläschchen an.
»Der Deutsche war wohl sehr tüchtig?«
Gina, Joël und ich begreifen augenblicklich, dass der Alte mit dieser Frage sein Wegbleiben erklärt hat – der Deutsche!
Doch Bastian hört nur die Frage, die einer Antwort bedarf: »Tüchtig ist sein Vorname. Hat geschuftet für zwei. Ein richtiger …« Französisch radebrechend, sucht er vergeblich das Wort für Teufelskerl, und so weicht er auf eine Umschreibung aus: »Il était un vrai monstre du travail.« Er lacht, um klarzumachen, dass er ein gutes Monster meint.
Gina erfasst sogleich, wie unglücklich gewählt dieses Wort ist. Doch als sie ihre Hand besänftigend auf Huberts Arm legen will, schiebt der gerade den Ärmel hoch, spuckt auf die Haut und zerreibt die Spucke. Nun schimmert leicht, was verblasst ist: eine tätowierte Nummer. »Des monstres– c’est juste.«
Er streift den Stoff wieder darüber, und wir umklammern unsere Fläschchen. Er nimmt einen Schluck, von uns wagt es niemand. Wir hocken da und hoffen, dass er, der Überlebende, mit uns Hilflosen umzugehen versteht. Das tut er – er lädt uns ebenso freundlich wie bestimmt zum Abendessen ein. Sagt, er mache einen Lammbraten. Wenn wir wollten, werde er uns von diesem Dorf erzählen.
»Als die Deutschen 1942, am 21. November, unser Dorf besetzten und unser Haus durchsuchten, hatten Sophie, meine Frau, und ich am Tag zuvor mit unserer Louise ihren vierten Geburtstag gefeiert. Der Rest des Schokoladenkuchens stand noch auf dem Küchentisch. ›Gâteau! Aha!‹, sagte der Offizier, als er mit lederner Hand das Tüchlein wegzog. Klang wie: Euch geht es ja noch verdammt gut. Er nahm aber nichts davon. Louise weinte trotzdem.« Er räuspert sich. »Wir kamen bei Nachbarn unter, an unserem Haus hing zwei Jahre lang das Schild FELDKOMMANDANTUR. Auf dem Dorfplatz parkten Panzerwagen und Geschütze. Wachen mit umgehängten Gewehren zirkulierten. Jäh war Deutsch die Sprache unseres Dorfplatzes: Halt! Ausweis! Wird’s bald!Nachts rückten sie oft aus, weil die Résistance mit Anschlägen begonnen hatte. Dann gellten ihre Kommandos durch die Gassen und schlugen in unsere Schlafzimmer ein: ›Aufsitzen! Zu Befehl, Herr Major!‹ Wenn ich starr und unnütz im Bett lag, kamen mir ihre Rufe wie Ohrfeigen vor. Ich lag da wie der letzte Versager, und draußen setzte Emile, mein Cousin und bester Freund, sein Leben aufs Spiel. Das Gedröhne des ausrückenden Konvois fraß sich in unsere Mauern.«
Ich höre Hubert zu, während mein Blick durchs Fenster auf den Feigenbaum fällt, der die Sicht auf den Dorfplatz verstellt. Nichts ist vorbei, geht mir durch den Kopf, hinter dieser grünen Sperre könnte sich genauso gut die Vergangenheit zeigen. Die Zeit ist ein Vorhang. Man kann ihn einfach wegziehen. Wenn ein Windstoß die Äste zur Seite drückte, wäre der Blick frei auf gepanzerte Wagen und uniformierte Kerle mit Helm und Gewehr. Und auf einmal kommt es mir höchst zufällig vor, dass ich jetzt und nicht damals hier bin. Irgendetwas stellt mich aus einer Laune heraus in irgendeine Zeit. Besteht mein Leben nur darin, aus diesem Zufall das Beste zu machen?
»Unsere Dorfgemeinschaft zerbrach. Einige passten sich sofort an. Suchten Vorteile zu erlangen. Und – verflucht! – sie bekamen sie auch. Schon im Januar war die Stimmung im Dorf unerträglich. Wir begannen, uns gegenseitig zu misstrauen … Was am 14. Februar 43 geschah, weiß ich nur vom Hörensagen. Da war ich schon deportiert, Zwangsarbeiter in einer Fabrik in der Nähe von Düsseldorf. Da kontrollierten zwei der Boches die achtzehnjährige Claire, Tochter unseres Bäckers. Sie verbat es sich, abgetastet zu werden. Als sie nicht aufhörten, riss Claire sich los und rannte über die Brücke hinaus in die Felder. Sie kam nicht weit. Einige von uns waren zufällig in der Nähe und mussten mitansehen, wie sie unter den Schüssen zusammenbrach. Wir kannten also die beiden Mörder … Sie hatten noch drei Tage, dann wurden sie nach Einbruch der Dämmerung … ihr wisst schon, mit Jagdgewehren. Von der Brücke aus. Für jeden genügte ein Schuss. Jemand im Dorf musste wissen, wer die Schützen waren, nahmen die Deutschen an. Sie stellten ein Ultimatum. Vergeblich. Alle hielten dicht. Am 19. Februar 1943 haben die Nazis dann Vergeltung geübt.«
Huberts Schnurrbart zittert, und die Augen sind trüb. Die Nase ist trotzig und weinselig, in der rissigen Haut zeigen sich Unwetter und Kummer.
»… dem Platz, wo heute noch das Schild hängt: 19ième février 1943.