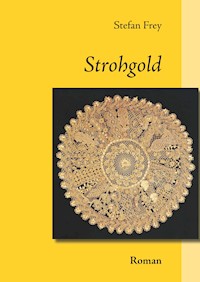Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wird geschehen, wenn jetzt nichts passiert? Stefan Frey denkt diese Frage bis zum bitteren Ende durch und legt ein Szenario vor, das uns in nicht allzu ferner Zukunft erwartet. Das scheinbar Unmögliche wird wahrscheinlich, wenn uns Ablenkung, Ignoranz und Opportunismus in einem Atem raubenden, aber scheinbar unmerklichen Ablauf unwiderruflich an das Unerträgliche heranführen. "Wenn sich wirtschaftliche Monopole auf die Seite der politischen schlagen, wird es gefährlich." stellt eine der Protagonistinnen fest, als es bereits zu spät ist und ein ursprünglich föderalistisch organisiertes und auf liberalen Grundsätzen aufgebautes Land innert weniger Jahre zum Totalitarismus kippt. In Zeiten der allmächtigen Internetmonopole - im Roman als das AGFA-Kartell bezeichnet - und dem gleichzeitigen Aufstieg der alles niederwalzenden Populisten, die man aus politischer Korrektheit nicht Faschisten nennt, kommt "Der Abgang" als Warnung nicht eine Stunde zu spät. Dass dabei beißende, zuweilen gar pechschwarze Satire wesentliches Stilelement ist, fördert beim Leser die Verdauung der Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Beda und Julian, Nolan und Yohan. In der Hoffnung, diese Geschichte werde sich als Irrtum erweisen.
Es ist die Dummheit, nicht der Geist, der sich in den Massen akkumuliert. Gustave le Bon (1841 – 1931), „Psychologie der Massen“.
Die Propaganda ist in Inhalt und Form auf die breite Masse anzusetzen und ihre Richtigkeit ist ausschließlich zu messen an ihrem wirksamen Erfolg. A.H. in M.K.
Um den völkischen Ideen zum Siege zu verhelfen, musste eine Volkspartei geschaffen werden, eine Partei, die nicht nur aus intellektuellen Führern, sondern auch aus Handarbeitern besteht. A.H. in M.K.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil I
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Teil II
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Epilog
Prolog
Die Schulabgänger und jungen Erwachsenen mit Berufslehre bekamen die rasant ablaufenden Veränderungen als erste zu spüren. Sie fanden keine Lehrstellen mehr, weil die kleinen und mittleren Unternehmen als traditionelles Rückgrat der Berufsbildung ausgefallen waren: man konnte es sich einfach nicht mehr leisten, Lehrlinge auszubilden. Und die etwas älteren jungen Berufsleute wurden, nachdem keine Ausländer mehr als Ausgleichsmasse zur Verfügung standen, als erste gefeuert, weil die Familienväter den Vorrang bekamen. Wenigstens vorläufig.
In Archburg-Ohringen, einem der traditionsreichsten und unerschütterlichsten Stammplätze der Partei, wo einst Sozialdemokraten und Gewerkschaften das Sagen hatten, war im Jahr Zwanzig jeder Zweite arbeitslos. Das von strammen Parteikadern geführte Sozialamt wurde tagtäglich von Bittstellern belagert. Die regionale Arbeitslosenverwaltung in Zofingen musste in Archburg eine eigene Dienststelle eröffnen, weil die auf viertausend Frauen und Männer angewachsenen Arbeitslosen nicht mehr im Bezirkshauptort betreut werden konnten, sie überforderten die dort vorhandenen Kapazitäten. Hauptursache der Arbeitslosigkeit war ein weltweit operierender Küchenhersteller, der seine Marke vor dem in Verruf geratenen Made in Switzerland nach Asien in Sicherheit bringen musste. Die Küchen wurden nun Made in Myanmar. Die wenigen, nicht entlassenen, hochqualifizierten Fachleute wurden vor die Wahl gestellt, entweder irgendwo zwischen Burma und Indonesien in einer Werksanlage zu leben, dort aber den erlernten Job weiter ausüben zu können oder sich bei der Umstellung der Produktion in Archburg-Ohringen nützlich zu machen und Produktions-Straßen für Rohlinge einzurichten und später als Schichtführer die auf einfache Handgriffe reduzierten Arbeitsplätze zu überwachen. In beiden Fällen für den halben bisherigen Lohn. Der Küchenhersteller lieferte das Beispiel für eine Entwicklung, wie sie vielerorts um sich griff. Das deindustrialisierte Land, das noch wenige Jahre zuvor Produkte von höchster Qualität exportiert hatte, verwandelte sich allmählich zu einem Produktionsstandort zurück für die Zulieferung an ehemals einheimische Firmen, die das Land verlassen mussten, wenn sie auf den Märkten überleben wollten. Im Herzen Europas, im Herzen der Alpen, zeichnete sich ein neues Tieflohnland ab. Es kam nicht einmal zu Streiks oder Unruhen, denn die Gewerkschaften hatten im Verbund mit einer längst zum Schmiermittel einer globalen Wachstumsmaschine verkommenen öko-sozialen Bewegung keine Alternative parat. Man hatte sich mit den Brosamen des Produktivitätszuwachses arrangiert. Schon vor der faktischen Machtübernahme hatten Generationen von Arbeitern und Angestellten dankbar anzunehmen, was der globalisierte Kapitalismus an Brosamen übrig ließ. Und nun? Es war zu spät für Gesellschaftsmodelle, die ein Leben ohne Konsumzwang, ohne das jahrzehntelange Immer-Mehr, die eine Gesellschaft des Genug hätten Wirklichkeit werden lassen. Der Zug war in eine Richtung abgefahren, von wo es kein Zurück mehr geben würde: mehr, noch mehr, immer mehr.
Die Partei antwortete mit Sport- und Kulturangeboten für die hervorragend ausgebildeten, aber zukunftslosen Jungen, die man jetzt in geleasten Fahrzeugen Uber-Dienste und als angeblich ‚Selbständige’ Versandaufträge verrichten sah. Landauf, landab gründete man Jugendsektionen und eine Akademie für künftige Parteikader, deren Hauptaufgabe darin bestand, das Internet mit Propaganda zu fluten. Was redlich gelang. Man legte Beschäftigungsprogramme auf, um die jungen Leute vor dummen Ideen zu bewahren. Parallel dazu vermittelten die gelenkten Medien den Eindruck, als ob es außer Sport und Unterhaltung nichts Wichtiges mehr gäbe. Reales Fernsehen vermittelte das Bild einer Gesellschaft, die in Sendungen im Stil „Shopping-Schlampe-führt-Millionärsidioten-vor“ oder in Direktübertragungen von Sportanlässen rund um den Globus ihre Erfüllung und Bestimmung zu finden schien.
Im öffentlichen Raum fehlte bald, was man erst mit einer gewissen Verzögerung zu vermissen begann. Die farbenfrohe Fratze der globalisierten architektonischen Einfältigkeit, die alle Städte der Welt zu austausch- und verwechselbaren Kulissen machte, wurde mehr und mehr ausgebleicht und verschwand bald ganz. Die alles dominierende Werbung wurde zuerst von den großen Marken mit Luxusimage zurückgefahren. Laut deren Einschätzung würde der hiesige Markt völlig einbrechen und der Aufwand würde sich kaum mehr lohnen. Ihrem Beispiel folgten nach und nach weniger bedeutende Labels, die sich vorwiegend auf das Weiße Kreuz im roten Feld verlassen hatten. Swissness war keine Auszeichnung mehr, sondern zum Stigma geworden. Die Straßen und Plätze entledigten sich der Farbe, wie eine Polaroid-Aufnahme mit der Zeit heller und heller wird, bis schließlich nur noch ein paar vereinzelte schmutzig weiße Flecken auf das einst Freude bereitende Sujet verwiesen.
Grau wurde zur dominierenden Farbe. Zeitzeugen wollten sich daran erinnern, solche Stadtbilder in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, andere in der Sowjetunion, gesehen zu haben. Man verbreitete auf geschützten Chat-Kanälen historische Aufnahmen vom Berliner Alexanderplatz und vom Moskauer Zentrum. Das passte zu den hierzulande aufgespannten Banderolen über Straßen und Plätzen, die vom Widerstandswillen des Volkes Zeugnis ablegen sollten. „Wir werden uns nicht unterwerfen.“ „Vaterland oder Tod.“ hängten etwa ein paar Jungspunde der Partei zwischen die Türme der Oltner Martinskirche. Man kannte solcherlei Durchhalteparolen aus der Geschichte, aber es war keiner mehr da, der den Bezug zur Geschichte herzustellen wagte. Jedenfalls nicht öffentlich. Öffentliches Erinnern war riskant geworden. Das organisierte Vergessen mutierte zu Gleichgültigkeit, bereit zur Schwester der Lüge zu werden. Es interessierte keinen mehr wirklich, was war und woraus man die Lehren hätte ziehen können. Es zählte nur noch das Jetzt.
Die landesweit offiziell kommunizierten Arbeitslosenzahlen blieben erstaunlicherweise tief, obwohl in großen und kleinen Städten gigantische Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose aufgelegt worden waren. In St. Gallen ordnete die Stadtregierung an, im öffentlichen Raum sei auf den Einsatz mechanischer Reinigungshilfen zu verzichten. Und bald sah man hunderte von Männern und Frauen in leuchtenden Overalls Straßen und Plätze kehren. Im benachbarten Appenzell stieg die Produktion von Reisigbesen sprunghaft an, was von Bauern und Förstern lebhaft begrüßt wurde und zur temporären Beschäftigung junger Arbeitsloser aus der Stadt führte. Ein geschlossener Kreislauf, wie flugs an der lokalen Universität für Wirtschaft doziert wurde. Es gab bereits Diplomarbeiten zum vor der Haustüre liegenden Phänomen.
In den öffentlichen Verwaltungen wurden die Frankiermaschinen und elektrischen Brieföffner abgeschaltet. Die Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen, Tramhaltestellen und Busstationen wurden abmontiert. Viele junge Menschen, insbesondere unverheiratete Frauen fanden so eine Stelle als Reiseberaterinnen und Verwaltungsassistentinnen, während ihre Bachelor- und Masterzertifikate an heimischen Wohnzimmer- und Toilettenwänden vergilbten. Die wertlos gewordenen Papiere interessierten keinen - meist an denselben Fachhochschulen ausgebildeten - Human-Ressource-Manager mehr. In den ehemaligen Tourismusdestinationen wurden hunderte von Kilometern Wanderwege erstellt, die niemals eintreffende Touristen weder zu den eisfreien Gletscherlandschaften noch zu Seen und Hotels führen würden.
Ein spektakulärer Befreiungsschlag mit freilich begrenzter Wirkung war die Schließung der Fachhochschulen. Diese innert zwei Jahrzehnten zu universitätsähnlichen Bildungsinstitutionen aufgeblasenen Diplomdruckanstalten waren der bodenständigen Elite um Parteiideologe Zeusler und Bildungsminister Feinsinger schon lange ein Dorn im Auge. Nun hatte man einen willkommenen Anlass gefunden, um die in den letzten Jahrzehnten zunehmend nur noch von ausländischen Dozenten und chinesischen Studenten bevölkerten Anstalten auszuschalten. Die nicht ganz von der Hand zu weisende Begründung lag in den ausufernden Kosten. „Diese realitätsfernen Lernoasen“, gab Feinsinger an einem Bildungsparteitag den Takt vor, „kosten den Steuerzahler nicht nur so viel, wie unsere Armee, sie sorgen darüber hinaus auch für ständig steigende Lohnkosten, ohne in den Unternehmen echten Mehrwert zu schaffen. Man kann nicht mehr einfach nur Maler oder Schreiner einstellen, man stellt einen ‚Bätschelor’ (Dialekt Feinsinger) ein, der die Hälfte mehr kostet, aber nur halb so gut arbeitet, wie ein Maler und Schreiner, der seinen Beruf gelernt hat und sich auf seine Arbeit konzentriert. Wir werden die ‚Bätschelorisierung’ unseres Berufsalltags beenden. Und zwar auch deshalb, weil das Ausland weder unsere Bätschelor noch unsere Master einstellt.“
So kam es, dass die Partei zwei Jahre nach der erfolgreichen Neunzehner Wahl vor ihrer ersten echten Herausforderung stand. Es drohte eine soziale Explosion, die sie um die Früchte von drei Jahrzehnten Aufbauarbeit hätte bringen können. Es musste dringend etwas geschehen. Zwar blieben mit zwei umgänglichen Sozialdemokraten noch Mitglieder in der Regierung, die den konkordanten Anschein aufrecht hielten, aber es war allen klar, wer die tatsächliche Verantwortung für das Land in Händen hielt. Doch das eigentliche Ziel, die reine und wahre rechte Machtergreifung unter Führung der Partei, war noch lange nicht gesichert. Die nächsten beiden Jahre bis zur Dreiundzwanziger Wahl mussten unbedingt ohne größere Probleme über die Bühne gebracht werden. Da half das jahrelang geschmähte Ausland. In England hatten die Sieger des EU-Austrittsreferendums einen Sieg eingefahren, der Osten war unter Führung des faschistischen Ungarn weggebrochen, die Mittelmeerländer, mit Ausnahme Frankreichs, waren dabei, eine eigene Allianz aufzubauen und in Deutschland übernahm nach einer äußerst knappen Wahl eine rot-rotgrüne Regierung die Macht.
Der Partei wurde so vom Ausland eine ideale Ausgangslage geschenkt, um trotz der katastrophalen einheimischen Wirtschaftslage dem Volk die Vorzüge der eigenen Politik vor Augen zu führen. Da waren einerseits die britischen Insulaner, das ehemalige Weltreich, das „unseren Weg gewählt hat“, wie sich Koebbel in einem vielbeachteten Essay in der Weltsicht ausdrückte. Und da war das benachbarte Deutschland, das „für unser Land die größte sozialistische Bedrohung seit dem zweiten Weltkrieg darstellt“, so Zeusler, in einer August-Rede auf dem Rütli.
Das Land am Rand der Alpen sollte auf die Dreiundzwanziger Wahl hin auf einen Quasi-Kriegszustand eingeschworen werden. In einer Sondernummer des Extrablattes der Partei, das in alle Haushaltungen verschickt worden war, wurde zum Nationalfeiertag am 1. August Einundzwanzig zur „geistig-moralischen Generalmobilmachung“ aufgerufen.
Die Mobilmachung befolgten allerdings erst einmal jene, die mobil genug gewesen waren, um sich gerade noch rechtzeitig aus dem Land zu verabschieden. Zu Beginn des Wahljahres Dreiundzwanzig verließen Tag für Tag junge Menschen die Schweiz in überfüllten Zügen. Parallel dazu folgten Maschinen und Betriebe. Die Landesflüchtigen, denen der Entzug der Staatsbürgerschaft angedroht wurde, machten es ungewollt Behörden und Politik einfach: Es gab ab jetzt nur noch gute und böse Landsleute. Hatte man die Industrie und das Gewerbe noch vor drei, vier Jahren umworben beziehungsweise davon abgehalten, sich offen gegen die Partei zu stellen, wurden die nun im Ausland angesiedelten Firmen und ihre Patrons skrupellos als „Vaterlandsverräter und schamlose Egoisten“ (die aus dem Luzernischen stammende, mit Migrationshintergrund ausgestattete Parteivorständin Esterhazy in einem Interview mit der Weltsicht) an den Pranger gestellt. Professoren und Kader, die sich in innovations- und investitionsfreundliche Länder abgesetzt hatten, wurden mit Bild und Kontaktdaten als Staatsfeinde aufgelistet. Ganz zu schweigen von den wenigen Intellektuellen, die es noch wagten, sich öffentlich, wenn auch nur noch in digitalen Netzwerken, zu den Entwicklungen im Land zu äußern. Sie waren dafür auf die publizistische Hilfe des Auslands angewiesen, weil es für ihre Stimmen im Land selber keine Resonanzkörper mehr gab. Man titulierte sie als Kakerlaken, die im Dunkeln gegen die aufrechten Menschen dieses Landes wuselten und sich nicht getrauten, öffentlich hin zu stehen, um dem Volk ins Gesicht zu sagen, was man von ihm denke.
Die Diffamierung der politischen Gegner und der Andersdenken wurde zum Schwert in einer gnadenlosen Schlacht. Das war auch dringend notwendig. Denn der größte Erfolg der Partei, die Säuberung des Landes von unerwünschten Ausländern wie Flüchtlingen und Arbeitsmigranten wurde zu ihrer ernsthaftesten Bedrohung. Angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs fehlte nun plötzlich der jahrzehntelang gepflegte Sündenbock. Alle angeblich kriminellen Ausländer, die schmarotzenden Asylanten, die faulen Wirtschaftsflüchtlinge, standen als Schuldige nicht mehr zur Verfügung. Und ein Angriff auf die Sozialhilfebezüger, nunmehr ausschließlich Leute mit dem roten Pass, kam aus naheliegenden Gründen nicht in Frage. Denn sie bildeten, zusammen mit dem immer schneller anwachsenden, verarmenden unteren Mittelstand, das eigene Elektorat. Ganz zu schweigen von den Rentnern. Ihre Pensionen waren als Folge jahrzehntelanger Spekulationen in einen maroden Immobilienmarkt buchstäblich in Nichts aufgelöst worden. In Scharen mussten sie bei gestressten Kindern und Enkeln als Sozialflüchtlinge unterkommen.
Nur in Andeutungen und verklausuliert wiesen einige Autoren des regelmäßig landesweit gestreuten Extrablattes auf hausgemachte Probleme hin. So wurde zum Beispiel bedauert, nicht schon viel früher mit den Ausländern aufgeräumt und der Infiltration der Schulen durch linke Kräfte zu lange untätig zugeschaut zu haben. Zeusler legte in einem Editorial in der Weltsicht dar, „wie dieses wunderbare Land schon mit ganz anderen Krisen fertig geworden ist, wenn man denn überhaupt von einer Krise sprechen kann“. Er bezog sich etwa auf den Niedergang der Uhrenindustrie, den man überwunden habe, weil man auf die „bewährten Kräfte“ gesetzt habe. Und selbst die Banken blieben nicht unerwähnt, „die den Beweis dafür erbracht haben, wie verantwortungsvolle Kader, die Unternehmen auf die Gewinnspur zurück führen können, trotz jeder Art von Sabotage aus den eigenen Reihen und durch Kreise, die sich schon in der Geschichte mehrmals als sehr egoistisch erwiesen hatten“. Die Absicht war klar und die Richtung für die Dreiundzwanziger Wahl vorgezeichnet. Der verunsicherten Bevölkerung sollte die Überzeugung eingeimpft werden, jene, die das Land in den Abgrund geführt hätten – ohne freilich diesen Tatbestand als solchen zu benennen – , seien die einzigen, die den Weg zurück kennen würden.
Die Beschäftigungsprogramme wurden in der Folge mit publizistischem Getöse als Erfolgsgeschichten verkauft. Die Konversion von gut ausgebildeten jungen Menschen in Handlanger, Straßenkehrer und Abrufarbeiter galt als Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der freien, unabhängigen und autarken Alpenrepublik.
Die Aufbruchstimmung, die der Ankündigung neuer Atomanlagen folgte, verpuffte rasch, als sich herumsprach, für diese Projekte würden nur ein paar hundert hoch spezialisierte Arbeitskräfte gebraucht, die man erst noch dafür ausbilden oder gar im Ausland rekrutieren müsse. Der Hintergrund war: es gab gar keine Kernkraftspezialisten mehr, seit das Land nach wiederholten schweren Unfällen – wenngleich sehr weit weg im fernen Ausland – aus dieser Technologie endgültig hatte aussteigen wollen. Immerhin lieferte die wankelmütige Energiepolitik der letzten Jahrzehnte der Partei einen willkommenen Sündenbock. Es waren, wie immer, die anderen, die „unserem Volk die Zukunft verbaut“ hatten, schrieb Koebbel in einem Editorial in seiner Weltsicht unter dem Titel „Die Wende von der Wende“.
Es war nicht die einzige Wende, die durch die Partei und ihre Helfershelfer seit der Fünfzehner Wahl eingeleitet worden war. Auf dem Weg zurück in die Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte man einige Meilensteine gesetzt und das Ziel war nicht mehr weit. So nahm der Anteil von Frauen im Arbeitsprozess Jahr für Jahr ab, was mit geschickten Schachzügen in einer die Einverdienerfamilien begünstigenden Steuerpolitik begünstigt und mit unverhohlenen Werbekampagnen zugunsten einer Vater-Mutter-Tochter-Sohn-Gemeinschaft untermauert wurde. Das Fernsehen zog nach mit Remakes uralter amerikanischer Serien wie „Vater ist der Beste“. Doris Day wurde als telegene Urmutter zur posthumen Stilikone. Es gab Petticoats-Wettbewerbe zur Ermittlung des ’echtesten’ James-Dean-Paares, was von der mobilen Online-Generation dankbar aufgenommen wurde. ‚Endlich neue Ideen’, hieß es auf allen Kanälen der Partei und in jenen Medienprodukten, die nicht als Parteifeinde diffamiert werden wollten. Es war in der Tat erstaunlich: Niemand schien sich über die Wiedergeburt einer Zeit zu wundern, in der der aus gesellschaftlicher Sicht ideale Freund, Bräutigam und Ernährer ein weißer Mann, in Nylon-Hemd und dreiteiligem Anzug zu sein hatte, den seine in Kochschürze und unter Lockenwickler-Haube an der Haustüre stehende zum Abschied winkende Ehefrau anhimmelte. Der einzige Unterschied schien darin zu bestehen, die spritfressenden Chevrolets, Buicks, Packards und Pontiacs durch lautlose, selbststeuernde Elektroautos ersetzt zu haben. Die Jungmannschaft trug nun natürlich keine Transistorradios mehr umher, sondern lief mit überdimensionierten Kopfhörern – die wenig später durch implantierbare Chips ersetzt wurden – durch die Gegend, in der einen Hand ein Mobilgerät, in der anderen eine ebenso überdimensionierte Schnabeltasse.
Die Partei förderte die Re-Amerikanisierung des Alltags nach Kräften. Nichts konnte das Wahlvolk besser auf das angestrebte uniforme Einheitsmodell vorbereiten als der Konsum. Die Sache hatte freilich einen Haken: dafür braucht es Geld. Und nicht zu knapp. Die Folge waren überschuldete Generationen. Ihre Einkommen hielten mit Ansprüchen, Ausgaben und den stetig wachsenden Krediten nicht mehr Schritt. Unter dem Strich blieb Monat für Monat, Jahr für Jahr weniger in der Kasse. Irgendwann musste es zum Massenbankrott kommen.
*
Vor der Dreiundzwanziger Wahl war das Land am Boden. Aber die Partei feierte die Situation trotzig als ‚letzte Etappe vor dem historischen Durchbruch’.
Die hohe Arbeitslosenzahl wurde in den offiziellen Statistiken auf die Hälfte geschönt, weil Zweitverdiener nach einer hastig durchgezogenen Reform nur noch drei Monate lang Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten. Das konnten vor allem allein erziehende Frauen und Familien, die ohne zweites Einkommen nicht überleben. Doch die Maßnahme machte Sinn, weil so zweihunderttausend Menschen innert kürzester Zeit statistisch nicht mehr existierten. Man gab stolz und wider besseres Wissen bekannt, das Land zähle noch immer nur die Hälfte der in Europa mittlerweile üblichen zwanzig Prozent Arbeitslose. Die Abwanderung von Forschern, Akademikern und Dozenten bezeichnete man als ‚Entlastungsfaktor für das Bildungsbudget’. Außerdem betreffe es sowieso zu neunzig Prozent Ausländer, was Plätze für die eigenen Leute frei machen würde.
Der Verlust tausender industrieller und gewerblicher Arbeitsplätze war eine Folge einer ‚notwendigen Anpassung an den vom Volk gewählten Weg zur Freiheit’. Dem ständen jedoch tausende neuer Arbeitsplätze gegenüber, für die es weder Bachelor noch Master brauche und die Milliarden für ein überzüchtetes Bildungssystem, das lauter diplomierte Analphabeten produziere, würden in das Auffangnetz für die Folgen der vom Ausland vorangetriebenen Isolierung des Landes verwendet, ließ die Wirtschaftsministerin und spätere Bundespräsidentin Mortadello in einem Interview mit dem nationalen Fernsehen verlauten. „Da müssen wir durch, aber wir schaffen das.“ Der Satz beendete ein vielbeachtetes Interview in einer angesehenen deutschen Wochenzeitung und wurde fortan zum Leitmotiv der ganzen Wahlkampagne.
Kurz darauf, als ein von Sommer, dem neu ernannten Chefredaktor des nationalen Fernsehens, nicht genehmigter Beitrag über die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen – mit Bildern von endlosen Schlangen gut gekleideter, ehemaliger mittlerer Kader und einfacher Angestellter vor den Arbeitsämtern – über den Sender ging, wurde der verantwortliche Sendeleiter ‚wegen Verstoßes gegen interne Regeln für ausgewogene Berichterstattung’ umgehend entlassen. Die Warnung wurde von allen anderen Journalisten verstanden. Zwar war niemals die Rede von Zensur, aber die einseitige, auf Parteilinie ausgerichtete Sicht der Dinge, wurde auch so zum journalistischen Prinzip. Die Schere im Kopf war das wichtigste Werkzeug für überlebenswillige Medienschaffende geworden. Die Wahrheit war, was der Partei diente. Die vierte Gewalt war zum Schweigen gebracht worden.
Die ständige Bedrohung durch einen Handelskrieg, die unerträglichen Einschränkungen in der seit Jahrzehnten hoch gehaltenen Reisefreiheit, die Inflation und die gleichzeitige ins Astronomische steigende Aufwertung der einheimischen Fluchtwährung, die Flucht der hochqualifizierten Arbeitskräfte ins feindliche Ausland, alles trug zur Vernebelung der wahren Verhältnisse bei. Bis zur Dreiundzwanziger Wahl hatte sich in breitesten Kreisen das Axiom eines von fremden Mächten umzingelten Landes durchgesetzt. Die angeblich älteste Demokratie im Herzen eines aggressiven Europas musste verteidigt werden. Was der Sache – der Erfüllung der Mission, SEINER Mission – zusätzlichen Auftrieb verlieh, waren die als Naturkatastrophen eingestuften, der Klimaveränderung geschuldeten, Bergstürze im zentralen Bergmassiv, in der Leventina, im Berner Oberland und im Wallis. Die wichtigsten Alpenverbindungen, mit Ausnahme des fast 60 Kilometer langen Bahn-Basistunnels, waren auf Jahre hinaus unterbrochen. Der aufgetaute Permafrost hatte zu Erdrutschen und Felsabbrüchen geführt, Überschwemmungen taten das ihre für die Unbewohnbarkeit ganzer Talschaften. Es kam zu internen Fluchtbewegungen. Aber noch wichtiger war, dass das Land nun auch physisch vom Ausland weitgehend abgeschnitten war. Die San Bernardino-Route war zwar befahrbar, aber sie wurde von der europäischen Transportindustrie gemieden, weil man sie als zu gefährlich einstufte.
Partei und Medien stellten die durch zwei Regenwintern verursachte Blockade der Alpen als schicksalsbefohlenes Reduit dar. Sie würde das Volk zusammenschweißen. Außerdem begrüßte man den Frischlufteffekt als erwünschten Beitrag an einen ökologischeren Umgang mit der Umwelt.
Die Rechnung ging auf. Eine entweder bereits verarmte oder in Angst und Schrecken vor einer bevorstehenden Verarmung lebende Bevölkerung entschied sich im Oktober 2023 für eine rechtsextreme – im deutschen Ausland als helveto-faschistische, in Frankreich eleganter als front national helvétique bezeichnete – Mehrheit. In beiden Kammern erzielten die Olivgrünen zusammen mit den inzwischen farblosen, freisinnigen Steigbügelhaltern absolute Mehrheiten. Die siebenköpfige Regierung wurde zu einem Fünf-Zwei vereinfacht, ohne dass sich darüber noch jemand wirklich aufgeregt hätte. Im Gegenteil, die Kommentatoren sprachen von einer wünschenswerten ‚Konzentration der Kräfte, angesichts der Bedrohungslage’. Der Widerstand war gebrochen. In der ersten Sitzung des neu gewählten Parlamentes wurde das oberste Gericht, das Bundesgericht, von unsicheren Elementen gesäubert. Das Richtergremium bestand fortan aus olivgrünen und farblosen Richter der beiden Regierungsparteien ein.
Die Partei feierte das Ereignis nicht zu unrecht als historisch. Das Ausland – mit Ausnahme Kasachstans, Weißrusslands, Polens, Ungarns und den übrigen, ehemaligen Ostblockstaaten – wertete es freilich eher als Putsch. Das Alpenland wurde endgültig als unberechenbar eingestuft. Botschafter wurden zu Konsultationen in ihre Hauptstädte beordert.
In einer Radiobotschaft wandte ER sich persönlich an das Volk, indem er ihm für die Weisheit gratulierte, die es ermögliche, das Land nun endlich in Ordnung zu bringen und die Werte der Vorfahren zu neuem Leben zu erwecken und zu den Leitlinien unseres Denkens und Handelns zu machen. „Wir sind ein starkes Land, das durch harte Schicksalsschläge zu dem wurde, was es heute ist. Ein Land, in dem das Volk wie ein Mann zusammensteht, wenn es gilt, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit und unsere Einzigartigkeit zu verteidigen. Liebi Froue ond Manne, es isch wieder e sowiit. Unsere Feinde werden sich an unserem Wehrwillen die Zähne ausbeißen.“
Niemandem fiel auf, dass der über Jahre hinweg keinen öffentlichen Auftritt scheuende Parteiführer nur noch seine Stimme verlauten ließ. Es gab von seiner Rede weder bewegte Bilder noch Fotos.
*
Die Neujahrsansprache 2024 von Mortadello, der neu auf fünf Jahre gewählten Bundespräsidentin, blieb ganz der Partei-Tradition ihres Erzeugers verhaftet. Die Mythen aus dem Mittelalter wurden ebenso bemüht, wie jene aus der Geschichte des vorigen Jahrhunderts. Die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft werde als Ereignis in die Geschichte des Landes eingehen, das auf Generationen hinaus das Bewusstsein des Volkes prägen werde.
Man wunderte sich zwar hinter vorgehaltener Hand über die prophetischen Fähigkeiten der Präsidentin, doch den Medien dienten die etwas ungewöhnlichen Wünsche an die Nation als Steilvorlage für einen die nächsten Monate dominierenden Hype. Der Fußball wurde zum Tranquilizer in stürmischen Zeiten, die Emotionen in nationalistische Begeisterung umgeformt.
Und tatsächlich, wider alle Erwartungen – im Ausland - wurde das Alpenland Europameister im Fußball. Die Wochen bis zum Final waren eine einzige Euphorie. Man lief grundsätzlich nur noch in Rot-Weiß herum. Die öffentlichen Plätze wurden jeder zu einer Art Rütli, auf denen sich ausschließlich Rot-Weiße versammelten und selbstredend vor den An- und nach den Abpfiffen der Spiele der Nationalmannschaft die Landeshymne sangen, schrien, grölten – je nach Tagesstunde und Alkoholpegel. Man war unter sich, das war, was zählte, auch wenn jede und jeder sich ein wenig einsam fühlte.
Teil I
Eins
Das Land stand still. Staatstrauer, Staatsbegräbnis. Es fuhren weder Autos, noch Busse oder Züge. Die Flughäfen blieben während zweier Stunden geschlossen. Ebenso ruhte der Grenzverkehr zwischen zehn und zwölf Uhr. Nur Ambulanzen und Polizei sowie olivgrüne Fahrzeuge der bundesstaatlichen Ordnungsdienste blieben für Notfälle im Einsatz. In den Kantonshauptstädten fanden sich schon frühmorgens Hunderttausende ein, um an den staatlich verordneten Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Schulkinder reihten sich in ihren mit schwarzen Armbinden bestückten, olivgrünen Uniformen auf den Schulhöfen ein, um sich, angeführt von ihren beispielhaft trauernden Lehrkräften, in Viererkolonnen hinter den Schulstandarten aufzustellen und auf den Abmarsch Richtung Kirche, Turnhalle, Stadion – wo es der örtlichen Parteiführung dem epochalen Ereignis angemessen erschienen war – zu warten. In größeren Städten und Dörfern dienten die noch während der letzten drei Wochen für das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft genutzten Plätze, Hallen und Säle als Trauerstätten. Die Großbildschirme, die auch in allen anderen Stätten des organisierten Trauerns montiert waren, übertrugen nun keine Freudentaumel der ersten Schweizer Fußball-Europameister, sondern die Direktsendung aus der Kirche in Zürich. Die Stadt am See wurde für diesen Freitag nicht nur zur wirtschaftlichen, sondern zur allgemeinen Hauptstadt erklärt, was der politischen Logik folgend nur recht und billig war. Mit Ausnahme zweier bettlägeriger Mitglieder des Ständerates fand sich denn auch die Landesregierung und das Parlament zum Abschied vom Vierundachtzigjährigen in corpore ein.
Es wurden auch Angehörige des diplomatischen Korps beobachtet, wenn auch nur aus den befreundeten Staaten entlegener Regionen, wie Kasachstan, Aserbeidschan, Weißrussland und Kirgisien. Die USA entsandten ihren Kulturattaché, während aus den direkten Nachbarländern die zweiten oder gar nur dritten Botschaftssekretäre anwesend waren. Mit Ausnahme Deutschlands, das sich durch den Hauswart seiner Botschaft vertreten ließ, in Begleitung seiner Frau Gemahlin, in schwarzem, dezent hoch geschlossenem Dirndl.
Schlag Zehn heulten landesweit die Sirenen zum Abmarsch zu den Trauerstätten und als Zeichen tiefster Not und Gefahr, denen sich das Land ausgesetzt sah. So jedenfalls lautete die Regieanweisung aus der Berner Parteizentrale, die den Großanlass nach einer Woche Vorbereitungszeit auf Groβleinwand und für die Geschichtsbücher in Szene gesetzt sehen wollte. Die Todesnachricht hatte das Land nur Stunden nach dem Schlusspfiff des in die Verlängerung gegangenen Fußball-Finals erreicht. Seither war die Zeit gut genutzt worden. Das Land, das Ausland, die Welt sollte es bezeugen können.
In Dörfern und Städten, ja sogar in abgelegenen Tälern setzten sich gleichzeitig Trauerzüge in Bewegung, die stets nach derselben Ordnung aufgestellt waren. Vorneweg die jeweils verfügbare Blasmusik, die Chopins Marche Funèbre zu intonieren hatte. Dahinter folgte die Fahnendelegation in Dreiecksformation, an deren Spitze stets ein lokaler Würdenträger der Partei die Parteistandarte tragen musste. Dann schritten die ostentativ trauernden örtlichen Parteigranden einher, die sich ihrer Tränen nicht schämten und anordnungsgemäß hemmungslos in olivgrüne Taschentücher weinten und schnäuzten. Für alle Parteimitglieder galt strikte Trauerpflicht. Das demonstrative Trompeten und Schnarren übertönte zuweilen Chopins Trauermarsch. Hinter den Parteigröβen marschierten die jeweils höchsten Amtsträger – sofern diese nicht schon in der vorausschreitenden Abteilung der Parteiführer eingereiht waren – und deren Substitute oder Ehepartner.
Es folgten die Schulen. An deren Spitze zogen die jahrgangsbesten Schüler auf einer Art Lafette fünf Meter hohe, vor- und rückseitig bedruckte Paniere. Breit und gnädig – für einige Ewiggestrige jedoch niederträchtig – lachte der nun verstorbene Landesvater auf den Trauerzug davor und dahinter herab. Die übrigen Schulklassen schoben und zogen auf Efeu- und Olivenzweigen berankten Leiterwagen die ikonengleichen, weltformatigen Bilder aus dem Leben des Toten durch die Straßen. Auf der Vorderseite der Landesvater in Siegerpose nach Volksabstimmungen der letzten vierzig Jahre, auf der Rückseite die stilistisch dem Holzschnitt entliehenen, jeweils siegreichen Abstimmungsplakate. Dann kam das einfache Volk, die vom Verstorbenen zu Lebzeiten in seiner unvergleichlichen Art stets als „Froue ond Mane“ angeredeten untersten Glieder des Staates, die noch über den Tod hinaus ganz im Banne ihres die Geschichte für immer überragenden Mannes zu erstarren schienen. Kaum ein Trauernder ließ seinen Blick abseits schweifen. In diesem Moment wurde man sich SEINER wahren Größe bewusst. Die Blicke blieben gebannt auf den Riesenbildern haften, wie in Trance schritt man zum Bestimmungsort, kein Auge blickte nach links oder rechts. Abgesehen davon hätte es auch gar nichts zu sehen gegeben, denn die Straßen waren beidseits der Trauerzüge, mit Ausnahme der Parteispaliere, leer, die Geschäfte geschlossen, die Fenster der darüber liegenden Wohnungen und Büros zugesperrt. Es war niemand mehr da, der die Trauermärsche durch Präsenz hätte ehren können. Die Trauernden mussten sich selbst genügen.
Die gewöhnlichen Parteimitglieder, die das Trauerspalier gebildet hatten, reihten sich nun, nachdem die allesamt schwarz gekleideten Frauen und Männer vorbeimarschiert waren, in ihren olivgrünen Parteiuniformen in Viererkolonnen ein, gleichsam als Nachhut des bereits vorangegangenen Volkskörpers. Kommentatoren ausländischer Fernsehanstalten, die den Staatsakt in ihre Länder übertrugen, bezeichneten diese Abschlussformation gezielt boshaft als Bewachungsdetachement. Man erging sich sogar in Spekulationen, wonach die Partei kontrolliert haben soll, ob die Bevölkerung vollzählig zur Staatstrauer angetreten sei. Es war manipulativ die Rede von Druckversuchen in der öffentlichen Verwaltung und in so genannten öffentlichrechtlichen Privatbetrieben und Zulieferern. Es ließ sich nicht beweisen. Unstrittig hingegen blieben nachträgliche Meldungen von Polizeistellen, die für die Dauer der Trauerfeierlichkeiten einen dramatischen Anstieg von Einbrüchen in leerstehende Privat- und Geschäftshäuser vermeldeten. Der Schaden gehe in die Millionen. „Ehr- und schamlose Kriminaltouristen“ hätten sich am Vermögen des Volkes während der Ausübung seiner patriotischen Pflicht vergriffen“, hieß es tags darauf in den Medien.
Nach einer Dreiviertelstunde wurden überall die Zielorte erreicht. Die trauernden Massen versammelten sich würdevoll vor den Groβbildschirmen. Die Sitzplätze waren den geladenen Gästen und der Partei vorbehalten, im ganzen Land mussten sich deshalb Abertausende stehend die Übertragung anschauen, was durch die gegen Mittag ins Hitzschlägige steigende hundstägliche Hitze für viele zur schmerzhaften, durstigen Pein werden sollte. Zwar wurde durch die Parteijugend in unbegrenzten Mengen gratis Schweizer Wasser verteilt – einheimisches Mineralwasser aus Ems, das seit zwei Jahren vom Staat als Alternative zu den aufgrund der Sanktionen überteuerten Importprodukten auf dem ausgedünnten Getränkemarkt subventioniert vertrieben wurde. Viele Trauergäste, vor allem die männlichen, dürsteten und gierten aber nach dem von der Partei für den Abschluss der Feier – Staatstrauer hin oder her – versprochenen Gratisbier und den Würsten. Jede stehend und durstig verbrachte Minute geriet so zu einer noch härteren Prüfung. So, wie bei einem Marathonlauf die letzten drei Kilometer die härtesten sind.
Immerhin: die Trauerfeier begann pünktlich um halb Elf Uhr, was tatsächlich wie angekündigt das Ende gegen halb Eins versprach.
*
Die Übertragung aus der Zürcher Kirche begann mit einer Totalen, von der Orgelempore herab, das ganze Kirchenschiff ins Bild setzend. Es war bis auf den letzten Platz besetzt. Zwischen den das Gewölbe tragenden Pfeilern gespannt, hingen olivgrüne und rotweiße Banner herab, die olivgrünen schwarz beflort. Der auf Wunsch der Familie verschlossene Sarg, ein einfaches Modell aus einheimischer Eiche, stand vor einem Porträt des Verstorbenen; dasselbe, das von Schülern im ganzen Land durch Dörfer und Städte getragen, gezogen, geschleppt oder gestoßen worden war, ganz im Sinne der seit Jahrzehnten von der Partei durchgezogenen Bildsprache. Hunderttausendfach prangte das immer gleiche Porträt seit dem Montagmorgen, als nach der Finalfeier der Tod bekanntgegeben wurde. ER hing an Plakatwänden in den Flughäfen, in sämtlichen Bedürfnisanstalten an allen Bahnhöfen und auf Straßen und Plätzen. ER war das Bild der Schweiz, als zöge der Tote ein weiteres Mal in einen plebiszitären Kampf. Doch nun ging es nicht mehr um Sieg oder Niederlage, sondern nur noch gegen das Vergessen. Hinter dem Altar stand der Chor in Reihen und sang das Ave Verum Corpus. Bild und Musik, ohne Kommentar des Reporters.
Die mobile Kamera im Hauptschiff schritt die Reihen der Gäste ab, beginnend bei den zuvorderst sitzenden, hinterbliebenen Familienangehörigen, direkt gegenüber dem Sarg. Sie führte das Korps der Trauernden an. Steinerne, abweisende, arrogante Mienen. Dahinter saßen der Bundesrat mit Kanzlerin und die Kantonsregierung von Zürich, wobei die Landesregierung nur zu sechst aufgereiht war, weil Mortadello, die Tochter des Verstorbenen, aktuelle Bundespräsidentin und Volkswirtschaftsministerin, in der Reihe davor inmitten der Familie trauerte.
Die Kamera holte die Mitglieder der Landesregierung nahe heran. Ihre vom Weinen geröteten Augen und die schmerzverzerrten Gesichter, das ganze unermessliche Leid wurde sozusagen von urbi nach orbi ins ganze Land hinausgetragen. Dort sorgten die Parteimitglieder für massenhaftes Weinen oder doch zumindest Schluchzen. Koebbel, der Vizepräsident des Bundesrates und Umwelt-, Verkehrs, Energie- und Kommunikationsminister, fiel durch besonders herzrührende, exzessive, beinahe hysterische Trauergestik auf und musste von Graf, dem Außenminister zur Linken, und Ziger, dem Justiz- und Polizeiminister zur Rechten, gestützt werden. Franke, der Finanzminister und Retter des Bankgeheimnisses, Petitpin, freisinniger Verteidigungsminister aus Genf und dessen Tessiner Parteikollege, Innenminister Globbi, trugen würdevoll in sich gekehrte Trauer vor.
Das berstend volle Kirchenschiff war überwiegend durch Parteimitglieder besetzt, was leicht an der dominanten olivgrünen Bekleidung der Gäste abzulesen war. Vereinzelt sah man schwarzgekleidete Trauergäste, nicht wenige Frauen versteckten ihre Gesichter hinter schwarzen Schleiern. Dafür wurde per außerordentlichem Bundesratsbeschluss das landesweit erlassene Vermummungsverbot – Terrorabwehr –, eine Folge des per Volksabstimmung in die Verfassung geschriebenen Burka-Verbotes – Islamabwehr -, vorübergehend aufgehoben. In den hinteren Reihen, dem Ausgang zu, erblickte man die Größen oder vielmehr die ehemaligen Größen des Showbusinesses, des Sportes und des geistigen Lebens, die dem Verstorbenen über Jahre eng verbunden waren, ihn in Auftritten parodierten, mit Leistungen ehrten oder in Werken dessen Bedeutung für das Land und die Gesellschaft untersucht hatten. Die Kamera setzte Theil-Kamm, den Intendanten des Fernsehens, ins Bild. Er saß neben Ragusa-Gottardi, der warzengeschminkten nationalen Unterhaltungschefin. Sie wurde auf der anderen Seite vom Schriftsteller und Ernst-Jünger-Preisträger Feinsinger flankiert. In derselben Reihe sah man auch Ruckli, die Generaldirektorin der nationalen Radio- und Fernsehanstalt, die pensionierten Möller und Caruso, die Erfinder der Konkordanzkomik, und das Duo DebiloTempo. Letzteres wurde auch gerne als das Furzkissen der Nation bezeichnet und durfte nach der Übernahme der nationalen Fernseh- und Rundfunkanstalt durch die Parteifunktionäre, die Samstagabende mit ihren Nummern abfüllen. Es reihte sich neben die Vorzeigeflüchtlinge und Titelhalter Heidarabad und Telekweit, die unverzichtbare Bucheli, die in die Jahre gekommenen Rüsi und Hubi und die Fernseh- und Radio-Chefredaktoren Sommer, SEINEM Biographen, und Gütlich, dem immer noch begnadeten Kampagnenjournalisten, ein. Den eigentlichen Farbtupfer setze aber die Fuβballnationalmannschaft, die frischgebackenen Europameister, die in der letzten Reihe mit dreiundzwanzig Mann und ihrem balkanstämmigen Coach erschienen war. Die Fußballer fielen nicht wegen besonders bunter Leibchen auf, denn ihre feinen Anzüge passten sich problemlos in die dunkle Masse vor ihnen ein; es waren die zwanzig farbigen Köpfe, die im bleichdominierten Kirchenschiff für Auffallen sorgten und immer wieder von der Kamera erfasst wurden.
Nach dem Ave Verum ein Augenblick der Stille. Aus dem Hintergrund des Altarraumes trat ein Pastor vor die Trauergemeinde. Es war ein einfacher Pastor, ohne höheres Kirchenamt, denn, wie im Laufe der Trauerwoche bekannt wurde, hätten sich die Kirchenfürsten sowohl der christlichen Landeskirchen, als auch der oberste Imam der staatlich anerkannten, als gemäßigt eingestuften Muslimgemeinden sowie der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinden geweigert, trotz oder gerade wegen Bitten und Drohen der Parteiführung, dem Verstorbenen das ökumenische Geleit zu geben. Der so aufs Obligatorische verkürzte geistlichsakrale Teil der Feier begann. Die Evangelisten wurden angerufen und der Herr um Trost gebeten, nicht aber um Vergebung, wie einige Beobachter feststellten, der nun seinen Sohn nach erfüllter Mission zu sich gerufen habe. Nach dem abschließenden Vaterunser, das einige im Kirchenraum in ganz eigener Auslegung dem Toten im Sarg widmeten, stieg Koebbel auf die Kanzel.
Wie seine Magistrats-Kollegen trug der Kommunikationsminister einen schlichten schwarzen Anzug. Am Revers steckte ein goldumrandetes Schweizer Kreuz, das auf einem Schild lag, der von zwei Hellebarden über Kreuz getragen wurde.
Koebbel schien sich von seiner Trauerattacke erholt zu haben. Er richtete sich jedenfalls ohne Anzeichen besonderer Erschütterung auf der Kanzel ein. Büschelte sorgsam sein Manuskript auf das vom Kirchenschiff her nicht einsehbare Rednerpult. Auf den Leinwänden erschien das schmallippige, knopfäugige und mehr denn je eingefallene – von den im Untergrund agierenden Oppositionellen auch schon als ausgemergelt bezeichnete – Gesicht des Ministers, der sich jahrelang europaweit als Wutschweizer durch die Fernsehkanäle gekeift hatte. Bis man die Schweiz endlich als das freie, eigenständige und doch weltoffene Land, dessen Wurzeln durch die eigene Geschichte geadelt sind und das sich gegen jede Einmischung von außen erfolgreich verteidigt hat, anerkennen musste. So jedenfalls Koebbels Selbsteinschätzung in der von ihm herausgebrachten Weltsicht. Freilich lagen seine Auslandeinsätze schon ein paar Jahre zurück und seit den Neunzehner Wahlen lud ihn keine Fernsehanstalt mehr ein. Zombies, so ließ man verlauten, hätte man seit dem Aufstieg der Völkischen genug eigene und als Satiriker sei er schlicht zu langweilig, was ihn laut eigener Einschätzung immerhin auf die Stufe des von ihm protegierten Theil-Kamm stellte. Er war stolz darauf. Das tat jedoch seinem Ruf hierzu Lande keinen Abbruch. Er wurde zweimal mit Glanzresultaten als die intellektuelle Hellebarde wiedergewählt und nach der Dreiundzwanziger Wahl unvermeidlich Minister.
„Liebe Trauerfamilie, hob er an und richtete das Wort an die in der ersten Reihe sitzende Familie, allen voran an die Witwe und Kampfgefährtin des Verblichenen, die körperlich gebrechlich zwar, aber stolz wie eh und je, mit versteinerter Miene der ersten Kirchenbank vorangestellt im Rollstuhl saß. „Ihr habt den treusorgenden Ehegatten und Vater verloren und wir sind in diesem unermesslichen Schmerz mit euch. Die Schweiz aber ist Waise geworden.“ Eigentlich wollte er die Schweiz als Witwe darstellen, was ihm dann aber im letzten Moment vom geschichtsbeflissenen Außenminister Graf durchgestrichen wurde. Er befürchtete, eine solche Äußerung könne in Frankreich entweder als Anmaßung oder dann als schiere Beleidigung interpretiert werden, habe doch seinerzeit Pompidou den Franzosen den Tod de Gaulles mit den Worten „la France est Veuve“ eröffnet. Also wurde die Schweiz zur Waise gemacht. Eigentlich zur Halbwaise, es war ja bloß der Landesvater gestorben, nicht aber die Landesmutter, über deren Identität man sich parteiintern auch nach vierzig Jahren Symbolismus und Mythenzauber noch immer nicht einig war.
Helvetia war zwar bei der Parteielite hoch im Kurs, jedoch beim Fußvolk hatte Johanna, in Erinnerung an die Heidi-Schöpferin, Johanna Spyri, die weitaus bessere Quote. So blieb die Mutterschaftsfrage bis auf weiteres diffus, auch wenn eine militante Minderheit in regelmäßigen Abständen Heidi selbst ins Gespräch zu bringen versuchte.
„In einem Moment, in dem das Land vor seiner historisch bedeutsamsten Herausforderung steht, wenn es gilt, unser Schiff in dunkler Nacht aus dem Sturm herauszuführen, hat es auf einen Schlag seinen Leuchtturm und seinen Steuermann verloren. ER – Koebbel wies mit ausgestreckter Hand auf den rechts unter ihm liegenden, verschlossenen Sarg – der uns vierzig Jahre lang den richtigen Weg wies. ER, der uns mit sicherem Gespür und in Kenntnis aller Fährnisse durch die Untiefen der Geschichte geführt hat.“ Der Redner zog die Hand zurück, um sie flach auf die Stelle des Herzens zu legen. „ER wird uns für immer fehlen und in unseren Herzen eine nie vernarbende Wunde hinterlassen.“
Koebbels Ansprache war schon zwei Tage vorher als Leitartikel im Parteiblatt Weltsicht unter dem Titel „Die Schweiz ist Witwe geworden“ (Grafs diplomatischer Rettungsversuch kam erst nach Drucklegung) erschienen. Er fühlte sich immer noch als Journalist und hatte sich den Primeur über seine eigene Darbietung nicht entgehen lassen wollen, auch wenn er nach der Ernennung zum Minister die schreibende Feder von Amtes wegen an seinen als Wadenbeißer bekannt gewordenen Stellvertreter Gütlich hatte abgeben müssen. Dieser wiederum sollte kurze Zeit später zum Chefredaktor der nationalen Rundfunkanstalt ernannt werden, weil dort immer noch ein paar rückwärtsgewandte, reaktionär-sozialistische Elemente ihre wühlerischen Zellen betrieben und endgültig zu beseitigen waren. Gütlich hatte jetzt im nationalen Interesse Größeres aufzuräumen während die Redaktion des Parteiblattes dem noch jungen Wolgensinger aus dem Solothurnischen übertragen wurde. Einer, der sich jahrelang im regionalen Monopolblatt einen Namen als unverbesserlicher Rassist erschrieben hatte. Die klassische Karriere eines Intellektuellen völkischen Zuschnitts: vom pubertären Versammlungs-Pöbler, zum Studenten, zum Juristen, zum Leserbriefschreiber, zum Gemeinderat, zum Kantonsrat, zum Kolumnisten, zum Journalisten, zum Chefredaktor. Doch jeder im Land wusste, selbst nach zehn Jahren Absenz von schreibender Arbeit blieb er, Koebbel, die lenkende Hand hinter den großen Geschichten des Blattes, dessen erfolgreicher Kampagnenjournalismus nach der faktischen Machtergreifung nun nicht mehr gegen die in Bern, sondern gegen den Rest draußen im Land, ja gegen den Rest der Welt weitergeführt werden würde, ja geradezu musste. Das inzwischen in Millionenauflage erscheinende Blatt war mit dem Segen des jetzt eingesargten Parteiführers zum offiziellen Leitorgan der Partei und damit zum Kampfblatt gegen die Opposition geworden. Die politischen Gegner, von denen es immer weniger gab, wurden nicht durch Fakten sondern unter Einsatz der tödlichsten aller politischen Waffen zur Randerscheinung degradiert: durch Lächerlichkeit.
Selbentags erschien die Sondernummer einer jahrzehntelang als kultureller Leitstern geltenden Monatsschrift mit Trauerbalken auf dem Titelblatt. Sie würdigte die Verdienste des Kunstsammlers und Mäzens, dem auch die Zeitschrift viel zu verdanken habe, wie es hieß. Nur wenige erinnerten sich an die Jahre zuvor von IHM bezahlte, identische Ausgabe. Durch einen Nachruf ergänzt, war sie aus gegebenem Anlass neu aufgelegt worden.
Biographien sind Nekrologe, zu denen nur noch die letzte Seite fehlt. So war es kein Wunder, wenn sich Koebbel an Sommers Biographie hielt. Koebbels genuiner Beitrag dazu war, die Person des nun vor ihm im Sarg Liegenden in die Reihe historischer Figuren und Mythen einzuordnen. Der Bogen spannte sich von Tell und Winkelried über Bismarck, Wille, Guisan, Churchill, Thatcher, Reagan, den Polen-Papst bis hin zum unlängst verstorbenen Berlusconi, den der Medienminister Koebbel als herausragende Persönlichkeit für die Verteidigung der Meinungsfreiheit und „unseren Bruder im Geist“ ehrte. Die Trauerrede Koebbels war eine geballte Ladung Krieg, dekoriert von ein paar geschönten Lebensläufen. Er pflanzte dem rechts unter ihm ruhenden Leichnam gleichsam eine Allee aus historischen Figuren und Fakten in die Ewigkeit. Das Einreihen in die Weltgeschichte sollte den Verblichenen in den Olymp überführen, um von seinen irdischen Adepten bei Bedarf als Zeuge und letzte Instanz bei schwierigen aktuellen Entscheidungen orakelhaft befragt werden zu können. Und ganz nebenbei verlieh es auch dem Redner eine Aura geschichtlicher Relevanz. Tatsachen und geschichtliche Zusammenhänge fielen unter den Tisch beziehungsweise unter das Rednerpult. Es störte keinen. Es galt, allenfalls Störendes zu vergessen, um an das zu erinnern, was im eigenen Interesse lag. Das Vergessen wurde, wie zu SEINEN besten Zeiten, zur Schwester der Lüge. Insgesamt hinterließ der dreiviertelstündige Vortrag einen eher lähmenden Eindruck. Jeder wusste über das Gerangel Bescheid, das für das Vorrecht der Trauerrede ausgetragen worden war. Ein tagelanges Hickhack auf höchster Parteiebene, weil derjenige, der sich über den Sarg erheben dürfe, selbstredend auch als politischer Erbsohn gehandelt werden würde. Aber Koebbel hatte in den Augen vieler Beobachter diese Mission eindeutig verfehlt. Da hatte keiner mit Charisma gesprochen; mit Verve wohl, aber kaum einer spürte das innere Feuer, das dem Toten so eigen gewesen war. Da hatte einer nicht nur seinen Auftritt verpasst, sondern auch noch seinen Erbschaftsanspruch verspielt.
Nachdem der Pastor die Trauergemeinde zum abschließenden Gebet aufgerufen hatte, ertönte die Nationalhymne, die von den Trauergästen im ganzen Land zur selben Zeit mit etwas zu viel Inbrunst gesungen wurde. Man hätte meinen mögen, von Inbrunst übertünchter Angst oder war es Trotz? Derweil wurde in Zürich der Sarg auf eine echte, aus dem nahen Nationalmuseum für den Zweck herbeigeschaffte Lafette geladen. Anschließend zogen Hunderttausenden vorbei sechzehn braune Freiberger Wallache den Sarg zur Schiffsanlegestelle gezogen. Hier bahrte man die Holzkiste auf ein olivgrün beflaggtes Ledischiff,