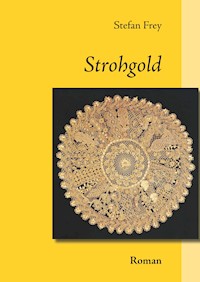Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Lustigen Witwe schuf Franz Lehár eine neue Form der Operette, deren stilistische Bandbreite vom Gassenhauer bis zum Musikdrama reichte. In der vorliegenden Biographie zeichnet Stefan Frey Lehárs Lebensweg von der Blütezeit der K.u.K.-Monarchie bis ins Dritten Reich nach, wo er als Hitlers Lieblingskomponist mit seiner jüdischen Frau zwischen alle Fronten geriet. Als prägende Figur der Operette des 20. Jahrhunderts steht Franz Lehár ein ähnlicher Rang zu wie Jacques Offenbach oder Johann Strauß. Doch anders als seine Vorgänger ist der am meisten aufgeführte Operettenkomponist seiner Zeit noch immer umstritten, gilt doch ausgerechnet seine Lustige Witwe als Sündenfall des Genres. Dieses Werk hat 1905 Lehárs steile Komponistenkarriere begründet und eine internationale Operettenkonjunktur von bisher unbekanntem Ausmaß ausgelöst. Die Wiener Operette beherrschte fortan die Bühnen der Welt, ehe der Erste Weltkrieg dem ein jähes Ende setzte. Nach Krieg und Inflation erlebte der Komponist erst in den späten zwanziger Jahren zusammen mit dem Tenor Richard Tauber eine Renaissance. Gegen Zeitgeist und Jazz konnte er seinen Thron als Operettenkönig behaupten. Lehárs lebenslanger Zwiespalt zwischen U- und E-Musik prägte nicht nur sein Werk. Zwiespältig verlief auch seine bewegte Lebensgeschichte, die im vorliegenden Buch erzählt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Frey
Franz Lehár
Der letzte Operettenkönig
Eine Biographie
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
© 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Kölblgasse 8–10, A-1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Michael Haderer, Wien
Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien
Satz: Bettina Waringer, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21182-2
Für Susan, mein „lachendes Glück“
Inhalt
Der letzte Operettenkönig
Vom Wunderkind zum Militärkapellmeister
Das Rätsel Franz Lehár• Lehár-Familien-Geschichten• Der Vater• Die Mutter• Tornisterkind• Wunderkind• Ungeliebte Violine• Primgeiger in Elberfeld• Jüngster Militärkapellmeister der Monarchie• „Wie empfunden, so geschrieben“• Marinekapellmeister• „Franz ist nicht ganz gesund“• „Was sagt Ihr zu diesem Erfolg?“• Belagerung der Wiener Oper• „Jetzt geht’s los“
Blindlings in die Wiener Operette hineingeraten
„Ich bin nicht Dein Kolumbus“• Der Rastelbinder• „A einfache Rechnung“• Louis Treumann• Wiener Frauen• „In die erste Reihe der Wiener Operettenkomponisten gestellt“• Wiener Walzer Vakuum• „Drei Achtel Künstler, fünf Achtel Allrightman“• Der Göttergatte• „Kein Offenbach“• Die Juxheirat – oder: Wiener Operette am Wendepunkt
Die Jahrhundert-Operette: Die Lustige Witwe
Die Zukunft der Operette• L’Attaché d’ambassade• Wahre Dichtungen und falsche Wahrheiten• „Das is ka Musik …“• Denkwürdige Premiere• „Alles vibriert von Wirklichkeit“• Die Lustige Witwe steht auf der Grenze• Getanzte Sexualtheorie• „Lippen schweigen“• Das Traumpaar Mizzi Günther und Louis Treumann• Operettenkult• Der Danilo, der nicht singen konnte• „Sucess of the biggest and brightest kind“• Going global• The Merry Widow Craze• The battle of the hats• Marktlücke Lustige Witwe
Der Zeit ihre Kunst! Operettenmoderne
„Von modernem Geist beseelt“• „Eine tiefe Tantiemeneinsicht“• Hölle und Schlaraffenland• „Sei modern“• Der Mann mit den drei Frauen• „Unbewußt mit Opernmitteln kommen“• Die Treumann-Affäre• Die versuchte Verhaftung des Schauspielers Treumann• Das Fürstenkind• „Waghalsige Experimente“• Zigeunerliebe• Zwischen Oper und Operette• „Man greift nicht nach den Sternen“• Der Graf von Luxemburg• „Wie’s nur ein Luxemburger kann“• The Count of Luxembourg• Calais – Dover• „Nacht für Nacht bis zum Morgengrauen am Schreibtisch“• Wie eine Märchenkönigin – Eva• Die soziale Frage im Dreivierteltakt• Eva in Tripolis• Ischler Villa und Wiener Mietshaus• Jodeln und Jüdeln• Die ideale Gattin• „Der Mann, der Die lustige Witwe nicht kennt“• Endlich allein – eine erotische Phantasie• Der Wagner der Operette
Operettenfiguren spielen Tragödie
„Aus eiserner Zeit“• Bruder Franz und keuscher Joseph• Der Sterngucker• „Und der Herrgott lacht“ – Operette im Ersten Weltkrieg• Wo die Lerche singt• „Mit dem nächsten Werk künstlerisch um eine Stufe höher“• „Wo die Leiche singt“• „Mein Leben steht noch vor mir“• „Ehrgeizmusik“: Die blaue Mazur• Kokettieren mit der Oper• „Menschliche Güte und die Melodien welterobernder Musik“• Tangokönigin und Operettenputsch• Frühling• „Von klingender Geilheit“ – Frasquita• „Tiefkolletierter Höhepunkt“• La danza delle libellule• Chinesische Schallplatten• Die gelbe Jacke• „Monsieur Butterfly“• „In memoria della grande amicizia“
Das wahre Zeittheater
„Geburtstagsgeschenk vom lieben Gott“• Karczags Tod und Marischkas Erbe• Cloclo• „Rückkehr zur typischen, lustigen Operette“• Richard Tauber• „Clewing in Wien, Tauber in Berlin! Mehr kann man nicht wünschen.“• „Das Beste, was Lehár bisher geschrieben“ – Paganini• „Der Knopf aufgegangen“• „Verhemmter Frauenfeind“ sucht Komponisten• Russisches Alt-Heidelberg - Der Zarewitsch;„Zu Füßen des Schmalztenors“• „Die beiden Meister“• Goethe als Librettist• Die Partitur seiner schönsten Ekstase - Friederike 265;„Die negative Ewigkeit der Operette“• „Pardon, mein Name ist Goethe“• Die verwitwete Operette: Charells Lustige Witwe• Dramatische Musik der dritten Art?• Fleischtöpfe der Operette• „Was tut sich in Ischl?“• Gelb und Weiß• Das Land des Lächelns• „Tauber or not Tauber, that is the question“• Vergebliches Happy End – Schön ist die Welt• „Die Liebe ist der größte Bolschewik!“• „Das Buch der Bücher“
Lehár unterm Hakenkreuz
„Es wird auch ohne Lehár gehen “ • „Gesinnungsgenosse und Rassekollege“• Giulietta – Giuditta• Ein Spiel von Liebe und Leid• Operettenheld im Schatten des Faschismus• „Aus meinem tiefsten Innern geschöpft“• „Es war ein Märchen“• Die Sensationspremiere• „Für die Kulturpolitik des Dritten Reiches ein strittiges Problem“• Was die Glocken läuten …• Tonfilm und Hollywood• „Haben die Amerikaner andere Ohren?“• Komponistenstreik und Menageriedirektor• Schmalz für Auge und Ohr• Deutsches Urhebergesetz à la Richard Strauss• „Wenn Lehár doch die Musik zum Rosenkavalier gemacht hätte.“• Was sich an den Anschluß anschloß …• Hitler zur Operette• Hitlers Lustige Witwe• Fritz Fischers „jazz-zeitige“ Witwen-Revue• „Ehrlich, deutsch empfunden“• „Schleierlos kommt Lehár Franz“• Die Ehrenarierin• Dr. Fritz Löhner-Beda• „Marsch der Kanoniere“• Garabonciás Diák• „Politik ist schmutzig“• Schatten der Vergangenheit• „Dort und dort ein bißchen gepatzt“
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Werkverzeichnis
Bühnenwerke• Walzer• Märsche• Tänze• Orchesterwerke• Kammermusik• Liederzyklen• Lieder
Bildnachweise
Personenregister
Der letzte Operettenkönig
Vorwort
Später mache ich eine Lehár-Renaissance mit.
Karl Kraus1
„Ah, lassen Sie sich umarmen, Freund Neddar, genialer Komponist, musikalischer Hexenmeister, Mann mit dem betränten Humor im Auge – –, lassen Sie sich an meine Brust drücken, denn was wir beiden mit unserer Operette … erreicht haben, das hat noch kein Komponist und kein Librettist erlebt.“2 Mit diesen Worten feiert Alfons Bonné anlässlich der 200. Aufführung ihrer gemeinsamen Operette Die lustigen Weiber von Wien seinen Kompagnon Hans Neddar. Hinter diesen beiden Figuren aus dem „Wiener Theaterroman“ Operettenkönige von 1911 waren für die Zeitgenossen unschwer Victor Léon und Franz Lehár zu erkennen, seit der Lustigen Witwe die unbestrittenen Operettenkönige ihrer Zeit. Hatte der pseudonyme Autor Franz von Hohenegg den Titel seines Schlüsselromans noch polemisch gemeint, erlebte dieser Titel nach dem Ende der Monarchie einen Bedeutungswandel. Nun nämlich nahmen Operettenkönige die Stelle der realen ein. Und vor allem Lehár war nach dem Tod des alten Kaisers dazu ausersehen, zumindest symbolisch seine Nachfolge anzutreten, zumal beide ihre Sommerresidenz in Bad Ischl hatten. Nicht umsonst gab es schon damals einen Stummfilm mit dem Titel Franz Lehár, der Operettenkönig. Und der amerikanische Reporter Karl K. Kitchen nannte Lehár 1920 gar „the only undethroned King in Central Europe.“3
Wie er diesen Thron bestieg und als Letzter seiner Art behauptete, ist das Thema der vorliegenden Biographie zu Lehárs 150. Geburtstag. Geplant war sie ursprünglich als überarbeitete Neuauflage meines 1999 erschienenen Lehár-Buchs Was sagt Ihr zu diesem Erfolg. Durch den Abstand von zwanzig Jahren und nicht zuletzt durch die vielen erst seitdem zugänglichen neuen Quellen ergab sich jedoch bald die Notwendigkeit, seine Biographie aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Der Fokus liegt daher nicht mehr wie 1999 auf Rezeptionsgeschichte und Werkanalyse, sondern auf der immer noch schwer zu fassenden Person des Operettenkönigs selbst. Denn sein Leben war auf sein Werk ausgerichtet und so ist es auch seine hier ausgebreitete Lebensgeschichte. Sie folgt fast immer der Chronologie seiner 30 Bühnenwerke, die sich von 1896 bis 1934 wie ein roter Faden durch seine Biographie zieht. Dokumentarisches Material dazu gibt es inzwischen in Fülle, wenn das bis jetzt zugängliche auch nur die Spitze eines Eisbergs ist. Immerhin hatte Lehár an seinen langjährigen Direktorenfreud Wilhelm Karczag 1916 geschrieben: „Du weißt, dass ich ein Tagebuch führe und dass ich jede Episode meines Lebens darin festgehalten habe und ich glaube, Du hast es nicht notwendig, darin die Rolle eines ‚Schikander‘ zu spielen … wenn ich auch kein Mozart bin!“4
Tagebuch führte Lehár in speziellen Kalendern, von denen bislang freilich nur die der Jahre 1911, 1928, 1934, 1937, 1939, 1940 und 1941 aufgetaucht sind. Ähnlich verhält es sich mit den Korrespondenzbüchern, die der Komponist ebenso regelmäßig wie penibel führte. Bis jetzt sind an seinen beiden Wohnsitzen, der Lehár-Villa in Bad Ischl und dem Lehár-Schlössl im Wiener Stadtteil Nussdorf nur die Jahrgänge 1924–1926 und 1931–1934 aufgetaucht. Ob die fehlenden Bände der Plünderung des Nussdorfer Schlössls nach Kriegsende zum Opfer fielen, wird sich wohl erst bei einer systematischen Erfassung aller vorhandenen Zeugnisse herausstellen. Schließlich sind alle übrigen Leháriana über diverse Wiener Archive sowie private Sammlungen verstreut. Besonders der umfangreiche Nachlass Hubert Marischkas im Österreichischen Theatermuseum ist bis auf die Korrespondenz noch immer nicht aufgearbeitet und wird erst in einigen Jahren zugänglich sein.
Dass ein geschlossener Nachlass mustergültig aufgearbeitet vorliegt, wie im Fall von Barbara Denschers 2017 erschienener Werkbiographie Der Operettenlibrettist Victor Léon, ist eine rühmliche Ausnahme. Überhaupt sind seit 1999 einige grundlegende Publikationen zum Thema Operette erschienen, die auch für Lehár und das vorliegende Buch relevant sind. Gerade die neuere Forschungsliteratur zeigt aber auch, dass es nicht mehr wie noch in den 1990er Jahren darum geht, das Genre Operette grundsätzlich zu rehabilitieren oder Lehárs umstrittene Ästhetik wissenschaftlich zu legitimieren. Die gängigen Antinomien von Kitsch und Kunst, goldener und silberner Ära oder guter und schlechter Operette, wie sie besonders Volker Klotz in seiner damals bahnbrechenden Enzyklopädie betrieben hatte, haben sich überholt und greifen hier zu kurz. Denn verstehen lässt sich die Operette nur aus ihrer Zeit heraus. Als ehemals aktuelle Theatergattung bedarf sie mehr als jede andere der Kontextualisierung. Schließlich galten gerade Lehárs Werke einmal als modern In ihrer wilden Mischung von Stilgebärden spiegeln sie die Widersprüchlichkeiten einer turbulenten Umbruchepoche, in der Neues und Altes unvermittelt aufeinanderstieß. Die Wiener Operette und mit ihr Lehár als ihr letzter legitimer Regent stellt inmitten von Veränderungen bisher nicht gekannten Ausmaßes eine ästhetische Konstante dar, an die sich das Publikum gerne klammerte, egal ob im Habsburger Vielvölker-Imperium, in Revolution und Republik oder im Dritten Reich. Und dennoch kann man an Lehárs Operetten „wie an einem Präzisionsinstrument die feinsten gesellschaftlichen Veränderungen ablesen.“5 Diese seismographische Fähigkeit, die Siegfried Kracauer im Vorwort zu seinem Buch über Jacques Offenbach seinem Protagonisten zuschrieb, besaß auch Franz Lehár. Doch während Kracauer damit noch den Anspruch einer „Gesellschaftsbiographie“ verbinden konnte, ist dies bei Lehár kaum mehr möglich. Eine Gesellschaft, der er so eindeutig zuzuordnen wäre wie Offenbach der des Zweiten Kaiserreichs, gab es im 20. Jahrhundert nicht mehr. Dass Lehár auf gesellschaftliche Veränderungen ähnlich präzise reagierte wie vor ihm Offenbach, hat als einer der Ersten der Schriftsteller Felix Salten in einer Besprechung der Lustigen Witwe bemerkt und 1934 noch einmal zusammengefasst:
„Die Operette ist die Frohlaune der Epoche, der sie entwuchs, ist das Echo ihrer Lebensfreude, die spielerische Kunst, die jedes Zeitalter nach seinem Ebenbild genau so formt wie den Roman oder die Tragödie. Seit dem sentimentalen Finale des zweiten Aktes in der Lustigen Witwe ist Lehar nur selten, nur ausnahmsweise, beinahe widerwillig bloß lustig geworden. So wenig wie seine Librettisten, so wenig wie das Publikum dürfte er selbst gewußt haben, warum eigentlich das fröhliche Antlitz der Operette sich zu Anfang des Jahrhunderts mit grauen Schleiern verhängte. … Heute erkennen wir, nach Krieg, Revolution und inmitten chaotischer Wirrnisse, daß jene üppige, glückselige Zeit von damals wohl üppig, jedoch wohl keineswegs ungetrübt glückselig war … Der Himmel, der voller Geigen hing, erglühte in Abendröte. Man war freilich ahnungslos, aber daß in der Operette Tränen vergossen wurden, entsprach irgendwie den witternden Instinkten der breiten Menge. Eine Regung, die … instinktivem Wittern glich, dürfte Lehar zum Ernst und zum Pathos getrieben haben. Er ist ein vollständig einfacher Mann, das bare Gegenteil von intellektuell. Eine echte Künstlernatur, also geheimnisvoll seherischen Gaben verwandt.“6
Dass Lehárs Musik mehr weiß als ihr Schöpfer, ist ihre große Qualität und lag gewiss auch daran, dass er eben kein Intellektueller war, wie Salten zu Recht feststellte. In seiner Polemik gegen den „Operettenmoloch“ ging der Musikwissenschaftler Alfred Wolf 1909 sogar so weit, zu raunen: „Er wäre zu Großem prädestiniert gewesen, wenn ihm nicht die selbst dem musikalischen Genie unerlässliche Intelligenz fehlte.“7 Lehárs naiv raffinierte Musik provoziert aber nicht nur Musikwissenschaftler. Ihre Diskrepanz zwischen Opernanspruch und Schlagerform wäre durchaus auch ironisch zu lesen, als das nämlich, was Susan Sontag als „Camp“ bezeichnet hat – also als „Kunst, die sich ernst gibt, aber durchaus nicht ernst genommen werden kann, weil sie ‚zuviel‘ gibt.“8
Die Wirkung solcher Kunst aber zielt auf das Unterbewusstsein. Lockenden Weisen wie „Dein ist mein ganzes Herz“ konnten sich nur wenige Zeitgenossen entziehen, nicht einmal Theodor W. Adorno, der bekannte: „Wir kommen unter Autos, weil wir’s unachtsam summen, beim Einschlafen verwirrt es sich mit den Bildern unserer Begierde.“9 An Lehár kam keiner ungestraft vorbei, war er doch der „innerhalb seiner Lebensgrenzen am meisten aufgeführte Komponist aller Zeiten“10, wie seine Hofbiographin Maria von Peteani errechnet hat. Bei Karl Kraus wuchs sich das zu einer wahren Verfolgungsmanie aus. Einem bösen Schatten gleich folgte er Lehárs Spuren durch die Geschichte und traf ihn damit besser als die jubelnde Mitwelt, die fast ein halbes Jahrhundert der „Lehárgie“11 verfiel. Eine Würdigung Franz Lehárs aus dem kulturellen Kontext seiner Zeit heraus bewegt sich zwischen Polemik und Glorifizierung, zwischen Hass und Verehrung – und damit dialektisch zwischen den Zeilen. Ist nach Adorno „leichte Kunst … das gesellschaftlich schlechte Gewissen der ernsten“12, so wäre Lehárs Operette das schlechte Gewissen der leichten Musik.
„Lolo, Dodo, Jou-Jou, Clo-Clo, Margot, Frou-Frou“ in Erich von Stroheims Merry Widow-Verfilmung, 1925
01„Wie’s da drin aussieht, geht niemand was an“ Franz Lehár bei Dr. Zachar Bißky, 1929
Vom Wunderkind zum Militärkapellmeister
1870–1901
Wie viele Flammen, wie viel Asche …
Franz Lehár13
Das Rätsel Franz Lehár
1929 versuchte der ukrainische Arzt Zachar Bißky mithilfe des von ihm entwickelten Diagnoskops, das Innere Franz Lehárs zu ergründen - ohne Ergebnis. Sein Proband hielt es lieber mit dem Helden seiner im selben Jahr uraufgeführten Operette Das Land des Lächelns: „Wie’s da drin aussieht, geht niemand was an.“ Nicht anders als Zachar Bißky ergeht es jedem Lehár-Biographen. Schon das erste Zeitungsporträt des Komponisten, das Alfred Deutsch-German 1903 auf Wunsch der „vielen jungen Mädchen“ verfasst hatte, „die brieflich ersuchten, ihnen von Franz Lehar etwas zu erzählen“14, beginnt mit der Frage: „Wer ist Lehar?“
Sein „Militär-Paß“ von 1889 hält folgende Antworten parat: 1,65 Meter Körpergröße, blaue Augen, blondes Haar und als Sprachen „deutsch, ungarisch, böhmisch“15 – mithin die drei Hauptsprachen der Monarchie. Deutsch-German beschreibt den jungen Lehár als „eine gewinnend sympathische Persönlichkeit, klein, zart und erfüllt von ungeheurer Gutmüthigkeit. Er spricht mit leisem, angenehmem Organ“ und ist ein Mann, „der sich nicht verstimmen läßt … das breite, zufriedene Lächeln wird nicht eine Secunde von seinem Gesichte weichen.“16 Es wurde sein Markenzeichen. Hinter diesem Lächeln verbarg der Komponist alles Private so geschickt, dass es nicht einmal mithilfe des Diagnoskops gelang, hinter sein Geheimnis zu kommen. Auch sein erster Biograph, der Musikkritiker Ernst Decsey, musste vor Lehárs berühmtem Lächeln kapitulieren: „ein scharmantes Weltmannslächeln … Oder es ist Nachklang des verbindlichen Berufslächelns … das Erfolgslächeln des Meisters … ein dreifaches und dennoch unergründliches Lächeln.“17
Nicht minder rätselhaft ist die Aussprache seines Namens. Während seine dritte Biographin Maria von Peteani berichtet, „der junge Franz“ habe bei seiner Ankunft in Wien allen „mit beflissener Eindringlichkeit“ erklärt, die Betonung liege, wie am Akzent ersichtlich, „nicht auf der ersten, sondern auf der zweiten Silbe“, hatten „seine Bemühungen … freilich nach dieser Richtung wenig Erfolg.“18 Seine Zeitgenossen betonten den Namen umgekehrt: auf der ersten Silbe, so wie im Ungarischen. Denn da bezeichnet der Akzent nicht die Betonung, sondern die Aussprache, in diesem Fall also ein langes, offenes „a“. Und so wird auch in fast allen zeitgenössischen Tondokumenten der Name „Le-haar“ ausgesprochen19 – für Peteani „das einzige kleine Missverständnis, das zwischen Publikum und Meister je in Erscheinung trat.“20
Grund für diese Sprachverwirrung ist die ungeklärte Herkunft des Namens. Als Erster versuchte in den 1930er Jahren Franz Lehárs jüngerer Bruder Anton der Sache auf den Grund zu gehen. Zusammen mit dem Heimatforscher Otto Kühnert kam er zu folgendem Schluss: „in den 3 üblichen Schreibweisen: Lehar – deutsch, Léhar – tschechisch, Lehár – magyarisch … steckt ein Wort, das aus keiner dieser Sprachen erklärt werden kann. Wohl aber aus dem Französischen, wo ‚le harde‘ der Kühne heißt.“21 Nur zu gern hat Anton Lehár deshalb die damals kursierende Geschichte vom französischen Offizier Marquis Le Harde aufgegriffen, der in den Napoleonischen Kriegswirren aus russischer Gefangenschaft nach Brünnles (heute: Brníčko) in Nordmähren floh und dort von einer Bauerntochter verköstigt und schließlich geheiratet wurde. Obwohl selbst durchaus skeptisch hat Anton Lehár „die Franzosenlegende“ an Ernst Decsey weitergegeben, der sie in seinem Buch augenzwinkernd erwähnt. Seitdem geistert sie, entsprechend ausgeschmückt, durch sämtliche späteren Biographien und wurde vom Komponisten selbst als Argument für die Betonung auf der zweiten Silbe ins Feld geführt.
Lehár-Familien-Geschichten
Der wirkliche Urgroßvater Franz Lehárs war allerdings kein Marquis, sondern laut Sterbematrikel „Häusler, Glaser und Händler“22, wie der Genealoge Wolfgang Huschke 1970 herausfand. Er hieß Johannes Lehar, geboren 1782 in Brünnles, wohin sein Vater, ebenfalls ein Johannes, zugewandert war. Schon Anton Lehár und Otto Kühnert wussten das, denn dieser Ururgroßvater ist der erste nachweisbare Vorfahr. Woher er kam, ist nicht überliefert. Da er aber, wie ein Großteil der damaligen Bevölkerung Mährens, nicht frei war, sondern erbuntertänig, durfte er das Gebiet seiner Herrschaft nicht verlassen, in seinem Fall das der Fürsten von Lichtenstein. Der Ururgroßvater konnte also nur aus deren Besitzungen stammen. Namensvorkommen weisen auf die Dörfer Rowenz (Rovensko), Lesnitz (Lesnice), Hochberg (Vyšehoří) und Kolleschau (Kolšov), wo der Name 1767 auch in der Form „Lechar“ vorkommt. Da all diese Orte noch bei der Volkszählung 1900 eine fast rein tschechische Bevölkerung hatten, liegt es Huschke zufolge nahe, dass „der Name ursprünglich offenbar tschechisch oder slowakisch war.“23
Auch Schönwald (Šumvald), wo sich der Großvater Josef Lehar niedergelassen hatte, war ein tschechischsprachiges Dorf und auch er selbst „sprach nur tschechisch“24, wie Anton Lehár überliefert hat. Wie all seine Vorfahren war auch er Häusler und Glaser und heiratete im Jahre 1829 neunzehnjährig die sechs Jahre ältere Bauerntochter Anna Polach. Sie brachte, wie Lehárs vierter Biograph Bernard Grun spekulierte, „Wohlstand und Musikalität“25 in die Familie und ein Haus, das dem Ausseer Rentamt zins- und robotpflichtig war. Sie muss „eine recht energische Frau gewesen sein“, schreibt Anton Lehár, „hatte die ganze Wirtschaft für den viel abwesenden Gatten zu führen und 8 Kinder aufzuziehen und zu betreuen“. Denn Josef Lehár betrieb „einen lebhaften Glashandel, d. h. er zog von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf mit einer ‚Kraxe‘ am Rücken, auf der Fensterglas und allerlei sonstige Glaswaren verstaut waren. Er spürte zerbrochene Fensterscheiben auf und schnitt neue ein, reparierte Laternen und Spiegel … Auch unser Vater hat noch als Kind seinen Vater mehrmals begleitet. Er trug selbst voll Stolz seine kleine ‚Kraxe‘.“ Gemeint ist Franz Lehar sen., der Vater des Komponisten und einer der drei Söhne, die aus dieser Ehe hervorgegangen waren.
Der Vater
Geboren am 31. Januar 1838 in Schönwald, wurde er bereits im Alter von 10 Jahren in die nächstgrößere Stadt, ins deutschsprachige Sternberg (Šternberk) „zum Stadtkapellmeister … Heydenreich in die Lehre gegeben[,] um dort in der Musik unterwiesen zu werden.“ Anton Lehár vermutet, dass er „wahrscheinlich nur notdürftig des Lesens und Schreibens kundig“ war und dort auch erst Deutsch gelernt hat. Als „Lehrbub der Kapelle“ musste er „Glockenstrang ziehen, Blasebalg treten“ und die „kleinen Kinder seines Meisters“ herumtragen. „Nach und nach erlernte er aber doch auch jedes Instrument der Kapelle zu spielen“, besonders Violine und Waldhorn. Nach sechs Jahren hatte er ausgelernt und zog weiter nach Wien. Mit 17 Jahren saß er bereits als Hornist im Orchestergraben des Theaters an der Wien, wo damals Franz von Suppè am Pult stand. Nach zwei Jahren wurde Franz Lehar sen. zum Militär eingezogen und leistete seinen Dienst in der Musikkapelle des 5. Infanterieregiments ab. „Der Militärdienst, in dem [er] es bald zum Feldwebel brachte“, hatte, wie Anton Lehár meinte, „einen großen Einfluss auf den allgemeinen Bildungsstand des jungen Mannes … [der] sich fast ohne Schulbildung eine so schön gleichmäßige Handschrift, ein so gutes allgemeines Wissen aneignen konnte, dass er zweifellos an jenes der Durchschnittsoffiziere heranreichte.“ Da Deutsch die Armeesprache war, „wurzelte seine für einen Autodidakten geradezu erstaunliche … Bildung“ nach Einschätzung des Sohnes „in der deutschen Sprache. Trotz des Tschechischen seiner Kindheit“ fühlte er „sich ganz als Deutscher“ und wäre „dem damaligen Zeitgeiste entsprechend am ehesten als Deutschliberaler anzusprechen gewesen.“26
1859 machte er dann den für Österreich desaströsen ersten italienischen Feldzug mit. Die Niederlagen bei Solferino und Magenta kosteten das Kaiserreich die Lombardei. Lehar sen. blieb auch danach in Italien und wurde mit 25 Jahren vom „Offizierskorps des k. k. Infanterieregiments Friedrich Wilhelm Ludwig Großherzog von Baden Nr. 50“ zum jüngsten Militärkapellmeister der Monarchie gewählt. Zuerst in Verona, dann in Treviso stationiert, machte er 1866 auch den zweiten italienischen Feldzug mit. Vor der siegreichen Schlacht bei Custozza verfasste er den Oliosi-Sturmmarsch, der später unter die historischen Märsche Österreich-Ungarns aufgenommen wurde. Über dessen Entstehung verfasste der einstige Kommandant des Regiments ein Gedicht, in dem Kapellmeister Lehár in der Nacht vor der Schlacht von seinem Oberst Karl Schwaiger beim Komponieren überrascht wird:
„Kommt’s zum Sturm, soll die Kapelle, / Dacht ich, eine Weise spielen,
Die so recht zum Kämpfen klinget / Und dem Feinde baß mißfallet …
Meine wack’ren Leute blasen, / Flöten, trommeln und posaunen
Wenn’s zum Kämpfen kommt, ganz tüchtig …
‚Bravo Lehar‘, sprach der Oberst, / ‚Das habt herrlich ihr ersonnen!
Laßt Euch danken. Dieses Gläschen / Weih’ ich Euch und Eurer Weise.‘“27
Die österreichischen Militärmusiken genossen weltweit einen besonderen Ruf, verfügten sie doch, wie der Historiker Simon Kotter ausführt, seit Philipp Fahrbachs Zeiten bei den Hoch- und Deutschmeistern (1841–1845) über eine Streicherbesetzung: „Die meisten Musiker hatten nun zwei Instrumente zu beherrschen, ein Blasinstrument für dienstliche Auftritte und zusätzlich ein Streichinstrument.“28 So wurden die k. u. k. Militärkapellen zu veritablen kleinen Symphonieorchestern, die zeitgenössische Musik bis in die entlegensten Provinzen verbreiteten. Die gesellschaftliche „Stellung der Militärkapellmeister war hingegen ein Beispiel für die zahlreichen Halbheiten, mit denen man sich in der Donaumonarchie so oft und gerne behalf“, fand Anton Lehár. Denn „im Budget des Heeres war für den Militärkapellmeister überhaupt kein Posten vorgesehen … Er war nicht vom Staate, sondern von den Offizieren des Regiments mit Kündigungsmöglichkeit angestellt … Der gänzlich dem freien Übereinkommen überlassene Gehalt wurde durch den Beitrag bestritten, den jeder Offizier perzentuell aus seiner Gage für die Erhaltung der Musik zahlen musste … Zwar glich die Uniform jener der Offiziere. Nur trug der Kapellmeister am Kragen statt der Distinktionssterne eine von einem Schwert durchkreuzte Lyra … ‚ein uniformierter Zivilist‘, wie sich mein Vater einmal bitter äußerte“.
Dennoch haderte Franz Lehár sen. nur selten mit seinem Schicksal, genoss er durch seine hervorragende Arbeit doch großes Ansehen im Offizierskorps, mit dem er meist „auf kameradschaftlichem, seinem Alter entsprechend, meist auf dem Armee üblichen ‚Du‘-Fuße stand“29. Wie auch Franz Lehár später anerkannte, gehörte der Vater zu jener „alten Garde von Militärkapellmeistern, die bewußt Musikkulturarbeit leisteten in einer Zeit, da gute Zivilorchester noch zu den Seltenheiten gehörten und die österreichischen Militärmusiker Weltruf genossen. Die Hingabe, mit der mein Vater nach vielen umständlichen Proben etwa eine Schubert-Sinfonie herausbrachte, hatte für mich immer etwas Rührendes.“30
Die Mutter
Die Niederlage Österreichs im Krieg mit Preußen führte 1867 zum Ausgleich mit Ungarn, in dessen Folge das 50. Infanterieregiment ein Jahr später nach Komorn versetzt wurde (ungarisch Komárom, slowakisch Komárno). In der kleinen Garnisonsstadt an der Mündung der Waag war Ungarns bedeutendster Romancier Mór Jókay geboren worden, dessen Erzählung Saffi dem Zigeunerbaron von Johann Strauß zugrunde lag. In seinem Roman Ein Goldmensch (Az arany ember) von1872 schildert er eindrücklich das bunte Völkergemisch der Stadt: „die Nachkommen der reichen ‚racischen‘ (serbischen) Handelsleute; das ungarisch gutsbesitzende Herrenelement, die fleißigen ‚Schwaben‘“31, wie die deutschen Kolonisten genannt wurden, und einfache slowakische Handwerker. Außerdem befand sich in Komorn eine bedeutende Festung, die im ungarischen Aufstand von 1849 trotz massiven österreichischen Bombardements bis zuletzt gehalten werden konnte. Die schmachvolle Kapitulation hatte man nicht vergessen, als Franz Lehár sen. in die Stadt kam. Ein österreichischer, deutschsprachiger Militärkapellmeister hatte hier keinen leichten Stand.
Trotzdem gelang es ihm durch seine Promenadenkonzerte, nicht nur die Sympathie der Stadt, sondern auch die der zwanzigjährigen Christine Neubrandt zu gewinnen. Sie war „ein liebes, frisches Mädel, aber nach den Bildern jener Zeit, keine auffallende Schönheit“, urteilte Anton in seinem der Mutter gewidmeten Buch. Nach nur vierwöchiger Bekanntschaft wurde am 4. Mai 1869 geheiratet: „Es war … unbedingt eines Liebesheirat und es muß dabei romantisch zugegangen sein, denn die damalige ungarische Gesellschaft war scharf gegen alles K. K. eingestellt, die Neubrandts aber waren schon völlig magyarisiert; trug doch der Großvater ausschließlich die ungarische Nationaltracht jener Zeit … als die Mutter … heiratete, konnte sie sich in der deutschen Sprache, die ihre Eltern noch vollständig beherrschten, kaum ausdrücken. Mein Vater sprach dagegen fast gar nicht Ungarisch.“32 Immerhin hatte er sich seit der Hochzeit den ungarischen Akzent auf dem „a“ zugelegt.
Die Familie der Mutter selbst war sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits deutscher Herkunft und soll ursprünglich „Neubrandenburger“ geheißen haben und aus Brandenburg stammen. Dafür gibt es allerdings, wie Anton Lehár recherchierte, „keinerlei Anhaltspunkte“, vielmehr weisen die Kirchenmatriken Christine Lehárs Vorfahren als Neubrandts (auch: Neubrands) und Handwerker aus. Nur Christines Großvater Georg wird als „Magister Notarius“ geführt. „Grund genug zur Annahme, dass Georg Neubrandt, wie man damals sagte, zur ‚Lateiner Klasse‘ gehörte, also akademisch gebildet war“33. Auch die Mutter Christine Neubrandts entstammte einer wohlhabenden Familie von Großbauern und Wirten, den Gogers aus dem benachbarten Igmánd. Sie hieß ebenfalls Christine und war das strenge und gefürchtete Oberhaupt und die Ernährerin der Familie. Durch ihre kaufmännische Geschicklichkeit brachte sie es zu einigem Wohlstand. Ihr Mann Franz Neubrandt, laut Traumatrikel „smigmator magister“34 (Seifensieder und Kerzenmacher), handelte aber vor allem mit Mehl und Hülsenfrüchten und soll in seinen letzten Lebensjahren das Geschäft seiner Frau überlassen haben. Wie Anton Lehár überliefert, führte er „ein echt ungarisches Herrenleben. Seine Pfeife, lustige Gesellschaft guter Freunde beim Glase Wein, Spiel und Spaß mit den Kindern und ewiger Kleinkrieg mit der geschäftstüchtigen und strengen Hausfrau, so etwa ließe sich aus Äußerungen meiner Mutter, die ihren Vater über alles liebte, seine Einstellung zum Leben schildern.“35 Besonders eng war sein Verhältnis tatsächlich zu Christine, die gerade einmal siebzehn war, als er starb. Drei Jahre später lernte sie Franz Lehar kennen und übertrug, schenkt man ihrem Sohn Glauben, „die kindlichen Gefühle vom Vater auf den Gatten. Obzwar nur neun Jahre jünger … blickte sie doch stets mit einer stillen Verehrung auf ihn … Ich habe nie gehört, dass die Mutter ihren Gatten anders als ‚Vater‘ genannt hätte.“36
Tornisterkind
So wurde am 30. April 1870 gegen 22 Uhr Franz Christian Lehár als Sohn eines tschechischstämmigen, „deutsch fühlenden“ Mährers und einer deutschstämmigen, magyarisch fühlenden Ungarin in der Nádorgasse, im heute slowakischen Teil Komorns, geboren. Noch prägender als seine Genealogie dürfte jedoch, wie er selbst schrieb, sein Schicksal als ‚Tornisterkind‘ gewesen sein: „So bezeichnet ja der Armeewitz in Österreich-Ungarn jene Soldatenkinder, die ihren Eltern bei den zahlreichen Transferierungen von Garnison zu Garnison folgen, also gleichsam im Tornister überall mitgeschleppt werden und eigentlich nur diesen als ihre Heimat anerkennen.“37 Die Familie Lehár hatte in der Folge nicht weniger als 22 Garnisonswechsel mitzumachen, so bereits 1872 von Komorn nach Preßburg, drei Jahre später von Preßburg nach Oedenburg, wo sich der Vater mithilfe der Schwiegermutter ein Haus kaufte. Von dort ging es 1877 nach Klausenburg, dann ins siebenbürgische Karlsburg und schließlich nach Budapest, der letzten Station, die Franz junior mitmachte. Bruder Anton fand später, dass sie „unter ganz abnormalen Verhältnissen“ heranwachsen mussten: „Schule – wie soll diese die leicht empfängliche Seele des Kindes formen, wenn der Schüler in jedem 2ten Jahr in einer andern Stadt, mit andern Umgangssprachen, nach völlig verschiedenen Lehrplänen und unter ganz anders gelagerten Verhältnissen unterrichtet wird?“38
Sein Bruder Franz hingegen konnte diesem Wanderleben – vor allem musikalisch – durchaus einiges abgewinnen. So bekannte er nach dem Zusammenbruch des Habsburgerreichs, „daß ich die ungarische, die slawische und die Wiener Musik so intensiv in mir aufgenommen habe, daß ich unbewußt in meiner Musik eine Mischung all dieser Nationen wiedergebe. Dies ist eben meine Marke … denn die moderne Wiener Operette hat ihre Kraft aus allen Völkern der einstigen österreichisch-ungarischen Monarchie gesogen und was durch die politischen Umwälzungen getrennt wurde, bleibt durch die Künstler der jetzigen Generation absolut und untrennbar verbunden.“39 Privat sollte das Thema der nationalen Identität dennoch bis zum Ende seines Lebens eine Rolle spielen. So wurde er im Wien der Jahrhundertwende wegen seines Geburtsorts und des Lokalkolorits seiner ersten Operette, Der Rastelbinder, sofort mit dem wenig schmeichelhaften Etikett „der Slowak“40 versehen. Er selbst gestand zwar, wie Karl Kraus überlieferte, gern ein, „slawischen Ursprungs … zu sein“, legte „zugleich aber“ besonderen Wert auf die Feststellung, auch „das Feuer der ungarischen Rasse, der … er gleichfalls angehöre“41, zu besitzen. In diesem Kontext ist auch Lehárs Behauptung zu sehen, er habe bis zum Alter von zwölf Jahren kein Wort Deutsch, „nur Ungarisch gesprochen“42, was wiederum geheißen hätte, dass er sich mit seinem Vater nur unzureichend hätte verständigen können. Doch schon sein Spitzname „Lanzi“, nach Peteani aus den ersten Sprechversuchen seines deutschen Vornamens Franz entstanden, widerspricht dieser Behauptung - ebenso die von ihm selbst überlieferte Legende um die Entstehung seines ersten Lieds. Inspiriert dazu habe ihn nämlich eines der Gedichte, die seine Mutter zur Vervollkommnung ihrer Deutschkenntnisse oft laut deklamiert habe. „Es begann mit den Worten: ‚Ich fühl’s, daß ich tief innen kranke, und Trauer zieht in mein Gemüt …‘ … Ich fand zu den Worten eine Melodie, die in G-Dur begann, um nach drei Takten ganz sinngemäß in Moll überzuleiten. Das war meine erste Komposition!“43
Wunderkind
Der junge ‚Lanzi‘ zeigte jedenfalls beachtliche Ansätze zum Wunderkind, obwohl man „von einem Wunderkind … in der Familie nur dann gesprochen hätte, wenn ich nicht Musiker geworden wäre. Der Musikunterricht, den mir mein Vater gab, hat allem Anschein nach nicht lange nach meinen ersten Gehversuchen begonnen. Er war aber von Haus aus sehr streng und auf Systematik abgestellt. So forderte mein Vater schon bei den ersten Klavierstücken mit starrer Pedanterie das genaue Einhalten der Tempi. Zu schnelles Spiel bei leichten Stellen nannte er ‚hudeln‘. Hudeln war ihm ein Greuel“.44 Wie Lehárs späterer militärisch-straffer Dirigierstil zeigt, hatte die strenge väterliche Schule durchaus Spuren hinterlassen. „Ich konnte als vierjähriger Knabe am Klavier zu jeder Melodie die richtige Begleitung, selbst in schwierigen Tonarten, finden, konnte auf verdeckten Tasten und im finsteren Zimmer spielen; ich wußte auch ein gegebenes Thema kunstvoll zu variieren.“45 Dem Zehnjährigen schenkte der Vater zu Weihnachten die Klavierauszüge von Carmen, Faust und Lohengrin, was diesen zu weiteren Kompositionsversuchen animierte. In diese Zeit dirigierte Franz Liszt ein Domkonzert in Klausenburg, bei dem der Militärkapellmeister Lehár freiwillig als Geiger mitwirkte. Sein Sohn saß neben ihm in einer Ecke. „Als Liszt nach Beendigung des Konzerts meinen Vater verabschiedete, beugte sich dieser über die Hand des Meisters, um sie zu küssen. Da erwachte in meiner kindlichen Seele zum erstenmal das Bewußtsein, daß Musik, ‚die Urform aller Künste‘, mehr ist als bloße Unterhaltung oder Broterwerb.“46
Den Ausgleich zum strengen Regiment des Vaters bildete die Mutter, die ihren Erstgeborenen verhätschelte, hatte sie doch die beiden nächsten Kinder früh verloren. Erst im Alter von fünf und sechs Jahren bekam „Lanzi“ Geschwister: Maria Anna, genannt Marischka, und Anton, den späteren Familienchronisten. Der berichtete, wie seine Mutter unter den oft nächtlichen Dienstzeiten ihres Mannes zu leiden hatte, nicht weniger unter den häufigen Umzügen und der geringen Gage. „Das Wirtschaftsgeld wurde am ersten jedes Monates in ‚Sackerln‘ tagweise verteilt. Vorzeitiges Entleeren eines ‚Sackerls‘ war ausgeschlossen. Mutter war eine seltene Sparmeisterin. Sie gab aber das Ersparte gern und ohne Zögern wieder aus, wenn es sich um ihre Kinder handelte.“47 Diese Sparsamkeit hat ihren Sohn geprägt, der auch später im Gegensatz zu seinen Kollegen sein vieles Geld nie zum Fenster hinausgeworfen hat.
Unter dem Wanderleben der Familie hatten allerdings auch die schulischen Leistungen gelitten, so dass es 1880 beim Übertritt ins Budapester Piaristengymnasium für Franz Lehár zum bösen Erwachen kam. „Wer weiß, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht in der Gesangsstunde das Harmoniumspiel übernommen hätte?“48 Da „Lanzi“ überdies ein fauler Schüler war, beschloss sein Vater, er solle die für ihn seit langem vorgesehene Musikerlaufbahn sofort einschlagen. „Als elfjähriger Knabe mußte ich, so wie einst mein Vater, das Elternhaus verlassen und an das deutsche Gymnasium in Sternberg in Mähren gehen. Damit hat meine glückliche Kinderzeit wohl zu rasch ein Ende gefunden“.49 Als weiteren Grund gibt Anton Lehár an, dass sein Bruder „zwar deutsch mit seinem Vater sprach, aber durch den Besuch magyarischer Schulen die deutsche Schriftsprache immer mehr und mehr vernachlässigt“50 hatte. Aus diesem Grund musste er in Sternberg dann auch das Gymnasium verlassen und noch einmal zurück in die Volksschule. Dafür lernte er dort als Musiker umso mehr. Schließlich war inzwischen Anton Lehar, der Bruder des Vaters, Stadtkapellmeister. Wie einst sein Vater bei dessen Vorgänger Heydenreich erhielt nun der Sohn systematischen Musikunterricht und geigte mit in der Stadtpfeiferei. Der Vater war derweil nicht müßig. Wegen der beschränkten finanziellen Möglichkeiten sah er sich nach kostenlosen Freiplätzen an den Musikhochschulen der Monarchie um. In Budapest, wo „Lanzi“ 1880 bei Professor István Tomka extern studiert hatte, waren sie bereits vergeben, in Wien erst für Vierzehnjährige zugelassen, in Prag aber nur durch eine äußerst schwierige Aufnahmeprüfung zu erlangen. Franz Lehár jun. bestand sie mit Bravour. So wurde er 1882 mit zwölf Jahren Instrumentalzögling am Prager Konservatorium.
Ungeliebte Violine
Am Konservatorium geriet er gleich zwischen die Fronten der „zwei scharf getrennten Lager der tschechischen und deutschen Mitschüler. In beiden hatte ich gute Freunde. Beide suchten mich für ihre nationalen Ideen zu gewinnen. Ich hatte aber wenig Verständnis für derartige Streitigkeiten. Musik soll die Völker einigen, nicht trennen. So fand ich leicht den Ausweg aus dem Dilemma. Als Ungar konnte ich, ohne anzustoßen, die kollegialen Beziehungen zu beiden Teilen aufrecht erhalten. Indem ich mein Ungarntum durch die Schreibweise Lehár betonte, führte ich auch die paar witzig sein wollenden Buben in unserer Schule ad absurdum, die meinen Namen gern als Lehař [ř=rsch] aussprachen. So kam es, dass ich ausgerechnet gerade in Prag in meinem ungarischen Bewusstsein gefestigt wurde.“51
In seinem Hauptfach Violine wurde er vom Direktor des Instituts, Anton Bennewitz, unterrichtet, in Musiktheorie von Josef Förster. Komposition stand nicht auf dem Lehrplan. Nach dem Willen des Vaters sollte er ausschließlich zum Geigenvirtuosen ausgebildet werden. Als Koststudent lebte er von 10 Kreuzern täglich in wechselnden, nicht gerade ansprechenden Quartieren. „Das Kostgeld, das meine Eltern schickten, kam mir nur zum geringen Teil zugute, und so geschah es, daß ich einmal auf der Gasse vor Hunger zusammenstürzte. Als mich einmal meine Mutter in Prag besuchte, hatte ich doch die Kraft, nicht zu klagen. Erst als sie wieder wegreiste und der Zug sich in Bewegung setzte, brach sich das trotzig bekämpfte Leid gewaltsam Bahn. Ich schrie: ‚Mutter! Mutter!‘ und lief dem Zug eine Strecke weit nach. Nur schwer konnten die Mitreisenden die arme Frau daran hindern, aus dem Coupé zu springen.“52
Nach zwei Jahren hatte das Elend ein Ende. Das Regiment des Vaters, mittlerweile das 102. der Infanterie, wurde nach Prag versetzt. Der Vierzehnjährige kehrte in den Schoß der Familie zurück. Geblieben war der Groll gegen den Hauptgegenstand seines Studiums: „Die Violine … war mir ob der stundenlangen Fingerübungen geradezu verhasst, nur Harmonielehre und Kontrapunkt war das einzige mich interessierende Fach“53 - noch mehr freilich Komposition. Da dieses Fach aber für Instrumentalzöglinge nicht vorgesehen war, nahm er heimlich Privatunterricht bei Zdenko Fibich, damals Dirigent des Hochschulorchesters und selbst erst Mitte zwanzig. Als Bennewitz dies entdeckte, stellte er seinen Zögling vor die Wahl, entweder Fibich oder das Konservatorium aufzugeben. Lehár blieb nur ein Ausweg: Antonin Dvořák, „der Wilde, wie man ihn nannte“54. Er hatte die Gewohnheit, sich seine neuen Streichquartette, ehe sie veröffentlicht wurden, erst von Studenten vorspielen zu lassen, und war froh um einen guten Geiger. So lernte Lehár den Komponisten auch persönlich kennen. „1887 legte ich Dvořák zwei Kompositionen vor: eine Sonate ‚Al’ Antique‘ in G-Dur und eine Sonate in d-Moll. Dvořák sah sich die Arbeiten an und sagte mir: ‚Hängen Sie die Geige an den Nagel und komponieren Sie lieber!‘ Das war mir aus der Seele gesprochen. Ich wollte sofort aus dem Konservatorium austreten und ausschließlich bei Fibich Unterricht nehmen. Aber dieser Plan scheiterte an dem festen Widerstande meines Vaters. Er beharrte darauf, daß ich als absolvierter Konservatorist ein Instrument, die Violine, vollkommen beherrsche. Wenn bei mir Talent zum Komponieren sei, so werde es sich später schon Bahn brechen. Von meinen zwei … Sonaten schien mein Vater nicht gerade entzückt.“55
Dennoch führte er ihn kurz vor Ablauf der Studienzeit zur nächsthöheren Instanz, Johannes Brahms. „Auch ihm habe ich meine Sonate vorgespielt. Brahms äußerte sich sehr wohlwollend über mich und gab mir eine Empfehlungskarte an Professor Mandyczewski; von der ich keinen Gebrauch machen konnte, denn ich mußte wieder nach Prag zurückkehren. Die Empfehlung hatte folgenden Wortlaut: ‚Herrn M.D. (Musikdirektor) Lehár empfehle angelegentlich und bitte wegen seines Sohnes freundliche Rücksprache zu nehmen – die Beilagen sprechen und empfehlen weiter‘.“56 Lehár hat diese Empfehlung aufbewahrt und ihr im Museum seines Lebens einen Ehrenplatz hinter Glas zugewiesen.
Dass ihn die Prager Jahre musikalisch geprägt haben, ist Lehárs Kompositionen durchaus anzuhören, besonders seiner ersten aufgeführten Oper Kukuška, über die ein Wiener Kritiker schrieb, sie habe „das Richard Wagnersche Kunstprinzip … so gut wie verschlafen.“57 Tatsächlich hat Lehár Wagner erst später für sich entdeckt, seine Vorbilder waren Smetana, Dvořák und Fibich. Außer den wenigen heimlichen Stunden bei letzterem hatte er keinen Kompositionsunterricht genossen und muss daher als Autodidakt bezeichnet werden, vor allem im Vergleich zu seinen Konkurrenten Oscar Straus und Eduard Künneke, die bei Max Bruch in Berlin studiert hatten, oder zu Emmerich Kálmán, dem Meisterschüler Hans Koesslers in Budapest.
Entsprechend ernüchternd fällt das Resümee des Komponisten über sein Studium aus: „Ich kann mir die Bemerkung nicht versagen, daß das künstlerische Resultat meiner Konservatoriumszeit kein überwältigendes war. Wirklich verwerten konnte ich später fast nur das, was ich außerhalb der Schule gegen den Wunsch meiner Lehrer und meines Vaters gelernt habe. Das Opfer unzähliger Übungsstunden, ja ganzer Nächte, habe ich vollkommen nutzlos gebracht.“58 Bezeichnenderweise unternahm Franz Lehár nach seiner Prager Studienzeit keine weiteren klassisch-akademischen Kompositionsversuche mehr. Abgesehen von den immerhin fünf Sonaten, einem Scherzo und der einem „Frl. Marie Prawender“59 gewidmeten Fantasie für Klavier, die er alle im Alter von 16 und 17 Jahren schrieb, komponierte er auch später weder Sonaten noch überhaupt Klavierwerke, sieht man von den 1909 herausgegebenen Salonstücken 12 compositions pour piano einmal ab.
Primgeiger in Elberfeld
Nachdem Lehár beim Abschlusskonzert der Instrumentalzöglinge am 12. Juli 1888 mit Max Bruchs Violinkonzert in d-Moll geglänzt hatte, empfahl ihn sein Diplom als „vorzüglichen Orchester- und Solo-Spieler.“60 Als solcher wurde er zwei Monate später an die ‚Vereinigten Stadttheater Barmen-Elberfeld‘ (heute Wuppertal) engagiert, der ersten Station seiner eigentlichen Lehr- und Wanderjahre. „Obwohl ich die Stelle ungern und nur aus materiellen Gründen antrat, hat mir dieses erste Jahr, in dessen Verlaufe ich zum Konzertmeister aufrückte, sehr genützt. Ich lernte das Orchester kennen und bekam vom Theater, namentlich von der Oper, deutlichere Begriffe“61, insbesondere von Wagner, dessen Rheingold und Walküre damals auf dem Spielplan standen. Der achtzehnjährige Primgeiger verdiente 150 Mark im Monat und knüpfte erste zarte Bande zu einer „blonden sechsunddreißigjährigen Sängerin“62. Trotzdem fühlte er sich eingeengt. „Durch ein Telegramm meines Vaters wurde ich plötzlich nach Wien gerufen, er benötigte für seine Kapelle dringend einen Solisten. Direktor Gettke weigerte sich, mich freizugeben, außer wenn ich ihm einen genügenden Ersatz verschaffen würde. Da das so schnell nicht möglich war, bin ich einfach durchgegangen und kontraktbrüchig geworden“63. Ein Motiv, das Lehárs Leben und Werk durchzieht, angefangen bei der männlichen Hauptfigur seiner Kukuška bis hin zum Deserteur Octavio in Giuditta.
Um den gerichtlichen Folgen seines Kontraktbruchs zu entkommen, ließ er sich sofort zum Militär assentieren und übernahm die Konzertmeisterstelle im Orchester des IR 50 seines Vaters in Wien. Sein Pultnachbar war der sechzehnjährige Leo Fall, ebenfalls Sohn eines Militärkapellmeisters und damals Student am Wiener Konservatorium. Er war der einzige seiner späteren Konkurrenten, zu dem Lehár ein engeres Verhältnis hatte. „Freundschaften werden in der Jugend leichter geschlossen als im Alter, und so blieb er mir in allen weiteren Jahren stets der gleiche gute Kamerad, der zwar seinen Weg ging, aber immer wieder die alten Beziehungen erneuerte, wenn sich unsere Lebenswege kreuzten.“64
Franz Lehár genoss die neue Freiheit, komponierte für die väterliche Kapelle den Marsch Rex Gambrinus Ex, den Walzer Liebeszauber, eine Festhymne zur Enthüllung des Grillparzer-Denkmals im Volksgarten sowie eine Sérénade romantique für Violine, in der, wie Lehár später feststellte, „merkwürdigerweise schon Santuzzas ‚Höre, Turriddu, reize mich nicht …‘ Note für Note vorkommt. Das war zu einer Zeit, da Mascagnis Cavalleria Rusticana kaum geschrieben war“65. Ansonsten tat er sich mit Violinsoli vor allem bei der Wiener Damenwelt hervor und vertrat den Vater gelegentlich wohl so gut am Pult, dass es, wie er selbst 1903 Deutsch-German berichtete, zu ersten Spannungen kam: „Er sah in mir eine Gefahr für sich und sagte mir eines Tages: ‚Schau, daß du weiterkommst, suche dir eine eigene Capelle‘.“66
Jüngster Militärkapellmeister der Monarchie
Auf Empfehlung von Karl Komzak67 wurde Franz Lehár jun. schließlich mit 20 Jahren Militärkapellmeister beim Infanterieregiment Nr. 25, Freiherr von Pürcker, und damit der jüngste der gesamten Armee. Stationiert war das Regiment im oberungarischen Losoncz (Lučenec), einem jener berüchtigten Garnisonsstädtchen „mit zirka 8000, zum größeren Teil ungarischen, zum kleineren Teil slowakischen Einwohnern“, dessen Tristesse Lehár eindrücklich schildert: „Der Ort selbst ist sehr arm. Er besteht im großen Ganzen aus einem Straßenzug und aus einem Marktplatz, an den sich einige Reihen von Bauernhäusern schließen. Die Beamten- und Kaufmannsfamilien sowie die – zum Teil adeligen – Gutsbesitzer der Umgebung bildeten im Verein mit dem Offizierskorps der Garnison die gesamte Intelligenz des Ortes. Hier sollte ich nun wirken“. Dem jungen Dirigenten stand ein Orchester mit bescheidenen Mitteln und nur wenigen ausgebildeten Feldwebeln zur Verfügung. Es bestand zum Großteil „aus den einigermaßen musikkundigen Rekruten des Regiments“. Und der junge Kapellmeister machte es sich „zur Aufgabe, die Soldaten zu Musikern zu erziehen. Ich hielt vormittags tüchtig Proben und gab nachmittags musiktheoretischen Unterricht und hatte bald die Freude, daß die Aufführungen eine achtenswerte Höhe erreichten. Ich gründete ein Quartett, Kammermusik wurde eifrig betrieben, musikalische Messen und Oratorien kamen in der Kirche zur Aufführung, kurz, der Betätigungsdrang der Jugend kannte keine Grenzen.“68
An Grenzen stieß er jedoch, als ihm sein vorgesetzter Oberst, Baron Fries, auftrug, seiner Tochter Gesangsunterricht zu erteilen. Lehár, in völliger Unkenntnis der Gesangstechnik, wagte nicht abzulehnen. „Befehl ist Befehl … Meine Verlegenheit war nicht gering, als ich dem hübschen siebzehnjährigen Mädchen gegenüberstand … die junge Baronesse merkte sehr schnell, daß ich mich auf Gesangsunterricht nicht verstand … Vilma Fries lernte bei mir zwar nicht singen, aber schon in der zweiten Stunde sang sie ein Lied, das ich für sie komponiert hatte. Ach, wie oft probierten wir dieses Lied: Vorüber!“ Emanuel Geibels Text besang den flüchtigen „Traum, den erste Liebe webt“ und Lehárs Komposition wob ihn melancholisch weiter. Mit Widmung an und Bild von „Baronesse Vilma Fries“ erschien das Lied noch 1890 bei Hofbauer im Druck. Lehár „lebte in einer ständigen Todesangst“, dass sein Vorgesetzter seine mangelnde gesangspädagogischen Fähigkeiten entdecken würde. „Um die Oberstentochter zu versöhnen, komponierte ich Lieder, die ich ihr widmete. Sie verstand dies zu würdigen, verriet mich nicht bei ihrem Vater, sondern erschien pünktlich zu den Gesangsstunden, während ihre Stimme von Mal zu Mal heiserer wurde. Als sie schließlich keinen Ton aus der Kehle brachte … verstand sie es, ein für mich glimpfliches Ende der Unterrichtsstunden herbeizuführen.“69 Ob dies auch das Ende ihrer Bekanntschaft war, ließ er offen. Jedenfalls vertonte er noch am 20. September 1891 eines ihrer Gedichte, das im Mazurka-Rhythmus viel über ihre Beziehung verrät:
02 Franz Lehár (2. v. l. stehend) in „genießender Gesellschaft“, Losoncz 1892
„O schwöre nicht! Ich weiß es doch, daß nimmer, nimmer du mir treu,
denn leicht und flüchtig ist dein Sinn, wie duft’ger Windeshauch im Mai.“
Im selben Jahr entstand auch Aus längst vergangener Zeit, ein weiteres Lied nach einem Gedichte der Baronesse und ein frühes Beispiel für Lehárs Drang zur Oper: eine fast dramatische Szene mit rhapsodisierender Klavierbegleitung und veristischen Ausbrüchen. Ungewohnt freizügig musste er über seine Losonczer Zeit später „mit einem kleinen Geständnis herausrücken. Ich war schon mit zwanzig kein Feind von Frauen.“ Und fährt fort: „Manches Lied aus jener Zeit … verdankt seine Entstehung meiner – ‚ersten Liebe‘. Ich will darüber den Schleier des Vergessens legen.“ Ein Kavalier nennt keine Namen, zumal in diesem Kontext eine weitere Musentochter auftaucht: Rosa Cebrian, eine Comtesse, der er sein erstes Walzerlied mit dem vielsagenden Titel Möcht’s jubelnd in die Welt verkünden verdankte. „Mein leicht entzündliches Temperament, ein lustiges in den Tag hineinleben riß mich fort von der Seite meiner Angebeteten und mitten hinein in die – man verzeihe mir mit Rücksicht auf Losoncz diesen Ausdruck – genießende Gesellschaft. Daraus erwuchsen mir Verpflichtungen, mit denen meine geringe Gage nicht in Einklang stand … Ein Gutes aber hatten die Schwierigkeiten. Sie wiesen mich gebieterisch auf das Feld der Arbeit zurück, auf dem allein ich eine Besserung erwarten konnte. Freilich, so ganz ohne Ulk ging auch das nicht ab. Ich wettete mit einer Tischgesellschaft von Offizieren um fünfzig Liter Wein, daß ich den ganzen Winter hindurch weder tanzen noch eislaufen werde. Im Anfang hatte es mich … Überwindung gekostet … aber schließlich gewann ich die Wette, und mehr als der Wein, den gute Freunde austranken, bedeuteten für mich die gewonnenen Stunden“. Er nutzte sie zur Komposition von Märschen, Walzern und virtuosen Geigenstücken wie Magyar dalok, Magyar ábránd, Magyar noták, Magyar egyveleg. Aber sein stilles Verlangen galt der Oper. Sein erster Versuch auf musikdramatischem Gebiet war Der Kürassier, nach einem Libretto des Bahnbeamten Gustav Ruthner. „Aber die Arbeit gedieh über einige Szenen nicht hinaus“70.
03 Lehárs Gesangsschülerin Vilma Fries auf dem Titelblatt seines ersten veröffentlichten und ihr gewidmeten Lieds, 1890.
„Wie empfunden, so geschrieben“
Im Jahre 1893 schrieb der Herzog von Coburg-Gotha einen Wettbewerb für Operneinakter aus. Vorbild war der Concorso Sonzogno des gleichnamigen Mailänder Musik-Verlags, der auf diese Weise 1889 Pietro Mascagnis Cavalleria Rusticana entdeckt hatte. Gesucht wurde also der deutsche Mascagni. Franz Lehár fühlte sich berufen, bewarb sich und vertonte Rodrigo, eine echte Räuberpistole, deren Handlung Ernst Decsey folgendermaßen wiedergibt: „Räuber Fernando … raubt einem Ritter Rodrigo die eben angetraute Angela. Angela willigt ein, Fernandos Geliebte zu werden, verlangt aber vorher noch einmal ihren Mann Rodrigo zu sehen. Der harmlose Räuber erlaubt es, worauf die weitaus raffiniertere Angela sich von Rodrigo erstechen lässt. ‚Tausend Dank‘ hauchen ihre hochgemuten Lippen …“71
Lehár war Feuer und Flamme: „Ein Kamerad, Oberleutnant Mlcoch, ein etwas wirrer, aber genialer Kopf, schrieb den Text, eine romantische wahre Räubergeschichte. Ich war mit heller Begeisterung bei der Sache und arbeitete Tag und Nacht. Kaum war eine Szene fertig, wurden auch schon die Stimmen herausgeschrieben und jede Stelle vom Orchester probiert.“72 Dies wurde die wahre Schule des Autodidakten Lehár, der sich hier durch praktische Umsetzung seine vielgerühmten Instrumentationskünste erwarb: „Wenn andere am Klavier komponieren, komponiert Lehár am Orchester.“73 Angesichts der beschränkten Möglichkeiten seiner Militärkapelle lernte der Dreiundzwanzigjährige mit kleinen Mitteln große Wirkungen zu erzielen. Auf 118 Partiturseiten frönte er ungeniert einem Verismus à la Mascagni, dessen Cavalleria ihn bei einem Wienbesuch tief beeindruckt hatte, bis hin zu einem Preludium religioso in der Nachfolge des berüchtigten Intermezzo sinfonico: mit effektvollem Violinsolo, das unverkennbar bereits den typischen lyrischen Lehár-Ton verrät.
„Wie empfunden, so geschrieben“74, notierte der junge Komponist aufs Titelblatt und formulierte damit gleich das Motto für sein gesamtes Werk. Dass es ihm bei seinen Libretti mehr auf den emotionalen als den intellektuellen Gehalt ankam, blieb eine Konstante seines Schaffens. Auch in dieser Beziehung hatte er mit Rodrigo seinen Weg als Komponist gefunden. Trotzdem war der Oper kein Preis beschieden, ein Schicksal, das sie mit Le Vili von Giacomo Puccini teilt. Der Erstling seines späteren Freundes war beim Concorso Sonzogno ebenfalls leer ausgegangen. Die während der Komposition gemachten Erfahrungen wollte Lehár freilich auch im Nachhinein nicht missen: „Ich glaube auch heute müßte mich jeder Konservatorist um die Gelegenheit beneiden, die ich hatte: ein gutes Orchester von 42 Musikern stand mir frei und ohne jede Beeinträchtigung zur Verfügung. Ich konnte mit ihnen experimentieren. Das habe ich auch gründlich getan und so manches gelernt, was ich später verwerten konnte.“75
Es war ausgerechnet die Geige, die Lehárs produktiver Idylle in Losoncz ein Ende setzte. „Nie gewann ich die Herzen meines zumeist ungarischen Publikums so sehr, als wenn ich die Geige selbst zur Hand nahm und, von der Kapelle begleitet, die bald melancholischen, bald feurigen ungarischen Weisen ganz nach Zigeunerart zum Vortrag brachte. An einem Abend, es war im November oder Dezember 1893, setzte ich mich gegen 12 Uhr nachts, nach einem längeren Konzert ermüdet, an einen Tisch, um zu nachtmahlen, während die Musik noch einige Märsche als Schlußmusik spielte. Da ließ mich ein Stabsoffizier durch einen Kellner auffordern, ein Violinsolo, sein Lieblingslied, vorzutragen. Ich fühlte mich durch die Form und den Inhalt dieses Ansinnens in meinem Künstlerstolz tief verletzt. ‚Ich bin kein Zigeunerprimas, und wenn der Herr etwas haben will, dann möge er selbst kommen‘, so lautete meine heftige Antwort. Es kam zu einem Konflikt, und trotzdem die Sympathie des Offizierskorps auf meiner Seite war, wurde ich doch als der jüngere aufgefordert, dem Stabsoffizier Abbitte zu leisten. Ich beantwortete diese Zumutung mit der Kündigung meiner Stellung.“76
Der zuständige Oberst war Baron Fries, Vilmas Vater, der die Affäre des jungen Kapellmeisters mit seiner Tochter offensichtlich nicht vergessen hatte. Der wiederum rächte sich auf seine Weise und entzog dem ihm gewidmeten Oberst-Baron-Fries-Marsch kurzerhand den Titel.77 Dass sich Lehár dem militärischen Ehrenkodex überhaupt durch Kündigung entziehen konnte, lag an der erwähnten gesellschaftlichen Zwitterstellung der österreichischen Militärkapellmeister, die ihm als Zivilist innerhalb des Offizierskorps erlaubte, selbst zu kündigen, ein Vorrecht, von dem Kapellmeister Lehár reichlich – und meist zu seinem Vorteil – Gebrauch machen sollte. „Dieser Vorteil wurde für meine Karriere entscheidend, denn ich kam aus dem kleinen Ort heraus in ein neues Milieu“78.
Marinekapellmeister
Kurz nach Lehárs Kündigung in Losonc wurde nämlich die begehrte, einzige Dirigentenstelle bei der Marine ausgeschrieben. Es gab über 120 Bewerber. Franz Lehár junior erhielt sie. Hauptkriegshafen der österreichischen Marine war Pola (heute: Pula) in Istrien damals eine Stadt von 40.000 Einwohnern, davon über ein Viertel Militärangehörige. Nach der Volkszählung von 1900 waren 59 % Italiener, 26 % Kroaten und 11 % Deutsche. Vor dem Ausbau des Hafens 1856 war Pola ein unbedeutendes Fischerdorf gewesen, im März 1894, als Franz Lehár seine neue Stelle antrat, war es eine moderne Stadt, malerisch an der Adria gelegen, mit eleganter Uferpromenade und Kasino. Ein anderes Milieu als das provinzielle Losoncz. Außerdem stand ihm hier das größte Militärorchester der Monarchie zur Verfügung. Zwar mussten immer kleine Abteilungen für die Kriegsschiffe bereitgestellt werden, doch bildeten die „110 Mann“ in voller Besetzung ein veritables Sinfonieorchester, mit „mehr als 30 gut ausgebildeten Musikmeistern (mit Feldwebelrang)“79. Lehár war überwältigt von den Möglichkeiten, die sich hier boten. Kaum einen Monat nach seiner Ankunft konnte er sie auch schon bei einem Konzert vor dem deutschen Kaiser Wilhelm II. erproben. Der war von seinem, wie es sein Begleiter Fürst Philipp zu Eulenburg nannte, „merkwürdig begabten“80 Dirigat derart beeindruckt, dass er sich noch vier Jahre später bei seinem nächsten Besuch nach dem jungen Kapellmeister von damals erkundigt haben soll.81
Wie damals stand auch beim „Großen Concert der k. u. k. Marine-Musik im Politeama Ciscutti am 5. Jänner 1895“ der von Wilhelm II. komponierte Sang an Ägir auf dem Programm. Lehár selbst hat den Programmzettel aufbewahrt, stand doch bei diesem Konzert auch die Uraufführung seiner Symphonischen Dichtung „für Pianoforte mit Orchesterbegleitung“ Il Guado (Die Furt) auf dem Programm. Vorlage war Lorenzo Stecchettis gleichnamiges Gedicht, in dem das Durchschreiten eines Flusses als erotische Metapher dient – mithin der perfekte Stoff für den jungen Lehár, der hier zum einzigen Mal in seinem Schaffen Klavier und Orchester kombiniert. Fließend gehen der flirrende Klavierpart und die illustrativen Orchesterfluten ineinander über, bis nach deren langsamem Anschwellen und einer Kadenz des Klaviers alles wieder flirrend fließt wie zuvor. Die Musik kommt dabei so unschuldig naturhaft daher, dass deren erotischer Doppelsinn kaum auffallen würde, wäre der Text nicht so eindeutig: „Ich fühlte mir in die Lenden schießen / die Wollust wie ein eisiges Schwert … Ich fiel auf die Knie / küßte sie auf den Mund und schloß die Augen. / Was dann geschah? Das sah und verstand / das Wasser des Flusses, kristallen und klar.“82
Auf dem Programm dieses Konzerts standen unter anderem auch die Vorspiele der Oper Cornelius Schutt von Antonio Smareglia, dem istrischen Meister des Verismo. Mit ihm hatte sich Lehár in Pola angefreundet. Noch wichtiger war freilich die Freundschaft zum dichtenden Korvettenkapitän Felix Falzari. „Der gebürtige Venezianer und um elf Jahre älter als Lehár, war ein poetischer Mann. Weite Seereisen hatten seine Phantasie beflügelt“83, wie Maria von Peteani sich ausdrückte. Der perfekte Partner also für Lehárs große Ambitionen. Unverzüglich machten sie sich an seinen ersten und ambitioniertesten Liedzyklus, die Karst-Lieder, 1894 unter dem Titel Weidmannsliebe publiziert und dem selbst komponierenden Fürst Eulenburg gewidmet. Die sieben kurzen Lieder beschwören in zart hingetupften Akkorden eine „Welt der Träume“. Auch wenn man den Zyklus nicht wie Bruder Anton gleich „neben die Mörikelieder Hugo Wolfs“84 stellen muss, nehmen die Karst-Lieder doch unter allen Kunstliedern Lehárs eine Sonderstellung ein und zeigen erstmals seine lyrische Meisterschaft. Beglückt von dieser Zusammenarbeit, drängte er Felix Falzari, ihm das ersehnte Opernlibretto zu schreiben. Als Vorlage schlug Falzari George Kennans damals populäre Reiseschilderungen Durch Sibirien vor. Lehár war Feuer und Flamme. Und Falzari schrieb ihm das „Lyrische Drama in drei Aufzügen Kukuška“. Lehár vertonte es „innerhalb zehn Monaten in einem wahren Begeisterungstaumel, in den mich Falzari zu versetzen und in dem er mich auch zu erhalten wußte.“85
Kaum ist im Mai 1895 der Klavierauszug fertig, erfasste den Komponisten angesichts der täglich ein- und auslaufenden Schiffe das Fernweh. Als im Juni ein Geschwader zur Eröffnung des Nord-Ostseekanals von Pola abgehen sollte, entschloss er sich, „in die strahlende Welt hinauszuziehen“. Obwohl er als Marinekapellmeister eigentlich im Hafen verbleiben musste, wenn seine Musiker auf See gingen, bekam er die Erlaubnis. Wieder war es seine Geige, die den Kommandanten des Geschwaders, Admiral Erzherzog Karl Stephan, bewog, ihn mitzunehmen. „Ich war damals ein flotter Geiger … und hatte mir speziell ungarische Violinsoli zurechtgelegt, die ich nun täglich zu spielen hatte, ob schön, ob Regen, ja selbst bei Sturmgebraus … Was ich auf der Reise sonst sah? Ich kann es nur in Schlagworten wiedergeben. Von Gibraltar ging’s mit der Eisenbahn nach Ronda … mit seinen schaurigen Schluchten, dann nach Linea zu einem Stiergefecht … Auf der Seefahrt sahen wir fliegende Fische und einmal einen Haifisch … Dann will ich noch die Luftspiegelungen erwähnen, wo wir am Horizont alle Schiffe verkehrt, mit deren Segeln und Rauchschloten nach unten gerichtet sahen. In Kiel waren … Kriegsschiffe aller Nationen … und auf Kommando begannen die Salutschüsse, die in einem das Gefühl erweckten, die ganze Welt müsse untergehen. Nach zweimonatiger Reise, reich an Erinnerung, kehrte ich wieder nach Pola zurück und kam mir nun wie umgewandelt – wie ein anderer Mensch vor.“86
„Franz ist nicht ganz gesund“
Derart umgewandelt machte sich Lehár mit Feuereifer an die Instrumentation seiner zweiten Oper. Weit mehr als bei seinem Erstling Rodrigo versetzten ihn die Möglichkeiten seines Orchesters in die Lage, die Instrumentation original in der Praxis zu erproben, hatte er doch hier tatsächlich die große Besetzung eines Opernorchesters zu Verfügung. Hier erst eignete er sich jene Technik des „auf Zuruf Instrumentierens“ an, für die er nachmals berühmt werden sollte und die darin bestand, einen notierten Orchesterklang auf der Probe zu überprüfen und gegebenenfalls „auf Zuruf“ der entsprechenden Instrumentalisten zu korrigieren. Das nahm so viel Zeit in Anspruch, dass er deswegen seinen Dienst als Marinekapellmeister vernachlässigte. Zermürbt von den „andauernden Zwistigkeiten“87, dachte er nur noch an die Vollendung seiner Oper. Der Wiener Verlag Hofbauer, bei dem bereits einige Lieder, Märsche und die Dvořák und Brahms vorgespielte Sonate erschienen waren, erklärte sich bereit, den Druck zu übernehmen und konnte Kukuška auch gleich beim Leipziger Stadttheater unterbringen. Kaum hatte Direktor Staegemann den Uraufführungstermin angesetzt, verabschiedete sich Lehár genialisch von Pola, der Marine und seinem bisherigen Dasein mit den prophetischen, an die Eltern gerichteten Worten: „Ich tauge nicht zum Militärkapellmeister, ich habe zuviel Ehrgefühl dazu! … Wollt Ihr es Eurem Kinde nicht verzeihen, wenn es seine Knechtschaft endlich einmal abschüttelt! Ich kann nicht mehr dienen, ich will frei sein … Ich fühle mich seit der Stunde, wo ich diesen Entschluß ausführte, wie neugeboren! Es kommt schon die Zeit, wo Ihr mich verstehen werdet!“88
Militärkapellmeister Franz Lehár sen. fiel aus allen Wolken. Nach aufreibenden 40 Dienstjahren kurz vor der Pensionierung stehend, war er entsetzt, dass sein Sohn die glänzendste Stellung in der gesamten k. u. k. Militärmusik aufgegeben hatt, zumal die finanzielle Situation der Familie noch immer keine großen Sprünge erlaubte. 1890 war Nachzüglerin Emmy in Wien geboren worden, wo der Vater etwa ein halbes Jahr vor ihrer Geburt ein denkwürdiges Konzert in den Harmonie-Sälen dirigiert hatte, bei dem auch Anton anwesend war. Wie der sich erinnerte, spielte er als Zugabe einen Marsch mit dem Refrain: „‚Wenn die Schwalben wieder kommen, die werden schaun, ja, die werden schaun!‘ – Vater lachte meine Mutter beim Dirigieren spitzbübisch an. Diese aber wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte“. Zwei Jahre zuvor war Vaters Liebling Marischka, gerade frisch verlobt, in Sarajevo an einem „tückischen Halsleiden“ gestorben, „ein liebes stilles Mädchen“, wie sich Anton erinnerte, deren „ruhige, jeden Effekt vermeidende, überlegene Art des Klavierspielens“89 er bewunderte.
Anton selbst war noch auf der Kadettenschule in Kronstadt (Brasov). Er war der Vertraute seiner Mutter, die ihm besorgte Briefe über den nach Budapest heimgekehrten Bruder schrieb: „Franz ist nicht ganz gesund. Denn es ist undenkbar, daß ein gesunder Mensch nicht mehr Selbstbeherrschung haben sollte. Es ist dringende Arbeit gekommen. Die Aufführung in Leipzig hängt davon ab, ob die Stimmen rechtzeitig korrigiert und in Druck gegeben werden. Und was tut Franz? Er steht um 8 Uhr vormittag [!] auf. Badet. Liest die Zeitung. Dann frühstückt er. Arbeitet dann kaum eine halbe Stunde. Gabelfrühstück. Dann liest er wieder. Etwas Arbeit. Mittagessen. Dann schläft er bis 4 Uhr nachmittags. Tuschbad. Arbeit ganz ohne Animo. Einmal schreibt er die Nächte durch. Dann bekommt er einen Anfall von Starrkrampf in den Fingern und hat wüste Träume und wacht mit furchtbaren Kopfschmerzen auf. Dann kommen wieder Zeiten, wo er gar nicht arbeitet. Franz will weder dem Direktor der Budapester Oper, Kaldy, schreiben, noch nach Wien zum Verleger Hofbauer gehen. Es soll alles von selbst kommen. Er träumt von 100.000den, da wird er sich aber sehr täuschen. Daß er leichtsinnig gewirtschaftet hat, kannst Du Dir denken. Er hat sein Klavier und die Violine verkauft und Schulden! Alles ist darauf gegangen [!]. Nun ist Franz in Wien. Was wird er ausrichten? Der Verleger Hofbauer hat ihm noch nichts gegeben. Wir wissen nicht, ob er einen Kontrakt mit ihm abgeschlossen hat. Franz meint, das ist alles Nebensache. So steht es also mit ihm … Vater möchte am liebsten schon in Pension gehen. Er wartet nur, bis Franz ein sicheres Brot hat.“90
Dieser Brief der Mutter gibt eines der wenigen ungeschminkten Porträts des jungen Lehár: ein Bohemien, der seine Habe verjuxt, Schulden hat, den Tag vertändelt und in der Nacht arbeitet – Letzteres eine Gewohnheit, die er sein Leben lang beibehalten sollte. Ansonsten ist „Leichtsinn die Parole“ des sechsundzwanzigjährigen angehenden Opernkomponisten. Das gilt auch für die Partitur von Kukuška, in der sich seine Leidenschaft ungebrochen austobt. Und so sind auch die Figuren: Da ist Alexis, ein russischer Soldat, der aus Liebe zum Wolgafischermädchen Anuška erst deren Vater gegen den aufgebrachten Mob verteidigt und dafür dann vom Statthalter des Zaren nach Sibirien verbannt wird. Und da ist Anuška, die ihm nach Sibirien folgt. Dort hat sich Alexis mit seinem kirgisischen Rivalen Sašha versöhnt, der ihn eben noch erdolchen wollte und ihm jetzt zur Flucht in die Steppe verhilft, wo bereits Anuška herumirrt. Der trügerische Freiheitsruf „General Kukuškas“, wie auf Russisch der Kuckuck heißt, führt Alexis zu seiner Geliebten. Statt in „Frühlingsblumen“ findet er sie in schneebedeckter Taiga und mit ihr gemeinsam den Liebestod.
Dies Schlussbild getäuschter Frühlingshoffnung erinnert an jene „unermeßliche Ebene an der fernsten Grenze von New Orleans“, in der Manon Lescaut „sola, perduta, abbandonata“91 seit 1893 zu Tode kommt. Puccinis Oper hatte Lehár bei der Budapester Erstaufführung im Jahr darauf schwer beeindruckt. Wie bei Manon Lescaut bildet auch bei Kukuška