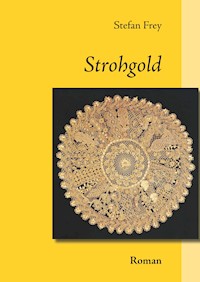
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau und ein junger Mann - beide schön anzuschauen - begegnen sich im Zug nach Paris, wo sie sich vorerst in der Gare de l'Est trennen müssen. So beginnen üblicherweise Liebesgeschichten. Auch im Roman Strohgold von Stefan Frey steht die Geschichte zweier Verliebter am Anfang und am Ende. Sie beginnt im Februar 1855, vor der ersten Weltausstellung in Paris, und findet ihr - vorläufiges - Ende nach der Internierung der Bourbaki-Armee (Februar 1871) in der Schweiz.Die junge Frau ist die älteste Tochter einer Bauern- und Heimarbeiterfamilie, die sich im aargauischen Freiamt mehr schlecht als recht mit Strohflechten über Wasser hält. Sie startet als Au-Pair-Mädchen und setzt sich bis zur Spitze des Stroh-Unternehmens durch. Der junge Mann ist Offiziersanwärter an der Militärakademie St. Cyr und wird später Brigadier der Kaisergarde. Beide treffen im Herzen des zweiten französischen Kaiserreichs ein - dem Second Empire - wo Baron Haussmann gerade jene Stadt aus dem Boden stampft, die heute von aller Welt geliebt wird. Die Verliebten - und schließlich Verlobten - durchlaufen eine Epoche unglaublichen persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Aufstiegs. Geprägt von Figuren, die ihre Länder 'wieder groß' machen wollten - und sie in den Abgrund stürzten. Dabei erweist sich der scheinbar fragile Rohstoff der Heimarbeiter - Stroh - als bemerkenswert resistent. Er ist nicht nur biegsam und lässt sich zu unvorstellbaren, bis heute existierenden Kunstwerken verarbeiten, er ist auch wirtschaftlich von herausragender dauerhafter Bedeutung. Vor allem im Freiamt, das bis in die Mitte des 20. Jahrhhunderts diesbezüglich der globale Maßstab war. Hier errichten während und nach dem Second Empire die Strohbarone ihre Reiche. In ihren Bauernkaten sind derweil die Stroh flechtenden Frauen, Männer und Kinder glücklich, wenn sie nicht noch ärmer werden und schließlich als Arbeiter in der Fabrik ihr Brot verdienen dürfen. Das Erstaunliche am Roman Strohgold sind nicht die schrecklichen historischen Ereignisse, die das Paar mitreißen. Nicht einmal die Zwangsläufigkeit irritiert, mit der sich von Politikern verursachte Katastrophen wiederholen. Das wirklich Beängstigende ist der Unwille, aus der Geschichte zu lernen. Damals und heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Vreni und Kurt
„Hegel bemerkt irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Thatsachen und Personen sich so zu sagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als große Tragödie, das andre Mal als lumpige Farce.“
Karl Marx (in Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon, Titel 1. Auflage 1852 )
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Abschied und Ankunft
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweiter Teil: Aufbau, Erfolg, Wohlstand
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Dritter Teil: Sieg, Niederlage, Heimkehr
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Erster Teil Abschied und Ankunft
Prolog
Der Winter hielt das Bünztal im eisigem Griff. Aus dem letzten Sommer stehen gebliebene Schilfhalme stakten unbeweglich und mattsilbrig auf Schneefeldern über Mooren, in einen sich in den Morgen flüchtenden Nachthimmel. Weiße Birkenstämme markierten rare senkrechte Streifen in einer Landschaft, die sich in sanften Hügeln, einer ozeanischen Dünung gleich, von Osten nach Westen wellte, und die Schemen für Schemen aus einer sternenlosen Nacht in einen wintergrauen Tag auftauchte. Während am östlichen Horizont, Baden zu, eine lachsfarbene Wand in die Höhe wuchs, ging im Westen, Bern zu, der ins Anthrazitene spielende Nachthimmel unter.
Aus den Dächern der verstreut in der Dünung der Landschaft liegenden Bauernkaten entwichen dünne Rauchfahnen. Kein Mensch war zu sehen. Man suchte Schutz und Wärme im bescheidenen Heim, das sich Mensch und Tier teilten und außerdem - meist auf dem Dachboden oder in angebauter Tenne - als Lager für Futter und Stroh diente. Die Dörfer selbst waren hingeworfene Ansammlungen gemeinsamen Zwecken dienender Gebäude. Um die Kirche scharten sich das Pfarrhaus, das Wirtshaus, die Grundschule mit dem Lehrerhaus, eine Handlung, die gleichzeitig die Milchsammelstelle war, ein Versammlungsort, in dem Gemeindeangelegenheiten geregelt wurden, aber, an hohen kirchlichen Feiertagen, auch pastorale Veranstaltungen stattfanden, sofern das Wirtshaus dafür zu klein gewesen wäre. In jedem zweiten Dorf gab es einen Schmied für das Beschlagen der Pferde und die Reparatur von Karren und allerhand Fahrbarem. Für Behördliches, Medizinisches oder auch Gerichtliches musste man in Hauptorte fahren oder laufen. Nach Wohlen etwa oder nach Muri, je nachdem, was näher lag und wohin man nach dem Willen der höheren Gewalt zu gehen hatte.
Kirchtürme prägten die Ortsbilder im Freiamt, dessen Herz das Bünztal war; katholische Kirchtürme, um genau zu sein. Denn bis hierhin hatten es trotz des Sieges im Sonderbundskrieg, der vor gut einem halben Jahrzehnt des Land zerrissen hatte, die Liberalen noch nicht geschafft. Hier herrschte noch römisch-katholische Gottesfurcht und der Pfarrer war die erste und letzte Instanz, von der Wiege bis zur Bahre. Der Katholizismus blieb hier Staatsreligion, möglicherweise sogar wegen der neuen Verfassung von 1848. Diese Religion ist Teil des Erbgutes der hiesigen Menschen; gleichgültig einer von nahen oder fernen Liberalen geschriebenen Verfassung. Und Muri, mit seinem monumentalen Benediktiner-Kloster, blieb auch nach der Aufhebung der Männerklöster gleichsam das geistlich-kulturelle Zentrum des Freiamtes.
Wiewohl Frühling, Sommer und Herbst das Freiamt in eine liebliche Landschaft verwandelten, war das Leben auf den kleinbäuerlichen Betrieben, die durch Erbgänge in immer kleinere Einheiten aufgeteilt werden mussten, hart und entbehrungsreich. Zehn-, oft mehrköpfige Familien mussten sich mit dem zufrieden geben, was die kleinen Felder an den sanften Abhängen der niedrigen, im oberen Teil bewaldeten Hügel hergaben. Getreide, Kartoffeln, Pastinaken, Kohl, Lauch und anderes, lagerfähiges Gemüse, das den harten Winter für Mensch und Tier übersteht. Wie jedes Jahr kam im Dezember der Störmetzger auf den kleinen Hof und schlachtete das während eines Jahres in einem dunklen Koben, bei Rüst-, Speise- und Ackerresten gemästete Schwein. Die eine Hälfte ging mit dem Metzger weg, die andere wurde gepökelt in den Kamin gehängt, wo Würste, Speck und Schinken ihrer Reife entgegen baumelten. Und - wie gesagt - Stroh wurde gelagert. Stroh war der Rohstoff für Gelderwerb, neben der Landwirtschaft, die nur knapp die vielköpfige Familie ernährte. Es wurde als Sommerroggen kurz vor der Reife gesichelt, zum Trocknen auf den Feldern ausgelegt oder bei schlechtem Wetter in Halmenbüscheln in der Scheune aufgehängt. Anschließend wurde der Rohstoff gespalten, geflochten und zuweilen gebleicht. Feine Frauen- und vor allem Kinderhände verarbeiteten die nunmehr geschmeidigen Strohhalme zu Hüten, Tressen oder Hutschmuck, der vom Zwischenhändler, dem Fergger, gegen Barzahlung abgeholt und an die Fabrikanten zur Weiterverarbeitung nach Wohlen geliefert wurde. Das Kunsthandwerk war im Freiamt in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zum weitherum gefragten Spitzenprodukt geworden, obwohl die Strohflechterei zu Beginn des Jahrhunderts noch unbekannt gewesen war und erst von den Mönchen des Stiftes Muri von ihren Pilgerreisen aus der Lombardei importiert worden war. Tausende Freiämter Bauernfamilien verdankten dem Nebenerwerb ihr Überleben während der harten Winter, die Fergger machten gute Geschäfte und für die wenigen Fabrikanten in Wohlen, immer auf der Suche nach noch günstigeren Produktionsmethoden, brachen goldene Zeiten heran. Gerne zeigten sie ihren aus Stroh geflochtenen Reichtum. Großzügige Villen hier, politische und wirtschaftliche Macht dort. Nicht dass Forderungen nach besserer Löhnung für die flechtenden Frauen und die Kinderarbeiter in den Himmel wüchsen. Die Fabrikanten sorgten dank florierenden Geschäften dafür, dass immer mehr Bauern zu Arbeitern wurden und das Bauerngewerbe immer öfter nur noch als Nebenerwerb betrieben werden konnte. Innert zweier Generationen wurden tausende von den Wohler Strohbaronen abhängig. In der ersten Blütezeit des Geschäftes, als man andernorts in der Schweiz die Armen auf Kosten der Gemeinde nach Amerika verschiffte, um sie loszuwerden, wurden im aargauischen Freiamt Strohflechtschulen eingerichtet, in denen die Kinder zwar schulisch auf der Unterstufe etwas mitbekamen, deren Zweck es aber war, eine möglichst hohe Qualität der Agréments – der Garnituren - und Schnürli zu sichern. Die Strohflechter verdienten so zuviel, um weggehen zu müssen und zu wenig, um hier bleiben zu wollen.
1
In Wiederkehrs Haus in Bünzen, auf einem noch ganz dem Bauernstand verpflichteten, die Strohflechterei nur als Nebenerwerb betreibenden Hof, herrschte schon zu früher Morgenstunde, noch bei Kerzenlicht, Aufregung in der feuchtkalten Küche. Der Ofen wollte nur zögernd Wärme verbreiten, nachdem er die Nacht hindurch bis zu einer schwach glimmenden Glut heruntergebrannt war. Die Milch blieb auf dem Herd länger kalt als sonst und die zehn Teller standen leer auf dem Tisch, weil die Rösti - Speck gab es nur für den zusammen mit dem erstgeborenen Sohn Hans-Rudolf und seinen mit ihm im Stall mit den Tieren beschäftigten Vater Rudolf – noch nicht parat war. Trotzdem war es eher eine fröhliche Aufregung. Die Küche war mit quirligem Leben erfüllt und die sechs Kleinen beobachteten von ihrer Eckbank aus das hektische Treiben. Anna-Katharina, die älteste Tochter, sollte zur längsten Reise einer Wiederkehr aufbrechen. Eine Reise, zu der noch am Vorabend in der Stube nebenan der Herr Pfarrer Hauser mittels eines eindringlichen Gebetes vor versammelter Familie seinen Segen erteilt hatte. Die siebzehn-, bald achtzehnjährige Anne-Käthi - wie sie alle nannten-, musste so vor dem in der unbekannten Groß-Stadt an jeder Hausecke, in jeder Gasse und auf jedem Platz lauernden Bösen bewahrt und deshalb dem Schutz des Allmächtigen anheim gestellt werden. Gerne hätte er seinerzeit die Tochter der streng gläubigen Familie in einem Kloster untergebracht. Der zweitgeborenen Tochter ohne Anspruch auf den Hof - und angesichts der weitherum grassierenden Armut mit schlechten Aussichten auf eine ‚gute’ Heirat - fühlte er sich, wie gegenüber der ganzen streng gläubigen Wiederkehr-Sippe, in der Pflicht. Aber die Wirren um die Klosteraufhebung im Aargau, die am Ende zwar zur Wiederzulassung von vier Frauenklöstern geführt hatten, dauerten zu lange, das kluge und bildhübsche Mädchen entwuchs der Primarschule, besuchte die Sekundarschule – was für ein Mädchen seines Standes schon eine Ausnahme war - und dann war es irgendwann zu spät für den Eintritt in eine Klosterschule.
So zeigte er sich am Palmsonntag des vorigen Jahres als höchst besorgter Seelsorger und Hirte einer von drohender Gefahr umgebenen Herde, als ihm Katharina, die Mutter, am Rande der Prozession eröffnete, der Vetter zweiten Grades, Basil, Sohn eines Onkels mütterlicherseits und Fergger aus Villmergen, habe ihr angeboten, Anne-Käthi bei einer hochkarätigen und ebenso anständigen und gläubigen katholischen Handelsfamilie, bedeutende Vertreter der Wohler Strohflechterei, in Paris unterzubringen. ‚Kost und Logis gratis, dazu ein Taschengeld und die Möglichkeit, französisch zu lernen.’ habe Basil ihr angeboten. Aber so richtig ablehnend zeigte sich der Pfarrer dann auch wieder nicht. Mit gewissen Vorbehalten und nach gebührenden „Nachforschungen über unser weit gespanntes Netz im Garten des Herrn“ könne er einen derartigen Aderlass in seiner Gemeinde wohl verschmerzen. Der Familie Wiederkehr sei sicher auch gedient, „wenn ein Mund weniger am Tisch sitzt“, meinte er geradezu aufmunternd zur Wiederkehr Katharina, während er frohen Mutes seinen die Prozession säumenden Schäfchen den Segen erteilte.
Und ein paar Wochen später, es ging schon gegen Fronleichnam zu, meinte er nach einer sonntäglichen Frühmesse zu Wiederkehrs: „Der Fergger-Bäsi kennt sich nicht nur in den hiesigen Fabrikantenkreisen aus, er weiß scheinbar auch, mit wem sie in Paris geschäften.“ stellte der Kirchenmann schmunzelnd fest. „Ich habe jedenfalls vom Curé der St. Eustache-Kirche – dem Benediktiner-Bruder Anselm, der aus St. Gallen stammt und übrigens Schweizerdeutsch spricht, - ganz vorzügliche Nachrichten erhalten, was die Handelsfamilie Fischer et Compagnie betrifft.“
Pfarrer Hauser, selbst ein ehemaliger Schüler im Stift Muri und noch vor dem Klosterstreit zum Benediktiner-Mönch geweiht, schilderte das Ergebnis der Recherchen seines Kirchenbruders in Paris.
„Ganz feine Leute sind das, ganz feine Leute. Der Handelsmann Fischer ist vor Jahren mit einem Musterbuch an Strohgeflechten nach Paris gereist und hat dort sofortigen Erfolg erzielt. Und mit dem geschäftlichen Erfolg“, Pfarrer Hauser unterbrach seine Schilderungen durch einen vernehmlichen Atemzug, „kam auch der private und gesellschaftliche, der ihn in die besseren Kreise habe aufsteigen lassen. Heute gehört er scheint’s zu den Lieferanten der Schneider, welche die Tüllerien beliefern“, wie sich der Pfarrer aus dem Freiamt ausdrückte. Selbstredend kam Pfarrer Hauser auch auf die christliche, genauer die römisch-katholische Gesinnung von Anne-Käthis künftiger Gastfamilie zu sprechen.
„Das sind ganz noble Leute. Madame Fischer ist eine De und entfernt mit der Marquise Latour Maubourg verwandt, welche wiederum unter den Hofdamen der Kaiserin eine Sonderstellung einnehmen soll. Am Sonntag sitzt die ganze Familie - Monsieur Fischer, Madame und ihre beiden halbwüchsigen Kinder, ein dreizehnjähriger Erstgeborener, seine zehnjährige Schwester und das Nesthäkchen, ein Dreijähriger, auf dem Schoss einer Kinderfrau - zuvorderst in der Kirche, immer auf denselben Plätzen, die nach ungeschriebenem Recht für sie reserviert sind. Madame sei sehr gebildet, heißt es, und halte zweimal monatlich einen Salon für Leute aus besseren Kreisen. Also alles in allem“, beschloss der Kirchenmann seinen Rapport über Anne-Käthis Gastfamilie, „eine sehr gute Adresse, an der unsere Tochter sehr viel lernen wird können. Und sie hat, wenn sie sich gut anstellt, vielleicht sogar Zugang zum Hof“.
Die von der Mutter weitererzählten Schilderungen des Pfarrers waberten jetzt ohne Sinn und Ordnung durch Anne-Käthis Kopf, während sie von der Stube zur Küche und von der Küche zum „Meitschi“-Zimmer im ersten Stock tigerte und wieder zurück in die Stube. Sie ergriff hier ein Kopftuch, dort eine Haarspange oder klaubte endlich die von der Mutter auf das Stubenbuffet gelegte Brosche, ein Erbstück von Großmutter Anna. Es war eine Elfenbeingemme, im Profil die in jungen Jahren während einer der häufigen Grippewellen Verblichene darstellend, deren Relief der zur Reise aufbrechenden Enkelin verblüffend ähnlich sah. Sie packte alles zusammen - das von einer Cousine geschenkte Sonntagskleid, etwas Wäsche, die auf dem letzten Monatsmarkt in Wohlen gekauften Hausschuhe für das Haus „feiner Leute“, (wie der spendierende Götti gemeint hatte), die mit einer Widmung versehene, ledergebundene Bibel, (ein Geschenk Pfarrer Hausers), und einigen Reiseproviant aus Rauchwurst, Speck und Roggenbrot - in die von einem Onkel väterlicherseits - er hatte es einmal bis nach Mailand gebracht, wo man Strohhüte studierte - geschenkte, lederne Reisetasche. Mutter Katharina versuchte zwischen dem Zubereiten des Frühstücks, dem Ruhighalten der Kleinen auf der Eckbank und dem Erteilen guter Ratschläge die Übersicht zu behalten und das Packen zu überwachen.
Das mit den Ratschlägen war freilich nicht so einfach. Es musste bei Frauenangelegenheiten und Benimmregeln bleigen, die, so sah es die Mutter, ihrer Tochter überall auf der Welt nützlich sein könnten. Und sonst? Was hätte sie, die, mit einer Ausnahme - der Hochzeit einer gut verheirateten Tante in Lenzburg - nie über Villmergen, wo sie aufgewachsen war, und das Freiamt hinausgekommen war, ihrer Tochter auf den Weg nach Paris schon mitgeben können? Die Bauersfrau, die acht Kinder auf die Welt gebracht hatte, vertraute ihrer Tochter und deren Verbundenheit mit den traditionellen Werten der Familie und der Kirche.
„Wenn du etwas nicht verstehst, wende dich immer an Herrn Fischer. Fragen kostet nichts und ist keine Schande. Und in moralischen Fragen gehst du zu Pfarrer Anselm, wie es unser Pfarrer empfohlen hat. Du musst mir schreiben und berichten, so oft es geht. Dann kann ich das mit Vater und Pfarrer Hauser besprechen und dir, wenn nötig, Ratschläge geben. Und du musst mir schreiben, wie die Kaiserin ist. Ob sie wirklich so schön ist, wie im Bauernkalender steht. Und ob sie Strohhüte trägt, auf denen unsere Strohschnürli und Agréments eingearbeitet sind. Und was die Leute dort essen. Und wie die Stadt ist. Und schau, dass du auf der langen Reise auch immer wieder etwas Ordentliches isst. In Straßburg holt dich ein Pfarrer aus der Münster-Pfarrei am Bahnhof ab. Du übergibst ihm den Brief von Pfarrer Hauser. Er gibt dir Kost und Logis für eine Nacht und wird dich anderntags zur rechten Zeit auf den Zug bringen. Und im Zug nicht am Fenster sitzen. Es zieht und es ist jetzt kalt und der Rauch dringt überall ein. Halte immer ein Tuch vor Nase und Mund. Die Familie Fischer hat dir den Platz in den Kutschen und Zügen reserviert. Die Wohler Verwandte der Fischers in Paris gibt dir dann noch französisches Reisegeld und natürlich die Billette, wenn du in Wohlen in die Postkutsche nach Aarau steigst. Ach ja, und hier noch dein Reisepass. Das ist dein wichtigstes Dokument. Pass gut darauf auf.“
Mutter Wiederkehr redete pausenlos auf ihre Tochter ein. Sie versuchte, das ihr in den letzten Wochen und Monaten - seit bekannt geworden war, dass Wiederkehrs Anne-Käthi als Au Pair-Meitschi nach Paris gehen würde - auf den Märkten und nach Kirchenbesuchen zum Thema Paris seitens weltläufigerer Verwandter und Bekannter Gehörte und Gesagte oder bei Stadtbesuchen in illustrierten Blättern Gelesene als Reiseratschläge mitzugeben. Aber Anne-Käthi, damit beschäftigt, um die ansehnliche Ledertasche herum einen kräftigen Ledergurt als doppelte Sicherheit gegen Diebstahl oder plötzliches Aufschnappen zu zurren und den Nickelstift mit einem Ruck in das engst mögliche Loch gleiten zu lassen, hörte ihrer besorgten Mutter nur mit einem Ohr zu. Sie wie war berauscht und fühlte sich wie von einem Sog in eine noch unbekannte Welt gezogen. Da kündigte sich vor dem kleinen Bauernhaus mit Hoh-Hoh-Rufen und dem hellen Schellen der mit Glöckchen behängten Kummet seines Zweispänners der Fergger-Bäsi an, um seine Nichte für die Reise ins Unbekannte abzuholen.
Als der Vetter die Küche unter herzlichem ‚Willkomm’ betrat, saß die ganze Familie am Tisch und frühstückte wie an jedem normalen Tag. Vater Rudolf und der Älteste, Hans-Rudolf, schaufelten am oberen Tisch-Ende herzhaft die Rösti in sich hinein. Die Arbeit im Stall und bei klirrender Kälte verlangte nach Energiezufuhr. Der Reihe nach schlürften die Kleinen auf ihrer Eckbank aus den Milchkacheln die nun warme Milch und tunkten dunkles Brot hinein. Mutter Wiederkehr schöpfte nach und aß im Stehen den einen oder anderen Bissen. Auch der Vetter aus Villmergen wurde zu Tisch gebeten und langte herzhaft zu. Nach einer Viertelstunde, während der für Momente außer dem Schmatzen und Schlürfen kein Wort fiel und die elf Menschen in eine beinahe feierliche Stille eingehüllt wurden, war alles bereit für den großen Moment, der, wie bei den kleinen Leuten üblich, ganz kurz und ohne Pathos vorüberging.
Nach Tränen und Umarmungen bestieg Anne-Käthi schließlich den gedeckten Zweispänner, den der Fergger-Bäsi bereits gewendet hatte, um über Boswil zügig Richtung Wohlen abzufahren. Es war sechs Uhr. Die Nacht hatte ihre schwarze Decke noch nicht über den Westen abgezogen und dem Tag im Osten erst ein gräuliches, ins Lachsfarbene spielende Dämmern eingestanden. Ein kurzes Zungenschnalzen des Kutschers und die stämmigen Haflinger stampften schnarrend durch die schneebedeckte Zufahrt davon. Schon nach wenigen Metern war die kleine Kutsche aus dem spärlichen Lichtkegel der wiederkehrschen Küche verschwunden. Schon bald wurde Anne-Käthi von der Nacht verschluckt. Der Lichtkegel vor dem sich schemenhaft abzeichnenden Haus verengte sich und verschwand plötzlich wie das Licht einer ausgehauchten Kerze. Man sah das Winken der Abreisenden nicht mehr. Und die Tränen der Mutter fielen ungesehen auf den gefrorenen Boden.
2
Nach einer Kutschenfahrt durch den knarrenden Schnee, während der sie sich in einem Gasthof an einer heißen Suppe aufgewärmt hatten, erreichte das Gespann Wohlen. Es ging auf zehn Uhr zu und auf dem zentralen Marktplatz, der zugleich Ankunfts- und Abfahrtsort der Postkutschen nach Süden und Norden sowie nach Westen und Ost war, herrschte viel Betrieb. Vetter Basil machte sein Gespann beim Fuhrhalter fest, wo er auch Hafer für seine beiden Haflinger-Pferde bekam.
Die Postkutsche nach Aarau war leicht zu finden. Sie war mit zehn Plätzen, Gepäckträgern auf dem Dach und am Heck, der mit verschließbaren Fenstern versehenen Fahrgastkabine, die imposanteste auf dem Platz und mit acht vorgespannten Pferden die schnellste, die Richtung Aargauer Hauptstadt - vor ein paar Jahren noch Hauptstadt der Schweiz - abging. Der Vetter aus Villmergen trug seiner Base aus Bünzen die Tasche. Sie steuerten auf eine bemerkenswert elegant gekleidete Dame zu, die ihnen quer über den Platz entgegenzukommen schien. Sie stellte sich als Emilie Fischer vor und war die Schwester des Herrn Fischer in Paris. Gleichzeitig war sie seine Geschäftspartnerin in Wohlen, wo sie die Fabrikation in den stetig ausgebauten eigenen Werkstätten leitete. Sie war auch die Abnehmerin der Schnürli und Garnituren, welche von hunderten Bauernfamilien an die Fergger geliefert wurden. Die besonders fein gearbeiteten, ja fast „gestickten“ Agréments der Familie Wiederkehr hatten schon lange ihr Interesse geweckt, weshalb sie beiläufig den Fergger Basil nach Name und Herkunft dieser perfekten Arbeiten fragte. Der Mann mit dem lockeren Mundwerk – sein wichtigstes Arbeitsinstrument - erzählte darauf der Fabrikantin sämtliche Details aus dem Familienleben der ärmlichen Familie aus dem Bünztal.
Als sich dann, vor einem guten halben Jahr, ihr Bruder während des letzten Besuchs in Paris, vor allem aber dessen Frau adliger Herkunft, über die Schwierigkeiten auf der Suche nach Hauspersonal, das „honnête et éduqué“ sei, ausließ, brachte Emilie das „Mädchen aus Bünzen“ ins Spiel. Selbst einmal als Au-Pair-Mädchen bei einer gut situierten Arzt-Familie im schweizerischen Welschland zum Sprachaufenthalt im Tausch zum Kinderhüten geschickt, fiel es ihr nicht schwer, der Bauerntochter diese einmalige Gelegenheit zu verschaffen. Dies umso mehr, als die geschäftstüchtige Mittdreißigerin ledig geblieben war, keine Kinder hatte - auch keine haben wollte - und sie und ihr Bruder die einzigen Überlebenden des Fischer-Klans geblieben waren. So konnte sie Gutes für ein Mädchen aus einer Familie tun, die es nötig hatte. Emilies Interessen galten ansonsten dem Geschäft, der Kunst, der Mode und damit dem Paris des zweiten Kaiserreiches, das sie jedes Jahr mindestens zweimal besuchte. Ihr Ruf als modernste und eleganteste Frau reichte weit über das Freiamt hinaus; man sprach sogar in Aarauer und in Badener Gesellschaften in neidischem Unterton von der Strohwitwe aus dem Freiamt, die jeden Frühling und Herbst mit dem Neusten vom Pariser Hof zurück käme.
Aber davon wusste Anne-Käthi nichts, denn in ihrer Familie gab es Wichtigeres, als auf Gerüchte aus den besseren Kreisen zu achten. Doch sie war von der eleganten Dame im pelzbesetzten und in die Taille geschnittenen schwarzen Mantel und in ebenso eleganten Stiefeln sehr beeindruckt; wie umgekehrt Emilie Fischer das schüchterne, hoch aufgeschossene blonde, kornblumenäugige Mädchen vom Land auf Anhieb ins Herz schloss.
„Der Basil hat nicht gelogen, als er mir von dir berichtet hat“, begrüßte Emilie das Mädchen aus dem Bünztal und ihren Vetter. „Du bist ein hübsches Mädchen und ich bin sicher, du wirst meinem Bruder und seiner ganzen Familie in Paris gefallen. Lass uns schnell dein Gepäck dem Postkutscher geben und dann gehen wir ins Gasthaus und wärmen uns an einem währschaften Frühstück auf. Abfahrt ist in einer knappen Stunde, nicht wahr Kari?“ fragte sie den mit der Kontrolle des Pferde-Geschirrs beschäftigten Kutscher, den sie offenbar persönlich gut kannte.
„Jawoll, Fräulein Fischer, um Elf geht’s los.“ antwortete der Kutscher dienstbeflissen.
Anne-Käthi, die ob der Freundlichkeit der vornehmen Dame ganz verlegen wurde, kam nicht einmal dazu, ein Wort zu sagen. Emilie hatte gleich das Kommando übernommen, da galt es, einfach zu nicken und zu folgen. Während der Kutscher Anne-Käthis Reisetasche im hinteren Gepäckraum verstaute, überquerten die drei den verschneiten Platz und stapften zum Gasthaus Sternen. An einem Fenster mit Blick auf den Marktplatz war ein Tisch für drei Personen gedeckt. Emilie steuerte geradewegs darauf zu und rief nach dem Wirt. „Hannes, wir wären jetzt da.“ Emilie Fischer schien hier alles und jeden zu kennen, und es gab keinen Zweifel daran, wer das Sagen hatte. Es gab Gerüchte über das solitäre, kinder- und männerlose, aber keineswegs traurige Leben der mondänen Frau. Aber niemand wusste etwas Genaues, zudem machen in einer durch und durch katholisierten Gesellschaft, wie jener im Freiamt, schnell einmal Gerüchte die Runde, wenn jemand nur ein Jota von der Norm abweicht. Vor allem, wenn es ums Familiäre oder genauer ums Intime geht. Da aber für das Moralische und Sittliche sowieso der Pfarrer zuständig war, fand man sich damit ab, dass Emilie irgendwie von der Norm abwich. Im übrigen beschäftigte sie jedes Jahr mehr Leute aus der Gegend und sicherte ihnen Brot und Leben. Das war für die einfachen Leute, was zählte.
Eilfertig begannen der Sternen-Wirt und seine Serviertochter, ein reichhaltiges Frühstück aufzutragen. Nebst Kaffee, Tee, Milch standen im Handumdrehen Schinken, Wurst, Butter, Käse, Konfitüren, ein Zopf, ein dunkles und ein helles Brot auf dem Tisch. „Speck und Ei kommen sofort, Frau Fischer.“ bemerkte der Wirt und verschwand in der Küche.
Anne-Käthi kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht nur, dass sie noch nie in einem Wirtshaus, geschweige denn in einem derart noblen Gasthaus eingekehrt war; sie hatte auch noch nie eine so reichhaltige Tafel vor sich gehabt – und das nur schon zum Frühstück!. Das alles erstaunte sie im höchsten Grad, gewiss. Aber es war da noch etwas anderes. Es war dieses Drum-und-Dran, das mit Emilie Fischer zu tun hatte. Diese unglaublich starke Geschäftsfrau, die alles um sich herum zu dominieren schien, machte auf das Bauernmädchen mächtig Eindruck. So jemandem, der auch noch ausnehmend freundlich zu ihr war, war sie noch nie begegnet.
Emilie langte herzhaft zu und forderte ihre beiden Gäste auf, es ihr gleich zu tun. Basil und Anne-Käthi ließen sich nicht zweimal bitten. Und während sie aßen, begann Emilie von Paris zu erzählen. Allein ihre Begeisterung für die aufstrebende Stadt der Lichter, der Kunst und der Mode entfachte in Anne-Käthi eine unbändige Vorfreude, die mit den strengen Hinweisen auf die Pflichten eines Au-Pair-Mädchens kaum getrübt werden konnte.
Unvermittelt griff Emilie in ihre Tasche und holte daraus ein dickes, kleinformatiges Buch hervor. „Das habe ich für dich besorgt, Anne-Käthi. Du kannst es sicher schon auf der Reise gebrauchen. Es ist ein kleiner Larousse, ein deutsch-französisches Wörterbuch. Ich bin sicher, dass er dir oft eine wertvolle Hilfe sein wird. Mir ist es jedenfalls zu meiner Zeit so ergangen, als ich selber ein Jahr lang Au-Pair-Meitschi in Genf gewesen bin.“
„Danke Fräulein Fischer, danke vielmals.“ brachte Anne-Käthi, immer noch ganz verlegen, hervor. „Frau Fischer ist auch recht.“ erwiderte Emilie beiläufig, Anne-Käthi verstand nicht so recht.
„Aber das ist noch nicht alles.“ fuhr die Geschäftsfrau aus Wohlen fort. „In der Postkutsche ist bereits ein Paket verstaut. Der Kari weiß Bescheid. Es ist ein länglicher Lederzylinder, in dem eine ganz wichtige Arbeit steckt, die du bei der Ankunft meinem Bruder überreichen musst. Wenn du nicht nach Paris fahren würdest, hätte ich es selber überbringen müssen; aber der Betrieb hier in Wohlen braucht mich gerade jetzt. Hier,“ sie zauberte einen Briefumschlag hervor, „sind die nötigen Papiere, falls man dich an der Grenze dazu befragt. Hüte das Paket ab Aarau, wo du auf die Kutsche nach Olten umsteigen wirst, wie deinen Augapfel. In Aarau übergibt dich der Kari einer Frau Herzog, die dich dort erwartet und dir ein Nachtlager bereitet hat. Herr und Frau Herzog sind sehr gute und treue Freunde unserer Familie, du hast da nichts zu befürchten. Ab jetzt hast du also zwei Gepäckstücke, deine Tasche und eine Flechtarbeit aus Stroh. Das ist nämlich der Inhalt des Zylinders. Und hier,“ sie griff nochmals in ihre scheinbar unendlich tiefe Tasche, „sind die Billette für die Kutschen und hier für die Bahn. Wir haben dir 2. Klasse-Billette ab Liestal besorgt, in der dritten Klasse tummeln sich allerlei Leute, weißt du...“ sie beendete den Satz nicht.
„Ja, Fräulein Fischer.“ antwortete Anne-Käthi etwas eingeschüchtert von der ihr anvertrauten wichtigen Mission.
Während der ganzen Zeit saß Basil mit am Tisch und beschäftigte sich mit den Frühstücksleckereien, ohne auch nur ein einziges Mal an der Unterhaltung teilzunehmen. Es wurde seitens der dynamischen Emilie wohl auch nicht erwartet, denn Auftragnehmer wie Basil, der die Flechtarbeiten bei den Bauernfamilien einsammelt und im Namen der Firma Fischer neue Aufträge verteilt, hatten ihre Pflicht zu tun und sonst nichts.
Langsam wurde es Zeit für den Aufbruch. Kari hatte bereits ein erstes Mal in sein Posthorn geblasen, um die in verschiedenen Gaststätten verstreuten Passagiere auf die baldige Abfahrt aufmerksam zu machen. Anne-Käthi bedankte sich förmlich aber aufrichtig bei Emilie Fischer für die Ratschläge und ihre Berichte aus Paris. „Ich werde ganz gewiss auf das Paket aufpassen und es dem Herrn Fischer abliefern.“ versprach sie dessen Schwester beim Einsteigen. Basil drückte ihr durch das vor der Abfahrt noch heruntergelassene Fenster zum Abschied die Hand. Und Emilie rief ihr, verzaubert durch ein breites Lachen, zu: „au revoir, Anne-Catherine, et bon voyage.“, was Anne-Käthi noch nicht wirklich verstand.
Der Himmel hatte aufgeklart. Ein strahlender Wintertag bildete den Rahmen zum Auftakt der Reise, die sie bis zum frühen Abend nach Aarau führte. Auf dem Marktplatz, gegenüber dem vormaligen Bundeshaus, wo sich die aus allen Himmelsrichtungen eintreffenden Postkutschen einfanden, wartete bereits die für diesen Zweck von Emilie Fischer aufgebotene Freundin der verstorbenen Eltern und jetzt jene der verwaisten Geschwister, mit einem Gehilfen, der von Kari die beiden Gepäckstücke entgegennahm. Nur wenige Schritte von der Postkutschenstation entfernt betraten sie ein nicht unbescheidenes, mehrstöckiges Stadthaus, in dessen Innenhof eine private Kutsche stand, derweil die Pferde in dem den Innenhof umgebenden Hausgeviert befindlichen Stall untergebracht waren. Die von Emilie als Tante bezeichnete Frau, die sich wegen der Kälte und der hereingebrochenen Dunkelheit um eine kurze Begrüßung bemühte, hatte sich als Frau Herzog vorgestellt. Sie beantwortete die fragenden Blicke des Mädchens aus dem Bünztal noch bevor sie zur Freitreppe kamen. Diese führte in die Beletage des eigentlich als Stadtpalais zu bezeichnenden Gebäudes hinauf. „Morgen wirst du von Friedel,“ der neben ihr gehende Gehilfe nickte beflissen, „mit meiner Kutsche nach Olten gefahren. Darin bist du und das Paket von Emilie in Sicherheit. Außerdem ist es dann nicht so eng, wie in der Postkutsche. Ich gebe dir neben Friedel und seinem Gehilfen auf dem Kutschbock noch Fräulein Herosé mit, die auf dich aufpassen wird und schaut, dass ihr unterwegs etwas zu Essen bekommt. Sie wird dich in Olten unterbringen, von wo du übermorgen mit der Postkutsche nach Liestal weiter fahren wirst. Von dort aus wirst du dann mit dem Zug weiter reisen.“
Anne-Käthi bekam von Aarau nicht viel mit, obwohl sie sich noch zu Hause in Bünzen fest vorgenommen hatte, nichts von der alten Hauptstadt verpassen zu wollen. Aber es war Abend geworden. Nur wenige Lichter aus Gaststätten und Privathäusern und noch weniger Straßenlaternen warfen ihr dürftiges Petrollicht in winzigen Lichtkegeln auf die Straßen. Und einmal im Palais der Frau Herzog – sie schien, vom Hauspersonal abgesehen, allein in dem herrschaftlichen Haus zu leben, deren Anzahl Zimmer Anne-Käthi nicht überblicken konnte – wurde rasch zu Tisch gebeten, um gleich anschließend schlafen zu gehen. Frühmorgens wurde sie durch Fräulein Herosé geweckt. Reichliches Frühstück, und schon galt es, die Reise nach Olten unter die Räder zu nehmen.
Das einzige, was Anne-Käthi im Gedächtnis behielt, war ein riesiges Porträt eines streng blickenden uniformierten Mannes, das den in dunkles Holz verkleideten Frühstücksraum beherrschte, wo sie, Frau Herzog und Fräulein Herosé gemeinsam die erste Mahlzeit des Tages einnahmen. Und natürlich das Schlafzimmer! Zum ersten Mal in ihrem Leben schlief sie allein in einem eigens für sie bereiteten Schlafzimmer, das zudem mit einem Wasserkrug und einer Waschschale ausgestattet war und von dem man aus einem Nebenraum direkten Zugang zu einer Toilette hatte. Auch dieses Zimmer war mit Holz ausgelegt und an der Decke prangten kunstvolle Stuckaturen, die in den Ecken der Zimmerdecke sich in gipserne Engelchen verwandelten, die das Mädchen vom Land in den Schlaf gewiegt hatten.
Die Fahrt nach Olten dauerte einen halben Tag, verlief ohne Zwischenfälle und bei weiterhin schönstem Winterwetter. Die Gegend zwischen Aarau und Olten, durch die der Aare-Fluss in weiten Bögen mäanderte, hatte sich durch die weiße Decke und am Fuß des verschneiten Jura-Südfußes in eine Märchenlandschaft verwandelt. In Schönenwerd hatten sie im Gasthof Storchen Halt gemacht, wo eine kräftige Suppe eingenommen wurde, um kurz darauf die Fahrt nach Olten, dessen gedeckte Holzbrücke man gegen Mittag befuhr, fortzusetzen. Im Hotel Krone, just außerhalb der befestigten Stadtanlage mit Toren am östlichen Ufer, unmittelbar vor der Holzbrücke und im Westen, Solothurn zu, wurde abgestiegen und Fräulein Herosé sorgte sich ums Zimmer und alles andere. Auch Fräulein Hérosé schrieb sich im Hotel ein und nahm ein Zimmer; sie musste dafür von Frau Herzog, diese wiederum von Emilie Fischer, die Anweisung erhalten haben, das Mädchen bis zum Besteigen der Postkutsche nach Liestal zu begleiten.
Den Nachmittag nutzten die beiden jungen Frauen für einen kurzen Bummel durch die Stadt an der Aare. Der Kern der Stadt, innerhalb der Stadtmauern, war recht klein und nur gerade von zwei Gassen durchquert. Gasthäuser und enge Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie einige Wohnhäuser und das Spital reihten sich aneinander. Ein paar nicht sehr ansehnliche Wohnhäuser säumten einen Platz, auf dem nur noch der Turm stehen geblieben war, nachdem die dazu gehörende Kirche ersatzlos abgebrochen worden war. Außerhalb des engen Zentrums öffnete sich der Ort jedoch. Wo sich die Krone befand, weitete er sich zu fast großstädtischem Gehabe. Der längliche Marktplatz, der auf der Südseite durch elegante Bürger-Häuser und rechterhand von der neuen katholischen Stadt-Kirche gesäumt wurde, war das neue Zentrum außerhalb der alten Gemäuer.
Das frühe Abendessen nahmen sie in der Krone ein, wo ihnen der Wirt Johann von Arx ein besonders leckeres Nachtessen mit geräuchertem Salm aus der Aare als Vorspeise und einem eingelegten Hasen „aus eigener Jagd“, wie er stolz verkündete, zubereiten ließ. Doch obwohl sich Wirt von Arx alle Mühe gab, den beiden durchreisenden Fräuleins den Aufenthalt durch eine gastronomische Spitzenleistung zu verschönern, wollte keine richtige Stimmung im fast leeren Restaurant aufkommen. Die wenigen Gäste sprachen leise, flüsterten fast, trugen alle Schwarz und an der Wand gegenüber dem Eingang hing ein trauerumflortes Porträt eines schmächtigen, sehr ernst dreinblickenden Mannes. Er war der bedeutendste Sohn der Stadt, Josef Munzinger, der vor wenigen Tagen in der Hauptstadt Bern während der Wintersession der eidgenössischen Räte im Amt verstorben war. Er hatte als als einer der Begründer, ja als Kopf des liberalen Staates Schweiz gegolten und war somit folgerichtig Mitglied des ersten schweizerischen, rein liberalen Bundesrates geworden. „Gestern hatten wir hier, gegenüber in der Stadtkirche, den Staatsakt. Es war sehr traurig, wissen Sie, gnädige Fräuleins, denn der Josef war auch einer meiner engsten Freunde gewesen.“ Von Arx, dem die Augen immer wässeriger wurden, wandte sich unter dem Vorwand, in der Küche gebraucht zu werden, eilig von den beiden jungen Damen ab. Fräulein Herosé erklärte hierauf dem völlig ahnungslosen Anne-Käthi, dass auch sie „gewissermaßen indirekt“ in die „Sache“ verwickelt sei, denn ihr Oheim, Friedrich Frey-Herosé sei ja einer der Regierungskollegen des Verstorbenen gewesen. Anne-Käthi war beeindruckt von den weltläufigen Beziehungen ihrer Begleiterin, verstand aber kein einziges Wort von der „liberalen Bewegung“, die das Land regierte und der die genannten Politiker angehören würden. Sie konnte auch nicht ahnen, dass der verstorbene Munzinger, schwerkrank, buchstäblich bis zum Tode im Amt bleiben musste, weil es für ihn weder eine Pension noch eine Art Abfindung für geleistete Dienste gegeben hätte. So erhielt seine Witwe wenigstens ein Gnadenbrot der Eidgenossenschaft. Außer Frage steht freilich, dass Pfarrer Hauser im heimischen Bünzen wohl mehrere Vater Unser und darüber hinaus auch noch den Rosenkranz vor- und rückwärts gebetet haben würde, wenn er auch nur einen Hauch davon verspürt hätte, in welch gotteslästerliches Quartier sein ehemaliger Schützling bereits am zweiten Tag der von ihm gesegneten Reise gelandet sei. Immerhin, er wäre unschuldig gewesen, denn seine schützende Hand würde erst ab Frankreich über dem Mädchen aus Bünzen schweben. Bis Basel waren die Unternehmer aus Wohlen und deren Freunde die Beschützer.
Anderntags wurde bei tiefster Dunkelheit aufgestanden und zur Abreise gerüstet. Die Postkutsche, in einer nahen Fuhrhalterei angeschirrt, stand nun vor der Krone, deren Gaststubenlichter den Vorplatz schwach beleuchteten. Hier stiegen ein halbes Dutzend Passagiere ein und Fräulein Herosé regelte mit dem Kutscher und seinem Gehilfen die Gepäckfrage, wobei sie ganz besonderen Wert auf den Lederzylinder mit seinem delikaten Inhalt legte. Beiden reichte sie ein fürstliches Trinkgeld zum Kutschbock hinauf, was ein breites Lächeln auf die wettergegerbten Gesichter der Fuhrmänner zauberte und das für einen Moment den Kronenplatz in ein strahlendes Licht zu tauchen schien. „Sie sorgen dafür,“ sagte Fräulein Herosé in einem für ihre zierliche Erscheinung unerwartet befehlsmäßigen Ton, der keinen Widerspruch dulden würde, “dass meine Nichte“, sie sagte ohne jede familiäre Beziehung zum Freiämter Bauernmädchen tatsächlich Nichte, vermutlich um die Verbindlichkeit ihrer Anweisung zu unterstreichen, „pünktlich und mit allem Gepäck in Liestal in den Zug steigt.“ „Verstanden, gnädiges Fräulein“, sülzten die beiden Hartgesottenen vom Kutschbock herab. Um Sieben, die rechter Hand liegende Stadt tauchte aus einem blau-grauen Wintermorgen auf, gab der Kutscher mit einem Peitschenknall den sechs Pferden den Befehl, die schneebedeckte Straße Richtung Liestal unter die Hufe zu nehmen.
Das Tageslicht gab die Blicke der Reisenden auf einen von Wolken verhangenen, Schnee verheißenden Tag frei. Die Handvoll Fahrgäste, die sich nebst Anne-Käthi in der Kutsche befanden, schienen die Gegend wohl zu kennen, und machten sorgenvolle Bemerkungen über den weiteren Verlauf der Reise, insbesondere was den gerade begonnenen Aufstieg zum Hauenstein-Pass betraf. „Wenn es erst dann zu Schneien beginnt, wenn wir in Läufelfingen sind, ist es mir gleich.“ meinte eine eher korpulente Dame, die geschäftlich in Liestal zu tun zu haben schien. Ein sehr gepflegter Mann mit Backenbart und in pelzgefüttertem, dickem Mantel, der seine Erscheinung noch imposanter machte, fügte an: „Das alles wird uns in Zukunft erspart bleiben, wenn endlich die Bahn von Liestal bis nach Olten kommt. Gestatten, Riggenbach Niklaus mein Name. Ingenieur. Bahningenieur.“ Und wie er im Laufe der Fahrt über den kurvigen Pass berichtete, sei er nach Basel unterwegs, um dort mit Banken und befreundeten Unternehmern Gespräche über die Linienführung einer künftigen Centralbahn durch, „ich betone durch den Hauenstein“ zu diskutieren. „Alles eine Frage der Ingenieurskunst, wir werden das meistern. Die Werkstätten, soviel ist heute schon sicher, werden jedenfalls in Olten entstehen“ unterstrich er. Die Kutsche hatte gerade die auf neunhundert Meter über Meer liegende Passhöhe erreicht; es schneite noch nicht, aber durch die Fenster war kaum mehr als ein düsteres Grau, unterbrochen von schwarzen Baumgerippen, zu erkennen. Und als man, schon fast wieder im flachen Gelände, in Läufelfingen, die Pferde wechselte, war im Innern der Kutsche ein Aufschnaufen zu vernehmen.
Auf der Nordseite des Hauenstein-Passes lag viel weniger Schnee als noch zuvor auf der Passhöhe, auf der Südseite und im ganzen Flachland. Die Landstraße war hier bereits schneefrei. Im oberen Baselbiet, wie man die Gegend hier bezeichnete, waren nur noch die nach Norden ausgerichteten Wiesen und Wälder von weißem Schaum bedeckt. Es ging nun zügig voran und in wenigen Stunden erreichte die Postkutsche Punkt sechzehn Uhr den Hauptort des nach langen, religiös bedingten Wirren von der liberalen Stadt Basel getrennten ländlich-konservativen Halbkantons Basel-Land. Doch der liberale Wind und die damit einhergehende wirtschaftliche Dynamik hatte auch die frühere Poststation Liestal erreicht. Der Ort war jetzt Bahnstation und vorerst Endstation der Bahnlinie, die von der Grenze zu Frankreich in die Schweiz führte. Die Postkutschen hielten nun nicht mehr im engen Städtchen zwischen den zwei Stadttoren sondern am etwas südlich der Stadtmauern gelegenen Bahnhof. Der Ort war im Aufbruch und für die nahen Tonwerke die Eisenbahn der Schlüssel für eine blühende Zukunft. Die gebrannte Ware konnte so schneller und billiger an eine stets wachsende Kundschaft in der Nordschweiz und im nahen Elsass geliefert werden. Der Bahnhof Liestal war denn auch eher ein Verladebahnhof als ein Ankunfts- und Abfahrtsort für Reisende. Täglich verkehrten drei Personenzüge von und nach Basel: am Morgen am Mittag und am Abend.
Anne-Käthi hatte sich mit dem eleganten und gesprächigen Herrn Riggenbach während der fast zehnstündigen Fahrt auf eine gewisse Art angefreundet. Sie schien die einzige der Postkutschen-Reisenden zu sein, die sich für das Wissen des Ingenieurs um künftige Bahnlinien, Geschwindigkeiten der Dampflokomotiven oder Tunnelbauten und so weiter interessierte. Immer wieder hatte sie ihm Fragen gestellt, die er gerne beantwortete. Unbeabsichtigt konnte sie sich nun an der Bahnstation Liestal ganz auf ihren sachkundigen Begleiter verlassen. Kaum der Kutsche entstiegen – Riggenbach half der jungen Dame, die er nun Mademoiselle nannte, weil sie ihm von ihrer Reise nach Paris erzählt hatte, galant beim Abstieg von der Kutsche - rief er Träger herbei, die nicht nur sein Gepäck sondern auch Anne-Käthis Tasche und Lederzylinder in sein reserviertes 1. Klasse-Coupé nach Basel verfrachten sollten. Den etwas ängstlichen Hinweis, dass sie nur ein Billett 2. Klasse habe, wischte der Backenbärtige mit einer Handbewegung und der von einem verschmitzten Lächeln begleiteten Bemerkung weg:, „Lassen sie das nur meine Sorge sein, Mademoiselle.“ Noch vor der Abfahrt führte Riggenbach das neugierige Mädchen um den Zug herum und erklärte ihr die Bahntechnik und das Funktionieren der Dampflokomotive, die furchterregend, scheinbar aus allen Löchern dampfte und zischte. Anne-Käthis Gefühlslage schwankte zwischen Angst und Staunen. Noch nie hatte sie ein solches Ungetüm gesehen, das, so der Ingenieur an ihrer Seite, „mit dreißig Kilometern in der Stunde mit fünf angekuppelten Wagen nach Basel rasen“ werde.
Kurz darauf bestiegen sie ein bequemes Abteil mit dick gepolsterten, hohen Sesseln im 1.Klasse-Wagen. Ein eiserner Ofen am vorderen Ende des Wagens strahlte Wärme aus, die über eine durchgehende Öffnung zwischen Wagendecke und Abteilwänden in alle Abteile verteilt wurde. Es war angenehm warm. Anne-Käthi und Riggenbach waren allein im Abteil und es schien, als ob dieses tatsächlich für den Mann aus Olten reserviert sei, auch wenn sichtbar nichts darauf hinwies. Punkt Siebzehn Uhr ertönte ein schauerlicher Pfiff aus der Lokomotive. Anne-Käthi erschrak, Riggenbach lachte und der Zug bewegte sich ruckweise bis er regelmäßige Fahrt aufgenommen hatte.
Die Fahrt durch das untere Baselbiet, der unbekannten Stadt Basel zu, war für Anne-Käthi eine Fahrt wie durch ein fremdes Land. Anfänglich noch bei rasch schwächer werdendem Tageslicht sah man links und rechts landwirtschaftlich geprägte Bilder mit jetzt schneefreien Feldern, die noch ungebrochen auf die Pflüge der Bauern warteten. Nach den ersten beiden Haltestellen, an denen Leute in Gehröcken und Mänteln, bewehrt mit Regenschirmen und kleinem Gepäck zustiegen, verschwand zwar das Tageslicht, dafür gab es immer mehr Lichter, die in kurzen Abständen ganze Straßenzüge beleuchteten; Häuser waren von unten bis oben mit beleuchteten Fenstern besetzt, vorstädtisches Leben kündigte die Großstadt an. Gelegentlich gab Niklaus Riggenbach Erklärungen ab, um der noch unerfahrenen Reisebegleiterin von Basel und seiner im Aufbau befindlichen Industrie zu erzählen. Er sprach von Seidenbandfabriken, von neuen Erfindungen in der Farbenherstellung, wofür nun ebenfalls Fabriken entständen. Schemenhaft waren riesige Gebäudehallen zu erkennen, aber Anne-Käthi konnte damit nicht viel anfangen. Als der Zug in den Bahnhof von Basel einfuhr, herrschte für das Mädchen aus dem Freiamt ein unglaubliches Treiben, das von Dampfschwaden und Rauchfahnen ein- und ausfahrender Züge, von Pfiffen und Zischen, von Befehlen und Rufen in unbekannten Sprachen und von einer in Anne-Käthis Augen noch nie gesehenen Menschenmenge brodelte und dem Mädchen aus Bünzen fast den Verstand raubte. Zum Glück durfte sie sich an den weltgewandten Riggenbach halten, der gerade Gepäckträgern befahl, sein Gepäck und jenes des Mädchens zu einer bereits auf ihn wartenden, vor Kälte und Unwetter geschützten, geschlossenen Droschke vorauszutragen. Denn wie der Zufall es wollte, hatten beide dieselbe Adresse in Basel. Anne-Käthi hatte ihrem Beschützer schon kurz nach Liestal den Zettel gezeigt, den ihr Emilie in Wohlen, zusammen mit den anderen Papieren zugesteckt hatte. Hotel Les Trois Rois stand darauf. Und Riggenbach stellte staunend und erfreut fest: „Mein Stammhotel, wenn ich in Basel bin.“ Es war auch, was Anne-Käthi nicht wissen konnte, das Stammhotel der Fischers, wenn sie jeweils von hier aus nach Paris weiter reisten. Und wie sich bald zeigen würde, waren die Fischers im Hotel wohlbekannt.
In der Hotel-Halle verabschiedete sich der freundliche und hilfsbereite Riggenbach von seiner jugendlichen Begleiterin und entschwand „für ein Geschäftsessen“, und entschuldigte sich für seinen raschen Abgang. „Ich wünsche Ihnen, verehrte Mademoiselle, eine gute Weiterreise nach Paris. Und dort wünsche ich Ihnen eine unvergessliche Zeit und viel Glück beim Französischlernen.“ Er geleitete sie zum Concierge und überließ sie dessen Obhut. Sie sollte erst viele Jahre später wieder etwas von diesem Niklaus Riggenbach hören.
Anne-Käthi überreichte dem Mann mit den Schlüsseln auf dem Revers der schwarzen Uniform einen Brief, den Emilie vorbereitet hatte. Der mit mindestens hundertneunzig Zentimetern fast alle und alles überragende Mann hinter der Empfangstheke und vor dem beeindruckenden Schlüsselbord öffnete den Brief als ob er jeden Tag zwanzig solcher Briefe öffnen würde. Es musste ein sehr instruktiver Brief gewesen sein, denn kaum hatte er seine Brille zurecht gerückt und den Blick auf das Papier gerichtet, nahm er Anne-Käthi ins Visier und hieß sie - einer Prinzessin gleich - ehrerbietig „in unserem bescheidenen Hause willkommen, Mademoiselle. Wir werden alles tun, um sie bis zur Abreise morgen früh in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.“ Ein energischer Schlag auf die vor ihm liegende Glocke ließ zwei livrierte Burschen herbeieilen. Sie hatten sich um das Gepäck „unserer hochverehrten Freundin der Familie Fischer“ zu kümmern und sie umgehend in das für sie reservierte Zimmer in der ersten Etage zu geleiten.
Das Zimmer war eine Suite mit Schlafzimmer, Salon, Badezimmer und sie ging auf den Rhein hinaus! Anne-Käthi kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, obwohl sie sich in den beiden vorangegangenen Nächten schon ein bisschen daran gewöhnt hatte, in einem eigenen Zimmer zu schlafen. Und es hatte ihr ganz gut gefallen! Wie gerne würde sie jetzt ihrer Mutter in Bünzen berichten, was ihr widerfahre. Und ihren Schwestern und ihren Brüdern, angefangen beim Hans-Ruedi, der jetzt wohl gerade dabei war, zusammen mit Vater die Kühe zu melken und für die Nacht den Stall zu richten. Und Mutter! Sie war jetzt wohl damit beschäftigt, das Znacht zuzubereiten, zwischendurch die kleinen Geschwister zu waschen, um sie nach dem Essen für die Nacht parat zu haben und dann noch eine Stunde mit Vater und Hans-Ruedi am Küchentisch zu verbringen, den Tag vorbei ziehen zu lassen, den nächsten Tag zu planen; so, wie sie es zusammen mit ihr oft getan hatten. Anne-Käthi stand in Gedanken versunken vor dem Spiegel in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich für das Nachtessen etwas frisch machte und als sie sich im Spiegel sah, bemerkte sie die Tränen, die ihr über die Backen kullerten. Sie schalt sich eine „dumme Base“ und wischte die Folgen des Gefühlsausbruches weg. Sie hatte es eilig, in den Speisesaal zu kommen, denn der Concierge hatte ihr Pünktlichkeit „empfohlen“, da das Souper ab Punkt Zwanzig Uhr serviert werde. Wieder ein Ausdruck, den sie nicht verstanden hatte; vor dem Einschlafen wollte sie im Wörterbuch blättern.
Es kam nicht dazu. Die anstrengende Reise und ein mehrgängiges Nachtessen, das sie ganz allein an einem Tisch im Speisesaal des Les Trois Rois, der durch die wandhohen Spiegel noch um ein Vielfaches weitläufiger erschien als er tatsächlich war, zu sich nahm, hatte Anne-Käthi auch an diesem dritten Reisetag ziemlich ermüdet. Endlich im Zimmer, fiel sie wie ein Stein erschöpft ins Bett.
Am nächsten Morgen wurde sie um Sieben von einer Zimmerfrau durch ein Klöpfeln geweckt. „Fräulein, das Frühstück.“ Anne-Käthi war ganz durcheinander und hatte völlig vergessen, dass ihr das Frühstück auf dem Zimmer serviert werde. Der Empfangschef hatte es ihr ja schon bei der Ankunft mitgeteilt, als dieser Emilies Brief gelesen hatte. Doch die Eindrücke der letzten Tage waren für sie so gewaltig, dass ein Frühstück auf dem eigenen Zimmer irgendwie nicht bis zu ihrem Bewusstsein vorstoßen konnte. So etwas war ganz einfach jenseits von jeder Vorstellung. Das war ihr schon am Abend so vorgekommen, als sie sich im Speisesaal umgesehen hatte: ein Bauernmädchen, das sich in einem Hotel für Reisende aus der ganzen Welt bedienen lässt!
Aber sie war weit davon entfernt gewesen, sich von der Eleganz und der Weltläufigkeit des Hotelbetriebes einschüchtern zu lassen. Neugierig hatte sie jedes Detail beobachtet, auch wenn sie die komplizierten Abläufe etwa beim Servieren oder das umständliche Essen der Gäste, die allerlei Besteck vor sich hatten und sich damit zurecht finden mussten, immer wieder in Erstaunen versetzten. Und jetzt das Frühstück! Ein riesiges Tablett wurde auf dem Salontisch abgesetzt und die Zimmerfrau richtete in geübten Gesten den Tisch für Anne-Käthi her. Tassen, Kännchen, Schälchen, Körbchen, Döschen und Eierbecher bildeten schließlich das Tableau eines vornehmen Frühstücks, das Brot und Croissants, Butter und Konfitüren, Tee und Zwei-Minuten-Eier, eingemachte Pfirsiche und Aprikosen sowie Wurst, Speck und Schinken enthielt. Ganz so, wie es auf einem Gemälde über dem offen Kamin dargestellt war. „Sie müssen gut essen, Fräulein,“ sagte die Zimmerfrau in einem mütterlichen Unterton, „denn sie haben eine lange Reise vor sich.“
Das bodenständige Mädchen tat wie befohlen und langte herzhaft zu. Man konnte ja nie wissen, was der Tag noch bringen würde. Um acht Uhr, so hatte es ihr der Concierge am Vorabend ans Herz gelegt, erschien sie reisefertig vor der Empfangstheke, während ihre beiden Gepäckstücke gerade von einem Hausburschen von der Treppe her herangetragen wurden.
„Haben Fräulein gut geschlafen?“, fragte der lange Mann hinter dem hohen Pult. „Ja, sehr.“ antwortete Anne-Käthi auf die Standardfrage.
„Sehr gut. Dann wollen wir uns also Ihrer Reise nach Straßburg widmen. Alfred, der junge Mann, der Ihr Gepäck heruntergetragen hat,“ er wies auf den Hausburschen, der sich bei der Namensnennung gerade aufrichtete und ein diensteifriges Lächeln aufsetzte, „wird Sie jetzt zum französischen Bahnhof begleiten und dort dem Zollbeamten – einem Bekannten - übergeben. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als dem Grenzbeamten Ihre Papiere und dieses hier,“ – er reichte ihr einen mit dem Zeichen des Hotels und Stempel versehenen Umschlag – „zu überreichen. Dann geht alles wie geschmiert.“
„Danke vielmals. Sie sind sehr hilfreich zu mir.“ sagte sie.
„Nicht der Rede wert, verehrtes Fräulein. Für die Familie Fischer tun wir alles.“
Anne-Käthi konnte nicht wissen, dass in Emilies Brief an den Empfangschef – ein Vertrauter der Familie seit der Gründung des Hotels - nicht nur exakte Anweisungen für den Grenzübertritt des Au-Pair-Mädchens und seines Gepäckes, insbesondere eines Lederzylinders, enthalten waren, sondern auch ordentliche Trinkgelder für das Les Trois Rois-Personal, allen voran für den Concierge selber, und für die kaiserlichen, französischen Grenzbeamten, denen der Concierge eine persönliche Notiz auf Hotel-Papier zukommen lassen sollte.
Das Mädchen aus Bünzen zog kurz vor halb Neun im Schlepptau des Gepäckträgers und Hausburschen Alfred los. Sie überquerten den vom Droschkenverkehr in ein Bienenhaus verwandelten Vorplatz des französischen Bahnhofes. Alfred musste mehrmals – Reisetasche und Lederzylinder auf einem hoteleigenen Gepäckkarren vor sich her stoßend – brüsk anhalten, um seine teuren Frachten vor und hinter sich nicht von rasenden Pferdegespannen, angetrieben von fluchenden Droschkenkutschern, überfahren zu lassen.
Endlich im Bahnhofsgebäude angelangt, umtoste sie ein Sturm. Dagegen war das gestern Abend Erlebte nur ein laues Lüftchen gewesen. Während auf der Schweizer Seite sich nur wenige Leute in Richtung eines Zuges nach Liestal bewegten – dem einzigen am Vormittag -, herrschte Richtung Frankreich ein Gedränge, ein Rufen, Schreien und Stoßen, dass es einem ganz schturm im Chopf wurde, wie es Anne-Käthi bezeichnet hätte. Das hatte damit zu tun, dass die Bahnlinie eigentlich nur von Straßburg nach Basel verlief und der französische Bahnhof Start- und Endstation für Reisen nach Frankreich war. Die Strecke von Basel nach Liestal, für die man in den Schweizer Bahnhof wechseln musste, war das erste Bahnstück für die Centralbahn überhaupt und tatsächlich erst die zweite Bahnstrecke in der noch jungen Schweiz. Kurz vorher war eine dreiundzwanzig Kilometer lange Bahnverbindung von Zürich nach Baden in Betrieb genommen worden, die eigentlich bis nach Basel hätte führen müssen, aber den Betreibern, der Nordostbahn, war das Geld ausgegangen. Im benachbarten Frankreich und in Deutschland dagegen hatte die Bahn schon längst ihren Einstand gefeiert und den Siegeszug begonnen. Was zu Beginn vor allem für den Transport von Kohle nützlich erschien, wurde dort schon nach kurzer Zeit auch für den allgemeinen Warentransport, aber auch für Personentransporte immer attraktiver. Die Compagnie de l’Est betrieb die Strecke Straßburg-Paris und hatte sie durch einen Ast nach Basel ergänzt, was den Betreibern aufgrund der aufstrebenden Industrie attraktive Erträge versprach.
Anne-Käthi durchquerte die Bahnhofshalle wie im Traum; so fremd und stark waren die Eindrücke, deren befremdlichster schwarze Menschen waren. Solche Leute hatte sie noch nie gesehen. Sie wusste nur vom Religionsunterricht davon, wenn Pfarrer Hauser einmal erklärte, der Liebe Gott sei für alle da, „für weiße, schwarze, gelbe und rote Menschen, von denen wir die meisten noch zu Christen erziehen müssen“. Nun stand sie mit diesen in einer Menschenschlange, die nach Frankreich wollte und – wie sie selbst - den Grenzbeamten die Ausweise zeigen mussten. Nebst den Schwarzen fielen ihr aber auch die zahlreichen eleganten Leute auf, von denen die Damen kolossale runde Schachteln mit sich trugen oder vielmehr tragen ließen, denn es waren, wie sie nun feststellte, oft Schwarze, die diese riesigen Behälter den Damen hinter her trugen. Es waren natürlich Hutschachteln, aber das konnte Anne-Käthi zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Die Herren gefielen in eng anliegenden Leibröcken, über denen sie, wie zufällig, meist pelzbesetzte Mäntel offen trugen und so imposante Figuren abgaben.
Und dann die Sprachen! Niemand redete in einer für Anne-Käthi verständlichen Sprache. Dass viele von ihnen Französisch sprechen mussten, lag auf der Hand, denn schließlich stand man hier am Eingangstor zu Frankreich. Aber da waren auch noch Leute, die in ganz komischen Lauten daherredeten, als hätten sie Kartoffeln im Mund. Dann die Männer, die sich laut und gestenreich über Menschenreihen hinweg unverständliche Dinge zuriefen und dabei ständig von Mamma zu sprechen schienen, soviel konnte Anne-Käthi erraten. Es gab auch Leute, die von den Lauten her fast so sprachen wie sie zu Hause im Bünztal und trotzdem verstand sie kein Wort. Auf der Reise sollte sie schon bald herausfinden, dass es Elsässer waren, von denen die meisten auf einem Streckenhalt, in Colmar, ausstiegen und andere zustiegen.
Anne-Käthi war an der Reihe. Während Alfred die Reisetasche und den Lederzylinder dem Grenzbeamten vor die Füße stellte und umgehend verschwand, überreichte ihm das Au-Pair-Mädchen seine Papiere und den Brief des Concierge. Der blau Uniformierte öffnete zuerst den Briefumschlag mit dem Wappen des Les Trois Rois, während er Anne-Käthis Papiere darunter klemmte. Er schien die Notiz des Concierge zu lesen, prüfte den Umschlag, um sich zu vergewissern ob noch etwas – vermutlich Erwartetes – darin sei, steckte ihn in einer fließenden, unauffälligen Bewegung in seine Uniformtasche, warf einen Blick auf die Papiere der Schweizerin und interessierte sich keinen Deut um das Gepäck. Sein eleganter Armschwung winkte die vor ihm stehende junge Dame über die Grenze, dabei bemerkte er lächelnd beiläufig: „Bienvenue en France, Mademoiselle.“
Das Mädchen aus Bünzen betrat zum ersten Mal in seinem Leben das Ausland. Es fühlte sich nicht besonders an; jedenfalls konnte Anne-Käthi außer den fremdartig sprechenden und aussehenden Menschen keinen markanten Unterschied zwischen der Schweiz und Frankreich entdecken. Gut, vielleicht ging jenseits der Grenze alles etwas schneller vor sich, man schien es eilig zu haben. Doch solcherlei Gedanken rückten in den Hintergrund, als es galt, den richtigen Zug und den richtigen Platz in der 2. Klasse zu finden. Auf den Perrons herrschte Gedränge, schwierig für einen Neuling, die Übersicht zu finden. Ein Mann, eine rauchende Zigarette im Mundwinkel, in ausladendem blauem Hemd und unter einer Mütze mit dem Schildchen Porteur bot sich im breiten Schweizer Dialekt an, für sie beides zu finden. „Bitte folgen Sie mir, Fräulein. Der Zug nach Straßburg fährt ab Gleis zwei.“ Anne-Käthi stellte erleichtert das Gepäck auf den Gepäckkarren und folgte dem freundlichen Mann. Schon nach wenigen Metern stand sie vor dem auf dem Billet aufgedruckten Waggon und Abteil. „Das hätte ich ja auch selber gefunden.“ dachte sie bei sich. Der Porteur half ihr, den reservierten Platz zu finden und das Gepäck auf dem Ablagefach über den Sitzen zur verstauen. „Danke Herr“, sagte Anne-Käthi freundlich, und verstand nicht, weshalb der hilfsbereite Mann wie angewurzelt vor dem Abteil stehen blieb und der jugendlichen Reisenden die nach oben gerichtete Handfläche entgegenstreckte. Sie wusste nicht, was zu tun sei. Da mischte sich eine offenbar erfahrenere Reisende ein, die sich bereits auf ihrem Platz eingerichtet hatte und sprach in einer halb deutschen halb schweizerischen Sprache: „Jo, dann gebe se em halt e Santimm als Trinkgeld, Mamsell.“
Anne-Käthi verstand ‚Trinkgeld’ und nestelte aus ihrem Reisebeutel eine Münze von dem Reisegeld heraus, das ihr Emilie Fischer mitgegeben hatte. Sie überreichte die Münze dem Porteur, dessen Augen urplötzlich die Größe der Münze annahmen. Im Nu packte er zu und verschwand lachend und johlend in der Menge. „Jo, das wär mer au a groß pläsir gewese“, bemerkte die Dame, „e ganze Napoleon pour zwöi paket zwanzg mètre wiit stosse.“ Anne-Käthi verstand nicht ganz den Sinn der Worte, aber irgendwie spürte sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Zu ihrem Schaden, aber zur Freude eines Anderen. Die Reise hatte mit Lehrgeld begonnen.
3
Wo, au diable, ist meine nouvelle cravate? Mer.., was ist mit unserem, mit deinem Personal los. Man findet gar nichts mehr. Soll ich als Bauer zum Hof?“
„Du calme, Guillaume, du calme! Et, s’il vous plaît, nicht diese wüsten Worte, mon cher. Die Kinder könnten es hören. Und das Personal sowieso.“
Guillaume Fischer – eigentlich Wilhelm und noch eigentlicher Willi Fischer - und Charlotte De Villepin führten eine durchaus normale Ehe ‚in gehobenen Pariser Kreisen’, wie man dies im Ausland bezeichnet hätte. In Paris war ein Stadtpalais an der Rue du Louvre und eine Geschäftsadresse in der nahe gelegenen Galerie de Valois so etwas wie ein kommerzieller Adelstitel. Wer sein Geschäft in einer der vier den Jardin du Palais Royal umschließenden Arkaden einmieten konnte, gehörte zu den Leuten, die es geschafft hatten. Vorbei die Zeiten, da die Galerien des Palais Royal - gegenüber des Louvre – Glücksspiel, Prostitution, jede Menge Restaurants und Cafés die ganze Halbwelt und den Rest der vergnügungssüchtigen Vermögenden, Intellektuellen und Theaterleute von Paris angezogen hatten; unter dem Second Empire regierte jetzt der Luxus. Die neuen Mieter gehörten zu „tout Paris“; jene Leute also, die an einem der fast wöchentlich veranstalteten, edlen Feste am Hof dazu gehörten.
Die Art der morgendlichen Diskussion im Ankleidezimmer des Hausherrn hatte sich seit Wochen zwischen den Eheleuten etabliert. Genauer, seit bekannt war, dass das Etablissement Fischer et Cie einerseits als Teil der Schweizer Vertretung an der Exposition Universelle gesetzt war und andererseits die Produkte des loyalen Schweizer Unternehmers von der Kaiserin persönlich ins Visier genommen worden sein sollen. Wer daran zweifeln wollte, hätte sich bloß die Hüte der Kaiserin Eugénie vorführen lassen sollen. Überall, auf Krempen, als Schleifen, als Hauptschmuck des Hutes - ohne die Schweizer Strohgeflechte ging es nicht. Selbst Winterhalter, der unbestrittene und einzig zugelassene Porträtist der Kaiserin und ihres Hofes, verlangte widerspruchlos die Agréments de Wohlen pour les Chapeaux de l’impératrice. Willi, Guillaume, lieferte stets das Gewünschte, pünktlich und – wie üblich im zweiten Reich der Bonapartes - zu exorbitanten Preisen.
Seit dem Tag, als Willi Fischer mit nichts als einem Muster-Koffer voller Wohler Agréments und einem unbändigen Optimismus nach Paris kam, waren zwanzig Jahre verstrichen. Während damals in der Schweiz die bleierne Zeit des sich gegen den Untergang wehrenden Ancien Regimes jede Entwicklung verhinderte, erschien mutigen Leuten das ferne Paris wie ein Ort des Aufbruchs. Was es nicht war, denn die nach dem Wiener Kongress dem nachnapoleonischen Frankreich verordnete Bescheidenheit in europäischen Fragen war auch keine wirtschaftliche Triebkraft. Aber für die kleinen Händler aus der Schweiz, die nach eigener Darstellung ganz originelle Produkte anzubieten hatten, war es auf jeden Fall ein riesiger Markt, den es zu erobern galt. Vor allem, seit die Bonapartes nach dem Sturz des ersten Napoleon aus dem Land gejagt worden waren und nun die Bourbonen zurück an die Macht strebten. Das roch nach Glanz, Hof und Luxus – das rechte Umfeld für Produkte, die neben der praktischen Seite vor allem einen dekorativen Charakter hatten, wie die Stroh-Agréments aus dem Freiamt, die zwar einzigartig und unbestritten schön waren, aber eigentlich niemand wirklich brauchte.
Willi hatte sich mit seiner Schwester Emilie auf eine Risikozeit von sechs Monaten geeinigt. Wenn er bis dann den Einstieg in den Markt der Pariser Hutmacher nicht geschafft haben würde, sollte die Übung abgebrochen werden. Man hätte sich dann auf das heimische Strohhutgeschäft der Florentiner konzentriert, das man zwar schon recht gut verstand, aber irgendwie nicht wirklich weiter führte. Die beiden Geschwister wollten mehr; sie wollten alles und waren bereit, dafür das Erbe der während einer Grippe-Epidemie früh dahin gerafften Eltern aufs Spiel zu setzen.
Als der Wohler Strohgeflecht-Händler Willi Fischer nach strapaziöser Reise Mitte der Dreißiger Jahre in Paris ankam, war von Glanz und Luxus nicht viel zu sehen. Frankreich und seine Hauptstadt waren durch die europäischen Nachbarn und früheren Kriegsgegner auf ein provinzielles Niveau zurück versetzt worden. Der Bourbone Louis-Philippe war vor allem damit beschäftigt, die eigene Familie mit Posten und Privilegien auszustatten, das gemeine Volk darbte. Es kam immer wieder zu Revolten und Aufständen, die niedergeschlagen wurden. Willi Fischer suchte den Kontakt mit Hutmachern, Schneidern und Theaterleuten. Von seiner bescheidenen Absteige in der Nähe der Rue de Rivoli hatte er es nicht weit, um jeden Tag zu Fuß, den Musterkoffer unter dem Arm, die rund um den Louvre und den Palais Royal angesiedelten Ateliers aufzusuchen. Die Muster mussten für sich selber reden, denn Willi sprach zu Beginn seines ersten Aufenthaltes in Paris kein Wort Französisch, außer vielleicht Bonjour und Aurevoir. Er hatte sehr rasch gemerkt, dass der Name Willi Fischer, so wie er es gewohnt war, ihn auszusprechen, nicht so recht ankam. Es passierte immer wieder, dass man nachfragte und dazu die Frage anhängte: „Vous n’êtes pas Prusse, Monsieur?“ Das waren ernsthafte Hindernisse, um in dem unter Führung der Preussen geschlagenen Frankreich Karriere zu machen. Erst recht in Paris, wo die Wut über alles Preußische und preußisch Klingende auch zwanzig Jahre nach dem Sturz des Korsen noch tief im Bewusstsein der geschlagenen Nation verankert war.
Willi Fischer ließ sich von einer Druckerei an der Rue St. Honoré Visitenkarten herstellen. Guillaume Fischer. Directeur Fischer et Compagnie. Agréments artistiques en Paille. Wohlen–Suisse. Die erste Zeile, mit seinem Namen, war ebenso wie die vierte, mit der Herkunft, fett gedruckt. Fortan übergab er diese Karte der jeweiligen Zielperson, indem er seinen Namen betont französisch aussprach, aus dem an sich kurzen Fischer wurde nun eine Art gedehntes Fischèère. Die Wirkung war erstaunlich.
Nach zwei Monaten – er hatte inzwischen in das soeben eröffnete erste Luxushotel, Le Meurice an der Rue de Rivoli, gewechselt - und ungezählten Kilometern durch die nicht sehr einladenden innerstädtischen Quartiere, die sich neben den monumentalen historischen Bauten eher elend ausnahmen, wo oft noch offene Abwasserkanäle durch enge Straßen die Luft verpesteten und an denen heruntergekommene Wohnhäuser standen, wurde der Wohler Fischer nun freundlich, zuvorkommend gar, empfangen. Dies nicht zuletzt auch, weil er sich schon leidlich in der fremden Sprache ausdrücken konnte. Die vielen Stunden in Restaurants und Cafés, die wie Pilze aus dem Boden zu schießen begannen, hatten eine positive Auswirkung auf seine sprachliche Weiterbildung gehabt. Er hatte sich bereits ein paar typische Pariser Redensarten angewöhnt, die allerdings nichts anderes waren, als die Verkürzung dessen, was normalerweise im tiefen Frankreich gesprochen wurde. So ließ er die Pronomen zugunsten eines unhörbaren l’ fallen, das schließlich vollständig wegfiel.
Noch vor Ablauf der mit seiner Schwester vereinbarten Risikoperiode holte er sich mehrere Aufträge für Strohschnürli, Agréments und sogar für Strohhüte im Florentiner Stil. Das Wichtigste war aber, dass er sich in den Köpfen und Herzen seiner Geschäftspartner aus der Pariser Modistenbranche – meistens talentierte Frauen, die aus einfachen Hutmodellen und Kleidern wahre Kunstwerke zauberten - einzunisten wusste. Willi war einfach ein Schatz für die hochnäsigen Pariser, die jeden, der weiter als aus





























