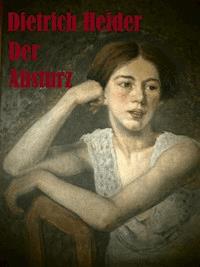
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die frühkindliche Rivalität zwischen zwei Schwestern wird durch ungeschicktes Verhalten der Eltern, überkommene Denkmuster und den überraschenden Tod der jüngeren zur Katastrophe für die ganze Familie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aufs Ganze betrachtet, — wenn denn in ihrem zarten Alter von Betrachtung überhaupt die Rede sein konnte — nach Anzeige aller ihr bereits zu Gebote stehenden Sinne also, stellte sich Isabell ihr Dasein als durchaus befriedigend dar. Ihre Umgebung war hell und trocken und, wenn sie Unwillen kundtat, was sich bei fortgesetztem Alleinsein schon hin und wieder als nötig erwies, ließen ihre Bezugspersonen selten lange auf sich warten. Am liebsten trippelte sie barfuß über den neuen Bodenbelag aus terrazzoartig gesprenkeltem Kunststoff, dessen schaumiges Unterfutter dem Druck ihrer Füße sanft nachgab, und dabei liebte sie das Gefühl, wenn sie mit Ballen und Zehen Dellen in die weiche Fläche grub. Dass es mit dieser Auslegware so seine Bewandtnis hatte, dass sie etwa auf nagelneues Eichenparkett geklebt war, und vollends aus welchem Grunde, dafür fehlte ihr allerdings noch jegliche Vorstellung. War denn nicht für Essen, Kleiderwechsel, selbst für Zerstreuung gesorgt, und sogar in mehr als wünschenswerter Weise? Wie hätte sie da zur Kenntnis nehmen sollen, dass der Bauch ihrer Mutter in den letzten Monaten etwas angewachsen war, da er doch bis dahin mit ihrem Wohlbefinden in keinem erkennbaren Zusammenhang gestanden hatte? Überdies floss die für sie bestimmte Milch seit Neuestem weiterab von ihrer Mutter aus einem glatten, bissfesten Gummizapfen und schmeckte süßlich, manchmal auch nach Haferflocken, Bananenmus oder Karamell, was bei allem zunächst Ungewohnten doch eine Verbesserung bedeutete. Vielleicht, wenn sie ein bisschen schlauer gewesen wäre, — aber eigentlich war sie für ihre drei Jahre ziemlich schlau — vielleicht hätte sie dann das ihr drohende Unheil daran ersehen können, wie hingebungsvoll sich ihr Vater dieser neu entstandnen Schwellung zuwandte, denn Zuwendung gebührte doch eigentlich ihr, dem herzigen Fratz. So taumelte sie wie Flitter in einer Schneekugel, willenlos und unwissend, im Strudel des Geschehens bis zu jenem Tage, der ihr schlagartig zwar keine Selbsterkenntnis bescherte, aber doch die Erkenntnis dessen, was sie nicht mehr war oder nie sein würde, blond, blauäugig und ein niedliches Bettscheißerchen.
Für die Fahrt zu ihrer seit Tagen abwesenden Mutter hatte man ihr ein hellblaues Kleid mit Puffärmeln und eine weiße Strumpfhose angezogen. Ihr langes kastanienbraunes Haar war in der Mitte gescheitelt und mit Hilfe zweier Schleifen straff zur Seite gespannt, von wo es jedoch wie zwei Dochte kraus und unbezähmbar um ihre Ohren baumelte. Weit nach hinten in die Holzbank gerückt, streckte sie ihre Beine, da sie sie nicht abwinkeln konnte, gerade von sich zwischen die gespreizten, leicht zittrigen Knie ihres Großvaters, der ihr in der Straßenbahn greisenhaft lächelnd gegenübersaß. In seinem viel zu weiten Anzug wirkte er gebrechlich und krank. Isabell zur Seite wachte ihre Großmutter, die Pfauenwirtin aus Degerloch, in Kostüm und Rüschenbluse über diesen Ausflug ihrer Enkelin.
Langsam fuhren sie über die kurvenreiche Strecke in Stuttgarts Innenstadt hinunter und eigenartigerweise hat sich später für Isabell mit dieser Fahrt die Vorstellung verbunden, sich mit jeder Haltestelle weiter dem Herd einer schrecklichen Verwüstung zu nähern. Nie zuvor waren ihr die von Gestrüpp überwucherten Grundmauern einstiger Villen in den Gärten hoch über dem Straßenrand aufgefallen. Nie hatten die Baulücken, die entlang der Hauptverkehrsachse klafften, ihr Interesse erregt, nie die auch noch in ihren Trümmern beeindruckende Fassade der Landesbibliothek, die den vorbeifließenden Verkehr hohl und bedrohlich überragte. Inzwischen längst in einen Bus umgestiegen, bewegten sie sich über die Talsohle, als Isabell ein überwältigendes Ahnen von Zerstörung überkam, genau in diesem Augenblick, wie sie später immer wieder festgestellt und sich selbst gegenüber versichert hat. Es ergriff sie, durchdrang sie, berauschte sie. Jedoch, ohne hinzuschauen, unterhielten sich ihre Großeltern über die Vorbereitung eines bevorstehenden Festes, indes das Flickenbild von Ruinen und Neubauten, Lücken und Baustellen an ihnen vorbeizog, und eben das Bewusstsein der Teilnahmslosigkeit angesichts der Eindrücke, die sie so tief bewegten, hat ihr später alle Zweifel zerstreut, sooft sie darüber nachgrübelte, ob denn ein so junges Mädchen zu solchem Empfinden überhaupt in der Lage sei. — Vielleicht aber war sie doch durch eine Bemerkung ihrer Begleiter auf das Feld des Verstörenden gelenkt worden, denn, während sie vor dem Hauptbahnhof auf die Abfahrt des Busses warteten, hatte sich ihr Großvater nicht laut, aber nachdrücklich über eine Gruppe Betrunkener ereifert. Da hatte Isabell geschwind aus dem Schiebefenster gespäht, hinüber auf den Rasenplatz im Schlossgarten, auf dem sie lungerten, eine Flasche von Hand zu Hand reichend, einige Frauen mit verklebten Haaren und zerrissner Kleidung sowie ein Mann, der sich ihr durch sein feuerrotes Hemd tief einprägte.
Zu beiden Seiten der Freitreppe, über die man in die Eingangshalle der Klinik gelangte, standen Baubaracken. Rohre, Kabel, Fliesen waren zwischen den Kellerfenstern des Sockelgeschosses aufgeschichtet und allerorten herrschte geräuschvolle Betriebsamkeit. Während ein Betonmischer knirschend kreiste, schaufelte ein Arbeiter im blauen Kittel Sand und Zement in dessen runde Öffnung. Auch im Innern des Gebäudes trafen die drei Besucher auf Handwerker, die damit beschäftigt waren, das Leitungssystem sowie die sanitären Einrichtungen vollständig zu erneuern. — Elf Jahre waren seit der bedingungslosen Kapitulation vergangen, acht seit der Währungsreform und seit fünf Jahren gab es im Südwesten Deutschlands ein einziges, großes Bundesland mit Stuttgart als Hauptstadt. Wer, selbst wenn er noch so hinfällig gewesen wäre, hätte da an Baulärm Anstoß genommen, galt er doch als die Begleitmusik eines sachten Wiederauflebens?
Isabell stürzte auf das Bett ihrer Mutter zu. Nur am Rande bemerkte sie ihren Vater und ihre andre Großmutter, wie diese sich in eigenartigem Widerspruch zu ihrem sonstigen Verhalten, ja, wie ihr schien, in fast lächerlicher Missachtung ihrer Erwachsenenrolle mit einem unordentlichen Wäschepacken abgaben. Irgendwo am Rande ihrer Wahrnehmung, in den hintern Bereichen des Raumes, befanden sich wohl noch weitere Betten, in denen ebenfalls Frauen lagen, auch diese von Besuchern umstellt. Nachdem sie mit ihrer Mutter, wie gewohnt, Küsschen gewechselt hatte, überließ sie sich zaghaft der in ihr aufkeimenden Hoffnung, ihre Lebensumstände könnten wieder annähernd so werden wie früher, zumal da ihre Mutter nicht müde wurde, ihr zu versichern, dass alles gut verlaufen sei. Alles habe sich ganz wunderbar gefügt und nichts stehe weiter zu befürchten. Sie richtete sich auf, um ihren Oberkörper wie erschöpft gegen das Kopfende zu lehnen, und Isabell folgte dem Gesicht ihrer Mutter mit ihren Blicken, hinauf zu einem Handgriff, der an einem Galgen über dem Bett baumelte, und noch etwas höher, zu dem Gekreuzigten, der vom braunen Lackfarbenanstrich der Zimmerwand auf sie beide herniederblickte. Mittlerweile hatten sich auch die Eltern ihres Vaters zu dem Stoffklumpen begeben und, während sich nun alle mit gleicher Betulichkeit unterhielten, — auch die beiden alten Frauen, was sonst eher selten vorkam — falteten sie andächtig die Fetzen auseinander. Ja, alles sei nun überstanden, fuhr ihre Mutter gleichfalls mit süßlich gedämpfter Stimme fort, und sie werde wohl bald wieder nach Hause kommen, zu ihrem tapfern Mädchen, wobei sie ihr Wangen und Scheitel streichelte. Aber nun dürfe auch sie den kleinen Goldschatz anschauen. So viel befremdliches Gehabe hatte Isabell in der Tat auf Außerordentliches eingestimmt und ein Goldschatz, wenn auch ein kleiner, vermochte da schon einiges zu erklären. Ihr Vater führte sie zu den andern, um ihr mit dem Bekunden äußerster Verzückung etwas zu zeigen, wofür ihr Begriffsvorrat keine Benennung und ihre Erinnerung keinen Vergleich bereithielten. Erst Monate später, als ihre Mutter ihr auseinandersetzte, ein so großes Kind wie sie könne nun wirklich nicht mehr an der Schoppenflasche nuckeln, und Isabell, die wild schreiend um sich schlug, dazu zwingen wollte, eine aufgeplatzte Brühwurst von der Gabel zu essen, erwachten in ihr Erinnerungen an dieses Erlebnis und weihten sie von Stund an zur Fleischverächterin.
Bei Familie Grundmann war Taufe. Der große Saal des Goldnen Pfauen, ganz neu mit Zirbelpanelen vertäfelt und parkettiert, da die Wirtin auf die heimelige Wirkung von Holz schwur, bot kaum genug Raum für die unzähligen Gäste. Weder an der Ausstattung noch an leiblichen Genüssen war gespart worden und die heitere Stimmung bestärkte die alte Dame in der Überzeugung, sich bei der Auswahl der Speisen gegenüber ihrer Schwiegertochter mit Recht unnachgiebig gezeigt zu haben. Schließlich konnte sie am ehesten ermessen, welche Gerichte eines solchen Anlasses würdig waren, und, dass es dabei nicht so sehr auf den eignen Geschmack ankam, durchschaute niemand besser als sie selbst. Wer wollte denn schon — darin war sie mit Hilde durchaus einer Meinung — sonntags, etwa im Familienkreis, Briessuppe oder Kalbsnierenbraten essen?
Da die frisch Niedergekommene sich noch etwas schwach fühlte, ging die alte Frau Grundmann immer wieder durch die Reihen, um von den Köstlichkeiten anzubieten. Außerdem benötigten die beiden Mädchen, Anna, der Täufling, und ihre nun schon große Schwester immer wieder die Mutter. Isabell, die seit einiger Zeit in Trotz verfallen war, liebte es, sich kindischer zu geben, als ihr von Alters wegen zukam. Babbeln ohne Sinn, affige Bewegungen, aber auch absichtliches Sabbern und Bettnässen gehörten zu diesen abgelegt geglaubten und zur Unzeit wiedergekehrten Verhaltensmustern. Allein, ihre Großmutter hatte auch in dieser Verlegenheit schnell Abhilfe geschafft, denn, wie sie stets betonte, auf der Nase konnte sie sich in ihrem Beruf nicht herumtanzen lassen. Höchstpersönlich hatte sie deshalb ihre etwas widerspenstige Enkelin vor Beginn des Festes hinreichend lange auf den Topf gesetzt.
Hilde Grundmann weilte, um Anna zu stillen, in einem anstoßenden Raum zusammen mit Maria Genrich, einer Russlanddeutschen, die sie seit Langem gut kannte. Diese war in den letzten Kriegstagen mit einem Flüchtlingszug auf den Fildern angekommen und im Gasthof zum Goldnen Pfauen, der unversehrt geblieben war, einquartiert worden. Inzwischen arbeitete sie am Tresen einer Cannstatter Wäscherei. In ihr sah Frau Grundmann eine Seelen- und Schicksalsverwandte, der sie sich vorbehaltlos anzuvertrauen wagte. „Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die Alte in der letzten Zeit zuwider ist.“ Bei allem innerlichen Aufruhr nahm sie Anna doch liebevoll aus ihrem Korbwagen, um sie an ihre Brust zu legen. „Ständig muss sie mir unter die Nase reiben, dass ich in ihren Augen nur zweite Wahl bin. Um ihren Sohn vor der Ehe zu unterhalten, um hier Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu putzen, war ich allemal gut. ‚Aber doch bitte nichts Festes, nicht mit der Hilde, einer Unehelichen!‘ Am Ende spitzte sie sich sogar darauf, dass ihr vergötterter Alfred mir auch einen Bankert anhängen werde. Aber wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann, eisern zu sein. Ohne Trauschein lief gar nichts, ganz gleich, wie er winselte und süß tat.“ Hier rang sie um Fassung, da sich ihre seelische Erregtheit auf den Säugling übertrug und er sich zu verschlucken drohte. „Selbst noch kurz vor der Hochzeit musste ich hören, wie ihn seine Alte anbenzte: ‚Wenn es bloß nicht die Hilde wäre! Man weiß ja nicht einmal, von welchem Zigeuner sich ihre Mutter die eingefangen hat!‘“
Sie saß auf einer Holzbank hinter einem Wirtshaustisch, das in Tücher geschlagene Kind in den Armen haltend, und blickte betrübt auf ihre Freundin, die auf einem der unzähligen derben Stühle ihr zur Seite Platz genommen hatte. Während Hilde Grundmann dann die unruhig gewordne Kleine mit schaukelnden Bewegungen stärker an sich drückte, strich sie sich mit der freien Linken eine verschwitzte Strähne ihres pechschwarzen Haares aus der Stirn. „Ich kann mir denken, was du einwenden willst, aber du hast sie erst kennengelernt, als der braune Spuk vorbei war. Da waren auch ihr die Felle davongeschwommen, zumindest zunächst, bevor die Familie von Basedow drüben unterkam, mit dem Fräulein, das ihrer Meinung nach besser zu ihrem Alfred gepasst hätte. Für deutsche Recken gab es ja keine besondern Posten mehr.“ „Mein Gott,“ fuhr ihre Gesprächspartnerin ungeduldig dazwischen, „was rührst du denn ständig den alten Mist auf! Du hast ihn ja nun, du bist die Mutter seiner Kinder und deine Herkunft ist längst ein untergeordnetes Problem. — Glaubst du vielleicht ich hätte als Deutsche unter Stalin ein leichtes Leben gehabt?“ „Du hast ja so recht.“ Hilde klopfte ihrem Töchterchen, das sich gesättigt zu haben schien, mit der flachen Hand mehrfach sanft auf den Rücken. „Aber die Zurücksetzungen, denen ich so viele Jahre hindurch ausgesetzt gewesen bin, werde ich wohl nie ganz verwinden können. Schon bei den Schwestern im Kindergarten die dauernde Aufforderung, für das Heil meiner sündigen Mutter zu beten, dann sie selbst, ganz in der Rolle der Büßerin, setzt mich vor sich auf den Küchentisch und flennt mich an: ‚Du armes, armes, lediges Kind!‘ Ja, wenn sie sich von einem Nordmann hätte schwängern lassen, hätte das Elend wenigstens im Tausendjährigen Reich ein Ende gehabt. Beten jedenfalls war da nicht mehr angesagt und Kinder waren erwünscht, solange sie den Vorgaben entsprachen. Wenn da bloß nicht der verhängnisvolle Akteneintrag gewesen wäre: ‚Frucht einer Vergewaltigung, Kindsvater vermutlich ein Landfahrer‘! Damit hatte sich meine Mutter herausgeredet, weil sie ihre Liebschaft nicht zugeben wollte, aber für mich bedeutete dieser Vermerk das Aus. Zuerst noch wurden mir die Blonden nur als Vorbilder hingestellt, dann zunehmend vorgezogen, schließlich musste ich mich ihnen unterordnen, auch wenn sie noch so hohlköpfig waren, wie etwa Mechthild Kramer ...“ Ihre Stimme bebte. „Ja, Mechthild Kramer,“ schaltete sich nun wieder die andre ein, „ich weiß, ihr gilt dein unauslöschlicher Hass.“ „Du kennst sie: flachshaarig, groß, kräftig, eine Walküre, allerdings unrettbar dumm, mit einem wirren Tuff auf ihrem Germanenschädel und mit einem fleischigen Zinken im Gesicht. Wir nannten sie deshalb bloß den Synagogenschlüssel, bis ihr Vater in SS-Uniform den Klassenlehrer im Schulhof abfing und sich solche Witze laut schreiend verbat. Auch mein Alfred gehörte zu den Angebeteten. Vorstellig war er ja allemal und für mich unerreichbar. Es kommt mir vor, wie wenn es gestern gewesen wäre: Dass ich auf dem Gymnasium keine Zukunft hatte, — wegen schlechter Leistung, wie es hieß — das wusste ich bereits, ich, ein unscheinbares Mauerblümchen, und er, der Mädchenschwarm, trat festen Schrittes nach vorn, um uns einen Hausaufsatz, den ich für ihn verfasst hatte, vorzulesen. Das Thema: ‚Zeige anhand der geschichtlichen Entwicklung die Überlegenheit des Germanentums!‘ Beifall ohne Ende! Ein Held war geboren, in jeder Hinsicht zur Nachahmung empfohlen, besonders mir! Dabei hatte er von der Rassenlehre keine blasse Ahnung, ein Zuchtbulle, der sich selbst nicht verstand.“
Frau Genrich, sichtlich verstört, schlug dennoch oder vielleicht gerade darum aufs Neue einen leichten Ton an: „Nun hast du ihn und nun gib dich zufrieden! Auch deine Schwiegerleute scheinen doch langsam einzulenken. Immerhin haben sie für die junge Familie den obern Teil des Hauses ausbauen lassen.“ „Von unsrem Geld, was sie nicht gern zugeben! Und ich habe einen wesentlichen Teil dazu beigesteuert. Deshalb fällt mir nicht ein, mir wieder einen Holzboden aufs Auge drücken zu lassen, wenn ich den alten gerade erst losgeworden bin. Mir lag der Umbau viel mehr am Herzen als ihnen, und Alfred wäre es herzlich einerlei gewesen, wenn er noch dreißig Jahre in zugigen Zimmern mit Wickelwänden und schimmligen Dielen hätte zubringen müssen. Ohne mein dauerndes Nachhaken wären sie auch nicht dazu zu bewegen, sich aufs Altenteil zurückzuziehen, obwohl die veränderten Bedingungen sie doch sichtlich überfordern. Aber, wenn es nach Alfreds Kopf ginge, könnte alles noch lange so bleiben, wie es ist. Er liebt den schönen Schein und das unbeschwerte Genießen. Aber, was rede ich! Es ist mir wahrlich genug sauer geworden, mir ihn zu erkämpfen, und nun muss ich ihn nehmen, wie er ist!“ Frau Grundmann hatte mittlerweile ihre Jüngere in den Stubenwagen zurückgelegt und ließ sinnend ihre Blicke auf ihr ruhen, während sich diese in den Schlaf lullte.
Nach beendetem Mittagsmahl belebte sich das Gespräch bei Wein, Kaffee und Selbstgebackenem. Pfarrer Kunz, der die Taufe vollzogen hatte, saß am Ende der Tafel zwischen dem alten Herrn Grundmann und seinem Sohn. „Unter der Hitler-Diktatur stand es mit unsrer Kirche insgesamt gewiss nicht zum Besten.“ Mit diesen Worten ging er, an Alfred Grundmann gewandt, auf eine zuvor an ihn gerichtete Frage ein. „Es ist aber schlicht empörend, wenn vonseiten bestimmter Opfer — und Opfer gab es viele, aus allen gesellschaftlichen Kreisen und mit sehr unterschiedlichen Geisteshaltungen — wenn von ihnen immer wieder vorgebracht wird, das Christentum habe insgesamt versagt. Es habe keinen Aufschrei gegeben, als die NS-Führung zum Schlag gegen die Juden ausgeholt habe. Es gab sehr wohl Widerspruch, und recht deutlichen, aus unsren Reihen. Sicher hätten noch mehr mutige Priester sich der Verfolgung aussetzen können. Jedoch weiß jeder, welchen Blutzoll die heilige Kirche für ihre Überzeugungen und ihre Unwandelbarkeit in der Treue zum Herrn hat entrichten müssen. Sicher wären alle Christen berufen gewesen, in so dunkeln Zeiten ihr Kreuz auf sich zu nehmen, und sicher entzogen sich viele dieser Pflicht aus Sorge um das eigene Wohl oder um das ihrer Angehörigen. Allein, wer dürfte hier richten?“ Er machte eine kurze Pause, aber niemand schien seinen Gedanken fortspinnen zu wollen. „Ja, die Kirche durchlebte damals eine finstere Zeit, aber heute ...“ Mit gesenkter Stimme dehnte er das letzte Wort und schaute seinem jüngern Gesprächspartner sorgenschweren Blickes in die Augen. „... heute macht sich überall unter den jungen Leuten Gleichgültigkeit breit. Unmittelbar nach Kriegsende waren die wenigen heil gebliebenen Gotteshäuser bis auf den letzten Platz voll. Die Menschen, die das Grauen überlebt hatte und die nun in den Trümmern ihr Davonkommen suchten, waren für jeden Zuspruch, den ihnen die Kirche spendete, dankbar. Jetzt jedoch, wo es langsam bergauf geht, — Gott sei Dank, wie ich nur sagen kann — da wenden sich viele ausschließlich der Arbeit zu. Andererseits greift jedoch mit anwachsendem Wohlstand schon wieder eine gewisse Übersättigung um sich. Viele bleiben, selbst wenn sie ermahnt worden sind, dem Gottesdienst fern, ja, es gehört für manchen zum guten Ton, sich eigenmächtig der Führung durch die Geistlichkeit zu entziehen und erneut in weltlichen Lehren und politischen Ideologien, wohl gar in Sekten oder Ersatzreligionen sein Heil zu suchen.“





























