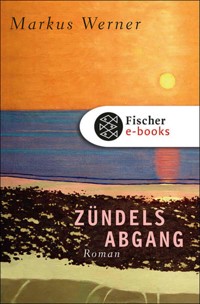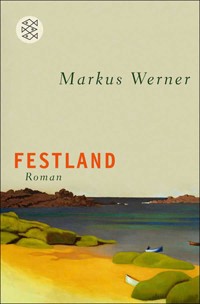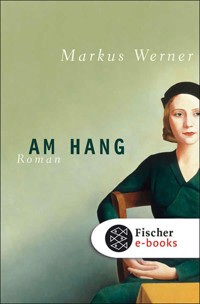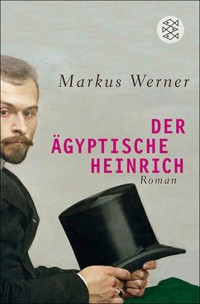
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»In diesem halb-historischen Roman verstört Geschichte. Besseres kann sie, in erzählter Form, kaum bewirken.« Susanne Beyer, Der Spiegel Die Geschichte von Heinrich Bluntschli, dem »ägyptischen Heinrich«, ist ein wenig auch die Geschichte seines Ururenkels. Denn er hat mit Umsicht und Geduld nach Spuren seiner Vorfahren gesucht und ist dabei auf allerhand Menschliches, das heißt Merkwürdiges und Abgründiges, Ägyptisches und Schweizerisches gestoßen. Ein amüsanter und spannender Bericht, denn Markus Werner kann wie kaum ein anderer Witz und Wahrheit auf ihren gemeinsamen Nenner bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Markus Werner
Der ägyptische Heinrich
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte von Heinrich Bluntschli, dem »ägyptischen Heinrich«, ist ein wenig auch die Geschichte seines Ururenkels. Denn er hat mit Umsicht und Geduld nach Spuren seiner Vorfahren gesucht und ist dabei auf allerhand Menschliches, das heißt Merkwürdiges und Abgründiges, Ägyptisches und Schweizerisches gestoßen. Ein amüsanter und spannender Bericht, denn Markus Werner kann wie kaum ein anderer Witz und Wahrheit auf ihren gemeinsamen Nenner bringen.
»In diesem halb-historischen Roman verstört Geschichte. Besseres kann sie, in erzählter Form, kaum bewirken.« Susanne Beyer, Der Spiegel
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Markus Werner wurde 1944 in der Schweiz, in Eschlikon im Kanton Thurgau, geboren und starb 2016 in Schaffhausen. Er studierte in Zürich Germanistik, arbeitete bis 1990 als Lehrer und dann als freier Schriftsteller. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane ›Zündels Abgang‹, ›Froschnacht‹, ›Die kalte Schulter‹, ›Bis bald‹, ›Festland‹, ›Der ägyptische Heinrich‹ und ›Am Hang‹. Zu seinem Werk erschien der von Martin Ebel herausgegebene Band ›»Allein das Zögern ist human«‹.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
© 1999 Markus Werner Erstveröffentlichung im Residenz Verlag, Salzburg, Wien Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Imke Schuppenhauer
Coverabbildung: Félix Vallotton, »Félix Jasinski seinen Hut haltend«, 1887
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401267-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
1
Ich hatte viel von ihr gehört, viel über sie gelesen, und ihr Erscheinungsbild war mir so gut vertraut wie ihre Herkunft und ihre Körpermaße, und alles, was ich wußte und mir während der Fahrt zu ihr noch einmal nicht ohne Erregung vergegenwärtigte, deutete Großes an. Trotzdem verlor ich, als ich vor ihr stand, die Fassung, die Knie zitterten mir, ich schrumpfte. Nie zuvor hatte eine wirkliche Wirklichkeit mein Bild von ihr so entschieden verkläglicht, daß ich mich meiner Vorstellungskraft hätte schämen müssen. Nun tat ich es – wenn auch nur für ein paar Augenblicke – , denn vor dem sinnlichen Da des Wunders, ich spürte es, wird alle Malerei des Hirns zum bleichen Pfusch.
Ich stand ihr gegenüber, erschüttert, überwältigt von ihrer Ausstrahlung und gelassenen Wucht. Hinfällig war ich, ein markloser Zwerg, ein Erdenwurm halt, der sich endlich, nachdem die Benommenheit ein wenig gewichen war, dazu anschickte, um sie herumzukriechen, immer ehrfürchtig und immer ungläubig aufschauend zu ihr und zum Tiefblau des Himmels, dem sie entgegenwuchs. Andere umkreisten das Phänomen auf Kamelen, der Rummel war groß.
Aber als ich, nach Bezahlung des Eintritts, ins Innere und Dunkle drang, war ich plötzlich allein. In tief gebückter Haltung folgte ich dem abwärts führenden Schacht. Die Luft wurde stickig, ich dachte an Umkehr. Am Ende des Gangs konnte ich mich aufrichten und etwas Atem schöpfen. Dann begann der ansteigende Stollen, der endlos schien. Ich quälte mich vorwärts und dachte an Umkehr. Ich dachte an die Millionen von Tonnen Gestein über mir, die, aufgeschichtet von Menschenhand vor Jahrtausenden, jederzeit und gerade jetzt, wo ich so gern noch ein Weilchen gelebt hätte, ins Wanken kommen konnten. Endlich mündete der Tunnel in eine hohe, langgestreckte Galerie, eine Art Treppenhaus, nach dessen oberster Stufe nochmals ein kurzer Engpaß folgte, der sich als Gang und Eingang zum Zentrum erwies. Ich stand in der Königskammer, ich stand in der Grabkammer, die in Wahrheit keine Kammer, sondern ein kleiner Saal ist, ein Grabsaal, leer bis auf den leeren Granitsarg des verschollenen Cheops.
Ich blieb nicht lange, es roch so arg nach Urin, daß ein gemessenes Verweilen nicht in Betracht kam. Auch huschte jetzt ein asiatisches Pärchen herein und sagte Good morning. Ich warf noch einen Blick in den offenen Sarkophag, Kaugummis, eine zerknüllte Tampaxschachtel, ich kroch zurück ans Licht.
Es war schon später, als ich geglaubt hatte, es blieb mir keine Zeit mehr für die zwei anderen Pyramiden und für die Sphinx. Wenn mir die Botschafterin schon eine Audienz gewährte, so durfte ich sie weder warten lassen noch in verschwitztem und verstaubtem Zustand vor sie treten. – Antreiben mußte ich den Taxifahrer nicht, er fuhr so mörderisch wie alle, und ich hatte im Hotel noch Zeit genug, mich zu duschen und die Kleider zu wechseln. Ich hätte sogar noch etwas essen und trinken können, glaubte aber, da ich auf dreizehn Uhr geladen war, an einen kleinen Imbiß oder Umtrunk auf der Botschaft.
Sie lag nur wenige Fußminuten vom Hotel entfernt, ich fand sie auf Anhieb, obwohl man die schneeweiße und durchaus stattliche Villa aus kolonialen Zeiten leicht übersehen kann, da sie von den umstehenden Gebäuden überragt und insbesondere von der direkt neben ihr sich erhebenden ARAB INVESTMENT BANK förmlich erdrückt wird. Und da sie zudem von der brodelnden Straße zurückversetzt und vom einzigen Grün weit und breit umgeben ist, erscheint sie vollends als Insel und sonderbares Relikt, verloren, unwirklich fast. Umso eigensinniger, so schien es mir, blähte sich die auf der hellblauen Holzbalustrade aufgepflanzte Schweizerfahne im Wind der Gegenwart.
Als der ägyptische Wachmann, der in einer verglasten Loge zwischen dem äußeren und dem inneren Gitterportal saß, bemerkte, daß ich Einlaß begehrte, plauderte er noch ein wenig mit einem Kollegen, ehe er auf den Knopf drückte, der die Verriegelung des äußeren Tores öffnete, das gleich nach meinem Passieren wieder zuschnappte. Ich war jetzt gefangen, mußte Rede und Antwort stehen und meinen Paß durch einen Schlitz schieben. Der Wachmann studierte ihn und telefonierte dann lange mit dem Inneren der Botschaft, worauf er mir mit Knopfdruck das zweite Gittertor öffnete. Ich eilte über den Vorplatz, ich hatte aufgrund der Schleuse rund zehn Minuten Verspätung und nahm auf der Freitreppe zwei Stufen auf einmal. Die Eingangstür war angelehnt, ich stieß sie zögernd auf und kam in ein geräumiges Entree. Links und rechts befand sich je ein Büroraum hinter Glas. Ich trat zum rechten hin, da ich nur dort jemanden sah, eine junge Frau, die sich erhob, zum Schalter kam und mich mit Namen begrüßte. Sie sagte, die Frau Botschafterin sei im Moment noch besetzt, wies auf den Tisch und die Stühle in der Ecke des Vorraums und bat mich, noch ein wenig Platz zu nehmen. Ich setzte mich, stand aber gleich wieder auf, als ich ein Anschlagbrett entdeckte. Die Mitteilungen, die ich überflog, richteten sich an die Mitglieder der hiesigen Schweizerkolonie, hatten aber keinen amtlichen Charakter, sondern verwiesen auf private Veranstaltungen und Aktivitäten. Auf einem der Blätter, einem ziemlich veralteten offenbar, las ich, daß es nach den jüngsten Erfolgen unserer Fußballnationalmannschaft an der Zeit sei, auch hier in Kairo Farbe zu bekennen und die bereits bestehenden Teams von Italien und Holland herauszufordern. Gesucht würden deshalb elf senkrechte Männer, vorzugsweise Schweizer, die Kampfgeist und Kameradschaftssinn hätten. – Ich las nicht weiter, setzte mich wieder und dachte an meinen Vorfahren, um dessentwillen ich hier war und der das unermeßliche Glück gehabt hatte, in einer Zeit zu leben, in der es zwar mancherlei Seuchen gab, aber wenigstens keinen Sport.
Nach einer Viertelstunde war es soweit, und die Botschaftssekretärin führte mich über eine Steintreppe ins Obergeschoß, klopfte dort an eine halboffene Tür, wartete das Ja ab und meldete mein Hiersein. Die Botschafterin empfing mich nicht herzlich, aber höflich. Sie war etwa Mitte fünfzig und wie erwartet von gepflegter und gesetzter Erscheinung und mittelkühler Aura. Zwischen den beiden schwarzledernen Polstersesseln, auf denen man Platz nahm, stand ein Glastisch, auf dem in einer farblosen Klarsichthülle der Brief lag, in dem ich der Botschafterin die Gegebenheiten, soweit sie mir bekannt waren, geschildert, mein Vorhaben skizziert und sie um ihre Hilfe gebeten hatte. Die Botschafterin fragte, ob ich mich in Kairo schon etwas umgesehen hätte. Ja, sagte ich, ich sei noch ganz benommen von den ersten Eindrücken, vor allem von den Pyramiden, die so aufreizend unerschütterlich im Strom der Zeit stünden, während unsereins von ihm fortgerissen … – Ich brach ab vor Schreck über den zutraulichen Schwulst, und die Botschafterin räusperte sich und sagte dann: Sie suchen hier also nach Spuren Ihres Großvaters. – Meines Ururgroßvaters, sagte ich. – Sie warf einen raschen Blick auf meinen Brief. – Ja, richtig, sagte sie, das ist ja eine schöne Weile her. – Ich gab ihr recht und meinte, daß eben dieser Umstand die Nachforschungen erschwere. – Dabei schaute ich hinüber zum großen Schreibtisch, auf dem sich Berge von Dossiers stapelten – warum zögerte die Botschafterin mit der Aushändigung der Akte meines Ururgroßvaters? – Die Botschafterin, als ahne sie, was in mir vorging, sah jetzt schon den Zeitpunkt gekommen, das Ende der Audienz einzuleiten, indem sie mir zu erkennen gab, daß sie solche Familiengeschichten überaus interessant finde, daß aber mit Anliegen wie den meinigen nicht sie selbst, sondern der Konsul sich befasse und sogar schon befaßt habe, er stehe mir jetzt zur Verfügung. – Und damit wußte ich nach acht Minuten einerseits, daß ich entlassen war, und andrerseits, daß ich empfangen worden war, obwohl ich keine Sache von eidgenössischem Belang verfolgte.
Der Konsul empfing mich nicht herzlich, aber freundlich. Ich sah, daß er eine farblose Klarsichthülle vor sich auf dem Schreibtisch liegen hatte, in der sich eine Kopie meines Briefes an die Botschafterin befand. Wie sich zeigte, war der Konsul meinen Fragen auf gründliche und hilfsbereite Weise nachgegangen und hatte alles in Erfahrung gebracht, was über meinen Ururgroßvater mit den Mitteln der Botschaft in Erfahrung zu bringen war, nämlich so gut wie nichts. Einzig in einem Buch mit dem Titel CENT ANS DE VIE SUISSE AU CAIRE, erschienen in den vierziger Jahren in Alexandrien, war der Konsul auf eine Erwähnung meines Vorfahren gestoßen: Arrivé en Egypte aux environs de 1850, après de solides études, Henri Bluntschli de Zurich fut chargé par le Gouvernement Egyptien de la direction des Salines gouvernementales. – Henri Bluntschli mourut au Caire en 1901. Il avait quatre fils et deux filles. – Das war mager und mir bereits bekannt, so bekannt wie die Tatsache, daß Heinrich nur während fünf von fünfzig Jahren, die er an den Ufern des Nils verbracht hatte, Generaldirektor der ägyptischen Salzwerke gewesen war, aber ich machte ein freudiges Gesicht, und dies fiel mir umso leichter, als im gleichen Augenblick ein dunkelhäutiger Dienstbote mit einem Tablett eintrat, auf dem ein Glas Orangensaft stand. – Was Ihre Frage nach möglichen noch hier lebenden Nachkommen Ihres Ururgroßvaters betrifft, sagte der Konsul, nachdem er das Glas vom Tablett genommen und einen Schluck getrunken hatte, so ist das Ergebnis meiner Nachforschungen negativ. Was nicht heißen muß, sagte der Konsul, daß es nicht irgendwo auf der Welt noch Nachkommen gibt, immerhin hatte der Mann sechs Kinder. – Ja, sagte ich, nur schon von seinem einzigen Sohn und Kind aus erster Ehe stammen rund zwei Dutzend noch lebende Menschen ab, zu denen ja auch ich gehöre, allerdings heißt von all diesen Leuten niemand mehr Bluntschli, da dieser Sohn nur zwei Töchter – die eine war meine Großmutter – , aber keinen sogenannten Stammhalter hatte. Hingegen besteht die Möglichkeit, daß die Söhne, die der ägyptischen Ehe meines Ururgroßvaters entsprungen sind, ihrerseits wieder Söhne hatten und diese wieder und so fort, weshalb ich auch in der Hoffnung angereist bin, hier in Ägypten einen lebendigen Bluntschli zu finden. – Seine diesbezüglichen Recherchen, sagte der Konsul und schaute auf die Uhr, seien wie erwähnt negativ verlaufen, ob ich sonst noch einen Wunsch hätte. – Ich fragte, ob ich die drei alten Bücher zum Thema Schweizer in Ägypten, die er mir gezeigt habe, zum Studium mit ins Hotel nehmen dürfe. – Eigentlich nicht, sagte er, aber wir wollen eine Ausnahme machen und nicht bürokratisch sein. – Er nahm ein Blatt Papier, schrieb die Titel der drei Bücher darauf, bat mich um meine Unterschrift, bat mich um meinen Paß, den er kopierte, und legte Blatt und Paßkopie in ein farbloses Klarsichtmäppchen. Es war mir bewußt, daß ich den Konsul zu quälen begann, ich fragte ihn aber doch noch, ob er eine Ahnung habe, wo mein im Jahr neunzehnhundertundeins hier verstorbener Ururgroßvater begraben sein könnte. – Er wisse nur, sagte der Konsul, daß es damals noch keinen Schweizer Friedhof in Kairo gegeben habe, aber vielleicht könne mir der hiesige Schweizer Pastor weiterhelfen. – Er schrieb, schon im Stehen, dessen Namen und Telefonnummer auf einen Zettel, geleitete mich hinaus und sagte – so sehr schien ihm der Kopf zu schwirren – : Auf Wiedersehen, Herr Bluntschli.
Nachdem ich mich im nahen Swissair-Restaurant, bedrängt von sechs Kuhglocken, ein wenig gestärkt hatte, ging ich zurück zum Hotel. Auf den Gehsteigen herrschte ein solches Gewimmel, daß Zusammenstöße nur durch ständige Ausweichmanöver vermieden werden konnten, wobei mir auffiel, daß immer ich es war, der ausweichen mußte, während die Einheimischen, als wäre ich Luft, nie auswichen und Platz machten – ein Verhalten, das ich als späten Rachereflex auf jene Zeiten deutete, als sich die europäischen Herren, worunter gewiß auch mein Heinrich, den Weg durch die Einheimischen mit Stockhieben bahnten. Im Hotel begann ich sofort in den ausgeliehenen Büchern zu blättern, und mit Freude stieß ich schon bald auf den Hinweis, daß die in Kairo gestorbenen Schweizer Protestanten bis zum Ersten Weltkrieg auf dem protestantischen englischen Friedhof beigesetzt worden seien, dann aber infolge vermehrten Eigenbedarfs der Engländer kein weiteres Gastrecht mehr hätten genießen können. Ich rief noch am gleichen Abend den Schweizer Pastor an, stellte mich kurz vor und fragte ihn, ob er wisse, wo sich der protestantische englische Friedhof befinde, falls er überhaupt noch existiere. Der Pastor war sehr nett und wußte es nicht, verwies mich aber an die zwei Schweizer Inhaber einer Kairoer Buchhandlung. Der Vater, neunzig, lebe seit seiner Jugend hier und wisse viel von früher, der Sohn verwalte den Schweizer Friedhof.
Am anderen Morgen, nach schlechtem Schlaf und Ahnenträumen, suchte ich die Buchhandlung auf und sah mich – obwohl nicht angemeldet und den Herren ein Fremdling – aufs liebenswürdigste empfangen. Sie wußten um die letzte Ruhestätte der frühen Schweizer, kannten sogar die genaue Lage, meinten aber, es sei mir auch mit Hilfe des Stadtplans unmöglich, den protestantischen englischen Friedhof allein zu finden. Sie boten mir an, Mahmud, ihren zuverlässigsten Mitarbeiter, gründlich zu instruieren und mir als Führer mitzugeben.
Am liebsten wäre ich gleich aufgebrochen, ein unruhiger Eifer, ein Fieber fast schien mich befallen zu haben, aber im Orient wird nichts überstürzt, wir fuhren zwei Tage später. Mahmud, ein Ägypter nubischer Abkunft, hochgewachsen und kräftig, zuvorkommend auf zurückhaltende Art, steuerte den Wagen auf die endlose Corniche, der er in südlicher Richtung folgte. Rechterhand – braun, ungeheuerlich und abgeklärt – der Nil. Wenige Minuten nach dem Passieren des Aquädukts, der ihn, den Nil, seit Saladins und noch zu Bluntschlis Zeiten mit der Zitadelle verband, bog Mahmud nach links ab, hielt irgendwo an, stieg aus, erkundigte sich, fuhr weiter, hielt an, erkundigte sich. Schließlich ließ er den Wagen stehn, die ungepflasterten Straßen gehörten den Eselskarren, und wir suchten zu Fuß, und Mahmud fragte hier und fragte dort, und eine Frau mit blutigem Messer in der Rechten griff sich, während sie antwortete, mit der Linken zwei Täubchen aufs Mal aus dem Käfig, bog ihnen die Hälse nach hinten, durchschnitt ihre Kehlen und warf sie in ein Blechfaß, und Hunde folgten uns, räudige, sandgelbe, die, sobald wir uns umdrehten, stehenblieben und ihr Geschlecht benagten, und ein Fleischer schien den Friedhof zu kennen, denn er zeigte mit seinem Beil in eine bestimmte Richtung, bevor er damit auf einem dreibeinigen Holzblock den Kopf einer Ziege zerteilte, indem er zuerst die Hirnschale abschlug, dann mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger das Gehirn herausklaubte, dann den Schädel mit einem Längs- und einem Querhieb spaltete. Wir passierten tote und lebendige Baustellen und Hinterhöfe, Mahmud fragte sich durch, und seine Frage löste Gegenfragen aus und zog auch Ungefragte an, die wissen wollten, was wir wissen wollten, und plötzlich standen wir vor einer Mauer, und Mahmud sagte: Here we are.
Er klopfte an ein Eisentor, es tat sich nichts. Er schlug daran und rief. Es wurde uns aufgetan. Der Friedhofswärter, ein Gnom mit türkisfarbenem Hütchen, nickte, während ihm Mahmud mein Anliegen vortrug, so heftig, daß ich den Eindruck gewann, nichts sei ihm vertrauter als Heinrichs Grab. Aber als er uns dann eingelassen hatte, zeigte er nur vage auf die linke Hälfte des knapp fußballfeldgroßen Friedhofs, wo auf grasloser Erde, spärlich beschattet von vereinzelten Palmen und Akazien, vielleicht hundert verwitterte Grabmäler windschief herumstanden. Die andere Hälfte war vom saftigsten Rasen bewachsen, dort lagen die Engländer in Reih und Glied unter niederen weißen Steinen. Ich bat Mahmud, den Wärter zu fragen, ob auf diesem Friedhof überhaupt noch Gräber aus der Zeit der Jahrhundertwende zu finden seien. Der Wärter wußte es nicht, er wußte nur, daß sich die ältesten und vor kurzem abgeräumten genau dort befunden hatten, wo wir jetzt standen.
Die Erde war weich hier und von einem seltsamen Hellviolett wie überhaucht. Der Gnom entfernte sich, Mahmud und ich begannen, jeder für sich, zu suchen, und wenn Mahmud auf einen Namen stieß, der irgendeine Ähnlichkeit mit dem Namen Bluntschli zu haben schien, so winkte er mich heran, und ich eilte mit Herzklopfen hin, um festzustellen, daß Mahmud nur einen Balzli oder einen Schlumpf gefunden hatte – immerhin zwei unverkennbar schweizerische Namen. Nach einer halben Stunde hatte ich den Überblick: Die meisten Grabsteine und Grabkreuze erinnerten an Engländer, zum Teil auch an Deutsche, die in der ersten Jahrhunderthälfte gestorben waren; rund zwölf andere konnte ich aufgrund der Namen oder sonstiger Hinweise – wie etwa der Inschrift SEIN LEBEN WAR ARBEIT – als schweizerisch identifizieren, wobei das älteste dieser Gräber aus dem Jahr neunzehnsieben stammte. Da es nahe der abgeräumten Zone lag, nahm ich an, daß die dortigen Gräber noch einige Jahre älter gewesen waren und daß sich darunter auch das meines Ururgroßvaters befunden haben mußte. Ich war also ein paar Monate, vielleicht nur ein paar Wochen zu spät gekommen, man hatte hier, während ich in den Archiven Zürichs saß und Spuren suchte, das wohl massivste Zeugnis seines Dagewesenseins entfernt.
Da rief Mahmud, der meine Betrübnis gespürt und sich ein wenig zurückgezogen hatte, hinter einem Maulbeerfeigenbaum hervor, ich solle kommen. Am Maulbeerfeigenbaum lehnte ein Grabsteinfragment in der Form eines stehenden Trapezes. Es war, von mir aus gesehen, der linke Teil des von links oben nach rechts unten diagonal zerbrochenen Steins, und zu entziffern war Folgendes:
HEINR
18
FERN DER H
VEREINT IN
Ich war überzeugt und ergriffen im ersten Moment, dann kamen mir Zweifel. Gewiß, hier handelte es sich um einen HEINRICH, um einen Heinrich zudem, der wie der meinige um 18soundso geboren worden war, nur, ich wußte es, gab man in jener Zeit fast jedem dritten Schweizerknaben diesen Namen, und auch im deutschen Nachbarland war er gebräuchlich. Noch skeptischer hingegen stimmte mich die Grabinschrift. Das mit H beginnende Wort hieß HEIMAT, daran war nicht zu rütteln. Und in was konnte man fern der Heimat VEREINT sein? IN LIEBE? IN TREUE? Vielleicht IN GOTT? – So oder so, der Spruch zeugte von inniger Verbundenheit mit dieser Heimat und von der Gewißheit, vereint zu sein mit den Dortigen. Dies aber paßte nicht zu Heinrich, es paßte nicht zu den fatalen Umständen, unter denen er als junger Mann die Heimat verlassen hatte, und nicht zu jenen, die er sich in Ägypten schuf und die ihm die Fühlung mit ihr entbehrlich zu machen schienen. Aber ich konnte mich irren, es war mir ja bekannt, daß es in seinen späten Lebensjahren wieder Berührungen gab, und wer kann wissen, wie nahe seinem Herzen, als es ans Sterben ging, das früh Verlorene und scheinbar Abgetane rückte? Jedenfalls war keine Gewißheit zu haben ohne die fehlende Hälfte des Grabsteins, und Mahmud fragte den Friedhofswärter, der sich in Erwartung des Bakschischs seit längerem in unserer Nähe aufhielt, wo diese Hälfte hingekommen sei. Der Wärter wußte es nicht. Ich drückte ihm zur Ermunterung zwei ziemlich große Scheine in die Hand, er wußte es trotzdem nicht, er verbeugte sich nur.
2
Obwohl der Pfarrer daneben stand, um das Abladen der Fäßchen zu überwachen, fiel eines vom Karren und schlug leck. Der Pfarrer, unbeherrscht seit je, fluchte wie ein Fuhrknecht, die Fuhrknechte schwiegen und stierten auf die rote Pfütze und auf die rasch versickernden Rinnsale um sie herum. Als die herbeigeschriene Dienstmagd, zwei Krüge an jeder Hand, auf dem staubigen Hof vor der Pfarrscheune eintraf, gab das Fäßchen schon nichts mehr her, und Stille machte sich breit. Und die Schläfenadern des Pfarrers waren so ausgeprägt, daß die Fuhrleute sowohl ihren Taglohn als auch ihr Trinkgeld samt Speis und Trank verloren sahen. Da beugte sich die Magd über das lädierte Fäßchen, klopfte mit dem Knöchel daran – es tönte hohl – und sagte mit einer Stimme, die noch hohler tönte: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen. – Worauf der Pfarrer, zur Verwunderung aller, das flammende Schwert aus der Hand fallen ließ und zu glucksen begann, so daß sich die Helfer und Gaffer ihrerseits nicht länger bezähmen konnten. In der Mitte des Aufruhrs aber stand Beth, die fromme, schwerhörige Magd, und da sie, was vorging, nicht recht verstand, suchte sie die Augen des Pfarrers, und der Pfarrer sah es und gebot mit einer Handbewegung Ruhe. – Macht fertig, sagte er mild, die Tafel wartet.
Umständehalber und ausnahmsweise hatte er in diesem Jahr, zusätzlich zu den elf Eimern, die ihm als Teil seiner Naturalbesoldung zustanden, noch weitere vierzehn Eimer angefordert. Macht zusammen fünfundzwanzig Eimer, macht zusammen, da ein Eimer damals und in jener Gegend einer Flüssigkeitsmenge von einhundertundzehn Litern entsprach, zweitausendsiebenhundertfünfzig Liter, ein unerhörtes Quantum. – Woher dieser Bedarf? Wohl liebte der Pfarrer – es war kein Geheimnis im Sechshundertseelendorf – den Wein, wohl war er ein eifriger Jäger, der nach jeder Treibjagd nicht nur die Schützen, sondern auch alle Treiber in seine Trottstube lud, nur: neu waren diese Umstände nicht, es wurde immer schon, seit seiner Amtseinsetzung vor einem Jahrzehnt, großzügig aus- und eingeschenkt in der Pfarrei, und trotzdem hatten die jährlichen elf Eimer immer, fast immer ausgereicht.
Ein anderer Umstand war neu. Seit einigen Monaten gab es keine Frau Pfarrer mehr, der Pfarrer lebte allein im stattlichen Pfarrhaus, einem zweigeschossigen, traufständigen Giebelbau, der heute noch, doch davon später, steht, und während der Pfarrer im Vorjahr, um die eheliche Disharmonie und Mißstimmung der Gemüter ertragen zu können, häufiger als üblich zum Krug gegriffen hatte, so tat er es jetzt, nach Barbaras Auszug, noch energischer, einerseits um sich von der Mühsal seiner Ehe, die zwei Dezennien gedauert hatte, zu erholen, andererseits um die Stille im Haus auszuhalten, drittens und vor allem aber in der Hoffnung – er war fast fünfzig – , sich zu verjüngen, denn seine Zukunft, die schon ein bißchen begonnen hatte und Margaretha hieß, erforderte Mut und Glut.
Wie auch immer, der Vorrat schmolz, und wäre die Tür zum Weinkeller nicht verriegelt und der Schlüssel versteckt gewesen, so hätte er womöglich den Verdacht gehabt, der treue Stallknecht Melchior genieße heimlich mit. Doch Melchior, der das Versteck seit langem kannte, blieb unbehelligt und bediente sich. – Jedenfalls drohte ein Engpaß, und der Pfarrer, geplagt von der Vorstellung, Mangel zu leiden, sah sich gezwungen, sein Kontingent gehörig aufzustocken und auf vorzeitiger Lieferung zu bestehen. Die Kosten kümmerten ihn, aber in seinem Taschenbüchlein hatte er schriftlich ausgerechnet, wie teuer ihn seine eßlustige Frau im Jahresdurchschnitt zu stehen gekommen war, nämlich nicht sehr viel billiger als vierzehn Eimer Wein. Allerdings berücksichtigte diese Rechnung nicht, daß er sich vor dem Ehegericht dazu verpflichtet hatte, ihr nach der Scheidung alljährlich die Summe von einhundert Gulden zu entrichten. Die Dorfhebamme verdiente im gleichen Zeitraum zwölfeinhalb, der Totengräber elf Gulden, der Pfarrer zirka fünfundsiebzig, so daß er den richterlich ratifizierten Betrag, für den der Schindelmacher viermal mehr Eichenschindeln hergestellt hätte, als für die kürzlich vorgenommene Neudeckung des Kirchturms nötig gewesen waren, und ohne den seine fünf Jahre ältere und kinderlos gebliebene Barbara niemals gewichen wäre, der Schatulle entnehmen mußte, in der sein väterliches Erbe lag. Darüber führte er gesondert Buch. Er tat es im Bewußtsein, daß er dem seligen Vater Salomon, Steinmetz und Steinwerkmeister, Mitwirkender und Mitverdiener am gewaltigen Bau des Waisenhauses in der Kantonshauptstadt, so ziemlich alles verdankte, am meisten aber die freie Bahn zum späten Glück, das Margaretha hieß.