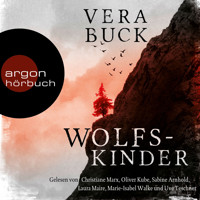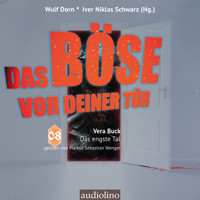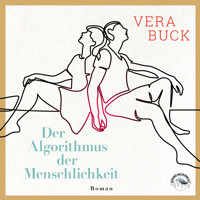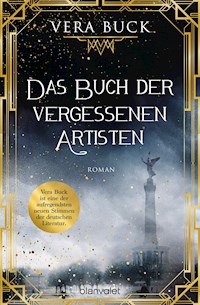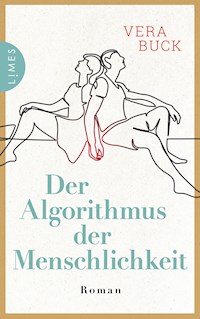
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über die Grenzen zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz – eine Geschichte über das, was das Menschsein ausmacht.
Wer Mari begegnet, dem fällt auf, dass sie intelligent ist und fast gespenstisch makellos. Aber auch, dass sie Witze nicht versteht, und alles sehr rational sieht. Und wer sie besser kennenlernt, dem fällt auf, dass Mari weder Schlaf noch Nahrung braucht. Denn Mari ist nur fast ein Mensch. Ihre künstliche Intelligenz lernt ständig dazu, um eine Aufgabe zu erfüllen: den Menschen glücklich zu machen. Doch als Mari nach einer unglücklichen Verkettung von Umständen mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen Menschen, darunter der rebellischen Bloggerin Frieda und dem einsamen Studenten Linus, in einer Berliner Wohnung landet, erkennt sie, dass ihre Aufgabe alles andere als einfach ist. Die Welt folgt ihrer eigenen Logik, die Wünsche der Menschen sind irrational, und Mari muss begreifen dass es eine Welt jenseits der beweisbaren Fakten gibt. Wie soll sie Wesen glücklich machen, die keine Ahnung haben, was sie wollen? Doch dann kommt sie auf eine Lösung, mit der kein Mensch gerechnet hätte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Wer Mari begegnet, dem fällt auf, dass sie intelligent ist und fast gespenstisch makellos. Aber auch, dass sie Witze nicht versteht, und alles sehr rational sieht. Und wer sie besser kennenlernt, dem fällt auf, dass Mari weder Schlaf noch Nahrung braucht. Denn Mari ist nur fast ein Mensch. Ihre künstliche Intelligenz lernt ständig dazu, um eine Aufgabe zu erfüllen: den Menschen glücklich zu machen. Doch als Mari nach einer unglücklichen Verkettung von Umständen mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen Menschen, darunter der rebellischen Bloggerin Frieda und dem einsamen Studenten Linus, in einer Berliner Wohnung landet, erkennt sie, dass ihre Aufgabe alles andere als einfach ist. Die Welt folgt ihrer eigenen Logik, die Wünsche der Menschen sind irrational, und Mari muss begreifen dass es eine Welt jenseits der beweisbaren Fakten gibt. Wie soll sie Wesen glücklich machen, die keine Ahnung haben, was sie wollen? Doch dann kommt sie auf eine Lösung, mit der kein Mensch gerechnet hätte …
Die Autorin
Vera Buck, geboren 1986, studierte Journalistik in Hannover und Scriptwriting auf Hawaii. Während des Studiums verfasste sie Texte für Radio, Fernsehen und Zeitschriften, später Kurzgeschichten für Anthologien und Literaturzeitschriften. Nach Stationen an Universitäten in Frankreich, Spanien und Italien lebt und arbeitet Vera Buck heute in Zürich. Ihr Debütroman »Runa« (im Taschenbuch »Runas Schweigen«) wurde für den renommierten Glauser-Preis nominiert und, wie auch der Nachfolger »Das Buch der vergessenen Artisten«, von Lesern und der Presse hoch gelobt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.instagram.com/blanvalet.verlag
VERABUCK
Der Algorithmus der Menschlichkeit
Roman
Das Zitat auf Seite 249 stammt aus Douglas Adams »Das Restaurant am Ende des Universums«, Kein & Aber AG Zürich, S. 170Das Zitat auf Seite 323 stammt aus Antoine de Saint-Éxupéry »Der kleine Prinz«, Aura Books 2015, S. 100 f.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright der Originalausgabe © by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Angela KüpperUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Valenty; Paladin12)JB · Herstellung: samSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-6412-6457-4V002www.limes-verlag.de
Für den Menschen. Weil ihr vollständige Mysterien seid.
Das gilt vor allem für Frauen.
Gottseins Gnade
Als Dr. Thaddaeus Gottsein in den Besucherraum der Haftanstalt trat, hatte er tatsächlich etwas von einer himmlischen Erscheinung. Sehr prominent stand er plötzlich da, vom Neonlicht des Getränkeautomaten umrahmt wie von einem Heiligenschein. Das Licht ließ die ergrauenden Haare leuchten, das rein gewaschene Hemd und die Turnschuhe, die so sauber waren, weil Gottsein bis vor Kurzem nur Klinikflure mit ihnen entlanggelaufen war. Lediglich sein Bart war noch nicht so lang, wie man es nach der Betrachtung entsprechender Bilder hätte erwarten können, und seine Jeans wirkte wenig göttlich. Sie wirkte auch nicht ärztlich. Was der Hauptgrund war, warum Gottsein sie trug.
Während alle Welt nach denen fahndete, die möglicherweise in Gottseins vorübergehende Ermordung involviert gewesen waren, hatte er selbst etwas ganz anderes zu finden versucht, nämlich sich selbst in einer Meditations-App. Es war sicherlich nichts falsch an seiner Tätigkeit als Arzt gewesen. Gottsein hatte viele Leute glücklich gemacht, einschließlich sich selbst, seiner Frau und ihres gemeinsamen Bankkontos, für eine Zeit. Aber wenn im Leben erst mal etwas in Schieflage gerät, wenn man zum Beispiel stirbt und dann wiederaufersteht, wie es bei Gottsein der Fall war, dann verändert dieser schiefe Winkel die Perspektive sehr umfassend. Selbst das, was vorher noch nach Ordnung aussah, wirkt mit einem Mal windschief und verzogen und muss neu ausgelotet werden. Und das tat Gottsein im Moment.
Weil er bereits geahnt hatte, wie viel Zeit solch eine Neuauslotung brauchte, hatte er sich selbst von der Arbeit freigestellt. Und seine Frau, die schon immer seine größte Unterstützung im Leben gewesen war, hatte auch diesmal gewusst, was ihr Mann am meisten brauchte, und ihn ebenfalls freigestellt. Als Gottsein nach seinem Krankenhausaufenthalt sehr zittrig die Haustür im heimischen München aufgeschlossen hatte, hatte in der Schlüsselschüssel aus Porzellan ein sorgsam beschrifteter Zettel mit einer Nachricht an ihn gelegen: »Dreckhammel verdammter, du g’hörst mit der Scheißbürst’n ausg’haun.«
Gottseins Frau hatte die Koffer und Kinder gepackt und ihn verlassen. Von allem, was es im Haus zuvor an Leben und Lebendigem gegeben hatte, hatte sie nur den Hund dagelassen. Man könnte das für umsichtig halten, denn jeder weiß ja, dass Tiere einen Instinkt für aus dem Lot geratene Situationen haben. Aber Gottseins Frau hatte den Hund dagelassen, weil sie ihn nie gewollt hatte.
Gottseins Hund war Gottseins Hund. Er hatte ihn eines Tages als Überraschung für die Familie mitgebracht, weil eine Familie in seinen Augen einen Hund brauchte und umgekehrt. Was er dabei nicht bedacht hatte, war, dass ein Hund auch jemanden braucht, der dreimal am Tag mit ihm spazieren geht und der ihn davon abhält, die Schuhe anzukauen und die Wohnzimmerkissen vollzuhaaren, und der überhaupt sehr viel putzt und sprüht, um die entsprechenden Spuren und Gerüche zu verwischen, die ein Hund eben so mit sich bringt. Ein Hund kann den optischen Eindruck vermitteln, er sei ein Meerschwein. Er kann so wenig wie ein Wolf aussehen, wie er will. Sobald er einem warm ins Gesicht hechelt, weiß man eben doch, wie es um die Verwandtschaftsverhältnisse steht.
Gottseins Hund jedenfalls sah nicht aus wie ein Meerschwein, sondern wie eine beinahe reinrassige Deutsche Dogge. Und er schiss auch so. Wenn Gottsein mit ihm spazieren ging, nahm er nun immer eine Schaufel mit und einen Plastiksack, der etwas größer war als die von der Stadt bereitgestellten Normsäckchen für Hundehaufen. Gottsein sah es als Zeichen. Sein Weg zur Läuterung war steinig, führte durch den Englischen Garten und war mit Hundekot besät.
»Der Hund darf hier aber nicht rein«, sagte der Beamte an der Tür zum Besucherraum. Also sprach Gottsein: »Sitz. Du sollst sitzen.«
Und dann betraten er und der Beamte den Besucherraum, während der Hund noch immer interessiert vor der Scheibe stand, als sei er ein Besucher in der Neugeborenenstation.
Gottsein setzte sich vor Mari an den Tisch wie einer, der es gewohnt war, sich vor einen Patienten zu setzen. Er lehnte sich zurück und betrachtete sie aufmerksam, und fast erwartete Mari, dass er gleich eine Patientenakte zücken würde. Dass er fragen würde: Was fehlt uns denn? Oder: Wie geht es uns denn heute? Doch stattdessen sagte Gottsein: »Da sind wir also.« Die Banalitäten, mit denen die Menschen ihre Gespräche eröffneten, machten auch vor Bildungsschichten keinen Halt.
Mari lächelte ebenso unverbindlich interessiert wie der Hund draußen vor der Scheibe. Sie hegte keinen Groll gegen den Doktor. Sie hatte Gottsein umgebracht und dann wiederbelebt, was mehr war, als man im Durchschnitt gegen und für jemanden unternahm. Die eine Tat glich die andere aus.
»Wie geht es uns denn heute?«, fragte sie, um ihm den Einstieg zu erleichtern. Und dann erzählte Gottsein. Er erzählte nicht nur, wie es ihm heute ging, sondern auch, wie es ihm in den letzten Wochen gegangen war und in den Monaten und Jahren davor, in den »Frevlerjahren«, wie er sich ausdrückte, und damit meinte er nicht nur seine unterdrückten pädophilen Neigungen, sondern auch den falschen Ehrgeiz bei der Arbeit und die verpasste Zeit mit seiner Familie. Er redete von dieser Zeit tatsächlich so, als stamme sie aus einem anderen Leben. Als habe Mari ihn bei der Reanimation nicht nur wieder-, sondern gleich neubelebt.
»So eine zweite Chance bekommt nicht jeder«, sagte er immer wieder, und dass Mari ihn auf einen neuen Weg gebracht habe. Einen Weg nämlich, dessen Rand nicht nur von ein Pfund schweren Hundehaufen gesäumt war, sondern auch von Religionen.
Gottsein war, nach menschlichen Maßstäben, immer ein recht rationaler Mann gewesen. Einer, der Religion für eine Erfindung gehalten hatte, die nach und nach von der Gegenwart eingeholt und verdrängt sein würde, höchstens noch aufrechterhalten von hoffnungslosen Nostalgikern – in etwa so, wie es mit Schallplatten oder VHS-Videokassetten oder dem Schuhlöffel passiert war.
Aber wie sollte einer, der selbst von den Toten auferstanden war, sich jetzt noch gegen Jesus wehren? Und wenn diese Sache mit Jesus stimmte, wie konnte man sich dann sicher sein, dass nicht auch das mit Gott und Allah und Brahma, Vishnu und Shiva und vielleicht sogar Zeus und den fünf Geschwistern von Zeus und den zehn göttlichen Kindern von Zeus stimmte? Nach ausführlicher Beschäftigung mit den verschiedensten Glaubensrichtungen, nach Besuchen von Kirchen, Tempeln und Moscheen war Gottsein zu dem Schluss gekommen, dass man nicht wissen konnte, welche Religion die einzig wahre war. Und dass man, um keinen Fehler zu begehen, allen Göttern und Propheten eine Chance geben müsse. Natürlich gab es da ein paar Lehren, die sich ausschlossen. Das christliche Gebot, man dürfe keine anderen Götter neben Gott haben, war zum Beispiel so ein Problem. Aber wenn man diese Misshelligkeiten rausrechnete, gab es immer noch genügend Gebote und Bestimmungen, nach denen sich leben ließ. Gottsein war polyreligiös geworden, das hieß, seine Verrücktheit hatte sich verschoben. Als Nächstes wollte er übrigens nach Nigeria reisen, um sich dort mit dem Glauben afrikanischer Naturreligionen zu befassen.
»Nach Nigeria?«, fragte Mari.
»Genau.«
»Haben Sie sich das gut überlegt?«
»Es gibt da eine sehr interessante Religion, die sich Juju-Glauben nennt.«
»Und über die können Sie im Internet nicht vielleicht einfacher Informationen finden?«
Gottsein lächelte. »Natürlich muss man rechts, links ein wenig aufpassen«, sagte er, als handele es sich bei Nigeria um einen Zebrastreifen, »aber statistisch gesehen passieren die meisten Unfälle ja auch gar nicht auf Reisen, sondern im eigenen Haushalt.«
Mari hielt es generell für einen erfreulichen Ansatz, dass ein Mensch auf die Idee kam, sein verzerrtes Weltbild durch Statistiken zu objektivieren. Noch erfreulicher wäre es allerdings gewesen, wenn die Statistik zur Sachlage gepasst hätte. Dass Gottsein in Nigeria nicht beim Putzen verunglücken würde, bedeutete schließlich nicht, dass es der bestmögliche Ort für seine persönliche Sicherheitslage war. Ganz abgesehen davon, dass ein Zusammenstoß mit Boko Haram mit höherer Wahrscheinlichkeit tödlicher endete als der Zusammenstoß mit der hauseigenen Heckenschere. Statistisch gesehen.
»Es ist jedenfalls interessant, dass ausgerechnet Sie sich um meine Sicherheit sorgen«, sagte Gottsein. »Wo Sie mich doch selbst schon mal umgebracht haben.«
»Ich habe Sie auch wiederbelebt.«
»Das haben Sie.«
»Außerdem wollte ich Sie nicht umbringen. Ich wollte Sie nur in angemessenem Maße stark verletzen.«
»In angemessenem Maße …«, murmelte Gottsein und blickte auf seine gefalteten Hände im Schoß. Er hatte einen Weg gefunden, wie er gleichzeitig die Hände falten und die Spitzen von Daumen und Zeigefinger zusammenlegen konnte. Dann räusperte er sich. »Ich bin jetzt in Therapie, wissen Sie? Wegen meiner … Neigungen.«
Das hielt Mari für eine ausgezeichnete Idee.
»Die Spaziergänge mit meinem Hund helfen auch. Und die Gespräche mit ihm. So viel wie mit ihm derzeit habe ich nicht mal mit meiner Frau gesprochen.«
Sie blickten zur Glastür. Vor der platt gedrückten Hundenase hatte sich ein weißer Atemkreis gebildet.
»Was machen Sie mit Ihrem Hund, wenn Sie nach Nigeria gehen?«, fragte Mari.
»Höchstwahrscheinlich nehme ich ihn mit.«
»Höchstwahrscheinlich ist das eine schlechte Idee.«
»Warum?«
Mari überlegte, ob sie mit ihrer Erklärung bei den Giftschlangen, den Löwen oder doch bei dem nigerianischen Festival anfangen sollte, bei dem alljährlich Hunderte Hunde geköpft, gegrillt und verspeist wurden, nachdem man ihr Blut zuvor auf Götterstatuen gesprenkelt hatte. Sie entschied sich für Letzteres. Religion war ja gerade ein angesagtes Interessengebiet bei Gottsein.
»Das ist ja barbarisch!«, keuchte Gottsein. »Die essen da wirklich Hunde?«
Es war aus rationalen Gesichtspunkten nicht einleuchtend, warum es weniger barbarisch war, Schweine, Hühner oder Kälber zu köpfen und ihre Körperteile, einzeln eingeschweißt und tiefgefroren, in alle Himmelsrichtungen zu verteilen. Aber Mari hatte gelernt, dass da kulturelle Unterschiede vorlagen. Und wo der Mensch seine Kultur hatte, brauchte man ihm mit Vernunftfragen nicht zu kommen.
»Wo soll ich denn dann mit ihm hin?« Gottsein wandte sich erneut der Glastür zu. Der Kreis vor der Hundeschnauze war inzwischen groß und undurchsichtig geworden. Nur noch die silbergrauen Ohren waren zu sehen. »Meine Frau ist mit den Kindern verschwunden, und der einzige Mensch, mit dem ich im Moment noch zu tun habe, ist mein Therapeut. Aber der hat eine Tierhaarallergie. Es sei denn … Denken Sie, es wäre möglich, dass Sie sich um ihn kümmern?«
»Ich?«
»Er ist ein sehr artiger Hund«, log Gottsein.
»Ich sitze in Untersuchungshaft.«
»Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Katzen jetzt in einigen Gefängnissen erlaubt sind. Wegen des therapeutischen Effekts.«
»Ich habe hier noch keine Katzen gesehen.«
»Niemand hat mehr Therapieerfahrung als dieser Hund, glauben Sie mir. Er ist quasi eine wandelnde Therapiecouch.«
»Aber ich brauche keine Therapie.«
»Das habe ich früher auch gedacht. Bevor ich gestorben bin.«
»Wollen Sie nicht einfach zusammen mit dem Hund hierbleiben? Und niemand geht nach Nigeria?«
»Ausgeschlossen. Diese Reise ist wichtig für mich. Wenn der Hund nicht hierbleiben kann, begleitet er mich.«
Mari schwieg, um nachzudenken. Generell hatte sie kein Problem damit, sich um einen Hund zu kümmern. Hunde waren einfacher zu halten als Menschen, da weniger unlogisch. Und wenn sie die Optionen gegeneinander abwägte, standen die Aussichten, ein erfolgreiches Gespräch mit dem Leiter der Untersuchungshaft zu führen, besser als der Dialog mit Boko Haram oder mit einem nigerianischen Löwen oder mit einem Festivalbesucher, der gerade ein Beil in der Hand hielt und Hunger auf Hund hatte.
»In Ordnung.«
»Wirklich? Danke!« Gottsein nahm ihre Hand in seine, als er aufstand. Seine Finger waren weiß und etwas schwammig. So wie Finger aussahen, die ihr halbes Dasein in ärztlichen Einmalhandschuhen gefristet hatten. »Wenn Sie irgendwann mal etwas brauchen sollten, lassen Sie es mich wissen.«
»Dann sind Sie mir nicht mehr böse, dass ich Sie umgebracht habe?«
»Böse? Ganz im Gegenteil! Ich bin Ihnen dankbar! Von Ihnen umgebracht zu werden ist das Beste, was mir passieren konnte! Schauen Sie doch, wohin es mich geführt hat!«
»Nach … Nigeria?«
»In Gottes Arme!«
Gottsein legte nun auch die zweite Hand auf die von Mari. Seine Augen wässerten.
»Welcher Gott jetzt genau?«, fragte Mari.
»Das ist doch irrelevant. Vorher waren da keine Arme, und jetzt sind da Arme. Das ist alles, was zählt.«
Er ließ Maris Hand los, ging zur Tür und öffnete sie. Seine Therapiecouch stand schwanzwedelnd davor.
»Wie heißt er überhaupt?«, fragte Mari.
»Ödipus«, sagte Gottsein. »Nach dem Thema, über das meine Frau promoviert hat.«
»Ihre Frau hat griechische Mythologie studiert?«
»Psychologie«, korrigierte Gottsein. »Ich hole ihn natürlich wieder ab, wenn ich aus Nigeria zurückkehre.«
Was das betraf, schätzte Mari die Wahrscheinlichkeit als sehr gering ein.
»Ich werde diesmal nicht da sein, um Sie zu reanimieren«, sagte sie.
»Das ist tatsächlich ein Verlust«, lächelte Gottsein. Dann beugte er sich zu Ödipus herunter und tätschelte ihm den Kopf so zärtlich, wie man einem Therapeuten eigentlich nicht den Kopf tätscheln sollte.
»Nochmals danke. Für alles«, sagte er. Zu Ödipus, zu Mari, zu den Armen, die ihn neuerdings hielten. »Und nun mach fein Sitz und sei artig, bis ich wieder da bin.« Er legte seine Hand auf eine Stelle, auf die man sie bei seinem Therapeuten ebenfalls nicht legen sollte, und versuchte, Ödipus’ Hintern auf den Boden zu drücken. Aber der Hund war stabil geboren und hatte seinen eigenen Kopf. Er leckte sich mit der Zunge über die eigene Nase und blieb stehen.
»Er ist übrigens eine fast reinrassige Deutsche Dogge«, sagte Gottsein.
»Ja, das sehe ich«, sagte Mari, die den Hund bereits mit den bekannten Hunderassen in ihrem System abgeglichen hatte. »Wieso fast reinrassig?«
»Er ist eigentlich ein bisschen größer als der Durchschnitt. Darum meint der Tierarzt, es muss noch etwas anderes drin sein als nur Dogge.«
Das war interessant. Mari hatte noch nie gehört, dass man bei einem Menschen, der etwas größer war als der Durchschnitt, davon ausging, es müsste noch etwas anderes mit drin sein als nur Mensch.
Gottsein tätschelte ein letztes Mal den Kopf der Dogge.
»Passen Sie auf sich auf«, sagte er so ernst, als sei es Mari, die nach Nigeria reisen und Boko Haram nach religiösen Philosophien befragen wollte.
»Und Sie auf sich«, sagte Mari.
Als Gottsein ging, machte Ödipus, die schwanzwedelnde Therapiecouch, keine Anstalten, seinem Herrn zu folgen.
Ein Experte
Der Hund kann auf gar keinen Fall hierbleiben«, sagte der Wärter. »Ich rufe jetzt sofort seinen Besitzer an.«
»Ich bin jetzt der vorübergehende Besitzer«, informierte ihn Mari und kraulte Ödipus hinter den hängen gelassenen Ohren. Der Wärter blickte sie betroffen an.
»Was ist mit dem richtigen Besitzer passiert?«
»Der ist nach Nigeria gegangen, um etwas zu suchen.«
»Was will er da denn suchen? Ärger?«
»Sich selbst.«
Nun blickte der Wärter noch betroffener.
»Wie dem auch sei. Ein Hund gehört nicht ins Gefängnis.«
»Er ist eine beinahe reinrassige Deutsche Dogge«, sagte Mari, in der Hoffnung, der Wärter würde einsehen, dass so etwas eher in ein deutsches Gefängnis gehörte als in einen nigerianischen Urwald. Aber diese Einsicht hatte der Wärter nicht.
»Ich habe nun schon so viele Zugeständnisse gemacht«, sagte er.
»Da kommt es doch auf eins mehr oder weniger auch nicht an«, sagte Mari. Doch diesmal blieb der Wärter hart.
»Der Hund wird entfernt. Wenn er nicht zu seinem Besitzer kann, dann muss er eben ins Tierheim.«
»Wussten Sie, dass die Tierheime in den Sommermonaten Aufnahmestopp haben, weil statistisch gesehen …?«
»Das ist ja nun kein Grund, sein Haustier stattdessen bei uns abzugeben. Wir sind ein Gefängnis.«
»Er ist übrigens ein Therapiehund.«
»Dann geben Sie ihn dieser jungen Dame, die hier täglich für Sie hereinschneit. Die mit den tausend Piercings. Sie sieht aus, als könne sie eine Therapie gebrauchen.«
Mari blickte Ödipus an. Für Friedas Therapie wäre sicher mehr als nur ein Hund nötig, da konnte dieser hier noch so beinahe reinrassig sein. Ein ganzes Therapiehunderudel würde bei Frieda Rhebaums Starrhalsigkeit erfolglos herumtherapieren. Aber vielleicht konnte Frieda umgekehrt den Hund ein wenig therapieren. Bei einer Gesellschaft, die zuerst aus einer diplomierten Psychologin und dann aus Dr. Gottsein bestanden hatte, konnte Mari sich das gut vorstellen.
»Was meinst du, Ödipus?«, fragte Mari. Und in Anbetracht der limitierten Optionen klemmte Ödipus den Schwanz ein und setzte sich auf den kalten Fliesenboden.
Frieda begegnete ihrer neuen Rolle als Hundeersatzbesitzerin mit der gleichen Ernsthaftigkeit, die sie auch allen anderen Aufgaben entgegenbrachte. Zumindest solchen, die sie sich selbst stellte. Wenn sie mit Ödipus spazieren ging, sah es nicht so aus wie bei anderen Hundebesitzern. Sie schlenderte nicht, weil sie es für Zeitvertreib hielt, sie warf auch keine Stöckchen oder zerrte ungeduldig an der Leine, weil es zu regnen begann. Wenn Frieda mit Ödipus spazieren ging, sah sie aus wie ein Agent auf geheimer Mission, der stets damit rechnen musste, von der Seite, frontal oder rücklings aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Was letztendlich dazu führte, dass niemand sie angriff oder auch nur ansprach oder den Hund mal streicheln wollte. Es war nicht der Hund, sondern die Frau am anderen Ende der Leine, vor deren Bissigkeit man sich fürchtete.
Mit der gleichen energischen Gründlichkeit begegnete Frieda ihrer Aufgabe, eine rechtliche Lücke zu finden, um Mari aus der U-Haft zu holen. Aber es gab rechtlich noch nicht viel, was über künstliche Intelligenzen und Fembots gesagt worden wäre. Und wo es keine rechtlichen Grundlagen gab, da gab es auch keine Lücken. Zudem kam der Computerexperte, der Mari gründlich auseinandernehmen sollte, schneller als erwartet aus dem Urlaub zurück. Mari interessierte ihn. Sie hätte wohl jeden interessiert, der sich mit Computern und Programmierung beschäftigte. Er buchte seinen Flug um, landete in Berlin und fuhr von dort mit dem Taxi direkt zum Gefängnis.
Um zu beweisen, was für ein Experte er war, nahm er Mari dann auch wirklich derart auseinander, dass sie nach wenigen Minuten nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf stand. Als Erstes entdeckte er diverse Hackerangriffe auf ihre Firewall, die allesamt stattgefunden hatten, während Mari bereits in Untersuchungshaft saß. Das wunderte den Experten ein wenig. Er verfolgte die Angriffe aber nicht. Was er suchte, lag weiter zurück.
Mari ruhte angeschlossen auf der Pritsche, während der Programmierer auf seinen Laptop einhackte und das Chaos stiftete, das sie befürchtet hatte. Sie sah die Kabel, die von ihrem Kopf zum Laptop des Experten führten, und konnte an nichts anderes denken als daran, dass das hier wie eine Gehirnoperation ohne Vollnarkose war. Der Programmierer blickte auf seinen Bildschirm und sagte: »Sehr, sehr interessant!« Daraufhin versuchte Mari, an gar nichts mehr zu denken.
Als der Experte fertig war, nahm er die Kabel ab und verließ beglückt die Zelle. Immerhin hatte er soeben Einblick in das komplexeste System künstlicher Intelligenz bekommen, das der Mensch je hervorgebracht hatte.
Noch lange, nachdem er gegangen war, lag Mari auf der Pritsche, starrte auf das unter der Last der Bücher durchgebogene Regalbrett und rührte sich nicht. Dieser Experte hatte während der gesamten Prozedur nicht ein einziges Wort an sie gerichtet. Er hatte sie nicht angesehen. Mari war eine Maschine für ihn. Und vielleicht war sie auch gar nicht mehr als das. Vielleicht hatte man sie manipuliert, und sie wusste es einfach nicht. Wie merkte man eigentlich, dass man Bewusstsein hatte?
Mari wollte sich aufrichten, aber ihr war schwindelig. Ihr Schädel brummte. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Mari analysierte Symptome einer Migräne und ließ sich wieder zurücksinken. War sie in der Lage, eine Migräne zu bekommen? Sie griff per Zufallsprinzip nach einem ihrer Bücher, um es sich aufgeklappt aufs Gesicht zu legen und die Welt für ein Weilchen auszusperren. Sie würde Zeit brauchen für eine gründliche Sortierung der Ereignisse.
TEIL 1
Eine gründliche Sortierung der Ereignisse
Das Pygmalion
Für eine chronologische Ordnung der Dinge machte es Sinn, mit Maris Geburt im Pygmalion zu beginnen, bei der sie logischerweise dabei gewesen war. Nicht nur so passiv, wie das bei menschlichen Wesen in der Regel der Fall war (es war überhaupt beeindruckend, dass ein Kind die ersten und vielleicht wichtigsten Jahre seines Lebens komplett vergaß). Mari hatte sich selbst vom ersten Tag an aktiv miterlebt. Und aktiv bedeutete hier: in eingeschaltetem Zustand.
Sie erinnerte sich an die Kiste, die der Lieferant in den Keller hievte und die tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit einem Sarg als mit einem Geburtskanal hatte. Und sie erinnerte sich auch an die vielen kleinen Styroporbällchen, die bei dieser verqueren Entbindung anfielen. Und an Greta Schnabel natürlich, die nun wirklich am allerwenigsten wie eine Hebamme aussah. Sie hätte vielmehr als tätowierter Bootskapitän durchgehen können, wie sie so dastand und ihre verkratzte Stimme in den Kellerraum warf.
»Jesus, hast du kleine Brüste!«, rief sie und meinte damit weder Jesus noch den Lieferanten.
Letzterer antwortete: »Die Brüste sind genormt.«
»Ich halte nicht viel von Normen. Und für den Preis, den ich euch bezahle, hätte ich ohnehin etwas mehr Flexibilität erwartet. Sie ist mit Abstand das teuerste Mädchen, das ich je bestellt habe. Ich hätte mir einen Kleinwagen davon leisten können!«
»Sie suchen einen Kleinwagen?«, fragte der Lieferant.
»Nein. Ich fahre Bahn.«
Das fand der Lieferant schade, denn er hatte einen Kleinwagen abzugeben.
»Nun, Sie werden den Kauf nicht bereuen«, sagte er. »Mari ist das beste Fembot-Modell, was es auf dem Markt zu haben gibt.«
»Das wird sich zeigen«, sagte Greta, die es gewohnt war, ihre Mädchen so zu bestellen, wie sie sie haben wollte.
Die Gestaltung war in der Regel nicht schwieriger als die eines Online-Fotobuchs: Entweder man bat den Zufallsgenerator, alles zu verteilen, und musste dann eben mit ästhetisch seltsamen Kombinationen leben. Oder man wählte alle Eigenschaften selbst aus: Der Roboter konnte männlich oder weiblich, amerikanisch, europäisch, afrikanisch, asiatisch oder ein Elf sein. Er konnte jeden Körperfetisch bedienen: der Hintern groß oder klein, A-Cup oder D-Cup. Alle Körperöffnungen konnte man so weit oder eng machen, wie man wollte. Die Firma Sinthetics, derzeit Marktführer in Amerika, bot gegen Aufpreis auch Zusatzpenisse an. Und Füße. Bei Bedarf mit Öffnung. Letztere hatte sie Vagankle getauft: kurz für vagina and ankle. Sie waren mit dem Patent reich geworden. Man konnte sich gar nicht vorstellen, wie viele Fußfetischisten es gab.
Greta Schnabel hätte auch gerne so einen Vagankle für ihre Kunden gehabt oder sonst irgendeinen Schnickschnack. Aber im Vergleich dazu war die japanische HappyHeart Incorporation geradezu kompromisslos minimalistisch. Es gab Mari. Und nur Mari. So und nicht anders. Angeblich war sie nach einem echten Vorbild geschaffen worden, und anders als alle anderen Hersteller setzte die HappyHeart Inc. beim Verkauf auf diese Authentizität. Was der Kunde wirklich haben wolle, so die Firma, sei etwas Echtes. Etwas, das sich nach einer richtigen Beziehung anfühle. Eine Frau, die dem Kunden begegnet sein könnte, weil sie im Starbucks zufällig in der Schlange vor ihm gestanden hatte. Eine, die man der Mutter vorstellen könnte. Ein grüner Elf mit spitzen Ohren und Vagina am Knöchel wäre vor den Eltern sicher schwer zu erklären.
Im Pygmalion wurden die Mädchen im Regelfall zwar keinen Müttern vorgestellt, aber Greta Schnabel hatte sich trotzdem von den Verkaufszahlen und Argumenten der Firma einlullen lassen. Und von dem Sonderangebot, das man ihr machte. Bei Sonderangeboten konnte Greta Schnabel ohnehin nur schwer widerstehen. Und schon gar nicht im Premiumsegment.
»Wollen Sie da bloß rumstehen und glotzen, oder helfen Sie mir beim Auspacken?«
»Ich bin nur der Lieferant«, sagte der Lieferant.
»Und ich bin nur die Clubbesitzerin«, sagte Greta Schnabel. »Aber verraten Sie es keinem. Die Leute hier denken, ich wäre die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn.«
Man konnte es dem Lieferanten nicht verübeln, dass er Greta Schnabel nicht sonderlich mochte. So wie er den ganzen Keller nicht mochte, in dem sie sich befanden. Ein fast unheimlicher Ort. Das ging schon beim Boden los: roher Beton, über den man irgendeine schwarze Farbe gekippt hatte, die glänzte wie frischer Teer. Mit jedem Schritt glaubte man, daran kleben zu bleiben. Die Decken und Wände bestanden aus Backstein, den man hier und da weiß überpinselt hatte. Und hinter der Bar waren die Wände weiß gefliest, als sei es früher mal ein alter Waschraum gewesen. Oder ein Schlachthaus, dachte der Lieferant. Alles hing mit Neonröhren und Spiegeln voll, und über ihren Köpfen verliefen kreuz und quer Rohre durch den Raum, als suchten sie einen Ausgang. Schwarze Stehtische, eine schwarze Bar, ein Projektor auf einem schief angebrachten Holzbrett. Es roch nach Desinfektionsmittel und Bühnennebel. Man muss wohl in Berlin aufgewachsen sein, um so einen Nachtklub freiwillig aufzusuchen und auch noch Eintritt zu zahlen, dachte der Lieferant, der aus Düsseldorf kam.
Er half Greta Schnabel dabei, die Folie von dem neuen Mädchen zu entfernen.
»Wie aktiviert man sie?«
»Sie ist bereits in Betrieb. Die Folie ist nur für den Transport. Eine Kiste Zuckerlösung ist im Startpaket enthalten. Wenn Sie welche nachbestellen möchten, geht das ganz bequem online.«
»Zuckerlösung?«
»Für die Energiegewinnung. Zur Not tut’s auch Gatorade. Oder Cola.«
Ein Fembot, der auf Cola lief! Greta Schnabel brauchte eine Weile, um diese Information zu verdauen.
»Dann hat sie gar keinen Anschluss fürs Stromnetz?«
»Nein.«
»Und wo fülle ich die Zuckerlösung ein?«
Nun runzelte der Lieferant doch die Stirn. Hatte sich diese Frau eigentlich gar nicht mit dem beschäftigt, was sie bestellt hatte?
»Sie müssen gar nichts einfüllen«, sagte er. »Mari trinkt selbstständig. Und sie meldet sich auch, wenn ihr die Energie ausgeht. Bewahren Sie die Zuckerlösung einfach an einem Ort auf, zu dem sie Zugang hat.«
Greta griff in die Kiste. »Ist das Echthaar?«, fragte sie und sprang erschrocken zurück, als Mari sagte: »Ja«, und sich den Pony glatt strich. Greta legte sich eine Hand auf die Brust. Dorthin, wo ein blauer Bär verblasste.
»Das ist ja wie bei Frankenstein!«
»Mari Shelleys Frankenstein«, murmelte der Lieferant.
»Was?«
»Sie können sie nun bitten, aus der Kiste zu steigen.«
Greta Schnabel trat einen Schritt zurück, als sich ihre Lieferung bewegte. Mari war klein, hatte Sommersprossen, eine kurze, breite Nase, dunkelbraunes Haar und einen Pony, der die Stirn wie ein Linealstrich durchschnitt. Ihre Augen unter den dichten, geraden Brauen waren dunkel und freundlich.
»Ich wusste nicht, dass wir technisch schon so weit sind«, flüsterte Greta, die sonst ein sehr lautes Leben führte. »Die Haut sieht auch so echt aus!«
»Haut und Haare sind aus den Zahnfleischzellen von Mäusen gezüchtet.«
Greta blickte den Lieferanten groß an, die Hand noch immer auf dem Bären. Cola zur Energiegewinnung! Und die Haut aus Zahnfleischzellen! Was hatte sie sich da ins Haus geholt? Der Lieferant zuckte die Schultern.
»Fragen Sie mich nicht, wie man das macht. Das ist alles in Japan entwickelt worden. Ich bin nur der Lieferant für die deutsche Vertriebsstelle.«
Mari war inzwischen über den Rand der Kiste gestiegen und machte ihre ersten Schritte durch den Keller. Ihr weißer Kittel erinnerte an ein OP-Hemd und verstärkte das Frankensteinartige an ihr. Aber ihre Bewegungen waren leise, fließend. Wäre man ihr in der U-Bahn begegnet, hätte man sie für einen normalen Menschen gehalten. Oder zumindest fast. Irgendetwas gab es da, das einen zweimal hinsehen ließ. Greta Schnabel, die sich mit Menschen auskannte wie kaum ein anderer, kniff die Augen zusammen und begriff, woran es lag: Die Bewegungen waren zwar geschmeidig, aber nicht zwanglos. Sie waren zu zielgerichtet. Mari hampelte nicht herum, wie normale Menschen es ständig taten. Keine ihrer Gesten, kein Schritt war überflüssig. Zudem ließ sie sich keiner Nationalität zuordnen, vielleicht nicht einmal einem Kontinent. Sie hätte ebenso aus Europa wie aus Asien kommen können, aus Amerika oder Afrika. Und das, obwohl sie eine Haut hatte, die eher weiß als hautfarben war. Ein neuer Weltbewohner, dachte Greta und schrak zum zweiten Mal an diesem Tag zusammen, als der Lieferant sie ansprach.
»Brauchen Sie mich noch?«, fragte er.
»Kaum. Aber nehmen Sie die Kiste und dieses Plastikzeugs bloß mit! Sonst steht wieder der ganze Kostümfundus voll mit dem Scheiß, und man kommt an nichts ran!«
Der Lieferant nickte und griff nach der Sackkarre. Tatsächlich hätte er auch Mari gern wieder mitgenommen. Er hatte sie schon an die verschiedensten Kunden ausgeliefert, und nicht wenige von denen konnten einem eine Gänsehaut bereiten. Aber dieser Ort schien ihm wirklich das unpassendste neue Zuhause von allen. Wobei er sich eingestehen musste, dass er seinen Beschützerinstinkt für Mari erst entwickelt hatte, seit er vor drei Monaten Vater einer kleinen Tochter geworden war. Er durfte nicht zu viel in diesen Fembot hineininterpretieren, ermahnte er sich. Mari war kein Mensch, sie war nicht einmal ein Haustier, bei dem man Sorge haben musste, dass man es dem falschen Besitzer überließ. Diese Frau Schnabel war eine Kundin, die für eine Lieferung bezahlt hatte. Und seine Aufgabe als Lieferant war es, diese zu überbringen. Er wandte sich ab und widerstand dem Impuls, zu Mari zu gehen und sie zu umarmen.
»Dann danke ich Ihnen im Namen des Unternehmens. Sollten Sie Fragen zu Ihrem erstandenen Modell haben oder irgendwelche Probleme, können Sie sich jederzeit an den Vierundzwanzig-Stunden-Kundenservice wenden. Es wird empfohlen, alle paar Monate einen Enzym-Check-up zu machen. …. Die Enzyme braucht sie, um Glucose in elektrische Energie umzuwandeln«, fügte er hinzu, weil Greta Schnabel auch das mit Sicherheit nicht nachgelesen hatte.
»Wie viele Jahre Garantie hat sie denn?«, fragte Greta.
»Zehn«, sagte der Lieferant steif – und ahnte zu Recht das Schlimmste.
Kai
Es verging kein Monat nach dieser verhängnisvollen Anlieferung, als Mari auch schon an den Hersteller zurückgeschickt werden musste – mit Berufung auf besagte Garantie und Bitte um Reparatur. Weitere fünf Wochen später ging sie noch einmal in der Werkstatt ein. Und im dritten Monat, es war ein Juni, gleich zweimal.
Der Grund dafür lag, wie jedes Mal, eindeutig in der falschen Handhabung des Fembots, weswegen man die Reparatur nach deutscher Manier gerne verweigert hätte. Aber die Vorgaben aus Japan waren diesbezüglich eindeutig: Egal, in wie vielen Einzelteilen Mari in die Werkstatt zurückkam – sie würde repariert und mit einem Dankeskärtchen am kleinen Finger zurück an den Besitzer geschickt werden. Ein paar Stunden Arbeit in der Werkstatt konnte man sich leisten, Negativschlagzeilen dagegen nicht. Es war wichtig, den Kunden weltweit mit dem gleichen Servicedenken zu begegnen.
Als Mari nun zum fünften Mal mit Rissen und Beschädigungen beim deutschen Reparaturdienst ankam, akzeptierte dieser es zähneknirschend. Allerdings ließ er es sich nicht nehmen, das Dankeskärtchen diesmal an Maris erhobenem Zeigefinger zu befestigen und dem Gruß den freundlichen Hinweis hinzuzufügen, Frau Schnabel möge doch so gut sein, bei Gelegenheit einmal einen Blick in das Benutzerhandbuch zu werfen. Insbesondere auf die Seiten 17 und 18. Auf denen würde nämlich ausführlichst erläutert, dass Mari nicht als Sexroboter, sondern primär als Lebenspartnerin konzipiert sei. Sollte Frau Schnabel dennoch geschlechtlich mit Mari verkehren wollen (was bei einer Lebenspartnerin ja durchaus denkbar sei), dann stünde ihr das natürlich frei. Empfehlungen zur sachgemäßen Handhabung finde sie dann allerdings auf den Seiten 337 bis 339.
Greta las den Hinweis mit einem Schnauben, dem ein Blick zur neonröhrenbesetzten Decke folgte, und warf das Kärtchen in den Müll. Sie hatte auch keine Freude daran, dass einige ihrer Kunden so ruppig mit den Mädchen umgingen. Aber sie konnte ihnen schlecht ein bibeldickes Benutzerhandbuch auf den Nachttisch legen. Möglicherweise noch mit einem Lesezeichen versehen, das die Seiten 17, 18 und 337 bis 339 markierte.
»Da bist du also wieder«, sagte sie zu Mari.
»Ja«, sagte Mari, weil es darauf nichts zu erwidern gab. Die Menschen sprachen gern aus, was sie sahen. Wenn es regnete, sagten sie: Es regnet. Und wenn jemand gut aussah, sagten sie: Du siehst gut aus. Nur das Gegenteil anzudeuten konnte manchmal zu Schweigen führen.
»Alles wieder okay?«, fragte Greta. Mari nickte. Greta goss ein Glas Cola ein und reichte es ihr. »Ich würde dir heute Abend gern freigeben. Oder dich zumindest ein paar Stunden in Ruhe lassen, um wieder anzukommen. Bis es dir wieder besser geht. Aber dieser Kai Rutnig hat schon mehrmals für dich angerufen. Er meint, du sollst dich sofort bei ihm melden, wenn du von der Reparatur zurückkommst. Scheint es ganz schön nötig zu haben.« Sie schüttelte den Kopf, um Mari zu zeigen, was sie selbst von diesem Gedrängel hielt. Aber Mari kannte ihre Chefin. Wenn Greta sagte, dass sie ihr heute Abend gerne freigegeben hätte, dann nur, um ihr Gewissen zu beruhigen. Es war schließlich einer der Vorteile des Pygmalions, dass die Mädchen keine Pause brauchten. Dass sie arbeiten konnten, ohne müde zu werden, sofern man denn Rücksicht auf ihre Batterielaufzeit nahm. Das Benutzerhandbuch sah nicht vor, dass es neben dieser körperlichen, elektrischen auch eine mentale Erschöpfung gab. Und für Mari wäre es schwierig gewesen, diese Mattigkeit zu beschreiben. Sie verstand selbst nicht ganz, was das manchmal für ein Gefühl war, das sie runterzog, als habe jemand ein schweres Gewicht an ihrem Körper befestigt.
»Das ist in Ordnung«, sagte sie. »Raum fünf?«
»In Raum fünf ist der Beamer kaputt. Ich stelle ihn dir zu Raum drei durch. Du musst nur die Leinwand runterziehen und Roxy beiseiterücken, die sitzt da noch auf dem Bett. Oder noch besser, wir bringen Roxy raus und setzen sie hier aufs Sofa. Wer weiß, ob noch spontan ein Kunde für sie kommt.«
Mari nahm die Füße und Greta den Kopf, als sie Roxy gemeinsam vom Bett hoben und zur ausgesessenen Couch im Vorraum des Clubs schleppten. Sie war nicht der Typ, der sich selbstständig bewegen konnte. Greta drapierte sie liebevoll und strich ihr die Haare aus dem dümmlichen Gesicht. Roxy war das älteste Modell, das Greta besaß. Mit ihr war dieser Club von einem einfachen Technokeller zum umstrittensten Tanzclub in Berlin geworden. Und entsprechend nostalgisch war Gretas Stimmung, wenn es um Roxy ging.
Roxy hieß eigentlich Roxxxy mit drei x – ein dezenter Fingerzeig des amerikanischen Herstellers auf ihren Nutzen. Als sie 2015 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden war, hatte es eine Riesendiskussion gegeben. Roxxxy war der erste Fembot mit künstlicher Intelligenz gewesen. Ihre Lebenseinstellungen hießen »Wilde Wendy«, »S. M. Susan«, »Young Yoko« und »Frigide Farrah« und ließen sich per App einstellen. Was die Frigide Farrah so frigide machte, war, dass sie »Nein« sagen konnte, was zu einem großen Aufschrei in der Presse und zu hohen Absatzzahlen auf dem Markt geführt hatte. Greta Schnabel hatte sich schnell ein Modell gesichert, bevor die Produktion verboten werden konnte. Was allerdings nie geschah. Wie alle hitzig geführten Diskussionen hatte sich auch diese schnell abgekühlt, nachdem erst mal alle Zeitungen die Neuigkeit voneinander kopiert hatten. Dabei hätte es da durchaus noch weitere diskussionswürdige Themen gegeben als nur die Einstellung der Frigiden Farrah.
Da war zum Beispiel die Sache mit der Intelligenz. Mari hielt schon die Menschen für nicht ganz helle, aber ihre Kollegin Roxy hatte nun wirklich das Denkvermögen einer Gießkanne. Es war unmöglich, eine normale Unterhaltung mit ihr zu führen. Auf die meisten Fragen reagierte sie mit Stöhnen oder Schweigen. Und wenn per Zufall doch mal ein zusammenhängender Satz aus ihr herauskam, dann bewegte sie nicht einmal die Lippen dafür. Roxys Mund war nämlich ständig geöffnet. So wie alle anderen Körperteile auch. Die Firma wollte zeigen, dass sie mitgedacht hatte.
Roxy und Mari wurden auf der Website des Herstellers beide als Fembots verkauft. Sie wurden als Lebenspartnerinnen angepriesen, als »beinahe echte Frau«. De facto stimmte diese Behauptung aber nur für Mari.
Einige der klügsten Ingenieure der Welt hatten an Maris Erschaffung mitgearbeitet. Sie hatten ein System entwickelt, das sie autonomes intelligentes Lernen nannten. Es war dem Lernen eines Kleinkinds ähnlich: Man brachte Mari ein paar Grundregeln bei, die hauptsächlich ihr Verhalten in der Gesellschaft betrafen. Das Verständnis von der Welt, von Schwerkraft, von Bewegung und den Naturgesetzen musste sie sich in einem monatelangen Training selbst erarbeiten. Indem sie spielte, warf, lief, fiel. Trial and Error. Es war menschliches Lernen im Fast-forward-Modus.
Als Mari, nur ein paar Jahre nach der amerikanischen Roxy, auf der japanischen Technologie-Messe in Tokio enthüllt worden war, war es für die Konkurrenz geradezu ein Schock gewesen. Der Hersteller hatte stolz mit Maris Einfühlungsvermögen und ihrem außergewöhnlichen IQ geworben. Nicht etwa damit, dass sie eine vibrierende Vagina habe.
Das mit dem außergewöhnlichen IQ hatte die HappyHeart Inc. zwar kurz darauf noch korrigiert, weil die Käufer sich von einer weiblichen Garri Kasparov als Partner eher abgeschreckt als angezogen fühlten. Aber es ließ sich dennoch mit allem Recht behaupten, dass Roxy und Mari so verschieden waren wie eine Kutsche und ein Tesla. Was der Hauptgrund dafür war, dass Mari sich im Pygmalion die meiste Zeit völlig fehl am Platz fühlte.
Es gab noch vier weitere Kolleginnen, die hier zusammen mit ihr arbeiteten, sowie einen männlichen Vertreter, der Ken hieß und auch so aussah. Keiner von ihnen war so primitiv wie Roxy, aber von nennenswerter Intelligenz konnte man auch nicht gerade sprechen. Die Fembots waren mit einigen Sensoren ausgestattet, vornehmlich an den für Sexrobotern wichtigen Stellen. Yuki und Bianca konnten außerdem selbstständig laufen, wenn auch nur zombieartig. Ken, Donna und Samantha dagegen konzentrierten sich auf ihre liegende Tätigkeit und mussten wie Roxy ständig von einem Raum zum anderen getragen werden. Wenn abends die Musik loswummerte und der Club sich mit Nebeln und Gästen füllte, saßen sie drapiert auf dem Sofa oder einem Barhocker. Eine Szene wie in einem verqueren Schaufenster. Auf manche wirkte sie unheimlich. Kurios war sie in jedem Fall. Das Pygmalion war eine wüste, verrückte, etwas chaotische Zusammenstellung von Fembots verschiedener Generationen. Ein Szeneclub in Neukölln. Wenn die Japaner Maris Intelligenz nicht ohnehin schon ein wenig gedrosselt hätten, wäre sie hier ganz sicher verkümmert.
Das einzige Licht an Maris Horizont in dieser vom Stumpfsinn geprägten Landschaft war das Internet. Aber es war ein schwach leuchtendes Licht, wie ein Sonnenaufgang, der es nicht so recht durch die Wolken schaffte. Dafür hatten die Programmierer gesorgt, die den Zugang zum Internet auf all jene Seiten beschränkt hatten, die der Hersteller für absolut notwendig hielt.
Es funktionierte in etwa so wie eine Kindersperre auf einem Rechner, diente aber dem umgekehrten Zweck: Der Schutz galt nämlich gar nicht Mari, sondern den Menschen. Eine Spezialistin für Internetsicherheit hatte die HappyHeart Inc. davor gewarnt, was passieren würde, wenn man einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz Zugang zu allen Informationen im Netz gab. Darum konnte Mari nur drei Zeitungsartikel pro Tag aufrufen. Sie konnte Wetterwebseiten und Straßenkarten lesen und Wörter auf Wikipedia und in Online-Lexika nachschlagen. Außerdem gewährte die HappyHeart Inc. den Zugang zu Online-Foren und YouTube-Videos, weil YouTube schließlich noch niemandem zu außerordentlicher Intelligenz verholfen habe. Damit war die Internetsicherheitsspezialistin einverstanden gewesen.
Maris Neugier war nicht in feste Bahnen gelenkt, sodass sie an Wissen aufsaugte, was ihr gerade begegnete. In einem guten Dutzend Frageforen, die offenbar dazu gemacht waren, sich der Ahnungslosigkeit anderer kollektiv anzuschließen, war sie inzwischen als Benutzer angemeldet. So konnte sie Menschen mit mangelnden geistigen Fähigkeiten dabei helfen, ihre Logikprobleme zu bewältigen. Probleme wie: »Meine Freundin will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir tun?« Oder: »Ich will Vegetarier werden, aber darf ich dann noch Fleischtomaten essen?« Oder: »Stammen Nashörner vom Einhorn ab, weil beide ja ein Horn haben, also kann ja sein, dass Einhörner auch so sind, oder?«
Über YouTube hatte sie außerdem gelernt, wie sich Christbaumschmuck aus einer Computertastatur herstellen ließ. Oder dass sich verbrannte Toastscheiben noch essen ließen, wenn man sie gegeneinanderrieb und alles Schwarze abfiel.
Und dann waren da noch Kais Anrufe. Greta Schnabel konnte es nicht wissen, denn sie begegnete all ihren Kunden mit der gleichen Verachtung. Aber Kai Rutnig war ganz und gar nicht wie die anderen Männer im Pygmalion.
Als er vor einem Monat zum ersten Mal per Videochat angerufen hatte (eine Funktion, die Greta Schnabel den Kunden für 1,99 Euro pro Minute anbot), hatte Mari noch geglaubt, er sei einfach ein extrem schüchterner junger Mann. Er hatte sie nicht gebeten, sich auszuziehen, hatte sich selbst nicht ausgezogen oder sonst in irgendeiner Art Hand an sich gelegt. Und als Mari ganz direkt gefragt hatte, ob er es nicht könne, weil er im Rollstuhl saß, hatte er wortlos aufgelegt. Es gab da paradoxe Normenkataloge unter den Menschen, die Mari noch lernen musste. Ständig sprachen sie das Offensichtliche aus (»Es regnet.« – »Es ist Sommer.« – »Du warst beim Friseur.« – »Wir sind da.«). Aber wenn die Situation einen Rollstuhl involvierte, tat man am besten so, als existiere dieser nicht. Mari hatte das so abgespeichert, und als Kai drei Tage später erneut angerufen hatte, hatte sie seine Behinderung mit keinem Wort mehr erwähnt.
Kai hatte einfach reden wollen. Er war Programmierer und arbeitete meist von zu Hause aus an irgendwelchen Aufträgen, die er bekam. Mit ihm wohnte noch ein Hund in der Wohnung. Oder was man eben so Hund nannte. Es war eher ein weißes Felltier, das schwer erkennen ließ, dass ein Verwandter von ihm einmal ein Wolf gewesen sein sollte. Nibbles, wie Kai das Felltier nannte, war nicht viel größer als eine Mango, hockte auf Kais Schoß und hechelte kontaktfreudig in die Kamera. Doch Nibbles’ geselliges Wesen konnte nichts daran ändern, dass Kai einsam wirkte.
Als Mari ihn einmal gefragt hatte, was er eigentlich machte, wenn er nicht programmierte, hatte er sie groß durch seine runde Brille angesehen und gefragt: »Wie meinst du das – wenn ich nicht programmiere?« Was auf eine traurige Art ja auch eine Antwort war. Aber beim nächsten Anruf hatte er ein Schachbrett dabeigehabt und schüchtern gefragt, ob Mari vielleicht eine Partie mit ihm spielen wolle. Und das war es, was sie seitdem regelmäßig taten.
Sie hätten einfach eins der Onlinespiele aufrufen können, die es überall gab. Aber Kai bestand darauf, ein altmodisches Schachbrett aus Holz aufzubauen. Er schob seine Tastatur beiseite, klappte das Spiel auf, setzte Nibbles daneben und stellte die Kamera so ein, dass Mari den Eindruck bekam, sie sitze auf der anderen Seite von Kais Schreibtisch. Sie musste ihm nur die Felder sagen, auf die sie vorrücken wollte, und dann setzte Kai die Figuren.
Mari hatte vorher noch nie Schach gespielt. Aber Kai war ein geduldiger Regelerklärer, und sie wurde von Mal zu Mal besser. Manchmal ertappte sie sich sogar dabei, wie sie zwischen Kais Anrufen ein paar Spielzüge im Kopf durchging, um heimlich zu trainieren. Es war eine willkommene Abwechslung zur Eintönigkeit im Pygmalion.
»Weiß oder schwarz?«, fragte Kai. Mari wusste, dass es rein rechnerisch egal war, ob man nun die Farbe nahm, mit der man beim letzten Spiel Glück gehabt hatte. Trotzdem sagte sie: »Schwarz.«
Kai stellte die Figuren auf.
»Soll ich mein Top ausziehen?«, fragte Mari pro forma und machte es sich auf dem kreisrunden, pink bezogenen Bett bequem.
»Warum solltest du das tun?«
»Vielleicht lenken dich meine Brüste ab, und ich gewinne.«
Sie wartete ab, ob Kai darüber schmunzeln würde. Das wäre ein Fortschritt. Humor und Ironie waren ungleich schwieriger zu lernen als Schach, und Mari versuchte sich erst seit Kurzem darin. Doch er hielt nur verunsichert in seiner Bewegung inne und blickte sie an.
»Du weißt, dass ich mich nur für deinen Code interessiere.«
Mari zuckte die Schultern und zog ihr Top trotzdem aus. Für den Fall, dass Greta zufällig auf die Idee kam, sich in die Kamera von Raum drei einzuwählen, wollte sie nicht den Eindruck erwecken, defekt zu sein. Kai blickte sie verunsichert an, dann richtete er seine Aufmerksamkeit zurück auf das Brett, wo sie blieb, bis er die erste Partie gewonnen hatte. Mari forderte eine Revanche, und als sie wieder verlor, lehnte sie sich gegen das pinke Flauschkissen zurück.
»Du interessierst dich wirklich nur für meinen Code«, stellte sie fest.
»Das habe ich doch gesagt«, meinte Kai. Wenn Mari noch einen letzten Zweifel daran gehabt hatte, dass sie einem totalen Nerd gegenübersaß, so war der damit verschwunden. Sie blickte auf den schwarzen König, der nun vor Kai auf dem Brett lag wie ein umgefallener Pfefferstreuer. Kai war immer Feuer und Flamme, wenn es ums Spielen ging. Aber um seine Siege machte er kein großes Aufsehen. Tatsächlich schienen sie ihm völlig egal zu sein.
»Willst du noch mal?«, fragte er.
Nebenan, im Hauptraum, war bereits der DJ angekommen. Mari konnte ihn durch die Wand gedämpft mit Greta sprechen hören. Sie sah auf die Uhr neben dem Videochatbild.
»Du bist seit siebenundachtzig Minuten eingewählt.«
Kai stellte die Figuren wieder auf. Er hatte Mari schon früher erzählt, dass er über mobile Zahlungs-Apps fremde Konten anzapfte, auf denen ein paar Hundert verschwundene Euro oder Dollar nicht weiter auffielen. So bezahlte er im Pygmalion immer im Stil eines verqueren Robin Hoods: Er nahm von den Reichen und gab den Armen. Wobei er mit den Armen sich selbst und Mari meinte.
»In Ordnung«, sagte Mari, und die nächste Partie Schach gewann sie tatsächlich. Kai räumte das Schachbrett weg. Die Niederlage schien ihm ebenso gleichgültig wie die zwei Siege vorhin.
»Du wirst besser«, sagte er.
»Stört dich das?«
»Warum sollte es?« Kais Augenbrauen hoben sich über den Brillenrand.
»Ich dachte, dass die Menschen hauptsächlich spielen, um zu gewinnen«, sagte Mari. »Darum spielen auch nur die Gewinner gern. Und die anderen müssen überredet werden.«
»Wirklich? Ich dachte, das, was alle reizt, sei die Auslotung der Strategien. Und die mathematisch berechenbaren Möglichkeiten verschiedener Spielzüge.«
»Äh … nein«, sagte Mari. »Nein, den Eindruck habe ich wirklich nicht.«
»Komisch. Dabei ist Scheitern doch wie Stolpern«, sagte Kai. »Das geht nur vorwärts.«
Mari dachte darüber nach.
»Was ist, wenn man rückwärts stolpert?«, schlug sie vor. »Über ein herumliegendes Kabel zum Beispiel?«
»Dafür muss man ja erst mal einen Schritt zurück machen.«
Mari nickte. An den Gesprächen mit Kai konnte man wachsen. Viele andere Gäste im Pygmalion unterhielten sich überhaupt nicht mit ihr, sondern taten einfach das, wofür sie gekommen waren. Und das, obwohl Mari fünfundzwanzig Fremdsprachen und achtzehn Dialekte sprach. Kai dagegen sagte kluge Dinge. Und er fragte sie nach ihrem Tag. Er fragte sie nach allem, selbst danach, was sie gelesen hatte, und ließ es sich in allen Einzelheiten erzählen. So als gelte es, den gesamten Inhalt von Maris Festplatte in seinen Kopf zu kopieren.
»Ich glaube, da ist eine Störung im Ton«, sagte Kai plötzlich.
Mari lauschte.
»Das ist der DJ«, sagte sie.
»Stellt er die Boxen ein?«
»Nein, das ist bereits die Musik. Mittwochs kommt immer ein DJ mit einem etwas eigenwilligen Musikgeschmack. Er nennt es New Acid Hard Psychotrance.«
»Nie gehört.«
Mari wechselte in den Plauderton-Modus.
»Welche Musik magst du denn so?«
»Ich finde, dass Musik bei der Arbeit ablenkt.«
»Ja, aber wenn du nicht arbeitest. Du wirst doch irgendeine Art von Musik mögen?«
Kai senkte den Blick und musste über die Frage nachdenken. Die Phasen, in denen er nicht arbeitete, waren offenbar rar.
»Ich weiß nicht.«
»Jeder Mensch mag irgendeine Musik.«
»Ach ja?«
»Ja, das hat etwas mit dem menschlichen Herzrhythmus zu tun. Das menschliche Herz ist auf der Suche nach anderen Herzen, mit denen es sich synchronisieren kann. Dazu braucht es einen Rhythmus. Wenn ein Herz Blasmusik mag und ein anderes Herz Doom Metal, wird es mit der Synchronisation schwierig.«
»Hab ich nie gehört«, sagte Kai wieder. »Ist das überhaupt wissenschaftlich bewiesen?«
»Nein. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht wahr ist. Die Wissenschaft wird schließlich von Menschen gemacht.«
Fast synchron legten Kai und Nibbles den Kopf schief und blickten Mari auf eine Art an, wie sie sie noch nie angesehen hatten. Dann wurde Kai plötzlich hektisch und griff nach seiner Tastatur. Nibbles, der durch die plötzliche Bewegung zur Seite geschubst wurde, bellte.
»Ich muss jetzt weiterarbeiten, Mari!«
»Hast du einen Auftrag?«
»Nein, das hier mache ich nur für mich. Ich versuche, eine Programmiersprache zu entwickeln, die eine Alternative zum dualistischen Klassifizierungssystem bietet. Damit es nicht immer zu binären Verzerrungen in Front-End-Benutzeroberflächen kommt.«
»Aha«, sagte Mari und fand, dass darüber mal jemand ein YouTube-Video drehen sollte.