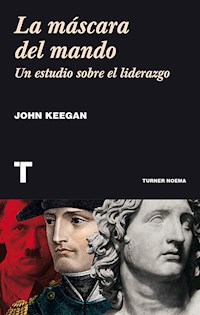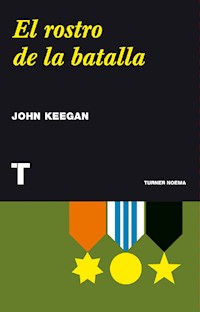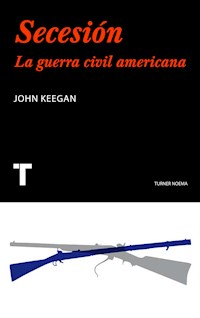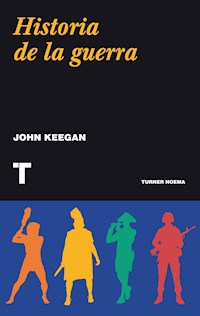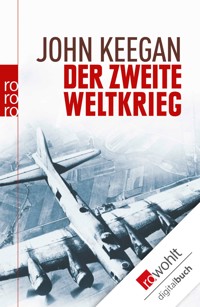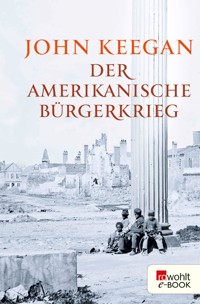
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit über 700 000 gefallenen Soldaten war der Amerikanische Bürgerkrieg blutiger und verlustreicher als alle Kriege zusammen, die die USA seither geführt haben. Und was seine Brutalität und Totalität angeht, nahm er sogar die Schrecken des Ersten Weltkriegs vorweg. Für John Keegan, laut New York Times «der originellste Militärhistoriker der Gegenwart», ist dieser Konflikt schlichtweg der erste moderne Krieg und zugleich «der wichtigste ideologische Kampf der Weltgeschichte». In seinem Buch schildert er nicht nur die Vorgeschichte des Bürgerkriegs, die großen Ereignisse und Schlachten und welche Folgen sie hatten – er widmet sich genauso den Protagonisten wie Abraham Lincoln, Robert E. Lee oder Ulysses Grant. Dabei geht es ihm neben der profunden militärhistorischen Analyse auch um die politischen Dimensionen und die menschlichen Erschütterungen. Nicht zuletzt beschäftigt ihn die Frage, wie es möglich war, dass ein Land, das so sehr auf Konsens gebaut ist wie die Vereinigten Staaten, von einem tödlichen Bruderkonflikt zerrissen wurde. Ein Standardwerk, das eine Lücke schließt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
John Keegan
Der Amerikanische Bürgerkrieg
Deutsch von Hainer Kober
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Einleitung
Kapitel eins: Norden und Süden leben sich auseinander
Kapitel zwei: Wird es Krieg geben?
Kapitel drei: Improvisierte Armeen
Kapitel vier: Kriegführung
Kapitel fünf: Die militärische Geographie des Bürgerkriegs
Kapitel sechs: Soldatenleben
Kapitel sieben: Pläne
Kapitel acht: McClellan übernimmt das Kommando
Kapitel neun: Der Krieg in der Mitte
Kapitel zehn: Lees Krieg im Osten, Grants Krieg im Westen
Kapitel elf: Chancellorsville und Gettysburg
Kapitel zwölf: Vicksburg
Kapitel dreizehn: Unterbrechung der Verbindung Chattanooga–Atlantik
Kapitel vierzehn: Überland-Feldzug und Fall Richmonds
Kapitel fünfzehn: Der Einfall in den Süden
Kapitel sechzehn: Die Schlacht vor Cherbourg und der Bürgerkrieg zur See
Kapitel siebzehn: Schwarze Soldaten
Kapitel achtzehn: Die Heimatfronten
Kapitel neunzehn: Walt Whitman und die Verwundeten
Kapitel zwanzig: Die Generalität des Bürgerkriegs
Kapitel einundzwanzig: Die Schlachten des Bürgerkriegs
Kapitel zweiundzwanzig: Hätte der Süden weiterbestehen können?
Kapitel dreiundzwanzig: Kriegsende
Abbildungen
Anhang
Literatur
Anmerkungen
Danksagung
Register
Bildnachweis
Für Lindsey Wood
Einleitung
Eines meiner früheren Bücher begann ich mit dem Satz: «Der Erste Weltkrieg war ein grausamer und unnötiger Krieg.» Der Amerikanische Bürgerkrieg war sicherlich ebenfalls grausam, sowohl was das Leiden der Teilnehmer angeht als auch die Sorgen und Nöte der Zivilbevölkerung. Aber er war kein unnötiger Krieg.
Im Jahr 1861 war die Spaltung, verursacht durch die Sklaverei als das wichtigste aller Dinge, die Nord und Süd voneinander trennten, so virulent geworden, dass nur eine umfassende Veränderung zu einer Lösung führen konnte. Mit Sicherheit erforderte dies die Abkehr von der Überzeugung, Sklaverei sei das einzige Mittel, das amerikanische Rassenproblem im Zaum zu halten; vielleicht auch die dauerhafte Trennung der Sklavenhalterstaaten und ihrer Sympathisanten vom übrigen Teil des Landes; und möglicherweise, bedenkt man die Verwerfungen, die eine solche Trennung nach sich ziehen würde, den Krieg. Das heißt jedoch nicht, dass der Krieg unumgänglich gewesen wäre. Politische und soziale Variablen aller Art hätten zu einer friedlichen Lösung führen können: Wenn der Norden einen im Amt erfahrenen Präsidenten statt eines neugewählten gehabt hätte, dessen Einstellung gegen die Sklaverei dem Süden weniger provokant erschienen wäre; wenn der Süden über eine potenzielle nationale Führungspersönlichkeit mit der Fähigkeit und Redekunst eines Lincoln verfügt hätte; wenn beide Seiten, insbesondere jedoch der Süden, nicht in so starkem Maße von dem naiven Militarismus der Freiwilligenregimenter und Schützenvereine geprägt gewesen wären, die es um die Mitte des 19.Jahrhunderts in der angelsächsischen Welt beiderseits des Atlantiks in großer Zahl gab; wenn die Industrialisierung der Nordstaaten ihren Optimismus nicht gefördert hätte, der Kriegslust des Südens die Stirn bieten zu können; wenn Europas Appetit auf Baumwolle nicht so viele Pflanzer und Produzenten südlich der Mason-Dixon-Linie im Glauben gestärkt hätte, diplomatische Anerkennung erzwingen zu können; wenn Unsicherheit nicht zunehmend zur prägenden Geisteshaltung des Nordens wie des Südens geworden wäre – dann hätte vielleicht der schlichte Wunsch nach Frieden und seiner Wahrung den Lärm der marschierenden Massen und der Rekrutierungsversammlungen verstummen lassen und der großen Republik einen Weg durch das Kriegsfieber zu Normalität, Ruhe und Ausgleich gewiesen.
Denn die Amerikaner waren es gewohnt, Kompromisse zu schließen. Ein halbes Dutzend Mal hatten sie bereits im Laufe des 19.Jahrhunderts die Gefahr einer Spaltung mittels gütlicher Übereinkünfte abgewendet. Auch dass das Land zu Beginn des 19.Jahrhunderts den Ausgleich zur Leitlinie seiner Beziehungen mit den alten Kolonialherren machte und – mit der einmaligen Ausnahme des Kriegs von 1812 – auf alle Konflikte mit England dauerhaft verzichtete, verdankte es seiner Kompromissfähigkeit. Allerdings waren die Amerikaner auch ein prinzipientreues Volk. Sie hatten Grundsätzliches in die richtungweisenden Präambeln ihrer wunderbaren konstitutiven Dokumente aufgenommen: der Unabhängigkeitserklärung, der Verfassung und der als Bill of Rights bezeichneten ersten zehn Zusatzartikel der Verfassung. Im Zustand politischer Erregung griffen die Amerikaner gern auf solche Grundsätze zurück: als Orientierung, die ihnen den Weg aus ihren Schwierigkeiten aufzeigte.
Unglücklicherweise ließen sich die wichtigsten Unterschiede, die Nord und Süd 1861 voneinander trennten, als Grundsatzfragen darstellen: Die Integrität der Republik und deren unumschränkte Macht wie auch die Rechte der Gliedstaaten wurden seit den Gründertagen stets beschworen, wenn der Fortbestand der Republik gefährdet war. Auf diese Grundsätze hatten sich während der politischen Zwistigkeiten in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts so lautere und beredsame Männer wie Henry Clay und John Calhoun immer wieder aufs Neue bezogen. Es sollte sich letztlich zudem als verhängnisvoll erweisen, dass Amerika Meinungsführer von großer Überzeugungskraft hervorbrachte. Der Süden, der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts Herr der Debatte gewesen war, hatte jedoch in ebenjenem Augenblick, als der verbale Streit in den Ruf zu den Waffen umzuschlagen drohte, das Pech, dass der Norden über einen politischen Führer verfügte, der besser und überzeugender zu reden verstand als die eigenen Interessenvertreter.
Der Krieg muss 1861 schon unter der kontroversen Debatte geschwelt haben, denn kaum hatte der Süden sich organisatorisch auf die Sezession vorbereitet, da ernannte er nicht nur seinen eigenen konföderierten Präsidenten, sondern auch einen Kriegsminister und dazu Minister des Äußeren, der Finanzen und des Innern. Kurz nachdem Präsident Lincoln sein Amt angetreten hatte, verpflichtete er die Milizen aus den Nordstaaten zum Dienst für den Bund und rief Zehntausende auf, sich freiwillig zu den Waffen zu melden. Innerhalb weniger Wochen übten in einem der friedfertigsten Gemeinwesen der zivilisierten Welt zahllose Männer das Marschieren und die Handhabung von Waffen. Es sollte zwar noch eine Zeit dauern, bis genügend Waffen verfügbar waren. Diese Verzögerung führte jedoch nicht zu einer Mäßigung des Aufruhrs, denn die Kampfansage an Integrität und Autorität der Republik hatte bei vielen tiefsitzende Leidenschaften geweckt. In der Alten Welt waren es die nationalen Befreiungskämpfe gewesen, im spanischsprechenden Teil des Kontinents ebenso wie im englischsprachigen, die die Völker zu ihrer Sache erhoben hatten. Die beiden Amerikas von 1861 hingegen, der Norden wie der Süden, waren stillschweigend übereingekommen, dass die Grundsatzfrage, die der Konflikt mit der Wahl Abraham Lincolns aufwarf, gewichtig genug war, um mit der Waffe entschieden zu werden. Dadurch gewann die bevorstehende Auseinandersetzung eine düstere Perspektive: Es sollte ein Krieg der Völker, ein Bürgerkrieg werden, und die Menschen beider Seiten sollten fortan das, was sie voneinander unterschied, für bedeutender ansehen als die Werte, die sie seit 1781 als dauerhaft und verbindlich anerkannt hatten.
Zunächst konzentrierten sich die Führer des Nordens wie des Südens auf die Frage, wie dieser Krieg geführt werden sollte. Für den Süden stellte sich die Sache unkompliziert dar: Er würde seine Grenzen verteidigen und jeden Eindringling abwehren. Im Norden lagen die Dinge nicht so einfach. Jeder Krieg bedeutete eine Rebellion, Widerstand gegen seine Autorität, der gebrochen werden musste; doch wie und – noch wichtiger – wo sollte dem Gegner die Niederlage zugefügt werden? Der Süden erstreckte sich über die Hälfte des Staatsgebiets, stellte eine ungeheure Fläche dar, die nur an wenigen, weit auseinanderliegenden Punkten an die infrastrukturell durchorganisierten Regionen des Nordens stieß. Als der Krieg im April 1861 dann ausbrach, schien er infolgedessen zunächst willkürlich und wahllos, planlos und weitgehend führungslos zu sein; die embryonalen Armeen fielen übereinander her, wann und wo immer sie sich begegneten. Die ersten Gefechte waren unbedeutende, kleine Scharmützel auf «unumkämpftem Gebiet», wie ein Korrespondent der Londoner Times sie abfällig bezeichnete. Dass die erste größere Schlacht des Kriegs, die Erste Schlacht am Bull Run – so die Bezeichnung der Union, nach konföderierter Nomenklatur die Erste Schlacht von Manassas–, mit einem Sieg des Südens endete, erwies sich für die Konföderation als besonders günstig – aber für die Vereinigten Staaten hatte es schlimme Folgen. Der unverhoffte Erfolg entmutigte den Norden, während der Süden nun davon überzeugt war, dass der Sieg zu erringen sei. Wäre die Schlacht anders ausgegangen, was ohne weiteres möglich war, hätte der Krieg vielleicht ein früheres Ende genommen und wäre den Norden wie den Süden nicht so teuer zu stehen gekommen.
So aber war ein Resultat der Schlacht am Bull Run, dass der Krieg als Auseinandersetzung großen Stils geführt werden musste und beiden Seiten den vollen Einsatz aller Ressourcen abverlangte. Bald wurde der Bürgerkrieg zum Krieg der Verlustziffern, nicht anders als später der Vietnamkrieg. Das bevölkerungsreiche Nord-Vietnam konnte in den 1960er Jahren einen solchen verlustreichen Krieg durchhalten und die 50000 jungen Menschen, die von den USA und ihren Verbündeten jährlich getötet wurden, im Folgejahr ersetzen, ohne dass seine Kriegsanstrengungen spürbar darunter litten. Der amerikanische Süden konnte solche Lasten nicht tragen. In den Jahren 1861 bis 1864 schien er imstande zu sein, ohne Schwächung die im Kampf oder durch Erkrankung im Feld eingetretenen Verluste zu ersetzen, doch dieser Anschein der Unanfechtbarkeit war trügerisch. Für den Süden endete der Blutverlust nach und nach tödlich, während der Norden mit seiner größeren Bevölkerung zwar litt, die Verluste aber ausgleichen und weiterkämpfen konnte. So, wie der Norden dem Süden die wehrfähigen Männer raubte – vielleicht eine Million–, so verleibte er sich auch dessen Gebiet allmählich ein. Der Zug des Unions-Generals Ulysses S.Grant nach Shiloh führte nicht nur zu starken Verlusten, sondern leitete auch die Halbierung des Südens ein. Darauf folgte die Zerstückelung. Zunächst dadurch, dass Grant quer durch das südliche Tennessee zum Süden Georgias vorstieß, später dann, indem er den Tiefen Süden von den Grenzstaaten abschnitt. Anschließend konnte er den Süden in immer kleinere Teile zerlegen, wobei er ihm von Mal zu Mal schwere Menschenverluste zufügte.
Die Konföderierten, insbesondere die Nord-Virginia-Armee unter dem Oberbefehl Robert E.Lees, konnten dem Norden keine vergleichbaren Verluste bereiten. Lees Einfälle in Pennsylvania und Maryland waren kaum mehr als größere Strafexpeditionen. Er vermochte in keinem der beiden Staaten auf Dauer Fuß zu fassen, und obwohl Lee in großen, verlustreichen Schlachten, so am Antietam und bei Fredericksburg, die Oberhand behielt, musste er dafür einen hohen Preis zahlen. Nach dem Fehlschlag seiner Expeditionsunternehmen hatte Lee für den Osten keine Strategie mehr; er konnte lediglich noch starke Abwehrstellungen halten und zusehen, wie die Union im Westen eine zunehmend wirkungsvolle Strategie entfaltete.
Der Amerikanische Bürgerkrieg zählt zu den rätselhaftesten großen Kriegen der Geschichte. Rätselhaft, weil unerwartet; rätselhaft aber auch wegen der Heftigkeit, mit der er entflammte. Ein großer Teil dieses Rätsels rührt von dem Umstand her, dass ein Bürgerkrieg ausgerechnet in einem Land zum Ausbruch kommen sollte, das sich seit seinen ersten Anfängen dem Frieden unter den Menschen verschrieben hatte, der Bruderliebe seiner Bewohner, wie die bei Kriegsausbruch zweitgrößte Stadt des Landes, Philadelphia, in ihrem Namen verkündete. Auch aufgrund seiner Humangeographie ist der Bürgerkrieg rätselhaft, da er anfänglich auf das unmittelbare Umfeld seiner beiden Hauptstädte, Washington und Richmond, fixiert zu sein schien, ehe er später wie ein exotischer Eindringling aus einer tropischen Flora unverhofft weitab von den Schlachtfeldern Virginias in Tennessee, Missouri und Louisiana aufkeimte – und seine wahren Wurzeln oftmals nicht mehr zu erkennen waren. Abraham Lincoln, der neue Präsident, sagte 1861, es sei «in gewisser Weise ein Krieg um Sklaverei», doch 1862 und 1863 trieb der Krieg seine kräftigen, aggressiven Ableger in Teile der kurz zuvor noch vereinigten Staaten, wo die Sklaverei nur ein höchst marginales Kennzeichen des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens war.
Heute wissen wir, dass viele Südstaatler eigentlich gar keine persönliche Beziehung zur Sklaverei hatten, weder als Sklavenhalter noch als Nutznießer von Sklavenarbeit. Dies jedoch hinderte sie nicht daran, sich zu Tausenden zum neuaufgestellten Heer der Konföderation zu melden und in den Schlachten mit unglaublicher Kühnheit und bewundernswertem soldatischem Können gegen die Armee der Union zu kämpfen. Dies war ein weiteres geheimnisvolles Moment des Kriegs: Warum kämpften Männer ohne jedes vernünftige Interesse an einem Krieg so verbissen gegen die Nordstaatler, die angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage häufig von ihren armen Gegnern aus dem Süden nicht zu unterscheiden waren? Im Süden wurde das Fehlen einer unmittelbaren persönlichen Motivation oftmals in dem Paradoxon deutlich: «Eines reichen Mannes Krieg, aber eines armen Mannes Kampf.» Darin kommt die unleugbare Tatsache zum Ausdruck, dass sich in den Reihen der Grauen kaum Sklavenhalter mit Großgrundbesitz oder deren Söhne fanden, dafür jedoch sehr viele arme Bauern und nicht wenige Männer, die gar nichts besaßen.
Auch der unterschiedliche Wohlstand von Norden und Süden verleiht dem Krieg eine rätselhafte Dimension. Unter dem Strich war der Süden – anders als vielfach kolportiert – nicht reich genug, um gegen die ernstzunehmenden Kriegsanstrengungen der Union durchhalten zu können. Das Pro-Kopf-Vermögen war im Süden zwar größer als im Norden, aber nur aufgrund des Marktwerts der Sklaven und wegen der Barerträge, die sie hervorbrachten; ein Reichtum, der sich in privater Hand befand. Die Kapital- und Ertragswerte der Wirtschaft des Nordens übertrafen die des Südens bei weitem, da jener unentbehrliche Rohmaterialien– Eisen, Stahl, Nichteisenmetalle, Kohle, Chemikalien – in großen Mengen produzierte und über Transport- und Umschlagmöglichkeiten verfügte, der Süden jedoch nicht. Noch weiter lag der Süden bei den Industrieprodukten zurück. 1861 exportierte der Norden bereits Kohle und Stahl auf eigene Rechnung; im Jahr 1900 übertraf seine Produktion kriegswichtiger Güter bereits die Großbritanniens. Dieser Umschwung des ökonomischen Schicksals zeichnete sich bei Ausbruch des Bürgerkriegs bereits ab.
Dass eine Kriegspartei, die der anderen wirtschaftlich so weit unterlegen und personell so sehr im Hintertreffen war wie der Süden gegenüber dem Norden, so lange einen Kampf so großen Ausmaßes zu führen vermochte, das macht das Rätsel dieses Kriegs aus.
Kapitel eins
Norden und Süden leben sich auseinander
Amerika ist anders. Heute, da der amerikanische «Exzeptionalismus» zum Gegenstand akademischer Forschung geworden ist, sind die Vereinigten Staaten – abgesehen von ihrem Wohlstand und ihrer militärischen Macht – weit weniger eine Ausnahmeerscheinung als in den Jahren, als man nur per Segelschiff über den Atlantik dorthin zu gelangen vermochte. Damals, bevor die amerikanische Kultur von Hollywood, der Fernsehtechnik und der internationalen Musikindustrie globalisiert wurde, unterschied Amerika sich räumlich und gesellschaftlich von der Alten Welt, aus der es hervorgegangen war. Europäer stießen dort auf Unterschiede jeglicher Art, nicht nur in politischer und wirtschaftlicher, sondern auch in menschlicher und sozialer Hinsicht. Die Amerikaner waren größer gewachsen als Europäer – selbst ihre Sklaven waren größer als deren afrikanische Vorfahren–, dank des Überflusses an Nahrungsmitteln, den die amerikanische Landwirtschaft erzeugte. Amerikanische Eltern gestatteten ihren Kindern eine Freiheit, wie man sie in Europa nicht kannte; vor Züchtigungen und Bestrafungen nach Art europäischer Eltern schreckten sie zurück. Ulysses S.Grant, später Oberkommandierender der Unionsarmeen und Präsident der Vereinigten Staaten, beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, was es von Seiten seiner Eltern nie gegeben habe: «…kein Schelten, keine Bestrafung… keine Einwände gegen vernünftige Vergnügungen wie Angeln, im Sommer in dem eine Meile entfernten Fluss zu schwimmen, die Großeltern zu Pferd im fünfzehn Meilen entfernten nächsten Landkreis zu besuchen, im Winter Schlittschuh zu laufen oder ein Pferd vor den Schlitten zu spannen, sobald Schnee lag»1. Diese Schilderung seiner Kindheit entsprach zu jener Zeit den Verhältnissen, wie sie auf dem Lande in den meisten begüterten Familien anzutreffen waren. Die Grants lebten in bescheidenem Wohlstand; Jesse Grant, der Vater des künftigen Präsidenten, besaß eine Gerberei und bewirtschaftete einen weitläufigen Besitz, Ackerland und Forsten. Doch zu jener Zeit waren die meisten alteingesessenen Familien wohlhabend; die Grants selbst waren 1630 in die Neue Welt gelangt. Dieser Wohlstand war der Grund für ihren gelassenen Umgang mit der Nachkommenschaft, denn sie hatten es nicht nötig, den Nachbarn durch Bändigung ihrer Kinder einen Gefallen zu tun. Die Kinder der Wohlhabenden waren dennoch gesittet, wurden sie doch zu Schulbesuch und Kirchgang angehalten. Beides gehörte zusammen, wenn auch nicht zwingend. Lincoln war zwar ein besonders nachsichtiger Vater, jedoch kein strenggläubiger Christ. In Amerika, einem – vor 1850 überwiegend protestantischen – Land der Kirchgänger, musste man die Bibel lesen können. Nördlich der Mason-Dixon-Linie, der informellen Grenze zwischen Nord und Süd, konnten vier Fünftel der Amerikaner lesen und schreiben. Fast alle Kinder im Norden, und wirklich alle in Neuengland, besuchten eine Schule – ein viel höherer Prozentsatz als selbst in England, Frankreich oder Deutschland, wo der Alphabetisierungsgrad etwa bei zwei Dritteln lag. Amerika wurde auch ein Land der Hochschulabsolventen, die Universitäten Harvard, Yale, Columbia, Princeton und das William and Mary College brachten es gleich nach ihrer Gründung zu beachtlicher Qualität. Amerika konnte es sich leisten, einen solchen Hochschulbetrieb einzurichten und zu unterhalten, da es bereits erkennbar wohlhabender als Europa war; reich aufgrund seiner Landwirtschaft, obwohl noch kein Agrarexportland, und zunehmend prosperierend aufgrund seiner Industrialisierung. Es war ein Presseland mit einer riesigen Leserschaft und unzähligen Lokalzeitungen und einigen überregionalen städtischen Blättern. Die zahlreiche Köpfe zählende amerikanische Ärzteschaft beherrschte ihr Handwerk, und Erfindungsreichtum und technische Begabung der Bevölkerung wurden von allen Besuchern hervorgehoben. Dies galt auch für den lebendigen, engagierten Politikbetrieb. Amerika wurde geprägt von politischen Ideen und Bewegungen und war sich seiner Entstehung in Freiheit und des Vermächtnisses der Revolution bewusst; der Anti-Imperialismus war eines seiner Gründungsprinzipien gewesen. In den Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg erlebte Amerika einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine industrielle Revolution ganz eigener Art. Die eigentliche industrielle Revolution in England hatte ihren Anstoß durch die Nutzbarmachung der Dampfkraft erhalten; die Primärenergie zur Ausbeutung der umfangreichen Erzlagerstätten fand sich in den reichen Kohlevorkommen der Insel. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts begann auch in Amerika der Kohle- und Eisenerzabbau, beide Rohstoffe waren unter Tage in gewaltigen Mengen vorhanden, doch anfangs waren es zwei andere Energiequellen, die die Vermehrung der Fabriken und Werkstätten voranbrachten: Wasserkraft und Holz. Die Flüsse Neuenglands, New Yorks und Pennsylvanias trieben Schaufelräder, und die endlosen Wälder lieferten das Brennholz. Die Zeiten, da der Holzeinschlag für das nötige Heizmaterial sorgte, waren in Europa längst Vergangenheit. Der alte Kontinent war, abgesehen von Skandinavien und dem Inneren Russlands, weitgehend entwaldet. In Amerika waren Bäume noch immer ein Hindernis und mussten, um Ackerland zu gewinnen, gerodet werden. Zersägt aber lieferten sie den Rohstoff von Baumaterialien und Holzerzeugnissen jeder Art. Amerika musste entwaldet werden, wo dessen Boden landwirtschaftlich genutzt werden sollte, und im Zuge dieser Maßnahme gingen Industrialisierung und Abholzung Hand in Hand. In den 1830er Jahren und auch danach noch verbrauchte die Stadt New York jährlich mehrere Millionen Fuhren Holz, eingeschlagen und entrindet in Maine und New Jersey. Erst allmählich wurden Kohlezechen gegraben und erweitert, anfangs von Einwanderern aus den englischen Kohlenfeldern und den walisischen Tälern, doch hatte sich die Förderleistung der Anthrazit-Felder Pennsylvanias in den dreißig Jahren bis 1860 vervierzigfacht. Zu dieser Zeit war in den Vereinigten Staaten eine charakteristische Wirtschaftsgeographie erkennbar. New York und Philadelphia bildeten die Zentren der expandierenden Industrieregionen; der Kohleabbau erfolgte auf den Feldern New Jerseys, Pennsylvanias und in den Alleghenies, einem Teil der Appalachen; um Pittsburgh entwickelte sich ein Industriegebiet, und das südliche Neuengland war das Revier der florierenden Textilindustrie und des Maschinenbaus. Im Norden war der Anteil der Landarbeiter an der Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung auf weniger als vierzig Prozent gesunken, während er in den Südstaaten unverändert bei über achtzig Prozent lag. Eine wirtschaftsgeographische Karte hätte gezeigt, dass es südlich der Linie St.Louis– Louisville– Baltimore kein industrielles Zentrum gab; im Süden lebten neun Zehntel der Bevölkerung auf dem flachen Land, im Norden lediglich ein Viertel. Holz verfeuerten auch die Schaufelraddampfer, die ab 1850 alle schiffbaren Binnengewässer befuhren, ebenso die Dampflokomotiven, die auf einem Schienennetz, das immer weiter gespannt wurde, um die bedeutenderen Städte untereinander und mit den Seehäfen an der Küste zu verbinden. Im Jahr 1850 erstreckte sich das Schienennetz der Vereinigten Staaten über 9000Meilen, 1860 schon über 30000.Flüsse und nach und nach auch Kanäle waren in den Anfangsphasen des Booms die Hauptverkehrsadern gewesen. Doch Schleppzüge und Flussdampfer verloren gegenüber der Eisenbahn rasch an Bedeutung. 1850 hatte Amerika das Ursprungsland der Eisenbahn-Revolution, England, an Streckenlänge hinter sich gelassen, tatsächlich übertraf die Gesamtlänge der amerikanischen Schienenwege sogar die der übrigen Welt.
Die Vereinigten Staaten waren jedoch noch immer abhängig von der europäischen Industrie, insbesondere Englands, woher die meisten Fertigprodukte bezogen wurden; dies jedoch lag an Englands Frühstart bei der industriellen Revolution. Am Ende des Jahrhunderts hatte sich das gründlich geändert. Allmählich verlor Amerika seinen überwiegend ländlichen Charakter und nahm das Aussehen eines urbanen Landes an. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs lebten mehr Amerikaner auf dem Lande als in der Stadt, für den Süden galt dies in weitaus stärkerem Maße, doch tendenziell begannen die Städter, das Übergewicht zu erlangen. Mit atemberaubendem Tempo entstanden neue Städte, die sich exponentiell rasch vergrößerten. Die alten Städte der kolonialen Landnahme– Boston, New York, Philadelphia, Baltimore – behielten ihren Rang, doch neue Städte traten in Erscheinung und expandierten, insbesondere jenseits der Appalachen und selbst jenseits des Mississippi. Eine Zeitlang schien es, als würde Cincinnati zur wichtigsten neuen Metropole werden, doch fiel es rasch hinter Chicago zurück, dessen Einwohnerzahl in der Zeit von 1840 bis 1860 von 5000 auf 109000 stieg. Man könnte sagen, Chicago hielt dabei nur mit den Vereinigten Staaten in ihrer Gesamtheit Schritt, deren Bevölkerung von 5 306000 im Jahr 1800 bis 1850 auf 23192000 angewachsen war. Ein Teil des Bevölkerungswachstums war auf Einwanderung zurückzuführen, obwohl die Jahrzehnte der Masseneinwanderung noch bevorstanden; zum größten Teil war es jedoch die Folge einer hohen Geburtenrate. Die verblüffende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Vereinigten Staaten bot jedem Beschäftigung, der das Stadtleben vorzog, während in den neuen Staaten jenseits der Appalachen und des Mississippi fast unbeschränkt viel Land verfügbar war, das Scharen von künftigen Bauern oder bereits Ansässigen auf der Suche nach besseren Bodenverhältnissen anlockte. Das Land wuchs überall, wohin ein Besucher auch schauen mochte.
Es war nicht so, dass Amerika das ihm zugefallene Land sich selbst überlassen hätte. Im Gegenteil; in den zwanzig Jahren vor 1860 wurden ungeheuer große Flächen des Halbkontinents unter den Pflug genommen; das war allerdings die Folge innerer Migration, die Bauern verließen ihre Heimat auf dem kargen, ausgelaugten Boden Neuenglands, Virginias und der beiden Carolinas und zogen westwärts in das neue Land in den Tälern des Mississippi und Missouri und jenseits der beiden Flüsse. Die Landentwicklungspolitik des Bundes kam diesen Migranten entgegen. 1800 wurde Land im Besitz der öffentlichen Hand pro Acre (0,4Hektar) für zwei Dollar verkauft, die zu einem Viertel bar bezahlt werden mussten, während die Restschuld in vier Jahren zu tilgen war. 1820 war der Preis auf 1,25Dollar pro Acre gefallen. Die Flächen wurden zu je 640Acres parzelliert und anteilig verkauft. 1832 nahm die Regierung Gebote für ein Viertel einer Viertelparzelle, also 40Acres, entgegen. 1862 erließ der Kongress das Heimstättengesetz, das einem Siedler 160Acres kostenlos übereignete, sobald er sie fünf Jahre lang bewirtschaftet hatte. Mit diesem Gesetz gingen 80Millionen Acres (32Millionen Hektar) endgültig aus Staatsbesitz in Privateigentum über und fanden eine halbe Million Menschen ihr Einkommen. Die amerikanische Grundeigentumspolitik ließ Staaten wie Ohio, Indiana und Illinois, den eigentlichen Mittleren Westen, entstehen. Als die Besiedlung auf die weiter entfernten Prärien in Iowa, Kansas und Nebraska übergriff, sicherten sich die ersten Ankömmlinge die besten Partien. Während der Besiedlung der Prärien herrschte ein untypisch feuchtes Klima, das schwere Arbeit mit reichen Erträgen belohnte. Mit dem 20.Jahrhundert setzte jedoch die Dürre ein, sodass das staubige Trockengebiet nun auf viele Höfe übergriff.
Die Besiedlung erfolgte jedoch nicht nur durch Freie. In der Zeit zwischen 1830 und 1850 zogen die lockenden Gewinne viele Baumwollpflanzer nach Westen in die neuen Länder, insbesondere zu den dunklen, fetten Böden von Alabama und Mississippi und selbst bis in die weit entfernten texanischen Flusslandschaften. Schätzungsweise 800000Sklaven siedelten mit ihren Eigentümern zwischen 1800 und 1860 von der Atlantikküste ins tiefere Binnenland um.
Nicht nur die Bevölkerung Amerikas nahm zu, auch der Wohlstand des Landes wuchs. Da es, von Baumwolle abgesehen, noch kein Exportland war, nahm der riesige Binnenmarkt alle Produkte auf, soweit sie erzeugt werden konnten. In den 1850er Jahren industrialisierte sich ganz Amerika, besonders jedoch jene Landesteile, die seit dem 18.Jahrhundert besiedelt waren: Neuengland, Pennsylvania, New York und Teile Virginias. Zentrum der Industrialisierung war Connecticut. Der Staat besaß wegen seiner Binnenwasserstraßen– Flüsse und Kanäle – vorzügliche Verbindungen mit anderen Teilen seiner Region, dazu verfügte er über reichlich Wasserkraft zum Antreiben der Maschinen seiner Fabriken. Auch in dieser vorindustriellen Wirtschaftsphase fragte Amerika den Ausstoß der Werkstätten und Fabriken Neuenglands nach, die nach Methoden arbeiteten, die bald von der ganzen Welt übernommen werden sollten. In Connecticut entstand das sogenannte amerikanische Fabrikationssystem, das auch treffend als «System der austauschbaren Teile» bezeichnet wurde. Eine gutausgebildete und eingespielte Arbeiterschaft lernte, metallene oder hölzerne Passteile bei so geringen Toleranzen herzustellen, dass das Endprodukt aus beliebig zusammengestellten Einzelteilen montiert werden konnte. Die Standardwaffe des amerikanischen Heers, das Springfield-Gewehr, war ein solches Produkt. Britische Besucher der Springfield-Waffenfabrik waren davon so beeindruckt, dass die englische Regierung die entsprechenden Werkzeugmaschinen kaufte, um sie in ihrer Waffenfabrik in Enfield aufzustellen und für den Krimkrieg gerüstet zu sein. Als 1861 die amerikanische Regierung bedeutende Mengen Gewehre benötigte, konnte die Waffenfabrik in Enfield einen großen Teil des Bedarfs decken. Weil die Läufe der Springfields und Enfields beinahe das gleiche Kaliber hatten – das Enfield das geringfügig größere–, war die amerikanische Munition für beide Waffen gleich gut geeignet, sodass die Unionssoldaten zwischen Springfields und Enfields keinen Unterschied machten. Viele gute Republikaner zogen daher mit einer Handwaffe in den Krieg, auf deren Schlossplatte über den Initialen VR die Königskrone prangte. Das System der austauschbaren Teile ermöglichte auch die Herstellung von Uhren jeder Art, von Haushaltsgeräten, landwirtschaftlichen Maschinen und der zunehmend größer werdenden Zahl von arbeitssparenden Geräten, die amerikanischer Erfindungsgeist in die Welt setzte. In Amerika herrschte chronischer Arbeitskräftemangel, in den Städten wie auf dem Land, sodass jedes Gerät, das die Arbeitsleistung zweier Hände vervielfachen konnte, rasch in Gebrauch genommen wurde. Die Nähmaschine, die es den Hausfrauen ermöglichte, zu Hause für sich selbst und die Familie zu schneidern, oder der Schneiderin vor Ort Gelegenheit gab, sich als Kleinunternehmerin selbständig zu machen, wurde in ganz Amerika rasch angenommen, sobald sie perfekt funktionierte. Mittlerweile kauften amerikanische Bauern Erntemaschinen, Mähbinder und Drillmaschinen, um mit deren Hilfe die Arbeiten zu erledigen, für die das Personal fehlte. Das wichtigste Element der Mechanisierung entstand jedoch bereits vor dem 19.Jahrhundert. Es war die Erfindung der Baumwollentkörnungsmaschine, die Eli Whitney 1793 gelang. Die Maschine trennt die Baumwollfasern von den Samenkörnern und der Kapsel, der beide entsprangen. Die Maschine revolutionierte die Faserproduktion. Um ein Pfund Fasern zu gewinnen, wozu sich ein Sklave eine Stunde lang abmühen musste, benötigte die Maschine nur wenige Minuten. Weiterverarbeitet wurden die Fasern im Süden nur in geringer Menge, man schickte die Rohbaumwolle in die Spinnereien des Nordens und musste sie später als gewebte Tuche oder Kleidung von der Stange wieder einkaufen.
Der Abhängigkeit des Südens von den industriellen Ressourcen des Nordens lag ein erkennbarer gesellschaftlicher Unterschied zugrunde. Der Süden blieb, was der Norden im 18.Jahrhundert war, ländlich rustikal strukturiert; die meisten Südstaatler lebten auf dem Land als Subsistenzbauern, die Mais, Schweine und Hackfrüchte zogen, größtenteils für den eigenen Bedarf, aber auch zum Verkauf in der Umgebung. Im Norden dagegen begann schon im 19.Jahrhundert die Landflucht, da es in den Städten gutbezahlte Arbeit gab.
Die Bereitwilligkeit, mit der beide Seiten bei vorübergehender Waffenruhe miteinander gutnachbarlich umgingen, formell wie informell, und die gleiche Bereitwilligkeit, mit der sich beide bei der jeweils anderen Seite in Gefangenschaft begaben, widerlegen die Auffassung, dass es sich beim Norden und Süden um zwei grundverschiedene Gesellschaften handelte. Trotz des Kriegs blieben Amerikaner Amerikaner. Sieht man von Sprachakzenten und Dialekten ab – viele Nordstaatler klagten, dass die Südstaatler kaum verständlich redeten–, so gab es zwischen den Soldaten beider Seiten mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Auf beiden Seiten handelte es sich bei der überwältigenden Mehrheit um junge Männer vom Land, Bauernsöhne in ihren Zwanzigern, die dem Hof den Rücken gekehrt hatten und Soldat geworden waren. Trotz alledem – der Norden und der Süden unterschieden sich, und diese Unterschiede zeigten sich im Charakter ihrer Truppen.
Die Südstaatler stammten, soweit sie nicht Söhne kleinerer Bauern waren, fast ausnahmslos aus Kleinstädten. Nur eine kleine Minderheit war Sklavenhalter. Von den fünf Millionen der weißen Bevölkerung des Südens galten nur 48000 als Pflanzer, das heißt, als Besitzer von mehr als zwanzig Sklaven. Lediglich dreitausend von ihnen besaßen mehr als hundert Sklaven, nur weitere elf hielten mehr als fünfhundert Sklaven – in einer Zeit, da ein tüchtiger, junger Landarbeiter tausend Dollar kostete, ein schwindelerregender Reichtum. Das Herrenhaus mit den weißen Säulen, die das Portal flankierten, inmitten schattenspendender Bäume weitab von den Hütten der Landarbeiter gab es zwar, doch eher in der Phantasie von Fremden denn in der Realität. Die Hälfte der vier Millionen Sklaven im Süden gehörte Männern, die weniger als zwanzig ihr Eigen nannten. Meistens besaßen sie nur einen oder zwei und arbeiteten mit ihnen auf ihren kleinen Landwirtschaften. Die meisten Südstaatler lebten von der Hand in den Mund und besaßen überhaupt keine Sklaven.
Dies erklärt die Redensart, die während des Kriegs, besonders aber in schweren Zeiten für die Konföderierten, in aller Munde war: «Eines reichen Mannes Krieg, aber eines armen Mannes Kampf.» Die meisten konföderierten Soldaten waren arme Teufel und hatten ein schweres Leben hinter sich, ein Umstand, der immer wieder zu der Frage führte: «Wie konnte der Süden unter diesen Umständen so lange und so erfolgreich kämpfen?» Zum Teil liegt die Antwort darin, dass die meisten Südstaatler sich der Institution der Slaverei verbunden fühlten und nach Sklavenbesitz strebten, war der doch im Süden Ausweis des Wohlstands und Erfolgs. Die Politik des Südens wurde von Sklavenhaltern dominiert, und mit dem Kauf von Sklaven stieg das Ansehen des Südstaatlers: vom Kleinbauern zum Großbauern und am Ende vielleicht zum Pflanzer. Noch wichtiger: Die Gesellschaftsordnung des Südens beruhte auf dem System der Sklaverei. Da die Sklaven in vielen Gebieten des Südens zahlreicher als die Weißen waren – so stellten sie in South Carolina und Alabama die Bevölkerungsmehrheit und waren auch in vielen anderen kleineren Gebieten in der Überzahl–, sah man in der Sklaverei die Garantie sozialer Kontrolle.
Obwohl die Pflanzer als Gesellschaftsschicht von den unteren Schichten abgelehnt wurden, blieben sie doch Objekt des Neides und der Begehrlichkeit. Diese Empfindungen waren nicht unrealistisch, gelang vielen Südstaatlern doch der Sprung vom Pächter zum Pflanzer. Fraglich ist jedoch, ob sich viele erfolgreiche soziale Aufsteiger in den Reihen des konföderierten Heeres fanden. Denn die Armee rekrutierte sich weit überproportional aus den Bewohnern des Oberlands, aus den waldigen, hügeligen Regionen im Inneren Georgias, der Carolinas und Virginias; die legendäre Zähigkeit des konföderierten Soldaten war die Folge einer schweren Jugend in Gegenden, die sich zum Anpflanzen von Baumwolle nicht eigneten.
Der typische Soldat des Nordens kam ebenfalls vom Land, jedoch von einem Hof, der dem Vater gehörte und den der Sohn eines schönen Tages beerben würde. Anders als der Südstaatler mit seiner heimlichen, aber ständigen Hoffnung auf sozialen Aufstieg zum Sklavenbesitzer konnte der Nordstaatler solche Hoffnungen auf Vorankommen nicht hegen – es sei denn, er kehrte dem Land den Rücken, ging in die Stadt und verdingte sich als Lohnarbeiter. Im Amerika des 19.Jahrhunderts erfolgte die Veränderung der Lebensumstände durch Landflucht in die Stadt viel rascher, als dies in Europa möglich war. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Befreiung war es, die Tausende von Einwanderern aus der Alten Welt anzog; deren Zahl ging mit Ausbruch des Bürgerkriegs zwar zurück, stockte jedoch niemals.
Man durfte davon ausgehen, dass der Rekrut der Armee des Nordens mehrere Jahre lang eine Schule besucht hatte und aller Wahrscheinlichkeit nach einer der großen protestantischen Glaubensgemeinschaften– Methodisten, Presbyterianer (Calvinisten) oder Baptisten – angehörte. Praktizierende Anhänger religiöser Überzeugungen waren in den meisten Regimentern in der Minderheit, einer gewöhnlich jedoch einflussreichen Minderheit. Captain John Gould vom 10.Maine-Regiment hielt in seinen Notizen fest: «Schmerzlich zu wissen, wie wenige gläubige Christen es in unserem großen Regiment gab – weniger als fünfzig–, doch unbestritten war das Regiment dank der Anwesenheit dieser kleinen Handvoll in jeder Hinsicht wesentlich besser. Sie gaben ein gutes Beispiel ab, denn sie waren gute Soldaten – ein für das Recht kämpfender christlicher Soldat ist immer ein beispielhafter Soldat. In jeder Prüfung war das Regiment immer das stärkere, da es diese wenigen christlichen Männer besaß.»2 Auch die konföderierten Regimenter hatten ihren christlichen Kern, bei dem es sich, obwohl er nicht ohne Bedeutung war, doch etwas anders verhielt: Das Christentum des Südens war durch seine Verwicklung in die Sklaverei diskreditiert. Diese Vorbehalte hatten schon vor dem Krieg zu einer Spaltung der baptistischen und methodistischen Kirche geführt. Selbst fromme konföderierte Soldaten konnten daher höchst unchristliche Gefühle hegen – so 1864 beim Gefecht im Krater bei Petersburg, als sie den Tod schwarzer Soldaten der Union beklatschten und einzelne schwarze Gefangene ermordeten. Auch die Moral der Pflanzergesellschaft brachte das Christentum des Südens in Verruf. In einem Amerika, das der Familie und dem geheiligten Band zwischen der Frau und Mutter und ihrem Ehemann den höchsten Rang zugewiesen hatte, war der fortwährende sexuelle Missbrauch von Sklavinnen durch die Pflanzer und ihre Söhne und die Anwesenheit gemischtrassiger Verwandter in den Sklavenquartieren der Plantage den Frauen und Töchtern der Besitzer ein ständiger Dorn im Auge. In der Gesellschaft des Nordens kam derlei nicht vor; dort praktizierte man, was gepredigt wurde. Im Norden war die christliche Familie Realität, und deren Stärke half, die christliche Frau, personifiziert in Harriet Beecher Stowe, der Verfasserin von Onkel Toms Hütte, zu jener furchteinflößenden Symbolgestalt des Abolitionismus zu machen, die sie oftmals war.
Wenn der Soldat aus dem Norden das Land im Süden kennenlernte, wie es seit 1863 der Fall war, sah er sich in seinen kritischen Ansichten bestätigt. Die Südstaatler waren, abgesehen von den wirklich armen Weißen, die als Selbstversorger auf ärmlichen Höfen wirtschafteten, pro Kopf reicher als die Nordstaatler. Dies lag an der hohen Bewertung der Sklaven als Eigenkapital, wenngleich die Sklavenbesitzer nur unregelmäßig über das Land verteilt waren. In den Augen der Nordstaatler jedoch erschienen sie arm. Das hatte wiederum mit der Lebensart im Süden zu tun. Die Südstaatler kümmerten sich um das Aussehen ihrer Häuser nicht so wie die Nordstaatler, hielten auch Gärten und Anwesen nicht in Schuss wie diese. Elegant gekleidete Frauen ließen sich im Süden von zerlumpten schwarzen Dienstboten begleiten. Die Nordstaatler neigten unter anderem dazu, die Südstaatler nach dem Auftreten ihrer Schwarzen zu beurteilen. Waren die Schwarzen der Sprache nicht recht mächtig und wirkten beschränkt, so vermutete der Soldat des Nordens, schuld daran wäre das schlechte Beispiel ihrer Herrschaften.
Doch trotz wirklicher Unterschiede zwischen Nord und Süd hatten die Soldaten beider Seiten auch vieles gemeinsam. Da sich der Krieg hinzog und dessen Härten und Strapazen den einfachen Soldaten schlimm zusetzten, war das nicht im mindesten überraschend. Sie erduldeten eine gemeinsame Erfahrung, und die Soldaten wurden sich dessen bewusst. Die Soldaten des Nordens, besser verpflegt und versorgt als ihre Gegner, begannen Johnny Reb zu bewundern. Er hatte Schneid. Er war noch kampftüchtig, wenn das Stehvermögen der härtesten Männer auf die Probe gestellt wurde. Johnny Reb selbst hielt sich gemeinhin für besser als Billy Yank – eine Selbsteinschätzung, die sich bis tief in den Krieg hinein hielt. Der Ausgang der Ersten Schlacht am Bull Run schien dies zu bestätigen. Bis zu den ersten Schusswechseln war der Unterschied zwischen Nord und Süd nicht so leicht zu erkennen. Sobald jedoch Blut geflossen war, trat er deutlicher in Erscheinung. Der Krieg als sich selbst erfüllendes Urteil bestätigte den Unterschied.
Dixie – das Gebiet südlich der Mason-Dixon-Linie – war schon vor 1860 zu einem besonderen Gebilde geworden. Dies hatte keine historischen Gründe. Eigentlich war Dixieland auch während der Konföderation zu keiner Zeit der «einmütige Süden». Gebiet und Wirtschaft waren zu unterschiedlich, die Menschen zu verschieden, als dass sie eine geschlossene Einheit gebildet hätten. Außerdem war die Zugehörigkeit zum Süden in ständigem Fluss, wie auch heute noch. Der Süden griff über die Mason-Dixon-Linie hinaus und vereinnahmte das südliche Illinois und Teile New Jerseys, sodass Princeton als Universität des Südens betrachtet wurde. Obwohl die Mehrheit der Südstaatler um 1860 englischer Herkunft war oder schottisch-irischen Ursprungs, wie die Amerikaner die Siedler aus Ulster bezeichnen, so gab es doch auch erhebliche Bevölkerungsteile, die aus anderen Gegenden stammten. Viele Bürger Charlestons und Savannahs kamen von Barbados, während die Vorfahren vieler Einwohner von New Orleans aus dem kanadischen Neufrankreich etappenweise den Mississippi hinabgezogen waren und sich unterwegs in anderen Städten französischer Prägung wie St.Louis in Missouri und Louisville in Kentucky niedergelassen hatten.
Auch hinsichtlich der Quellen seines Reichtums war der Süden nicht homogen. Reich war er allerdings. Das Pro-Kopf-Vermögen seiner freien Bevölkerung wurde doppelt so hoch wie im Norden veranschlagt. Doch war nicht alles Geld der Baumwolle zu verdanken. Baumwolle war eine empfindliche Kulturpflanze. Sie gedieh nur auf bestimmten Böden unter besonderen klimatischen Bedingungen. So entwickelte sie sich sehr gut im «Black Belt», so genannt wegen der tiefdunklen Farbe des Bodens, im tiefen Süden, auf den Sea Islands vor der Küste Georgias und der beiden Carolinas. Bestimmte Sorten hatten sich auch den feuchteren Klimaten in gewissen Teilen von Texas gut angepasst. In Virginia wurde kaum Baumwolle gepflanzt, dort blieb der Tabak die wichtigste Nutzpflanze. Im Mississippi-Delta dominierte das Zuckerrohr, in den beiden Carolinas und im Tiefland Georgias der Reisanbau.
Die Population von Sklaven und Sklavenhaltern entsprach unmittelbar dem Muster der Rohstoffproduktion. Ihre größte Dichte hatte die schwarze Bevölkerung in South Carolina und den Mississippi entlang in Alabama und Mississippi und in der nördlichen Mitte Virginias. In South Carolina, jedoch nicht nur dort, stellten die Sklaven die Bevölkerungsmehrheit. Im ganzen Süden machten sie fast die Hälfte der Einwohnerschaft aus, im Alten Süden sogar die Mehrheit. Sklaven hielt nur eine Minorität, doch die Besitzer von zwanzig oder mehr Sklaven bildeten die herrschende Klasse des Südens und dominierten Wirtschaft und Politik. In der ersten Legislaturperiode des konföderierten Kongresses gehörten vierzig Prozent seiner Mitglieder zur Gruppe der Besitzer von mehr als zwanzig Sklaven. Nur sehr wenige Abgeordnete besaßen gar keine. Sklavenbesitz war das Maß aller Dinge, die im Vorkriegssüden als wichtig galten: nicht nur Wohlstand – zwanzig gesunde Sklaven brachten 20000Dollar–, sondern auch soziale Stellung, Ansehen sowie häusliche Bequemlichkeit und Erleichterungen. Überschüssiges Kapital verwendete man im Vorkriegssüden fast immer zum Ankauf von weiteren Sklaven oder Ländereien, die ihrerseits zur Bewirtschaftung weitere Sklaven benötigten.
Die größten Grundbesitzer verfügten über hundert oder mehr Sklaven. Der Großgrundbesitz war als Plantage angelegt. Dazu gehörte die Hüttenkolonie der Sklaven in der Nähe des Herrenhauses, das gewöhnlich neoklassizistisch und mit einem Säulenvorbau versehen war, dazu Stallungen und, ebenfalls in der Nähe, die Behausung des Sklavenaufsehers. Dieses Bild wurde verewigt durch den ungeheuer erfolgreichen Roman Vom Winde verweht und dem nach dieser Vorlage gedrehten Hollywood-Film; eine Vorstellung vom großzügigen Lebensstil auf den Plantagen, die die Phantasien Amerikas und Europas gefangen nahm; eine Vorstellung von quasiaristokratischem Müßiggang, gebieterischen Gutsherren, befehlsgewohnten Frauen, die von privilegierten Haussklaven bedient wurden, denen aufgrund ihrer langen Verbindung mit der Familie die Freiheit zugestanden war, ihren inzwischen erwachsen gewordenen Schützlingen von einst die Meinung zu sagen; die Vorstellung von einem Leben, das um üppige Gastmähler, häufige gesellschaftliche Vergnügungen und sorglosen Wohlstand kreiste. Die Welt, wie sie in Vom Winde verweht gezeichnet wird, gab es nur vereinzelt, aber es gab sie, und so wurde sie zum Modell, dem die kleineren Pflanzer und die reichen Großbauern nacheiferten. Der Wohlstand des Südens vergrößerte sich in den 1850er Jahren, wenn auch nur, weil die Sklavenpreise stiegen. Der Marktpreis der Baumwolle hatte sich seit 1845 verdoppelt, und die großen Produzenten machten riesige Gewinne, erzielten Kapitalrenditen von 20Prozent. Das Geld floss größtenteils in die Annehmlichkeiten des Plantagenlebens, europäische Mode, rassige Pferde und französische Weine. Viele Großpflanzer lebten gar nicht auf dem Land, sie überließen die Bewirtschaftung den Aufsehern und verbrachten die Zeit in den Landeshauptstädten oder auf Landsitzen, insbesondere an Orten wie Charleston in South Carolina, Natchez in Mississippi oder dem neuen Gartenviertel von New Orleans.
Die Städte des Südens waren, verglichen mit denen des Nordens, alle klein. New Orleans wies eine mindestens viermal größere Bevölkerungszahl auf als jede der übrigen. Montgomery in Alabama, die erste Hauptstadt der Konföderation, wuchs von allen am raschesten, hatte beim Abfall von der Union aber gerade einmal 36000Einwohner. Zu dieser Zeit war Chicago binnen zwanzig Jahren schon auf 109000Einwohner angewachsen, und sowohl St.Louis als auch Cincinnati zählten mehr als 160000Menschen. Zusammen hatten Richmond und Petersburg bei der Sezession lediglich 56000Einwohner – und zwischen dem Unterlauf des Mississippi und der Atlantikküste gab es überhaupt keine größeren Städte; die Einwohnerzahl Charlestons war vor dem Krieg sogar rückläufig. Der Süden machte aus seinem ländlichen Charakter eine Tugend und betonte die Idyllik der Vereinigten Staaten der Gründerväter; tatsächlich war seine Struktur jedoch nur Anzeichen seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Norden und seines relativen Niedergangs. Industriell konnte der Süden nicht mithalten. Zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung lebte die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung südlich der Mason-Dixon-Linie. Um 1860 war die Hälfte der Bevölkerung westlich der Appalachen, zumeist im Tal des Mississippi, beheimatet.
Die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit des Südens litt darunter, dass sein Bildungsstand hinter dem des Nordens zurückblieb. Zwanzig Prozent seiner weißen Bevölkerung waren Analphabeten, während 95Prozent der Neuengländer lesen und schreiben konnten; nur ein Drittel der Kinder des Südens besuchte eine Schule, in Neuengland dagegen waren es drei Viertel und in den Atlantikstaaten und im Mittleren Westen beinahe ebenso viele.
Analphabetismus perpetuiert die Armut, und die Südstaatler waren arm. 1860 besaß in den Vereinigten Staaten die Hälfte der Bevölkerung nur ein Prozent des Volksvermögens, doch die risikobereiten Nordstaatler hatten und nutzten die Gelegenheit, durch Abwanderung in die Städte ihren persönlichen Wohlstand zu steigern. Im Süden war nicht die Baumwolle, sondern der Mais die vorherrschende Nutzpflanze. Zu grobem Mehl geschrotet, wurde daraus derbes Brot gebacken oder Maisgrütze gekocht, auch die Schweine wurden mit Mais gefüttert. Die Hauptnahrung des Südens, jedenfalls außerhalb der großen Herrenhäuser der Pflanzer, waren Maisbrot, Grütze und Schweinefleisch. In den Sklavenquartieren aß man das Gleiche, allerdings mehr Mais und weniger Fleisch.
Das Leben auf der Plantage bestimmte das Bild, das die meisten Amerikaner sich von der Sklaverei machten. Es waren die Plantagen, wo man Sklaven in größter Ballung antraf und zugleich die typischen Merkmale des Sklavenlebens beobachten konnte, repressiv und bezaubernd zugleich. Dass dieses Leben auch seine anrührenden Seiten hatte, hätten nur die erbittertsten Gegner der Sklaverei bestritten. Master und Mistress kümmerten sich gewöhnlich, teils aus Eigennutz, aber teils auch aus Gründen der Menschlichkeit und Zuneigung, um das Wohlergehen ihrer Sklaven; sie arrangierten Freizeiten und Festlichkeiten, gaben Essen, machten Geschenke und feierten mit ihnen besondere Ereignisse wie Geburten und Hochzeiten (eine rechtsverbindliche Ehe von Sklaven gab es in den Sklavenhalterstaaten nicht; konnte es nicht geben, denn die Zahlungsfähigkeit eines Pflanzers hing letztlich davon ab, dass es ihm unbenommen war, sich durch Verkauf seiner Sklaven auf dem Markt Liquidität zu beschaffen). Gute Zeiten und schlechte wechselten selbst auf den am nachsichtigsten geführten Plantagen; bei Fehlverhalten oder Faulheit wurden Sklaven im Regelfall mit der Peitsche geschlagen, vom Aufseher, vom Master selbst oder gar von dessen Frau. Die Plantage war eine geschlossene repressive Gesellschaft. Der Eigentümer stand an der Spitze einer Disziplinarordnung, in der der Aufseher, der normalerweise beschäftigt wurde, die Anweisungen gab, deren Befolgung nötigenfalls gewaltsam von einer besonderen Schicht von Vorarbeitern, den sogenannten Sklaventreibern, durchgesetzt wurde, die Fehler und Vergehen nach oben meldeten. Die Aufseher waren oftmals Söhne der Pflanzer, die sich ins Geschäft einarbeiten oder auf diese Weise das Geld zum Kauf von Land oder Sklaven zusammentragen wollten. Es gab jedoch auch eine Klasse professioneller Aufseher, die so ihren Lebensunterhalt verdiente und vielleicht auch hoffte, Kapital anhäufen zu können; diese Aufseher galten generell jedoch als unsichere Kantonisten, die häufig wieder entlassen wurden – entweder wegen mangelnder Tüchtigkeit oder weil man glaubte, durch ein Auswechseln des Personals die Landarbeiter bei Laune zu halten.
Eigennutz ließ die Eigentümer auf das Wohlbefinden ihrer Sklaven achten, und folglich waren diese meist gut genährt. Allerdings ließ ihre Unterbringung zu wünschen übrig; die Einraum-Sklavenhütte war im Winter kalt, im Sommer übelriechend und zu jeder Zeit mit Parasiten und Krankheitserregern verseucht. Krankheiten waren in den Sklavenquartieren an der Tagesordnung; nur wenige Sklaven wurden älter als sechzig Jahre. Die wahre Bedrohung ihres Wohlbefindens waren jedoch nicht Krankheiten, sondern die Instabilität ihrer sozialen Lage. Es gab keine Rechtsmittel, denn das amerikanische Recht erkannte Ehen zwischen Schwarzen nicht an, selbst wenn die Sklaven selbst und manche ihrer Besitzer sie für bindend hielten. Unter einer wohlwollenden Herrschaft wurden Hochzeiten ganz förmlich gefeiert, vorgenommen von einem schwarzen oder weißen Prediger, jedoch auf etwas modifizierte Weise, letztlich konnten die beiden Beteiligten sich nicht die Treue geloben, «bis dass der Tod uns scheidet». Die familiären Verhältnisse vieler Sklavenpaare hielten lebenslang. Doch selbst der wohlmeinendste Master konnte nicht garantieren, dass angespannte finanzielle Verhältnisse ihn nicht zum Verkauf seiner Sklaven zwingen würden. Sinnigerweise gelobten daher die Sklaven manchmal, «bis dass der Tod oder die Distanz uns scheidet». Aus ebendiesem Grund ließen manche Besitzer keine religiösen Förmlichkeiten zu, sondern präsidierten einer Zeremonie, die man als Besenstiel-Hochzeit bezeichnete: Braut und Bräutigam gaben ihre Bindung aneinander zu erkennen, indem sie gemeinsam über einen Besenstiel hüpften.
Manche Sklavenhalter ermunterten ihre Sklaven zur Eheschließung, da diese auf den Plantagen Zufriedenheit und Stabilität schufen und eine schwarze Gemeinschaft erzeugten. Sie förderten die Ehen, indem sie den Sklaven beim Bau ihrer «Hütten» halfen, wie sie in der einschlägigen Literatur genannt werden, und ihnen Land für ihre Gärten, Hühnerkäfige und Schweineställe zur Verfügung stellten. Auf einer wohlhabenden, erfolgreich geführten Plantage konnten die Sklaven gut leben: Zu festen Zeiten unter der Woche gab der Master die Rationen aus, Mehl, Schweinefleisch, Maismehl; die zusätzlichen Kartoffeln, Erbsen und Rüben zogen die Sklaven selbst. Da der Master den Sklaven – normalerweise – das Jagen erlaubte, kamen Opossum, Waschbär, Kaninchen und Eichhörnchen hinzu.
Der Arbeitstag auf der Plantage war anstrengend und dauerte gewöhnlich bis zu zwölf Stunden, obwohl die Sklaven selber eher fünfzehn zählten. Mit Anbruch der Dämmerung wurde die Arbeit üblicherweise eingestellt. Die Sonntage waren arbeitsfrei, oft auch der Samstagnachmittag. In der Erntezeit waren die Arbeitstage länger, allerdings auch die Pausen während der Arbeitszeit. Die verschiedenen Nutzpflanzen verlangten eine unterschiedliche Zeitplanung. Die Plantagen im Süden Louisianas machten bei der Zuckerrohrernte lange Arbeitstage zur Auflage. Das Entblättern der Maiskolben, das auf den meisten Plantagen regelmäßig anfiel, war eine intensive, langwierige Arbeit, an der die Sklaven jedoch ihre Freude hatten, da sie der Beschaffung ihrer Nahrung galt und durch Spiele und Wettbewerbe aufgelockert werden konnte. Beinahe überall jedoch, auf guten Plantagen wie auf schlechten, bei nachsichtigen wie strengen Herren, wurde die Arbeit unter gewohnheitsmäßigem Einsatz der Peitsche vorangetrieben. Zwanzig, manchmal neununddreißig Schläge verabfolgten der Aufseher oder der Treiber, gelegentlich der Master selbst oder, im Hause, seine Frau. Die Peitsche war ein Teil des Sklavendaseins. Ihre Anwendung wurde durch die öffentliche Meinung geregelt. Rohlinge unter den Sklavenhaltern traf die Missbilligung ihrer Nachbarn, doch dessen ungeachtet wurde weiterhin ausgepeitscht. Einige Sklavenhalter rühmten sich, nie zur Peitsche gegriffen zu haben, doch sie waren in der Minderheit. Manche Sklaven, vornehmlich die privilegierten Haussklaven, wurden niemals ausgepeitscht, aber auch sie waren nur die Minderheit. Ein Sklavenaufseher, der sich mit der Peitsche an einer Mammy vergriff – der schwarzen Haussklavin, die gewöhnlich das frühere Kindermädchen der Hausherrin war und in allen wichtigen Familienangelegenheiten konsultiert wurde, um zu raten und abzuraten–, wurde auf der Stelle entlassen und mit seiner Familie am selben Tage noch der Plantage verwiesen. Doch dieses Vergehen war ebenso ungewöhnlich wie die entsprechende Bestrafung.
Die Routineabläufe verlangten, dass die Sklaven ihre persönlichen Bedürfnisse den zeitlichen Erfordernissen der Feldarbeit unterordneten. Von dieser Notwendigkeit besonders schwer betroffen waren die Frauen, denn am Ende eines schweren Arbeitstages mussten sie noch für die Familie kochen. In Berichten der Sklavenhalter ist oft die Rede davon, dass sie ihre zufriedenen Landarbeiter bei Einbruch der Nacht schwatzend oder singend um die Feuerstelle ihrer Hütte versammelt vorfanden, doch unter der Woche ließ die Arbeit den Sklaven wenig freie Zeit. Allerdings konnten sie in aller Regel mit dem arbeitsfreien Sonntag rechnen, denn der Süden war ein gottesfürchtiges Land, und der Sonntag musste respektiert werden. Im 19.Jahrhundert war die schwarze Bevölkerung Amerikas generell christlichen Glaubens. Elemente afrikanischer Religionen hatten sich allerdings erhalten, insbesondere in den Gullah-Regionen an der Küste Georgias, und die schwarze Christenheit hatte afrikanische Züge integriert, darunter das Tanzen beim Singen der Kirchenlieder und die lauten, zustimmenden Rufe der Gläubigen während der Predigt. Zumeist schlossen sich die Sklaven der baptistischen und der methodistischen Kirche an, wahrscheinlich wegen deren informeller Organisation und des spontanen, inspirierenden Charakters ihrer Gottesdienste. Bis zum Ende des 18.Jahrhunderts waren schwarze Gemeindemitglieder in den weißen Kirchen nicht gelitten. Das schwarze Christentum wurde von allen, die in irgendeiner Weise mit dem Sklavensystem in Beziehung standen, zu Recht verdächtigt, die auf Sklaverei fußende Gesellschaftsordnung untergraben zu wollen, beinhaltete die Botschaft doch die Gleichheit aller Menschen und den Aufruf zu Besitz- und Gewaltlosigkeit. Im 17. und frühen 18.Jahrhundert konnten überzeugte Christen ihren Glauben nur schwer mit dem Prinzip der Sklavenhaltung in Einklang bringen; so traten die Gemeinschaften der Baptisten wie Methodisten anfangs in Amerika als Gegner der Sklaverei auf; die Quäker blieben bei dieser Haltung. Nach und nach jedoch begannen die Kirchen – insbesondere solche, die unter ihren Anhängern zahlreiche Sklavenhalter hatten, wie etwa die Episkopalkirche und die Presbyterianer–, die Sklaverei mit christlichen Argumenten zu rechtfertigen. Aus diesem Grund verlor die Episkopalkirche beinahe alle ihre schwarzen Mitglieder. Unterdessen fanden die Sklaven eigene Möglichkeiten, ihre christlichen Überzeugungen innerhalb kirchlicher Organisationen zum Ausdruck zu bringen; mit dem Auftreten schwarzer Prediger begann die Entstehung schwarzer Kirchen. Obwohl ihnen die Praktizierung zunächst gesetzlich untersagt war, traten Sklaven wie Freigelassene sehr bald als Prediger in mehreren Kirchen auf, insbesondere bei Baptisten und Methodisten. Oft war dies jedoch nur möglich, wenn sie sich als «Assistenten» weißer Geistlicher tarnten. Die schwarze Befreiungsbewegung sollte später den schwarzen Kirchen vorwerfen, sie hätten letztlich dafür gesorgt, dass die Schwarzen sich mit ihrer elenden Lage abfanden und im Gebet und in christlicher Glaubensausübung Trost suchten, statt durch politische Aktivität objektive Verbesserungen anzustreben. Zu einer Zeit, da Schwarze, von Sklaven ganz zu schweigen, keine Gelegenheit zu politischer Betätigung hatten, bot die Religion, die zudem Hoffnung und sogar Glück ins Dasein der Unterdrückten trug, die einzige Möglichkeit zu subjektivem Trost. Der Glaube brachte auch objektive Vorteile, denn er eröffnete Wege zur Alphabetisierung. In vielen Staaten wurden seit dem 17.Jahrhundert, zumal im tiefen Süden, Gesetze erlassen, die es untersagten, Schwarzen das Lesen zu lehren. Viele Sklaven lernten es dennoch: Um 1860 konnten vielleicht fünf Prozent der Sklaven lesen, wie der berühmte schwarze Wissenschaftler W.E.B.DuBois errechnet hat. Manche wurden von ihren Herrschaften unterwiesen, die eine aristokratische Verachtung solcher kleingeistiger Gesetze an den Tag legten, andere von weißen Spielgefährten; den meisten jedoch wurde es von weißen Christen gelehrt, die auf diese Weise die Botschaft der Bibel zu vermitteln versuchten. Die Alphabetisierung der Sklaven weckte jedoch die Besorgnis der Sklavenhalter, und zwar aus rein praktischen Erwägungen. Die Sklaven durften das Gelände der Plantagen nur verlassen, wenn sie einen handschriftlichen Passierschein mit sich führten. Dieses Passierscheinsystem wurde von den «Patrouillen» kontrolliert, Gruppen von Sklavenbesitzern oder deren Helfershelfern, die auf den Straßen Schwarze anhielten und deren Passierscheine kontrollierten und jeden Sklaven verprügelten, der das erforderliche Papier nicht vorweisen konnte.
Dieses Patrouillensystem wurde nicht durchgängig praktiziert, da die reichen Sklavenbesitzer darin eine lästige Pflicht sahen, die sie meistens den armen Weißen überließen, die ihr in ihrem Auftrag, aber auch aus eigenem Antrieb nachkamen. Wenngleich gelegentlich lax gehandhabt, so lief sich das Patrouillensystem doch niemals tot, denn dahinter stand die Furcht der Weißen vor einem Sklavenaufstand, von der sie alle mehr oder weniger regelmäßig und aus mehr oder weniger gutem Grund geplagt wurden.
Sklavenaufstände waren eine durchaus reale Gefahr, wenn sie auch häufiger und in größerem Umfang auf den Westindischen Inseln, in Guyana und Brasilien ausbrachen als in Amerika. Im 17.Jahrhundert hatte es in New York Sklavenrevolten gegeben, im 19.Jahrhundert in Florida und Louisiana. Am denkwürdigsten war jedoch 1831 der Aufstand in Virginia, angeführt von Nat Turner, der fast hundert Weiße das Leben kostete. Der Turner-Aufstand, der den Süden aufschreckte, hatte vielerlei Nachwirkungen in der Alltagspraxis und Gesetzgebung. Die Furcht vor Sklavenaufständen war ein Beweggrund für viele Befürworter der Sezession. Die Emanzipation, für die die Befürworter der Sklavenfreilassung im Norden mit Wort und Schrift in Staaten mit nur kleinem schwarzem Bevölkerungsanteil agitierten, war dort lediglich eine moralische Frage. In Staaten aber, wo die Schwarzen die Weißen zahlenmäßig oft übertrafen, war die Sklavenemanzipation nach Einschätzung der Weißen eine Frage auf Leben oder Tod. Dass die Furcht vor Sklavenaufständen fortwährend beschworen wurde, schwächte und entwertete natürlich die Argumente der populistischen Befürworter: Die Sklaverei sei den Schwarzen angemessen, sie sei deren natürlicher Zustand, garantiere ihr Wohlergehen und biete Fürsorge im Alter und so fort. Alle diese Argumente wurden gebetsmühlenhaft wiederholt und waren den weißen Südstaatlern ebenso vertraut wie die feierliche Berufung auf die Grundfreiheiten Amerikas. So unlogisch sie auch war, die Furcht vor Sklavenaufständen wurde von den Südstaatlern ernst genommen, besonders von denen, die sich für die Beibehaltung der «seltsamen Institution» einsetzten.
Die Sklaverei als Wirtschaftsordnung setzte voraus, dass Individuen zum Verkauf standen, um den Arbeitskräftebedarf an anderer Stelle des Baumwollimperiums zu decken; durch Verkauf wurden zwangsläufig auch Sklavenfamilien zerstört. Vielleicht jeder vierte Verkauf bedeutete die Trennung von Mann und Frau, von Eltern und Kindern. Einmal verkaufte Sklaven pflegten sich nur selten wieder zu begegnen, was systembedingte Verwaisungen und Scheidungen zur Folge hatte. Einigermaßen anständige Besitzer versuchten normalerweise, die Familien zusammenzulassen, da jeder Trennungsschmerz die Arbeitsleistung minderte. Manchmal war eine Trennung jedoch unvermeidlich, und manchmal machte man bewusst davon Gebrauch, um einen störrischen Sklaven zu disziplinieren. Diese Verhältnisse lieferten dem Abolitionismus eines seiner wichtigsten humanitären Argumente, insbesondere in Kreisen evangelischer Christen, waren die amerikanischen Schwarzen doch oftmals fromme Baptisten oder Methodisten. Die Tragödie familiärer Trennung war auch in Harriet Beecher Stowes Onkel Toms Hütte das stärkste Motiv. Tom weinte um seine Kinder, die in Kentucky zurückblieben, während er in den Süden verkauft wurde, und Frau Stowes nach Millionen zählende Leserschaft weinte mit ihm. Als sie Präsident Lincoln vorgestellt wurde, soll er gesagt haben: «Soso, dies also ist die kleine Frau, die das dicke Buch schrieb, das zu dem großen Krieg führte…» Damit kam er der Wahrheit denkbar nahe.
Die frühen 1830er Jahre waren in der Geschichte der amerikanischen Sklaverei eine kritische Phase. Zu dieser Zeit wurde die Bekämpfung der Sklaverei zu einer nationalen Bewegung, die man mit allen Mitteln verbieten und beseitigen wollte. Bis etwa 1831 konnte man sich aus der anhaltenden Auseinandersetzung heraushalten, indem man sich der verbreiteten Auffassung anschloss, die Sklaverei würde von allein verschwinden. Diese Ansicht war im Süden ebenso verbreitet wie im Norden. Der Glaube hatte mancherlei Gründe, sie alle hatten jedoch mit der Abschaffung des Sklavenhandels durch den Kongress zu tun; auch damit, dass das vom britischen Parlament verfügte Verbot des Handels durch den Einsatz der Navy durchgesetzt wurde. Die Unterbindung des internationalen Sklavenhandels wurde jedoch ausgeglichen durch den kometenhaften Anstieg des Baumwollhandels, der zwischen 1840 und 1850 die Wirtschaft des Südens transformierte und so manchen Pflanzer reich machte. Die Zunahme der Vermögen im Süden bewog dort Politiker und Publizisten, für die Beibehaltung der Sklaverei einzutreten, während die Politik und Publizistik im Norden eine intellektuelle Kampagne dagegen führten. William Lloyd Garrison gründete 1831 den Liberator, ein Blatt, das zum Organ der Abolitionistenbewegung wurde. 1837 tat Garrison sich mit den New Yorker Tappan-Brüdern zusammen und rief die Anti-Slavery Society ins Leben, die rasch die Unterstützung von Kirchen, Schulen und Colleges fand, insbesondere des Oberlin College in Ohio. Die abolitionistische Bewegung fand jedoch viel Munition in den Prozessen gegen entflohene Sklaven, die in den zehn Jahren vor Ausbruch des Bürgerkriegs in der Presse breite Beachtung fanden. 1793 hatte der Kongress ein Gesetz bezüglich flüchtiger Sklaven erlassen, das den Sklavenbesitzern das Recht gab, die Flüchtlinge wieder einzufangen und bei der Ergreifung entsprungener Sklaven Hilfe in Anspruch zu nehmen. 1850 wurde ein noch strengeres Gesetz, der Fugitive Slave Act, vom Kongress in Kraft gesetzt. Das löste eine Lawine von Prozessen gegen entflohene Sklaven aus, die jetzt, nachdem die Sklaven im Norden Unterschlupf gefunden hatten, von ihren Besitzern, oftmals mit Unterstützung von Justizbeamten, angestrengt wurde. Dagegen opponierten die örtlichen Abolitionisten, wobei sie sich häufig auf ein die persönliche Freiheit garantierendes Gesetz aus dem Jahr 1850 beriefen.
Um 1860 war die Sklaverei im Norden gründlich in Verruf geraten, obwohl dort das Interesse zeitweilig erheblich nachließ. Die meisten Nordstaatler, obwohl ohne jeden Zweifel negrophob, waren beschämt, dass ihr Land als einziges unter den großen konstitutionellen Gemeinwesen der westlichen Welt die Sklaverei weiterhin gestattete; ohne sich darüber einig zu sein, auf welche Weise deren Beendigung herbeizuführen wäre, wollte man die Institution jedenfalls verschwinden sehen. Viele Südstaatler, die zwar der Sklaverei als Wirtschaftsform nicht entrinnen konnten, weil davon ihre Welt und ihr persönliches Auskommen abhingen, erkannten jedoch bei einiger Aufrichtigkeit, dass die Sklaverei ihnen eine Last war und dass die Sklavenhalter paradoxerweise selbst die Sklaven des Systems waren, dem sie sich als Lebensweise verschrieben hatten und das nun ihre gesamte Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Selbst unter denen, die am verbissensten für die Konföderation kämpften oder ihre Männer in diesem Kampf bestärkten, fanden sich viele, die den Freiheitsverlust beklagten, den die Erfüllung ihrer Pflicht als Sklavenbesitzer ihnen auferlegte. Sie bemerkten, dass die «seltsame Institution» selbst der strengste aller Zuchtmeister war. Trotzdem war die Mehrheit der Südstaatler bereit, für ihre Beibehaltung zu kämpfen. Fragte sich nur, für wie viele Nordstaatler das Sklavenproblem Grund genug war, um gegen die Südstaaten zu kämpfen.
Nachdem es 1861 zu den ersten bewaffneten Konflikten gekommen war, begannen die Soldaten, die den Bürgerkrieg ausfechten sollten, sich gegenseitig zu dämonisieren. Für die Südstaatler waren die Männer in der Uniform der Union natürlich «die Yankees», aber auch «Söldner», «Hessen» oder «Reguläre» – diffamierende Begriffe, die im Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer benutzt worden waren. Für die Nordstaatler waren die Männer des Südens die «Sezis», aber auch «Wilde» und «Untiere» oder auch «Verräter» und «Rebellen». Als Rebellen wurden sie natürlich treffend beschrieben, und daher wurde der Konföderierte für den Unionssoldaten rasch zu Johnny Reb, die Nordstaatler wurden im Gegenzug als Billy Yank bezeichnet. Der Begriff Yankee hatte für den Südstaatler eine zugleich qualitative und geographische Bedeutung. Man verstand darunter einen gefühlskalten, beschränkten Puritaner und mithin all das, was der Südstaatler selbst nicht zu sein glaubte. Gebildete Südstaatler sahen sich gern als ritterliche Kavaliere, wie vom Romancier Walter Scott geschaffen, den Mark Twain, nur halb im Scherz, als Verursacher des Bürgerkriegs ausmachte.
Der Popanz einer Sklavenrevolte wurde von Panikmachern und unnachgiebigen Befürwortern der Sklaverei schon immer gern bemüht. Trotz intensiver Forschung nach den Beweggründen beider Seiten war und ist es schwer zu erklären, wieso eine langanhaltende Debatte über die Sklaverei, die schon vierzig Jahre lang in Nord und Süd die Gemüter erregt hatte, in einen Bürgerkrieg umschlug, anstatt sich weiter in die Länge zu ziehen. Die Yankees fragten die Rebellen gewöhnlich, weshalb sie zu den Waffen gegriffen hatten. Einer von ihnen, der gleich zu Anfang in Virginia in Gefangenschaft geraten war, antwortete daraufhin: «Weil ihr hier seid.» Das ist und bleibt als Antwort ebenso gut wie jede andere.
Oftmals wurde die Ansicht vertreten, der Krieg sei eine Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Amerikas gewesen, zwischen dem alten, agrarischen Süden und dem neueren, sich industriell entwickelnden Norden. Daran ist durchaus ein Körnchen Wahrheit.
Weil es im Süden weniger Orte gab, an denen man einen Arbeitsplatz in der Industrie finden konnte, lebten dort mehr Menschen als im Norden auf dem Land und arbeiteten in der Landwirtschaft. Trotzdem rekrutierten sich beide Heere überwiegend aus ländlichen Gemeinden, und die Liste der Zivilberufe der Soldaten war für beide Seiten beinahe deckungsgleich. Bell Irvin Wileys Untersuchung, vorgenommen an 9000Soldaten aus achtundzwanzig konföderierten Regimentern, ergab folgendes Bild: Die Hälfte bezeichnete sich als Bauern, während sich 474 als «Studenten» ausgaben, worunter wohl auch Schüler sein mochten, weiß man doch, dass bei Kriegsbeginn zumindest ein Lehrer seine Schule schloss und seine Klasse zur freiwilligen Meldung führte. In Wileys Stichprobe fanden sich weiterhin 472Arbeiter, 321Büroangestellte, dazu 318Mechaniker, 222Zimmerleute, 138Kaufleute und 116Grobschmiede. Zu sonstigen Berufen der Soldaten gehörten mehr als fünfzig Seeleute, Ärzte (die größtenteils im Sanitätsdienst eingesetzt gewesen sein dürften), Maler und Anstreicher, Lehrer, Schuster und Anwälte.3 Manche bezeichneten sich als «Gentlemen», gehörten also zweifellos zur Kategorie der Pflanzer, mit denen nach Ansicht der gewählten Offiziere oft nur schwer zurechtzukommen war. Professor Wileys Untersuchung der Personaldaten von 12000Unionssoldaten brachte beinahe das gleiche Ergebnis hinsichtlich der ausgeübten Berufe und der jeweiligen Anzahl ihrer Vertreter; im Unterschied zum Süden waren unter den Nordstaatlern jedoch mehr Lehrer oder Drucker– Beweis einer besseren Alphabetisierung der einfachen Soldaten des Nordens.4
Eine weitere Kategorie war im Norden stärker als im Süden vertreten: die gebürtigen Ausländer. 1860 lebten eine Million Deutsche in den Nordstaaten, größtenteils infolge der Repression nach der Revolution von 1848 eingewandert. Sie und ihre im Lande geborenen Nachkommen, die wohl immer noch Deutsch sprachen, stellten 200000Mann des Zweimillionenheers der Union. Das zweitgrößte Kontingent der im Ausland Geborenen stellten die Iren mit 150000Mann. Sie sprachen natürlich Englisch, nicht anders als die 45000 gebürtigen Engländer und die meisten der 50000Kanadier. Entsprechende Zahlen wurden von der Konföderation nicht erfasst, man weiß jedoch, dass es dort Zehntausende von Iren, Deutschen, Italienern und Polen gab. Der typische konföderierte Soldat, wenn es ihn denn überhaupt gab, war englischsprachig und von britischer Herkunft, also Engländer