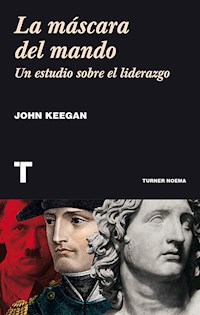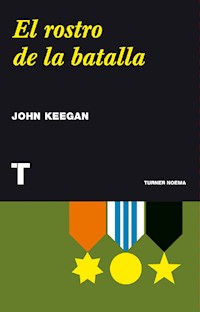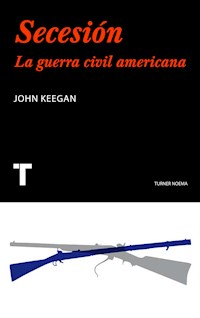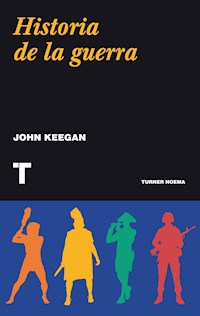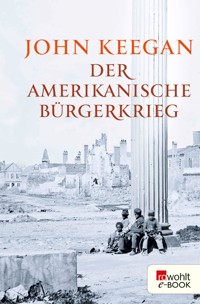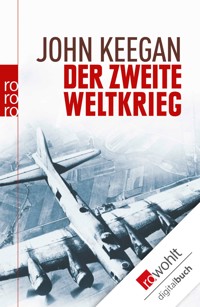
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keine militärische Auseinandersetzung hat das 20. Jahrhundert so geprägt wie der Zweite Weltkrieg. Welche Ziele verfolgten die einzelnen Kriegsparteien? Wie kam es dazu, dass sich der Krieg über die ganze Welt ausbreiten konnte? John Keegan schildert die Ereignisse dieser Jahre auf ebenso faszinierende wie beklemmende Weise: vom «Blitzkrieg» und dem Russlandfeldzug bis zu Pearl Harbor und den Schlachten im Pazifik; von der Landung in der Normandie bis zum Kampf um Berlin und dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Und er beschreibt, wie politisches Kalkül, technische Neuerungen und taktische Erwägungen den Kriegsverlauf entscheidend prägten – ein Standardwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1211
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
John Keegan
Der Zweite Weltkrieg
Deutsch von Hainer Kober
VORWORT
Der Zweite Weltkrieg, für sich genommen das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte, wurde auf sechs der sieben Erdteile und auf allen Weltmeeren ausgefochten. Er forderte 50Millionen Menschenleben, hinterließ viele hundert Millionen Opfer, die Schaden an Körper oder Seele nahmen, und verwüstete riesige Gebiete im Herzen der Zivilisation.
Kein Versuch, seine Ursachen, seinen Verlauf und seine Folgen im Rahmen eines einzigen Bandes darzustellen, kann zur Gänze gelingen. Statt die Geschichte des Krieges als stetige Ereignisfolge zu schildern, habe ich mich daher von Anfang dafür entschieden, sie in vier Themenkreise einzuteilen – Erzählung, Strategieanalyse, Schlachtbeschreibung und «Kriegsthema»–, um mit Hilfe dieser vier Komplexe die Geschichte jener sechs Hauptabschnitte zu beschreiben, in die der Krieg sich gliedern lässt: der Krieg im Westen 1939–1943, der Krieg im Osten 1941–1943, der Krieg im Pazifik 1941–1943, der Krieg im Westen 1943–1945, der Krieg im Osten 1943–1945 und der Krieg im Pazifik 1943–1945.Jeder Abschnitt wird durch eine strategische Analyse eingeführt, die sich auf jene Gestalt konzentriert, von der im fraglichen Zeitraum die Initiative in erster Linie ausging – in der Reihenfolge ihres Auftretens also Hitler, Tojo, Churchill, Stalin und Roosevelt. Daran schließt sich neben der erzählerischen Passage das entsprechende Kriegsthema und eine Schlachtbeschreibung an. Jede dieser Schlachtbeschreibungen wurde ausgewählt, um eine für den Konflikt charakteristische Art der Kriegführung zu illustrieren. Dabei handelt es sich um den Luftkrieg (die Schlacht um England), den Krieg der Luftlandetruppen (die Schlacht um Kreta), der Flugzeugträger (Midway), der Panzerwaffe (Falaise), den Straßen- und Häuserkampf (Berlin) sowie amphibische Operationen (Okinawa). Zum «Kriegsthema» zählen Logistik und Nachschubwesen, Kriegsproduktion, Besetzung und Unterdrückung, strategischer Bombenkrieg, Widerstand, Spionage und Geheimwaffen.
Ich hoffe, dass ich mit dieser Darstellungsweise dem Leser das Chaos und die Tragik der Ereignisse, von denen ich hier berichte, etwas übersichtlicher mache.
PROLOG
1 · JEDER MANN EIN SOLDAT
«Der Erste [Welt-]Krieg erklärt den Zweiten und er bewirkte ihn tatsächlich, soweit eben ein Ereignis das nächste bewirken kann», schrieb A.J.P.Taylor in seinem Buch Die Ursprünge des Zweiten Weltkrieges. «Der Zusammenhang der beiden Kriege war noch enger. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Deutschland besonders darum, das Urteil des Ersten rückgängig und die ihm folgende Regelung nichtig zu machen.»
Nicht einmal die schärfsten Kritiker von Taylors Darstellung der Zwischenkriegszeit werden an dieser Beurteilung Anstoß nehmen. Ursprünge, Wesen und Verlauf des Zweiten Weltkriegs sind ohne Berücksichtigung des Ersten nicht zu erklären, und Deutschland – ob es an dessen Ausbruch schuld war oder nicht, jedenfalls gab es den ersten Schuss ab – zog 1939 zweifellos in den Krieg, um den Platz in der Welt zurückzuerobern, den es durch die Niederlage von 1918 eingebüßt hatte.
Wenn man jedoch den Zweiten Weltkrieg mit dem Ersten in Verbindung bringt, heißt das noch keinesfalls (auch wenn man diesen als Ursache für jenen gelten lassen will), dass damit beide erklärt wären. Ihre gemeinsamen Wurzeln sind in den Jahren vor 1914 zu suchen, und diese Suche hat die Kräfte vieler Wissenschaftler über weite Strecken des vorigen Jahrhunderts in Anspruch genommen. Ob sie die Ursachen nun in unmittelbaren oder weniger nahe liegenden Ereignissen ausmachten, ihre Schlussfolgerungen haben wenig miteinander gemein. Die Historiker der siegreichen Seite haben es generell vorgezogen, Deutschland, insbesondere seinem Streben nach Weltgeltung, die Schuld am Ausbruch des Krieges von 1914 zu geben und Deutschland deshalb auch den Krieg von 1939 anzulasten, unabhängig vom Versagen der um Appeasement bemühten Mächte. Bis Fritz Fischer in den 1960er Jahren die in Deutschland vorherrschende Meinung ketzerisch in Frage stellte, versuchten deutsche Historiker im Allgemeinen, den Vorwurf der «Kriegsschuld» zurückzuweisen und diese anders aufzuteilen. Marxistische Historiker gleich welcher Nationalität haben sich über diese Debatte hinweggesetzt, indem sie den Ersten Weltkrieg als «Krise des Kapitalismus» in seiner imperialistischen Form darstellten und schilderten, wie die europäische Arbeiterklasse auf dem Altar eines Konkurrenzkampfs geopfert wurde, den sich die zum Untergang verurteilten kapitalistischen Systeme lieferten. Folgerichtig führen sie den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges darauf zurück, dass die Demokratien des Westens darauf spekulierten, Hitler werde vor dem entscheidenden Schritt zurückschrecken, und dass sie nicht versuchten, ihn mit Hilfe der Sowjetunion daran zu hindern, diesen Schritt zu tun.
Diese Ansichten stehen einander unversöhnlich gegenüber. Bestenfalls belegen sie die Behauptung, dass «die Geschichtsschreibung die Projektion von Ideologie in die Vergangenheit ist». Solange Historiker sich über Logik und Ethik in der Politik streiten und sich die Frage stellen, ob zwischen beiden ein Unterschied besteht, kann es in der Tat keine allgemein gültige Erklärung dafür geben, weshalb sich die Welt zweimal der Tortur eines Massenkrieges anheim gegeben hat.
Ein ergiebigerer, wenn auch seltener gewählter Ansatz zur Klärung der Ursachen geht in eine andere Richtung: Er fragt, wie die beiden Weltkriege möglich wurden, und nicht, warum sie zustande kamen. Die Umstände des Ausbruchs sind nämlich in beiden Fällen nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Die ungeheuerliche Wucht der Ereignisse, die auf die Geschehnisse vom August 1914 und September 1939 folgten, waren schuld daran, dass die Historiker so lange nach deren Gründen suchten. Kein vergleichbarer Impuls treibt die Suche nach den Ursachen des Österreichisch-Preußischen Kriegs von 1866 oder des Französisch-Preußischen Kriegs von 1870 an, so maßgeblich diese beiden Konflikte auch zur Verschiebung des europäischen Kräfteverhältnisses im 19.Jahrhundert beigetragen haben. Hätte Deutschland im Übrigen, was durchaus möglich gewesen wäre, die entscheidende Eröffnungsschlacht des Ersten Weltkriegs, die Marneschlacht im September 1914, gewonnen – und damit Europa nicht nur das unsägliche Leid der Schützengräben erspart, sondern auch all die soziale, ökonomische und diplomatische Verbitterung, die daraus folgte–, dann wären wohl kaum ganze Bibliotheken mit Büchern gefüllt worden, die den zwischenstaatlichen Beziehungen Deutschlands, Frankreichs, Britanniens, Österreich-Ungarns und Russlands in der Zeit vor 1914 gewidmet sind.
Da nun aber nicht Deutschland, sondern Frankreich, mit britischer Hilfe, die Marneschlacht gewann, entwickelte sich der Erste – und der Zweite– Weltkrieg anders als alle voraufgegangenen Kriege, anders in Bezug auf Ausmaß, Intensität, Umfang, Materialeinsatz und Zahl der Opfer. Aus diesem Grunde waren sich beide Kriege auch sehr ähnlich. Die Unterschiede und Ähnlichkeiten sind dafür verantwortlich, dass man die Frage nach den Ursachen für so bedeutsam hält. Das aber heißt, das Zufällige mit dem Wesentlichen zu verwechseln. Die Ursachen der Weltkriege lagen nicht tiefer und waren nicht komplexer als die Ursachen zweier beliebiger, miteinander in Zusammenhang stehender und kurz aufeinander folgender militärischer Konflikte. Ihr Charakter allerdings war beispiellos. Den Weltkriegen fielen mehr Menschen zum Opfer, sie verschlangen mehr Wohlstand und brachten mehr Leid über einen größeren Teil des Erdballs als jemals ein Krieg zuvor.
Die Menschheit war zwischen 1815, dem Ende des letzten großen Völkerstreits, und 1914 nicht schlechter geworden; ganz gewiss hätte sich damals kein vernünftiger erwachsener Europäer, wenn er die Zukunft hätte voraussehen können, die Verwüstungen und Not gewünscht, die mit der Krise jenes Augustmonats ihren Anfang nahmen. Hätte man gewusst, dass der folgende Krieg vier Jahre dauern, für zehn Millionen junge Männer den Tod bedeuten und Feuer und Vernichtung über Schlachtfelder bringen würde, die sich von Belgien bis Norditalien erstreckten, von Makedonien über die Ukraine, Transkaukasien, Palästina, Mesopotamien und Afrika bis nach China, und dass der nächste Krieg, 20Jahre später von denselben Gegnern auf genau denselben Schlachtfeldern und einigen weiteren geführt, 50Millionen Menschen das Leben kosten würde, dann wäre, so möchte man meinen, jeder individuelle und kollektive Wunsch nach Gewalt im Keim erstickt worden.
Diese Überlegung spricht für die menschliche Natur. Sie spricht aber auch gegen den Weg, den die Welt zwischen 1815 und 1914 genommen hatte. Ein vernünftiger erwachsener Europäer, der dies letztere Jahr erlebte, hätte mit jeder Faser seiner zivilisierten Natur die bevorstehenden Katastrophen beklagt, wären sie ihm prophezeit worden. Dazu hätte er jedoch die Politik, das Ethos und letztlich die menschliche und materielle Natur des Staates, dem er angehörte – ganz gleich, welcher es war–, verleugnen müssen. Er hätte sich sogar über die Bedingungen der Welt, die ihn umgaben, hinwegsetzen müssen. Denn die von Europa beherrschte Welt trug den Krieg bereits in sich.
Der enorme Zuwachs an Wohlstand, Energie und Bevölkerung, ausgelöst durch Europas industrielle Revolution im 19.Jahrhundert, hatte die Welt verwandelt. Er hatte Produktions- und Bergbauindustrien geschaffen – Gießereien, Maschinenbaubetriebe, Textilfabriken, Werften, Bergwerke–, die bei weitem größer waren als alles, was die geistigen Väter der industriellen Revolution, die Wirtschaftstheoretiker des 18.Jahrhunderts, vermutet hätten. Er hatte die produktiven Regionen der Erde durch ein Nachrichten- und Verkehrsnetz verbunden – Straßen, Eisenbahnen, Schifffahrtswege, Telegrafen- und Telefonkabel–, das dichter geknüpft war, als es der hellsichtigste Wissenschafts- und Technologieenthusiast hätte ahnen können. Er hatte Reichtümer geschaffen, die bewirkten, dass die Bevölkerungen historisch gewachsener Städte um das Zehnfache anstiegen, dass Ackerbauern und Viehzüchter auf Millionen von Hektar angesiedelt wurden, die noch nie zuvor bestellt oder beweidet worden waren. Er hatte die Infrastruktur – Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Laboratorien, Kirchen und Missionsstationen – einer dynamischen, kreativen und optimistischen Weltzivilisation entstehen lassen. Vor allem aber hatte er, als dramatischen und bedrohlichen Kontrapunkt zu all den hoffnungs- und verheißungsvollen Werken dieses Jahrhunderts, Armeen hervorgebracht – die größten und potenziell zerstörerischsten Kriegsinstrumente, welche die Welt je gesehen hatte.
Die Militarisierung Europas
Das Ausmaß der Militarisierung Europas im 19.Jahrhundert lässt sich nur schwer vermitteln, wenn man versucht, ihre psychologischen und technologischen Dimensionen ebenso zu erfassen wie ihre Größenordnung. Schon diese allein ist unvorstellbar. Ein gewisser Eindruck von ihrem Umfang wird vielleicht erkennbar, wenn wir vergleichen, wie Friedrich Engels die militärische Organisation in den unabhängigen norddeutschen Stadtstaaten einschätzte, als er dort eine Handelslehre absolvierte, und welche Truppenstärken die entsprechenden Wehrbezirke dem Kaiser des vereinten Deutschen Reiches am Vorabend des Ersten Weltkrieges zur Verfügung stellten.
Engels’ Aussage ist aufschlussreich. Als einer der Väter der marxistischen Theorie blieb er stets der Auffassung treu, die Revolution werde nur triumphieren, wenn es dem Proletariat gelänge, den staatlichen Streitkräften eine Niederlage zu bereiten. Als Jungrevolutionär erhoffte er diesen Triumph vom Sieg des Proletariats im Barrikadenkampf; als alter und zunehmend desillusionierter Ideologe versuchte er sich einzureden, dass sich das Proletariat von den Fesseln der europäischen Wehrpflichtgesetze befreien werde, indem es die staatlichen Armeen von innen her aushöhle. Engels’ Weg von den Hoffnungen der Jugend zu den Zweifeln des Alters lässt sich am besten nachvollziehen, wenn wir betrachten, wie sich die Truppen der Hansestädte zu seinen Lebzeiten veränderten.
Im August 1840 musste Engels von seinem Bremer Kontor einen dreistündigen Ritt absolvieren, um die gemeinsamen Manöver der Soldaten der Freien Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck und des Großherzogtums Oldenburg zu beobachten. Zusammen brachten es die Truppen auf eine Regimentsstärke von, großzügig gerechnet, 3000Mann. In Engels’ Todesjahr 1895 hingegen stellten diese Städte fast die gesamte 17. und Teile der 19.Division des deutschen Heeres, dazu je ein Kavallerie- und ein Artillerieregiment, was auf eine mindestens vierfache Zunahme hinausläuft. Das betrifft jedoch nur die Kampftruppe, das heißt, im Dienst und unter Waffen stehende Wehrpflichtige. Hinter den aktiven Divisionen standen die 17. und 19.Reservedivision, zu denen die Hansestädte im Mobilisierungsfalle die gleiche Anzahl Reservisten – gediente Wehrpflichtige früherer Jahrgänge – beisteuerten. Und hinter den Reservedivisionen stand die Landwehr, die sich aus älteren ehemaligen Wehrdienstleistenden rekrutierte und im Jahre 1914 eine weitere halbe Division stark war. Addiert man die Zahlen, stellt man fest, dass die Kräfte zwischen 1840 und 1895 um das Zehnfache angewachsen waren, eine Entwicklung, welche die Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum bei weitem übertraf.
Trotzdem lässt sich die enorme Vervielfachung der Truppenstärke in erster Linie auf den demographischen Wandel zurückführen. Die Einwohnerzahlen in den meisten Staaten, die in den Ersten Weltkrieg ziehen sollten, hatten sich im Laufe des 19.Jahrhunderts verdoppelt, in manchen Fällen gar verdreifacht. So wuchs die Bevölkerung Deutschlands in den Grenzen von 1871 von 24Millionen im Jahre 1800 auf 57Millionen im Jahre 1900 an. In Großbritannien war die Zahl der Einwohner zwischen 1800 und 1900 von 16 auf 42Millionen angestiegen; stellt man in Rechnung, dass in Irland die Hungersnot sowie die Auswanderung nach Amerika und in die Kolonien einen Nettoverlust von acht Millionen bedeuteten, so ergibt sich für Großbritannien sogar eine Verdreifachung der Zahl.
Die Bevölkerung Österreich-Ungarns stieg unter Berücksichtigung der Grenzverschiebungen von 24 auf 46Millionen an; die Italiens in den Grenzen von 1870 von 19 auf 29Millionen – trotz einer Einbuße von sechs Millionen Auswanderern nach Nord- und Südamerika. Belgiens Bevölkerung nahm von 2,5 auf sieben Millionen zu und die des europäischen Teils Russlands, zwischen dem Ural und der Westgrenze von 1941, annähernd auf das Dreifache, von 36 auf 100Millionen. Nur zwei der Krieg führenden Staaten, Frankreich und das Osmanische Reich, hatten keine ähnlichen Zuwächse zu verzeichnen. In Frankreich, früher einmal das bevölkerungsreichste Land Europas, erhöhte sich die Zahl der Einwohner von 30 auf 40Millionen, in erster Linie aufgrund gestiegener Lebenserwartung; die Geburtenrate blieb beinahe konstant – nach William McNeills Auffassung, weil Napoleons Soldaten von ihren Feldzügen neue Techniken der Geburtenkontrolle mit nach Hause brachten. In der Türkei gab es ebenfalls kaum eine Veränderung; 1800 lebten 24Millionen Menschen auf dem Gebiet der heutigen Türkei, 1900 waren es 25Millionen.
Fallen die Beispiele Frankreichs und der Türkei auch aus dem demographischen Rahmen, so können sie doch zu dessen Erklärung beitragen. Die gestiegene Lebenserwartung der Franzosen war die Folge einer Verbesserung des Lebensstandards und der Volksgesundheit, die ihrerseits auf die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Landwirtschaft, Medizin und Hygiene zurückzuführen waren. In der Türkei hingegen nahm die Bevölkerung aus dem entgegengesetzten Grund nicht zu: Die geringen Erträge aus herkömmlicher Bodenbewirtschaftung und die Krankheitshäufigkeit in einer Gesellschaft ohne Ärzte sorgten dafür, dass die Einwohnerzahl trotz hoher Geburtenrate auf ihrem alten Niveau blieb. Immer wenn gestiegene landwirtschaftliche Erträge (oder erhöhter Mitteleinsatz) mit hohen Geburtenraten und verbesserter Hygiene zusammenfielen, wie es im Europa des 19.Jahrhunderts so gut wie überall der Fall war, zeigten sich enorme Auswirkungen auf die Bevölkerungsgröße.
Spektakulär waren sie in England, dem Zentrum des Wirtschaftswunders im 19.Jahrhundert. Obgleich die Menschen massenhaft vom Lande in die übervölkerten Städte abwanderten, die oft nur aus einer Ansammlung von provisorischen Behausungen bestanden, stieg die Zahl der Engländer in der ersten Hälfte des Jahrhunderts um 100Prozent und in der zweiten um 75Prozent. Durch den Bau von Kanalisationssystemen – eine Maßnahme, die nach 1866 für die Ausmerzung der Cholera sorgte und kurze Zeit später die meisten anderen durch Schmutzwasser übertragenen Krankheiten beseitigte – und durch Schutzimpfungen, mit denen man, als sie 1853 gesetzlich vorgeschrieben wurden, die Pocken besiegte, wurde die Kindersterblichkeit drastisch reduziert und die statistische Lebenserwartung entsprechend verlängert. Die Todesfälle durch Infektionskrankheiten gingen zwischen 1872 und 1900 um annähernd 60Prozent zurück. Gestiegene landwirtschaftliche Erträge auf gedüngten Flächen, vor allem aber die Einfuhr von nordamerikanischem Getreide und australischem Gefrierfleisch waren dafür verantwortlich, dass eine wachsende Zahl von Menschen kräftiger und gesünder wurden. Sie nahmen mehr Kalorien zu sich, weil Luxusgüter wie Tee, Kaffee und insbesondere Zucker billiger geworden waren, mit dem Ergebnis, dass die Getreideprodukte schmackhafter und die Nahrung insgesamt abwechslungsreicher wurde.
Die Wirkung all dieser Fortschritte in Medizin und Ernährung auf die wachsende Bevölkerung bestand nicht nur darin, dass Jahr für Jahr die Kontingente junger Wehrpflichtiger (classes, wie die Franzosen sie nannten) größer wurden – in Frankreich zwischen 1891 und 1901 zum Beispiel um 50Prozent–, sie erwiesen sich auch als immer tauglicher für den Militärdienst. Offenbar gibt es eine unabänderliche militärische Notwendigkeit, dass der Soldat auf dem Marsch etwa 50Pfund körperfremdes Gewicht mit sich führt – Tornister, Gewehr und Munition. Je größer und kräftiger der Soldat, desto leichter ist er bei solcher Belastung zu der verlangten Tagesleistung von 30Kilometern imstande. Im 18.Jahrhundert hatte die französische Armee Männer mit entsprechenden körperlichen Voraussetzungen eher in der städtischen Handwerkerschaft als auf dem Lande gefunden. Der Bauer, unterernährt und ungeschliffen, gab nur selten einen brauchbaren Soldaten ab. Er war undiszipliniert, krankheitsanfällig und grämte sich zu Tode, wenn er der heimatlichen Scholle entrissen wurde. Diese Schwächen veranlassten Marx noch 100Jahre später, die Bauernschaft in Sachen Revolution als «hoffnungslos» einzustufen.
Mitte des 19.Jahrhunderts jedoch hatte sich in Deutschland, Frankreich, Österreich-Ungarn und Russland die physische Verfassung der Landbevölkerung so sehr verbessert, dass sie für die Heere ihrer jeweiligen Länder regelmäßig einen beträchtlichen Anteil der Wehrdienstjahrgänge oder classes stellen konnte, einen Anteil, der groß genug war, Marx Lügen zu strafen. Sein Urteil mag durch den Umstand getrübt worden sein, dass er sich in England aufhielt, wo die massive Landflucht nur die Trägsten unter dem Einfluss von Grundherrn und Pfarrern zurückließ. In Kontinentaleuropa, das sich langsamer als England industrialisierte – in Deutschland etwa betrug der Anteil der Landbevölkerung im Jahre 1900 immer noch 49Prozent der Gesamtbevölkerung–, stellten die ländlichen Regionen die classes der großen, kräftigen jungen Männer, aus denen sich die gewaltigen Heere des 19.Jahrhunderts rekrutierten.
Wenn der neue Bevölkerungsüberschuss, hervorgerufen durch die Verbesserung der Ernährung, der medizinischen Versorgung und Kanalisation, den europäischen Heeren eine größere Rekrutierungsbasis verschaffte, dann waren es die verfeinerten Methoden der Volkszählung und Steuererhebung im 19.Jahrhundert, die dafür sorgten, dass Rekruten registriert, ernährt, besoldet, untergebracht, ausgerüstet und ins Feld geschickt werden konnten. Die Einführung regelmäßiger Volkszählungen – in Frankreich 1801, in Belgien 1829, in Deutschland 1853, in Österreich-Ungarn 1857 und in Italien 1861 – verschaffte den Wehrersatzbehörden die nötigen Daten, um potenzielle Rekruten zu erfassen und (nach Tauglichkeitsgrad) zu klassifizieren. Das beendete die herkömmlichen Methoden – die willkürlichen Aushebungen, falschen Versprechungen, Bestechungsgelder und gewaltsamen Entführungen, mit denen all jene in die Heere des Ancien Régime gepresst wurden, deren Gedanken oder Füße nicht flink genug waren, um sie vor den Werbern in Sicherheit zu bringen. Steuerlisten, Wähler- und Schülerverzeichnisse belegten den Aufenthaltsort des Wehrpflichtigen – die Gewährung des Stimmrechts und das Recht auf Schulbildung für alle bedeutete nicht nur eine Ausweitung, sondern auch eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Um 1900 musste beispielsweise jeder deutsche Reservist einen Entlassungsschein besitzen, dem zu entnehmen war, in welchem Sammelzentrum er sich im Mobilmachungsfall zu melden hatte.
Das enorme Wirtschaftswachstum in Europa schuf unterdessen die steuerliche Grundlage für den Unterhalt der neuen Wehrpflichtigenarmeen. Die deutsche Wirtschaft etwa expandierte zwischen 1851 und 1855 um ein Viertel, zwischen 1855 und 1875 um die Hälfte und zwischen 1875 und 1914 um 70Prozent. Von diesem neuen Wohlstand sicherte sich der Staat über indirekte und direkte Einkünfte, unter anderem die ungeliebte Institution der Einkommensteuer, einen immer größeren Teil des Bruttoinlandsprodukts. So stieg in Großbritannien der staatliche Anteil am Konsum von 4,8Prozent in den Jahren zwischen 1860 und 1879 auf 7,1Prozent im Zeitraum von 1900 bis 1914.In Deutschland war ein Anstieg von 4,0 auf 7,1Prozent zu verzeichnen; in Frankreich und Österreich-Ungarn gab es ähnliche Zuwachsraten.
Der größte Teil der erhöhten Staatseinnahmen wurde für den Ankauf militärischer Ausrüstung im weitesten Sinne aufgewendet. Kanonen und Kriegsschiffe waren die kostspieligsten Anschaffungen, Kasernen aber die wichtigeren. Der Soldat des Ancien Régime war überall dort einquartiert worden, wo der Staat Platz für ihn fand, in Gasthöfen, Scheunen und Privathäusern. Der Wehrpflichtige des 19.Jahrhunderts wurde in eigens zu diesem Zweck errichteten Gebäuden untergebracht. Eingezäunte Kasernen waren ein wichtiges Instrument der sozialen Kontrolle; Engels prangerte sie als «Bastionen gegen das Volk» an. Ganz ähnlich sahen die Florentiner des 16.Jahrhunderts ihre Freiheit beschnitten, als die Fortezza de Basso innerhalb der Stadtmauern erbaut wurde. Die Errichtung von Kasernen war ganz gewiss eine wichtige Maßnahme, um eine rasch einsatzfähige Streitmacht zur Verfügung zu haben, mit deren Hilfe beispielsweise 1848 die Erhebung in Berlin und 1871 die Pariser Kommune niedergeschlagen wurden.1Allerdings waren die Kasernen nicht nur Bezirkswachen, in denen Polizeikräfte zur Bekämpfung von Aufständen untergebracht waren, es waren gleichzeitig «Verbindungshäuser» einer neuen Militärkultur, in denen die Wehrpflichtigen militärischen Gehorsam lernten und kameradschaftliche Bande knüpften, die sie für eine Feuerprobe von so schrecklicher Art wappnen sollten, wie sie noch kein Soldat zuvor erlebt hatte.
Der neu erworbene Wohlstand des Staates im 19.Jahrhundert schuf die Möglichkeit, den Wehrpflichtigen nicht nur unterzubringen und auszurüsten, sondern ihn auch aufs Schlachtfeld zu befördern und ihn dort bei seinem Eintreffen reichlich zu verpflegen. Ein Soldat des Ancien Régime war kaum besser mit Nahrung versorgt als ein römischer Legionär; seine Verpflegung bestand aus Mehl, das in den Handmühlen der Regimenter gemahlen wurde, und ein wenig Rindfleisch von Tieren, die man lebendig mitführte. Margarine und Büchsenfleisch waren das Ergebnis eines Wettbewerbs, den NapoleonIII. ausgeschrieben hatte, um Rationen zu entwickeln, die im Soldatentornister nicht verdarben. Die Notwendigkeit, den eigenen Verpflegungsvorrat mit sich zu tragen, entfiel weitgehend, als man das entstehende Eisenbahnsystem für militärische Zwecke nutzte.
Bereits 1839 wurden in Deutschland Truppen mit der Bahn bewegt. 1859, als Frankreich in Norditalien gegen Österreich kämpfte, schienen Truppenverschiebungen auf der Schiene bereits der Normalfall zu sein. 1866 und 1870 schufen sie die Grundlage für die preußischen Siege über Österreich beziehungsweise Frankreich. Inzwischen war das deutsche Eisenbahnnetz, das sich 1840 nur über 469Kilometer erstreckte, auf 17215Kilometer angewachsen. 1914 sollte es 61749Kilometer umfassen, wobei der größte Teil (56000Kilometer) staatlicher Kontrolle unterstand. Auf Drängen des Großen Generalstabes hatte die deutsche Reichsregierung schon früh erkannt, wie wichtig die Kontrolle des Eisenbahnsystems für defensive – und offensive – Zwecke war. Ein Großteil dieses Systems, insbesondere in Regionen wie Bayern und Ostpreußen, wo es nur geringen wirtschaftlichen Nutzen brachte, war mit Staatsanleihen finanziert und nach Vorgaben der Eisenbahnabteilung des Generalstabes angelegt worden.2
Im Dampfzeitalter sorgte die Eisenbahn für die Verpflegung und Beförderung des Soldaten (zumindest bis zum Ende des Schienenstrangs, von dort an musste er wieder marschieren und schleppen). Der technische Fortschritt, dem die Eisenbahn ihre Entstehung verdankte, lieferte auch die Waffen, mit denen sich die Soldaten der neuen Massenheere Massenverluste beibrachten. Dabei wurden diese Waffen nicht gezielt entwickelt, zumindest in der Frühphase nicht; später mag sich das geändert haben. Hiram Maxim, der Erfinder des ersten brauchbaren Maschinengewehrs, soll angeblich seine elektromechanischen Experimente 1883 eingestellt haben, als ihm ein Landsmann riet: «Zum Henker mit deiner Elektrizität! Wenn du ein Vermögen machen willst, dann erfinde irgendwas, womit sich die europäischen Schwachköpfe noch schneller umbringen können.» Anfangs verdankten die rascher feuernden, weiter reichenden und genauer treffenden Waffen, mit denen man die Wehrpflichtigenheere zwischen 1850 und 1900 ausstattete, ihre Entstehung jedoch dem zufälligen Zusammentreffen von menschlichem Erfindungsgeist und industriellen Fertigungsmöglichkeiten.
Dabei waren vier Faktoren von besonderer Bedeutung. Erstens die Verbreitung der Dampfkraft, welche die für den industriellen Produktionsprozess erforderliche Energie lieferte. Zweitens die Entwicklung eines geeigneten Produktionsverfahrens, das man zunächst das «amerikanische» nannte, weil es in den 1820er Jahren im Connecticut Valley entstanden war, wo ein chronischer Mangel an Facharbeitern herrschte. Dieses Produktionsverfahren führte zur Verwendung «austauschbarer Teile», die mittels einer Verbesserung des alten pantographischen Prinzips maschinell hergestellt wurden, was einen enormen Anstieg der Produktionsmengen bewirkte. Dreyse, der preußische Hersteller und Erfinder des revolutionären Zündnadelgewehrs (in dem ein beweglicher Schlagbolzen auf den Boden einer metallenen Patronenhülse schlug), brachte es 1847 mit der traditionellen Fertigungsmethode lediglich auf eine Stückzahl von 10000 – obwohl er sich gegenüber der preußischen Regierung vertraglich verpflichtet hatte, das ganze Heer umzurüsten. Im Gegensatz dazu stellte die britische Waffenfabrik in Enfield, die automatische Maschinen angeschafft hatte, 100370Gewehre im Jahr 1863 her. Als die französische Regierung die Waffenschmiede in Puteaux 1866 mit Maschinen zur Herstellung «austauschbarer Teile» umrüstete, erhöhte sich die Produktion des neuen Chassepot-Gewehrs auf jährlich 300000Stück.
Fortschritte auf dem Gebiet der Metallbearbeitung wären nutzlos gewesen, wenn man nicht gleichzeitig die Qualität des zu bearbeitenden Metalls verbessert hätte. Das erreichte man, indem man Schmelzverfahren für große Stahlmengen entwickelte, was nach 1857 vor allem dem britischen Ingenieur Bessemer gelang – auch ihn hatte ein von NapoleonIII. ausgelobter Preis zu seiner Erfindung angeregt. Bessemers «Konverter» markierte den dritten wichtigen Fortschritt. Mit ähnlichen Öfen begann in Deutschland der Kanonengießer Alfred Krupp in den 1860er Jahren Gussstahlbarren zu produzieren, aus denen sich perfekte Geschützrohre fertigen ließen. Seine Hinterlader-Feldgeschütze, die größeren Ebenbilder jener Gewehre, mit denen damals die Infanteristen aller modernen Heere ausgerüstet waren, erwiesen sich im Französisch-Preußischen Krieg von 1870/71 als die entscheidende Waffe.
Das vierte Element in dieser Revolution der Feuerkraft wurde kurz darauf von europäischen Chemikern beigesteuert, vor allem dem Schweden Alfred Nobel. Er entwickelte Treib- und Sprengladungen, die ein Geschoss über weitere Entfernungen trugen und bei der Detonation eine größere Sprengwirkung entfalteten als je zuvor. Die Fortentwicklungen der Maschinentechnik und der Treibmittelchemie sorgten zu gleichen Teilen dafür, dass sich beispielsweise die effektive Schussweite von Infanteriewaffen zwischen 1850 und 1900 von knapp 100 auf gut neunhundert Meter erhöhte. Als man zwischen 1880 und 1900 dazu überging, den bei chemischen Entladungen in Handfeuer- und Artilleriewaffen freigesetzten Gasdruck wiederzuverwenden, entstanden mit Maschinengewehren und Schnellfeuergeschützen die perfekten Waffen zur Massentötung aus der Entfernung.
Überschüsse und die Fähigkeit zur Kriegführung
Weit tragende Schnellfeuerwaffen stellten eine Bedrohung dar, die alle Steigerungen der Offensivkraft, welche durch die industriellen und demographischen Umwälzungen des 19.Jahrhunderts zustande gekommen waren, wertlos machen konnte. Darin lag eine gewisse Ironie. Der materielle Triumph des 19.Jahrhunderts sollte dazu dienen, den scheinbar unabänderlichen Kreislauf der mageren und fetten Jahre zu durchbrechen, der das Leben selbst der reichsten Länder seit ewigen Zeiten bestimmte, und permanent Überschüsse zu erwirtschaften – Überschüsse an Nahrung, Energie und Rohstoffen (allerdings nicht an Kapital, Krediten oder Barmitteln). Marktschwankungen verewigten den Rhythmus von Aufschwung und Rezession im friedlichen Leben der Staaten, Überschüsse veränderten ihre Fähigkeit zur Kriegführung.
Kriege, die den primitiven Rahmen von Überfall und Hinterhalt sprengten, setzten schon immer das Vorhandensein von Überschüssen voraus. Allerdings waren akkumulierte Überschüsse in der Geschichte selten groß genug gewesen, um Kriege zu finanzieren, die in dem entscheidenden Sieg der einen Seite über die andere gipfelten. Sich selbst tragende Kriege, in denen die Beute des Eroberers die Grundlage für die Fortsetzung seines Feldzugs lieferte, waren noch seltener gewesen. Externe Faktoren – krasse Ungleichheit der aufeinander treffenden Kriegstechnologien, die Dynamik gegensätzlicher Ideologien oder, wie William McNeill meinte, Anfälligkeit gegenüber unbekannten Krankheitskeimen, die ein Angreifer einschleppte – hatten gewöhnlich den Triumph einer Gesellschaft über die andere erklärt. Und gewiss sind sie der Grund für viele frappante militärische Erfolge gewesen, etwa die Vernichtung des Azteken- und Inkareichs durch die Spanier, die islamischen Eroberungen im siebten Jahrhundert und die Ausrottung der Kriegerkultur der Ureinwohner Nordamerikas.
In den europäischen Kriegen von der Reformation bis zur Französischen Revolution, die zwischen Staaten auf etwa gleicher militärischer und kriegerischer Entwicklungsstufe ausgetragen wurden, hatten externe Faktoren wie Kriegsbereitschaft oder Widerstandsfähigkeit gegen Ansteckungskrankheiten keine ausschlaggebende Rolle gespielt, während die zur Offensive aufgewendeten Überschüsse die Ausgaben für Verteidigungsmaßnahmen, insbesondere den Festungsbau, bei weitem übertrafen. Dabei widmete man sich zunächst einmal der Zerstörung jener Feudalsitze, von denen aus die örtlichen Machthaber der Zentralgewalt getrotzt hatten, als im 11.Jahrhundert die grundbesitzenden Klassen Europas ihre Leidenschaft für den Burgenbau entdeckten. Das war eine höchst kostspielige Angelegenheit, und dazu kamen dann noch jene Kosten, die im Verlauf des 16., 17. und 18.Jahrhunderts entstanden, als man in den grenznahen Gebieten lokale durch staatliche Befestigungsanlagen ersetzte.
Investitionen in den Festungsbau – destruktiver oder konstruktiver Art – hatten zur Folge, dass in die zivile Infrastruktur– Straßen, Brücken, Kanäle – kaum Mittel flossen, hätte man doch sonst einem angreifenden Heer den Vormarsch zu sehr erleichtert: Während 1826 das britische Straßennetz, das nach dem Jakobitenaufstand von 1745 in Schottland vorwiegend zu militärischen Zwecken angelegt worden war, mehr als 34000Kilometer umfasste, war das Straßennetz in Frankreich, einem Land von der dreifachen Größe Englands, keineswegs ausgedehnter, und Preußen, das sich über einen großen Teil des strategisch bedeutsamsten Gebietes in Mitteleuropa erstreckte, verfügte über ein Straßennetz von lediglich 5300Kilometern, vor allem in den Rheinprovinzen. Bei Preußens östlichen Nachbarn gab es praktisch gar keine befestigten Wege, woran sich in Polen und Russland – sehr zum Leidwesen Napoleons und später Hitlers – bis weit ins 20.Jahrhundert hinein auch nichts ändern sollte.
Die Überschüsse des 19.Jahrhunderts, die dem Wirtschaftswunder in Europa zu verdanken waren, glichen die Auswirkungen von Minderinvestitionen in den Straßenbau und Überinvestitionen in die Grenzbefestigung aus. Massenheere wurden entlang der neu entstehenden Schienenstränge verlegt und versorgt und überschwemmten strategisch wichtige Gebiete wie Flutwellen nach einem Anstieg des Meeresspiegels. 1866 und 1870 fielen die preußischen Armeen in die Grenzregionen des österreichischen Böhmen beziehungsweise des französischen Elsass-Lothringen ein, ohne dass die aufwendigen, zum Schutz der Grenzen errichteten Befestigungsanlagen sie daran hätten hindern können. Truppenbewegungen in Europa erfolgten jetzt ähnlich rasch wie die Feldzüge während des Amerikanischen Bürgerkriegs, die von Massenheeren in einer Landschaft ohne künstliche Hindernisse vorgetragen wurden. Regionen, die zweihundert Jahre lang Zankapfel habsburgischer und bourbonischer Generale waren, in denen um jedes Erdloch und jede Felsspalte gekämpft worden war, sahen sich jetzt unter der Wucht der Dampfkraft in wenigen Wochen vollkommen umgestaltet. Es schien, als ob eine zweite «militärische Revolution» bevorstehe, durchaus zu vergleichen mit jener, die zu Beginn von Renaissance und Reformation durch das Schießpulver und das mobile Feldgeschütz herbeigeführt worden war. Blut, Eisen und Gold, in einem Übermaß verfügbar, wie es bislang auch den reichsten Potentaten nicht zu Gebote gestanden hatte, verhießen schnellere und «totalere» Siege, als sie Alexander der Große oder Dschingis Khan je errungen hatten.
Solche Siege wurden verheißen, aber nicht zwangsläufig erzielt; denn die größten materiellen Vorteile nützen nichts, wenn es an den menschlichen Eigenschaften fehlt, die erforderlich sind, um den richtigen Gebrauch davon zu machen. Doch auch auf diesem Gebiet hatte das 19.Jahrhundert tief greifende Umwälzungen bewirkt. Der Soldat des 18.Jahrhunderts war ein bemitleidenswertes Geschöpf gewesen: Er war Untertan seines Königs und gelegentlich – so in Russland und Preußen – noch ein Höriger oder Leibeigener, der von seinem Grundherrn in den Waffendienst des Staates gegeben wurde.
Die Uniformen des Soldaten bedeuteten oft die Kapitulation vor Not und Elend, den häufigsten Gründen für eine Anwerbung. Darüber hinaus zeigten sie oft an, dass jemand die Seiten gewechselt hatte (in den meisten Heeren stellten gefangene Überläufer einen Großteil der Truppe) oder dass er unter fremder Fahne in Söldnerdienste getreten war (wie es zur Zeit des Ancien Régime Zehntausende von Schweizern, Schotten, Iren, Slawen und anderen Gebirgsbewohnern taten). Die Uniform konnte auch bedeuten, dass sich der Träger, nachdem er wegen eines Bagatellvergehens im Gefängnis gelandet oder wegen privater Schulden gepfändet worden war, auf einen «Kuhhandel» mit der Obrigkeit eingelassen hatte – oder er war einfach nicht schnell genug gewesen, um den Werbern zu entkommen. Freiwillige waren geradezu eine Seltenheit, dafür gehörten sie zu den besten Soldaten. Da so viele ihrer Waffenbrüder wenig Lust zum Kriegsdienst hatten, wurde Desertion mit drakonischen Strafen belegt; die Disziplinarordnung war grausam. Für Dienstpflichtverletzungen wurde der Soldat des 18.Jahrhunderts geprügelt, bei Disziplinlosigkeit gehängt; beide Vergehen wurden großzügig ausgelegt.
Im Gegensatz dazu war der Soldat des 19.Jahrhunderts ein Mann, der genau das sein wollte, was er war: Ein williger, oft begeisterter Soldat, zumeist ein Wehrpflichtiger, allerdings einer, der seine (zugegebenermaßen kurze) Dienstzeit hinnahm als eine bloße Verringerung seiner Jahre in Freiheit, eine Zeit, die man so munter wie gehorsam hinter sich brachte. Zumindest war das seit der Jahrhundertmitte in den Heeren der fortgeschrittenen Länder der Fall – vor allem in Preußen, aber auch in Frankreich und Österreich; die kleineren, weniger fortschrittlichen Staaten bemühten sich, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Die gewandelte Einstellung lässt sich zwar schwer belegen, sie ist jedoch durchaus real. Vielleicht zeigt sie sich am deutlichsten in der Beliebtheit der Regiments-Souvenirs, die man gegen Ende des 19.Jahrhunderts zu Zehntausenden herstellte. Ein solches Erinnerungsstück, in Deutschland meist ein Bierkrug mit Bildern aus dem Soldatenleben, trug gewöhnlich die Namen der Zug-Kameraden, ein paar neckische Verszeilen, einen Gruß ans Regiment – «Auf die 12.Grenadiere!» – und stets die Aufschrift «Zur Erinnerung an meine Dienstzeit». Der junge Mann, der von den Nachbarn mit Blumengirlanden geschmückt in die Kaserne aufgebrochen war – ein ganz anderer Abschied, als er dem russischen Leibeigenen im 18.Jahrhundert zuteil wurde, für den der Dorfpope eine Totenmesse las–, brachte nach Ende der Dienstzeit sein Erinnerungsstück heim und räumte ihm einen Ehrenplatz in der guten Stube ein.
Dieser bemerkenswerte Wandel in der Einstellung zum Wehrdienst war buchstäblich revolutionär. Seine Gründe sind vielfältiger Natur, doch die drei wichtigsten führen direkt zur Französischen Revolution und den zentralen Schlagwörtern ihrer Ideologie zurück: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Seine Beliebtheit verdankte der Militärdienst im 19.Jahrhundert zunächst einmal der Erfahrung der Gleichheit. «Kochs Sohn– Herzogs Sohn– Sohn eines vornehmen Grafen», so beschrieb Rudyard Kipling einigermaßen zutreffend die Armee, die England 1900 in den Burenkrieg schickte. Die allgemeine Kriegsbegeisterung veranlasste Angehörige aller Schichten, sich als einfache Soldaten zum Militär zu melden, natürlich als Freiwillige. Und die allgemeine Wehrpflicht wurde von allen Schichten wohl oder übel hingenommen – in Preußen seit 1814, in Österreich seit 1867 und in Frankreich seit 1889.Sie dauerte zwei oder drei Jahre.
Der Anteil der gezogenen Jahrgänge schwankte ebenso wie die Dauer der Dienstzeit. Junge Männer mit gehobener Bildung erhielten Zugeständnisse; in Deutschland zum Beispiel dienten Absolventen der Untersekunda und Abiturienten nur ein Jahr lang und kamen danach als potenzielle Offiziere zur Reserve. Doch das generell gutgeheißene Prinzip der allgemeinen Dienstpflicht wurde auch als Dauerinstitution akzeptiert. In der ersten Zeit nach ihrer Entlassung kehrten die Reservisten alljährlich zu Übungen zurück; mit zunehmendem Alter wurden sie der nur für den Kriegsfall benötigten Reserve eingegliedert (in Preußen war dies die Landwehr, in Frankreich die Territorialarmee), und während der letzten Jahre ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit standen die Männer der Heimatwehr (Landsturm) zur Verfügung. Reserveübungen ließ man gut gelaunt über sich ergehen und betrachtete sie als eine Art Urlaub unter Männern. Sigmund Freud, der im österreichischen Heer Sanitätsoffizier der Reserve war, schrieb 1886 einem Freund aus dem Manöver, es sei undankbar, nicht einzuräumen, dass das Soldatenleben mit seinem unentrinnbaren «Muss» gut gegen Neurasthenie sei: Bei ihm sei sie nach einer Woche verschwunden.
Auch in sozialer Hinsicht sorgte die Wehrpflicht für relative Gleichheit. Juden wie Freud zog man genauso ein wie Nichtjuden, und in der österreichisch-ungarischen Armee wurden sie bei entsprechendem Bildungsgrad automatisch zu Offizieren befördert. Im deutschen Heer konnten Juden Reserveoffizier werden, doch wegen des Antisemitismus in den Regimentern waren sie in regulären Offiziersstellen selten; zu den ganz wenigen Ausnahmen gehörte der Sohn von Bismarcks Finanzier Bleichröder, dem sein Vater ein reguläres Offizierspatent bei der Kavallerie verschaffen konnte. Der Offizier, der Hitler zur Verleihung des Eisernen Kreuzes Erster Klasse vorschlug, war ein jüdischer Reservist. Das war «Emanzipation» in ihrer militärischen Spielart, und sie betraf nicht nur die Juden. Die Universalität der Wehrpflicht scharte sämtliche Nationalitäten im Habsburgerreich zusammen, in Deutschland die Polen, Elsässer und Lothringer und in Frankreich die Basken, Bretonen und Savoyer. Dadurch, dass sie Soldaten waren, sollten sie Österreicher, Deutsche oder Franzosen sein.
Die Wehrpflicht war nicht nur ein Instrument der Gleichheit, sondern auch der Brüderlichkeit. Weil sie alle im selben Lebensalter erfasste und sie im Prinzip gleich behandelte, knüpfte sie brüderliche Bande, die junge Europäer so noch nie zuvor empfunden hatten. Die allgemeine Schulpflicht, ebenfalls eine Neuerung, nahm die Kinder aus ihren Familien heraus und vermittelte ihnen das Gemeinschaftserlebnis des Lernens, die Wehrpflicht entfernte die jungen Männer aus ihrer gewohnten Umgebung und vermittelte ihnen die Erfahrung des Erwachsenwerdens, indem sie sie mit einer Fülle neuer Anforderungen konfrontierte – die Trennung von Zuhause zu verarbeiten, neue Freundschaften zu schließen, sich in Autoritätsverhältnisse zu fügen, merkwürdige Kleidung zu tragen, ungewohnte Speisen zu essen (oft sehr viel bessere als daheim) und allein zurechtzukommen. Es war ein regelrechter Initiationsritus, in geistiger, emotionaler und nicht zuletzt in körperlicher Hinsicht.
Die Armeen des 19.Jahrhunderts, von denen es hieß, sie seien die «Schule der Nation», übernahmen viele Funktionen des damaligen Schulwesens, nicht nur die Überprüfung und Verbesserung von Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch die Unterweisung in Schwimmen, Leichtathletik, Geländelauf, Schießen und Kampfsport. Turnvater Jahn, der Pionier der Körperertüchtigung in Deutschland, übte nachhaltigen Einfluss auf die militärische Ausbildung im preußischen Heer aus. In Frankreich wurden seine Ideen von den Trainern des Bataillon de Joinville umgesetzt, während in Italien Hauptmann Caprilli eine Militär-Reitschule gründete, die in der ganzen westlichen Welt die Reitkunst beeinflussen und verändern sollte. Später prägte das militärische Leben im Freien, das sich am Lagerfeuer und unter dem Zeltdach abspielte, die Ideale der deutschen Jugendbewegung und der Pfadfinder. Der Kreis schloss sich, als diese Ideale von dort den Weg wieder zurück ins gesellschaftliche und militärische Leben fanden.
Der Initiationsritus der allgemeinen Wehrpflicht war jedoch nicht für jeden eine befreiende Erfahrung. Wenn junge Männer aus einer Gesellschaft, die sich in einem Prozess rascher Urbanisierung und Industrialisierung unaufhaltsam von Pflug und Dorfbrunnen entfernte, zum Wehrdienst eingezogen wurden, fanden sie sich, wie William McNeill darlegt,
in einer einfacheren Gesellschaft wieder, als sie ihnen aus dem Zivilleben vertraut war. Der gemeine Soldat verlor beinahe jede persönliche Verantwortung. Ritual und Routine beherrschten fast sämtliche Arbeitsstunden. Das schlichte Befolgen der Befehle, welche die Routine von Zeit zu Zeit unterbrachen und der Tätigkeit eine neue Richtung gaben, linderte die Ängste, die persönlichen Entscheidungen innewohnten – Ängste, die sich unübersehbar vervielfältigten in der städtischen Gesellschaft, in welcher konkurrierende Führergestalten, konkurrierende Loyalitäten und praktische Alternativen, wie man zumindest einen Teil seiner Zeit verbringen konnte, hartnäckig um die Aufmerksamkeit wetteiferten. So paradox es klingen mag, die Flucht vor der Freiheit war oftmals eine echte Befreiung, insbesondere für junge Männer, deren Lebensverhältnisse sich rasch veränderten und die noch nicht in der Lage waren, ihrer Erwachsenenrolle voll gerecht zu werden.
Doch selbst wenn man diese scharfsichtige Beobachtung in Rechnung stellt, war der wichtigste Wandel, den die allgemeine Wehrpflicht in der Einstellung zum Militärdienst hervorrief, der Umstand, dass ein solcher Dienst letztlich mit Freiheit in Verbindung gebracht wurde – wenn nicht im persönlichen, so doch im politischen Sinne. Die alten Armeen waren Instrumente gewesen, mit deren Hilfe Monarchen ihr Volk unterdrückt hatten; die neuen Heere sollten Instrumente sein, um das Volk von seinen Monarchen zu befreien, mochte sich die Befreiung in den Staaten, die die Monarchie beibehielten, auch in einem engen institutionellen Rahmen bewegten. Beide Ideen widersprachen einander nicht. Der französische Nationalkonvent hatte 1791 verfügt: «Das Bataillon eines jeden Bezirks hat sich unter einem Banner zu sammeln, das die Aufschrift trägt ‹Das französische Volk, gegen die Tyrannei vereint›.» Dieses Dekret brachte eine Idee zum Ausdruck, die in der Verfassung der Vereinigten Staaten ebenfalls enthalten ist, dass nämlich «das Recht, Waffen zu tragen», unmittelbare Freiheiten garantiere, sobald es für alle gelte. Zwei Jahre zuvor hatte der Revolutionsführer Dubois de Crancé einen ganz ähnlichen Vorschlag geäußert: «Jeder Bürger muss Soldat sein und jeder Soldat Bürger, sonst werden wir niemals eine Verfassung haben.»
Die Spannung zwischen dem Prinzip, Freiheiten durch revolutionären Umsturz zu gewinnen, und demjenigen, sie auf legale Weise durch Ableistung des Militärdienstes zu erwerben, sollte das politische Leben in Europa über weite Strecken des 19.Jahrhunderts lähmen. In Frankreich riefen die Auswüchse der mit Waffengewalt erstrittenen Freiheit die Reaktion des Thermidor hervor und lenkten den Eifer der extremistischen Sansculotten auf militärische Eroberungen. Die Siege der «revolutionären» Heere (nach 1795 fest in der Gewalt ihrer Offiziere, von denen ironischerweise viele wieder Monarchisten wurden) veranlassten ihre Feinde, vor allem die Monarchen von Preußen und Österreich, eine Spielart der Levée en masse anzuordnen, also der allgemeinen Wehrpflicht, in deren ursprünglicher Form sich die militärische Seite der Französischen Revolution manifestierte. Diese Konskription schuf Volksheere– Landwehr, Landsturm, Freiwillige Jäger–, um die Franzosen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Sobald sie ihre Pflicht getan hatten, wurden die Landwehr und die Freiwilligen Jäger lästig. Nachdem Napoleon auf St.Helena in sicherem Gewahrsam saß, verliehen Preußen und Österreich den Volksheeren mit ihren liberal gesinnten Offizieren den Status von Reservekontingenten und hatten nicht die Absicht, ihre Dienste jemals wieder in Anspruch zu nehmen. Trotzdem überlebten die Verbände bis zum «Revolutionsjahr» 1848, als ihre Angehörigen auf den Straßen von Wien und Berlin um die Verfassungsrechte kämpften; in Berlin wurde die Erhebung von den preußischen Gardetruppen niedergeschlagen, der stärksten Bastion der traditionellen Staatsmacht. Eine ganz ähnliche Rolle wie die Landwehr und die Freiwilligen Jäger spielte die Nationalgarde in Frankreich, in der während des Zweiten Kaiserreichs das «liberale» Prinzip des Soldatentums fortlebte. Als die Preußen sich 1871 aus Paris zurückgezogen hatten, unterstützte die Nationalgarde den blutigen Aufstand der Pariser Kommune gegen die reguläre Armee der konservativen Dritten Republik, der am Ende 20000Mitgliedern der Kommune das Leben kosten sollte.
«Keine Wehrpflicht ohne parlamentarische Vertretung»
Zwar endete der Kampf gegen die Armeen der Reaktion für die bürgerlichen Kräfte mit einer militärischen Niederlage, doch indirekt erzeugte er den Druck, der die konservativen europäischen Regierungen zwang, Verfassungs- und Wahlrecht zu gewähren. Die Forderung nach diesen Rechten lag in der Luft, und der impôt du sang – der «Blutzoll», wie man die Wehrpflichtgesetze in Frankreich nannte – konnte nicht erhoben werden, solange man den Bürgern verfassungsmäßige Rechte verweigerte, insbesondere dann nicht, wenn Nachbarstaaten ihre Heere und Reservetruppen mittels der Wehrpflicht vergrößerten. Preußen, der militärische Schrittmacher, erließ 1849 unter dem Eindruck der Furcht, die ihm die bewaffneten Revolutionäre im Jahr zuvor eingejagt hatten, eine Verfassung. 1880 hatten sowohl Frankreich als auch das Deutsche Reich (seit 1871) das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt, woraufhin Frankreich 1882 eine allgemeine dreijährige Dienstpflicht verfügte. Österreich dehnte 1907 das Wahlrecht auf alle Männer aus. Selbst Russland, das von allen Staaten der autokratischste und hinsichtlich seiner Wehrpflichtgesetze – sie sahen einen vierjährigen Dienst vor – der anspruchsvollste war, hatte nach der Niederlage gegen die Japaner in der Mandschurei und der darauf folgenden Revolution im Jahr 1905 ein Abgeordnetenhaus geschaffen.
Kurzum, No conscription without representation («Keine Wehrpflicht ohne parlamentarische Vertretung») wurde in dem halben Jahrhundert vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Europa stillschweigend zur politischen Maxime. Da es sich bei der Wehrpflicht tatsächlich um eine Besteuerung handelt, eine der Zeit, nicht des Vermögens, bringt die Maxime genau die Forderung zum Ausdruck, die die amerikanischen Kolonisten 1776 gegenüber GeorgIII. erhoben. Ausgerechnet in den Staaten, in denen das Stimmrecht allen, zumindest jedoch den meisten freien Männern, gewährt wurde und in denen der Militärdienst auf jene beschränkt blieb, die «Not und Elend» dazu trieb – also in den Vereinigten Staaten und Großbritannien–, zeigten die Bürger, als sich die europäischen Heere im 19.Jahrhundert unter dem Einfluss der Wehrpflicht stark vergrößerten, eine seltsame Leidenschaft für den Militärdienst. In seinem Anfangsstadium hätte der amerikanische Bürgerkrieg nicht ohne die Freiwilligenverbände geführt werden können, die Namen trugen wie Liberty Rifles of New Jersey, Mechanic Phalanx of Massachusetts, Republican Blues of Savannah (Georgia) oder Palmetto Guard of Charleston (South Carolina). 1859 hatte die durch den Ausbau der französischen Kriegsflotte ausgelöste Furcht in Großbritannien ein ähnliches, wenn auch viel größeres Netzwerk entstehen lassen. Tennysons aufrüttelnde Verse Form, Riflemen, form («Formiert euch, Schützen, formiert euch») hatten dazu beigetragen, dass sich 200000Zivilisten zu solchen Freischaren organisierten. Den Staat brachte das in große Verlegenheit; die Regierung konnte sie zwar nicht daran hindern, sich Uniformen anzufertigen oder zu kaufen, aber sie war nicht bereit, die Bewaffnung seiner Bürger zu dulden oder zu unterstützen.
Letztlich aber blieb der Staatsmacht, die wie alle anderen in Europa seit der Einführung der öffentlichen Ordnung zu Beginn des 18.Jahrhunderts die Entwaffnung der eigenen Bevölkerung energisch durchgesetzt hatte, nichts anderes übrig, als die Freiwilligen mit Gewehren aus den staatlichen Zeughäusern auszurüsten. Dass es sich dabei um moderne Waffen und nicht um die veralteten Musketen handelte, war von entscheidender Bedeutung. Die Muskete war, wie die von den dynastischen Heeren getragene Livree-Uniform, ein Symbol der Knechtschaft. Ihre Reichweite war so gering, dass sie ihre volle Wirkung nur dann entfaltete, wenn man die Musketiere zu dichten Reihen zusammenfasste und sie eng zusammengerückt und gestaffelt hielt. Im Gegensatz dazu war das Gewehr eine Waffe, bei der es auf individuelle Geschicklichkeit ankam. Es war nicht schwer, damit einen Soldaten auf 500Meter Entfernung zu erschießen, in den Händen eines Scharfschützen konnte es einen General aus einer Distanz von mehr als 1000Metern töten. Daher waren die Pariser Kommunarden davon überzeugt, dass «das Gewehr alle Männer groß macht», wie Thomas Carlyle sagte.
Ein Gewehrschütze konnte es mit jedem aufnehmen. Um den Status zu betonen, den ihnen diese Waffe verlieh, kleideten sich die British Rifle Volunteers nicht wie die Soldaten der Linientruppen, die sich aus «Not und Elend» heraus verpflichtet hatten, in den engen, scharlachroten Rock der Linientruppen, sondern in die lockeren Tweed-Jagdanzüge des Landadels. Diese Tracht ergänzten einige noch durch «Garibaldi-Hemden» oder die Schlapphüte der 1848er Revolutionäre. 1914 waren die Soldaten in allen europäischen Heeren (außer in Frankreich) mit derartigen Jagdanzügen ausgestattet, wenn auch mit Unterschieden in Schnitt und Farbe – feldgrau oder erdbraun–, und mit einem Hochgeschwindigkeitsgewehr mit großer Reichweite bewaffnet. Kein Militärabzeichen trug man stolzer zur Schau als das des Scharfschützen, und in den Einheiten, die sich als Erste der neuen Waffe bedienten – in Deutschland und in Österreich die Jäger, in Frankreich die Chasseurs und in England die Greenjackets –, herrschte ein besonderer Korpsgeist und das Bewusstsein, die modernste Form des Soldatentums zu verkörpern.
In Wahrheit jedoch waren alle Soldaten, die 1914 in den Krieg zogen, ein lebender Beweis für die Modernität ihrer Heimatländer. Sie waren diensttauglich, kräftig, hervorragend bekleidet und versorgt, mit hoch wirksamen tödlichen Waffen ausgerüstet und beseelt von dem Glauben, freie Männer zu sein, die sich frei auf dem Schlachtfeld entfalten und schnell entscheidende Siege erringen würden. Vor allem aber waren sie zahlreich. Keine Gesellschaft der Welt hatte, proportional gesehen, jemals so viele Soldaten hervorgebracht wie Europa im August 1914.Nach einer Faustregel der Nachrichtenabteilung im preußischen Großen Generalstab konnte eine Million Einwohner eines Landes je zwei Divisionen Soldaten, also rund 30000Mann, unterhalten.
Bei der Mobilmachung bestätigte sich dieses Verhältnis in etwa: Frankreich mit seiner Bevölkerung von 40Millionen mobilisierte 75Infanteriedivisionen (und weitere zehn Divisionen Kavallerie); in Deutschland, wo 57Millionen Menschen lebten, waren es 87Divisionen Infanterie (dazu elf Divisionen Kavallerie); Österreich-Ungarn besaß 46Millionen Einwohner und stellte 49 Infanteriedivisionen sowie elf Divisionen Kavallerie auf, und die 100Millionen Russen schickten 114Divisionen Infanterie und 36Divisionen Kavallerie ins Feld. Da sich jede Division aus einer bestimmten Region rekrutierte – die deutsche 9. und 10.Division zum Beispiel stammten aus Niederschlesien, die französische 19. und 20. kamen aus dem Pas de Calais, die österreichische 3. und 5. aus Linz und Oberösterreich, die ersten drei russischen Divisionen aus dem Baltikum–, wurden diese Gegenden durch das Ausrücken der Großverbände über Nacht ihrer jungen Männer beraubt. In den ersten beiden Augustwochen zogen mehr als 20Millionen Europäer, annähernd zehn Prozent der Gesamtbevölkerung aller Krieg führenden Staaten, die Uniform an, schulterten ihr Gewehr und bestiegen den Zug, der sie ins Feld brachte. Die meisten von ihnen glaubten, was man ihnen gesagt hatte: dass sie wieder in der Heimat wären, «bevor das Herbstlaub fällt».
Es sollten vier Jahre und fünf Herbste verstreichen, bis die Überlebenden heimkehrten, rund zehn Millionen Tote ließen sie auf den Schlachtfeldern zurück. Diese ungeheure Zahl von tüchtigen und kräftigen jungen Männern, ein Ergebnis des europäischen Wirtschaftswunders im 19.Jahrhundert, war von eben jenen Kräften verschlungen worden, die ihnen zu Leben und Gesundheit verholfen hatten. Die 1914 ursprünglich mobilisierten Divisionen hatten ihr Personal mindestens zweimal, in manchen Fällen sogar dreimal «ausgewechselt». Im Krieg aufgestellte Divisionen hatten vergleichbare Verluste erlitten, denn die Aushebungsmaschinerie lief bis zum Schluss und verschlang nicht nur die classes derjenigen, die ins wehrfähige Alter gekommen waren, sondern auch die Älteren, die eigentlich noch zu Jungen und die weniger Tauglichen, die sie in Friedenszeiten verschmäht hätte. Zwischen 1914 und 1918 wurden zehn Millionen Franzosen von dieser Maschinerie erfasst, wobei von jeweils neun Rekruten vier ums Leben kamen.
Bei den Deutschen betrug die Zahl der Gefallenen mehr als drei Millionen, bei den Österreichern eine Million, bei den Briten starben ebenso viele und bei den Italienern, die erst im Mai 1915 in den Krieg getreten und an der schmalsten Front gekämpft hatten, mehr als 600000Mann. Die Toten der russischen Armee, deren Zusammenbruch den Bolschewiki 1917 die Übernahme der Macht ermöglichte, sind niemals genau gezählt worden. Ihre Gräber und die ihrer deutschen und österreichischen Gegner liegen weit verstreut zwischen den Karpaten und der Ostsee; die an der Westfront gefallenen Franzosen, Briten, Belgier und Deutschen sind auf einem schmalen Streifen Grenzland bestattet, wo solche Grabfelder zu beherrschenden und dauerhaften Wahrzeichen geworden sind. Die von den Briten angelegten Friedhöfe – deren Architektur der große Neoklassizist Edwin Lutyens schuf, während Rudyard Kipling, selbst Vater von Opfern des Großen Krieges, für die Grabinschriften verantwortlich ist: «Ihr Name lebe fort in Ewigkeit» und, auf den Gedenksteinen der unbekannten Toten, «Ein Soldat des Großen Krieges, nur Gott bekannt» – sind Orte von ergreifender Schönheit.
«Totenstädte» hat man sie genannt, obwohl «Totengärten» die Sache eher träfe. Die Friedhöfe sind höchste Zeugnisse jener romantischen Landschaftskunst, die einen Beitrag Englands zur Weltkultur darstellt. Doch diejenigen, die sie füllten, kamen direkt aus den – wie man es damals empfand – «Stätten des wahren Lebens», in denen sich das emotionale, geistige und materielle Geschehen der Zeit konzentrierte, intensiver und leidenschaftlicher als alles, was Europa seit der Französischen Revolution erlebt hatte. «Die Front muss zwangsläufig anziehend auf uns wirken», schrieb der französische Jesuit und Philosoph Teilhard de Chardin, «ist sie doch in gewisser Hinsicht die äußerste Grenze zwischen dem, dessen wir uns deutlich bewusst sind, und dem, was noch im Werden ist. Wir sehen nicht nur Dinge, die wir nirgendwo anders erfahren, sondern nehmen auch wahr, wie in uns selbst eine Flut von Klarheit, Energie und Freiheit aufsteigt, die im normalen Leben kaum zu finden sein dürfte.»
Teilhard de Chardin bedient sich der Rhetorik der Barrikadenkämpfe von 1871, 1848 und 1789, und das mit gutem Grund. Die Schützengräben an der Westfront waren tatsächlich Barrikaden. Alan Seeger, ein Dichter und Opfer dieser Schützengräben, nannte sie «umstrittene Barrikaden» – über die hinweg die emanzipierte Jugend Europas die Gewehre, Symbole ihres Status als freie Bürger, zur Verteidigung der Werte von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in Anschlag brachte. Das 19.Jahrhundert hatte diese Werte allen geschenkt, doch der Nationalismus hatte dem einzelnen Bürger eingeredet, dass sie sich nur innerhalb der Grenzen des eigenen Staates sinnvoll entfalten könnten. Die Revolution, so hatten ihre Väter aufrichtig geglaubt, sei eine Gabe, an der alle teilhaben würden, ein Geschenk, das zur Brüderlichkeit unter den Völkern wie der Menschen beitragen werde. Aber sie hatte sich sämtlichen Versuchen, sie zu internationalisieren, widersetzt. In der Anfangsphase hatte sie ihre Dynamik nur in einem einzigen Land entfaltet, und als ihre Werte weitere Verbreitung fanden, führte das in einer merkwürdigen Pervertierung dazu, dass der Amour propre der Nationen, in denen sie heimisch wurden, sich verstärkte. Die Französische Revolution brachte die Franzosen zu der – noch heute bestehenden – Überzeugung, sie seien dem Gleichheitsprinzip wie keine andere Nation verpflichtet; unter dem Einfluss der Revolution verstärkte sich in Deutschland das Bekenntnis zur Brüderlichkeit; und die von der Revolution proklamierte Freiheit vermochte an der Gewissheit der Briten nichts zu ändern, dass sie dieses Ideal bereits weit gründlicher verwirklicht hätten, als irgendwelche Nachzügler jemals von sich behaupten könnten.
Die Früchte des Sieges
Die Staaten, denen der Erste Weltkrieg sowohl den Sieg als auch dessen Früchte brachte – in erster Linie Frankreich und Großbritannien–, konnten das erlittene Leid ohne ernstliche Beeinträchtigung des Nationalgefühls mit dem Glauben an die höheren Werte vereinbaren, der ihre Kriegführung motiviert hatte. In beiden Ländern herrschte die reale, aber unausgesprochene Einstellung, die Opfer des Ersten Weltkriegs seien nicht umsonst gewesen. Trotz des hohen Preises – an Menschenleben und, im Falle Frankreichs, auch an materiellen Werten – hatte der Krieg der Volkswirtschaft Aufschwung und Expansion beschert, selbst wenn in seinem Verlauf ein großer Teil der überseeischen Investitionen hatte liquidiert werden müssen, um Rohstoffe und Fertigwaren zu bezahlen. Noch wichtiger jedoch war, dass der Krieg ihre überseeischen Besitzungen stark erweitert hatte.
Großbritannien und Frankreich waren – in dieser Reihenfolge – bis 1914 die wichtigsten imperialen Mächte der Erde gewesen (für Deutschland ein ausschlaggebender Faktor, die beiden Länder anzugreifen); 1920, als man die Kolonien der besiegten Mächte unter dem Mandat des Völkerbunds verteilt hatte, waren ihre Imperien noch größer geworden. Frankreich, in Nord- und Westafrika die dominierende Macht, fügte seinen Besitzungen Syrien und den Libanon hinzu. Großbritannien, das Mutterland des größten Kolonialreiches, das die Welt je gesehen hatte, schlug seinen ostafrikanischen Kolonien Deutsch-Ostafrika hinzu, womit sich der Traum eines britischen Afrika «vom Kap bis Kairo» erfüllte. Gleichzeitig erwarb es die Mandate über Palästina und den Irak, ehemals türkische Territorien, und festigte so seine Macht über den «fruchtbaren Halbmond», der von Ägypten bis ans obere Ende des Persischen Golfs reichte.
Brosamen vom Tische des deutschen und türkischen Reiches fielen auch andernorts nieder; Deutsch-Südwestafrika und Papua gingen an Südafrika und Australien; Rhodos wurde italienisch; die deutschen Inseln im Pazifik fielen an Japan – eine Beschwichtigungsgeste, die, wie sich später zeigen sollte, schlecht bedacht war. Italien und Japan glaubten, dass ihnen mehr zustünde, insbesondere, weil auch die größeren Verbündeten die Krümel nicht verschmähten. Das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, sollte in den folgenden Jahre einen gefährlichen Unmut schüren. Aber die Verbitterung der benachteiligten Sieger war nichts im Vergleich zu derjenigen der Bezwungenen. Österreich und die Türkei, von alters her Konkurrenten um die Herrschaft über Mitteleuropa, fügten sich resignierend in die bescheidenen Rollen, die sie nun spielten. Anders Deutschland. Das Gefühl der Demütigung saß tief. Das Reich hatte nicht nur seinen Status als aufstrebende Kolonialmacht eingebüßt, sondern in Westpreußen und Oberschlesien auch seine historischen Vormarschstraßen nach Osteuropa. Außerdem hatte es die Herrschaft über ein strategisch bedeutsames Gebiet verloren, das so weitläufig und zentral gelegen war, dass dessen Besitz noch im Juli 1918 den Sieg und damit die Herrschaft über ein neues Reich im Herzen Europas verheißen hatte.
Am 13.Juli 1918, dem Vorabend der Zweiten Marneschlacht, hielten die deutschen Heere ganz Westrussland besetzt – bis zu einer Linie, die von der Ostsee westlich Petrograds (Sankt Petersburgs) bis ans Asowsche Meer bei Rostow am Don reichte. Mit der Ukraine einschließlich Kiew, Hauptstadt des Landes und ein historisches Zentrum der russischen Kultur, waren ein Drittel der russischen Bevölkerung, ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche und mehr als die Hälfte der Industrie vom Rest des Landes abgeschnitten. Zu alledem markierte diese Linie keine vorläufigen Gebietseroberungen, sondern den in einem internationalen Vertrag vom März 1918 in Brest-Litowsk festgeschriebenen Grenzverlauf des annektierten Territoriums.
Die deutschen Truppen waren im Osten bis nach Georgien, im Süden bis zur bulgarisch-griechischen Grenze und zur Po-Ebene in Norditalien vorgedrungen. Mittels seiner österreichischen und bulgarischen Satelliten kontrollierte Deutschland den gesamten Balkan, und durch das Bündnis mit der Türkei reichte seine Macht bis zu den nördlichen Gebieten Arabiens und Persiens. In Skandinavien war Schweden wohlwollend neutral, während Deutschland den Finnen half, die Unabhängigkeit von den Bolschewiki zu erlangen – ein Ziel, das bald auch Litauen, Lettland und Estland anstreben sollten. Im fernen Südostafrika hielt ein deutsches Kolonialheer eine zehnmal so große alliierte Armee in Atem. Und im Westen, an der entscheidenden Front des Krieges, standen die deutschen Armeen keine 80Kilometer vor Paris. In fünf Großoffensiven, deren erste im März 1917 begann, hatte die deutsche Oberste Heeresleitung das gesamte Territorium wiedergewonnen, um das es seit vier Jahren, seit der Ersten Marneschlacht, mit Frankreich kämpfte. In einer sechsten Offensive sollten die Angriffsspitzen bis Paris vordringen und den Krieg entscheiden.
Fünf Monate später war der Krieg tatsächlich entschieden, allerdings zugunsten der Franzosen, Briten und Amerikaner, nicht der Deutschen. Deren Soldaten, die von alliierten Gegenoffensiven im Juli, August und September an die belgische Grenze zurückgeworfen worden waren, erfuhren im November von dem Waffenstillstand, den ihre Truppenführer geschlossen hatten, und zogen über den Rhein zurück in die Heimat, wo sie sich selbst demobilisierten. Innerhalb weniger Tage nach ihrer Rückkehr hatte die größte Armee der Welt – sie zählte immer noch mehr als 200Divisionen – ihre Gewehre und Stahlhelme abgegeben und sich heimwärts zerstreut. In Auflehnung gegen all die Zwänge, auf die sich das Deutsche Reich und das militärische System Europas in den voraufgegangenen 50Jahren gegründet hatten, beschlossen Bayern, Sachsen, Hessen, Hannoveraner und Preußen, sogar die Angehörigen der Kaiserlichen Garde ganz spontan, sich den Befehlen ihrer Vorgesetzten zu verweigern und ins Zivilleben zurückzukehren. Städte und Dörfer, denen seit 1914 die jungen Männer fehlten, hatten sie plötzlich in hellen Scharen wieder. Die Berliner Regierung jedoch, die seit 100Jahren ihre schier grenzenlose Militärmacht für selbstverständlich gehalten hatte, musste plötzlich auf alle ihre Soldaten verzichten.
Das Freikorps-Phänomen
In einem militärischen Vakuum können Staaten nicht überleben; ohne Streitkräfte existieren sie nicht. Schon bald offenbarte sich diese Wahrheit den nach dem Sturz des Kaisers an die Macht gekommenen Sozialisten, obwohl sie die autokratische durch eine Volksregierung ersetzen wollten. Angesichts bewaffneter kommunistischer Aufstände und russisch-bolschewistischer Interventionen – in Bayern, in den Ost- und Nordseehäfen und in Berlin selbst – nahm die sozialdemokratische deutsche Regierung jede Hilfe an, die sie bekommen konnte. Es war nicht der Augenblick, um wählerisch zu sein, und sie zeigte sich auch nicht heikel in der Wahl ihrer Mittel. Friedrich Ebert, Reichskanzler der neuen Republik und Sozialdemokrat, verkündete, für die Sozialrevolution empfinde er nichts als Abscheu. Doch auch die Soldaten, die ihm in der Krise beistanden, dürfte er kaum geliebt haben. «Der Krieg hatte sie im Griff», schrieb Ernst von Salomon über die ersten Beschützer der jungen Republik, «und ließ sie nie wieder los. Sie waren nie wieder wirklich zu Hause.»
Die Männer, von denen er sprach – er selbst war einer von ihnen – repräsentierten einen Typus, wie er nach jedem großen militärischen Konflikt in Erscheinung tritt. Nach den Kriegen der griechischen Stadtstaaten im fünften Jahrhundert v. Chr. hatten sich solche Männer bei Kap Tenaro auf dem Peloponnes versammelt und eine Gelegenheit gesucht, sich als Söldner zu verdingen. Während des Dreißigjährigen Krieges hatte es in Deutschland von ihnen gewimmelt, und nach dem Sturz Napoleons traf man sie in ganz Europa an; manche verdienten sich ihren Lebensunterhalt, indem sie sich am Unabhängigkeitskrieg der Griechen gegen die Türken beteiligten. Im November und Dezember 1918 nannten sie sich «Frontkämpfer», Männer, die in den Schützengräben eine Lebensweise kennen gelernt hatten, die sie mit Beginn des Friedens nicht einfach abschütteln konnten. General Ludwig Maercker, der Organisator des ersten Freikorps der Weimarer Republik, sprach von einer gewaltigen Bürger- und Bauernmiliz, die sich zur Wiederherstellung der Ordnung um die Fahne geschart habe. Seine Vorstellung orientierte sich an einem vorindustriellen Militärsystem, zu dem sich Handwerker und Bauern zusammenschlossen, um Anarchie und Aufruhr niederzuschlagen. In Wahrheit hatte es ein solches System nie gegeben. In den Freikorps manifestierte sich ein weitaus moderneres Prinzip – der nach 1789 aufgekommene Glaube, ein politischer Akteur sei ein Bürger mit einem Gewehr, in dessen Gebrauch unterwiesen, um sein Vaterland und die Ideologie, auf der es beruhte, zu verteidigen.
Bezeichnenderweise hieß Maerckers Freikorps das «Freiwillige Landesjägerkorps», hatte zwischen Offizieren und Mannschaften eine mittlere Ebene, die so genannten Vertrauensleute, und enthielt in seinen Disziplinarvorschriften die Bestimmung, dass der Führer eines Freikorps niemals eine Strafe verhängen dürfe, die eine Ehrverletzung des Untergebenen bedeuten könnte. Kurzum, das Landesjägerkorps verkörperte die Idee, staatliche Souveränität sei letztlich militärischen Ursprungs, und Bürgerrecht gründe sich auf den Militärdienst; Waffendienst solle freiwillig geleistet und die Gehorsamspflicht des Soldaten vergolten werden durch die Ehre, die ihm als Krieger gebühre. Das war die vollkommene Verwirklichung jener politischen Philosophie, die von den Vätern der Revolution 130Jahre zuvor in Frankreich verkündet worden war.
Maerckers ursprüngliches Freikorps fand überall in der neuen deutsche Republik Nachahmer. Außerdem breiteten sich Freikorps in den Regionen aus, in denen das Deutschtum einen historischen Herrschaftsanspruch geltend machte – in den strittigen Grenzgebieten zwischen Deutschland und dem neu entstandenen Polen, im Baltikum, das seine Unabhängigkeit von Russland gewonnen hatte, und in den deutschsprachigen Resten des Habsburgerreiches. Die Namen, die sich diese Freikorps zulegten – das Wort selbst bezieht sich unmittelbar auf die Volksverbände, die 1813–14 in Preußen gegen Napoleon aufgestellt wurden–, lassen den Geist erkennen, aus dem sie geboren wurden: die Deutsche Schützendivision, das Landesjägerkorps, die Grenzschutzbrigade, die Gardekavallerie-Schützendivision, das Freiwillige Schützenkorps Yorck von Wartenburg. Es gab noch viele andere, und aus manchen gingen Brigaden, Regimenter und Bataillone des Hunderttausend-Mann-Heeres hervor, das Versailles der deutschen Republik schließlich zubilligte. Andere lösten sich offiziell auf, bestanden aber in der Weimarer Republik insgeheim fort als politische Milizen rechtsextremer Parteien. Aus den entsprechenden linken Kräften wurden nach ihrer Niederlage getarnte Rotfronttruppen für den Straßenkampf.
Allerdings war das Phänomen der Freikorps nicht auf Deutschland beschränkt. Überall dort, wo Völker durch Ideologien gespalten waren, etwa in Finnland und Ungarn – von Russland zur Zeit des Bürgerkrieges gar nicht zu reden–, trat es, oft genug hydraköpfig, in Erscheinung. In der Nachkriegswelt herrschte weder Mangel an Schusswaffen noch an entwurzelten, verbitterten Männern und bedenkenlosen Offizieren, die sie zu führen wussten. Doch nirgends nahm das Phänomen eine so entschlossene und zielgerichtete Gestalt an wie in Italien. Hier waren die Gemüter auf der diplomatischen wie der innenpolitischen Ebene auf das Äußerste erhitzt. Das Land hatte von den im Krieg erbrachten Opfern wenig profitiert; der Erwerb Triests, Südtirols und der Dodekanes-Inseln waren kaum eine Entschädigung für die 600000Toten. Die Überlebenden hatten von dem Sieg keinerlei Vorteile, da die Kriegskosten das Land in eine Wirtschaftskrise trieben, von der die traditionellen Parteien, die liberalen wie die religiösen, überfordert waren. Der einzige, der Rettung versprach, war Benito Mussolini, ein typischer Freikorps-Führer, der die Probleme des Landes auf militärische Art lösen wollte. Sein Fascio di Combattimento (Kampfbund) rekrutierte sich aus dem Kreis ehemaliger Soldaten, allen voran einstige arditi (Sturmsoldaten). Ihr Programm, verkündet am Vorabend des «Marschs auf Rom», durch den die Faschisten sich im Oktober 1922 der Regierungsgewalt bemächtigten, sah vor, «dem König und der Armee ein erneuertes Italien zu übergeben».
Die Idee, dass die Armee als Gesellschaftsmodell dienen könne – zentralistisch, hierarchisch und extrem nationalistisch