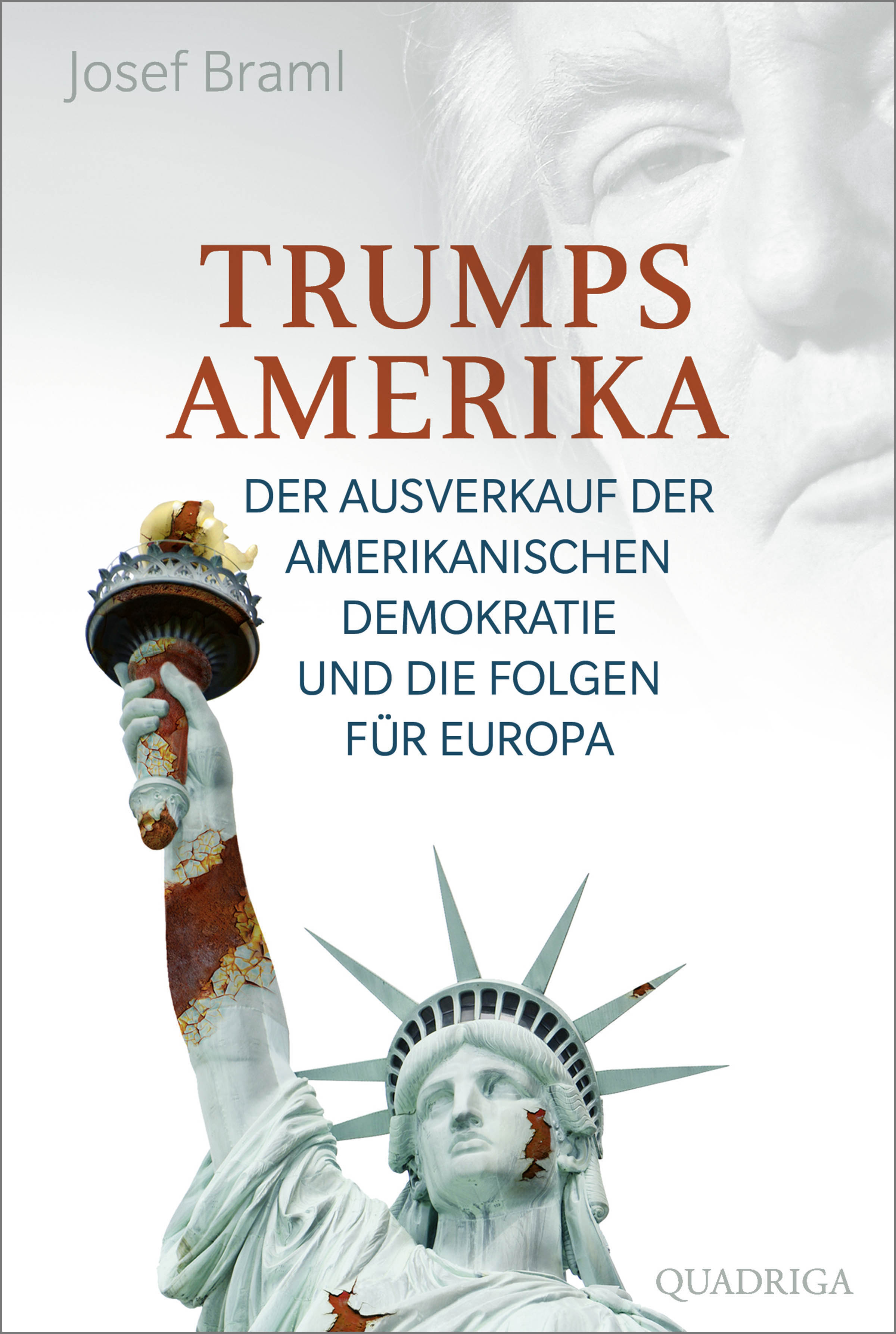9,99 €
Mehr erfahren.
Weltmacht auf Pump - Was passiert, wenn Amerika pleitegeht?
Amerika ist schwer erkrankt: Trotz jüngster Erfolge im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist das Land tief gespalten, die ökonomischen Probleme sind eklatant. Josef Braml liefert mit diesem wichtigen Buch eine Art wirtschafts- und außenpolitisches Frühwarnsystem und erklärt, was das Wanken Amerikas für den Rest der Welt bedeutet und wie sich Deutschland am besten darauf einstellen kann.
Aus den USA ist eine Weltmacht auf Pump geworden. Die schlimmste Rezession seit den 1930er-Jahren, eine beängstigende Staatsverschuldung, die dramatisch gestiegene Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und Armut, der rasante Verfall der Automobilindustrie und des Immobiliensektors, die Gefahr weiterer Spekulationsblasen und die starke Energieabhängigkeit – all das lähmt die Vereinigten Staaten.
Der renommierte USA-Experte Josef Braml analysiert, wie sich diese massiven Probleme auf die amerikanische Politik auswirken werden: etwa in Gestalt eines neuen Protektionismus, verschärfter Ressourcenrivalität mit China, zunehmender Sicherung eigener Interessen sowie einer Abwälzung friedenspolitischer und finanzieller Lasten auf die westlichen Verbündeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Alina
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Während Medien und Analysten mit ihrem Abgesang auf den Euro in Europa Untergangsstimmung verbreiten, rückt die ökonomische Schieflage Amerikas in den Hintergrund. Dort nehmen die wirtschaftlichen Probleme infolge der andauernden Wirtschafts-, Finanz- und Energiekrise ebenso zu und vergrößern die soziale Ungleichheit. Je weiter sich der Tanker USA aber zur Seite neigt, desto mehr wird die politische Manövrierfähigkeit der Regierung im Innern wie nach außen eingeschränkt.
Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme verstärken die von den Gründervätern angelegte Konkurrenz der politischen Gewalten so sehr, dass sie sich allmählich blockieren und die politische Handlungsfähigkeit im Innern wie nach außen lähmen. Zwar erheben die Vereinigten Staaten nach wie vor den Anspruch, eine liberale Weltordnung amerikanischer Prägung aufrechtzuerhalten, doch die wirtschaftliche Schwäche und die Einschränkungen der politischen Führung hindern sie zunehmend daran, so die zentrale These der hier vorgelegten Analyse, ihre globale Ordnungsfunktion wahrzunehmen, indem sie so genannte öffentliche Güter wie Sicherheit, freien Handel und eine stabile Leitwährung bereitstellen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass andere Länder die Vormachtstellung der USA, des liberalen Hegemons, akzeptieren und seiner Führung folgen. Doch Amerika wird in Zukunft mehr Gewicht darauf legen, seine vitalen Eigeninteressen rücksichtsloser durchzusetzen, und versuchen, Lasten abzuwälzen – und damit Konkurrenten, aber auch Verbündete in Asien und Europa massiv belasten.
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat bestehende Grundprobleme der amerikanischen Wirtschaft verstärkt und das Land in dem Moment getroffen, als die ersten Baby Boomer, die »goldene Generation« der zwischen 1946 und 1964 Geborenen, in den Ruhestand traten. Ausgestattet mit den bis dato exorbitant gestiegenen Vermögenswerten, freuten sie sich darauf, einen finanziell sorglosen Lebensabend zu genießen. Aber nun zeigte sich, dass die amerikanische Gesellschaft und Politik nicht auf die Wucht des demographischen Wandels und die damit verbundenen Kosten, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Altersvorsorge, vorbereitet sind. Zwar verjüngt sich die Bevölkerung permanent durch die ins Land strömenden Einwanderer, aber dieser Zustrom kann die Überalterung inzwischen nur noch abschwächen. Die jüngeren Generationen werden künftig nicht mehr in der Lage sein, die älteren finanziell zu unterhalten. Infolge der drastisch gestiegenen Arbeitslosigkeit, die insbesondere jüngere Arbeitssuchende trifft, und der schlechten Ausbildung in den oftmals maroden Bildungseinrichtungen sind die Jüngeren gar nicht in der Lage, im erforderlichen Umfang zum Bruttonationaleinkommen beizutragen und damit überhaupt erst die Voraussetzung für Unterstützungsleistungen zu schaffen.
Freilich gibt es in den USA nach wie vor einige Elite-Universitäten – und damit wichtige technische und wirtschaftliche Innovationsförderer, die auch international in der so genannten Ivy League spielen. Doch deren Vermögen blieben von der Finanzkrise auch nicht verschont; die horrend angestiegenen Studiengebühren können sich – sieht man von den paar Stipendiaten ab – nur noch wenige wohlhabende Studenten leisten. Für die so genannten oberen Zehntausend lohnt sich diese Investition allerdings allemal, denn sie werden – nicht zuletzt aufgrund ihrer in den Elite-Einrichtungen geknüpften Kontakte zu künftigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern – nach dem Studium ein Vielfaches dessen »verdienen«, was ihre mit schlechteren Startchancen versehenen Mitbürger zu erwarten haben. Ihr Einkommen wird auch nicht merklich durch Sozialabgaben oder Steuern geschmälert, mit denen man die verrottende öffentliche Infrastruktur oder die prekäre Lage sozial Schwächerer verbessern könnte.
Es gibt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Risiken einige, die von diesen Problemen überhaupt nicht, und andere, die davon umso mehr betroffen sind. Sieht man sich die Verteilung der Vermögen und Einkommen in den USA genauer an, fallen einem sofort gravierende Unterschiede auf, die sozialen Sprengstoff bergen und geradezu verhindern, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wenn nämlich stimmt, dass die amerikanische Wirtschaft zu zwei Dritteln durch Nachfrage, also vom Privatkonsum, angetrieben wird, dann ist die soziale Schieflage Gift für die wirtschaftliche Erholung. Woher kann die Kaufkraft bei hartnäckig hoher Arbeitslosigkeit kommen, wenn – wie bei der letzten Anhebung der Schuldenobergrenze vereinbart – der Schuldenabbau in erster Linie durch die Kürzung von Sozialleistungen und anderen nachfragewirksamen Ausgaben des Bundes und der Bundesstaaten erfolgen soll? Im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten Ländern ist in den USA die Umverteilung in Form von Arbeitslosengeld und Sozialabgaben recht gering.1 Das hat zur Folge, dass immer mehr Amerikaner immer weniger kaufen können, weil das Konsumieren auf Pump nicht mehr möglich ist.
In dieser misslichen Lage müssen die USA obendrein die in den letzten Jahrzehnten angehäuften Schuldenberge abbauen, um ihre Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Die inländische Sparquote trägt wenig zur Beseitigung des Problems bei, da sie traditionell niedrig ist und viele private Haushalte sogar hoch verschuldet sind. Und so wird der Staat seine Ausgaben umso drastischer senken müssen, je weniger das Ausland fähig oder bereit ist, Amerikas Staatsschulden zu finanzieren.
Das trifft auch die Politik, die keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr hat für weitere Wirtschaftsförderprogramme. Spätestens im Sommer 2011, als die heftigen Auseinandersetzungen um die Anhebung der Schuldenobergrenze Amerika erschütterten, wurde deutlich, dass das politische System blockiert ist. Sollte der Präsident versuchen, die Wirtschaft mit kreditfinanzierten Ausgaben anzukurbeln, wird er am Kongress scheitern, denn dort verhindern die libertären, staatsfeindlichen Repräsentanten der republikanischen Tea-Party-Bewegung die Kreditaufnahme, unterstützt von den fiskalkonservativen Demokraten, den Blue Dogs. Auch in der Handelspolitik sind dem Präsidenten bis auf Weiteres die Hände gebunden. Er wird kein Mandat für Freihandelspolitik erhalten – falls er diesen Machtkampf mit dem Kongress überhaupt wagen sollte.
Bei dieser finanz- und handelspolitischen Blockade bleibt die US-Notenbank die einzige handlungsfähige Institution. Amerika versucht, sich aus der Schuldenfalle zu befreien, indem es durch seine Notenbank jene Staatsanleihen aufkaufen lässt, die über den Markt von ausländischen Investoren nicht mehr bedient werden. Dieses Vorgehen wird beschönigend als »quantitative Lockerung« bezeichnet. In Wahrheit druckt man neues Geld. Die internationale Leitwährung Dollar gerät dadurch unter Druck, wird also abgewertet. Das hat zwei Nebeneffekte, die aus amerikanischer Sicht durchaus willkommen sind: Amerika kann sich einerseits eines Großteils seiner Schulden entledigen, andererseits verbilligen sich seine Exportwaren und sind damit wieder mehr gefragt.
Selbst wenn die Strategie, den Dollar zu schwächen, kurzfristig erfolgreich sein sollte, bleiben die langfristig grundlegenden Strukturprobleme der US-Wirtschaft bestehen. Die USA haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Industrieproduktion dahinsiechen lassen und sich zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt, die sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. In diesem Sektor gab es viele begrüßenswerte Innovationen, leider aber auch einige, die in die Wirtschafts- und Finanzkrise geführt haben. Während man sich in Amerika am Aufschwung im Dienstleistungssektor erfreute, blieben die weniger beweglichen Europäer dem Produktions- und Industriegewerbe verhaftet, was durchaus vernünftig war. Mittlerweile müssen die Verantwortlichen in Amerika einsehen, dass es sich rächt, wenn man die Produktion vernachlässigt.
Amerika muss wieder produzieren. Mit dem Green New Deal will Präsident Obama sowohl Arbeitsplätze schaffen als auch die binnenwirtschaftlichen wie außenpolitischen Kosten und Risiken senken. Dazu wurde der Wirtschaft zunächst eine Ölentzugskur verordnet. Amerikas Ölverbrauch muss drastisch reduziert werden, da die hohen Ölpreise die Wirtschaftskraft Amerikas lähmen und dessen außenpolitische Handlungsfähigkeit einschränken, weil die dafür erforderlichen Mittel nicht mehr aufgebracht werden können. Die weltweite Sicherung der vitalen Interessen Amerikas – dem mit dem aufstrebenden China ein mächtiger Konkurrent erwachsen ist – macht das nicht leichter.
Zwar wird in absehbarer Zeit die Militärmacht, die so genannte harte Macht der USA, unangefochten bleiben, denn kein anderes Land der Welt verfügt über annähernd so viel militärische Schlagkraft wie die Supermacht. Doch diese Ausrüstung ist in den drohenden Währungskriegen wenig hilfreich, ja könnte sogar zu einer schweren Bürde werden. Um den Haushalt zu konsolidieren, müssen die USA also auch umfangreiche Einsparungen im Militärbereich vornehmen. Das wird die amerikanische Wirtschaft, die von diesem Sektor im hohen Maße abhängt, noch mehr schwächen.
Auch die »weiche« Macht2 der USA, seine Vorbildfunktion und Anziehungskraft auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet, ist schwer beeinträchtigt. Vor allem der so genannte Washington-Konsensus, nach dem alle Länder ihre Gesellschaften und Märkte nach dem Vorbild Amerikas liberalisieren sollen, hat als Orientierungsmaßstab weltweit an Bedeutung verloren. Sogar in den USA selbst ist – wie schon so oft in der amerikanischen Geschichte – ein heftiger Streit darüber entbrannt, welche Rolle dem Staat im Verhältnis zur Wirtschaft und zur Einwanderungsgesellschaft beigemessen werden soll.
Das alles wird Amerika im Wahljahr 2012 beschäftigen und die Welt in Atem halten, denn die Handlungsschwäche der einstigen Weltordnungsmacht droht die Welt in Unordnung zu bringen.
Gleichgewichtsstörungen
Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass der mittlerweile in den USA reüssierende jüdisch-russische Schriftsteller Gary Shteyngart, der als Jugendlicher seiner Heimat, dem untergehenden Sowjetimperium, entfloh, seiner Wahlheimat, der Siegermacht USA, ein ähnliches Schicksal prophezeit. Fasziniert vom grenzenlosen Selbstbewusstsein der Amerikaner und bemüht, seine Herkunft wie seinen Akzent zu verbergen, stellt der Einwanderer heute nicht ohne Sarkasmus fest: »Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, aufzuholen. Und jetzt, wo ich aufgeholt habe, geht das Land zum Teufel. Jedes Weltreich, in das ich einen Fuß setze, zerfällt.«1 In seinem Bestseller Super Sad True Love Story erzählt Shteyngart vom sozioökonomischen Zerfall der Weltmacht Amerika, von einem Land, das pleite ist, dessen Leitwährung vom chinesischen Yuán abgelöst wird und dessen europäische Freunde sich abwenden, um die eigene Währung stark zu halten. Damit liegt er erschreckend nahe an der »Realität«, wie sie mittlerweile auch von Politikern und Journalisten in Washington mit kräftigen Pinselstrichen an die Wand gemalt wird.
Man muss kein Politiker, Untergangsapologet oder Kulturpessimist sein, um zu erkennen, dass die bei Shteyngart in der satirischen Fiktion überhöhten »posthumanen Dienstleistungen« – die den real existierenden, außer Kontrolle geratenen Finanzdienstleistern sehr ähneln – letzten Endes auch den Amerikanern mehr geschadet als genutzt haben. Die alarmierenden Wirtschafts- und Sozialstatistiken sprechen Bände. Zwar gibt es in den USA noch keinen Aufstand des Prekariats – die Protagonisten der gegen die soziale Ungleichheit und den Kasinokapitalismus gerichteten Occupy-Wall-Street-Bewegung sind im Vergleich zu den vielen in Armut lebenden Afro-Amerikanern und Latinos besser situierte Jugendliche und Studenten –, aber die sozioökonomischen Konflikte haben das Land bereits tief gespalten und den amerikanischen Traum vom unbegrenzten Wirtschaftswachstum durch Konsum auf Pump zerstört.
Allmählich weicht die amerikanische Überzeugung, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der vorigen, der Furcht,2 dass die Jugendlichen von heute einer »verlorenen Generation« angehören könnten. Im Vergleich zu der mittlerweile ins Rentenalter tretenden »goldenen Generation« der Baby Boomer wird die amerikanische Bevölkerung zukünftig im Durchschnitt merklich älter, außerdem größer, ethnisch heterogener,3 weniger gebildet und finanziell ärmer sein. Das wird sich belastend auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und damit auf den Wohlstand des Landes auswirken.
Regeneration und Wachstum durch Immigration
Seit den 1950er Jahren nimmt der Anteil der Alten in der amerikanischen Gesellschaft zu, während der Anteil der Jungen schrumpft. 2030, wenn die zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby Boomer aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sein werden, wird voraussichtlich einer von fünf Amerikanern im Rentenalter sein.4 Wie in anderen Industrienationen ist auch in Amerika die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten merklich gestiegen, mittlerweile auf knapp achtzig Jahre.5 Auf der anderen Seite sind die jährlichen Geburtenraten seit den 1970er Jahren zu gering, um die Bevölkerungszahl der USA zu halten. Bevölkerungsstatistisch geht man davon aus, dass in Industrieländern der Erhalt der Bevölkerung gesichert ist bei 2,1 Geburten je Frau. Diese Reproduktionsmarke haben die Amerikaner – mit Ausnahme der Jahre 2006 und 2007 – seit 1971 nicht erreicht.6 Dennoch hat sich die amerikanische Bevölkerung seit 1950 von 152 Millionen auf gegenwärtig 309 Millionen verdoppelt.7 Für dieses Bevölkerungswachstum haben seit den 1940er Jahren Millionen Einwanderer aus aller Welt gesorgt (siehe Tabelle 1).8
Tabelle 1.
Einwanderung in die USA, 1931–2009
Quelle: Laura B. Shrestha und Elayne J. Heisler, »The Changing Demographic Profile of the United States«, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington, D.C., 31. März 2011, S. 12.
2009, das letzte Jahr, für das offizielle Daten vorliegen, meldeten über eine Million Menschen erstmals ihren ständigen Wohnsitz in den USA an. Sie kamen hauptsächlich aus Mexiko (14,6 Prozent), China (6,0 Prozent), den Philippinen (5,3 Prozent), Indien (5,1 Prozent), der Dominikanischen Republik (4,4 Prozent), Kuba (3,4 Prozent) und Vietnam (2,6 Prozent). Seit 1971 finden die legalen Einwanderer ihre neue Heimat vornehmlich in Kalifornien, New York, Texas, Florida, Illinois und New Jersey. Daneben gibt es überall im Land illegale Einwanderer; ihre Zahl wird von Forschern des Pew Hispanic Center auf über 11 Millionen geschätzt.9
Mittlerweile übertrifft die »inländische Reproduktion« der Eingewanderten den Zustrom der Einwanderer. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Zuwanderung der größten Gruppe, der aus Mexiko stammenden Latinos, wegen der verschärften Grenzüberwachung und mangelnder Arbeitsperspektiven merklich zurückgeht. Dennoch hat sich die Gruppe der Mexican Americans zwischen 2000 und 2010 um 11,4 Millionen Menschen vergrößert – durch 4,2 Millionen Zuwanderer und 7,2 Millionen Neugeborene. Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung sind Amerikaner mexikanischer Herkunft jünger und fruchtbarer.10 Die Altersstruktur der größten Minderheit – Amerikaner hispanischer Herkunft machen mittlerweile knapp ein Sechstel (16 Prozent) der amerikanischen Bevölkerung aus – ist dementsprechend: Kinder und Jugendliche sind in dieser Gruppe stark vertreten.11 Nach den Untersuchungen des National Research Council ist die hispanische Bevölkerung in den USA aber nicht nur gekennzeichnet durch »eine jugendliche Altersstruktur«, sondern auch durch »niedrige Ausbildungsniveaus« sowie durch eine »unverhältnismäßig hohe Konzentration in Beschäftigungen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen und geringer Bezahlung«.12
Der Alterungsprozess und der Zuzug von Immigranten, die wegen ihrer unzureichenden Sprachkenntnisse und mangelhaften Ausbildung schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, zeigen bereits Wirkung. So verschlechtert sich etwa das Verhältnis der arbeitenden zur unbeschäftigten, unterstützungsbedürftigen Bevölkerung (Kinder, ältere Menschen). Immer weniger und schlechter ausgebildete Arbeitnehmer und Angestellte müssen immer mehr Rentner unterhalten. Neben der Frage der Generationengerechtigkeit wird längst auch die allgemeinere Frage gestellt, ob der Staat Fürsorge leisten sollte oder nicht vielmehr der Einzelne für sich selbst vorsorgen soll – und kann.
Soziale Ungleichheit am Start
Im »Land der Freien« dominiert die kapitalistische Orthodoxie, und deren Verfechter gehen davon aus, dass der Markt dem Staat überlegen sei, weil rational handelnde Individuen selbst am besten wissen, was das Beste für sie ist. Diese den meisten ökonomischen Modellen nach wie vor zugrundeliegende Annahme setzt allerdings voraus, dass diese Individuen lesen, schreiben und rechnen können, also über die Grundvoraussetzungen verfügen, ohne die man das Marktgeschehen nicht begreifen und nicht daran teilnehmen kann. Wer sich die Befunde zum Bildungsniveau jedoch genauer ansieht, muss feststellen, dass es in Amerika viele Analphabeten gibt und selbst in vermeintlich höheren Bildungsschichten erschreckend viele die Grundrechenarten nicht beherrschen und kein wirtschaftliches Basiswissen besitzen.13
Im Februar 2002, also in George W. Bushs erster Amtsperiode, wiesen wirtschaftliche und politische Entscheidungsträger bereits auf dieses Kernproblem einer »auf Wissen basierten Wirtschaftsordnung« hin. So räumte der damalige Notenbankchef Alan Greenspan bei einer Anhörung vor dem Kongress ein, dass eine finanzielle Grundbildung »verletzliche Konsumenten« davor schützen könnte, sich in finanziell ruinöse Kreditkonstruktionen verwickeln zu lassen. 14 Wie groß das Ausmaß der Verletzlichkeit und Verwirrung vieler Einzelner – und damit auch der gesamten US-Wirtschaft – tatsächlich war, sollte sich dann in den Jahren 2007 und 2008 im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise offenbaren. Im Januar 2008 richtete der Präsident dann per Exekutivorder einen Advisory Council on Financial Literacy ein. Im Oktober 2009 haben zwei renommierte akademische Einrichtungen – das Dartmouth College und die Wharton School – gemeinsam mit dem größten amerikanischen Think Tank, der RAND Corporation, das Financial Literacy Center ins Leben gerufen. Diese Einrichtung hat Programme entwickelt, die unzureichend ausgebildete Menschen in die Lage versetzen sollen, qualifizierte Finanzentscheidungen zu treffen.15
Wenn das Bildungsniveau sinkt, sinken auch die Einkommen. Wie Bildung Menschen befähigt aufzusteigen, kann Bildungsmangel ihren Abstieg befördern. Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Elternhäusern – und darunter sind besonders viele Kinder von Einwanderern – haben schlechtere Startchancen und finden seltener einen besser bezahlten Job – wenn sie überhaupt einen finden. Dagegen hilft nur eine effiziente Sozial- und Bildungspolitik, die letztlich zum Wohle aller ist.
Die Erfolgsgeschichten Einzelner, die es vom Tellerwäscher zum Milliardär gebracht haben, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Einwanderungsland USA wie in fast16 allen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die einen hohen Anteil von Immigrantenkindern aufweisen, Menschen mit Migrationshintergrund sozial benachteiligt sind und oft nur mäßige schulische Leistungen vorweisen können.17 Im Berufsleben haben sie dann sehr viel schlechtere Aussichten, ein Einkommen zu erzielen, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das betrifft neben den Latinos auch viele Angehörige der mittlerweile nur noch zweitgrößten Minderheit in den USA, der afro-amerikanischen Bevölkerung. Während jeder dritte »weiße« Amerikaner einen College-Abschluss vorweisen kann, schaffen das nur zwei von zehn Afro-Amerikanern und lediglich jeder zehnte Latino.18 Entsprechend niedrig sind die mittleren Jahreseinkommen: Etwa 32000 Dollar verdienen Afro-Amerikaner und rund 38 000 Dollar Latinos, während ihre weißen Mitbürger im Schnitt 55 000 Dollar pro Jahr beziehen.19
Bei schlechter Wirtschaftslage wird das Ausbildungsniveau geradezu ausschlaggebend bei der Entscheidung, ob jemand überhaupt einer Beschäftigung nachgehen kann: Mittlerweile haben nur noch acht von zehn Akademikern der höchsten Ausbildungsstufe (tertiary education) einen Arbeitsplatz, der Anteil der Beschäftigten bei geringerer Ausbildungszeit (upper secondary education) liegt lediglich noch bei zwei Dritteln, und von den Amerikanern mit dürftiger Ausbildung (below upper secondary education) ist sogar die Hälfte arbeitslos. 20 Angehörige der schlechter ausgebildeten Minderheitengruppen der Afro-Amerikaner und der Latinos sind grundsätzlich öfter arbeitslos als Weiße. Die Arbeitslosenquote bei Weißen liegt bei 8 Prozent, die der Afro-Amerikaner ist doppelt so hoch, nämlich 16 Prozent, und selbst bei den Latinos übertrifft die Quote mit über 11 Prozent deutlich den nationalen Durchschnitt von 9 Prozent.21 Das sind wohlgemerkt nur die offiziellen Zahlen. Nicht eingerechnet ist die etwa ebenso große Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die die Arbeitssuche bereits aufgegeben haben und in keiner Statistik mehr erfasst werden.
In einer Gesellschaft, die über ein schwaches soziales Auffangnetz verfügt, bedeutet Arbeitslosigkeit sehr schnell Armut. Amerika ist im letzten Jahrzehnt sehr viel ärmer geworden. Das Durchschnittseinkommen eines amerikanischen Haushalts hat sich insbesondere während der Amtszeit von George W. Bush merklich verringert. Dieser Trend wird erst recht deutlich, wenn man die Inflation berücksichtigt und die Kaufkraftwerte verschiedener Jahre vergleicht. Die Kaufkraft sank seit 2000 von 72 339 auf 67 530 Dollar ein Jahrzehnt später.22 Wirft man einen Blick hinter die Kulisse rechnerischer Durchschnittswerte, dann wird das Problem noch gravierender: Aufgrund der enormen Einkommensunterschiede gibt es nur ganz wenige »Durchschnittsamerikaner«. Eine kleine Elite erhält überproportional viel vom Einkommenskuchen, während sich sehr viele mit sehr wenig zufriedengeben müssen. Der Gini-Index, ein statistisches Maß, das die ungleiche Verteilung innerhalb einer Gesellschaft misst,23 zeigt, dass die Ungleichheit der Einkommen in den USA seit den 1970er Jahren beständig zunimmt.24 Unter den OECD-Staaten weisen heute nur noch Chile, Mexiko und die Türkei schlechtere Werte auf.25
Bei den Vermögen ist die Ungleichheit noch ausgeprägter. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die ohnehin schon große Kluft noch vertieft. Die Vermögenswerte weißer Amerikaner sind jetzt achtzehn- beziehungsweise zwanzigmal so hoch wie die der afro-amerikanischen oder hispanischen Bevölkerung.26 Ein typischer afro-amerikanischer Haushalt verfügte 2009, nach dem Platzen der Immobilienblase, nur noch über 5677 Dollar, ein hispanischer über 6325 Dollar; ein weißer Haushalt dagegen kam auf 113149 Dollar Vermögen in Form von Bargeld, Bankguthaben, Autos, Haus- und Grundbesitz, Aktien, Anleihen oder Rentenansprüchen. Das sind die größten Unterschiede seit 25 Jahren – seitdem diese Daten überhaupt erhoben werden. Auch hier offenbart ein Blick hinter die statistischen Mittelwerte noch trostlosere Verhältnisse: Jeweils ein Drittel der afro-amerikanischen und hispanischen sowie 15 Prozent der weißen Bevölkerung hat überhaupt kein Vermögen, sondern Schulden.
46 Millionen Amerikaner leben inzwischen in Armut.27 Das ist der höchste Wert, den diese seit 52 Jahren erhobene Statistik jemals ausgewiesen hat. Die Armut bei Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) ist geradezu alarmierend: Jeder fünfte Heranwachsende fällt in dem angeblich reichsten Land der Welt unter die Armutsgrenze. Besonders prekär ist die soziale Lage der Minderheiten: Die Armutsrate von Amerikanern afro-amerikanischer und hispanischer Herkunft ist fast dreimal so hoch (jeweils 27 Prozent) wie die der weißen Bevölkerung (10 Prozent). Die Zahl der Latinos und Latinas, die unter der Armut besonders schwer zu leiden haben – darunter alleine über sechs Millionen Kinder –, steigt rapide. In einem Drittel der hispanischen Haushalte gibt es nicht mehr genügend zu essen – sie sind von food insecurity (Nahrungsmittel-Versorgungsunsicherheit) betroffen, wie es im sozialstatistischen Kauderwelsch vernebelnd heißt.28 Einer von sechs Amerikanern, das sind insgesamt knapp 50 Millionen Menschen, kann sich auch keine Krankenversicherung mehr leisten.29 Die meisten dieser Amerikaner gehören den beiden großen Minderheiten an: Jeder fünfte Afro-Amerikaner und gar jeder dritte Latino genießt keinen Krankenversicherungsschutz.
Sollte Barack Obamas nach wie vor heftig umstrittene Gesundheitsreform vom März 2010, mit der künftig diese sozialen Missstände abgemildert werden können, auf juristischem Weg vom Obersten Gericht oder politisch von einem seiner möglichen Nachfolger im Präsidentenamt zurückgenommen werden, würde das Elend noch zunehmen. Wenn Millionen von Amerikanern künftig keine Arbeitslosenbezüge mehr erhalten, werden weitere drei Millionen Menschen unter die Armutsgrenze fallen. Noch werden 26 Millionen Kinder von der staatlichen Krankenfürsorge (Medicaid) aufgefangen. »Mehr Menschen denn je bestreiten gar ihren Lebensunterhalt mit Hilfe von Medicaid«, gab Ron Pollak, Direktor der Organisation Families USA, jenen Politikern in Washington zu bedenken, die diese Hilfen kürzen wollen.30 Und der in Wirtschaftsfragen eher marktliberal gesinnte Economist fügte diesen »schockierenden Daten« aus Amerika noch eine weitere Statistik hinzu: Ohne die staatliche Rentenfürsorge würden noch fünfmal mehr ältere Menschen verarmen als ohnehin schon.31
Welche Wirkung wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen entfalten können, haben die 1990er Jahre gezeigt. Zwischen 1990 und 2000, in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs, verbesserte sich die soziale Lage insbesondere der Minderheiten zusehends. In der prosperierenden Clinton-Ära herrschte allgemein die Auffassung, dass jeder, der arbeiten will, auch Arbeit findet. Angesichts dieser Verhältnisse verkündete der Präsident 1996, dass die mit dem New Deal der 1930er Jahre begründete Epoche des Staatsinterventionismus endgültig vorbei sei: The era of Big Government is over.32 Unter dem Slogan Ending welfare as we know it wurde unter Bill Clinton die staatliche Fürsorge beschnitten.33
Nach den zwei Amtsperioden seines republikanischen Nachfolgers George W. Bush sah sich Amerika jedoch wieder mit massiven sozioökonomischen Problemen konfrontiert. Im Zuge der größten Wirtschafts- und Finanzkrise seit den 1930er Jahren nahm die in Amerika ohnehin nicht große Wertschätzung staatlicher Eingriffe durch Wirtschafts- und Finanzpolitik noch deutlich ab. Doch mit dem Auftritt des Präsidentschaftskandidaten Barack Obama wurden in der politischen Auseinandersetzung plötzlich neue Töne laut.
Der Demokrat Obama wurde in erster Linie von den afro-amerikanischen und hispanischen Minderheiten gewählt in der Hoffnung, dass er ihre prekäre wirtschaftliche Situation verbessern werde. Wie Bill Clinton 1992 konnte Barack Obama 2008 die angespannte Wirtschaftslage bei den Präsidentschaftswahlen zu seinem Vorteil nutzen.34 Obama sensibilisierte die mittlere Einkommensschicht für wirtschaftspolitische Themen, und nicht zuletzt mobilisierte er afroamerikanische und hispanische Wähler35 für seine wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele. Bei der afro-amerikanischen Bevölkerung erhielt er 95 Prozent der Stimmen,36 und auch bei den Latinos konnte er den Wähleranteil der Demokraten deutlich erhöhen. Dass er mehr als zwei Drittel der Stimmen hispanischer Wähler gewann, hat in vielen hart umkämpften Bundesstaaten wie Florida, New Mexico und Colorado den Ausschlag gegeben.37
Obamas Erfolgsrezept war einfach: Seinen Wahlkämpfern gelang es, den auf sexualmoralische Themen fixierten »religiösen Rechten« und Republikanern moral issues entgegenzuhalten, die seinen Wählern mehr am Herzen lagen.38 So haben die Basisbewegungen der »religiösen Linken« (im Sinne der katholischen Soziallehre) unter anderem Armutsbekämpfung, Bildung, Krankenversicherung und Alterssicherung als moralische Themen definiert. Mit dem Amt hat Präsident Obama dann gewissermaßen die Pflicht übernommen, seine auf diesen Feldern gegebenen wirtschafts- und sozialpolitischen Versprechen einzulösen. Er musste seinen Worten also Taten folgen lassen.
Alles reine Kopfsache: die Ohnmacht der Politik
Ideologische Gegensätze, der Einfluss von Interessengruppen und ein blockadeanfälliges politisches System schränken den Handlungsspielraum der Politik – und damit vor allem des amerikanischen Präsidenten – erheblich ein und erschweren das Vorhaben, die notwendigen Weichen für die Zukunft zu stellen. In der derzeitigen Machtkonstellation sind Präsident und Kongress kaum in der Lage, wenigstens die akuten Probleme zu lösen. Im Gegenteil: Die wirtschaftliche Schwäche vertieft die ideologischen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern. Das verstärkt die Dysfunktionalität des Regierungssystems. Seit dem politischen Debakel bei der Anhebung der Schuldenobergrenze im Sommer 2011 wird zudem die Kreditwürdigkeit der USA von den internationalen Märkten und Ratingagenturen in Frage gestellt – Standard and Poor’s (S&P) stufte diese auf AA+ herab.
Wie sehr das Grundvertrauen der amerikanischen Bevölkerung in ihre Regierung inzwischen erschüttert ist, offenbart eine repräsentative Umfrage der Washington Post,1 wonach acht von zehn Befragten unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie das politische System funktioniert beziehungsweise nicht mehr funktioniert: Sieben von zehn Amerikanern stimmen der Begründung der Ratingagentur S&P zu, dass ihr Regierungssystem »weniger stabil, ineffektiver und weniger berechenbar« geworden sei. Genauso viele potenzielle Wählerinnen und Wähler haben wenig oder keine Hoffnung, dass die Regierung in Washington die wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen kann.
In dieser politischen Legitimationskrise und unter den bis auf Weiteres bestehenden fiskal- und handelspolitischen Beschränkungen ist die US-Notenbank die einzige noch handlungsfähige Institution, und sie versucht nach Kräften das Land aus der Wirtschaftskrise herauszuführen. Ginge es nach den Vorstellungen staatsfeindlicher libertärer Köpfe wie den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ron Paul, dann müsste jedoch die Federal Reserve abgeschafft werden.
Staat versus Markt – eine ideologische Auseinandersetzung
Welche Rolle dem Staat zukommt, wie viel Verantwortung der Einzelne hat und welche Freiräume der Wirtschaft – die nach der Theorie von rational handelnden Individuen bestimmt wird – zugestanden werden sollten, war in Amerika schon immer umstritten. So suchten bereits die Gründerväter der Nation die Fesseln staatlicher Gängelung, wie sie im alten Europa üblich waren, abzuschütteln. In der Neuen Welt sollte eine Ordnung errichtet werden für eine Gesellschaft freier Menschen. Diese Freiheit wird in den USA bis heute ins Feld geführt, wenn es darum geht, den ungeregelten Waffenbesitz zu rechtfertigen, die Trennung von Kirche und Staat zu erklären oder Besitz und Eigentum gegen den Zugriff des Fiskus zu verteidigen. Auf der anderen Seite werden der amerikanische Bürgerkrieg, die Emanzipation der schwarzen Bevölkerung und der Krieg gegen die Armut in Stellung gebracht, wenn staatliche Interventionen gefordert oder verteidigt werden. In dieser Auseinandersetzung hat sich die Waagschale im Laufe der Zeit mal der einen, mal der anderen Seite zugeneigt.
In seiner Analyse des amerikanischen »Marktplatzes der Ideen« hat der Historiker James Allen Smith grundlegende Veränderungen in der Diskursstruktur ausgemacht.2 Mitte des 19. Jahrhunderts, als in den USA höhere Schulen und Sozialwissenschaften noch nicht etabliert und die philanthropischen Aktivitäten noch gering waren, blieben die moralischen und intellektuellen Rechtfertigungen des Laissez-faire mehr oder weniger unangefochten. Doch im Zuge der industriellen Revolution wurde nicht nur die neue industrielle Technik von Europa übernommen, sondern auch intellektuelles Gedankengut: Mit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft stellte sich angesichts gesellschaftlicher Missstände auch die »soziale Frage«. Als europäische Soziologen die Macht der Fakten entdeckten, das Ausmaß des Problems bestimmten und damit ins öffentliche Bewusstsein rückten, führte an der Beantwortung dieser Frage kein Weg mehr vorbei. Erste Lösungsansätze wie die Bismarcksche Sozialgesetzgebung inspirierten Vordenker in Amerika, die aus Europa stammten oder dort ausgebildet worden waren. Damit gab die »Sozialpolitik« den Anstoß für die Herausbildung der Zunft der Sozialforscher und Sozialreformer in der Neuen Welt.
Beflügelt von der Überzeugung, mit empirischen Methoden ideologische Differenzen und Meinungsverschiedenheiten überwinden und konkrete Reformvorschläge entwickeln zu können, riefen progressive Pragmatiker Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Generation von praxisrelevanten Forschungsinstituten ins Leben. Die Russell Sage Foundation, der Twentieth Century Fund und das Institute for Government Research als Vorläufer der Brookings Institution gelten als Prototypen einer Bewegung, der es darum ging, über »objektives Faktenwissen« zum Fortschritt einer »intelligenten Demokratie« beizutragen. Diese Ideen inspirierten dann später Hoovers Technokraten, Roosevelts Brain Trusts, Trumans Cold War Liberals, Eisenhowers Modern Republicans, Kennedys New Frontiersmen und die »Architekten« der Great Society in der Johnson-Ära.
Als in den 1960er und 1970er Jahren der Vietnam-Krieg, Rassenunruhen und das ökonomische Phänomen der Stagflation – eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und Inflation, die bis dato für unmöglich gehalten worden war – das Land erschütterten, sah man sich allerdings jäh wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.3 Nun zeigte sich, dass die neuen Ideen auch unrealistische Erwartungen genährt hatten: »Zu viel wurde zu schnell versprochen, und es gab zu wenig Verständnis für schwer zu handhabende soziale Probleme. Wissenschaft und Vernunft schienen ins Wanken zu geraten, und auch unsere Tradition des pragmatischen Diskurses wurde in Frage gestellt. Sie wurde von Parteigängern am linken und rechten Rand des politischen Spektrums herausgefordert.«4
In der Folgezeit fanden die Stimmen der vom totalitären Staat des Naziregimes traumatisierten Wirtschaftswissenschaftler mehr Gehör. Diese warnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor dem »Weg in die Knechtschaft« und erhoben den Individualismus zur Grundidee wirtschaftlicher Ordnungsvorstellungen.5 Der Chicagoer Schule der Marktliberalen und den Monetaristen um Milton Friedman6 gelang es schließlich, den bislang vorherrschenden Keynesianismus, der einen starken Staat und damit auch eine prominente Rolle für technokratische Experten vorsah, zu verdrängen und ein neues wirtschaftsliberales Paradigma zu etablieren. Staatliches Handeln sollte nunmehr im Sinne des marktliberalen Vordenkers Adam Smith durch die »unsichtbare Hand« des Marktes ersetzt werden.
Beim Aufbau von »Gegeninstitutionen«, die von der Wirtschaft und von privaten Stiftungen finanziert wurden, tat sich eine Gruppe zum rechten Glauben bekehrter Linksintellektueller hervor. Die ehemaligen Verfechter kommunistischer Ideen, die, wie Irving Kristol nicht ohne Selbstironie erklärte, von der Realität »hinterrücks überfallen« (mugged by reality), die politischen Fronten wechselten, wurden von ihren einstigen Weggefährten als Neokonservative geschmäht. Doch die neue geistige Bewegung war nicht ohne Einfluss, denn sie verfügte mit Kristol, Nathan Glazer und Daniel Bell über prominente intellektuelle Fürsprecher und mit der 1965 etablierten Zeitschrift Public Interest über ein gewichtiges Sprachrohr.
In den 1970er Jahren betraten schließlich die christlichen Fundamentalisten die politische Arena. Ohnehin schon aufgeschreckt durch die gesellschaftliche Liberalisierung, sahen sie sich zum Handeln aufgefordert durch staatliche Eingriffe in ihre bislang politisch unberührte, abgeschiedene Lebenswelt, und zwar durch Urteile des Supreme Court im Abtreibungsfall Roe versus Wade 1973 und 1978 hinsichtlich der Steuerbegünstigung christlicher Schulen. Anders als in der Sexualmoral stimmen die Vorstellungen der rechten Christen bei wirtschaftspolitischen Themen durchaus mit dem konservativen Denken der Republikaner überein. Sie sind sich einig in der Zielsetzung, den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft zu reduzieren. Doch während wirtschaftslibertär überzeugte Republikaner an die unsichtbare Hand des Marktes glauben, sind für überzeugte Evangelikale persönliche Verfehlungen und unmoralisches Handeln die Ursache für wirtschaftliches Versagen: »Schwarze sind meist selbst verantwortlich für ihre Lage«, meinen zum Beispiel rund zwei Drittel der engagierten Evangelikalen.7 Staatliche Sozialleistungen und Wohlfahrt haben in diesem Denken keinen Platz. Das deckt sich mit den Forderungen der Republikaner.
Defunding the government, lautet ihr Slogan, und das bedeutet, dem Staat keine Mittel zur Verfügung zu stellen, es sei denn, die Finanzierung betrifft militärische oder sicherheitspolitische Belange. »Weniger Sozialstaat« und »weniger Steuern« sind Glaubenssätze konservativen Wirtschaftsdenkens in den Vereinigten Staaten. Wirtschaftssubjekte gelten als Individuen in freier Verantwortung. Staatliche Interventionen durch Wirtschafts- oder gar Sozialpolitik sind demzufolge überflüssig, ja kontraproduktiv.
Dieses staatsfeindliche Gedankengut wurde gemäß dem Slogan »Ideen haben Konsequenzen«8 über Think Tanks in praktische Politik übersetzt. Dabei zeigte sich, dass es nicht nur eine Gegenbewegung zur positivistisch-pragmatischen Weltanschauung darstellte, sondern auch den ideengeschichtlichen Nährboden und das geistige Klima schuf, in dem konservative Organisationen – vor allem Think Tanks, private Stiftungen und Basisbewegungen – prächtig gedeihen und wuchern konnten.9 Vom durchschlagenden Erfolg der politischen Rechten wachgerüttelt, ist man seither auch auf Seiten der Linken bemüht, eine »intellektuelle Gegenmacht« in Stellung zu bringen, so William Marshall, Mitbegründer der New-Democrat -Bewegung und Präsident des 1989 gegründeten Progressive Policy Institute (PPI), eines den Demokraten nahe stehenden Think Tanks.10 PPI hatte großen Einfluss auf das Wahl- wie auch auf das Regierungsprogramm Bill Clintons.
Die traditionellen Vertreter zentristisch orientierter, das heißt politisch nicht festgelegter akademischer Think Tanks wie die renommierte Brookings Institution sehen sich zunehmend mit ideologischen Organisationen konfrontiert, die im »Krieg der Ideen« spezifische, festgelegte politische Interessen vertreten. Die Heritage Foundation, sicherlich das prominenteste Beispiel für eine ideologisch geprägte Institution, träumte in den 1990er Jahren gar davon, als Avantgarde der »Konservativen Revolution« in die Weltgeschichte einzugehen.
Ganz ohne Frage hat die konservative Bewegung durch Think Tanks