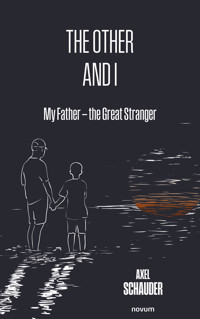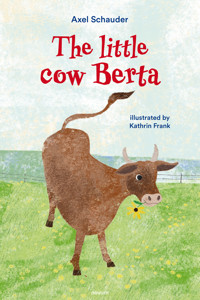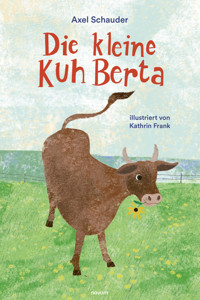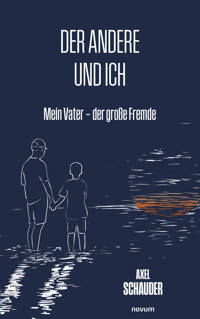
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Axel Schauder, Autor und gleichzeitig Ich-Erzähler dieses ganz besonderen, biografischen Romans, auf sein Leben und das seiner Familie zurückblickt, gibt es viel zu erzählen: Nicht nur das problematische Verhältnis zu seinem Vater, sondern unter anderem auch die Flucht aus der DDR sowie verschiedene Jugenderlebnisse mit Frauen, prägten ihn. Teilweise tiefe, ehrliche und bewegende Einblicke erhält die Leserschaft, indem sie eine Vielzahl an Personen kennenlernt, die im Leben des Ich-Erzählers eine wichtige Rolle gespielt haben. Dabei wird die Erzählung immer wieder auf den Ausgangspunkt, nämlich die Beziehung zu ihm, seinem Vater, zurückgeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0131-5
ISBN e-book: 978-3-7116-0132-2
Lektorat: Vivika-R. Andige
Umschlagabbildung: Semmki91 | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Namensverzeichnis
Verzeichnis der wichtigsten Namen, die in der Geschichte vorkommen:
Ada:
Schwester des Icherzählers und Autors und Tochter von Strickchen aus deren erster Ehe
Albert:
Freiherr von Hoyningen Huene, zweiter Ehemann von Dora
Axel:
Sohn von Albert aus dessen erster Ehe, und damit später Stiefbruder von Strickchen
Axel Schauder:
Der Autor und Icherzähler, Sohn von Strickchen aus deren erster Ehe
Bernd von Hoyningen Huene:
Neffe von Albert von Hoyningen Huene, der in Westberlin lebte
Bobby Scholz:
Besitzer einer Strandvilla und Pension in Heringsdorf an der Ostsee
Charles:
Ex-Freund von Marion, den sie in Paris kennengelernt hatte und der Juttas Vater war
Dora:
Mutter von Strickchen, geborene Kürsten, verwitwete Freifrau von Bistram (aus dieser ersten Ehe ging Strickchen als einziges Kind hervor), in zweiter Ehe verheiratet mit Albert Freiherr von Hoyningen Huene
Elfriede:
Mutter von ihm, dem Vater des Icherzählers
Er:
Vater des Icherzählers und Autors, der mit bürgerlichem Namen Horstdietrich Konrad Schauder hieß
Erich:
Nennonkel des Icherzählers, der mit Elfriede und Herbert in einer Dreierbeziehung lebte
Ernstl Langner:
Sehr wohlhabender Kunsthändler aus Dresden
Frank Thoma:
Kurzzeitiger Arbeitskollege des Icherzählers und ehemaliger Lebensgefährte von Marion
Fräulein Mia:
Angestellte von Bobby Scholz, mit der er, der Vater des Icherzählers, ein flüchtiges Liebesverhältnis hatte
Fred Raumann:
Lkw-Fahrer und kurzzeitiger Arbeitskollege des Icherzählers
Hanna:
Strickchens Studienfreundin aus der Berliner Zeit
Henriette Sparmann:
Ehefrau von Juwelier Hans Christian Sparmann aus Dresden und eine der Geliebten des Vaters des Icherzählers
Herbert:
Vater von ihm, dem Vater des Icherzählers
Ina:
Tochter des Fuhrunternehmers, bei dem der Icherzähler kurzzeitig beschäftigt war
John:
Neuer Freund der Tochter von Mr. Walker
Jörg:
Strickchens zweiter Ehemann, der ursprünglich Georg Sackenheim hieß und mit der Heirat Strickchens Familienamen annahm, sich fortan also Georg Freiherr von Bistram nannte
Jutta:
Tochter von Marion, die mit ihrer Mutter bis zu deren Lebensende nichts mehr zu tun haben wollte
Lena:
Verlobte des Icherzählers, die sich später in ihren Chef, einen Arzt aus München, verliebte
Margot Wehn:
Patentante von Strickchen aus Dresden
Martin Schuhrag:
Sehr wohlhabender Webereifabrikant aus einer Kleinstadt nahe Dresden
Marion:
Ehemalige Lebensgefährtin von Frank Thoma, mit der sich ein kurzzeitiges Liebesverhältnis zum Icherzähler entwickelte, und die später an Krebs verstarb
Mill:
Weiterer Hotelgast in Salzburg, der sich von seinen Freunden „Mill“ nennen ließ, in Wirklichkeit aber Milleman hieß
Mr. Walker:
Ein Hotelgast, der sich, aus London kommend, mit seiner Frau und Tochter in Salzburg aufhielt
Otto Rosenmann:
Hannas späterer Ehemann und Holzfabrikant in Oberbayern
Peter Wehn:
Margots Ehemann und sehr wohlhabender Textilhändler aus Dresden
Raboschowsky:
Prokurist bei Otto Rosenmann, der mit Hanna ein Liebesverhältnis einging und nach Hamburg zog
Rose von Hoyningen Huene:
Ehefrau von Bernd von Hoyningen Huene
Samier:
Ein Studienkollege des Icherzählers, mit dem er zusammen eine Reise nach Salzburg unternahm
Strickchen:
Mutter des Icherzählers und Autors, die nach ihrer Scheidung ihren Mädchennamen wieder angenommen hatte, und von da an mit bürgerlichem Namen Irmgard Gabriele Freifrau von Bistram hieß. Sie legte sich später den Künstlernamen „Nina“ zu
Winkler:
Wurde von seinen Freunden „Sepp“ genannt und war Verwalter des landwirtschaftlichen Betriebes, der dem Arzt aus München gehörte, in den sich Lena später verliebt hatte
Vorwort
Ich gehe vom Haus meiner Großeltern, das in einem Dorf in der Nähe von Dresden steht, über die Straße. Auf der anderen Seite angekommen, überquere ich eine kleine, schmale, alte, rostige Eisenbrücke mit Geländer und Holzbohlen, die über einen Mühlgraben hinweg auf einen Wiesenhang führt. Dort lege ich mich hin. Erst langsam setzt sich mein kleiner magerer Kinderkörper, noch nicht ganz vier Jahre alt, in Bewegung, kullert seitlich den Hang abwärts, schneller werdend, immer schneller und schneller und dann noch schneller, schließlich wieder langsamer, und nun ist die ganze Freude schon vorbei. Jetzt liege ich auf der Wiese im hohen Gras, ganz still, die Beine und Arme ausgebreitet, den Blick in Richtung Himmel, wo die weißen Wolken vom Wind getrieben werden, sich immer neue Fantasiefiguren bilden, die bald wieder vergehen, neuen Formen Platz machen, die sich wiederum auflösen, in der Kinderfantasie aber hängen bleiben, um dort zu Geschichten zu werden; wie Figuren, die sich aneinanderreihen, eben immer Geschichten werden.
Neben mir ein alter Apfelbaum, schon etwas windschief, seine zahlreichen Früchte sind noch nicht ganz reif, aber es dauert nicht mehr lange; es sind Augustäpfel und wir haben Juli, genauer, Juli 1948. Es werden kleine rotgestreifte Äpfel sein, mit einem Duft, der mir mein ganzes Leben lang unvergessen bleiben wird. Intensive Düfte, die man in der Kindheit einmal eingeatmet hat und die in Verbindung mit prägenden Erlebnissen stehen, wird man nie wieder los. Sie werden dich, wo immer sie dir später begegnen, in allen Lebenslagen an eben diese prägenden Begebenheiten erinnern. Noch jetzt, nach über siebzig Jahren – das Kullerspiel habe ich damals oft gemacht und der alte Apfelbaum steht immer noch – erscheinen mir jene Wolkenbilder, wenn ich diese Äpfel esse.
Damals lag ich manchmal lange so im Gras, anfangs etwas schwindelig, nach und nach Kinderträume zulassend – nicht nur fröhliche. Gedanken, auch an meine Mutter, die ich in dieser Zeit selten sah. Sie war meistens unterwegs, zum Beispiel, um im Tauschhandel mit Bauern irgendetwas Essbares zu ergattern, denn Geld hatten wir nicht, oder um mit anderen Frauen abgeerntete Felder zu „stoppeln“. Dann kam sie manchmal am Abend mit einer kleinen Tüte Getreideähren nach Hause, nach vielleicht zehn oder fünfzehn Stunden Abwesenheit.
Was ihr, der damals jungen und wunderbaren Frau in dieser Nachkriegszeit unterwegs von russischen Soldaten angetan wurde, und wie sie dennoch die kleine Tüte mit Getreideähren oder mit vielleicht zehn Kartoffeln oder fünf Möhren oder drei Eiern mit nach Hause bekommen hat, das haben wir nie erfahren. Darüber schwieg sie ein Leben lang. Doch manchmal sah ich sie, den versteinerten Blick ins Leere gerichtet, Tränen auf ihren Wangen, da hatte ich fast Angst vor ihr. Meine Großmutter vermochte bei ihr diese „Starre“ zu lösen, indem sie sie einfach wortlos in den Arm nahm, bis es aufhörte. Vorübergehend. Wirklich hat es nie aufgehört – bis zu ihrem Lebensende nicht.
Oder Gedanken an meinen Vater, den ich damals noch gar nicht kannte, nur aus Erzählungen, da er immer noch in russischer Kriegsgefangenschaft war. Wie er wohl aussah? Ob und wann er zurückkommen würde? Ob er mich in den Arm nehmen würde, wie das die Väter anderer Kinder im Dorf taten?
Ich hatte in der damaligen Zeit einen anderen, mich prägenden Menschen: meinen Großvater. Nie in meinem späteren Leben ist mir eine Person begegnet, die so viel Güte ausgestrahlt hat wie dieser Großvater und ganz besonders mir gegenüber. Kein lautes Wort, kein Geschimpfe, nichts, was mich je hätte verletzen können.
1952 – ich war gut 7 Jahre alt – ist er gestorben und man hat mir „aus Rücksicht gegenüber dem Kinde“ verboten, an seiner Beerdigung und Trauerfeier teilzunehmen. Ich habe diese gut gemeinte, aber für mich fatale Entscheidung meiner Eltern bis heute nicht verwunden.
1993, also 41 Jahre später – alles DDR-Unwesen war überstanden – da habe ich zusammen mit meiner Frau das alte Haus meines Großvaters zurückgekauft. Es war eine nahezu unbewohnbare Ruine. Das Grundstück war zur Müllhalde verkommen. Aber es ist mein Geburtshaus, und viel wichtiger, es ist das Haus meines Großvaters. Den Mühlgraben mit der Brücke gibt es nicht mehr und aus der Obstwiese ist bewaldetes Unland geworden.
Der Wiederaufbau hat zwei Jahre gedauert und anstelle der ehemaligen Waschküche steht jetzt ein zweites kleines Häuschen, in dem wir dann und wann Ferien machen.
Dort ist mir dann der Großvater – nach inzwischen sieben Jahrzehnten – wieder nahe. Wie er mit mir im Garten spielte, dem Garten übrigens, den wir zum Entsetzen aller „Fachleute“ wieder so angelegt haben, wie er ihn einst hinterlassen hat. Oder wie ich auf dem Gepäckträger seines alten Fahrrades sitzend, mit ihm ins Dorf fahren durfte:
„Mach immer die Beine ganz breit, damit sie nicht in die Speichen kommen!“
Oder wie ich mit ihm spazieren gehen durfte, er mit Gehstock, ich an seiner Hand, mit Tirolerhut auf dem Lockenkopf.
Und der Apfelbaum?
Irgendwann haben wir uns entschlossen, wieder eine Obstwiese anzulegen, so wie sie damals war. Alle Waldbäume mussten gefällt werden und die kleine ehemalige Wiese trat allmählich wieder zutage.
Und wer stand da ganz am Rande auch noch? Eine Baumruine, nur noch bestehend aus mächtiger Rinde, schiefer noch als damals schon, von außen bemoost, von innen hohl – der Apfelbaum! Große, tote Äste rings herum, aber die Krone ganz oben noch mit Leben erfüllt und – man glaubt es kaum – sogar einige kleine rotgestreifte Äpfel tragend. Und der Duft erinnert an die weißen Wolkenberge meiner Kindheit.
Lange kann er wohl nicht mehr stehen, aber an seiner Seite, ganz unten, wächst aus der Wurzel ein Wildtrieb, wird das ein neuer Apfelbaum?
Ein Fachmann hat diesen Wildtrieb inzwischen mit Reisern des alten Baumes veredelt, damit die Sorte und der Duft auch dann erhalten bleiben, wenn der alte Baum eines Tages in sich zusammengefallen ist.
Und?
Einige Reiser des alten Baumes habe ich im Jahr 2012 mit nach Hause, nach Nordfriesland, genommen. Gärtner Boysen hat ein kräftiges junges Bäumchen damit veredelt, was auch geglückt ist.
Der Apfelbaum lebt also weiter, der alte wohl nicht mehr lange. Und der Duft, der die Kindheitsträume beflügelt hat, bleibt erhalten. Er kann jetzt andere Kinderherzen erfreuen, denn die weißen Wolken ziehen immer noch, regen immer noch zum Träumen an, bilden immer noch Figuren, die ebenso schnell vergehen, wie sie entstanden sind, und aus denen Geschichten werden, auch wenn sich die Zeiten geändert haben und damit auch der Inhalt der Geschichten.
I. Teil
1. Kapitel:
Heimgekehrt
Er kam die Treppe herauf, die in das Dachgeschoss führte. Dort befand sich das Kinderzimmer, das ich mit meiner Schwester teilte, die vier Jahre älter war als ich. Ein kleines Zimmer, der Fußboden mit einem Strohteppich belegt, zwei hintereinanderstehende Kinderbetten, darüber auf der schrägen Zimmerdecke Märchenfiguren, die meine Mutter gemalt hatte. Zum Garten hin zwei nebeneinanderliegende Rundbogenfenster, durch die ich von meinem Bett aus nachts manchmal den Mond sehen konnte; Vorhänge gab es nicht, auch keine Heizung. Wir bekamen Ziegelsteine ins Bett gelegt, die vorher am Wohnzimmerofen aufgeheizt wurden und mit einer Sofadecke umhüllt waren, damit man sich im Bett die Füße nicht verbrannte, jedoch die Wärme möglichst lange anhielt.
Es war Winter, Winter 1949, spät in der Nacht. Wir hatten schon den ganzen Tag auf ihn gewartet, aber vergebens. Es hatte keine Nachricht von ihm gegeben, wann er eintreffen würde. Wie auch! Telefonleitungen waren in unserem Dorf nicht mehr vorhanden. Soweit es früher, vor dem Krieg, mal welche gegeben hatte, waren sie zerstört und die Apparate waren von den Russen mitgenommen worden. Legal oder illegal, das weiß niemand mehr.
In seinem Telegramm, das tags zuvor bei uns eingetroffen war, stand keine Ankunftszeit.
Uns: Das waren mein Großvater Albert, meine Großmutter Dora, meine Mutter, genannt Strickchen, meine Schwester Ada und ich.
Aber nun war er da. Seine Schritte kamen langsam näher, er hatte Knobelbecher an, die schmale, alte, ausgetretene Holztreppe quietschte viel lauter, als sie das tat, wenn wir hinaufrannten. Hinter ihm her kam meine Mutter.
Nun trat er in unser Kinderzimmer. Er war groß, fast zwei Meter, aber abgemagert. Vier Jahre russische Kriegsgefangenschaft – davon ein großer Teil in Sibirien – hatten ihm übel zugesetzt. In den zehn Jahren, die nun seit Kriegsbeginn vergangen waren, hatte er nur zwei- oder dreimal Fronturlaub, das letzte Mal im Frühjahr 1944, danach war er nicht mehr gekommen. Ich wurde daraufhin im Dezember 1944 geboren, er hat mich also nie zuvor gesehen.
Er trug noch immer die alte, inzwischen schäbig gewordene Unteroffiziersuniform. In der einen Hand hielt er seine Mütze, mit der anderen fuhr er vorsichtig über meinen Lockenkopf und sah mich lange an. Dann sagte er:
„Das ist also mein Sohn!“
War er enttäuscht? Fast schien es so. Hatte er sich ein gesundes, fröhliches Kind vorgestellt? Und nun das? Ein von Ruhr, Nachkriegshunger und Rachitis gezeichneter schwerhöriger, eher ängstlicher und ein wenig linkischer Junge? Der so gar nicht in das väterliche Hoffnungsbild passte?
Ich hatte noch obendrein gerade schweren Keuchhusten und eine langwierige Mittelohrvereiterung hinter mir. Man musste von da an laut mit mir reden. Dennoch habe ich meistens nur wenig verstanden, am ehesten noch meinen Großvater, dessen sonore Stimme mit baltischem Akzent mir am deutlichsten vorkam.
Meine Mutter stand hinter meinem Vater und sagte nichts. Er sagte:
„Ich habe dir etwas mitgebracht.“
Er knöpfte die rechte Jackentasche auf, fuhr hinein und zog einige in Pergament eingepackte Stücke Würfelzucker heraus. Wochen vor seiner Entlassung hatte er begonnen, bei den Mitgefangenen Brot gegen diesen Würfelzucker einzutauschen, um ihn seinen Kindern als Geschenk mitzubringen. Er legte die kleinen Päckchen in meine Kinderhand. Ich konnte damit jedoch nichts anfangen, denn ich hatte noch nie zuvor Würfelzucker gesehen.
Dann ging er weiter zu meiner Schwester. Er hob sie aus dem Bett, nahm sie in seinen Arm, küsste sie, es war eine unbeschreibliche Wiedersehensfreude. Er saß lange auf ihrer Bettkante und sie auf seinem Schoß. Er langte erneut in seine Jackentasche und da kamen weitere eingepackte Würfelzuckerstücke zum Vorschein. Sie lachten und scherzten. Es hörte gar nicht auf, bis meine Mutter mahnte, dass die Kinder jetzt wohl schlafen sollten. Erneut ging er langsam, den Blick auf mich gerichtet, an meinem Bett vorbei; meine Mutter hinter ihm her, sie gab mir einen Gutenachtkuss, danach schlossen sie hinter sich die Tür. Ich hörte beide noch die Treppe hinuntergehen, dann war alles still. Meine Schwester ist wohl bald eingeschlafen, ich aber habe noch lange wach gelegen und hatte Sehnsucht nach meinem unendlich geliebten Großvater, der mit Bedacht an dieser Begrüßung nicht teilnehmen wollte und mir an diesem Abend sehr gefehlt hat.
2. Kapitel:
Wer ist da heimgekehrt?
Er wurde 1917 in Gabel, Kreis Guhrau, in Schlesien geboren und wuchs in einem gutbürgerlichen, sehr strengen Elternhaus auf. Sein Vater war Lehrer, seine Mutter eine ehrsame Bauerntochter. Der Heranwachsende war nicht gerade der Liebling seines Vaters, eher das Gegenteil. Er wurde oft gezüchtigt, ja regelrecht verprügelt, während man seine Schwester verwöhnte. Seine Mutter litt sehr unter dieser Ungerechtigkeit und unter dem väterlichen Jähzorn gegenüber dem Buben. Die Schwester starb mit elf Jahren an einer Kinderkrankheit, die mit hohem Fieber einherging, was die Eltern förmlich traumatisierte. Er, der Ungeliebte, bekam fortan auch noch den Schmerz der Eltern über den unsäglichen Verlust der Schwester zu spüren, das heißt, er konnte jetzt eigentlich machen, was immer er wollte, nie war es dem Vater recht, und ständig wurde er, besonders vom Vater, für Nebensächlichkeiten hart bestraft. Eines Tages hat er einmal aus Furcht vor Prügel nicht ganz die Wahrheit gesagt. Als sein Vater schließlich dahinterkam, ließ er ihm, nach der Züchtigung mit dem Rohrstock, zum Zeichen seiner Schande die Haare abschneiden, und nun musste er monatelang als Lügner, als Kahlkopf, rumlaufen. In der Schule wurde er daraufhin natürlich angesichts seiner Glatze gehänselt, wurde schnell zum Außenseiter und fand kaum noch Anschluss. Wie aber geht es einem, der von den Eltern, vor allem vom Vater derart gepeinigt wird, keine Schulfreunde mehr hat und auch keinen geliebten Großvater – so wie das bei mir ja der Fall war? Und was wird aus so einem Kind?
Anfang der 1930er-Jahre – längst hatte er sich aus diesem Elternhaus befreien können – war er nach Berlin gezogen und hatte das vermeintliche große Glück, ausgerechnet im Nobelhotel Adlon eine Lehrstelle zu finden. Jetzt lernte er erstmals das Leben von einer anderen, ganz neuen Seite kennen.
Im Adlon, nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor und vom Reichstag, verkehrten hochgestellte Persönlichkeiten aus Politik, auch sehr verhängnisvolle, wie sich wenig später herausstellen sollte, aus Wirtschaft, Finanzwesen, Künstler aller Richtungen, auch und gerade aus dem emporkommenden Filmgeschäft und, nicht zu vergessen, der Hoch- und gelegentlich auch der Landadel. Das Adlon war für all diese Leute die erste Adresse. Es war mehr oder weniger ständig ausgebucht. Diese sogenannte Elite war in der damaligen Zeit des hereinbrechenden und sich ankündigenden Nationalsozialismus gerne unter sich. Man hatte andere Probleme als die der übrigen Bevölkerung. In diesen Kreisen gab es keine Arbeitslosigkeit, keinen Geldmangel, keine Angst, wie der nächste Monat bestritten werden sollte. Die Welt war in Ordnung, jedenfalls schien es so.
Und er war zwar nur Lehrling, aber er war da plötzlich mittendrin. Überall roch es nach Wohlstand, Geld spielte keine Rolle. Sparsamkeit, wie sie ihm in seinem biederen Elternhaus vorgelebt wurde? Vergiss es!
Inzwischen war er zu einem jungen, stattlichen fast Einmeterneunzigmann herangereift. Ein Jungmädchenschwarm! Er trug jetzt, kaum sechzehnjährig, schon ein Oberlippenbärtchen, das war Mode; die gewellten Haare links gescheitelt und mit Pomade auf Hochglanz gebracht. Tagsüber, und zum Teil auch abends, kellnerte er, lernte dabei Manieren, das war wichtig, denn davon hing ja auch die Höhe der Trinkgelder ab, aber – nicht weniger wichtig – ebenso die Zuneigung junger Damen.
Unter das erlauchte Adlon-Publikum mischten sich mitunter auch Studenten oder, was immer seltener vorkam, höhere Töchter aus dem kaum noch vorhandenen, wohlhabenden Mittelstand, aber immerhin, es gab sie noch, und sein Anblick, sein Benehmen, seine gesamte Erscheinung waren ihnen nicht gleichgültig.
Häufig hielt man sich im Nachmittagscafé des Hotels auf, einem erlesenen Saal mit Blick auf die breite gepflasterte Straße, die zum Reichstag führt. Bei einem bescheidenen Kännchen Kaffee, das sich selbst Studenten dann und wann leisten konnten, ließ es sich in dieser Wohlstandsatmosphäre aushalten. Da traf man sich zum Plaudern und genoss für ein paar Stunden die große Welt.
Zu dieser Adlon-Gesellschaft zählte auch die junge Kunststudentin Hanna, Tochter eines wohlhabenden Brauereibesitzers. Hanna war eine ausgesprochene Schönheit mit ihren langen pechschwarzen Haaren, den großen blauen Augen, dem üppigen Mund und dem wohlgeformten Dekolleté. Aber auch sonst saß bei ihr so ziemlich alles in gut ausreichender Menge an der richtigen Stelle. Darüber hinaus war sie stets hochmodisch, aber vornehm und in bester Qualität gekleidet, und ihr Gang war schlichtweg sensationell. Die Unterhaltung der Männer im Café wurde häufig auffallend leiser, ja manchmal verstummte sie regelrecht, wenn sie durch den Saal schritt, wandelte, ja fast schwebte.
Dann und wann brachte Hanna ihre Studienfreundin Irmi mit, die „Strickchen“ genannt wurde, warum, wusste eigentlich niemand so genau.
Strickchen war klein, sehr schlank, schlanker als Hanna und zierlicher, fast zerbrechlich, allerdings nur vom Aussehen. Ihre langen braunen Haare wellten sich über ihre Schultern. Eindrucksvolle starke Augenbrauen wölbten sich über ihre dunkelbraunen, großen Augen. Strickchen puderte gerne etwas ihre Nase, die ihr ein wenig zu groß und glänzend vorkam, was aber tatsächlich nicht der Fall war, und sie schminkte ihren auffallenden, volllippigen Mund knallrot. Das war damals Mode. Ihre langen Fingernägel hatten meistens die gleiche dunkelrote Farbe, übrigens auch die Fußnägel.
Strickchen war eine Baroness. Sie entstammte einer alten baltischen Adelsfamilie. Nach dem ersten Weltkrieg waren bekanntlich zahlreiche adelige Gutsherren aus dem Baltikum von den Bolschewisten vertrieben worden und Strickchens leiblicher Vater, Ernst Freiherr von Bistram, hatte das große Glück, nach der Flucht mit seiner Familie auf dem Rittergut seines Schwagers, Egon Kürsten, in der Nähe von Dresden unterzukommen. Dort verlebte Strickchen eine traumhafte Kindheit, die allerdings vom baldigen Tode ihres Vaters überschattet war. Er starb 1921. Strickchen war gerade drei Jahre alt, sie kannte ihn also kaum.
Ende der 1920er-Jahre heiratete Strickchens Mutter, Dora, erneut und zwar den Baron Albert von Hoyningen Huene. Alsbald verließen Mutter und Tochter das Rittergut und zogen in das nicht weit vom Gut entfernt gelegene Landhaus des neuen Vaters, des Stiefvaters, der von Beruf Architekt und außerdem ein Hobbymaler war.
Die Zeiten für die Landwirtschaft waren in den 1920er-Jahren nicht einfach. Die Erlöse für landwirtschaftliche Produkte waren niedrig und viele Gutsbetriebe retteten sich nur dadurch über die Runden, dass sie ab und zu Land verkauften, aber vor allem „den Gürtel enger schnallten“. Letzteres fiel der Familie von Strickchen besonders schwer, sodass das Gut schließlich verkauft werden musste, um die angehäuften Schulden loszuwerden.
Für Strickchen ging die traumhafte Kindheit jäh zu Ende, eine Kindheit, die sie prägen sollte. Im Vorwort ihres späteren Buches über die Bilder ihrer Kindheit, das sie 1998, also mit achtzig Jahren, herausbringen würde, wird es heißen:
„Manchmal gelingt mir die Rückkehr zum Geschehen von damals mühelos. Dann sehe und fühle ich alles, genauso wie das Kind, das ich war und das ich immer noch bin. Ich sehe das Land, das Haus, die Tiere und die Menschen, die mich umgaben, ich fühle meine Zuneigung, mein Glücklichsein, meine Ängste und Schmerzen. Ich habe mich nie davon entfernt, ich habe nichts verloren.“
Hanna und Strickchen ließen sich im Café des Adlon gern von ihm bedienen. Meistens gab es neben dem perfekten Service auch ein paar galante Bemerkungen von ihm, Höflichkeiten, die den beiden jungen Damen gefallen haben und die auch entsprechend erwidert wurden, wie gesagt, er war beiden nicht unsympathisch. Sein Interesse allerdings konzentrierte sich mehr und mehr auf Strickchen, was Hanna registrierte, nicht nur wohlwollend.
Gegen Mitte der 1930er-Jahre war Berlin in großem Aufbruch. Die Vorbereitungen für die Olympiade von 1936 liefen auf vollen Touren, die Jugend – vor allem die Sportjugend – war vom nationalsozialistischen Regime begeistert und alles richtete sich auf ein gigantisches Sportereignis ein, jenes Ereignis von einer Größenordnung, die es vorher weder in Deutschland noch sonst wo auf der Welt je gegeben hatte. Die Werbemaschinerie hatte eine nie zuvor gekannte Dimension erreicht, das Deutsche Fernsehen sollte Weltpremiere feiern, Rundfunk und Presse überschlugen sich in Propaganda. Kaum jemand bemerkte indessen, welch ein Irrsinn sich tatsächlich in Deutschland anbahnte. Man war im Olympiade-rausch.
3. Kapitel:
Albert
Strickchen hatte ihren Stiefvater, Albert, als ihren Vater akzeptiert und dessen Sohn, Axel, aus erster Ehe – etwas älter als sie – wurde ihr wahrhaft zum Bruder. Für diesen Vater aber – und das lag ihm ganz besonders am Herzen – war Strickchen auch längst zur Tochter geworden. Er machte zwischen seinem Sohn und ihr keinen Unterschied. Und überhaupt, er war der sanftmütigste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Nie wurde in seinem Hause je ein heftiges oder gar lautes Wort gesprochen. Es konnte wohl passieren, dass im Detail mit großer Ernsthaftigkeit diskutiert wurde, ausgeschlossen war jedoch die Form des hitzigen Gegeneinanders, in der der andere sich verletzt gefühlt haben könnte. Er hatte Sehnsucht nach Harmonie, Strickchens Mutter hatte es insofern auch leicht, ihre Wünsche durchzusetzen. Er hatte in seiner Eigenschaft als Architekt zum Beispiel etwas gegen offene Feuerstellen im Haus. Zu oft schon hatte er in seinem Beruf erleben müssen, wie verheerende Unglücke durch falsch gebaute offene Kamine geschehen waren. In seinem Hause gab es daher keinen solchen, sehr zum Leidwesen seiner Frau Dora. Sie war aus den Herrenhäusern, in denen sie früher gewohnt hatte, offene Kamine gewohnt und liebte die Atmosphäre, die von ihnen ausging, die Wärme, den Zauber, den ein offenes Feuer zu verbreiten vermochte, die Teestunden, die man in der kalten Jahreszeit davor genießen konnte, die klassische Musik im Hintergrund aus dem in Mode gekommenen Grammophonapparat und die intensiven Gespräche, die dabei stattfinden konnten.
Eines Tages musste also Albert – ich nenne ihn von nun an „Strickchens Vater“ (der er ja eigentlich nicht war) – verreisen, für ein paar Tage nur, nach Berlin, wo er zur Durchführung eines speziellen und nicht alltäglichen Auftrages an der dortigen Universität aus der Fachliteratur bestimmte Informationen zusammenzutragen hatte. Als er wieder heimkam, staunte er nicht schlecht:
Seine Frau saß in der Eingangshalle – man glaubt es nicht – vor einem offenen Kamin. In nur drei Tagen hatte sie es geschafft, einen Schornstein durch die drei Etagen des Hauses ziehen zu lassen und in der Eingangshalle einen Eckkamin aus rötlichem Backstein mit weißen Fugen, die Feuerstelle hinter einem Rundbogen, aufstellen zu lassen. Die unabdingbare Wartezeit, die man vor Inbetriebnahme einhalten muss, bis das Gemäuer getrocknet ist, interessierte sie ebenso wenig, wie die gesetzlich geregelte Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister. Der Kamin brannte, er zog wunderbar, sie war glücklich. Und Albert? Er stand sprachlos im Hauseingang und sagte nach einer Weile mit betretener Stimme:
„Aber Dora!“
Dann setzte er sich zu ihr, ganz nahe, blickte ins Feuer und schwieg. Das war alles.
Albert war ein sehr disziplinierter Mensch, weder eitel noch verschwenderisch, eher genügsam, was seine persönlichen Bedürfnisse anbelangte, allerdings immer äußerst korrekt, ja elegant gekleidet. Er nahm seinen Beruf sehr ernst, weil er sich da auch ein Stück verwirklichen konnte. Dieser Architektenberuf passte auch vorzüglich mit seinem ausgeprägten Hang zur Perfektion zusammen. Ebenso zeugte seine Hobbymalerei – einige Arbeiten sind uns bis heute erhalten geblieben – von diesem Hang zur Perfektion; nichts darin war dem Zufall überlassen.
Sein Büro in Dresden, ungefähr 15 Kilometer entfernt von seinem Haus, erreichte er Sommer wie Winter, indem er zunächst mit dem Fahrrad zum drei Kilometer entfernten Bahnhof und dann von dort aus mit dem Zug in die Stadt fuhr. Das kostete wenig und hielt ihn gesund. Im Winter konnte die Heimfahrt am Abend vom Bahnhof aus schon mal eine Stunde dauern, bei Schneefall auch noch länger. Auf Doras Vorschlag aber und nicht zuletzt auch auf Strickchens Drängen, entschloss er sich eines Tages, ein wenig gegen seinen Willen, ein Auto zu kaufen, einen Opel Olympia, eine Cabrio-Limousine mit aufrollbarem Verdeck. „Ein Traum“, wie Strickchen feststellte. Aber Albert konnte sich noch so bemühen, er wurde kein routinierter Autofahrer. Rückwärts einparken war ihm verhasst, häufig brauchte er fünf Anläufe und mehr. Auch die vielen Verkehrsregeln, besonders in der Großstadt, wollten einfach nicht in seinen, auf anderen Gebieten so intelligenten Kopf. Nach und nach stand das Auto mehr zu Hause in der Garage, als dass es benutzt wurde, sehr zur Freude von Strickchen, die lebte ja inzwischen in Berlin, wo sie gerade ihr Kunststudium aufgenommen hatte. Natürlich war Albert überhaupt nicht in der Lage, ihr, seiner Tochter, abzuschlagen, den Opel von Zeit zu Zeit einmal auszuleihen. Anfänglich machte Strickchen kleine Touren auf dem Land, nach und nach ging es dann auch schon mal nach Dresden. Schnell wurde Strickchen – was in den 1930er-Jahren noch eher die Ausnahme war – eine passable Autofahrerin, jedenfalls verstand sie erheblich mehr davon als ihr Vater. Das führte schließlich auch dazu, dass sich für Strickchen die Gelegenheiten häuften, mit dem Opel nach Berlin zu fahren, anfänglich, um am gleichen Tag wieder nach Hause zurückzukehren, nach und nach aber auch mal, um für zwei und schließlich auch für mehrere Tage in Berlin zu bleiben. Frei und ungebunden an irgendwelche Eisenbahnfahrpläne die Zeit zu gestalten, das war für Strickchen ein Zugewinn an Lebensqualität von unvorstellbarer Dimension, aber nicht nur für Strickchen.
4. Kapitel:
Verliebt
Strickchen hatte sich inzwischen unsterblich verliebt. In ihn! Und er sich in sie! Sie waren ein Paar geworden, noch unverheiratet zwar, aber unzertrennlich. Er im Adlon inzwischen fest angestellt, schon mit passablem Einkommen, sie unverändert Studentin an der Kunsthochschule. Nun sogar mit einem Auto ausgestattet, wenn auch nicht dem eigenen. Die Welt schien wunderbar und grenzenlos. Was sich außer dem Glück beider in Deutschland auch noch zusammenbraute, nahm man nicht wahr oder es wurde verdrängt, nicht nur von den beiden, auch von den meisten anderen Menschen. Leider!
Inzwischen hatte Strickchen ihn auch schon zu Hause vorgestellt. Dort im Elternhaus ging er bald ein und aus. Vor allem Strickchens Mutter war begeistert von ihm, von seinem tadellosen Benehmen, den galanten Umgangsformen, aber auch von seinem imposanten äußeren Erscheinungsbild, während sich Strickchens Vater eher ein wenig zurückhielt.
Für beide, wie auch die meisten Deutschen, war die Olympiade 1936 in Berlin ein absoluter Höhepunkt. Sie hatten es geschafft, für die eine oder andere Sportveranstaltung Karten zu bekommen. Das gelang durch seine Beziehungen, die ihm sein Arbeitgeber, das Hotel Adlon, eingebracht hatte. Angereist wurde in Alberts Auto. Übernachtet wurde im Adlon. Bezahlt wurde später, und wenn, dann von Strickchen. Alles war in Ordnung. Wichtig war ihr die grenzenlose Liebe zu ihm.
In ihrem späteren Leben würde sie sich fragen müssen, ob diese, ihre allumfassende Hingabe gerechtfertigt war.
1938 wurde er zum Militärdienst eingezogen, zur Infanterie. Die Ausbildung war hart, besonders für jemanden wie ihn, der bereits einige Zeit auf der Woge des Elitären geschwebt hatte. Plötzlich hieß es: Befehle, Gehorsam, Unterordnung; Fußboden und Klo scheuern, Kasernenzwang, durch Dreck und Schlamm im Gelände während der Grundausbildung, Abhängigkeit von morgens bis abends und von abends bis morgens. Nichts war mehr so wie bisher. Die alten Erinnerungen an sein Elternhaus, besonders an seinen Vater, brachen erbarmungslos hervor. Und er machte sich mit seinem elitären Gehabe unter den übrigen Rekruten auch nicht sehr beliebt. Im Gegenteil: Wo immer es gelang, schickten ihn die „Kameraden“ in die Scheiße und lachten ihn aus. An eine mögliche höhere Laufbahn, etwa in Richtung Offizier, war gar nicht zu denken, dafür fehlten ihm zudem die allgemeinbildenden Voraussetzungen.
Strickchen aber stand in dieser für ihn harten Zeit wie ein Felsen hinter ihm und sie war schließlich fest entschlossen, allen möglichen Anfechtungen, die sich ihr in den Weg stellten, Widerstand zu leisten. Zu diesen Anfechtungen zählte zum Beispiel ein griechischer Student namens Stefan Dragume, der sich sehr für Strickchen interessierte und einer äußerst wohlhabenden Familie aus Athen entstammte. Stefan setzte alles, was er aufbieten konnte, daran, um Strickchen zu erobern, sie zu heiraten und ihr gewissermaßen Athen zu Füßen zu legen. Eine grandiose Aussicht für Strickchen, wenn man bedenkt, dass sie ja nicht gerade eine Abneigung gegen Wohlstand und das Leben in den oberen Kreisen hatte. Doch am Ende nützten alle Aussichten auf Luxus nichts, auch nicht die Aussicht, dem bevorstehenden Schrecken der sich abzeichnenden Kriegskatastrophe gemeinsam mit Stefan zu entrinnen.
Nein, die wenigen Begegnungen mit ihm, meinem Vater, die sein gnadenloser Militärdienst zuließ, wurden für alles, was ihr und auch sein Herz begehrte, genutzt. Sie war entschlossen, bestärkt auch von ihrer Mutter, sich nicht Stefan, sondern ihm und nur ihm für immer vollständig hinzugeben und mit ihm eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.
Schließlich hatte er herausgefunden, dass es da einen griechischen „Widersacher“ gab. Seitdem hasste er nicht nur diesen, sondern gleichsam alle „miesen Griechen“ – übrigens dauerhaft, sein ganzes Leben lang. Wollte er Stefan ausschalten, blieb ihm nichts anderes übrig, als sie kurzerhand zu heiraten.
Strickchen glaubte, dass sich mit seinem Heiratsantrag, den er eines Tages in ihrem Elternhaus machte – Rosen, dunkler Anzug, Kniefall, also alles, was man in dieser Hinsicht aufbieten konnte – ihr Lebenstraum erfüllte.
Der Kriegsausbruch im Herbst 1939 durchkreuzte diese Pläne jedoch erst einmal gründlich. Nicht, dass er sofort an die Front musste, aber die Deutsche Wehrmacht, soweit sie nicht am Polenfeldzug teilgenommen hatte, wurde in Alarmbereitschaft versetzt und unter diesen Voraussetzungen war an eine große Hochzeit vorläufig nicht zu denken.
Strickchen aber gestaltete inzwischen die halbe untere Etage des väterlichen Hauses in eine separate Wohnung um. Zum Entsetzen ihres Vaters wurde ein weiterer offener Kamin gebaut, in Form einer halbierten Zwiebel, das war innenarchitektonisch jetzt der letzte Schrei. In Berlin wurden Möbel gekauft, unter anderem eine voluminöse Sitzgarnitur, der Bezugsstoff schneeweiß mit dunkelblauem Muster, mit edelstem Kirschholz umrandet, sowie ein chinesischer Tisch mit Metallintarsien, Teppiche, große Vasen aus Meißner Porzellan, Bilder, unter anderem von Bertling, einem Romantiker, der nach der Jahrhundertwende eine Zeit lang in Strickchens Heimatdorf gelebt und gemalt hatte.
Strickchens Eltern mussten sich nun mit der mittleren Etage ihres Hauses begnügen, die ursprünglich recht großzügige Eingangsdiele, die ehedem für Festlichkeiten verschiedenster Art oder auch für Billardabende zur Verfügung gestanden hatte, war jetzt nur noch halb so groß.
Im Dachgeschoss wurden Bad, Schlafnische und ein separates Atelier für Strickchen eingerichtet. Sie hatte wirklich an alles gedacht und Geldsorgen gab es nicht, noch nicht!
Strickchen hatte sich nach Beendigung ihres Kunststudiums in ihrem Heimatdorf als einzige junge Frau einer kleinen Gruppe von Kunstmalern angeschlossen. Da waren weitere Anfechtungen vorprogrammiert.
5. Kapitel:
Die Hochzeit
Er, eben noch in die große Gesellschaft des Adlon eingebunden, nun jedoch in der verhassten Kaserne gelandet. Das hieß: ein Leben voller Entbehrungen, unerfüllbarer Sehnsüchte, geplagt auch von grundloser Eifersucht, also ganz und gar nicht nach seiner Fasson, in der Fremde, nur selten unterbrochen durch himmlische, aber viel zu kurze Wochenenden. Da mögen Spannungen in ihm entstanden sein, die ein junger Mensch kaum aushalten kann, gerade in der damaligen Zeit mit ihren vielen Ungewissheiten.
Sie hingegen, eingebettet in noch uneingeschränkte, wirtschaftliche Unabhängigkeit, in romantische Verliebtheit, in Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, begleitet von ihren Eltern, die ihr jeden Wunsch erfüllten. Ihr Bruder war inzwischen auf der Offiziersschule. Um sie herum die Künstlergruppe, in der sie ja die einzige junge Frau war, und jeder der Maler versuchte, etwas mit ihr anzufangen. Sicher war sie fröhlich und unkompliziert in dieser Gruppe, man hat gemalt, man hat sich gegenseitig verglichen, man stand miteinander im Wettbewerb und es wurden Ausstellungen organisiert, auch Sommerfeste im elterlichen Garten gefeiert, und sicher hat sie da und dort auch mal ein wenig kokettiert, mit all ihren Sinnen aber blieb sie bei ihm, uneingeschränkt.
Noch im Jahr des Kriegsausbruches, um Weihnachten, fassten beide den Entschluss, den Hochzeitstermin nicht mehr zu verzögern. Vor allem Strickchen war die treibende Kraft, zumal die Zivilbevölkerung anfänglich noch vergleichsweise wenig vom Krieg merkte. Oder merken wollte! Denn Deutschland hatte am 1. September Polen überfallen, woraufhin zwar England und Frankreich zwei Tage später den Deutschen den Krieg erklärt hatten; da die deutsche Armee aber zu Beginn der Katastrophe an allen Fronten äußerst siegreich war und auch die Propaganda das ihrige tat, vermittelte sich noch für viele Menschen – auch für Strickchen und deren Familie – der Eindruck, dass das Ganze relativ schnell vorübergehen werde. Strickchens Bruder – inzwischen Leutnant – bestärkte die Familie in dieser Auffassung.
Strickchen schmiedete nicht nur Hochzeitspläne, sondern gestaltete in ihrer Fantasie auch die gemeinsame Zukunft.
Als Hochzeitstermin wurde nach langem Suchen schließlich der 9. März 1940 festgelegt. Eine Hochzeit also zum Zeitpunkt des Erwachens der Natur, Wiesen und Wälder voller Anemonen und Schneeglöckchen. Die jetzt schon wärmenden Sonnenstrahlen zauberten in den Gärten die ersten Krokusse hervor und der letzte Schnee war verschwunden. Das lautstarke und emsige Gehabe der Singvögel bestimmte das Geschehen in der Natur. Genau das war in Strickchens Gedankenwelt die richtige Atmosphäre für ihre Hochzeit. Hinzu kam, dass wenige Tage danach auch noch ihr 22. Geburtstag gefeiert werden konnte, also zwei Höhepunkte in einem Monat, wunderbar!
Auch er – inzwischen zum Gefreiten U.A. (Unteroffiziersanwärter) „aufgestiegen“ – freute sich sehr auf seine Hochzeit, war damit doch auch gewissermaßen der Einstieg in adelige Familienkreise verbunden und gefestigt. Gerne hätte er auch anstatt seines Familiennamens den von Strickchen angenommen, was aber leider zur damaligen Zeit nicht möglich war. Auch über Doppelnamen wurde nachgedacht, am Ende scheiterten all diese begehrten Vorstellungen jedoch am Namensrecht des „Dritten Reiches“.
Noch immer nicht an der Front, war es für ihn nicht allzu schwierig, um den 9. März herum eine Woche Urlaub zu erhalten. Das Wetter war relativ warm und sonnig und die anstehende Hochzeit beschäftigte alle.
Die Vorbereitungen waren in vollem Gange, es sollte ein Höhepunkt werden, nicht nur für Strickchen, nicht nur für ihn, auch für ihre Eltern, auch für die Seinen, die die neue adelige Familie bisher nur aus seinen wenigen und auch knappgehaltenen Briefen kannten, nicht jedoch persönlich.
Dies in einer Zeit unheilvoller Entwicklungen, die durch Radio, Zeitungen und Wochenschauen gezielt verharmlost wurden, und die meisten Menschen ließen sich immer noch dahingehend belügen, dass der Krieg heldenhaft geführt würde und siegreich, würde er doch schon bald durch weitere deutsche Siege beendet werden können. Würde sich doch dann in einem inzwischen größer gewordenen Deutschen Reich Wohlstand für alle entwickeln können. Strickchens Eltern – vor allem die Mutter, die ohne Wissen des Vaters zum Eintritt in die NSDAP überredet werden konnte – glaubten daran. Der Bruder – inzwischen Leutnant – glaubte daran. Noch! Der Vater sah mit Sorge Menschen aus seinem Freundeskreis verschwinden, nicht nur Juden, aber der junge Leutnant, sein Sohn, redete ihm bei jeder Gelegenheit die Zweifel aus.
„Denk an die Arbeitsplätze, Vater, die die Nationalsozialisten geschaffen haben, die Ordnung im Lande, die Jugendorganisationen, den Aufschwung, den das Reich erfahren hat. Denk daran, Vater, was der Vertrag von Versaille nach dem Ersten Weltkrieg für Deutschland an Elend nach sich zog. All das wird jetzt aufgearbeitet, zum Guten hin, Vater!“
Der Vater glaubte dem Sohn nicht, aber er redete nicht dagegen, er wollte den Familienfrieden um jeden Preis erhalten. Und: Der Vater hatte Angst!
Und er? Er nahm die dunklen Wolken am Horizont des „Deutschen Reiches der Arier“ am wenigsten wahr. Seine Gedanken kreisten ausschließlich um seine persönliche Zukunft in dieser neuen adeligen Familie.
„Sollen die da in Berlin, in Paris oder London sich doch die Köpfe einschlagen; solange meiner nicht davon betroffen ist, ist es mir ziemlich wurscht. Und wenn Menschen, wohin auch immer, deportiert werden sollten, falls das überhaupt wahr ist, dann wird das schon seine Gründe haben. Menschen, die sich an Recht und Ordnung halten, werden sicher nicht deportiert“, sagte er zu Strickchen.
Was für eine verhängnisvolle Blindheit! Und nicht nur er dachte so, viele andere auch. Strickchens Mutter Dora etwa war zwar nicht von egoistischen Gefühlen in die Irre geführt worden, sondern sie glaubte vielmehr an das Gute im Nationalsozialismus und sie verschloss dabei die Augen vor dem immer offensichtlicher werdenden Erscheinungsbild des heraufziehenden Grauens. Die verheerenden Auswirkungen dieser Denkweise jedoch waren am Ende leider immer die gleichen.
Die kirchliche Trauung fand in einem Nachbarort statt, weil es in Strickchens Dorf keine Kirche gab. Er in Ausgehuniform, sie in einem eierschalenfarbenen hochgeschlossenen, bodenlangen Seidenkleid mit langen Ärmeln. Den Stoff hatte ihre Patentante Margot aus Dresden gestiftet, deren Mann, Onkel Peter, dort eine Stoffgroßhandlung besaß.
Es war eine kleine Hochzeitsgesellschaft, vielleicht zwanzig oder fünfundzwanzig Personen. Zu ihnen gehörten: Strickchens beste Freundin, Hanna, die inzwischen mit Otto, einem wohlhabenden Holzhändler verheiratet war, weiterhin die kleine Künstlergruppe, die nun aus vier Malern bestand, seine Eltern mit einem Nennonkel Erich, Strickchens Patentante Margot mit ihrem Mann, Onkel Peter, die Schwester von Strickchens Mutter, Tante Else, mit ihrem Mann und der Tochter Marianne, eine Tante Lotte mit Tochter Usse, Strickchens Bruder, Axel, in feierlicher Offiziersausgehuniform mit seiner Frau Charlot und etliche Freunde der Eltern, einige davon auch aus dem Dorf. Sie alle trafen im Kirchhof ein, teilweise mit großen Autos – Tante Margot und Onkel Peter zum Beispiel mit einem amerikanischen Lassalle – einige mit zweispänniger Kutsche, er und Strickchen in geschmückter weißer, von zwei Schimmeln gezogenen Hochzeitskutsche. Da das Wetter sonnig und schon relativ warm war, genügten Strickchen ein Lammfell zum Zudecken der Beine und ein Cape aus Loden, das in ähnlicher Farbe wie ihr Kleid gehalten war. Er saß in seiner Ausgehuniform daneben.
Die kleine Dorfkirche war etwa zur Hälfte gefüllt. Die Zeremonie begann damit, dass Strickchen von ihrem Vater zum Traualtar geführt wurde, wo er, der Bräutigam, schon stand, beiden gegenüber der Pastor im bodenlangen Talar, mit seiner feierlichen Miene. Strickchen war sehr aufgeregt und ihr „ja, ich will“ kam nach schier unendlichen, vielleicht dreißig Sekunden, während sein „ja, ich will“ militärisch präzise erschallte, noch bevor der Pastor mit der Frage zu Ende war.
Danach säumten blumenbekränzte Mädchen aus dem Dorf mit ihren Streublumen den Weg aus der Kirche, alles so, wie es Strickchen sich vorgestellt und gewünscht hatte, die beschwingte Fahrt nach Hause durch die sanfte Natur des beginnenden Frühlings, vorbei an Feldern, die das erste Grün zeigten, der Himmel klar, weitgehend wolkenlos, und die Sonne, die eine angenehme Wärme ausstrahlte, unterstrichen von einem leichten Windhauch.
Eine riesige Tafel war unterdessen in der Billarddiele angerichtet, an deren Kopfende das Hochzeitspaar Platz nahm, rechts seine Eltern, links ihre Eltern; bis jetzt hatten diese außer der förmlichen Begrüßung kein einziges Wort miteinander gewechselt und das sollte für den Rest des Tages auch so bleiben.
Köstlichkeiten, geliefert und serviert von einem Restaurant aus Dresden, wie man sie in diesem Haus zuvor noch nie in dieser Menge und Vielfalt gesehen hatte, waren aufgetischt. Dezent reichte das Personal den Gästen diese Speisen und Getränke.
Echte Fröhlichkeit wollte sich jedenfalls anfänglich noch nicht so recht einstellen. Nennonkel Erich plauderte zwar mit Strickchens Vater über sein neues DKW-Motorrad, jener aber verstand von Motorrädern nichts, sagte gelegentlich, wenn es ihm so vorkam, dass der richtige Moment gekommen sein müsste, lächelnd mal „ja“ oder mal „nein“. Umgekehrt verstand Nennonkel Erich nichts von Architektur und antwortete Strickchens Vater einfach gar nicht, sondern setzte unverdrossen seine Erläuterungen über Zweitaktmotoren fort. Hingegen verstanden sich Hanna und Onkel Peter blendend, was Patentante Margot mit einem gewissen Argwohn verfolgte. Hanna, die modebewusste, sehr attraktive junge Dame, hatte mit Onkel Peter – er hätte ihr Vater sein können, sah aber immer noch blendend aus – jede Menge Gesprächsstoff, war dieser doch der Modebranche beruflich sehr verbunden. Auch zwischen Hannas Mann Otto und der immer noch wunderschönen Tante Else entwickelte sich nach und nach eine leichte, fast ausgelassene Unterhaltung, und so kam im Laufe des Nachmittags und des frühen Abends schließlich doch eine überwiegend gesellige Stimmung zustande. Es wurde über alles Mögliche geplaudert, gelacht, und es wurde sich gegenseitig zugeprostet.
Einzig seine Eltern lieferten ausgesprochen wenige Beiträge zur Ausgelassenheit.
Seine Mutter Elfriede, inzwischen ausgebildete Krankenschwester, kam mit Tante Lotte, die in der evangelischen Fürsorge tätig war, ein wenig ins Gespräch, weil beide bereits Lazaretterfahrungen hatten. Das war aber ein eher ernster Gesprächsstoff, der sich nicht in die allgemeine Fröhlichkeit einzufügen vermochte. Sein Vater Herbert hingegen blieb weitgehend teilnahmslos. Selbst mit seinem Sohn, den er immer noch „Bub“ nannte, wechselte er den ganzen Tag über kaum mehr als fünf Worte; beide wussten eigentlich so gut wie nichts mehr voneinander. Und er war überhaupt nicht daran interessiert, seine alten Kindheitswunden wieder aufzureißen; er ging seinem Vater deshalb einfach aus dem Weg.
Gegen Mitternacht schließlich löste sich die Gesellschaft langsam auf. Nennonkel Erich, Otto, aber auch Onkel Peter waren ein wenig betrunken und der Bräutigam konnte seine Gangart nur noch mit Mühe kontrollieren. Dagegen hatten sich die Damen überwiegend unter Kontrolle, auch Strickchen und Hanna, die beide allenfalls einen leicht beschwipsten Eindruck hinterließen.
Strickchen hatte es von jeher geliebt, Feste zu feiern, sie war auch perfekt in der Vorbereitung und Gestaltung. Ihre Hochzeit hatte alles bisher Dagewesene übertroffen. Aber es hatte auch etwas Gewagtes, fast Peinliches, in dieser aufkommenden Katastrophe so zu feiern. Es sollte für viele Jahrzehnte ihr letztes großes Fest gewesen sein. Erst in den 1980er-Jahren, also im Alter – die Kriegswirren, die furchtbare Nachkriegszeit, das Ende ihrer großen Liebe zu ihm, all das hatte sie lange hinter sich – begann sie noch einmal, in ihrem bayerischen Zuhause Feste zu geben, in Erinnerung an ihre Jugend, die am 9. März 1940 ihr jähes Ende gefunden hatte.
6. Kapitel:
Im Krieg