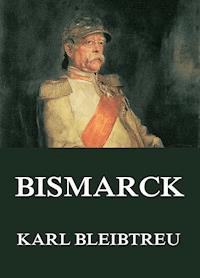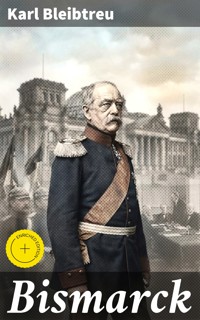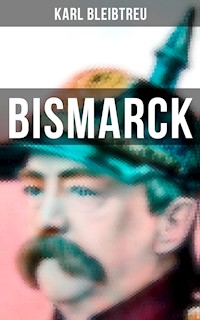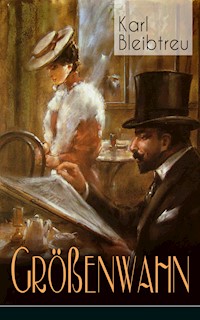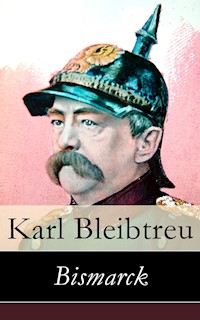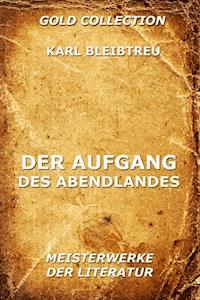
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht von ungefähr ähnelt der Titel dieses Werkes einem bekannten Buch von Oswald Spengler. Bleibtreu behandelt ähnliche Themen, aber aus einer komplett anderen Perspektive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 949
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Aufgang des Abendlandes
Karl Bleibtreu
Inhalt:
Karl Bleibtreu – Biografie und Bibliografie
Der Aufgang des Abendlandes
1. Naturerkennen und Erkenntniskritik.
I
II
III
IV
V
2. Das Unwirkliche des Wirklichen.
I
II
III
3. Der Evolutionswahn.
I
II
III
IV
V
4. Phrasenevolution der Menschheit.
I
II
III
IV
5. Das Weltreich der Illusionen.
I
II
III
IV
6. Der Ursprung der Religion.
I
II
III
IV
V
7. Von Buddha zu Jesus.
I
II
III
IV
8. Urreligion der Kosmogenie.
I
II
III
IV
V
VI.
9. Umschau der Philosophie.
I
II
III
IV
V
10. Anthroposophie.
I
II
III
11. Übersinnliches, Traum, Spiritismus.
I
II
III
12. Gehirn- und wahre Psychophysiologie.
I
II
III
IV
13. Die wahre Relativitätstheorie.
I
II
14. Unnatur der Naturforscher, Unbelehrbarkeit der Verlehrten.
I
II
III
15. Immanente Gerechtigkeit und kein Untergang.
I
II
III
16. Der transzendentale Monismus und das Gesetz des Entgegenkommens.
I
II
III
IV
V
Der Aufgang des Abendlandes, K. Bleibtreu
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606381
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Karl Bleibtreu – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, geb. 13. Jan. 1859 in Berlin, verstorben am 30. Januar 1928 in Locarno. Proklamierte frühzeitig in der Schrift »Revolution der Literatur« (Leipz. 1886) die modernen Tendenzen und zeigte in seinen ersten Versuchen: »Dies irae, Erinnerungen eines französischen Offiziers an Sedan« (5. Aufl., Stuttg. 1902), »Napoleon bei Leipzig« (Berl. 1885), »Deutsche Waffen in Spanien« (das. 1885), »Friedrich d. Gr. bei Kollin« (das. 1888), »Cromwell bei Marston Moor« (Leipz. 1889) ein bemerkenswertes Talent zu lebendiger Schlachtenschilderung. In seinem »Lyrischen Tagebuch« (Berl. 1884), dem Drama »Lord Byron« (Leipz. 1886), den Novellensammlungen: »Schlechte Gesellschaft« (das. 1885), »Kraftkuren« (das. 1885), in dem Roman »Größenwahn« (das. 1888) gärt es wie in den kritischen Auslassungen Bleibtreus heftig und leidenschaftlich. Aus der übergroßen Fülle seiner Werke seien ferner genannt: »Welt und Wille«, Gedichte (Dessau 1886); »Geschichte der englischen Literatur« (Leipz. 1887, 2 Bde.; Bd. 2, 2. Aufl. 1888); »Napoleon I.« (Dresd. 1888); »Die Entscheidungsschlachten des europäischen Kriegs 18..« (Leipz. 1888, 3 Bde.); »Schlachtenbilder« (das. 1889); »Heroica«, Novelle (das. 1890); »Kosmische Lieder« (das. 1890); »Zur Psychologie der Zukunft« (das. 1890); »Der Imperator« (Napoleon 1814, das. 1891); »Letzte Wahrheiten« (das. 1892); »Geschichte und Geist der europäischen Kriege unter Friedrich d. Gr. und Napoleon« (das. 1892, 4 Bde.); »Kritische Beiträge zur Geschichte des Krieges 1870/71« (Jena 1896); »Byron, der Übermensch« (das. 1897); »Zur Geschichte der Taktik und Strategie« (Berl. 1897); »Der Zar-Befreier« (Stuttg. 1898); »Geschichte der Kriegskunst im 19. Jahrhundert« (Berl. 1902); »Waterloo, eine Schlachtdichtung« (Münch. 1902) u. a.
Der Aufgang des Abendlandes
O Mirabile Giustizia Di Te, Primo Motore!O La Tua Divina Necessità!Leonardo Da Vinci
Ich sah keinen Tempel, denn Gott selbst war der Tempel.Apokalypse
Wir wissen noch nicht, was wir sein werden, wissen aber, wann es erscheinen wird, daß wir Gott gleich sind, denn wir werden ihn so schauen, wie er ist.Epistel Johanni
Wer mit Zweifel beginnt, endet mit Gewißheit.Bacon
Die Seele ist nicht räumlich im Körper ... Körper ist vielmehr in der Seele ... Einheit und Wahrheit sind das gleiche.Giordano Bruno
Ohne Unsterblichkeit ist das Leben sinnlos.Goethe zu Eckermann
Der Sinn, der Geist, das Wort, die lehren fromm und frei, Wenn du es fassen kannst, daß Gott dreifaltig sei. – Wär' Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, Wenn nicht gebor'n in dir, so bist du doch verloren.Angelus Silesius
Wer feige Frieden sucht nur für sein eigen Heil, Ist ein Verräter an der Welt gemeinem Heil. Rückert
Glück und Unglück sind nur Schein.Paracelsus
Glück und Unglück sind dem Starken gleich.Chamford
Jedes Phänomen der Geschichte wird Naturerzeugung.Herder
Nicht wir sind in der Zeit, Zeit oder vielmehr absolute Ewigkeit sind in uns. Natur weiß nicht durch Wissenschaft, sondern auf magische Weise.Schelling, »Über Dogmatik«
Gemeinschaft sucht, wer Einsamkeit nicht vertragen kann.Pascal
Unfreiheit ist ein Phänomen der Freiheit.Kierkegaard
Das Subjekt kommt nie zum Bewußtsein seiner Selbständigkeit, deshalb finden wir bei Juden keinen Glauben an Unsterblichkeit ... Statt die Welt analytisch zu buchstabieren, sollte Philosophie sie synthetisch konstruieren.Hegel
Nur Denken erzeugt, was als Sein gelten darf.Cohen
Die Methode des Denkens ist beim Kongoneger ganz wie die des Professors.Nordau, »Was ist Wahrheit«
Habichte fressen immer Tauben, warum sollte der Mensch seinen schlechten Charakter ändern?Voltaire, 1780
Erinnern des Lebensinhalts ist nur ein Vorbegriff.Fechner
Alles Erinnern an das alte Leben wird beginnen, wenn das alte Leben dahinten liegt ... Es ist umsonst, aus Umständen den Genius begreiflich zu machen, der eigenste Zugang zu ihm ist der subjektive.Dilthey
Deshalb ist Universalität das Kennzeichen des Genies ... Höchster Individualimus ist höchste Universalität ... Wissenschaft nimmt die Dinge, wie sie sind, Genie für das, was sie bedeuten ... Nur zeitlose Dinge werden positiv gewertet.Weininger
Für Wissenschaft gibt es keine Spezialuntersuchung, jedes ihrer Sonderprobleme dehnt seine Linie von selbst in letzte Fragen aus.Windelband
1. Naturerkennen und Erkenntniskritik.
I
»O Wunder der ersten Bewegung!« ruft Leonardo. Das klingt anders als die Altklugheit, die sich über nichts wundert und Bewegung als einzigen Lehrsatz ihrer Schematik herleiert, als drehe es sich bei Weltdrehung um objektive Tatsache statt um subjektiven Verstandesbegriff, der nach naivem Menschenmaß unterscheidet. Selbst der alte Helvetius, der nicht so dumm war wie die ihm folgende Kraftstoffelei, gab zu, daß Kraft und Stoff keine Wirklichkeiten, sondern nur Postulate menschlicher Auffassung seien. Ostwalds »Energetik« blieb auch nur eine nichtssagende Phrase, weil Energetiker und Vitalisten sich nicht dazu entschließen, aus solcher Lebensdynamik die natürliche Folgerung eines supranaturellen »immateriellen Lebensprinzips« (Kant) zu schöpfen. Was man als Bewegung wahrnimmt, ist trotz der Verpflichtung, damit zu rechnen, eine Täuschung der drei Vorstellungen Zeit, Raum, Kausalität. Wie sich aber die Materie von sich aus in Bewegung gesetzt haben sollte, wird wohl kein ehrlicher Mechaniker ausdenken. Eine »erste Bewegung« wäre freilich ein Wunder, denn wie konnte sie entstehen ohne Anstoß eines Bewegenden, der sie zum Rollen brachte? Oder war dies Bewegende immanent, dann wäre eben dies der »letzte zureichende Grund«, dem nicht höhere Mathematik die Wurzel ausziehen kann. Denn ob »Gott der erste Beweger« von außen oder ob er sich innen verbirgt, immer bleibt er bestehen als bewegende Kraft. Allein, das Wunder ist leider viel größer und unheimlicher, sintemal es eine » erste Bewegung« überhaupt nie gegeben haben kann, sondern Bewegung und Ruhe beide nur menschliche Begriffe für etwas sind, was weder Zeit noch Raum noch Kausalität weder ein Erstes noch ein Letztes hat. Denn die All-Ewigkeit kennt weder Ursache noch Wirkung, weder Anfang noch Ende, so daß ein »Wunder der ersten Bewegung« durch die Kinderfrage ausgehöhnt wird: Und wer schuf Gott? So kindlich gehen selbst die größten Geister, sobald sie von transzendentaler Metaphysik indischer Urweisheit abirren, an die Grundfrage heran. Diejenigen aber, die als angenehme Zerstreuung zwischen Kolleghalten über Kathederzoologie »Welträtsel« lösen, verdienen eine Anstellung als Wirklicher Geheimer Rat des höheren Blödsinns und des höchsten Größenwahns, der im Namen der bekannten Göttin Vernunft ein Sacrifizio dell' Intelletto und ein Credo quia absurdum neuen Pfaffentums fordert.
Wahre Erkenntnis ist schaurig-ernst und entzieht sich grabestief dem Lärm der Laboratorien, wo man froh ist, wenn man in den Retorten Regenwürmer findet. Wonnebrunzelnde Frömmelei und philanthropische Menschheitsliebelei erbauen aber auch nicht mit zerflossenem Quark den Sinai, zu dem Gott im Donner niedersteigt. Er ist durchaus kein Pazifist, mit ihm darf man nicht flirten, er ist nicht »die Liebe«, sondern Gerechtigkeit und den Imperatorhohn spricht er selber aus: »Ihr Racker, wollt ihr denn ewig leben?« Nicht verzückter ideologischer Augenaufschlag schaut diese Unendlichkeit. Dazu muß man auf dem Rücken liegen, durch die Brust geschossen, wie Tolstois Fürst Andrei auf dem Schlachtfeld von Austerlitz, dem ein vor ihm stehender Napoleon spaßig vorkommt, gemessen am unermeßlichen schweigenden Äther.
Heutige Naturforschung kann sich so wenig wie alte Scholastik von anthropomorphischen Voraussetzungen frei machen. Schon Sokrates meinte naiv, er wolle sich nicht mit spezialisierter Beschauung »die Augen verderben«, sintemal »das wahre Wesen der Dinge im menschlichen Denken darüber liegt«. Stolz will man den Spanier, doch in so überschäumende heilige Einfalt, die in Spitzfindigkeit eines Erdenwurms die Allwahrheit sucht, darf man wohl einige Wermuttropfen träufeln. Der Wissenschaftskirchenvater Aristoteles fing den Weltgeist hübsch in ein Dogmanetz ein, unterschied genau Geistgott und Ursubstanz und ließ amtierende Untergeister (Erzengel) als Lampenträger des Universums um die Erde herumtanzen, obschon von Pythagoras bis Aristarch lange vor Copernic und Cusa das heliozentrische System sich der Vernunft aufdrängte. Vergleicht man indessen dies Weltbild von Menschen, nicht Gottes Gnaden mit der modernen Substanzschwärmerei, so fällt einem Luthers Gleichnis ein: Die Vernunft sei ein betrunkener Bauer zu Pferde, der auf der einen oder auf der anderen Seite herunterfällt und sich den Hals bricht. Kaum stolperte so Herbarts Vorstellungsmechanik über die damit unvereinbare einheitliche Individualität, als auch schon die modernste Psychologie mit Assimilierung und Übung der Anschauung und die Gehirnpathologie mit Dezentralisierung der Geistesfunktionen in die Fußangeln der übersinnlichen Vitalität stürzten. Denn das Fehlen jeder sichtbaren Hirnzentrale, gleichmäßiges Wohnen und Betätigen an verschiedensten Orten der Hirnnerven, zeigt die Psycheenergetik als Abbild des Äthers allgegenwärtig ausgedehnt innerhalb des ihr zugewiesenen Organismus, ein Sinnbild von Einheit in Vielheit. Die Experimentalpsychologie rennt nur dem Ich nach, verleiht aber wichtigtuerisch diesem vor ihr hertanzenden Irrlicht den Namen Seele, sie sucht alldurchdringenden Sonnenstrahl in unterirdischem Keller statt im Äther, während Seele als Ichbegriff undenkbar und einfach mit dem immateriellen Lebensprinzip (Elektronen) identisch ist. Gehirnanatomie bedeutet nichts als Wohnungsuntersuchung, was den zeitweiligen unsichtbaren Mieter kalt läßt, da er ja doch bald auszieht. Sie klopft als blinder Polyphem die Wände ab, um den Herrn Niemand zu suchen. Schon dieser, das Ich, narrt den Sucher, das Echo höhnt: Du sagst ja selbst, du suchst Niemand. Doch den wahren Jemand ahnt er in jeder Ecke, ohne den »Sitz« zu finden, an dem »er« arbeitet. Die immaterielle Ausdehnung der Elektronen als Teil der Weltseele im Hirn suchen ist gerade so kindisch, wie das frühere Festhalten an einer freien Ich-Seele. Wenn Erhaltung der Kraft für die Energie gilt (Mayers Wärmetheorie), so bewahrt auch die Psyche ihre eigene unzerstörbare Kraftkonstante.
II
Aristoteles ließ bei seinen 10 Kategorien den Grundzügen »Stoff, Bewegung, Form« ein Endziel folgen, das er nicht klarzumachen weiß. Das Fundament des Stoffes scheint heut mehr denn je auf Sand gebaut. Das vom Araber Maimonides übernommene »unzerschneidbare« Atom als Urkörperahne der Allfüllung enthüllte sich jüngst experimentell von sehr zerschneidbarer Seite. Da auch mit starren Atomen nichts für psychische Bedingungen anzufangen ist, setzte Leibniz den Atombegriff in seelische Monaden um. Er ließ sich dabei auf sozusagen Gleichstellung aller Monadeuhren ein, die ohne Einwirkung aufeinander die Stunde schlagen, nur bewegt vom Normalzeitzeiger der Urmonade Gott. Solcher Gleichklang ohne Wechselbeziehung bleibt ein Unding, denn Monaden wechseln natürlich ihre Lage wie Elementatome durch veränderliche Wärmestadien. Doch die organische Chemie schöpft auch kein Fundamentalwissen aus der Retorte. Man kann die 64 Elemente, die man nun glücklich herausklaubte, nicht in ihre Grundstoffe auflösen, Atomwägung bleibt für sinnlich Unwahrnehmbares illusorisch. Erdichtung des Moleküls, d. h. der Atomverbindung gestand, daß Einzelatome nicht für sich selbst bestehen und sich fortwährend durch Reibung mit Nachbaratomen verwandeln. Chemische Wahlverwandtschaft aber setzt einen psychischen Prozeß des Wollens und Begehrens voraus. Da werden Ehefesseln abgestreift, alte Liebe rostet nicht, das Entfernte und scheinbar Entgegengesetzte findet sich wieder in elektrischer Spannung von Positiv und Negativ. Der Kohlenstoff erhebt sich im Verbrennungsprozeß zum Sinnbild organischen Lebens, Harnstoff wird Gleichnis der Gleichheit alles Animalischen mit den Elementen selber. Doch die Schleimzelle als Keimzitadelle des Materielebens entweicht vorwitziger Neugier, man kann sie nicht nachfabrizieren. Ihre dämonische Gewalt wird Medizinern in Bazillen, Agrariern im Samenkorn verdeutlicht. Pflanzenstäubchen begehen Minneheldentaten, zwischen dunkelm Erdschoß und lichter Himmelsluft werden beim Reifen der Neugeburt die sieben Arbeiten des Herkules vollbracht. Alle Elemente sind im Samenkorn enthalten, gewiß ebenso in einstiger Urkeimzelle des Menschen und ihrem heutigen Aufbau (Paracelsus). Materialisierung arbeitet mit möglichster Kraftersparnis nach einem einzigen Grundgesetz, doch unbegreiflich weit spannt sich dabei die individuelle Ungleichheit. Die einen Bakterien sind gut, die andern bösartig, dienen Leben oder Tod nach eigenem Gefallen, individuelle psychische Anreize durchziehen jede Naturstufe. Vagabundieren mancher Pflanzensporen gleicht dem Beute- und Minnesuchen der Tiere, neben andern harmlosen Schwestern stehen holde Blumen als spitzbübisch gierige Insektenfänger. Pflanze und Tier als Kohlenstoffverbindungen sind zugleich tier- und pflanzenähnlich, waschen sich die Hände als gegenseitige Lebensassekuranz, jeder nährt sich von Abfällen des andern wie der Mensch von beiden. Doch wie verschieden entfaltet sich die Psyche, je heftiger sich das Selbstbewußtsein meldet! Pflanzliches und Tierisches haben gleichen Verbrennungsapparat, doch wie verschieden atmen Pflanzen und Tiere Kohlen- und Sauerstoff ein und aus! Beide wichtigsten Lebensstoffe vermählen sich als Kohlensäure unter gewissen Bedingungen zu bestimmtem Zweckerfolg, scheinbarer Dualismus sucht auch hier Einheit, im Unsichtbaren gibt es sicher zahllose Verbindungen, die doch alle zu gleicher Familie gehören. Ihr Familiencharakter aber ist Beständigkeit. Naturapparate sind stets die gleichen, sogar Größeformate (Planeten) scheinen einmal für immer fixiert, in der ungeheuren Vielheit herrscht nur geringe physische Transformation, keine andere Verwandlungsfähigkeit wird zugelassen als die des Schauspielers, der Maske und Kostüm wechselt, doch stets der nämliche bleibt.
Der Mensch schwärmt gern von Generatio aequivoca bei Athene, Madonna und sogar der Bienenkönigin. Wären diese Damen Jungfern und ohne Mutter geboren – la recherche de la maternité est interdite –, so unterbrächen sie den Ring exakter Mechanik nicht eigentümlicher als Fehl- und Schwergeburten – Friedrich der Große, Voltaire usw. sträubten sich lebhaft gegen das Licht der Welt – oder die Buntscheckigkeit aller Erotik. Aristoteles lehrte »Form« als Folge von Stoffbewegung, Plato »Idee« als primär. Nun kristallisieren sich, mag man sie auflösen und andere Neubildung zur Verfügung stellen, Steinsalze immer wieder in Würfel, Alaun in Achteck, Korallen in Siebenornamente, die Pflanze schießt aus ihrer Wurzel stets zum gleichen architektonischen Gebäude auf. Ketzer mochten den heiligen Feigenbaum von Buddha-Gaya verstümmeln und umhauen, sie verminderten nur seine Größe, er wuchs immer wieder als Idee dieses Feigenbaums und lebt noch heut. Form ist also nur das Modell, nach dem sich der Stoff um seine Idee gruppiert. Im Atelier der Natur aufgestellt, gleicht sie der künstlerischen Idee eines Bauplans. Wir sehen uns allgemeiner Vorbestimmung der Formen und somit einer Ideenwelt gegenüber, in welcher der Stoff geknetet wird. Deshalb verwerfen wir das Wort Materie, setzen dafür Materialisation, die nicht von Ursubstanz, sondern Urkraft unbekannter Wesenheiten ausgeht. Könnte man das 300fach verstärkte Sehvermögen der Mikroskopforschung aufs gewöhnliche Sichtbare anwenden, würde man Überraschungen erleben. Ehrenberg spricht von »seelenvollem Aufbau zierlich lebendiger Formen«, wo das Gewebe kleinster Infusorien sich stets verfeinert. Plan, Gesetz, Einheit, wo man Zufallspiel des Formlosen vermutete! Je mehr sich Beobachtung verschärft und Schauen vertieft, desto deutlicher tritt jedes Naturteilchen als Spiegelbild einheitlichen Schöpfungswillens einer alldurchdringenden Psyche hervor.
Diesem logischen idealistischen Weltbild begegnet der Materialismus mit lauter Geschäftsphrasen über angeblich selbständige Naturwirtschaft. Das ist gut genug für Krämer, die ihr Hauptbuch mit Soll und Haben als Fetisch verehren, während dort verzeichnete Zahlenmessungen nur papierner Niederschlag von Addition und Subtraktion zahlloser lebendiger Tatsachen sind, aus denen man erst die Zahlen gewann. Der Wilde hält doch wenigstens seinen Stein oder Holzklotz nur für ein Merkzeichen des angerufenen Zauberfetisch, nicht das Holz selber für wundertätig. Freilich sind auch Stein und Holz nicht leb- und seelenlos. Denn Prof. Chander Bose, ein Hindu, bewies experimentell, daß Metalle genau so auf Stimulanzen reagieren wie ein Menschenkörper. Eine Eisenstange spürt Müdigkeit, schläft ein, erwacht, kann vergiftet und getötet werden. Man kann unter galvanischer Stromwirkung metallische Vegetation erzeugen, ein deutscher Gelehrter verwandelte Salz in farbige Pilzform. Nun kann aber Leben nur durch Leben entstehen, alles ist eben Leben, beständig kommen Lebensformen aus Unorganischem, siehe Bastians Experiment über Entstehung von Bakterien. Was heißt überhaupt unorganisch! Derlei kann es in der ungeheuren Weltorganisierung überhaupt gar nicht geben. Wieder nur anthropomorphische Täuschung, die alles für toten Stoff hält, was sich menschlicher Prüfung entzieht und sich nicht animalisch bewegt. Unstreitig entstand alle Materie durch Attraktion von »Molekülen«, An- und Abstoßung als Ehe und Scheidung chemischer Prozesse sind aber psychische Akte und solches muß bei allen sog. Atomen vorausgesetzt werden. Haeckel erklärte offen, er sehe Zu- und Abneigung in jedem Materieakt. Welche Begriffsstutzigkeit, daraus nicht sofort antimaterialistische Schlüsse zu ziehen! Komischerweise läuft nämlich der ganze Spektakel darauf hinaus, den ausgetriebenen Geist wieder in die Materie hineinzuschmuggeln. Leben ist eben allgegenwärtig, Geist immer dort, wo Leben ist, Leben aber in jedem Atom. Saaleby schließt daher ganz richtig, daß Geist in jedem chemischen Element der Zelle sei, Geist sozusagen das Elektron der Materie. Geist aber will stets etwas. Schon im 18. Jahrhundert sprach Crusius das große Wort: »Wille ist die herrschende Kraft im Universum«, moderne gelehrte Redensarten umschreiben dies nur wie Wundts Auslegung der Energie als »etwas dem Willen Ähnliches« oder Gudsworths »plastische Natur«, die dem »schöpferischen Willen« der Yogalehre entspricht als Instrument des absoluten Einen. Dieser Wille ist in der Natur unverkennbar, aber nicht Schopenhauers blinder Wille, der ohne Zweck und Ziel nach Leben hascht. Es ist auch etwas anderes, wenn Lamark »Begierde« als Ursache aller Formen erkennt. Formen sind ewiger Wechsel, Wille auch, identisch mit Bewegung, Geist aber als notwendige Ursache jedes Willens seinem Wesen nach wechsellos. Der Tautropfen der Wolke wandert auf mancherlei Wegen zum Meer zurück, aus dem die Wolke kam; so des Menschen wechselnde Psyche zurück zur ewigen Ruhe. Die Wissenschaft drückt sich mit unnötiger Vorsicht um die Erkenntnis herum: In jeder Energie ist »etwas wie Geist«, in jedem Elektron »etwas wie Materie«, nur unendlich feiner. »Etwas wie« ist Ausdruck der Hilflosigkeit, die nicht ehrlich sein will: ist das Elektron irgendwie mit sog. Materie (Äther) verkettet, dann ist eben die Materie geistig beseelt, und zeigt die Energie geistige Anlage, dann hat sie geistige Zwecke. Geist ist also das Uranfängliche, Energie seine Folge und deren Endfolge die Materie. Die umgekehrte Reihenfolge anzunehmen ist so verdreht, daß es sich nur noch pathologisch als epidemische Ansteckung erklären läßt wie im Mittelalter der Veitstanz. Schopenhauer nennt den Optimismus mehr verbrecherisch als leichtfertig, wir nennen Materialismus eher kreuzdumm als verbrecherisch.
Der primitivste Wilde fühlt das Übergewicht des Psychischen, die Antike verband mit Hades ganz logische Vorstellung, daß die Unterweltler nach Erdsinnlichem schmachten (»lieber ein Bettler hier als König im Reich der Schatten«), in dem allein sie aufgingen, während sie die Kämpfer für höhere Zwecke als Halbgötter in die Sterne versetzte. Materialisten bestehen gemeinhin aus Verstandesgelehrten, die überhaupt nichts vom Leben wissen, aus sog. Weltleuten, die nur winzigen Ausschnitt der Menschenwelt und ein paar wissenschaftliche Näschereien als Nachtisch der Sinnlichkeit kennen, und aus der riesigen Herde, die vor sich hingrast und ihren Grasfleck für die Welt hält. Die kleinste tägliche Beobachtung müßte den Materialisten verwirren und tut es auch, wenn er genug nachdenkt. Er sieht einen roten Kaschmirschal, schon dieser Vorgang ist psychisch, da die Augen nur als Fenster dienen, durch die der Sehnerv im Hirn hinausschaut. Daß nun das Bild des Schals samt seiner roten Farbe in einem Hirnkasten aufbewahrt wird, den wir Gedächtnis nennen, und dort reproduziert bleibt, daß ferner willkürlich Bilder im Hirn auftauchen, plastisch und oft farbig, und sich dies beim Künstler zum Schaffen selbstherrlicher Gebilde steigert, solche unverkennbaren Akte einer regierenden Psyche können durch keinerlei Floskeln von Apperzeptionen weggedeutet werden. Wir zünden hier absichtlich nur die Laterne des gesunden Menschenverstandes an, bevor wir das Erkenntnislabyrinth betreten. Wir rammen die Pflöcke ein für Pfahlbauten am See des Unsichtbaren. Vor Beweisaufbau muß man das Gelände abstecken, von wo er beginnen soll.
Schon die Annahme eines letzten Ursachgrundes, ohne den keine Wissenschaft denken kann, bedeutet einen Energiewillen, der sich in Marsch setzt. Bewegung ohne Willen kann es nicht geben, so wenig wie der Arm sich ohne Gehirnvorgang hebt. Alles hat ein Woher, warum soll nur das All kein Warum und kein Wozu kennen, ziellos seine Massen angehäuft haben? Umgekehrt schiebt menschlicher Unverstand dem Unendlichen endliche Funktionen unter: Gott will »sich ausdrücken« oder »träumen, spielen« oder »Erfahrung gewinnen«, wenn er die Welt darstellt? Ihm solche Bedürfnisse zuzuschieben ist naiv. Er fühlt sich zu »einsam«, so daß er notgedrungen unzählige Seelen aus seiner Allseele produziert? Wer so denkt, besudelt leidig das Eine, das immer zugleich Eins und All bleibt. Plotin griff hier ungeschickt daneben. Oder führt der Eine in den Vielen vor sich selbst eine Maskerade auf? Solche kindischen Ratereien sind notwendig anthropomorphische Täuschungen. Doch ein notwendiges Warum zu leugnen, weil der kleine Mensch es nicht erfassen kann, ist eine Frechheit, die nur von ihrer Dummheit übertroffen wird. Wahrlich, es gibt ein Warum für jedes Was und Wie, nur hier so unaussprechlich erhaben, daß selbst der erleuchtetste Seher es nur in dämmernden Umrissen ahnt. Allerdings muß Gott schaffen wie das Genie, das ohne Schaffen kein Genie wäre, diese Analogie ist um so sinnbildlicher, als das Genie nur zur Selbstveranschaulichung schafft. Leonardo erkannte schon bald, sein Abendmahl werde eindunkeln, doch selbst wenn es sofort nach Vollendung hätte vergehen müssen, hätte er's doch geschaffen und Shakespeare seine Dramen geschrieben, wenn er gewußt hätte, die Manuskripte würden verbrannt werden. So darf man nicht abweisen, daß innerer Zwang das Absolute zum Schaffen nötigt als einer seiner Funktionen. Doch da dies Weltschaffen auf viel subtilerem Wege geschieht, als Götzentheologie sich träumen läßt, dürfen wir weder hierin das volle Warum vermuten noch auch im Christussymbol der Selbstkreuzigung Gottes, wieder nur einem Teil der möglichen Wahrheit. Jesu Geheimnis »Ich und der Vater sind eins« konnte die plumpe Menschheit nur götzendienerisch mißverstehen, wir aber erkennen, daß Kreuzigung und Himmelfahrt eine Notwendigkeit der Allökonomie sein müssen, genau so wie Schlaf und Wachen, Tod und Leben. Nur Pietätlosigkeit unterfängt sich, naseweise Fragen an den Einen zu stellen, Er wird schon wissen warum, wie soll das Endliche im Staubkleid das strahlende Unendliche verstehen! Wer ununterbrochen in grelles Licht blinzelt, erblindet. Sehe er lieber so weit, als sein Sehvermögen reicht, da lernt er schon genug. Gott sei uns Narren gnädig! wäre das passende Gebet gelehrter Zöllner, die mit plausibler Materialität den Welträtseln beikommen und dem Unerforschlichen ins Handwerk pfuschen.
III
Schon Heraklit und die Pythagoräer lehrten zyklischen Rhythmus der Allbewegung, Vedanta und Buddhismus bauten es schon in Zahlen auf. Ein Großjahr bedeutet 360 Erdjahre, ein Großzyklus 4+320+000, 71 Großzyklen ergeben Manvantara, teilweise zeitliche Auflösung, 14 Manvantaras wieder in 71 Zyklen unter dem Namen Kalia setzen die Zerstörung fort, 36+000 Kalias ergeben Maya-Praylaya: Zurückziehung aller Manifestation in den Einen. Das sind die »Nächte Brahms«, Einatmen des Daseinsodems in den Einen zurück, sogleich gefolgt von erneutem Ausatmen in neuen Zyklen der »Tage Brahms«, gleich lang wie die Nächte. So schwingt sich das Rad des Vergehens und Entstehens von Planet zu Planet, Tätigkeit und Untätigkeit wechseln wie Wachen und Schlaf. Sind wir so denkerisch befriedigt? Nicht ganz! Nach okkulter Auffassung ist Schlaf kein vermindertes, sondern gesteigertes Leben, Nacht hat Reize wie Tag, der Begriff Tage und Nächte deckt sich nicht damit, wenn Nacht des Manvantara wirkliche Götterdämmerung bedeuten soll, zeitweiliges Wegwischen des Weltbildes. Denn ein untätiger Weltgeist ist undenkbar, ein Nichts ebenso. Man könnte sich nur Einsaugen alles Sichtbaren in den Äther vorstellen, damit ist aber die Welt nicht aufgehoben, sondern besteht als Äther fort, natürlichster Aufenthalt für Nirvanaerlöste. Wo bleibt aber, was als Leben sich tummelte? Eine dem Manvatara verfallene Welt war nach indischer Vorstellung nicht mehr lebensfähig, der versinkende Planet durch angehäufte Karmaschuld in den Abgrund gezogen. So einst der Erdteil Atlantis, dessen Bewohner als Mechaniker und Elektriker schwarze Magie trieben, nach welchem 4. Zyklus allmählich der 5. ins eiserne Zeitalter Kali Yuga eintrat »an age full of horrors« (Blavatzky), dessen Früchte Weltkrieg und Weltrevolution. Gehen wir teilweisem Manvantara entgegen, wohin wandern die unzähligen selbstverdammten Seelen, so weit vom Nirvanaäther entfernt, und wohin erst, wenn die volle Nacht des Brahm hereinbricht und kein Planet mehr Wohnorte gewährt? Wie stimmt dies zu der Lehre, daß erdgebundene Individuen in wenig Jahren, sogar wenig Tagen zur Erde zurückkehren, wenn doch keine Erde mehr ist? Fortgeschrittene Seelen ruhen für Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende in höheren Ebenen, bis die Menschlichkeit ihr Niveau erreichte? Doch wo bleiben die höheren Ebenen, wenn alles Nacht bedeckt? Wir dürfen unmöglich Manvantara in solchem Sinne auffassen, das Sichtbare mit Unsichtbarem verwechseln. Letzteres kann nie und nimmer für eine Sekunde seine Tätigkeit einstellen, ob auch der Schein des Sichtbaren vergeht. Man denke sich also unter Einatmen Brahms eine andere Ordnung der Dinge, die über menschliches Denken geht, doch keine Nacht, kein wirkliches Schlafen des Weltwillens. Die sieben übernatürlichen Kräfte der indischen Adepten scheinen nicht übernatürlich genug, um hier das Mögliche geschaut zu haben.
Steigen wir aus höchsten Regionen des Alldenkens zu dem herab, was Menschen Natur nennen, wie kann eine an die Erde gefesselte Wahrnehmung Allgesetze entdecken? Linné sagt: »Die Natur bleibt sich immer gleich.« Ein kurzes Schlagwort, das zwar der Evolutionsphrase den Kopf abschlägt, doch den steten Stoffwechsel der Natur allzu summarisch abtut. Als Botaniker durfte er dies nicht mal formal behaupten, denn mannigfache Metamorphose der Pflanzen ergibt keine unbedingte äußere Gleichung. Dagegen wird der Metaphysiker dazu Beifall nicken, daß Transformierung gleichwohl den Kern der Dinge nicht antastet, während Naturkunde nur an der Schale herumknabbert. Er wird deshalb auch den Streit über »Schaffen« oder »Entstehen« der Welt als leeres Wortgezänk verpönen. Ungenauer Begriff macht Schaffen zu etwas zeitlich Begrenztem, Entstehen zu unbegrenzt Zeitlosem, als ob es nicht grenzenloses Schaffen und beengtes Entstehen geben könne. Erschaffen des Alls auf einen Hieb wäre so, als ob man an einem Tag eine vollendete Statue aushauen könnte, nie meinten dies die alten Schöpfungsmythen. Doch Zeitmaß des Schaffens variiert von Leonardos Langsamkeit bis zu Raphaels Überproduktion, neun Jahre wollte der ungeniale Horaz an einem Opus feilen und brauchte Gott 9 Billionen Jahre zur historischen Schöpfung, so bleibt er darum doch ihr Autor. Jedes Werk entsteht, trotzdem sagt man zutreffend, daß es geschaffen sei. Alles wechselnde Entstehen in Werden und Vergehen ist ein fortlaufender Schaffensakt, statt eines einmaligen setze man nur einen ewigen Schöpfer, der täglich an seinem Kunstwerk formt. Da wir ihn nicht beobachten können, so scheint auch der Streit müßig, wie er arbeitet. Angeblich langsames Entstehen aller sichtbaren Formen stellt man triumphierend in den Vordergrund, um Mechanistik von da aus einzuschmuggeln. Natürlich kann es in der Unendlichkeit keinen einmaligen Schöpfungsakt geben, doch allmähliches Entstehen eines Gemäldes und analytische Zerlegung, daß es aus Leinewand, Kohlenstift, Farbe hervorging, machen doch nicht den Maler selber überflüssig. Den sieht man ja auch nicht arbeiten und etwa mal ins Atelier Zugelassene, was sehen sie? Sichtbare Handarbeit, nicht unsichtbaren Plan der Kunstkomposition. Wenn man Goethe beim Dichten zuschaute, sähe man nur Hand und Feder auf dem Papier: So sieht man vom unsichtbaren Schaffen in der Natur stets nur die Materialisationsbewegung. Und deren Methode? Aus Blutkreislauf und Erdmagnetismus folgerte Descartes, daß Spiralbewegung und Polarität im ganzen kreisenden All regiere, der Lehrsatz mag richtig sein, zumal Buddha es ähnlich ansah, doch was gewinnt man damit? Untersuchung äußerer Mittel. Daß der Maler die Palette nicht verkehrt hält, Pinsel und Farbentuben benutzt, so weit in Wissensmacht sind wir schon. Doch die Leinwand des Ätherraums koloriert nicht selber die dort vorgezeichnete Komposition, auch behaupten Eingeweihte, daß manchmal eine mißlungene Linie weggewischt und ein störender Fleck übermalt wird. Wer aus solcher weisen Erforschung mechanisches Entstehen eines aus unsichtbarer Vorstellung des Kunstingeniums Entsprungenen begründen wollte, setzte sich dem Gelächter jedes Schuljungen aus. Das überhebt uns der Mühe, dies ironische Gleichnis weiter auszumalen. Ob wir den Bildner »Gott« oder »Nous und Logos« benamsen, hat nur für Kunstgelehrte Wichtigkeit, Name ist Schall und Rauch. Don Quixotes Wissenschaft attackiert auf dem Rosinanteklepper »Naturgesetze« alle möglichen Windmühlen, reitet Bleisoldaten der Pseudoreligion reihenweise nieder. Indem sie aber das Schlachtfeld zu behaupten wähnt, verwandeln sich die leblosen Figürchen plötzlich in lebendige Körper und schießen den vermeintlichen Sieger tödlich in den Rücken. Denn jenes Spielzeug der Kinderstube war doch Nachahmung wirklicher Soldaten, unsichtbare Wahrheit wird nicht aus der Welt geschafft, weil man sie stümperhaft versichtbaren wollte.
Tritt jemand zu stürmisch in einen Antiquitätenladen, schlägt er wohl unvorsichtig Tassen und Kelche vom Regal herunter, doch das Geschädigte braucht darum noch nicht Meißner Porzellan und Gold zu sein, die Schadenersatzrechnung richtet sich danach. Den Anempfehlern des Buddhismus, als ob er der Stein der Weisen und ein Kobrastein für alle Giftwunden sei, schauen wir geradeso auf die Finger wie den Kirchenchristen, und was wir herunterschlagen, ist billige Schleuderware gefälschter Reliquien, die man für Naive feilhält. Doch machen wir gewiß nicht Reklame für moderne Kaufhäuser des Westens, wo man statt solider antiker Eichenmöbel nur elegant geschmacklosen Pofel verkauft, das Antiquariat enthält trotzdem manch wertvolles Stück, das wir gebührend taxieren. Indessen haben achtarmige Buddhabroncen und elfenbeinerne Kruzifixe nur noch Liebhaberwert auf modernen Auktionen. Die kunstfremden mosaischen und islamitischen Semiten verdammten die arischen Christen als heidnische Götzendiener, weil deren Kirchenbilder die Götterstatuen fortsetzten, doch sie selber erklärten den Menschen für eine Götterstatue »Abbild Gottes«, welche Blasphemie nur den Spott wachruft: Ein netter Gott, wer solcher Kreatur gleicht! Mit solcher Selbstvergötzung räumte die Moderne nicht auf, sondern verstärkte sie. Nicht auf Heerstraße der Alltäglichkeit, sondern durch Schnee und Eis klimmt man zum Gipfel des Gaurisankar, wo man dem Äther näher zu sein scheint, doch Äther und Gaurisankar sind beide nur Veranschaulichung eines Unnahbaren und Alldurchdringenden, des Unsichtbaren.
Nach der Art eines Schwindlers versteckt der Materialismus seine Kurpfuscherei, indem er das Unsichtbare frischweg als Phosphoreszierung des Sichtbaren auslegt, obschon umgekehrt der Leichnam des Stoffes nur durch unsichtbare Kraft galvanisiert wird, ewige Auferstehung des Lazarus aus Starrkrampf und Scheintod. So verletzt die Wissenschaft sogar ihren eigenen Denkkreis, denn sie gibt zu: jede Verschiebung oder Verpolsterung unseres Sehvermögens würde uns Neues sichtbar, Altes unsichtbar machen, bisheriges Naturbild umstoßen. Was man zuversichtlich glaubte, würde unwirklich, das Bestrittene wirklich. Welche Stoffwirklichkeit soll die hochgelahrte Hirnsubstanz nun anerkennen, zumal ihre Optik nicht auf dem Augeninstrument, sondern dem eigenen Hirnsehnerv beruht? Sehen selber ist also ein unsichtbarer psychischer Akt, das innere Gesicht kann von sich aus eine schönere als die Außenwelt schauen, weshalb die Alten sich den Seher blind dachten. Wer telepathisches Hellgesicht anzweifelt, muß wenigstens zugeben, daß unser Natur-einseitiges Gesichtsbild ist, einseitige Ausbildung äußeren Schauens alle Vorgänge optisch färbte, während Hör-, Tast-, Geruchsinn ebenso verkümmerten wie die Instinkte. Jedes Tier weiß vorher, wenn ein Erdbeben kommt, der Mensch hat nicht mal politische Erdbebenkunde des Sichtbaren. Je schlechter des Menschen Sinnesorgane werden, desto eifriger konstruiert er sich eine Weltanschauung die auf sinnlicher Wahrnehmung beruht. Aller Rationalismus sollte Kurzsichtigkeitsbrillen tragen, das wäre die treffendste Symbolik.
Gewiß, beim Oberbewußtsein walten physische Scheinparallelismen, jeder gewöhnliche Bewußtseinsakt läßt sich auf sinnliche Wurzel zurückführen. Doch da Zeit, Raum, Kausalität bei Tranceentfesselung des Unterbewußtseins einstürzen, wird die Basis des Oberbewußtseins wie von einem Erdrutsch fortgeschoben und die Psyche müßte in den Abgrund fallen, da ein oberes Stockwerk das untere zu begraben pflegt. Offenbar verwischt aber Ober und Unter den richtigen Standpunkt, daß Ober- nur ein in Haft geschlagenes Unterbewußtsein vorstellt und beide scheinbar unvergleichbaren Psychemanifestationen nur den Standort wechselten. Beim Unbewußten herrscht keineswegs völlige Befreiung, Hellgesicht sieht indirekt doch immer räumlich kausal, das nämliche Bewußtsein verschob nur seine Sehensfläche. Telepathie ist nur ein Merkzeichen, sich aufs Transzendente vorzubereiten. Dem Ich fehlt jeder Maßstab für das, was auf einer ihm fremden Plattform vorgeht: Ehe man nicht im Flugzeug sitzt, kann man sich Luftreise nicht vorstellen, gleichwohl bleibt der Flieger der gleiche Mensch, wie der auf festem Boden ihm Nachschauende. Das als unnütz und nichtig verworfene Ichbewußtsein hängt mit dem Unbewußten geradeso organisch zusammen wie Wurzel und Wipfel, äußeres Wachstum löst nicht die Identität. Was drunten im Dunkel der Wurzel als Ursache des Baumes lebt, ahnt nichts vom Wipfelgefühl im hellen Licht und doch durchzittert das nämliche Leben den ganzen Stamm und all seine Blätter. Man muß beide Extreme der Materieanbetung und Materieableugnung berichtigen, jeder Materialisierung ihr Recht lassen, auf höherer oder niederer Wahrnehmungsebene ein psychisches Gesetz auszudrücken. Doch des unsichtbaren Gesetzgebenden jeweiliges Gebundensein an Materialisierung für ihr Wesen halten, heißt einen elektrischen Draht mit dem Element Elektrizität verwechseln.
IV
Ebbinghaus' »Abriß der Psychologie« (1914) kann weder Entstehen einer Vernunftidee erklären, noch »Eigenart« als Selbsterhaltungstrieb ausschöpfen. Als ob nicht umgekehrt das stolze Behaupten der Persönlichkeit die äußere Selbsterhaltung im Lebenskampf gefährdete! Methodische Einschachtelung in Allgemeinheiten entwurzelt nicht die Herrschaft des Individuellen bei ganz verschiedenem Reagieren auf Materieeindrücke, während bei sinnlicher Mechanik alle Eindrücke gleichmäßig wirken müßten. Wir könnten eine Reihe grundlegender Tatsachen anführen, wonach das Leben in der Psyche eine Korrektur besitzt, um sowohl der Lust als der Unlust äußerer Reibung zu widerstehen. Schält man das moderne Psychologiegerede klar heraus, so sei alles, was Ethik heißt, nur Gemeinsinn, verhüllt durch einen aus Gewohnheit vererbten Selbstzwang, der sich einbildet, aus eigenem Antrieb sittlich zu handeln? Kants abstruser kategorischer Imperativ wäre somit, wenn wir dies nachdeuten, praktischer Niederschlag der Gemeinbürgschaft, unbewußt ihres Zwecks: Erhaltung der Art? Solche Phraseologie vergißt, daß das Ich nur auf Erhaltung seiner selbst, nicht der Art bedacht bleibt, daß der Durchschnittsmensch die Zweckmäßigkeit des Gemeinsinns heimlich nicht anerkennt. Ein aus Gewohnheit vererbter Selbstzwang zum Sittlichen als Vorschule des Gemeinsinns ist eine Fiktion, nur das Ungewohnte und gar nicht Vererbbare steigt als höherer »Manas«, wie der Inder unterscheidet, aus dem Unbewußten empor und zwingt zu altruistischer Selbstaufopferung in vereinzelten Exemplaren, was nur durch Karmalehre verständlich und mit irgendwelcher Mechanistik unvereinbar ist.
Adlers Psychoanalyse, man gleiche Minderwertigkeit in einer durch Mehrwertigkeit an anderer Stelle aus, beutet Wirtz in einer Rundfrageschrift über Krüppel (1919) aus: »Gilt vom verwachsenen Michel Angelo dies Gesetz des Ausgleichs?« Da 99% der Genialen nicht verwachsen und 99% der Krüppel nicht hervorragend begabt sind, auch ethisch Ersatz von Häßlichkeit durch Seelenschönheit nur selten zutrifft, so entspricht dies der köstlichen Logik: weil einige Genies Abnormitäten zeigten, drum sind alle Normwidrigen Genies. Siehe auch die oberflächliche vorschnelle Übertreibung »Genie und Wahnsinn«, deren sich Lombroso, der als Spiritist endete, später selbst geschämt haben muß, denn der Prozentsatz wirklich »verrückt« gewordener Genies ist abnorm gering. Wir könnten dies ganze Thema durch reiche Erörterung zergliedern, haben aber hier nicht Anlaß zu solchen Aufzählungen und betonen nur kurz, daß Byrons besondere Verbitterung (Klumpfuß bei apollohafter Schönheit, ein ganz abnormer Fall) weder seinen Edelsinn und Heldenmut schmälerte, noch seine echt englisch-nationale Weltschmerzpoesie wirklich beeinflußte. Alle seelischen Eigenschaften sind völlig unabhängig von Umständen der Materie. Angeborene Gutheit wird angemessen handeln auch ohne religiöse Vorschrift oder Pflichtimperative, doch selbst Zweckmäßigkeitspolitik kann Selbstsucht nicht zu Gemeinsinn erziehen, wie halsstarrige Unbelehrbarkeit von Kapitalisten und Arbeitern gleichmäßig lehrt. Gerade Altruismus, die höchste Blüte »guter Gesinnung«, als deren ursprüngliche Grundlage aufzufassen, zu solcher Verschrobenheit versteigt sich diese weltfremde Psychologie im heißen Bemühen, Ethik rationalistisch auszudeuten! Ähnlich impfte Demagoge Eisner den dummen Massen das Gift ein, jeder Mensch werde als Genie geboren! Mit solchem ekelhaften Blödsinn sucht man die jeder Biologie im Wege stehende Ungleichheit aus der Welt zu schaffen. Der Streit, ob erworbene Eigenschaften vererbbar oder nicht, verrät die innere Unsicherheit, denn erkenntnistheoretisch besteht überhaupt keine Verschiedenheit von Vererbtem und Erworbenem, da alles, was Eigenart kennzeichnet, nur »erworben« sein kann durch Karmafügung. Selbst Spezialanlage eines bestimmten Berufstrebens durch erworbene Familienanpassung vererbt sich äußerst selten. Darwins Großvater und die drei Maler Vernet dürften wohl das einzige bekannte Beispiel sein. Genie vollends vererbt sich weder, noch wird es geerbt. Keiner wird je ergründen, wie Napoleon, Cromwell, Byron, Leonardo oder Proletarier wie Luther, Fichte, Kant, Petöfi, Burns, Faraday, Keats, Dickens aus so unbedeutender Abstammung unvermittelt hervorgingen. So steht es bei allen Bedeutenden.
Frau Rat gebar nicht den Faust, der schlaue Philipp und die wüste Olympias produzierten gewiß nicht die poetische Genieromantik Alexanders. Der Gründer des Preußentums bot den schreiendsten Gegensatz zu seinem elenden Papa und der schöngeistigen Mama, seine Tochter Wilhelmine malt ihn in ihrer Menagerie fürstlicher Paviane und Meerschweinchen nur als höheren Gorilla, und wenn sie einseitig übertreibt, so stimmt Treitschkes Verhimmelung des rasenden Staats- und Haustyrannen gewiß nicht zum hysterisch-pathologischen Temperament dieses ins Deutschpedantische übersetzten Peter der Große, dem die versöhnenden Züge des seltsamen russischen Gewaltmenschen mangeln. Was außer zwangsweiser Anpassung an das überkommene Staatsmilieu Friedrich der Große von ihm und der intriganten eitlen Mutter geerbt haben soll, wissen die Götter. Auch hilft hier der beliebte Biologensprung nach rückwärts zu Großmutter und Urgroßvater nichts, denn hier könnten allenfalls Ansätze geistiger Struktur übertragen sein, nie und nimmer aber ihre Verarbeitung zu einer völlig verschiedenen Eigenart von unermeßlich höherem Umfang. Dagegen waltet freilich bei seinen und Napoleons Geschwistern anscheinend die natürliche Vererbung, was den Geniefall erst recht unerklärlich macht, und Jesus weist Eltern und Brüder ab: »Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder?« Der heilige Geist senkt sich plötzlich auf ein Ich ganz außer der Reihenfolge seines Geschlechts. Kaiser Titus war Sohn und Bruder schlechter Menschen. Die unzähligen »übernatürlichen Phänomene« im genialen Menschen seit Sokrates' Dämon, der so sein Unbewußtes personifizierte, sind so verbürgt, daß der Astronom Herschel, dem wir auch ein religiöses Gedicht von tiefherzlicher Selbsterlebtheit verdanken, aussagte: »In unserem eigenen Organismus arbeitet eine Intelligenz, verschieden von derjenigen unserer sonstigen Persönlichkeit.« Auch die plötzlichen Bekehrungen, die »Metanoia« des alten Adam, die scheinbare Umkehr des innersten Menschen aus dem Unbewußten heraus, sind spontane inkommensurable Größen, die weder mit Zweckmäßigkeit noch vorher unhörbaren Imperativen, sondern nur durch das Karmagesetz erklärt werden können als Erwachen einer präexistenten Kausalität. Wie unbedeutende und schlechte Eltern oft bedeutende und gute Kinder haben, so können bedeutende und gute Eltern oft unbedeutende und schlechte Kinder haben, was bei Identität vom Physischen und Psychischen unmöglich wäre. Die psychischen Eindrücke der Schwangerschaft können jede natürliche Vererbung selbst im zoologischen Sinne umstoßen, z.B. ein schönes Gesicht von häßlichen Eltern stammen, wenn die Schwangere fortwährend inbrünstig einen Apollo anschaute. Umgekehrt wirken ungünstige seelische Einflüsse: häßliche Kinder schöner Eltern. Selbst jene Hypnose, die eine Masse selbstsüchtiger Einzelner gegenseitig mit Opfermut für Religion, Vaterland, Befreiung ansteckt, beweist die Übermacht der »Ideen«. Das ästhetische Bedürfnis, wahrscheinlich Urgrund des sittlich Schönen, wie denn Plato »schön und gut« zu einem einzigen Doppelwort verband, steht als begehrungslose Freude ohne jede Beziehung zum materiell Zweckmäßigen, hiermit aber außerhalb sinnlicher Mechanik. Wunschloses Anschauen der Welt in ästhetischem und sittlichem Gefühl läßt sich als Ideenbildung nur mit Einwirkung der Äther-Weltvernunft zusammenreimen, nie mit gleichmäßiger Zweckmäßigkeitsmechanik zur »Erhaltung der Art«. Denn jeder Idealismus beeinträchtigt die Erhaltung des Ich und damit der Art im ordinären Kampf ums Dasein. Allerdings nur scheinbar, denn der Idealismus züchtet eine höhere Art neben den ihm völlig ungleichen Vielzuvielen. Wie aber dies Züchten im vollsten Widerspruch zur Materie möglich sei, vor dieser Problemstellung muß selbst der denkunfähigste Materialismus die Waffen strecken.
Im Grunde beruht er wie der gegenstandslos gewordene kirchliche Aberglaube auf Personenglauben, indem er die Materie wie eine konkrete Person unterschiebt. Indessen ist sie so wenig konkret wie das Ich, sondern nur ein abstrakter Schulbegriff für das sinnlich Wahrnehmbare, so verschwommen und trügerisch, daß es sich durch nichts beweisen läßt als wieder durch sinnliche Eindrücke. Helmholtz sagt einmal: Wenn er sich an den Tisch stoße, so sei diese Materie doch da und nicht wegzudisputieren. Aber nichts ist an und für sich da als der subjektive Eindruck auf die menschliche Haut, und die Immunität des Fakirs gegen viel gefährlichere schmerzhafte Angriffe lehrt genügend die Unzuverlässigkeit der Empfindung. Denn wenn ein Zustand möglich ist, wo die sonst erfahrungsmäßigen Bedingungen aufgehoben werden, so zeigt das materielle Fühlen ein Janusgesicht, das sich nicht unter einen Hut bringen läßt. Ob also die Kirche einen persönlichen Gott oder die Naturforschung die persönlich empfundenen Naturphänomene anbetet, so bleibt beides gleich anthropomorphische Einbildung. Ob die »Natur« nichts als subjektiver Schein oder halbe Wirklichkeit sei, keinenfalls kann sie mehr als relativ sein, gerade weil wir sie nur sinnlich wahrnehmen und doch das Unvorstellbare zu erkennen glauben. Denn Materie als Allgemeinbegriff ist gerade so sinnlich unvorstellbar wie das Transzendentale, der Physiker also ein ähnlicher Charlatan wie der Theologe, sobald beide etwas sinnlich Vorgestelltes mit naiver Gewißheit als positiv »offenbart« unterschieben. Wer verderblicher, Wissenschaftspfaffen oder Priester, läßt sich kaum entscheiden, beide sind Früchte vom gleichen giftigen Upasbaum der Verblendung. Nur wer ihm den Rücken wendet, wird Byrons Vers »der Baum der Erkenntnis ist nicht der des Lebens« umprägen: wahre Erkenntnis ist das ewige Leben.
Descartes' »Ich denke, daher bin ich«, heißt ebenso klar: Ich bin, daher denke ich. (Sein und Denken sind das nämliche, selbst die Pflanze denkt: je höher das Denken, desto höher das Sein.) Schon er erkannte, daß Bewegung und Ruhe nur Zustände, nicht Gegensätze sind, Licht nur Ausstrahlung unwägbarer Substanz, Sehkraft in Gehirnmolekülen verlegt. Ja, natürlich! Jedes auf wahres Naturschauen eingestellte Auge schaut immer nur Einheit: Von Bewegung mit Ruhe, von Licht mit Äther, von Auge mit Licht, von äußerem Augennerv und äußerem Licht mit innerem Gehirnlicht! Die Ameise aber denkt nicht mit einem Hirn, sondern einem Klümpchen Rückenmark, die Insekten haben mehrseitige Augen, sehen also Welt und Farben anders als das angeblich mit einem Streifen Farbensubstanz ausgestattete Menschenauge, dem Papagei lösen nicht Brocasche Windungen die Zunge, obschon es sich auch bei ihm lediglich um Gehirnvorgang handelt. Das Pferd mit seinem großzügig konstruierten Hirn scheint einen sechsten Sinn zu besitzen, der vor uns unsichtbaren Dingen »scheut«. Anatomie menschlicher Gehirnfunktionen ist daher denkerisch zwecklos, weil die Psyche höherer Tiere auf anderer Basis beruht und die nämliche Allvernunft sich ihnen in anderer Weise mitteilt. Sie als »Automaten« zu betrachten wie Descartes oder sie mit dem fiktiven Begriff »Instinkt« abzuspeisen ist Rückständigkeit, übrigens auch ein Schlag ins Gesicht monistischer Erkenntnis.
V
Schon Goethe wußte, daß »Licht und Auge das nämliche« seien, doch Herder ahnte mehr: Gleichheit von »Licht, Äther, Lebensbewegung«. Unter gewissen Umständen erzeugen die Ätherwellen Licht, unter andern Elektrizität, unter wieder andern organisches Leben und hieraus in Steigerung der Bewegung alles Immaterielle des Lebensprinzips, nämlich Vernunft, Idee, Genie, d. h. den »höheren Manas« der Inder, untrennbar vom Weltäther. Dagegen hilft Ausdeutung der Farben als Lichtschwingung nichts für unser eigenes Weltbild, denn die Farbenempfindung ist rein subjektiv und je nach Stellung des Auges und Anlage des Hirnnervs verschieden. Die Physik leistet also wieder nichts als Beschreibung eines Vorgangs, der selber keine objektive Wirklichkeit bedeutet. Rot erregt die Rinder vermutlich als Blutfarbe durch Instinktassoziation mit Blut, als ob Tradition von Schlachthäusern ihnen okkult zugänglich sei. Hunde schnappen nach fleischfarbenen Röcken, auch Katzen sehen rötliche Speisen als blutig. Demnach sehen die Tiere Blut und überhaupt Rot wie wir? Nicht unbedingt, sie können auch darin eine beliebte andere Farbe sehen, die ihre Gier und Wut erregt. Das Rindvieh wird aber wohl nicht politisch als Antimarxist Rot hassen! Da ist nun bedeutungsvoll, daß Rot tatsächlich in okkulter Aura die Farbe böser Leidenschaft bedeutet, man könnte also folgern, daß die Tiere gleichsam symbolisch »rot sehen«. Jedenfalls empfinden sie an Blut erinnernde Farben gemeinsam als einen Komplex wie wir eben Rot, und daraus folgert, daß die Lichtwirkung genau wie beim Menschen einen Farbeneindruck hinterläßt, sie daher eine der unsern sehr ähnliche Außenwelt sehen von gleicher relativer Realität. Diese ist also auch »Vorstellung« des Tieres, womit alle anthropomorphische Eitelkeit zerfällt. »Die Tugend ist nur, weil ich selber bin« (Tieck) könnte auch ein gelehrter Papagei empfinden, wenn er es soweit in philosophischem Kursus brachte! Es gibt zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen wesentlich nur quantitative Unterschiede der Vorstellung, nicht qualitative, wobei obendrein noch wahrscheinlich, daß die besser entwickelten Sinne vieler nichtmenschlicher Wesen ein quantitativ reicheres Bild der Außenwelt haben. Über solche denkerische Beobachtung, die den Menschen äußerlich ganz ins Tierreich stellt – ein gelehrter Elefant könnte eines Tages durch den Rüssel trompeten: »der Dschungel ist meine Vorstellung!« –, darf aber der Materialist nicht frohlocken, denn alsbald tut sich eine andere Logik auf. Diese so wenig von der tierischen verschiedene Sinnesvorstellung steigerte trotzdem den »Geist« so ungeheuer, daß nun zwischen Jesus oder Leonardo und der höchsten Tierpsyche ein Abgrund klafft? Was folgert unabwendbar? Daß alles, was den Menschen über die Außenwelt erhob, nicht erfahrungsmäßiger, jedem Tier zugänglicher Wahrnehmungsvorstellung entstammt, sondern unbekannten unsichtbaren Ursachen. Abstrahieren wir sämtliche Sinne, würde diese Psyche sich dennoch eine Innenvorstellung schaffen, selbstherrlich unabhängig von der Außenwelt. Entspricht dies nicht sogar Mills Logik, man müsse Unwesentliches eliminieren, hier also das mit dem Tier Gemeinsame. Wichtig bleibt nur die metaphysische Erfassung des Lichts als einer alldurchdringenden Emanation unsichtbarer Kraft, und wenn Goethe sogar die sichtbaren Strahlen als »Abstraktion« betrachtet, so ahnt er damit die Einheit und Immaterialität der allgemeinen Lichtquelle, denn was wir als Licht empfinden, ist genau so abstrakt unwirklich wie die Farbe, wirklich nur die unsichtbare Einheitskraft, für welche »Licht« selber nur eine Teilschwingung bedeutet. Genau so wie die Sonne fernwirkend auf der Erde Lebenskeime ausbrütet, zu welcher Materietat ein immaterielles Gebot sie treibt, so erhält das Ich durch Berührung mit der Welt den Anstoß, auf der Grenzscheide des sinnlichen Verstandes das Unsinnliche aufblitzen zu lassen. Durch die Zündschnur des Ätherlichtes bringt die Weltvernunft dies Pulverfaß zur Explosion der »Ideen«, dafür muß aber eben schon Pulver vorhanden sein, nämlich die Ansammlung der Vernunft (des »höheren Manas«) im Unbewußten, dem nun freier Zugang zum Äther geöffnet wird. Doch selbst klarste Erleuchtung denkt nur in Gleichnissen, in endlichen Relativbegriffen unendlicher Ahnung. So ist »Licht« nur ein Symbol wie alles Physikalische, während man alles Immaterielle zugleich physikalisch auffassen kann. Alles Unvergängliche ist nur ein Gleichnis, alles Vergängliche ist unvergänglich, das scheinbar Unzulängliche immer Ereignis, das Unbeschreibliche nicht »hier«, sondern immer und überall getan. »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein sinnliches Gleichnis machen,« dies monotheistische Gebot gilt auch für monistische Einheit.
Descartes, ohne je in Materienwahn zu verfallen, von unbedingter Tatsächlichkeit und Notwendigkeit Gottes durchdrungen, verbannte ihn aber, vom Kosmos abgesondert, gleichsam auf eine einsame Insel, sonst hätten die Jesuiten ihm den Ellenbogenraum für Aufdeckung des äußeren Naturmechanismus verdorben. Auch bei Bruno schielt vielleicht Einiges, worauf Chamberlain übelwollend verweist, nach der Inquisition hin und auf Kants »Dunkelheit« färbte wohl auch die staatlich-kirchliche Hemmung ab. Könnten aber Descartes, Bruno, Kant sich mit Plato, Goethe und dem aus starrer Mechanistik zuletzt zu mystischer Denkart durchgerungenen Leonardo besprechen, so würde sich ihre Übereinstimmung trotz verschiedener Methode herausstellen und indische Urweisheit darüber den Segen sprechen. Denn auch im höchsten Denken waltet geistiger Monismus, die Weltseele weist ihm deterministisch immer das gleiche Endziel. Gerade durch Anerkennung der unfreien Determiniertheit tront die Einheit von Welt und Ich, Gott und »Seele« und hiermit die Idealität des Lebensprinzips auf erhebender Sicherheit. Transzendentale Freiheit entsprießt aus Notwendigkeit alles Geschehens. Intuitive Eingebungen wollte Goethe als freies Geschenk der Götter mit ehrfürchtigem Dank betrachtet wissen, doch auch hier ergänzt sich das Freie mit dem Notwendigen. Denn wie die Materie uns sinnliche Wahrnehmung erweckt, so stellen Ideen nur den Eindruck einer stofflosen Wahrnehmung dar, die sich als Ätherstrahl elektrisch vollzieht, von so erhabenem Ursprung, daß ihnen dann wohl »gesetzgebende« Macht (Kant) innewohnen mag, was sonst nur sträfliche Anmaßung des menschlichen Denkens wäre. Ideen sind nicht Produkte einer »produktiven Einbildungskraft«, womit Kant plötzlich die Vernunft ausstattet, als ob derlei ohne die sonstige Ichbedingtheit im Bewußtsein möglich wäre, sondern Empfängnisse aus einer Sphäre vom gleichen Stoff wie die Ideen: einer transzendenten Ideenwelt »geistiger Naturen«.
Ohne Erfahrung gibt es keine Wahrheit? Wie könnte dann etwas jede Erfahrung Überfliegendes Wahrheit besitzen, wenn nicht eine unsichtbare Erfahrungswelt zugrunde läge? »Ein Begriff, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee,« dann wäre sie wahrheitslos, doch beanspruchen Denker und Religionsstifter: »Ich bin die Wahrheit.« Ist dies relativ wahr, müßte eben Kant eine außer- und innerhalb der Materie bestehende vierte Dimension gelten lassen, und da dort Notwendigkeit geradeso regiert wie im Sichtbaren, so kann die Idealität im Menschen nur auf Spiegelung des Transzendentalen beruhen, das der Äther durchs Medium der Elektronen in das Selbst, eine Partikel des Welt-Selbst, hineinstrahlt. »Wir können nur verstehen, was wir selbst machen können?« Dann wohnt der Idee eine Schöpferkraft inne, die keinem Geschöpf der Materie zukäme, wohl aber einem Strahlenleiter aus dem Äther. Der Verknüpfung von Ich und Materie steht eine noch festere Einheit von Seele und Allseele gegenüber. In ein falsch konstruiertes All der Widersprüche, wo in Mechanik die Idee als Mädchen aus der Fremde hineinschneit, wagen Naturforscherhypothesen eine Luftschiffahrt, wo sie als erfahrungslose und höchst inexakte Vagabundinnen im stickstofflosen Ätherraum ersticken müßten, wenn sie nur allzumenschliche Töchter der Materie wären. Sie leben aber herrlich und in Freuden, Kants längst angefochtene Nebelkosmogenie am fidelsten, denn auch die sinnliche Naturerscheinung tut ihnen den Gefallen, sich ihnen so darzustellen, wie es für sie paßt. Für neueste Physik lösen sich die Atome in bloße Wirbelbewegung und ein nur mechanisch mitbewegtes Leben müßte sich in Horror Vacui verzehren, ohne je Immaterialität selbstherrlicher Ideen hervorzubringen. Daß ihm dies möglich, beleuchtet blitzartig das wahre Geheimnis: Drahtlose Telegraphie mit einer Kraftzentrale, die sich nach Bedarf als Telepathie, Idee, Genie entladet und deren das All durchschießende Ausstrahlung sich das Leben als elektrische Maschinerie erfand. Von solcher sichtbaren Stofflichkeit geht unendliche unsichtbare Kraft aus, unzerstörbar an sich, ob auch die Maschine einzeln stoppt. Diese allgemeine Elektronenvernunft beweist unwiderleglich die Immaterialität des Lebens, zugleich aber ein höchstes Wesen im All, dessen Strahlenblitze ununterbrochen das Materiedunkel umleuchten, und die Unsterblichkeit der Seelenmonade als symbolisches Abbild der Zentralleitung. Weil Materialisierung nötig und die elektrische Batterie oft repariert werden muß – ihre Verfeinerung in besonderer Sammelstelle bedeutet Genie –, deshalb das Karma der Wiedergeburt, bis solches überflüssig wird und das unbewegt im Unbewußten die Materieschwingung betrachtende transzendentale Ego sich wieder mit Gott vereint, d.h. die Elektronen der dauernd abgeschliffenen Persönlichkeit im Äther aufgehen. Die Karmalehre enthält trotz strenger Wahrung der individuellen Ungleichheit die Vielheit als Täuschung (»Schleier der Maya«), Einheit als Urprinzip, zu welchem »Nirvana« hinstrebt.
In diesem symmetrischen Bau ist alles nicht nur logisch wie bei keiner anderen Definition des Weltbildes, sondern auch viel klarer angeschaut, während ein älterer Franzose die Mathematik »dunkel« nennt und Goethe ihr »lebendige Anschauung« abspricht, welche sie geradezu aufhebe. In der Tat war ihr Ausgangspunkt anschauliche Idee, doch indem sie diese in bloße Zahlenmessung verstrickte, verriet sie die höhere Vernunft an den niederen Verstand. Sie wurde so zugleich das verwegenste Phantasieprodukt und die ausgeklügelste Abstraktion, ist Verstandesmechanik und möchte doch Freiheit über die Natur behaupten. Diese bewunderungswürdige Spielerei verwirrt daher unleidlich die Begriffe Freiheit und Mechanik. Sie läßt sich auf nichts Konkretes ein, wirkt nicht durch, sondern für Erfahrung, wie Kant von der Physik sagt, dies aber widerspruchsvoll fortsetzt: unsere Empfindung sei »was Wirklichkeit im Raum bezeichnet«. Wie kann subjektive Empfindung irgendwelche objektive Wirklichkeit ersetzen! Letztere würde hiermit ganz verneint, wenn sie nur als Scheinerfahrung des sinnlich Empfundenen auftritt. Vielmehr wird uns nur das innere Anschauungsvermögen als Ahnung einer Wirklichkeit durch das immaterielle Lebensprinzip übermittelt. Wäre der Raumbegriff »in uns schon bei der Geburt vorhanden« (Mach), so würde dadurch nur bewiesen, daß die »Welt« wünscht, wir möchten sie uns sinnlich vorstellen, weil dies ein nötiger Durchgang zum Verständnis ihrer Sinnbildlichkeit. Indessen gibt Helmholtz zu, die sog. Naturkräfte seien nur ein Objekt (richtiger Postulat) des Verstandes, Hertz resigniert sich offen: »das Scheinbild« der Naturforschung habe keinerlei »Übereinstimmung mit den (wirklichen) Dingen«. Das ist blanke Kapitulation. Wenn aber umgekehrt Kant völlig verworren »Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen vom Mechanismus der Natur« und der manchmal widerspruchsvolle Leonardo »Freiheit« als »Imperium der Natur« proklamiert, so verwechseln sie die Notwendigkeit elektrischer Entzündung von Intuitionen durch die Zentralstelle mit freier Verantwortung der Einzelseele. Beide Denker reizte ihre Milieuwidersetzlichkeit gegen Priesterscholastik zu widerborstigem Hervorkehren mechanistischer Stacheln, doch ihr im Alter über jeden Materialismus emporgereifter Denkerstolz verlockte sie umgekehrt zu unbesonnener Überhebung. Denn ihr geheimes Erkennen der Alleinheit hält die geahnte transzendentale Freiheit für gleichbedeutend mit Überwindung der unentrinnbaren Notwendigkeit innerhalb der Materie und des von ihr kausal bestimmten Ichs. Das ist Größenwahn, denn die ideenbildende Vernunft, solange sie an den Ichgeist gebunden, stellt nur den passiv empfangenden stillen Partner der Weltvernunft vor und darf von sich aus keinerlei Freiheit beanspruchen. Jede Inspiration des Genies unterfällt geradeso der Notwendigkeit wie jeder gewöhnliche Willensakt. Der vordem rationalistische Kant, den Nietzsche mit gewohnter Ungezogenheit des Un- und Mißverstehens als Begriffskrüppel verhöhnt, mußte im Alter zuletzt ein Corpus mysticum schauen, auch Leonardo Goethesche Ahnung singen hören: Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, nur unser Hirn ist trüb, unser Herz ist tot. Solchen Tiefblick gebeut kein freier kategorischer Imperativ, sondern die notwendige Kausalfolge eines einmal auf den richtigen Draht eingestellten Denkens, das einfach den Botschaften der Weltvernunft zu gehorchen hat. Wie man dies Mysterium wahrer »unbefleckter« Empfängnis für Kirchenbedürfnis sinnlich vergröberte, so sträubt sich auch das Ichbewußtsein mit Freiheitswahn gegen den Prozeß, die Scheinvielheit in das Allsein aufzulösen, d. h. die unbedingte Vorbestimmung alles Erkennens wie alles Geschehens anzuerkennen. Die Erleuchtung des Genies ist keinerlei freies Verdienst, sondern eine Art Gnadenwahl der Notwendigkeit infolge einer durch Präexistenzen verdienten Auslese einer besonders geeigneten Elektronenseele. Entzündet hingegen eine einheitliche Idee den latenten elektrischen Draht einer Massenpsyche, so verbiegt ihn bald die Trägheit der Materie, verschüttet den Anschluß an die Zentrale und schraubt ihn ab. Durchschneidet man grundsätzlich die Verbindung mit den Polen Gott und Unsterblichkeit, so steckt Kurzschluß die verschlammte Ichmaschinerie in Brand, wie Bolschewismus den Sozialismus in die Luft sprengt. Doch auf entgötterte und als Rumpelkammer mit Götzenbildern vollgestopfte Hirne kann die Ätherzentrale plötzlich vibrierende elektrische Schläge austeilen, wenn ein Genius als personifiziertes Licht mitten unter der Masse die Strahlen der Weltvernunft materialisieren will. »Wenn das Unrecht überhandnimmt, schafft Wischnu sich selbst« verkündet Brahminenweisheit das Erscheinen der Heilande als gesetzmäßige Notwendigkeit: Pfingstniederkunft des heiligen Geistes.
Selbst wer behutsam jeden Kirchenspuk bei jeder Pfingstmär ausschaltet, wird nicht die Möglichkeit plötzlicher Elektronenergießung leugnen, welche die Menschheit gleichsam mit ätherischem Öl einer Reinigungssehnsucht tauft, um Blut und Schmutz von ihr abzuwaschen. Ist die Zeit erfüllt für Wiedergeburt religiöser Erhebung? In Bereitschaft sein ist alles. Sollte Leonardos oft zitiertes »Miracolo del primo Movimento« am Ende nur Verballhornung sein für seinen wirklichen Satz über »wunderbare Gerechtigkeit des ersten Bewegungsurhebers«? So erben sich Verwechslung und Verdrehung als ewige Krankheit fort. Wer Chamberlains Anpreisung Leonardos als bloßen Außenschauer hinunterwürgt, wird gegen den Großen heimlich aufgebracht und hält ihn irrtümlich für mechanistisch. Wer aber den gewaltigen Innenschauer, dem Außenschauen nur als Werkzeug innerer Erleuchtung diente, wirklich erkennt, betrachtet es als Fälschung, daß man diesen Vorauserkenner des von uns gesuchten transzendentalen Monismus (siehe sein tiefsinniges Bacchus-Johannesbild) als Eideszeugen für antimetaphysische Hirngespinste anzurufen wagt. Ins Reich der transzendentalen Freiheit führt keine willkürliche Enterbrücke, sondern nur »göttliche Notwendigkeit, deren Wirkungen auf kürzestem Wege ihren Ursachen folgen« (Leonardo).Das Ursachlose, die Seele der Unendlichkeit, kann auch spontane psychische Wirkungen durch Herniederkunft von Ideen erzeugen, deren Ursachen über jede sichtbare Kausalität hinausreichen: die innere Notwendigkeit des Unsichtbaren.
2. Das Unwirkliche des Wirklichen.
I
Bergsons und seines Schülers Grandjean Vorwürfe gegen die Vernunft berücksichtigen nicht die radikale Ungleichheit der Anlagen, so daß man von allgemeinverbindlicher Menschenvernunft kaum reden darf. Bergson griff eigentlich nur den Verstand an, Grandjean das, was er Vernunft nennt, wobei er Begriffsschnitzler wie Spinoza meint. Plato, Bruno, Kant stehen auf anderer Stufe, obwohl Kants »praktische« keine »reine« Vernunft sein will. Kuba ist das einzige Tropenland, wo keine giftigen Schlangen und Insekten gedeihen: Gibt es Lande der Psyche, wo keinerlei Unvernunft regiert? Zweifellos das Reich der Genialität, doch Bergson und sein Schüler bestreiten, daß hier Vernunft arbeite, sondern nur Intuition, die sie streng davon unterscheiden. Sind Intuition und inspirierte Vernunft zu trennen? Was die Inder den höheren Manas nennen, kann kein Gegensatz der Vernunft sein. Allerdings läßt sich die Wirklichkeit, die hinter den Dingen steht, nur mit der Vernunft, die hinter dem Verstande ahnt, innerlich wahrnehmen. Das von Chamberlain gepriesene Nach-Außen-Schauen hilft zu nichts, richtig betont Grandjean, daß wir jedes Ding einseitig, einförmig, als Festbegrenztes nebeneinander sehen, was es notwendig nicht sein kann, und auf diesem Falschsehen Schlüsse aufbauen, so daß jede äußere Logik täuschen muß. Er übersieht dabei noch, daß der einseitig entwickelte Gesichtssinn (Tast- und Geruchsinn verkümmert, Hörsinn mangelhaft) wiederum sehr ungleich ist. Immerhin muß das Schauen des Sichtbaren so verschieden sein wie die Augen selber, allen gemeinsam nur das Nebeneinandersehen. Man versuche einen größeren Komplex anzuschauen, diese Probe wird jeden überzeugen, daß man nur einen bestimmten beschränkten Punkt des Gesichtsfeldes gleichzeitig sieht. Das Nebeneinander wird notwendig ein Nacheinander, so daß unsere Erfahrung sich aus lauter zeitlich und räumlich getrennten Bruchstückssteinchen zusammensetzt. Ist richtig, daß genau Gleiches beim Innern Schauen zutrifft? Mehr als ein Objekt und einen Gedanken kann man nicht gleichzeitig erfassen, doch genügt dies, um der Vernunft jede Fähigkeit des Erkennens abzustreiten? Wohl für gewöhnliche Verstandesprozesse, doch jede Denkervernunft gerät unwillkürlich in tranceartigen Zustand, wo sie alles mit einem Blick zu überschauen sucht. Der ernstlich Nachdenkende erblindet sozusagen für die näheren Objekte, seine gewöhnliche Wahrnehmung stumpft sich ab, während er überlegt, so befindet er sich auf dem Weg zur Intuition, die Bergson und Grandjean allein als großgeistig anerkennen. Das begrüßen wir an sich als Anerkennung des Schöpferisch-Geistigen im Vergleich zum trockenen Gelehrtenverstand, aber leiten aus obiger Betrachtung ab, daß Intuition und Vernunftdenken nur graduell verschieden sind, d. h. aus Letzterem die Erstere aufblitzen muß. Denn der intuitive oder gar inspirierte Zustand, »des Dichters Aug' in schöner Verzückung rollend« (nicht »Wahnsinn« wie Schlegel mal wieder falsch übersetzt) zeichnet sich dadurch aus, daß die Konturen des tagläufigen Gesichtsfeldes verschwimmen, das Einzelne nicht mehr unnützes Aufmerken erregt und so Erweiterung des Sehkreises gleichzeitiges relatives Allsehen verbürgt. Arsène Houssaye sagt von Musset: »Was ist Genie? eine Stunde Betäubung am Rand eines Abgrundes. Die das Absolute begehren, für die ist alles gut, was sie aus sich selbst heraustreibt.« Doch die Vielzuvielen sehen weder den Abgrund noch begehren Absolutes und doch verbringen sie ihr Dasein in chronischer Betäubung der Materietrunkenheit, »der Mensch, weil vernünftig, muß sich betrinken« höhnt Byron. Vielmehr möchte gerade der Geniale unbetäubt Abgründe überfliegen, nimmt aber wahr, daß sie überall und nirgends sind in ihm selber wie im Allgott, der immer gewaltiger und doch immer verschwindender wird, je mehr sich beflügeltes Denken ihm nähert.
Für Pythagoras bedeutete sein »Kreis« die Einheit der Gottsubstanz, sein »Punkt« darin die Monade, sein Dreieck die Gleichung von Geist, Materie und ihrem Sprößling Welt. Aristoteles verflachte dies in Linie, Form, Körper, doch wenn die Kabbala den Raum als substantielle Wesenheit erfaßte, so stand auch Demokrit dieser Urdenkweise keineswegs fern. Moderne legen alles in ihrem Sinne grob buchstäblich aus, wie z. B. Hatha Yoga »die Kunst willkürlichen Atmens« falsch wörtlich verstanden wird, während es innerlichen Geistatem der Selbstbeherrschung bedeutet. Sie hatten es freilich schwer, sich aus mittelalterlicher Scholastik herauszuarbeiten, die einige Reste von Grundwahrheiten so durch Kirchendogmen filtrierte, daß nur ein schwächlicher Abguß übrig blieb. Descartes mit seinem Korpuskularplenum blieb ganz Dualist, für Leibniz' ätherisches Plenum sind Atom und Element geistige Wesen, deren Natur das Wissen, Spinozas untätige Substanz wird ihm Energie, doch die Monaden bleiben ihm unkörperliche Automaten (Entelechien wie bei Aristoteles), während doch alle Teile einer tätigen Substanz Energien sein müssen. In Hegels vernunftgeschwängerter Welt ist alles einer universalen Existenz untergeordnet, ihr dienstbar und Werkzeug zu ihrer Entwicklung, doch zu welcher? Wieviel klarer und gesunder schreibt der alte Plutarch: »Eine Idee ist ein unkörperliches Wesen, das an sich selbst kein Dasein hat, doch der gestaltlosen Masse Figur und Farbe gibt und so Ursache der Offenbarung wird.« Denn Ideengeist im All kann als ursächlich gedacht werden, substantielle Existenz nur als bestehende Wirkung, die nichts erklärt. Der Psychophysiker G. Th. Fechner (»Zendavesta«, »vom Leben nach dem Tode«) meint, daß alle Gestorbenen noch als die gleichen Individuen in anderen Lebenden fortdauern, Wundt empfiehlt diese Phantastik, während er und Fechner die »Seelenwanderung« phantastisch nennen! Hört man dies unbeholfene Wort Seelenwanderung, so weiß man schon, welch unwissende Vorstellungen die Karmalehre in europäisch Verbildeten annimmt. (Unendliche Oberflächlichkeit in solchen Dingen! Der große Orientalist M. Müller verwechselt Vedanta mit Buddha, der große Sanskritkenner Rys Davids Buddha mit esoterischer Geheimlehre.) Wir kommen also wieder zum Doppelich, dem des Lebenden und des Verstorbenen, der sich ihm zugesellt, abstruser Dualismus. Rationalist Spencer führt aber auch mit vollen Segeln in die hohe See der Spekulation, wo alles, was als feste Säule des Herkules aufragt, weggeschwemmt wird von einem Meer unergründlicher Elemente »unter Bedingungen, die hervorzubringen die Chemie nicht imstande war«. Als den einzigen ehrlichen systematischen Denker schätzen wir den Metachemiker Crookes. Für ihn sind Wasser-, Sauer-, Stickstoff keine heilige Dreifaltigkeit, er verleugnet die 64 Elemente für einen Grundstoff, seine »Genesis der Elemente« predigt, daß Molekülen nicht an und für sich bestehen, sondern, durch unbekannte Prozesse aufgebaut, nach ihrer Auflösung alle die gleiche Substanz zeigen, wie Silber eines Fünfschillingsstückes im Schmelztiegel, das darin jede Prägung verliert und doch Silber bleibt. Dies entspricht dem okkulten Verstehen, daß Kraft und Stoff nur zwei Seiten derselben Erscheinung sind. Die Urquelle bildet Spiegel aus den Atomen und wirft auf jedes »einen Spiegel des eigenen Angesichts«, d. h. Silberstoff und individuelle Prägung sind beide nur Abbilder von etwas, was in keinem Schmelztiegel vergeht.