
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Berlin im Jahre 1887: Benjamin ist ein Waisenjunge deutsch-afrikanischer Herkunft. Er wird als Kuriosität auf einem Jahrmarkt präsentiert, bis er eines Tages ausreißt. Durch einen gestohlenen Brief der englischen Königin Viktoria, der in seinen Besitz gelangt, gerät Benjamin in höchste Gefahr. Verbrecher, ausländische Agenten und deutsche Behörden sind hinter ihm her. Doch Benjamin trickst alle aus. Er verhindert nicht nur einen Anschlag auf Fürst Bismarck, sondern findet sogar seinen totgeglaubten Vater wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Jahrmarkt
Der Fluchtplan
Benjamin haut ab
Muck
Grabow bekommt Ärger
Ein seltsamer Millionär
Eine gefährliche Frau
Verfolger!
Benjamins Vater
Jedah wird überfallen
Benjamin bei Riehmanns
Grabow und der falsche Pastor
Grabow bei Riehmann
Benjamin und Bettina verbünden sich
Die junge Dame
Überfall!
Das Kellerversteck
Abrasov sucht Liersch
Streit mit Bettina
Im Außenministerium
Grabow schlägt zu
Benjamin in Gefahr
Allein gegen alle
Angriff der Agenten
Bismarck
Das Attentat
Abreise
Der Brief der Königin
Ein Benjamin Liersch-Abenteuer
von M. E Rehor
Imprint
Der Brief der Königin von M. E. Rehor
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: 2011 - M. E. Rehor
Titelfotos: Duncan Walker, John Albano - istockphoto.com
ISBN 978-3-8442-1554-0
- - -
Weitere Bücher von M. E. Rehor
Der Nebelkontinent - Fantasyroman
Die Brückeninseln - Fantasyroman
Sannall der Erneuerer - Fantasyroman
Der Thymian-Mord - Krminalerzählungen
Czordan und der Millionenerbe - Kriminalroman
Freiheit und Liebe - Historischer Roman
Gerrit aus Neukölln - Jugendkrimi
http://tinyurl.com/merehor
- - -
Die Personen und Begebenheiten in diesem Buch sind der Phantasie des Autors entsprungen. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Begebenheiten sind rein zufällig.
Jahrmarkt
Mit Speer und Schild bewaffnet ging Benjamin über den Rummelplatz, um Zuschauer für seine Vorstellung zu interessieren. Ein paar Kinder staunten ihn aus sicherer Entfernung an, rannten dann zu ihrem Kindermädchen und bedrängten es, Eintrittskarten zu kaufen.
Als die Kirchturmuhr vier schlug, kehrte Benjamin zum Zelt zurück und warf einen Blick hinein. Alles war bereit: Petroleumlampen tauchten die Mitte des Rundzeltes in dämmeriges Licht. Räucherstäbchen glommen gut versteckt hinter geschnitzten Masken und ausgestopften Tieren. Ihr schwerer, würziger Geruch überdeckte den Gestank der Lampen und half, die Illusion eines Bantu-Krals im afrikanischen Urwald zu schaffen.
Benjamin schloss den Vorhang am Eingang hinter sich und machte sich für seinen Auftritt bereit. Alles hing von ihm ab, denn er war gleichzeitig Kartenabreißer, Ansager und Hauptattraktion der Nachmittagsvorstellung. Die Kinder im Publikum tuschelten aufgeregt, als es dunkler wurde. Benjamin trat auf den am Boden angebrachten Blasebalg. Vom anderen Ende des Zelts ertönten Tierrufe, Vogelgezwitscher und das Trompeten eines Elefanten. Gespannt starrten die Zuschauer in diese Richtung. Als niemand mehr auf ihn achtete, sprang Benjamin zwischen die Sitzreihen. Ein Kindermädchen schrie auf vor Schreck. Mit einer Handbewegung brachte er es zum Schweigen. Er drehte sich mit ausgestreckten Armen um seine Achse und erwischte dabei einige Kinder mit dem buschigen Ende eines präparierten Löwenschwanzes. Johlen und Lachen belohnten ihn.
Fast eine Stunde lang unterhielt Benjamin sein Publikum mit Vorführungen, Erzählungen, Tierimitationen und Tänzen, bis er zum letzten Teil seines Programms kam.
„Alle singen mir nach!“, rief er und senkte die Stimme. „Ah-wumba-gumba-omba-dumba!“
Die Kinder wiederholten die sinnlosen Worte und klatschten im Rhythmus. Auch heute gelang es Benjamin, seinen Besuchern diesen Tag unvergesslich zu machen!
Bis jemand die Vorstellung störte.
Der Vorhang wurde beiseitegeschoben, das helle Licht des Nachmittags drang herein. Im Eingang stand ein Mann, der mit zusammengekniffenen Augen die Menschen im Zelt musterte. Ein gewaltiger Schnurrbart zierte sein Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen roten, randlosen Fez, also stellte er einen Osmanen oder Türken dar. Sein elegantes Jackett verrutschte und gab den Blick frei auf den Griff eines Revolvers, der aus der seidenen Bauchbinde ragte. Der Mann musste ein Schausteller sein. Schausteller verkleideten sich gerne als Türken, das verlieh ihnen etwas Exotisches, ohne allzu fremdartig zu wirken.
„Eintritt während der Darbietung untersagt!“, rief Benjamin. Ein Kollege sollte das eigentlich wissen. Der Mann rümpfte die Nase und ließ den Vorhang wieder fallen.
Benjamin hatte keine Zeit, sich über diesen Zwischenfall zu wundern. Er gab sich Mühe, seine Zuschauer wieder in den Griff zu bekommen. Erneut sprang er herum und gab mit einer kleinen Trommel den Takt vor, während er sinnlose Verse sang.
Die Kinder sangen zunächst nur zögerlich mit, aber bald schrien sie wieder, als hätte es nie eine Störung gegeben. Manche ihrer Mütter und Kindermädchen fielen leise mit ein, andere sahen verschämt zu Boden. Es war kein einziger Mann unter den Zuschauern: Väter gingen nicht mit ihren Kindern zum Rummel. Benjamin bedauerte das. Seinen eigenen Vater kannte er nicht, deshalb machte es ihn traurig, wenn er daran dachte, dass diese Kinder Väter hatten, die sich keine Zeit für sie nahmen.
Unvermittelt brach er den Gesang ab. „Das war großes Lied von Tapferkeit in unserem Stamm“, radebrechte er. Er wusste, dass ein Afrikaner, der fließend Deutsch sprach, nicht glaubwürdig klang. „Ihr jetzt auch große Krieger und tapfere Kriegerfrauen. Nie wieder Angst haben werden! Ab heute ihr seid mutig. Ja?“
„Ja!“, riefen die Kinder. Sie sprangen hoch und fingen die bunten Bonbons auf, die er zwischen sie warf.
„Sagt all euren Freunden, sie hier her kommen“, forderte Benjamin sie auf. „Sie auch große Krieger werden.“ Er öffnete den Ausgang und sprang beiseite, als lauere draußen eine Gefahr. Noch einmal schrien die Kinder, dann drängten sie hinaus, der nächsten Attraktion entgegen. Karussells und Puppentheater warteten auf sie, Zauberer und tanzende Bären.
Das Tageslicht verwandelte den afrikanischen Häuptlingssohn zurück in den geschminkten Benjamin, der vor den Kindermädchen dienerte. Er nahm ein paar Pfennige Trinkgeld entgegen und steckte den Kleinen beim Hinausgehen weitere Süßigkeiten zu.
Nachdem sie weg waren, wischte Benjamin die Schmutzschicht von der Werbetafel. Wegen des kühlen Wetters heizten die Leute noch. Der feine Regen filterte den schwefeligen Ruß aus der Luft und legte ihn als schmierige Ablagerung auf allem nieder.Der große Afrikaforscher Friedrich Grabow ..., stand auf der Tafel und in kleineren Buchstaben darunter: ... berichtet von seinen haarsträubenden Abenteuern in den unerforschten Teilen des Schwarzen Kontinents und präsentiert weltexklusiv den Sohn eines Bantu-Häuptlings aus den Dschungeln jenseits des Äquators. Nach Paris, London und Konstantinopel nun auch in Hannover! Nachmittags lehrreiche Veranstaltung für Kinder, exotische Abendvorstellung für Erwachsene!
Benjamins Ziehvater Grabow war nie in Afrika gewesen und Benjamin war auch nicht der Sohn eines Bantu-Häuptlings, sondern nur ein halber Afrikaner, vonseiten seiner Mutter. Doch seine dunkle Haut genügte den Menschen als Beweis für die Echtheit der Behauptungen auf dem Schild.
Der Mann, der die Vorstellung gestört hatte, fiel Benjamin wieder ein. Der hatte bemerkenswert echt gewirkt, sogar die Waffe, die zu sehen gewesen war. „Haben wir einen Neuen auf dem Platz, der einen Türken darstellt?“, fragte er seinen Standnachbarn, der gebrannte Mandeln verkaufte.
„Ne, nichts gesehen. Hier, sind noch warm.“
Benjamin nahm die Tüte mit den Mandeln und sah sich um, während er sie knabberte. Die Geschäfte auf dem Rummelplatz gingen schlecht in diesem Frühjahr 1887, die Menschen hatten nicht viel Geld in der Tasche. Zwar spazierten viele Neugierige über das Gelände, aber sie kauften nichts. Mit einem Speer in der Hand stellte sich Benjamin in Kriegerpose vor den Eingang des Zelts und hoffte auf Kundschaft für die erste Abendvorstellung. Ob Grabow mitmachen würde, hing wie immer davon ab, wie betrunken er war. Noch war er nicht von seinem Nachmittagsschoppen zurückgekehrt.
Ein junger Mann und seine Begleiterin, eine dickliche Dienstmagd, blieben vor dem Zelt stehen und lasen das Schild. Benjamin lächelte die Frau an und hielt ihr eine Eintrittskarte entgegen. Sie wich erschrocken zurück. Ihr Freund spuckte verächtlich auf den Boden und zog sie mit sich davon. Benjamin zuckte nur mit den Schultern. Bei Kleinstädtern, die zum ersten Mal einen Menschen mit dunkler Haut sahen, war das keine ungewöhnliche Reaktion.
Als der Regen stärker wurde, ging er ins Zelt, stellte die Stühle wieder richtig hin und sammelte den Abfall ein. Diese täglichen Arbeiten blieben immer an ihm hängen. Grabow kümmerte sich um nichts, sein Lebenszweck waren das Trinken und das Anzetteln von Ärger.
Einige Bonbons lagen zwischen den Stühlen. Als sich Benjamin danach bückte, wurde er von hinten angesprochen. Erschrocken fuhr er herum und starrte das Paar an, das geräuschlos das Zelt betreten hatte: Der Mann trug einen einfachen Anzug und hielt sich sehr gerade. Sein schütteres Haar war ergraut und seine Gesichtszüge zeigten die schlaffe Weichheit des beginnenden Alters. Er mochte Mitte fünfzig sein. Die Frau neben ihm war jünger und adrett gekleidet.
Es hätte ein gutbürgerliches Ehepaar sein können, wäre nicht dieser Hauch von Stolz und Duckmäuserei von ihnen ausgegangen, den Benjamin sofort zuordnen konnte: Dienerschaft aus einem vornehmen Haus! Solche Kunden sah man selten auf dem Rummelplatz.
„Geschlossen, bitte besuchen Sie unsere nächste Vorstellung“, sagte Benjamin und begann, die übliche Anpreisung der Darbietung herunterzurasseln.
„Ich wünsche Herrn von Grabow zu sprechen“, unterbrach ihn der Mann mit leiser, präziser Stimme. Er sah Benjamin nicht an, sondern drehte wie eine Schildkröte den Kopf weg, um einen Blick zurück zum Eingang zu werfen. „Es eilt!“
„Von Grabow?“ Benjamin konnte es nicht fassen. Den Namen seines Ziehvaters mit einem Adelstitel zu versehen, war lächerlich.
Aber der Mann machte nicht den Eindruck, als wolle er scherzen. Er war blass, sein rechtes Augenlid zuckte nervös. Die Hände der Frau zitterten. Der Mann bemerkte es und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. „Alles ist in Ordnung, Liebste.“
„Grabow ist nicht da“, sagte Benjamin. „Was wollen Sie denn von ihm?“
„Es ist vertraulich. Wann ist er wieder zu sprechen?“
„Vertraulich? Ich bin sein Pflegesohn. Sie können Vertrauliches auch mit mir besprechen.“
Der Mann zögerte. Die junge Frau schob sich energisch vor ihn: „Man hat uns gesagt, er kaufe manchmal gewisse Gegenstände an. Schmuck, zum Beispiel.“
Benjamin wusste, dass Grabow auch durch Hehlerei versuchte, an Geld zu kommen, das er dann vertrinken und verspielen konnte. Vermutlich hatten die beiden ihre Herrschaft beklaut und suchten nun einen Abnehmer für das Diebesgut. Am liebsten hätte Benjamin das Paar weggeschickt. Aber illegale Einnahmen bedeuteten immer auch, dass Grabows Druck auf ihn nachließ. „Da kommen Sie am besten morgen wieder“, empfahl er daher. „Solche Angelegenheiten verhandelt er nur persönlich.“
Der Mann senkte den Kopf und unterhielt sich flüsternd mit der Frau. „Ja, wir verstehen“, sagte er dann. „Wir werden am Vormittag noch einmal vorsprechen.“ Er deutete zum Abschied eine Verbeugung vor Benjamin an, was der noch nie erlebt hatte.
So vornehm und doch Gauner, dachte Benjamin; denen Grabow wiederum morgen für wenig Geld alles abluchsen würde, was sie hatten.
Nachdem er das Zelt in Ordnung gebracht hatte, ging er mit der Kassenschatulle unter dem Arm in den abgesperrten Bereich hinter dem Rummelplatz. Das Kleingeld in der Schatulle deckte kaum den Lebensunterhalt und die laufenden Kosten für einen Tag. Doch Benjamin liebte die Nachmittagsvorstellungen, bei denen er alleine vor Kindern auftreten konnte. Ohne Grabow im Nacken machte alles viel mehr Spaß.
Er gelangte auf den Abstellplatz, wo die bunt lackierten Wohnwagen nebeneinanderstanden. Pferde wieherten, Schaustellerkinder spielten Fangen, der Geruch von aufgewärmtem Essen wehte herüber. Diese Wagen und der Stall für die Zugpferde waren Benjamins Zuhause – egal, in welcher Stadt er sich gerade befand. Ob Hannover oder Hamburg, Leipzig oder Berlin: Jahrmarkt war Jahrmarkt.
Zurückhaltend grüßte er Breitmann, den Wurfbudenbesitzer, der in Geld schwamm und immer noch mehr haben wollte. Mamschka winkte Benjamin im Vorbeigehen zu. Sie war eine der wenigen eigenständigen Frauen im Schaustellergewerbe. Mamschka sah schlecht aus, letzte Nacht hatte sie sich ein blaues Auge eingefangen. Sie trank zu viel und oft mit den falschen Leuten. Zum Beispiel mit Grabow.
Sein Ziehvater war noch nicht im Wohnwagen. Benjamin nutzte die Zeit, um im Spiegel seine Verkleidung zu prüfen. Die abgewetzte Hose, auf die Federn und Fellstücke aufgenäht waren, sah noch ganz gut aus. Das mit Tiermotiven bedruckte, ärmellose Hemd dagegen wurde fadenscheinig. Aber das war kein Problem, von einem Wilden erwarteten die Zuschauer, dass er mit zivilisierter Kleidung nicht zurechtkam.
Im Gegensatz zu anderen Darstellern von Afrikanern, denen Benjamin auf Rummelplätzen begegnet war, brauchte er seine Haut mit Schminke nur ein wenig dunkler zu färben. Sie hatte von Natur einen hellbraunen Ton, ein Erbe seiner Mutter, die bei seiner Geburt gestorben war. Benjamin stellte sie sich als afrikanische Häuptlingstochter vor, wunderschön und reich und liebevoll. Er dachte oft an sie, wenn er sich beim Schminken im Spiegel sah. Seine breite Nase und die krausen Haare hatte er ebenfalls von ihr, die blauen Augen dagegen von seinem unbekannten deutschen Vater.
Da Benjamin nicht wollte, dass man ihm seine fünfzehn Jahre anmerkte, schminkte er sich außerdem vor den Vorstellungen einen Bartschatten ins Gesicht. Die Bilder von echten Afrikanern, die er in illustrierten Blättern und auf Plakaten gesehen hatte, zeigten zwar nie einen mit Bart, trotzdem war Grabow mit dieser Zutat einverstanden.
„Es muss nicht echt sein, es muss echt wirken“, sagte Grabow immer. „Du musst nicht aussehen wie ein junger afrikanischer Häuptling, sondern so, wie sich das verehrte Publikum einen vorstellt. Verstanden, Dummkopf?“
Grabow war heute mürrischer als sonst gewesen und schon mittags ausgegangen. An solchen Tagen kehrte er meist mit noch schlechterer Laune zurück. Benjamin war daran gewöhnt, deshalb erschrak er nicht, als er hörte, wie Grabows Stimme in der Ferne ein unanständiges Lied grölte.
Andere Stimmen fielen in den Gesang ein. Der Chor der Betrunkenen näherte sich dem Wohnwagen. Benjamin öffnete die Tür, obwohl er ahnte, was kommen würde.
Grabow stand mit einigen Kumpanen vor dem Wagen. Sein Anzug war schmutzig, die Jacke eingerissen. Er hatte sich wieder einmal geprügelt – und sicherlich gewonnen. Er überragte nicht nur die meisten Menschen um einen Kopf, sondern hatte auch Muskeln wie Stahlstränge.
„Merkt es euch: Niemand besiegt Friedrich Grabow!“, prahlte er gerade. „Benjamin, zu mir!“ Er zeigte auf Benjamin und sagte zu seinen Begleitern: „Das ist er, der afrikanische Häuptlingssohn.“
Benjamin musterte die Männer und versuchte, sie einzuschätzen. Es waren grobschlächtige Kerle, von denen einige Uniformjacken trugen. Vielleicht Soldaten, die sich ein paar schöne Tage in der Stadt machten.
„Tatsächlich, ein echter Neger! Lass ihn tanzen!“, schrie einer von ihnen, und die anderen stimmten ein: „Wir wollen ihn tanzen sehen!“
Grabow schubste Benjamin in Richtung Zelt. „Die Abendvorstellung fällt heute aus. Es gibt eine Sondervorstellung für meine Freunde“, sagte er. „Ich schulde ihnen Geld, also gib dein Bestes, du nichtsnutziger Affe. Tanz für uns!“
Zu Benjamins Abendvorführungen gehörte ein afrikanischer Kriegstanz, zu dem Grabow die Trommel schlug. Der Tanz bestand aus grotesken Sprüngen und sinnlos hervor gestoßenen Schreien, ähnlich wie in der Kindervorstellung, aber wilder.
Im Zelt nahm Grabow die Pose des Afrikaforschers ein, die er auch im Alltag pflegte. Benjamin zuckte zusammen, als Grabow die Peitsche aus dem Gürtel zog und ein paarmal damit knallte. Das gehörte nicht zum normalen Programm. Zum Glück klemmte Grabow sich die Peitsche anschließend unter den Arm und griff nach der Trommel.
Benjamin begann mit der Vorführung. Normalerweise kam der Tanz erst am Ende eines Programms. Er dauerte nicht lange und sollte das Publikum dazu verführen, dem Artisten noch ein paar Geldstücke zuzuwerfen. Benjamin tanzte zu Grabows unrhythmischen Trommelschlägen. Die Soldaten klatschten und schrien durcheinander.
Ein weiterer Soldat kam ins Zelt. Er brachte mehrere Schnapsflaschen, die er verteilte. Da Grabow keine Hand freihatte, hielt ihm der Mann eine Flasche an den Mund. Grabow trank gierig den Schnaps, während er weiter trommelte.
„Schneller, schneller“, brüllten die Soldaten.
Benjamin griff nach dem verzierten Speer und dem mit Fellen bespannten Schild. Noch wilder führte er den Kriegstanz fort. Als er erschöpft aufhören wollte, weil er nicht mehr konnte, trieb ihn ein Blick in Grabows grimmiges Gesicht zum Weitermachen. Immer lauter grölten die Männer.
Irgendwann wurde Benjamin schwindelig vor Atemnot. Keuchend hielt er inne.
Grabow warf die Trommel beiseite und schlug mit der Peitsche nach ihm. „Weiter, Affe!“
Erschrocken wich Benjamin aus. Grabow stolperte, fluchte und wurde noch wütender. Nun feuerten die Soldaten den betrunkenen Grabow an, der mit der Peitsche versuchte, Benjamin zu treffen. Die Peitsche war eine Waffe, mit der Benjamin schon mehrmals Bekanntschaft gemacht hatte. Seit er als fünfjähriges Kind damit fast tot geprügelt worden war, hatte er enorme Angst vor ihr.
Benjamin tanzte wie zufällig zum hinteren Teil des Zeltes. Dort gab es einen Durchschlupf. Aber einer der Soldaten durchschaute seine Absicht und schnitt ihm den Weg ab. Benjamin wich aus und geriet so in die Reichweite der Peitsche. Sie traf und schnitt eine Furche in seinen Rücken. Die Männer johlten begeistert.
Panisch suchte Benjamin nach einer Fluchtmöglichkeit. Er wich einem weiteren Peitschenhieb aus und schlug mit seinem Speer nach dem Mann, der vor ihm stand. Der Mann war so betrunken, dass er einfach umfiel. Der Weg zum Hinterausgang des Zelts war frei.
Die Stimmung der Soldaten schlug um. Sie grölten nicht mehr vor Schadenfreude, sondern vor Wut. „Bringt dieses tollwütige Tier um!“, brüllte einer. Sie wollten hinter Benjamin herrennen, behinderten sich aber gegenseitig. Ein Peitschenhieb Grabows traf in dem Durcheinander nicht Benjamin, sondern einen der Männer, noch dazu mitten ins Gesicht. Der Mann schrie auf und taumelte zurück. Blindlings rammte er dem Nächststehenden die Faust in die Magengrube. Eine Prügelei jeder gegen jeden begann.
In dem Durcheinander gelang es Benjamin, das Zelt zu verlassen. Zitternd vor Angst und Schmerzen suchte er sich eine Deckung und beobachtete durch einen Schlitz in der Zeltplane, was weiter geschah. Noch nie hatte er einen Menschen niedergeschlagen. Er musste unbedingt wissen, wie Grabow darauf reagierte.
Grabows Stärke und die Macht seiner Peitsche beendeten die Schlägerei schnell. Durch den Vorderausgang flüchteten seine Saufkumpane ins Freie. Sie verfluchten Grabow mit den schlimmsten Ausdrücken, die Benjamin je gehört hatte. Grabow pöbelte zurück. Da er immer noch die Peitsche schwang, wagten es die Männer nicht mehr, sich mit ihm anzulegen. Sie verzogen sich stolpernd zwischen die Rummelplatzbesucher.
Nun machte sich Grabow auf die Suche nach Benjamin. „Wo bist du, Ratte? Ich ziehe dir die Haut in Streifen ab!“ Er knallte mit der Peitsche in die Luft.
Benjamin blieb in Deckung und rührte sich nicht. Er sah zu, wie sein Ziehvater eine der herumkullernden Schnapsflaschen aufhob, halb leer trank und zum Wohnwagen torkelte. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Der Fluchtplan
Als Benjamin wieder zu sich kam, dauerte es eine Weile, bis er wusste, was geschehen war und warum er zwischen den Zeltplanen im Dreck lag. Es war spät geworden, auf dem Rummelplatz herrschte Ruhe. Vorsichtig tastete er seinen Rücken ab. Er spürte das klebrige Blut, das sein Hemd durchtränkte. Die Wunde schmerzte höllisch. So schlimm hatte ihn sein Ziehvater schon lange nicht mehr erwischt. Wer konnte ihm jetzt helfen? Ein Arzt kam nicht in Frage. Breitmann, der Besitzer der Wurfbude, fungierte als Sanitäter auf dem Rummel, verlangte aber Geld für seine Dienste. Blieb also nur Rosalinde. Benjamin wollte aufstehen, da legte sich von hinten schwer eine Hand auf seine Schulter.
Benjamin warf sich herum und versuchte, seinem Angreifer zu entkommen. Doch als er erkannte, wer es war, gab er den Versuch auf. Vor Herkules brauchte er sich nicht zu fürchten. Der ‚stärkste Mann der Welt‘ war gutmütig und so etwas wie sein Freund.
„Hab dich gesucht“, sagte Herkules. Er ließ Benjamin los und hielt die Hand hoch, um sie im Mondlicht anzusehen. „Blut“, sagte er. „Grabow?“
„Ja. Mit der Peitsche.“
„Ich bringe ihn um“, drohte Herkules und machte kehrt, um seinen Vorsatz sofort in die Tat umzusetzen.
„Halt, warte!“ Benjamin wusste, dass Herkules nicht zur Gewalttätigkeit neigte. Aber man konnte nie richtig abschätzen, was in seinem langsam arbeitenden Verstand vor sich ging. „So schlimm ist es auch wieder nicht. Warum hast du mich gesucht?“
„Rosalinde schickt mich. Hier.“ Herkules gab Benjamin ein zerknittertes Blatt Papier.
Es standen nur wenige Worte darauf: „Es geht um deinen Vater. Komm zu mir herüber.“ Darunter war groß und mit vielen Schnörkeln der Buchstabe ‚R‘ gemalt.
„Mein Vater!“, sagte Benjamin und ließ das Papier vor Überraschung beinahe fallen. Hatte Rosalinde etwas über seinen toten Vater in Erfahrung bringen können?
„Grabow!”, folgerte Herkules. „Ich bringe ihn um.“
„Nein, es ist alles gut. Danke für deine Hilfe. Ich gehe jetzt zu Rosalinde und du gehst schlafen. Gute Nacht.“
„Gute Nacht“, brummte der Riese und tappte davon.
Benjamin sprintete los zu dem in Pastellfarben bemalten Wohnwagen, in dem Rosalinde und ihre Mamschka lebten. „Was ist mit meinem Vater?“, rief er atemlos, als er die Tür des Wohnwagens aufstieß.
„Wie siehst du denn aus?“, begrüßte ihn Rosalinde. „Dreh dich mal um. Du blutest ja!“ Rosalinde rührte sich nicht aus ihrem Sessel, sie deutete nur auf einen Lappen und einen Krug mit frischem Wasser auf der Kommode.
Benjamin feuchtete den Lappen an und drückte ihn Rosalinde in die Hand. Dann zog er die Reste seines Hemds aus, bückte er sich vor ihr und ließ sich das Blut vom Rücken abwaschen.
Rosalinde keuchte, während sie vorsichtig über die zerschundene Haut fuhr. Selbst diese Anstrengung war ihr schon fast zu viel.
„Warum bist du heute nicht in der Abendvorstellung?“, fragte Benjamin, um sich von den Schmerzen abzulenken.
„Es geht mir nicht gut.“
Das sagte Benjamin genug. Rosalinde war erst vierzehn, wog aber schon mehr als vier Zentner. Ihr Körper kam mit dem Gewicht nicht mehr zurecht. An manchen Tagen musste Mamschka draußen im Zelt auf sie verzichten. Aber es arbeiteten noch zwei nicht ganz so dicke Mädchen für Mamschka. Die genügten, um Zuschauer anzulocken, auch wenn ‚das Kolossalkind Rosalinde‘ als Star der Vorführung fehlte.
Rosalinde legte den Lappen beiseite. „Wie ist das passiert?“, wollte sie wissen.
„Grabow hatte einen Wutanfall. Was ist mit dir?“
„Ich bin wieder ohnmächtig geworden.“ Rosalinde lief trotz des kühlen Wetters der Schweiß herunter. Der ganze Wohnwagen war erfüllt von dem Schweißgestank und dem süßlichen Bouquet des billigen Parfums, mit dem sie versuchte, ihren Körpergeruch zu überdecken.
„Wenn du nicht abnimmst, wirst du sterben“, mahnte Benjamin. „Du weißt, was die Ärzte sagen.“
„Ich darf nicht abnehmen. Wenn die Leute keinen Eintritt mehr bezahlen, um mich zu sehen, setzt mich Mamschka aus. Sie hat erst gestern wieder damit gedroht. Wir sind eh fast pleite.“
„Vielleicht kannst du ein ganz normales Leben führen, wenn du dünn wirst“, munterte Benjamin sie auf. Er hatte das schon Dutzende Male gesagt und wusste, dass es unsinnig war. Rosalinde war auf Gedeih und Verderb an Mamschka gebunden, so wie er an Grabow. Aber er konnte die Hoffnungslosigkeit in Rosalindes Augen nicht verkraften, wenn von ihrem Aussehen die Rede war.
„Ich habe einmal abgenommen, als Kind, weil ich krank war“, erzählte Rosalinde die alte Geschichte wieder, die ihr selbst als Rechtfertigung für ihr Dulden diente. „Ich sah aus wie ein Monster. Die Hautfalten hingen wie Säcke an mir herunter. Jetzt finden die Leute mich wenigstens niedlich, weil ich in den Rüschenkleidern wie ein Riesenbaby wirke.“
„Noch“, sagte Benjamin und bereute es gleich wieder.
„Du brauchst nicht so zu reden! Im Gegensatz zu mir könntest du wirklich weggehen. Und sag jetzt nicht, du hättest keine Chance im Leben, weil du ein Afrikaner bist. Du bist ein Mischling. Deine Haut ist so hell, dass du nur zu behaupten brauchst, du seiest ein Italiener aus dem Süden, und jeder würde dir glauben.“ Rosalinde blickte auf Benjamin herunter, der vor ihr auf dem Boden saß.
Benjamin wechselte schnell das Thema. „Was ist mit meinem Vater?“, fragte er.
„Gestern hat Grabow im Suff Mamschka verprügelt.“
Das interessierte Benjamin nicht sonderlich. Die Schmerzen auf seinem Rücken wurden stärker und machten ihn fast verrückt. Er riss sich zusammen und sagte: „Ich habe sie vorhin gesehen. Sie hat ein blaues Auge.“
„Und jede Menge blauer Flecken. Sie war betrunken und hat die halbe Nacht auf Grabow geschimpft.“ Rosalinde keuchte ein paarmal, bevor sie weiterreden konnte. Ein triumphierendes Blitzen ihrer Augen kündigte den nächsten Satz an: „Sie sagte, es sei schlimm, wie er alles Geld versäuft und verspielt, das er von deinem Vater bekommt.“
„Der ist tot!“
„Mamschka muss es besser wissen“, widersprach Rosalinde. „Sie hat ganz früher mal mit Grabow zusammengelebt.“
Das war ein Argument. Mamschka kannte Grabow schon, als Benjamin noch gar nicht geboren war. „Wenn das stimmt, haben es mir beide immer verheimlicht. Warum sollten sie das tun?“
„Grabow, weil er das Geld deines Vaters vertrinkt, und Mamschka aus Angst vor Grabow. Wahrscheinlich erwartet dein Vater, dass Grabow dich für das Geld gut erzieht. Mit Schule und so. Stattdessen lässt Grabow dich für sich arbeiten. Du musst herausfinden, um welche Summen es geht. Bestimmt gibt es Schecks oder Quittungen.“
„Dann sind sie in Grabows Eisenkassette. Den Schlüssel trägt er Tag und Nacht an einer Kette um den Hals. Als Kind habe ich mal versucht, die Kassette zu öffnen. Er hat mich erwischt und verprügelt.“
„Jetzt bist du kein Kind mehr.“ Rosalinde griff nach einem Fächer und wedelte sich Luft zu. „Du musst deinen Vater suchen und ihm sagen, was Grabow getan hat.“
Benjamin mochte diese Idee nicht. Wenn sein Vater wirklich noch lebte, hatte er Benjamin verstoßen – wegen der Hautfarbe, warum auch sonst? Benjamin war sich nicht sicher, ob es richtig war, zu so einem Mann zu gehen. Er sah in Rosalindes Gesicht. Waren es Schweißtropfen oder Tränen, die über ihre Wangen liefen? „Vielleicht tue ich es“, sagte er.
„Schau zumindest nach, was in der Kassette ist. Versprichst du mir das?“
„Klar. Wenn sich die Gelegenheit ergibt.“
„Dafür musst du sorgen! Nicht immer warten, Benjamin“, tadelte ihn Rosalinde. Sie wäre gerne Lehrerin geworden, das merkte man manchmal. Auch wenn sie selbst nur ein paar Monate in ihrem Leben eine Schule besucht hatte, den strengen, fordernden Ton hatte sie sich gemerkt.
„Also gut: versprochen!“
„Dann sage ich dir jetzt, wie du an den Schlüssel für die Kassette herankommen kannst. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Dort neben dem Spiegel liegt ein Papiertütchen mit Pulver.“
Benjamin stand auf und holte es. Das Tütchen war eines von der Sorte, in der Apotheker Medikamente in einzelnen Portionen verkauften.
Rosalinde bestätigte seine Vermutung: „Das ist ein starkes Schlafmittel, das Mamschka manchmal nimmt. Ich habe es ihr stibitzt. Jetzt brauchst du nur noch eine Flasche Schnaps. Errätst du meine Idee?“
Benjamin lachte, auch wenn ihm nicht wohl war bei dem Plan, den Rosalinde ausgeheckt hatte. „Ich verstehe“, versicherte er. Sein Herz schlug noch schneller als vorhin bei der Flucht aus dem Zelt. Hier eröffnete sich ihm ein Weg in die Freiheit. Eine Freiheit, die nicht ungefährlich war für einen wie ihn. Wie schlecht Grabow ihn auch behandelte, Benjamin war auf dem Rummel sicher vor Nachstellungen wegen seiner dunklen Hautfarbe. Wäre es nicht fahrlässig, diese Sicherheit aufzugeben?
„Ich werde es tun“, beteuerte er noch einmal. Er war selbst überrascht über die Festigkeit in seiner Stimme.
Zufrieden ließ sich Rosalinde zurücksinken. „Dann mach dich jetzt sofort daran!“, befahl sie.
Trotz seiner Angst vor Grabow schlich sich Benjamin zurück zum Zelt. Die Petroleumlampen brannten noch. Zwischen den umgestürzten und zerschlagenen Stühlen lagen zwei Schnapsflaschen. Eine davon war nicht ausgelaufen, die nahm er mit. Schmeckte der billige Schnaps anders, wenn das Schlafpulver darin aufgelöst war? Benjamin öffnete das Papiertütchen und probierte eine winzige Menge des Pulvers. Es war sehr bitter. Blieb also nur die Möglichkeit, Grabow weiszumachen, dass der Schnaps bitter schmecken musste, weil er etwas Besonderes war.
Im Mondlicht ging Benjamin über den dunklen Rummelplatz. Hier kannte er sich aus. Als Kind war er oft nachts aus dem Wohnwagen geschlichen, um sich draußen umzusehen. Es war dann so still und friedlich, ganz anders als tagsüber und abends, wenn Besucher über den Platz strömten. Nur die Gerüche hingen noch immer in der Luft: gebratene Wurst, Hustenbonbons, Pferdeäpfel. Er wüsste sogar mit geschlossenen Augen, wo er sich gerade befand.
In einem Abfallkorb entdeckte er eine bauchige Flasche mit ausländischem Etikett. Vielleicht französisch, was bei Alkohol ja immer gut war. Er füllte den Schnaps in die bauchige Flasche um, ließ das Pulver aus dem Tütchen hinein rieseln und verkorkte die Flasche sorgfältig. Dann kehrte er ins Zelt zurück und versteckte sie.
Die restliche Nacht verbrachte er unter Grabows Wohnwagen. Das tat er immer, wenn er sich dessen Zorn zugezogen hatte. Aus dem Stall, in dem die Zugpferde standen, holte er Stroh und breitete es unter dem Wagen aus. Er legte sich mit dem Bauch darauf, weil er es auf dem Rücken nicht aushielt, und hörte über sich Grabow randalieren. Als Grabow zu Schnarchen anfing, fand auch Benjamin ein wenig Schlaf.
Am frühen Morgen, als es empfindlich kalt wurde, kletterte Benjamin in den Wohnwagen. Es sah wüst aus, wie gewöhnlich nach Grabows Wutanfällen. Grabow schnarchte fürchterlich laut. Der Schlüssel, den er an einer Kette um den Hals trug, hing seitlich aus dem Hemdkragen. Er war wie ein Kreuz geformt. Das verlieh Grabow das Ansehen eines frommen Mannes – zumindest bei Menschen, die nicht wussten, was dieses Kreuz in Wirklichkeit war.
Benjamin wagte es nicht, dem Schlafenden die Kette mit dem Schlüssel über den Kopf zu ziehen. Grabow war unberechenbar und konnte von einem Moment zum nächsten hellwach sein.
Leise legte Benjamin sich in sein Bett und schlief noch ein paar Stunden, bis Grabow gegen Mittag stöhnend erwachte und krächzend nach etwas zu Trinken rief.
Benjamin brachte ihm einen Krug mit Wasser und ein Glas Kräuterlikör. Es gehörte zu seinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass immer ein Vorrat dieses leuchtend grünen, zuckersüßen Getränks vorhanden war. Der Likör war das Einzige, was Grabow über den morgendlichen Kater hinweg half.
Als Grabow sich schließlich nach einem zweiten Glas aus seinem Bett hochwuchtete, hatte er die Ereignisse des Vorabends vergessen. Auch das war nicht ungewöhnlich. „Räum auf!“, knurrte er Benjamin an, dann verließ er schwankend den Wagen, um sich bei einem der Nachbarn ein Frühstück zu schnorren.
Benjamin machte sich ans Säubern des Wagens, wobei er auch die Eisenkassette unter dem Schreibtisch abwischte. Sie war etwas größer als ein Schuhkarton und aus dickem Blech gefertigt. Das Schloss war eine Schweizer Spezialanfertigung, das behauptete Grabow jedenfalls.
Mit einem kräftigen Ruck hob Benjamin die Kassette einen Fingerbreit hoch. Mehr ließ die Eisenkette nicht zu, die als Schutz vor Dieben an beiden Seiten angeschweißt war. Diese Kette führte durch ein Loch im Boden nach unten und kam zwei Schritte weiter wieder hoch. Sie bildete also eine Schleife unter dem Wagenboden. Ein Dieb musste entweder die stabile Kette durchtrennen oder den Boden des Wagens mit einer Axt zerschlagen, wenn er die Kassette stehlen wollte. Grabow war selbst ein Gauner, deshalb wusste er, wie man sein Eigentum wirkungsvoll schützt.
Nur wenige Male hatte Grabow die Kassette in Benjamins Gegenwart geöffnet. Sie enthielt Papiere und ein paar Gegenstände aus Grabows Vergangenheit. Manchmal legte Grabow auch wertvolle Hehlerware hinein, bis er einen Abnehmer dafür fand.
Nachdem der Wohnwagen wieder bewohnbar war, ging Benjamin hinüber zum Zelt. Dort musste alles für die erste Vorstellung hergerichtet werden. Als er das Zelt durch den Hintereingang betreten wollte, hörte er Grabows Stimme. Benjamin duckte sich, um von niemandem beim Lauschen gesehen zu werden, und hörte zu.
„Ich bin im Moment nicht flüssig“, sagte Grabow gerade. „Einen Teil des Schmucks kann ich nur in Kommission nehmen.“
„Darauf können wir uns nicht einlassen“, antwortete eine Männerstimme. Es war der Diener vom Vortag, der gestohlene Ware loswerden wollte. „Auf Wiedersehen.“
„Nicht so hastig! Wir können uns vielleicht einigen.“ Grabow wusste, wie man einen Fisch an der Angel zappeln ließ.
Eine Frauenstimme sagte: „Georg, wir brauchen das Geld sofort. Wir müssen Hannover heute noch verlassen. Die Prinzessin ...“
„Still, mein Herz. Wir werden jemand Anderen finden, der uns Geld dafür gibt.“
Grabow schwieg einen Moment, bevor er sagte: „Ich werde das Geld besorgen, aber nur, weil ich so ein mitfühlender Mensch bin. Warten Sie! Ich bin in einer Minute wieder hier.“
Benjamin wusste, wohin Grabow jetzt ging: zu Breitmann, dem Inhaber der Wurfbude, der zu horrenden Zinsen Geld verlieh.
„Ist es richtig, was wir tun, Georg?“, fragte die Frau, als Grabow weg war.
„Es ist unsere einzige Chance, Liebes. Ihre Hoheit hat eine solche Abneigung gegen dich gefasst, dass deines Verbleibens nicht länger gewesen wäre. Wir wären getrennt worden, Melanie, für immer.“
„Ja, Georg.“
„Dieser Mann will uns betrügen. Aber das ist egal. Er muss uns für den Schmuck genug Geld für zwei Fahrkarten nach Berlin zahlen. Meine Verwandten werden uns helfen, mit neuen Papieren nach Bayern zu gelangen. Dort übernehmen wir die Gaststätte, die du geerbt hast, und gründen eine Familie, wie andere Leute auch.“
„Ja, Georg.“
„Aber den Brief behalten wir. Den soll dieser Grobian nicht bekommen. Wir wollen der Prinzessin nicht mehr schaden, als unbedingt nötig ist. Wir sind ehrliche Menschen, auch wenn wir nun zum Äußersten gezwungen werden.“
„Ja, Georg.“
Benjamin fand den Schlitz im Zelt wieder, durch den er gestern gespäht hatte. Er beobachtete das Paar. Georg sah zum Eingang und wischte sich alle paar Sekunden den Schweiß von der Stirn. Melanie tippelte von einem Fuß auf den anderen.
Grabow kam zurück und schwenkte ein paar Geldscheine in der Hand. „Mehr gibt‘s nicht. Gilt das Geschäft?“
Benjamin sah die schnelle Bewegung, mit der sein Ziehvater beim Hereinkommen weitere Geldscheine in der Hosentasche verschwinden ließ. Als gewiefter Feilscher hatte er sich bei Breitmann eine größere Summe geben lassen, bot dem Dienerpaar aber zunächst nur einen Teil davon an. Sein Trick funktionierte:
Georg atmete tief durch und richtete sich noch gerader auf, als er sowieso schon dastand. Er hielt auf der offenen Handfläche Grabow in paar Schmuckstücke entgegen, die der sich mit einer schnellen Bewegung schnappte.
Benjamin kannte sich nicht aus mit solchen Sachen, aber bestimmt war diese Diebesbeute auf dem Schwarzmarkt ein Vielfaches der gezahlten Summe wert.
Georg zählte die Geldscheine durch: „Moment, das ist weit weniger ...“
„Das oder nichts!”, bellte Grabow.
„Wir brauchen das Geld”, sagte Melanie unter Tränen.
Georg verstand aber besser als sie, wie Grabow dachte. „Wir können unser Angebot in anderer Richtung erweitern“, sagte er. Er zog ein paar gefaltete Schriftstücke aus der Tasche, sah sie durch und überreichte Grabow mit einer eleganten Bewegung ein Blatt Papier.
„Was soll dieses unleserliche Geschmier darstellen?“, blaffte Grabow.
„Dies ist ein Brief ihrer Majestät, der Königin Viktoria von England. Von eigener Hand geschrieben auf Schloss Windsor, wie Sie am Wappen sehen können. Er ist an eine Verwandte ihrer Majestät hier in Hannover gerichtet. Für seine Echtheit kann ich bürgen. Ich war zufällig dabei, als er von der Empfängerin geöffnet wurde. Dieser Brief ist vorgestern aus London eingetroffen.“
„Na, und?“
„Stellen Sie sich das doch einmal vor: Noch vor drei, vier Tagen hielt die Königin in eigener Person dieses Blatt in Händen!“
Nun verstand Grabow. Mit spitzen Fingern nahm er das Papier und hielt es mit ausgestrecktem Arm vor sich. „Ich kann das nicht entziffern!“
„Die Königin hat eine großzügige Handschrift. Selbstverständlich ist der Brief auf Englisch abgefasst“, erklärte Georg. „So weit ich es beurteilen kann, ist der Inhalt rein familiärer Natur. Aber ich betone noch einmal: Eigenhändig geschrieben! Dieser Brief ist noch einmal so viel wert, wie Sie uns für den Schmuck geben haben.“
Grabow verzog das Gesicht und tat, als wolle er den Brief fallenlassen. „Ach, was!“
Melanie schrie vor Schreck auf.
„Für Sammler ein unbezahlbarer Schatz!”, beeilte sich Georg noch einmal zu versichern.
Grabow zögerte. Er konnte sich von dem Brief nicht trennen. „Ich gebe zu, ich habe noch nie etwas besessen, das von einer echten Königin stammt. Gut, einverstanden.“
Georg steckte das zusätzliche Geld ein, nahm Melanie bei der Hand und verließ mit ihr eilig das Zelt.
Als Grabow auf den Hinterausgang zuging, den Brief wie eine Ehrenurkunde vor sich haltend, rannte Benjamin zurück zum Wohnwagen und gab sich den Anschein, eine Ecke auszukehren.
Polternd kam Grabow herein und zog sich die Kette mit dem Schlüssel über den Kopf. „Verschwinde“, herrschte er Benjamin an. „Bring das Zelt in Ordnung!“
Als Benjamin nicht schnell genug reagierte, schlug Grabow beiläufig nach ihm und traf ihn mit der Hand auf der frischen Wunde am Rücken.
Aufschreiend vor Schmerz flüchtete Benjamin nach draußen. Rosalinde hatte Recht: Es musste ein besseres Leben geben als dieses, ob nun bei einem echten Vater oder irgendwo sonst. Es war Zeit, zu gehen.
Benjamin haut ab
Am frühen Abend kam eine Polizeistreife auf den Rummel und befragte Besucher und Schausteller. „Hör zu, was die wollen und was die Kollegen reden“, befahl Grabow. „Aber lass dich nicht dabei erwischen.“
Benjamin lungerte also in der Nähe der Polizisten herum und belauschte die Befragungen.
„Wurden von Ihnen verdächtige Personen am heutigen Morgen hier auf dem Gelände beobachtet?“, fragte ein Polizist den Herkules, der sein Kostüm aus Fellen trug und lässig eine Keule schwenkte.
„Ich weiß von keinem Gelände und Personen“, behauptete Herkules. „Und beobachten tu ich schon gar nicht.“ Er hob seine Keule und der Polizist machte, dass er weiter kam.
Alle Befragten würden leugnen, das Dienerpaar gesehen zu haben, daran zweifelte Benjamin nicht. Auch diejenigen, die wussten, dass die beiden Gesuchten zu Grabows Zelt gegangen waren. Die Schausteller hielten zusammen, solange es gegen Staat und Ordnungsmacht ging.
Benjamin ärgerte sich nicht über die abschätzigen Blicke, mit denen die Polizisten ihn bedachten. Es war zu seinem Vorteil, wenn sie ihn wegen seiner Hautfarbe für zu dumm hielten, Fragen zu beantworten. Solange er sich den Beamten nicht in den Weg stellte, würde er unbehelligt bleiben.
Später war er dabei, als Grabow vernommen wurde, und für einen Moment sah er ihn so, wie ihn die Polizisten sahen: als bulligen Kerl mit Schnapsfahne, dessen glasige Augen verständnislos aus dem geröteten Gesicht starrten.
„Heute Morgen?“, grunzte Grabow auf ihre Frage. „War ich noch gar nicht wach.“
„Also haben Sie niemanden gesehen?“
„Sag ich doch!“
Das genügte den Beamten, sie gingen weiter. Benjamin blieb in ihrer Nähe, bis sie das Gelände verließen. Anschließend nahm er seinen Mut zusammen und ging zu Rosalinde. Er wusste, sie würde von ihm eine Entscheidung erwarten, und die auszusprechen fürchtete er sich. Obwohl er sie für sich schon getroffen hatte.
„Hast du alles genau so gemacht, wie ich es gesagt habe?“, fragte Rosalinde.
„Ja“, sagte er. Dann sprudelte es aus ihm heraus: „Heute Nacht werde ich ihm das Schlafmittel geben. Dann haue ich ab.“
„Gut. Was tust du, wenn du deinen Vater gefunden hast?“
„Ich glaube, ich suche ihn gar nicht, sondern gehe gleich nach Afrika. Wenn meine Mutter dort herstammt, ist das ja mein Zuhause.“
„Du willst in die Kolonien? Da ergeht es dir schlimmer als hier.“
„Nein! Es gibt nicht nur die Kolonien. Das meiste Land dort ist noch gar nicht erforscht.“ Benjamin war nicht bereit, sich von Rosalinde seine Vorstellung von Afrika schlechtreden zu lassen. Für ihn war es das Paradies auf Erden: ein riesiges Land, in dem sich niemand um seine Hautfarbe kümmerte. Und natürlich voller Löwen, Zebras, Abenteuer und Geheimnisse.
Rosalinde fuhr ihn an: „Nichts da! Du suchst deinen Vater! Wenn du erwachsen bist, kannst du immer noch nach Afrika gehen.“
„Schon gut. Aber was ist, wenn mein Vater mich nicht bei sich haben will? Vielleicht jagt er mich fort.“
„Kann sein. Reiche Leute haben manchmal seltsame Anwandlungen.“
„Wie kommst du darauf, dass er reich ist?“
„Weil er viele Jahre lang Geld an Grabow gezahlt hat, damit der dich groß zieht. Wäre er nicht reich, hätte er dich einfach ausgesetzt oder in ein Findelheim gegeben. So etwas passiert ja alle Tage.“
Sein Vater ein reicher Mann! Auf die Idee war Benjamin noch nie gekommen. Er stellte sich seinen Vater immer als jemanden vom Rummel vor. Aber richtig reich war auf dem Rummel niemand – nicht einmal Breitmann, wenn man ihn mit den wohlhabenden Bürgern einer Stadt verglich. „Glaubst du, er war so richtig reich, mit eigenem Haus und Kutsche und allem?“, fragte er, fuhr aber ohne Rosalindes Antwort abzuwarten fort: „Das kann nicht sein. So jemand hat keinen Mischlingssohn. Der würde mich nicht einmal als Diener nehmen.“
Rosalinde stopfte Kuchen in sich hinein, deshalb verstand er ihre Antwort zunächst nicht. Es ging ihr besser an diesem Abend, das konnte Benjamin an ihrem zufriedenen Gesichtsausdruck erkennen. Außerdem war süßer Tee mit Kuchen ihr Lieblingsessen.
„Unsinn, er muss dich gern haben“, wiederholte sie deutlicher. „Auch das lässt sich daraus schließen, dass er für dich bezahlt. Zumindest hat er ein schlechtes Gewissen.“
„Du hast ziemlich viel Verstand für ein Mädchen“, lobte Benjamin.
„Und ziemlich viel Gewicht, das gleicht sich wieder aus. Denkst du an mich, wenn du bei deinem Vater bist?“
„Wenn er wirklich reich ist ...“ Benjamin stockte bei dem Gedanken an all das, was möglich wäre mit viel Geld. Es dauerte eine Weile, bis ihm auffiel, dass Rosalinde ihn wartend ansah. „Dann werde ich ihn bitten, dich in eine Klinik zu schicken, wo du ohne Nachteile abnehmen kannst“, versprach er. Er umarmte Rosalinde, so gut es ging, wischte ihr mit seinem Taschentuch eine Träne von den dicken Backen und verließ sie.


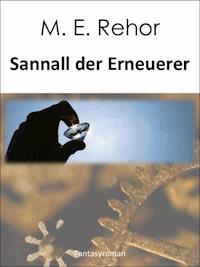
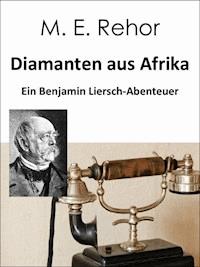













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











