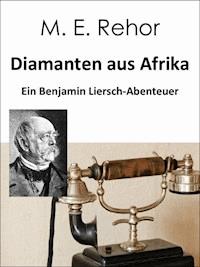
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Benjamin und sein Freund Saban kämpfen im Berlin des Jahres 1888 gegen Kriminelle, die Rohdiamanten aus der Kolonie Deutsch-Südwestafrika für politische Zwecke missbrauchen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Ankunft in Hamburg, Frühjahr 1888
Sabans Weg nach Berlin
Rummelplatz
Schornsteinfeger!
Benjamin in Berlin
Benjamin auf dem Rummelplatz
Gefangen!
Hans und Vetter Erich
Kommerzienrat Wilhelm Riehmann
Bettina
Saban ganz in Schwarz
Dem Grafen aufs Dach steigen
Saban und Benjamin
Benjamin belauscht den Grafen
Verfolgt!
Saban in der Villa Riehmann
Der Journalist
Das Treffen der Junker
Die Verschwörung der Junker
Nachricht nach Friedrichsruh
Graf von Wolfer bei Riehmann
Herr Liersch greift ein
Neue Pläne
Wieder gefangen
Flucht
Gerichtsverhandlung
Diamanten aus Afrika
Ein Benjamin Liersch-Abenteuer
von M. E Rehor
Imprint
„Diamanten aus Afrika“ von M. E. Rehor
Copyright 2012 - M. E. Rehor, Berlin
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-1888-6
Titelfotos: Elfriede Fleck, Ralf Hettler - istockphoto.com
- - -
Benjamin Lierschs erstes Abenteuer ist unter dem Titel „Der Brief der Königin“ erschienen.
- - -
Weitere Bücher von M. E. Rehor
Der Thymian-Mord - Kriminalerzählungen
Czordan und der Millionenerbe - Kriminalroman
Gerrit aus Neukölln - Kriminalroman
Freiheit und Liebe - Historischer Roman
Der Nebelkontinent - Fantasyroman
Die Brückeninseln - Fantasyroman
Sannall der Erneuerer - Fantasyroman
http://tinyurl.com/merehor
- - -
Die Personen und Begebenheiten in diesem Buch sind der Phantasie des Autors entsprungen. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Begebenheiten sind rein zufällig.
- - -
Ankunft in Hamburg, Frühjahr 1888
Die Haut des Jungen war schwarz, noch dunkler als die von Benjamin, und sein Haar war kraus. Während der Überfahrt hatte Benjamin ihn mehrmals kurz gesehen, aber da war der Junge mit Ruß und Kohlenstaub bedeckt gewesen. Er arbeitete wahrscheinlich als Heizer unten an der riesigen Dampfmaschine des Schiffes. Eben kam er wieder aus einer Luke hoch an Deck.
Benjamin machte seinen Vater auf ihn aufmerksam. Doch bis der hinsah, war der schwarze Junge wieder verschwunden.
„Warum interessierst du dich für ihn?“, fragte sein Vater.
„Er sieht aus, als ob er Angst hat“, antwortete Benjamin.
Benjamins Vater wandte sich an den Ersten Offizier und erkundigte sich, ob ein Afrikaner unter der Mannschaft sei.
„Nein, Herr Legationsrat“, lautete die Antwort. „Wo sollte der auch herkommen? Wir pendeln nur zwischen London und Hamburg.“
„Erkundigen Sie sich bitte beim Kapitän“, verlangte Benjamins Vater. „Vielleicht weiß er etwas.“
Der Erste Offizier fasste das als Beleidigung auf, wie Benjamin an dessen mahlenden Kiefern erkannte. Aber er gehorchte, denn Benjamins Vater war nicht irgendwer, sondern der Geheime Legationsrat Gregor Liersch. Ein Sonderbevollmächtigter von Fürst Bismarck bei der deutschen Botschaft in London, ausgestattet mit einem Diplomatenpass. Der Legationsrat befand sich auf dem Weg nach Berlin, um Bismarck in einer dringenden politischen Angelegenheit persönlich zu sprechen. So viel wussten die Offiziere an Bord, und deshalb genoss Gregor Liersch eine besondere Stellung. Allerdings stimmte das mit der dringenden politischen Angelegenheit nicht so ganz. Benjamin und sein Vater waren auf einer Urlaubsreise, in deren Anschluss ein Besuch in Berlin geplant war. Fürst Bismarck wollte den Legationsrat zwar sprechen, hatte aber gleich mitteilen lassen, dass das bis nach dem Urlaub Zeit habe.
Der Erste Offizier kam zurück und salutierte zackig. „Der Kapitän lässt ausrichten, dass sich an Bord unseres Schiffes keine Afrikaner befinden, auch keine Amerikaner oder andere Personen dunkler Hautfarbe.“ Nach einem Seitenblick auf Benjamin fügte er hinzu: „Jedenfalls nicht unter der Besatzung.“ Noch einmal salutierte er, dann ging er davon, bevor der Legationsrat eine weitere Frage stellen konnte.
„Du hast dich also geirrt, Benjamin“, sagte Gregor Liersch. „Wahrscheinlich war es ein Junge mit sonnengebräunter Haut, der durch den vielen Kohlenstaub schwarz aussah.“
„Er ist Afrikaner“, beharrte Benjamin. „Ich irre mich nicht.“
Wie sollte er auch, stammte doch seine eigene Mutter aus Afrika. Er selbst war also halb Afrikaner, weil sein Vater sich während einer diplomatischen Mission in Afrika in seine Mutter verliebt und sie geheiratet hatte. Benjamin war nie in Afrika gewesen, aber er spürte seine Verbundenheit zu diesem Kontinent, wann immer die Rede darauf kam. Er war sich sicher, in dem fremden Jungen fast ein Ebenbild seiner selbst entdeckt zu haben.
In der Ferne tauchten die Lichter des Hamburger Hafens in der Abenddämmerung auf. Noch eine Viertelstunde, dann würde der Dampfer anlegen. Es war Zeit, sich um das Gepäck zu kümmern. Schnell sammelten sich die Passagiere. Jeder wollte ganz vorne sein, sobald die Matrosen die Gangways anlegten. Die einfachen Reisenden drängelten sich in einer lautstarken Menge, diejenigen der Ersten Klasse standen hochnäsig im Hintergrund. Für sie gab es eine eigene Gangway, über die sie direkt zu den wartenden Droschken und Kutschen gelangten, während ihre Dienerschaft und einige Helfer die Koffer verluden.
Benjamin stand mit seinem Vater an der Reling und sah dem Treiben zu. Sie hatten keine Eile, weil sie erst am folgenden Morgen weiterreisen wollten.
Das Gewirr von Menschen unten am Kai lichtete sich allmählich, Pferdeomnibusse und Droschken fuhren los und brachten die Passagiere in die Stadt.
Hinter Benjamins Rücken ertönte Geschrei. Er drehte sich um und sah einen Matrosen, der den schwarzen Jungen mit einem Tauende bedrohte, während ein zweiter Matrose versuchte, den Jungen festzuhalten.
„Verdammter blinder Passagier!“, fluchte der Matrose. „Das werden wir dir ein für alle Mal austreiben.“ Er schlug mit dem Tauende zu.
Der Junge riss sich im letzten Moment los. Das Tau pfiff durch die Luft, während der Junge davonrannte. Er kam wenige Meter entfernt an Benjamin vorbei, sprintete die Gangway der Ersten Klasse hinunter und stieß dabei eine vornehme Dame in einem weißen Kleid beiseite. Die Dame kreischte auf; erst vor Schreck und dann vor Ärger, als sie den großen schwarzen Fleck auf ihrem Kleid sah, den der Zusammenstoß hinterließ.
Im Zickzack rannte der Junge weiter, dem Schutz der Lagerhallen entgegen, die in einiger Entfernung standen.
„Ich bin gleich wieder da“, rief Benjamin seinem Vater zu und spurtete hinter dem Jungen her.
Eine der Lagerhallen wurde nicht mehr genutzt. Vor ihrer halboffenen Türe stapelte sich Bauschutt, die Fenster waren zerschlagen. Die Arme der Kräne oben an den Luken standen schief oder waren abgebrochen. Auf diese Lagerhalle hielt der Flüchtige zu. Benjamin war noch fünfzig Meter hinter ihm, als der Junge durch die Tür ins Innere verschwand.
Benjamin folgte ihm. Doch kaum war er drinnen, blieb er stehen. Es war finster hier. Nur eine Ahnung von Licht kam durch ein paar kaputte Fensterscheiben herein.
„Wo bist du?“, rief Benjamin. „Ich tu dir nichts, ich will dir helfen!“
Keine Antwort. Benjamin hielt einen Moment die Luft an, um nicht durch sein eigenes hektisches Atmen abgelenkt zu werden. Doch der Lärm, der vom Kai herüber drang, machte es unmöglich, leise Geräusche zu hören, wie sie ein Mensch verursachte, der durchs Dunkel schlich.
Noch einmal rief Benjamin, dann ging er vorsichtig daran, das Innere der Halle zu erkunden. Seine Augen gewöhnten sich an das schwache Licht, er erkannte Kisten, Gerümpel, eine alte Kutsche mit gebrochenem Hinterrad. Hinter der Kutsche bewegte sich etwas. Benjamin ging darauf zu. Seine Hände tasteten nach Halt, während er über den Schutt stieg, der im Weg lag. Er griff in Dreck und Spinnweben, als er das brüchige Leder des Kutschenaufbaus anfasste.
„Ich will dir nichts tun“, wiederholte er halblaut. „Ich heiße Benjamin und stamme aus Afrika. Du auch?“
Er umrundete die Kutsche und hoffte, den Jungen nun vor sich zu sehen, aber da war niemand. Enttäuscht setzte er sich auf einen Stapel Säcke, die irgendein grobkörniges Material enthielten, vielleicht verdorbene Kaffeebohnen, die herausrieselten. Plötzlich spürte er jemanden hinter sich. Bevor er sich umdrehen konnte, drückte sich kühles Metall an seine Kehle. „Ich habe ein Messer“, sagte eine Stimme auf Deutsch, aber mit einem deutlichen Akzent. „Was willst du?“
Benjamin saß regungslos und bewegte nur die Lippen, als er antwortete: „Ich bin halber Afrikaner. Ich kenne sonst keine Afrikaner in Deutschland. Deshalb will ich mit dir reden. Wer bist du und wo kommst du her?“
„Ich heiße Saban. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich muss nach Berlin. Deshalb habe ich mich an Bord des Schiffes geschmuggelt. Die Heizer haben mir geholfen, weil ich mitgearbeitet habe. Aber die anderen Matrosen mögen keine blinden Passagiere.“
„Mein Vater und ich fahren nach Süddeutschland, Urlaub machen, aber danach auch nach Berlin. Wir könnten uns in Berlin treffen. Wenn du kein Geld für die Fahrt hast, leihe ich dir welches.“
Benjamin fühlte, wie das Messer von seiner Kehle weggenommen wurde. Er wollte sich umdrehen, doch Saban befahl: „Rühr dich nicht! Warum bist du ein halber Afrikaner?“
„Meine Mutter kommt von dort. Mein Vater ist Deutscher. Er wartet auf dem Schiff.“
„Ich habe von ihm gehört, und von dir. Die Heizer sagen, er sei ein Politiker. Sie halten nicht viel von Politikern. Bist du in Deutschland aufgewachsen?“
„Ja, auf dem Rummel. Ich war Darsteller in einer Kuriositätenschau, aber mein Vater wusste nichts ...“ Benjamin unterbrach sich, weil Saban an ihm vorbei sprang und nun vor ihm stand.
„Gib mir Geld“, forderte Saban und streckte die Hand aus. „Schnell!“
Anstatt das zu tun, starrte Benjamin das Messer an, das Saban immer noch in der Hand hielt.
Saban bemerkte es und steckte das Messer weg. „Man muss immer bereit sein, sich zu wehren“, erklärte er.
Benjamin zog das Bündel deutscher Geldscheine heraus, das ihm sein Vater als Taschengeld für den Urlaub und den Aufenthalt in Berlin gegeben hatte.
Saban schnappt das Geld aus Benjamins Hand und stopfte es sich in die Hosentasche. „Danke. Ich gebe es dir irgendwann zurück. Wie heißt du und wo wohnst du in Berlin?“
„Benjamin Liersch. Frag im Hotel Zentral am Gendarmenmarkt nach Legationsrat Liersch. Wir werden allerdings erst in einigen Wochen in Berlin sein.“
„Jemand kommt“, sagte Saban. Er warf sich herum und rannte davon.
„Warte!“, rief Benjamin ihm nach. Er wollte Saban folgen, doch vom Eingang her kamen zwei Männer auf ihn zu. Benjamin erkannte vor dem Hintergrund der Lichter des Hafens, dass es der Matrose mit dem Seilende und sein Kumpan waren. „Haben wir dich endlich du schwarzer Affe!“, schrien sie. „Jetzt bekommst du, was du verdienst.“
Benjamin sah ihnen furchtlos entgegen. „Saban ist weg“, erklärte er, als sie ihn erreichten.
Doch die Matrosen hörten nicht auf ihn. Einer packte ihn schmerzhaft an den Armen und zwang ihn in die Knie, der andere holte mit dem Tau aus und schlug zu.
„Ich bin nicht Saban!“, schrie Benjamin, dem nun aufging, dass sie ihn mit dem blinden Passagier verwechselten. Sie erkannten in dem Halbdunkel der Lagerhalle seine dunkle Haut, die breite Nase und die schwarzen Kraushaare. Das genügte den Matrosen offenbar, um sicher zu sein, den Richtigen vor sich zu haben.
Das Tau schlug durch Jacke und Hemd hindurch schmerzhafte Striemen in Benjamins Haut. Er versuchte, sich zu befreien, schaffte es aber nicht. Immer wieder schrie er, er sei der Falsche.
„Wir prügeln dich tot, du Ratte, als Warnung für andere deiner Sorte“, lautete die einzige Entgegnung, die er bekam. Wieder holte der Matrose aus.
Eine scharfe Stimme befahl: „Aufhören!“
Benjamins Vater und der Erste Offizier des Schiffes kamen heran. Der Offizier trug eine Petroleumlampe, mit der er die Szene beleuchtete.
„Ihr geht aufs Schiff!“, wies er die Matrosen an. „Dort steht ihr bis auf weiteres unter Arrest.“ Mit ein paar knappen Worten entschuldigte er sich dann bei Legationsrat Liersch für den Vorfall – nicht jedoch bei Benjamin, was den ziemlich wütend machte. Doch Benjamin war zu sehr damit beschäftigt, gegen den brennenden Schmerz in seinem Rücken anzukämpfen, und gegen die Tränen, die ihm deswegen zu kommen drohten. Deshalb sagte er nichts.
Der Offizier kehrte aufs Schiff zurück, um Maßnahmen zu ergreifen, wie er beim Weggehen sagte.
Benjamin ging mit seinem Vater langsam aus der alten Lagerhalle zu der wartenden Kutsche, die sie zu ihrem Hotel bringen würde. Ihm fiel auf, dass er von den umstehenden Menschen angestarrt wurde, aber das widerfuhr ihm wegen seiner Hautfarbe häufiger. Besonders ein elegant gekleideter Mann mit Backenbart konnte den Blick nicht von ihm wenden. Auffallend war jedoch nicht nur das Interesse dieses Mannes, sondern dass er sich in Begleitung mehrerer Hafenarbeiter befand, die ihrem Aussehen nach auch Raufbolde und Ganoven hätten sein können. Benjamin hatte den Mann während der Überfahrt auf dem Schiff gesehen. Er fragte sich, warum diese merkwürdige Gruppe am Kai stand, aber als die Kutsche losfuhr, vergaß er sie wieder.
Ihr vierwöchiger Urlaub führte Benjamin und seinen Vater in einem Bogen von Hamburg über Hannover und Frankfurt nach Süddeutschland. In der Nähe von München besuchten sie ein Hotel, das zwar nicht den gehobenen Standard bot, den der Legationsrat sonst für sich beanspruchte. Aber die Inhaber waren ein freundliches Ehepaar, das Benjamin aus seiner abenteuerlichen Zeit auf dem Rummel kannte. Man sprach viel über die gemeinsamen Erlebnisse und die schöne Zukunft, die man sich erhoffte. Vater und Sohn wanderten im Bayerischen Wald, sie besuchten Dresden und kamen schließlich nach Berlin. Fast fünf Wochen waren vergangen, seit sie in Hamburg an Land gingen.
Benjamin ahnte nicht, was er in dieser Zeit in der Hauptstadt verpasste.
Sabans Weg nach Berlin
Die Begegnung mit dem dunkelhäutigen Jungen brachte Saban durcheinander. Es lebten also auch Menschen in Deutschland, die aus Afrika stammten – oder bei denen mindestens ein Elternteil Afrikaner war. Das hatte er sich bisher nicht vorstellen können.
Während er sich im Dunkel der Hafenanlagen ein Versteck für die Nacht suchte, ließ ihn der Gedanke nicht los, diese Menschen müssten auch bereit sein, ihn und seine Sache zu unterstützen. Vielleicht gab es in Berlin, dem Ziel seiner Reise, noch mehr von ihnen. Er würde sich umhören, sobald er dort war.
Das Nachdenken macht ihn unaufmerksam. Als er einen passenden Unterschlupf entdeckte, einen windgeschützten Bretterverschlag in einer dunklen Ecke, ging er einfach darauf zu. Er war noch zwei Schritte davon entfernt, als sich jemand von hinten auf ihn warf und ihn zu Boden drückte, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte.
„Rühr dich nicht, sonst passiert was!“, befahl eine raue Männerstimme.
Saban spürte, wie der Angreifer seine Position so änderte, dass er ihn mit den Knien am Boden hielt. Die linke Hand umfasste Sabans Nacken, mit der Rechten tastete er Sabans Kleidung ab. Er fand das Messer und die Geldscheine, die Saban erst vor einer Viertelstunde von Benjamin bekommen hatte.
„Geld?“, fragte die Männerstimme verblüfft. „Wieso treibt sich jemand, der Geld hat, nachts hier herum? Mit dir stimmt etwas nicht, Junge.“
Das Messer erwähnte der Mann nicht, er schien es für normal zu halten, bewaffnet zu sein. „Wie heißt du?“, fragte er.
„Saban.“
„Blöder Name. Woher?“
„Mit dem Schiff aus London.“
„Lüg mich nicht an. Niemand fährt mit einem Bündel Geld von London nach Hamburg und läuft dann direkt ins schlimmste Hafenviertel.“
„Ich bin als blinder Passagier mitgefahren, weil ich das Geld noch nicht hatte. Die Scheine hat mir vorhin jemand geschenkt.“
Der Mann lachte laut auf und ließ Saban los. „So einer bist du also. Ja, das kenne ich! Immer mal wieder ‚schenken‘ auch mir Leute ihr Geld. Manche freiwillig, wenn ich in der Innenstadt bettle, manche nicht so freiwillig, wenn ich mich selbst bediene. Was ich nur tue, wenn die Not groß ist, versteht sich. Man ist ja ein anständiger Mensch, nicht wahr?“
Saban stand auf und drehte sich um. Der Mann, der ihn angefallen hatte, ging in den Bretterverschlag und entzündete eine Kerze. Er sah schlimmer aus als die Obdachlosen, die Saban in London angetroffen hatte. Wild wucherndes, weißes Haar bedeckte Kopf und Gesicht. Eine krumme Nase hing weit über den grinsenden Mund, in dem von Zigarrenrauch gelb gefärbte Zähne zu sehen waren. Der Mann trug abgerissene Kleidung und einen schief aufgesetzten Hut mit einer Vogelfeder im Hutband.
So aufmerksam, wie Saban den Mann musterte, wurde er seinerseits betrachtet. „Schau an, ein Afrikaner“, sagte der Mann. „Einer, der Deutsch spricht. Südwestafrika, vermute ich mal, aus der Kolonie. Was verschlägt denn einen wie dich hierher?“ Und dann fügte er ein paar kaum verständliche Worte in Sabans Muttersprache hinzu: eine Begrüßungsformel und ein wüstes Schimpfwort.
Überrascht antwortete Saban in derselben Sprache, aber der Mann verstand ihn nicht.
„Ist lange her, dass ich dort unten war, Kleiner. Trockene Gegend, war nichts für mich. Lieber hier ein Penner sein, als dort unten Soldat spielen. Aber ihr seid anständige Leute, ihr Schwarzen. Hier, nimm deinen Kram zurück.“ Er hielt Saban das Messer und das Geld entgegen. „Ich heiße Roland. Du kannst mich Rolli nennen, das tun alle. Wegen meines Vornamens und weil ich mal so dick war, dass man mich hätte rollen können. Ist lange her, lange her.“
Der Mann war alt, Saban schätzte ihn auf sechzig Jahre, und hager. Die hellblauen Augen wiesen einen Stich ins Gelbe auf, wahrscheinlich hatte Rolli in seinem Leben zu viel Alkohol getrunken – oder sich in Afrika eine der Krankheiten eingefangen, die die Leber angriffen. Weiße waren da besonders anfällig, hatte Saban gehört.
„Setz dich“, forderte Rolli und zeigte auf eine Kiste. Er selbst setzte sich ebenfalls. Eine dritte Kiste diente ihm als Tisch, auf dem er sein Abendessen ausbreitete: einen Kanten Brot, einen geräucherten Fisch, ein Stück stinkenden Käse und eine Literflasche Bier. „Du bist eingeladen, Kleiner.“
Saban, der mindestens einen Kopf größer war als Rolli, lehnte lächelnd ab. „Ich habe auf dem Schiff gegessen. Die Heizer haben mir etwas gegeben, weil ich ihnen geholfen habe.“
„Umso besser, bleibt mehr für mich.“ Rolli begann zu essen. „Jetzt erzähl, was du in Hamburg treibst. Noch dazu ausgerechnet hier, bei den alten Lagerhallen.“
„Ich will nach Berlin. Mit dem Kanzler sprechen, Fürst Bismarck“, erklärte Saban, der zunehmend Vertrauen zu dem alten Mann fasste.
„Bismarck?“ Rolli lachte. „Warum nicht gleich mit dem Kaiser?“
„Geht denn das?“
„Nein, natürlich nicht. Genauso wenig, wie du mit Bismarck sprechen kannst. Du noch weniger als ich; und ich schon gleich gar nicht. Dazu müsstest du mindestens ein Von-und-zu sein, mit Adelstitel. Oder ganz viel Geld haben. Ein paar Millionen, und alle Türen stehen dir offen. Auch die von Bismarck. Sogar vom Kaiser sagt man, er sei manchmal klamm und empfange deshalb Leute, die bereit sind, ihm Geld zu leihen.“
Verblüfft hakte Saban nach: „Der Kaiser muss sich Geld borgen?“
„Gerüchte, alles nur Gerüchte“, beschwichtige Rolli. „Es geht ja nicht darum, dass er die Palastmiete für den nächsten Monat nicht bezahlen könnte. Aber ein paar Millionen hier und ein paar Millionen da tun seiner Schatulle sicherlich auch gut.“
„Millionen habe ich nicht.“
„War ja nur ein Beispiel. Wegen des Kaisers.“ Rolli nahm einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche. „Um Bismarck steht es auch nicht besser. Was willst du denn von ihm?“
Saban druckste herum. „Es gibt da ein Problem bei meinen Leuten in Afrika. Ich glaube, dass er nichts davon weiß. Wenn ich ihm davon erzähle, hilft er uns vielleicht. Schließlich ist Südwestafrika jetzt eine deutsche Kolonie, also ist die deutsche Regierung auch für uns da.“
Rolli schob die Reste seiner Mahlzeit beiseite und legte die Beine auf die Kiste, die ihm als Tisch diente. Aus einer Tasche seines Mantels zog er einen Zigarrenstumpen, den er mit kennerischer Miene musterte, bevor er sich zu Seite beugte, um ihn an der Flamme der Kerze anzuzünden. Atemberaubender Gestank breitete sich in dem Bretterverschlag aus.
„Bismarck hilft dir nur, wenn es ihm mehr nützt als dir. Er soll kein angenehmer Mensch sein, was das angeht. Aber vielleicht kann ich dir helfen, und wenn es nur mit einem guten Ratschlag ist. Ich hab ne Menge gesehen in meinem Leben, das darfst du mir glauben. Also spuck es aus!“ Mit den letzten Worten spuckte Rolli ein paar Krümel Zigarrentabak auf den Boden, die ihm an den Lippen klebten. Dann lehnte er sich zurück und schloss erwartungsvoll die Augen.
Es fiel Saban nicht leicht, über die Angelegenheit zu sprechen, aber er hatte nichts zu verlieren, also vertraute er sich Rolli an. „In Südwestafrika gibt es Diamanten“, begann er.
„Weiß ich“, brummte Rolli, ohne die Augen zu öffnen.
„Vor einigen Monaten sind einige besonders große, reine Rohdiamanten aufgetaucht. Sie gehören zu den wertvollsten, die man je in Afrika gefunden hat. Niemand weiß, wo sie herkamen. Genauer gesagt, kein Weißer weiß es. Die Diamanten hat mein Volk an einen Händler verkauft, um an Geld zu kommen. Wir haben nämlich gelernt, dass man in der Welt der Europäer ohne Geld nichts zählt.“
„Das ist nur zu wahr. Dein Stamm sitzt also auf einer Diamantmine?“ Rolli blinzelte jetzt kurz zu Saban hinüber, wie um zu prüfen, ob der ihn auf den Arm nahm.
„Vielleicht. Mein Vater hat die Diamanten eines Tages mitgebracht. Bei uns darf nur der Häuptling solche Geheimnisse wissen. Ein Deutscher wollte hinter dieses Geheimnis kommen. Er hat einige Männer aus unserem Stamm betrunken gemacht und ausgehorcht.“
„Verdammter Alkohol!“, schimpfte Rolli und nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Bierflasche.
„Daraufhin hat dieser Deutsche ein paar Verbrecher angeheuert, die meinem Vater aufgelauert haben. Sie wollten von ihm erfahren, wo die Rohdiamanten herkommen, um dort eine Mine zu errichten. Er hat es ihnen nicht gesagt, obwohl sie ihn fast todgeprügelt haben. Zwei Tage später ist er dann gestorben.“
„Dann bist du jetzt Häuptling?“
„Nein, es wurde ein neuer Häuptling gewählt, der älter ist als ich. Aber mein Vater hatte nicht mehr die Zeit, ihn in die Stammesgeheimnisse einzuweihen.“
„Tragisch, tragisch“, sagte Rolli. „Aber es erklärt immer noch nicht, warum du hier bist.“
„Um zu erfahren, warum die Weißen so brutal sind, bin ich nach Lüderitz geschlichen und habe sie belauscht. Ihren ganzen Plan habe ich gehört. Sie wollen das Land, auf dem sie die Diamantmine vermuten, kaufen, meinen Stamm versklaven und die Diamanten ausgraben lassen. Wir wollen aber keine Sklaven werden.“
„Ich glaube nicht, dass unsere Regierung Sklavenhaltung erlauben würde. Das ist doch rückständig.“
„Wenn sie es erfährt, unternimmt sie sicherlich etwas dagegen. Aber wenn es ihr niemand sagt ...“
„Verstehe. Du bist also hier, um Bismarck auf den Plan dieser Gauner hinzuweisen, in der Hoffnung, dass er euch hilft. Deshalb hast du dir mit dem Geld für die Diamanten ein Schiffsticket nach Hamburg gekauft. Weil du mir nicht traust, hast du mich vorhin angeschwindelt und behauptet, jemand habe dir das Geld geschenkt.“
„Nein, es war anders. Ich wusste, dass ich von Lüderitz aus nicht nach Deutschland fahren kann. Die Verbrecher hätten mich abgefangen. Ein afrikanischer Junge, der alleine nach Hamburg will, das wäre nie gutgegangen. Deshalb bin ich weit in den Süden gereist, in englisches Gebiet. Vom Hafen in Port Nolloth aus bin ich als Helfer mit einem Erzfrachter nach England gefahren.“
„Hast du überhaupt einen Pass?“, fragte Rolli dazwischen.
„Nein. Ich habe mich als Sohn eines reichen Afrikaners ausgegeben, der in England zur Schule gehen soll. Engländer erlauben so etwas.“
„Woher kannst du überhaupt Deutsch?“, wollte Rolli wissen.
„Ein Missionar hat es mir beigebracht. Deutsch und Englisch. Er hat mir auch viel erzählt über die Europäer und das Leben in ihren Ländern.“
„Ein Missionar? Ein Jesuit, wahrscheinlich. Die treiben sich in allen Weltgegenden herum. Du bist also nach London gelangt. Weiter?“
„In London blieb ich drei Wochen. Es war die erste europäische Stadt, die ich kennengelernt habe. Ich glaube, ich habe mich ziemlich dumm angestellt. Man hat mir innerhalb von ein paar Tagen mein ganzes Geld geklaut. Deshalb musste ich mich als blinder Passagier auf den Dampfer nach Deutschland schmuggeln.“ Saban machte eine resignierte Geste. „Und jetzt bin ich hier.“
„Jetzt bist du in Hamburg. Aber wieso schleichst du wie ein Verbrecher durch die dunklen Ecken des Hafens?“
„Vorhin waren Männer am Kai, die ich schon in Lüderitz gesehen habe. Es sind welche von diesen Verbrechern und einer, der vielleicht ihr Anführer ist. Ich muss mich vor ihnen verstecken.“
„Verstehe.“ Rolli sog energisch an dem winzigen Stummel der Zigarre, den er noch zwischen seinen Lippen hatte, und dachte einige Minuten nach.
„Du hast also drei Probleme: Erstens, du willst nach Berlin, ohne dass die Gauner es merken. Zweitens, wie schaffst du es, dort mit Bismarck oder einem anderen einflussreichen Politiker zu reden? Und drittens, falls du das schaffst, wie erreichst du, dass man deinem Stamm hilft?“
„So ist es.“
Wieder schwieg Rolli eine Weile, bevor er sagte: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Geschichte glauben soll. Aber da es mich nichts kostet, kann ich dir zumindest einen Tipp geben, was die Reise nach Berlin angeht. Es gibt wenige Afrikaner in Deutschland. Wenn du also in einen Zug steigst, wirst du sofort auffallen. Du musst auf eine Art reisen, bei der man sich nicht über einen Afrikaner wundert.“
„Was kann ich tun?“, fragte Saban gespannt.
„In Hamburg-Bergedorf gastiert im Moment ein Rummel. Die bauen bald ihre Schaugeschäfte ab, weil sie nach Berlin weiterreisen wollen. Auf dem Rummel sieht man öfter Bewohner anderer Kontinente in den Kuriositätenschauen. Du könntest die Leutchen mal fragen, ob sie einen wie dich brauchen können. Dann hättest du die Reise umsonst, es wäre eine prima Tarnung und du verdienst noch Geld dabei.“
Saban überlegte. Hatte der dunkelhäutige Junge vorhin nicht auch erzählt, er habe auf dem Rummel gearbeitet? Dann war das vielleicht gar keine so abwegige Idee. „Wie finde ich den Rummelplatz?“, fragte er.
„Ich bringe dich morgen hin“, versprach Rolli. „Jetzt schlafen wir erst mal. Muss ja schon nach Mitternacht sein.“
Ohne sich weiter um Saban zu kümmern, schlurfte Rolli in eine Ecke des Bretterverschlags, in der zwei Säcke auf dem Boden lagen. Er wickelte seinen Mantel fest um sich, ließ sich auf die Säcke fallen und fing keine Minute später an zu schnarchen.
Saban legte sich in eine andere Ecke, die leider nicht so gut ausgepolstert war. Er konnte lange nicht einschlafen, weil er sich fragte, welche Abenteuer ihm in diesem merkwürdigen Land noch bevorstanden.
Rummelplatz
Sabans Rolle auf dem Rummelplatz in Bergedorf war erniedrigend. Zumindest empfand er es so, obwohl ihn die Schausteller ihn mit offenen Armen aufnahmen. Ihnen waren in den Wochen zuvor einige Attraktionen abhandengekommen – ein Löwe war an Altersschwäche gestorben, der starke Mann litt seit Wochen an einem Bandscheibenvorfall und die junge Wahrsagerin war mit einem Verehrer durchgebrannt; so tuschelte man jedenfalls auf dem Rummel.
In dem kleinen Zelt, in dem Saban seine kurzen Auftritte absolvierte, präsentierte man dem staunenden Publikum menschliche Monstrositäten. Darunter verstand man alles und jeden, der von der gewohnten Norm abwich: eine Frau mit starker Körper- und Gesichtsbehaarung; einen zwei Meter zwanzig großen jungen Mann mit seiner nur ein Meter dreißig großen Ehefrau, mit der er in Wirklichkeit gar nicht verheiratet war; und nun eben auch Saban, der als schwarzer Krieger aus den Dschungeln Afrikas angekündigt wurde.
Sabans Part dauerte nur 15 Minuten, in denen er mit einem nachgemachten Speer herumsprang und unverständliche Schreie ausstieß. Die Zuschauer johlten bei ihm nicht so laut wie bei den anderen Attraktionen, aber immerhin, er bekam Applaus.
Der alte Georg Meyer, der Inhaber der Monstrositätenschau, erklärte sich bereit, ihn nach Berlin mitzunehmen und dort ein komplettes Programm für ihn auszuarbeiten. Saban war einverstanden. Doch als er fragte, was er verdienen würde, überlebte er eine Überraschung.
„Verdienen? Du kommst auf merkwürdige Ideen! Freie Unterkunft und Verpflegung gibt es. In einem Jahr reden wir dann darüber, ob du es wert bist, ein paar Groschen am Tag zu verdienen“, raunzte Meyer ihn an. „Schließlich muss ich erst das wieder reinkriegen, was ich Rolli für dich bezahlt habe.“
„Bezahlt?“, fragte Saban verblüfft.
„Klar! Denkst du, der macht etwas umsonst? Auf seine Art ist Rolli ein knallharter Geschäftsmann. Ihm gehört die Hälfte von allem, was du im ersten Jahr verdienen würdest. Was nicht viel ist.“
„Und die andere Hälfte?“
„Sagte ich doch schon: Kost und Logis. Und jetzt scher dich weg, ich muss meine Abrechnung machen.“
Meyer, das wusste Saban bereits am dritten Tag von den anderen, war ein Geizhals und ein Säufer. Abrechnung machen hieß bei ihm, dass er nachts nach dem Ende des Rummeltages sein Büro abschloss, in die Stadt ging und die Einnahmen des Tages vertrank. Morgens kam er dann aufs Gelände getorkelt, beschimpfte seine Leute und legte sich ins Bett, bis die Abendvorstellung begann. Die Nachmittagsvorstellungen für die Kinder liefen ohne ihn.
Am Abend des fünften Tages gab es eine Abschiedsvorstellung, dann bauten die Schausteller noch in der Nacht alles ab. Am folgenden Vormittag rollten die Pferdewagen zum Bahnhof, wo sie auf einen Güterzug nach Berlin verladen wurden.
„Die Sommerfeste in Berlin sind die beste Einrichtung im ganzen Kaiserreich!“, behauptete der alte Meyer, während er zusah, wie seine Leute das Material in Güterwaggons verluden. „Die Leute haben Geld in den Taschen, das Wetter ist schön – Kaiserwetter, eben! – und die ganze Arbeit ist nur ein Spaß.“
Die Leute vom Rummel leisteten sich keine Sitzplätze in einem Personenzug, sondern reisten in einem Viehwaggon des Güterzugs, auf Stroh liegend eng an eng. Für die paar Stunden bis nach Berlin ging das.
Abends trafen sie in der Hauptstadt ein und fuhren gleich weiter, nach Süden hinaus, zu einem Zwischenquartier bei Teltow. Denn die Saison hatte noch nicht begonnen, es gab noch kein Engagement für sie.
Als am übernächsten Tag der alte Meyer von seiner nächtlichen Sauftour nicht zurückkehrte, machte sich niemand Sorgen. Doch am Abend kam ein Polizist mit der Nachricht, Meyer sei in einer Kneipe zusammengebrochen. Man hatte ihn in ein Spital gebracht, wo der Arzt nur lapidar feststellte, der Mann habe sich zu Tode gesoffen, ihm sei nicht mehr zu helfen.
Niemand trauerte Meyer nach. Das wenige Geld, das man in seinem Wohnwagen fand, wurde für die Beerdigung beiseitegelegt. Schon am folgenden Morgen machten sich die Mitglieder seiner Monstrositätenschau auf den Weg nach Berlin, um sich neue Arbeitgeber zu suchen. Saban hielt sich an die haarige Frau, die in einem langen Kleid und mit einem Hut mit Trauerschleier unterwegs war, um nicht aufzufallen. Sie hatte von ein paar Schaustellern gehört, die noch Attraktionen suchten, und hoffte, dort Anstellung zu finden.
Es war ein Kinderjahrmarkt, zu dem sie gelangten. Sie bummelten an den Buden entlang. Eine Monstrositätenschau gab es nicht, aber Kleinwüchsige, die als ‚die lustigen Zwerge aus den Höhlen Norwegens‘ angekündigt wurden und ein kleines Zelt für ihren Auftritt nutzten. Die haarige Frau war enttäuscht und machte sich auf die Suche nach einem anderen Rummelplatz, aber Saban gefiel es hier. Ihm fielen Rollis Worte wieder ein, dass ein Rummel eine gute Tarnung für einen mit schwarzer Haut war. Ein Unterschlupf, bei dem sich weder die Berliner, noch die Behörden, darüber wundern würden, wenn ein Afrikaner mit dabei war. Der Jahrmarkt war klein und befand sich am Rande der Stadt, das ideale Versteck also. Deshalb ließ sich Saban den Weg zum Wohnwagen der ‚Zwerge‘ zeigen und klopfte dort an.
Ein kleinwüchsiger Mann, eigentlich noch ein Junge etwa in Sabans Alter, öffnete die Tür.
„Guten Tag!“, grüßte Saban. Dann schwieg er, denn der Kleinwüchsige starrte ihn mit offenem Mund an, als hätte er noch nie so einen Menschen gesehen. Was bei einem Schausteller kaum möglich war.
„Guten Tag!“, sagte Saban noch einmal. „Ich suche Arbeit bei einem Schausteller. Habt ihr hier auf dem Jahrmarkt etwas für mich?“
Der Kleinwüchsige wandte sich um und rief: „Mutter, komm mal her. Das glaubst du nicht!“
Eine ebenso kleine Frau, deutlich älter und breiter als der Junge, kam. Sie wischte sich die Hände an ihrer Küchenschürze ab. Als sie Saban sah, machte sie große Augen, fing sich aber gleich wieder.
„Ein Afrikaner“, stellte sie fest. „Was will er?“
„Er fragt nach Arbeit“, erklärte ihr Sohn.
„Warum stehst du dann noch hier herum, Muck? Bitte ihn herein. Nur weil er Benjamin ähnelt? Das tun alle jungen Afrikaner, vermute ich mal. Immer rein mit ihm in die gute Stube.“ Sie streckte Saban die Hand entgegen. „Willkommen. Ich bin Jedah Stolberg und das ist mein Sohn Muck. Wie heißt du? Möchtest du Kuchen? Trinkst du Kaffee? Ich mache gerade welchen.“
Jedah plauderte fröhlich vor sich hin. Saban folgte ihr in den Wohnwagen und staunte über den Aufbau, den er nun sah: Der vordere Teil des Wagens war als gutbürgerliches Wohnzimmer eingerichtet, mit Sesseln und Tisch und Bildern an den Wänden. Die hintere Hälfte dagegen war auf halber Höhe in zwei Etagen aufgeteilt. Unten befand sich eine Küche, die gerade hoch genug war für die kleinwüchsigen Bewohner des Wagens, und oben sah Saban durch halb geschlossene Vorhänge zwei Schlafkammern. Die Sessel im vorderen Teil waren von der Größe her ebenfalls auf die Bewohner zugeschnitten, aber es gab einen Stuhl für normalgroße Menschen, auf dem Saban Platz nahm.
„Wo kommst du her, mein Junge?“, fragte Frau Stolberg, während sie Kaffeegeschirr und einen Kuchen auf dem Tisch anrichtete.
Saban behauptete, er sei aus Abenteuerlust nach Europa gekommen und habe in Hamburg Anschluss an eine Schaustellergruppe gefunden. Dann berichtete er vom Schicksal des alten Meyer. Muck und seine Mutter kannten den Mann. Die meisten Schausteller in Deutschland kannten sich untereinander zumindest dem Namen nach. Deshalb glaubten sie Saban auch den ersten Teil seiner Geschichte, der geflunkert war.
„Du musst schon entschuldigen, dass wir dich vorhin so angestarrt haben“, sagte Mucks Mutter schließlich. „Aber du ähnelst einem Freund von uns, der bis letztes Jahr hier mitgearbeitet hat. Benjamin Grabow hieß er. Der alte Grabow ist jetzt tot und Benjamin heißt mit Nachnamen in Wirklichkeit Liersch und wohnt jetzt im Ausland, aber das ist eine lange Geschichte, die auch nicht jeden angeht.“
„Wir dürfen sie eigentlich gar nicht erzählen“, warf Muck wichtigtuerisch ein. „Höchste Kreise waren damals darin verwickelt und man hat uns eine Belohnung bezahlt für unsere Hilfe. Aber auch, damit wir den Mund halten, wenn du verstehst, was ich meine.“
Saban verstand es nicht, aber es war ihm auch egal. „Ich habe in Hamburg einen Benjamin getroffen, der dunkle Haut hat. Nicht ganz so dunkel, wie ich, er ist ein Mischling. Er hat mir erzählt, dass er früher auf dem Rummel gearbeitet hat. Vielleicht ist es derselbe.“
Muck sprang auf. „Das muss er sein!“, rief er. „Wir dachten, er ist in London. Wie habt ihr euch kennengelernt?“
Da Saban nicht die ganze Wahrheit erzählen wollte, berichtete er, er habe Benjamin auf dem Schiff von London kommend gesehen und sich in Hamburg kurz mit ihm unterhalten. Er fügte hinzu, dass dieser Benjamin in einigen Wochen nach Berlin kommen würde.
Das löste bei den beiden Stolbergs solche Freude aus, dass sie sich an den Armen griffen und einen Tanz vorführten, der ihren Wohnwagen wackeln ließ.
„Du bist also ein Freund von Benjamin“, sagte Muck schließlich außer Atem. „Klar, dass wir dir helfen. Die Aufbauten von Grabows damaliger Afrika-Schau schleppen wir immer noch in einem der Wagen mit uns herum. Daraus können wir ein Zelt aufbauen und ein wenig einrichten, so dass du zumindest kurze Vorstellungen für Kinder geben kannst. Die Einkünfte kannst du erst mal behalten, und wenn wir im Laufe des Sommers bessere Engagements finden, bauen wir wieder eine große Schau auf. Vielleicht findet sich noch ein zweiter Afrikaner, dann wären wir eine Attraktion in Berlin. Die Zwerge vom Norden der Weltkugel und die Afrikaner aus dem Süden. Sensationen über Sensationen! Die Zuschauer werden uns die Eintrittskarten aus den Händen reißen. Einverstanden?“
Auch wenn er die Begeisterung des kleinen Mannes nicht teilte, stimmte Saban zu. Eine bessere Tarnung konnte er nicht finden. Rolli hatte ihm ja klar genug gesagt, wie schwierig es werden würde, an einen der wichtigen Politiker heranzukommen, von Bismarck gar nicht zu reden. Saban brauchte also Zeit, um sich in Berlin umzusehen, um die Gewohnheiten der Deutschen kennenzulernen und um Wege ausfindig zu machen, wie er sein Ziel erreichen konnte.
Für die Nacht fand Saban Unterschlupf bei den Pferden, die in einem Schuppen am Rande des Rummelplatzes standen. Am folgenden Morgen packten alle Schausteller mit an und errichteten aus den Resten der ehemaligen Afrika-Schau ein brauchbares kleines Zelt für Sabans Vorstellung. Als Schlafstelle für die Nacht riet man ihm, einen Wohnwagen zu mieten. Einer der Schausteller, der Wurfbudenbesitzer Breitmann, vergab für solche Zwecke Kredite und organisierte bei Bedarf auch Wagen und Pferde.
Saban trat zunächst nur an den Nachmittagen auf, wenn viele Kinder auf dem Rummel waren. Obwohl der Rummel als Kinderjahrmarkt angekündigt war, kamen abends die Erwachsenen und wollten auch ihren Spaß haben. Das war wegen des Alkohols, der dann in Mengen konsumiert wurde, nicht ungefährlich für einen wie Saban. Zumindest behauptete Muck das.



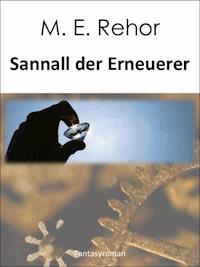













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











