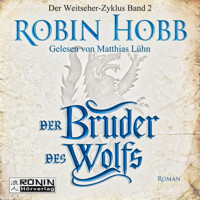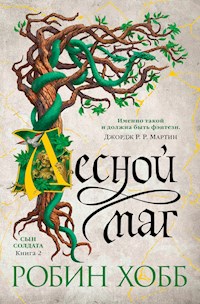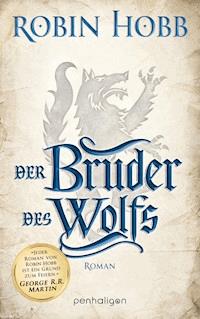
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chronik der Weitseher
- Sprache: Deutsch
»Magere Wölfe kämpfen am besten« Herzog Bryn
Fitz Chivalric hat bei der Verteidigung seines greisen Königs seine Gesundheit und beinahe auch seinen Verstand verloren. Doch König Listenreich bietet ihm keine Rache oder wenigstens Genugtuung. Schließlich war der Drahtzieher hinter Fitz' Verletzungen dessen eigener Onkel, der Sohn des Königs. Und der hat seine Pläne, um den Thron an sich zu reißen, nicht aufgegeben! Verzweifelt bemüht sich Fitz, die Intrigen des Prinzen zu durchkreuzen – und ahnt nicht, dass sein Schicksal längst besiegelt ist.
Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Des Königs Meuchelmörder« im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und unter dem Titel »Der Schattenbote« im Heyne Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1335
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Fitz-Chivalric hat bei der Verteidigung seines greisen Königs seine Gesundheit und beinahe auch seinen Verstand verloren. Doch König Listenreich bietet ihm keine Rache oder wenigstens Genugtuung. Schließlich war der Drahtzieher hinter Fitz’ Verletzungen dessen eigener Onkel, der Sohn des Königs. Und der hat seine Pläne, um den Thron an sich zu reißen, nicht aufgegeben! Verzweifelt bemüht sich Fitz, die Intrigen des Prinzen zu durchkreuzen – und ahnt nicht, dass sein Schicksal längst besiegelt ist.
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit Die Gabe der Könige, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz-Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Der Bruder des Wolfs
Die Chronik der Weitseher 2
Roman
Deutsch von Eva Bauche-Eppers
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel » Royal Assassin« bei Del Rey, New York.Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Des Königs Meuchelmörder« im Bastei Lübbe Verlag erschienen und unter dem Titel »Der Schattenbote« im Heyne Verlag.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 1996 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Covergestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, InkcraftCovermotiv: iStock.com/blgredlynx
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-17760-7V004www.penhaligon.de
Für Ryan
Prolog
Träume und Erwachen
Weshalb ist es verboten, genaues Wissen über Magie schriftlich niederzulegen? Vielleicht, weil wir alle fürchten, solches Wissen könnte in die Hände einer Person fallen, die nicht geeignet ist, davon Gebrauch zu machen. Von jeher hat es ein System der Ausbildung von Schülern gegeben, um sicherzustellen, dass spezifische Kenntnisse auf diesem Gebiet nur an jene vermittelt werden, die wissen, was sie tun, und sich würdig erwiesen haben. Während dies ein löblicher Versuch zu sein scheint, uns vor unlauteren Autodidakten zu schützen, wird dabei außer Acht gelassen, dass nicht dieses Wissen die Grundlage ist, aus der Magie entsteht. Die Befähigung für eine bestimmte Form der Magie ist entweder angeboren oder nicht vorhanden. Die Fähigkeit für die Gabe, zum Beispiel, ist eng mit der Blutlinie des Königshauses der Weitseher verknüpft, obwohl sie auch als »wilder Trieb« bei Leuten vorkommt, die durch ihre Vorfahren sowohl von den Inlandvölkern als auch von den Fernholmern abstammen. Jemand, der in der Gabe ausgebildet ist, vermag das Bewusstsein eines anderen über jede Entfernung hinweg zu berühren und dessen Gedanken zu lesen. Die in besonderem Maße der Gabe Kundigen sind imstande, die Gedanken des Betreffenden zu beeinflussen oder mit ihm zu kommunizieren. Alles in allem ist das ein durchaus nützliches Werkzeug, um in einer Schlacht die Truppen zu befehligen oder Nachrichten zu übermitteln.
Im Volk weiß man von einer seit undenklichen Zeiten existierenden Magie, der alten Macht. Sie ist heutzutage verpönt, und es wird kaum jemand zugeben, diese Fähigkeit zu besitzen. Es heißt immer nur, die Bewohner dieses oder jenes nächsten Tals seien darin bewandert oder die Menschen jenseits der fernen Hügel. Ich vermute, die alte Macht war einst das natürliche Talent derer, die als Jäger dieses Land durchstreiften, statt sesshaft zu werden; eine spezielle Form der Magie für all jene, die sich den wilden Tieren des Waldes verbunden fühlten. Die alte Macht, so heißt es, verlieh einem die Fähigkeit, die Sprache der Tiere zu verstehen, doch eine Warnung gab es dabei zu beachten: All jene, die die Macht zu lange oder zu gekonnt ausübten, würden sich schließlich in das Tier verwandeln, mit dem sie sich verbunden hatten. Aber das sind vielleicht nur Märchen.
Daneben gibt es die Heckenmagie, obwohl es mir nie gelungen ist, den Ursprung dieser Bezeichnung herauszufinden. Diese nur teilweise durch Beweise belegte und teils recht fragwürdige Form der Magie umfasst das Deuten von Handlinien, das Wasserlesen, die Weissagung aus der Kristallkugel sowie eine Vielzahl anderer hellseherischer Praktiken, die vorgeben, die Zukunft vorhersagen zu können. Eine eigene, nicht näher benannte Gruppe bilden die magischen Spielarten, mit denen physische Effekte erzeugt werden, wie etwa Unsichtbarkeit und Levitation, also toten Dingen Leben einzuhauchen oder sie in Bewegung zu versetzen – sämtlicher Hokuspokus aus den alten Märchen. Ich weiß von keinem Volk, das die letztgenannten Kräfte für sich in Anspruch nehmen kann. Sie scheinen einzig Auswüchse der Fantasie zu sein, die in ferner Vergangenheit oder fremden Ländern angesiedelt sind oder Geschöpfen der Mythologie zugeschrieben werden: Drachen, Riesen, den Uralten, den Anderen, Elfen.
Ich muss innehalten, um die Feder zu reinigen. Auf diesem armseligen Papier zerläuft der feinste Strich zu unförmigem Gekleckse, doch ich will für diese Worte kein gutes Pergament verwenden; zumindest vorläufig nicht. Ich zweifle, ob es gut ist, sie aufzuschreiben. Warum sie überhaupt dem Papier anvertrauen? Wird diese Geheimlehre nicht mündlich an jene weitergegeben werden, die ihrer würdig sind? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Was wir in unserer Zeit für ganz selbstverständlich halten, nämlich die Kenntnis dieser Dinge, mag eines Tages für unsere Nachfahren nur noch staunenswert und ein Rätsel sein.
In allen Bibliotheken lässt sich nur wenig Material über Magie finden. Mühselig verfolge ich einen roten Wissensfaden durch einen Flickenteppich von Informationen. Ich entdecke vereinzelte Querverweise, beiläufige Andeutungen, mehr nicht. In den letzten Jahren habe ich alles gesammelt und meinem Gedächtnis eingeprägt, immer mit der Absicht, mein Wissen aufzuschreiben – all das aufzuschreiben, was ich aus eigener Erfahrung weiß, aber auch all jenes, was ich in akribischer Kleinarbeit zusammengetragen habe. Antworten vielleicht für einen anderen armen Dummkopf, irgendwann in der Zukunft, der ebenso unter dem Widerstreit der magischen Kräfte in sich zu leiden hat wie ich selbst.
Doch sobald ich mich anschicke, das Vorhaben in die Tat umzusetzen, komme ich ins Zaudern. Wer bin ich, meinen Willen gegen die Weisheit jener zu stellen, die vor mir waren? Soll ich in klarer Schrift darlegen, wie jemand, dem die Gabe der alten Macht zuteilwurde, seinen Wirkungskreis vergrößern kann oder ein Lebewesen an sich binden? Soll ich die Einzelheiten der Ausbildung erläutern, die man durchlaufen muss, bevor man als ein der Gabe Kundiger anerkannt wird? Die Heckenmagie und die übrigen Praktiken habe ich nie beherrscht. Habe ich das Recht, ihre Geheimnisse auszugraben und auf Papier zu spießen wie zu Studienzwecken gesammelte Schmetterlinge oder Blätter?
Ich versuche mir vorzustellen, was man mit solchem – wohlfeil erworbenen – Wissen alles tun könnte, und das führt mich zu der Überlegung, was es mir eingebracht hat. Macht, Reichtum, die Liebe einer Frau?, frage ich mich selbstironisch. Weder die Gabe noch die alte Macht haben mir je das eine oder das andere verschafft. Oder falls doch, besaß ich weder den Verstand noch den Ehrgeiz, danach zu greifen.
Macht. Ich glaube nicht, dass ich je um ihrer selbst willen danach Verlangen hatte. Ich wünschte sie mir, wenn ich am Boden lag oder wenn andere, die mir nahestanden, unter der Willkür der Mächtigen leiden mussten. Reichtum. Darüber habe ich nie ernsthaft nachgedacht. Von dem Augenblick an, da ich, als sein illegitimer Enkelsohn, König Listenreich Gefolgschaft gelobt hatte, sorgte er für die Befriedigung all meiner Bedürfnisse. Ich hatte reichlich zu essen, mehr Ausbildung, als mir manchmal lieb war, Alltagskleidung genauso wie ärgerlich modisches Zeug, und oft genug standen mir dazu noch ein oder zwei Münzen zur freien Verfügung. In Bocksburg aufwachsen, das war Reichtum genug und mehr, als die meisten Jungen in Burgstadt für sich in Anspruch nehmen konnten. Liebe? Nun ja. Meine Stute Rußflocke hatte mich gern, auf ihre eigene, stoische Art. Ich hatte die anhängliche Treue eines Hundes namens Naseweis erlebt, und das brachte ihm den Tod. Ein Terrierwelpe schloss mich so sehr in sein Herz, dass auch er deshalb sterben musste. Mich schaudert bei dem Gedanken daran, was es kostete, mich zu lieben.
Mein Teil war die Einsamkeit dessen, der in einer Atmosphäre von Intrigen und berückenden Geheimnissen aufwächst, das Außenseitertum eines Jungen, der niemanden hat, dem er sich rückhaltlos anvertrauen kann. Undenkbar, zu Fedwren zu gehen, dem Hofschreiber, der mich für meine Schönschrift und meine sorgsam ausgeführten Illustrationen lobte, und ihm zu gestehen, dass ich bereits Lehrling des Königlichen Meuchelmörders war und deshalb nicht die Laufbahn eines Schreibers einschlagen konnte. Ebenso wenig konnte ich Chade, meinem Lehrer in der Diplomatie des gezückten Messers, anvertrauen, welch grausame Behandlung mir Galen, der Gabenmeister, als seinem Schüler angedeihen ließ. Und mit schon rein gar niemandem wagte ich über meine wachsende Gabe der alten Macht zu sprechen, die verpönte Tiermagie, die als widernatürlich galt, ein Makel für jeden, der davon Gebrauch machte.
Nicht einmal mit Molly konnte ich darüber sprechen.
Molly stellte für mich das Kostbarste dar, was es auf der Welt gibt: eine wirkliche Zuflucht. Sie hatte nicht das Mindeste mit meinem Alltagsleben zu tun. Schon dass sie ein Mädchen war, machte sie zu etwas Besonderem. Ich wuchs fast ausschließlich in der Gesellschaft von Männern auf, nicht nur ohne Mutter und Vater, sondern auch ohne jegliche Blutsverwandte, die bereit gewesen wären, sich offen zu mir zu bekennen. Als Kind kam ich in die Obhut von Burrich, dem bärbeißigen Stallmeister, früher meines Vaters rechte Hand. Die Stallburschen und Wachsoldaten waren meine Gefährten. Damals wie heute dienten Frauen in der Garde, wenn auch nicht in gleich großer Zahl. Doch wie ihre männlichen Kameraden hatten sie ihre Pflichten und außerhalb des Dienstes ein Privatleben und Familie. Ich hatte kein Recht auf ihre Zeit. Ich hatte keine Mutter, keine Schwestern oder Tanten. Es gab keine Frauen, von denen ich die besondere Zärtlichkeit erfuhr, die angeblich nur Frauen zu geben vermögen.
Ich hatte keine Frau in meiner Nähe – außer Molly.
Sie war nur ein oder zwei Jahre älter als ich und wuchs heran wie ein grüner Baumtrieb, der sich zwischen Pflastersteinen hervorzwängt. Weder die Trunksucht und Brutalität ihres Vaters, eines Kerzenziehers, noch die Anstrengungen, die nötig waren, um den Anschein eines Heims und eines ordentlich geführten Geschäfts aufrechtzuerhalten, konnten sie zerbrechen. Als ich ihr das erste Mal begegnete, war sie so wild und misstrauisch wie ein junger Fuchs. Molly Blaufleck hieß sie bei den Straßenkindern, wegen der Spuren der Schläge, die sie von ihrem Vater bekam. Trotz allem liebte sie ihn, etwas, das ich nie verstehen konnte. Er murrte und schimpfte, selbst während sie ihn nach einer seiner Zechtouren nach Hause führte und zu Bett brachte. Und wenn er aufwachte, empfand er nicht die mindeste Reue wegen seiner Trunkenheit und groben Worte. Es gab nur wieder Schelte: Weshalb war der Laden nicht ausgefegt und der Boden nicht mit frischen Binsen bestreut? Warum hatte sie nicht nach den Bienenstöcken gesehen, wo es doch kaum mehr Honig zum Verkaufen gab? Warum hatte sie das Feuer unter dem Schmelztiegel ausgehen lassen? Und oft genug hatte ich danebengestanden und musste mir das schweigend mit anschauen.
Doch nichts hinderte Molly daran, zu wachsen und zu gedeihen. Und eines Sommers erblühte sie so unerwartet zu einer jungen Frau, dass mich ihre sinnliche Nähe und ihre weiblichen Reize ganz befangen machten. Sie hingegen schien sich nicht im Mindesten bewusst zu sein, dass ein Blick aus ihren Augen genügte, um mich sprachlos zu machen. Keine Magie, über die ich verfügte, nicht die Gabe und nicht die alte Macht, wappnete mich gegen die zufällige Berührung ihrer Hand oder bewahrte mich vor der linkischen Befangenheit, die mich bei ihrem Lächeln überkam.
Soll ich beschreiben, wie ihr Haar im Wind wehte oder wie die Farbe ihrer Augen sich von dunklem Bernstein zu warmem Braun wandelte, je nach ihrer Stimmung und der Farbe ihrer Kleider? Erspähte ich das Rot von ihrem Rock und Schultertuch im Gedränge auf dem Marktplatz, dann nahm ich plötzlich nichts anderes mehr wahr. Das war ihre Zaubermacht.
Wie ich sie umwarb? Mit der unbeholfenen Galanterie eines Knaben; ich gaffte sie an wie ein Trottel, der von den wirbelnden Tellern eines Jongleurs gebannt ist. Sie wusste, dass ich sie liebte, bevor ich selbst es begriff, und ließ sich von mir den Hof machen, obwohl ich einige Jahre jünger war als sie und nicht wie andere Burschen aus der Stadt kam. Außerdem war ich ihrem Wissen nach ohne vielversprechende Zukunftsaussichten. Sie glaubte, ich wäre des Schreibers Laufbursche, der nebenbei im Stall half und für die Leute auf der Burg Botengänge unternahm. Wie sollte sie ahnen, dass ich der Bastard war, der illegitime Sohn, dessentwegen Prinz Chivalric von seinem Platz als Thronfolger hatte zurücktreten müssen. Das allein war schon ein schwerwiegendes Geheimnis. Von meinen magischen Kräften und meinem anderen Beruf wusste sie erst recht nichts.
Vielleicht war das der Grund, weshalb ich sie lieben konnte.
Ganz gewiss führte es aber dazu, dass ich sie verlor.
Ich ließ mich zu sehr von den Heimlichkeiten, Fehlschlägen und Schmerzen meines mehrfachen Doppellebens in Anspruch nehmen. Es galt, die Praktiken der Magie zu erlernen, Geheimaufträge auszuführen, Menschen zu töten und Intrigen zu überleben. Ich war darin so gefangen, dass mir nie auch nur der Gedanke kam, ich könnte mich an Molly wenden, um hier etwas Hoffnung und Verständnis zu finden, an dem es mir so mangelte. Sie hatte nichts mit diesen Dingen zu tun, blieb davon gänzlich unbefleckt, und ich trug Sorge, dass sie nicht damit in Berührung kam. Nie machte ich den Versuch, sie in meine Welt miteinzubeziehen. Stattdessen begab ich mich in die Welt ihrer kleinen Hafenstadt, wo sie in ihrem Lädchen Kerzen und Honig verkaufte, auf dem Markt Besorgungen machte und manchmal mit mir am Strand spazieren ging. Mir genügte, dass sie da war, damit ich sie lieben konnte. Ich wagte nicht zu hoffen, sie könnte dieses Gefühl erwidern.
Es kam eine Zeit während meiner Ausbildung in der Gabe, als mein Elend mich derart zu Boden drückte, dass ich glaubte, sterben zu müssen. Ich konnte mir nicht verzeihen, dass ich ein so unfähiger Schüler war; ich redete mir ein, jeder müsse mich wegen meines Versagens geringschätzen. Ich verbarg meine Verzweiflung hinter schroffer Unnahbarkeit. Die Wochen vergingen, ohne dass ich sie besuchte oder ihr wenigstens ausrichten ließ, dass ich an sie dachte. Erst als es schließlich niemand anderen mehr gab, an den ich mich hätte wenden können, ging ich zu ihr. Zu spät. An dem Nachmittag, als ich mich mit Geschenken in der Hand der Kerzenzieherei in Burgstadt näherte, kam ich gerade noch rechtzeitig, um sie weggehen zu sehen. Sie war nicht allein. Bei ihr war Jade, ein gutaussehender breitschultriger Seemann, den ein blitzender Ring in einem Ohr schmückte und die selbstsichere Männlichkeit der Jahre, die er mir voraushatte. Wie ein geprügelter Hund schlich ich unbemerkt davon und blickte ihnen nach, wie sie Arm in Arm die Straße hinunterschlenderten. Ich ließ Molly gehen, und in den Monaten darauf versuchte ich mich zu überzeugen, sie wäre nicht nur aus meinem Leben, sondern auch aus meinem Herzen verschwunden. Bis heute frage ich mich, ob ich ihnen hätte nachlaufen sollen, sie um ein letztes Wort bitten. Merkwürdig, wenn man bedenkt, dass vieles nur durch den fehlgeleiteten Stolz eines Knaben so gekommen ist, wie es kam, und durch seine zur zweiten Natur gewordene Hinnahme von Niederlagen. Ich verbannte sie aus meinen Gedanken und sprach mit niemandem über sie, und das Leben ging weiter.
Als König Listenreichs Assassine schloss ich mich der großen Karawane an, die von Bocksburg aufbrach, um bei der Vermählung zwischen der Bergprinzessin Kettricken und Prinz Veritas anwesend zu sein. Meine Mission bestand darin, unauffällig den Tod ihres älteren Bruders Prinz Rurisk herbeizuführen, ohne Verdacht zu erregen selbstverständlich, sodass sie die einzige Thronerbin sein würde. Doch was ich nach meiner Ankunft vorfand, war ein Netz von Täuschungen und Lügen, gesponnen von meinem jüngsten Onkel, Prinz Edel, der hoffte, Veritas von seinem Platz in der Thronfolge zu verdrängen und selbst die Prinzessin zur Gemahlin nehmen zu können. Mich hatte er als Sündenbock ausersehen, der ihm helfen sollte, sein Ziel zu erreichen. Stattdessen durchkreuzte ich seine Pläne, womit ich seinen Zorn und seine Vergeltung auf mich zog. Dennoch gelang es mir, Prinz Veritas’ Krone und Braut zu retten. Es hatte nichts mit Heldenmut zu tun. Ebenso wenig war es die wohlfeile Rache an jemandem, der mich von Anfang an drangsaliert und verhöhnt hatte. Es war die Tat eines Knaben, der zum Mann wurde und gemäß dem Treueid handelte, den er Jahre zuvor geleistet hatte, bevor er ahnte, was es ihn kosten könnte. Der Preis war mein gesunder junger Körper, ein für mich bis dahin für selbstverständlich gehaltener Besitz.
Nachdem ich Edels Verschwörung zerschlagen hatte, war ich noch lange Zeit in dem Bergreich ans Krankenbett gefesselt. Doch schließlich kam ein Morgen, an dem ich erwachte und glaubte, meine langwierige Krankheit sei endlich vorüber. Burrich hatte entschieden, ich sei gesund genug, um die lange Heimreise in die Sechs Provinzen antreten zu können. Prinzessin Kettricken war mit ihrem Gefolge schon Wochen zuvor noch bei gutem Wetter nach Bocksburg aufgebrochen. Jetzt lagen die höheren Regionen des Reichs bereits unter einer dicken Schneedecke. Wenn wir Jhaampe nicht bald verließen, wären wir gezwungen, dort zu überwintern.
An dem besagten Morgen war ich früh aufgestanden und verstaute die letzten Kleinigkeiten in meinem Gepäck, als sich das erste leichte Zittern bemerkbar machte. Ich achtete nicht darauf. Das ist die Aufregung, sagte ich mir, und schließlich hatte ich noch nicht gefrühstückt. Ich zog die Kleider an, mit denen Jonqui uns für die Reise durch die winterlichen Berge zu den Ebenen ausgestattet hatte. Für mich gab es ein langes, rotes, wollenes Hemd, dazu gesteppte Wollhosen, grün, doch am Bund und an den Beinabschlüssen mit roter Stickerei verziert. Die Stiefel aus weichem Leder waren formlos und beinahe sackartig, aber innen gut mit Wolle gefüttert und außen mit Pelz verbrämt. Sie wurden mit langen Riemen an den Füßen verschnürt, was für meine zitternden Finger eine schwierige Aufgabe war. Jonqui hatte uns erklärt, sie eigneten sich vorzüglich für den trockenen Schnee in den Bergen, dürften aber auf keinen Fall nass werden. Es gab einen Spiegel in meinem Zimmer. Im ersten Moment nötigte mein Anblick mir ein Lächeln ab. Nicht einmal König Listenreichs Narr war so buntscheckig gekleidet. Doch über den farbenfrohen Stoffen erschien mein Gesicht schmal und blass, wobei meine dunklen Augen unnatürlich groß wirkten, und mein wegen der langen Bettlägerigkeit kurz geschorenes Haar sträubte sich schwarz und borstig von meinem Kopf. Die Krankheit hatte mich gezeichnet, aber jetzt war ich gesund und im Begriff, nach Hause zurückzukehren. Als ich die kleinen Geschenke einpackte, die ich für meine Freunde daheim ausgesucht hatte, wurde mein Zittern stärker.
Zum letzten Mal setzten Burrich, Flink und ich uns nieder, um mit Jonqui das Frühstück einzunehmen. Erneut dankte ich ihr für all ihre Mühe, die sie für meine Heilung aufgewendet hatte. Doch während ich den Löffel aufhob, verkrampfte sich meine Hand, sodass er mir aus den Fingern glitt. Mein besinnungsloser Blick folgte dem Fall des silbrigen Etwas und zog mich mit hinab. Ich sank vom Stuhl zu Boden.
Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist das abgedunkelte Schlafzimmer. Geraume Zeit lag ich still, ohne mich zu rühren und ohne zu sprechen. Anfangs war ich nicht einmal fähig zu denken, dann wurde mir langsam bewusst, dass ich erneut einen Anfall gehabt hatte. Er war jedoch vorüber, denn sowohl mein Geist als auch mein Körper gehorchten mir wieder. Aber was hatte das noch für einen Wert? Mit fünfzehn Jahren, ein Alter, in dem die meisten ihre volle Kraft erreichten, ließ mein Körper mich bei den einfachsten Dingen im Stich. Er war minderwertig und erschien mir nur noch als Last. Ich empfand einen wütenden Groll gegen das schwache Fleisch und die Knochen, die mich gefangen hielten, und ich wünschte mir, auf irgendeine Weise meiner bitteren Enttäuschung Luft machen zu können. Warum hatte ich die Krankheit nicht besiegt? Warum war ich nicht gesund geworden?
»Es braucht Zeit, weiter nichts. Warte ab, ein halbes Jahr, und dann erst richte über dich selbst.« Es war Jonqui, die Heilerin. Sie saß im tiefen Schatten neben dem brennenden Kaminfeuer. Jetzt erhob sie sich schwerfällig, als stecke ihr der Winter in den Knochen, und trat an mein Bett.
»Ich will nicht sein wie ein alter Mann.«
Sie schürzte die Lippen. »Früher oder später wirst du es sein müssen. Zumindest wünsche ich dir, dass du erst hochbetagt aus dieser Welt abberufen wirst. Ich bin alt und mein Bruder, König Eyod, ebenfalls. Wir empfinden es als keine so unerträgliche Bürde.«
»Es würde mir nichts ausmachen, den Körper eines alten Mannes zu haben, hätte ich auch die Jahre dazu. Aber ich kann so nicht weiterleben.«
Sie schüttelte verwundert den Kopf. »Selbstverständlich kannst du. Die Zeit der Genesung erfordert manchmal viel Geduld, aber zu sagen, dass du nicht mehr weiterleben kannst … Ich verstehe das nicht. Liegt es vielleicht an der Verschiedenheit unserer Sprachen?«
Ich setzte zu einer Erwiderung an, doch in diesem Moment kam Burrich herein. »Aufgewacht? Wieder munter?«
»Aufgewacht, aber ganz und gar nicht munter«, antwortete ich verdrossen. Sogar in meinen eigenen Ohren hörte ich mich an wie ein bockiges Kind.
Burrich und Jonqui tauschten verständnisvolle Blicke. Dann legte mir die Heilerin schweigend die Hand auf die Schulter und verließ das Zimmer.
Die offensichtliche Nachsicht der beiden schürte meinen ohnmächtigen Zorn. »Warum kannst du mich nicht gesund machen?«, verlangte ich von Burrich zu wissen.
Er war bestürzt über den anklagenden Ton meiner Frage. »Es ist nicht so einfach«, begann er.
»Warum nicht?« Ich setzte mich auf. »Ich habe erlebt, wie du bei Tieren alle möglichen Leiden kuriert hast. Krankheiten, Knochenbrüche, Würmer, die Räude … Warum kannst du mich nicht heilen?«
»Du bist kein Hund, Fitz«, antwortete Burrich ruhig. »Bei einem Tier, dem es sehr schlecht geht, ist es leichter. Ich habe manchmal zu drastischen Mitteln gegriffen und mir gesagt, nun, wenn es stirbt, muss es wenigstens nicht mehr leiden, und vielleicht hilft es ja. Bei dir kann ich das nicht tun. Du bist kein Tier.«
»Das ist keine Antwort! Wie oft suchen die Männer bei dir um Hilfe nach, statt bei ihren Heilern! Du hast Den eine Pfeilspitze herausoperiert und ihm dafür den ganzen Arm aufgeschnitten. Als der Heiler sagte, die Entzündung in Greydins Fuß sei zu weit fortgeschritten, man werde ihn abnehmen müssen, ist sie zu dir gekommen, und du hast ihren Fuß gerettet. Und die ganze Zeit hat der Heiler prophezeit, die Entzündung würde sich ausbreiten, und sie würde sterben, und dann wärst du schuld an ihrem Tod.«
Burrich presste die Lippen zusammen, unterdrückte seinen Jähzorn. Unter anderen Umständen wäre ich davor auf der Hut gewesen, aber seine Geduld und sein Langmut während meiner Genesung hatten mich wagemutig gemacht. Als er sprach, war seine Stimme ruhig und gelassen. »Das waren riskante Eingriffe, ja. Aber die Leute, um die es dabei ging, wussten um die Gefahr. Und«, er hob die Stimme, um meinen Einwand gar nicht erst aufkommen zu lassen, »es war insofern einfacher, weil ich jeweils die Ursache kannte und genau wusste, was zu tun war. Die Pfeilspitze aus Dens Arm schneiden und die Wunde reinigen. Für Greydins Fuß Breiumschläge, um die Entzündung herauszuholen. Aber bei deiner Krankheit verhält es sich anders. Weder Jonqui noch ich wissen genau, was dir eigentlich so sehr zusetzt. Sind es die Nachwirkungen des Giftes, das Kettricken dir verabreichte, als sie glaubte, du wärst gekommen, um ihren Bruder zu ermorden? Oder ist es der vergiftete Wein, den Edel dem Prinzen schickte und von dem du auch getrunken hast? Kommt es von den unzähligen Schlägen, die du abbekommen hast, oder rührt es vielleicht daher, dass du fast ertrunken wärst? Oder ist das alles zusammen für deinen Zustand verantwortlich? Wir wissen es nicht, und deshalb wissen wir auch kein Mittel, dich zu heilen. Wir wissen es einfach nicht.«
Die letzten Worte kamen nur sehr gepresst heraus, und plötzlich erkannte ich, wie seine Zuneigung für mich es ihm nur noch schwerer machte, seine eigene Hilflosigkeit zu ertragen.
Er ging ein paar Schritte auf und ab. Dann blieb er stehen und starrte ins Feuer. »Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Jonqui kennt Mittel und Praktiken aus ihrer Bergwelt, von denen ich nie zuvor gehört habe. Und ich berichtete ihr von meinen Erfahrungen. Doch wir stimmten beide darin überein, dass es das Beste wäre, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es besteht keine Lebensgefahr, soweit wir es beurteilen können. Vielleicht wird dein Körper mit der Zeit die letzten Giftstoffe ausscheiden oder heilen, was immer dir für Schaden zugefügt wurde.«
»Oder«, fügte ich leise hinzu, »es besteht die Möglichkeit, dass ich mich für den Rest meines Lebens mit diesem Zustand abfinden muss. Dass das Gift oder die Schläge einen unwiderruflichen Schaden angerichtet haben. Verflucht sei Edel dafür, dass er sogar noch auf mich eingetreten hat, als ich schon am Boden lag.«
Burrich stand da wie zu Eis erstarrt, dann sank er auf Jonquis Stuhl, der im Schatten stand. Seine Stimme verriet Resignation. »Ja. Das ist ebenso gut möglich wie das andere. Aber verstehst du nicht, dass wir keine andere Wahl haben? Ich könnte dir etwas geben, um das Gift aus deinem Körper zu treiben, aber wenn nun gar nicht das Gift schuld ist, würde ich nichts weiter bewirken, als dich zusätzlich zu schwächen und den Selbstheilungsprozess weiter hinauszuzögern.« Den Blick starr in die Flammen gerichtet, hob er die Hand zu einer weißen Haarsträhne an seiner Schläfe. Ich war nicht der Einzige, der von Edels Intrigen gezeichnet war. Burrich selbst hatte sich erst vor kurzem von einem Schlag auf den Kopf erholt, der für jeden Menschen mit weniger dickem Schädel tödlich gewesen wäre. Als Folge davon litt er immer wieder unter Schwindel und Sehstörungen, doch er beklagte sich nie. Und das hätte mich schon ein wenig beschämen müssen.
»Und was soll ich tun?«
Burrich schrak in sich zusammen, als wäre er fast eingenickt. »Was wir bereits getan haben. Warte. Iss. Ruh dich aus. Habe Geduld mit dir selbst. Und warte ab, was geschieht. Ist das so furchtbar?«
Ich überging die Frage. »Und wenn es nicht besser wird? Wenn es so bleibt und ich jederzeit damit rechnen muss, dass dieses Zittern mich überfällt oder mir aus heiterem Himmel schwarz vor Augen wird?«
Er ließ sich Zeit mit der Antwort. »Lerne damit zu leben. Viele Menschen müssen sich mit schlimmeren Gebrechen abfinden. Die meiste Zeit wird es dir gut gehen. Du bist nicht blind. Du bist nicht gelähmt. Du hast immerhin noch deine fünf Sinne beisammen. Hör auf, dich um das zu grämen, was du verloren hast. Warum denkst du nicht lieber darüber nach, was dir geblieben ist?«
»Was mir geblieben ist? Was mir geblieben ist?« Mein Ärger stieg in mir auf wie ein vor Panik wild gewordener Vogelschwarm. »Ich bin hilflos, Burrich. So, wie ich jetzt bin, kann ich unmöglich nach Bocksburg zurückkehren! Ich bin nutzlos. Schlimmer noch als nutzlos, ich bin ein geradezu ideales Opfer. Wenn ich zurückkehren und Edel die Faust ins Gesicht schlagen könnte, das wäre mir eine Genugtuung. Stattdessen werde ich mich mit ihm an eine Tafel setzen müssen und höflich und ehrerbietig sein – und das zu einem Mann, der Prinz Veritas stürzen und mich, um seinen Triumph voll auszukosten, töten wollte. Ich kann es nicht ertragen, dass er mich zittern oder in Krämpfen zu Boden fallen sieht. Ich will ihn nicht lächeln sehen über das Wrack, das er aus mir gemacht hat. Ich will nicht Zeuge sein, wie er seinen Triumph auskostet. Und er wird erneut versuchen, mich zu ermorden. Wir beide wissen das. Vielleicht hat er eingesehen, dass er Veritas nicht gewachsen ist, vielleicht respektiert er die Stellung seines Bruders und dessen junger Gemahlin. Doch ich bezweifle, dass er, was mich betrifft, anderen Sinnes geworden ist. Ich bin für ihn eine weitere Möglichkeit, Veritas zu treffen. Und wenn er dann zu mir kommt, was werde ich tun können? Beim Feuer sitzen wie ein hilfloser Greis, unfähig zur Gegenwehr. Nichts werde ich tun können! Alles, was mir beigebracht wurde, von Hod der Umgang mit Waffen, von Fedwren der Umgang mit Tinte, Feder und Papier, sogar was ich bei dir über die Pflege der Tiere gelernt habe – alles vergebens! Ich bin zu nichts mehr fähig. Ich bin wieder der nichtsnutzige Bastard von früher, Burrich. Und jemand hat mir einmal gesagt, ein königlicher Bastard bleibt nur so lange am Leben, wie er zu etwas nütze ist.« Die letzten Worte schleuderte ich ihm fast schreiend entgegen, doch selbst in meiner Wut und Verzweiflung erwähnte ich ihm gegenüber nichts von Chade und meiner Ausbildung zum Meuchelmörder. Denn auch dafür war ich nicht mehr zu gebrauchen. Die Kunst, sich lautlos zu bewegen, all die Taschenspielertricks, die vielfältigen Tötungsmethoden, die sorgfältige Zubereitung von Giften – all das war mir nun durch die erbärmliche Schwäche meines Körpers versagt.
Burrich hörte mir schweigend und bis zum Ende zu. Als das Strohfeuer meines verzweifelten Ausbruchs dann erloschen war und ich nach Atem ringend die Hände ineinander verkrampfte, um ihr Zittern zu unterdrücken, ergriff er das Wort.
»Nun gut. Soll das heißen, wir gehen nicht nach Bocksburg zurück?«
Ich war schlagartig ernüchtert. »Wir?«
»Mein Leben gehört dem Mann, der den Ohrring trägt. Dahinter steckt eine lange Geschichte, die ich dir vielleicht irgendwann einmal erzählen werde. Philia hatte kein Recht, ihn dir zu schenken; ich dachte, er wäre mit Prinz Chivalric begraben worden. Sie hielt ihn vielleicht nur für ein beliebiges Schmuckstück aus dem Besitz ihres Mannes, über das sie nach Belieben verfügen konnte. Wie auch immer, du trägst ihn jetzt. Wohin du gehst, ich folge dir.«
Verwirrt hob ich die Hand zu dem Ring an meinem Ohr. Es war ein kleiner blauer Stein, eingeflochten in einem Netz aus Silberdraht. Ich machte mich daran, ihn abzunehmen.
»Tu das nicht«, sagte Burrich. Er sprach diese Worte mit ruhiger, tiefer Stimme, aber der Tonfall enthielt sowohl eine Drohung als auch einen Befehl.
Ich ließ die Hand sinken und verzichtete darauf, ihn nach weiteren Gründen zu fragen. Es erschien mir doch sehr merkwürdig, dass der Mann, der seit meiner Kindheit über mich gewacht hatte, nun seine Zukunft gerade in meine Hände legte. Und doch saß er da vor dem Kamin und wartete auf eine Entscheidung von mir. Ich betrachtete ihn im flackernden Feuerschein. Früher war er für mich ein unwirscher Riese gewesen, düster und furchteinflößend, aber auch ein starker Beschützer. Jetzt, vielleicht zum ersten Mal, sah ich ihn als Menschen und als Mann. Dunkles Haar und dunkle Augen waren das Merkmal des Geblüts der Fernholmer, darin ähnelten wir uns beide. Doch seine Augen waren braun, nicht schwarz, und wenn der Wind seine Wangen über dem krausen Bart erröten ließ, dann verriet sich der hellhäutige Vorfahre irgendwo in seiner Ahnenreihe. Beim Gehen hinkte er – an kalten Tagen besonders stark. Das war ein Andenken an einen blindwütigen Keiler, den er auf sich gelenkt hatte, um Chivalric zu retten. Er war auch nicht so groß, wie es mir als Kind erschienen war. Wenn ich selbst weiter so in die Höhe schoss wie bisher, konnte ich damit rechnen, ihm bald über den Kopf zu wachsen. Seine Gestalt wirkte gar nicht so muskulös, doch vermittelte er einen Eindruck geballter und konzentrierter Kraft, was das Ergebnis der ständigen Wachsamkeit sowohl seines Körpers als auch seines Geistes war. Nicht wegen seiner Größe hatte man ihn in Bocksburg gefürchtet und respektiert, sondern wegen seines hitzigen Jähzorns und seiner ungeheuren Zähigkeit. Einmal, ich war noch klein, fragte ich ihn, ob er je einen Kampf verloren hätte. Er hatte gerade einen eigensinnigen jungen Hengst zur Räson gebracht und stand bei ihm in der Box, um ihn zu beruhigen. Auf meine Frage grinste er nur mit einem wölfischen Lächeln, während ihm der Schweiß von der Stirn und über die Wangen in den dunklen Bart lief. Er sprach mit mir über die Trennwand des Stalls hinweg. »Einen Kampf verloren? Der Kampf ist nicht eher zu Ende, als bis du ihn gewonnen hast, Fitz. Nur daran musst du denken. Ganz gleich, was der andere Mann glaubt. Oder das Pferd.«
Aus dieser Erinnerung heraus kam mir der Gedanke, ob er mich vielleicht als einen Kampf betrachtete, den er gewinnen musste. Er hatte mir oft erzählt, ich sei der letzte Auftrag Chivalrics an ihn gewesen. Der Makel meiner Existenz war für meinen Vater Grund genug gewesen, auf den Thron zu verzichten, doch er hatte mich in die Obhut dieses Mannes gegeben und ihm befohlen, mich nach bestem Wissen und Gewissen aufzuziehen. Vielleicht glaubte Burrich, er habe diesen Auftrag noch nicht erfüllt.
»Was meinst du, was soll ich tun?«, fragte ich demütig. Beides, sowohl die Frage als auch meine Demut, kamen mich hart an.
»Gesund werden«, sagte er nach einer Weile. »Und dir die Zeit nehmen, um gesund zu werden. Es lässt sich nicht erzwingen.« Er warf einen Blick auf seine Beine, die er zum Feuer hin ausgestreckt hatte, und es legte sich ein ernster Ausdruck über sein Gesicht.
»Bist du der Ansicht, wir sollten zurückgehen?«, beharrte ich.
Statt zu antworten, legte er seine bestiefelten Füße übereinander und starrte in die Flammen. Endlich sagte er, beinahe widerstrebend: »Tun wir es nicht, wird Edel glauben, er habe gesiegt. Und er wird versuchen, Veritas zu ermorden. Oder zumindest tun, was er glaubt, tun zu müssen, um nach der Krone seines Bruders greifen zu können. Ich habe meinem König Gefolgschaft gelobt, Fitz, und du ebenfalls. Noch ist Listenreich dieser König, doch Veritas ist König-zur-Rechten. Ich finde, er sollte nicht die undankbare Arbeit des Thronfolgers tun müssen und um den Lohn betrogen werden.«
»Er hat fähigere Gefolgsleute als mich.«
»Bist du deshalb von deinem Eid entbunden?«
»Du argumentierst wie ein Priester.«
»Ich argumentiere überhaupt nicht, ich habe dir lediglich eine Frage gestellt. Und stelle dir eine zweite. Was gibst du auf, wenn du Bocksburg hinter dir lässt?«
Nun war es an mir zu schweigen und zu überlegen. Ich dachte an meinen König und daran, was ich ihm geschworen hatte. Ich dachte an Prinz Veritas und seine gutmütige Herzlichkeit mir gegenüber. Bocksburg, das war auch Chade und sein stilles Lächeln angesichts meines Begreifens einer neuen Lektion seines Geheimwissens, das waren Prinzessin Philia und ihre Zofe Litzel, Fedwren und Hod, sogar die Köchin und Mamsell Hurtig, die Schneidermeisterin. Es gab nicht so viele Leute, die mir nahestanden, aber gerade deshalb war jeder Einzelne besonders wichtig. Ich würde sie alle vermissen, falls ich nie wieder nach Bocksburg zurückkehrte. Doch was dann in mir aufloderte wie ein neu geschürtes Feuer, das war die Erinnerung an Molly. Ehe ich mich’s versah, erzählte ich Burrich von ihr, und er nickte nur, während aus mir die ganze Geschichte hervorsprudelte.
Leider wusste er auch kaum mehr als ich. Die Kerzenzieherei war geschlossen worden, als der alte Säufer, dem sie gehörte, hoch verschuldet starb. Seine Tochter war gezwungen gewesen, zu Verwandten in einen anderen Ort zu ziehen. An welchen Ort, das wusste er nicht, doch er war überzeugt, das ließe sich herausfinden, falls ich es wirklich wollte. »Befrage erst dein Herz, Fitz«, riet er mir. »Hast du ihr nichts zu bieten, lass sie in Ruhe. Bist du denn ein Krüppel? Nur wenn du entschlossen bist, einer zu sein. Aber wenn du dich selbst so siehst, hast du womöglich kein Recht, sie zu suchen. Ich kann mir nicht denken, dass du ihr Mitleid willst. Mitleid ist nur ein ärmlicher Ersatz für Liebe.« Damit stand er auf und ging und überließ mich meinen Gedanken.
War ich ein Krüppel? War ich geschlagen, besiegt? Mein Körper war ein einziger Missklang, ein verstimmtes Instrument, doch ich hatte meinen Willen gegen Edel durchgesetzt. Prinz Veritas war unbestrittener Thronfolger der Sechs Provinzen, und die Bergprinzessin war seine Gemahlin geworden. Fürchtete ich wirklich Edels höhnisches Lächeln, wenn er meine Hände zittern sah? Konnte ich nicht ebenfalls meinen Hohn zeigen, ihm, der nun niemals König sein würde? Ein heftiges Gefühl der Befriedigung durchströmte mich. Burrich hatte recht. Ich war kein strahlender Sieger, aber ich konnte Edel dauerhaft daran erinnern, dass er verloren hatte.
Und wenn ich hier gewonnen hatte, sollte ich dann nicht auch imstande sein, Molly zu gewinnen? Was stand zwischen ihr und mir? Jade? Nach Burrichs Worten hatte sie Bocksburg verlassen und nicht geheiratet. Mittellos war sie fortgegangen, um bei Verwandten Unterschlupf zu finden. Schande über ihn, falls Jade das zugelassen hatte. Ich würde sie suchen. Ich würde sie finden und für mich gewinnen. Molly, mit ihrem wilden Haar. Molly, mit ihrem leuchtend roten Rock und Umhang, kühn wie ein Sperber und mit ebenso hellen Augen. Bei dem Gedanken an sie lief mir ein Schauer den Rücken hinunter. Ich lächelte in mich hinein, bis ich fühlte, wie das Lächeln auf meinem Gesicht zur Grimasse erstarrte und ein Krampf meinen Körper packte. Mein Rücken wölbte sich, und mein Kopf schlug gegen das Bettgestell. Ohne mein Zutun entfuhr mir ein gurgelnder, wortloser Schrei.
Augenblicklich war Jonqui bei mir und rief Burrich zurück. Beide hielten sie mit vereinten Kräften meine zuckenden Glieder fest. Burrichs Gewicht drückte mich nieder, dann schwanden mir die Sinne.
Wie nach einem Versinken in tiefes Wasser tauchte ich aus der Dunkelheit ins Licht empor. Alles war friedvoll. Ich lag still da, umfangen von Daunen und weichen Decken, und einen Moment lang fühlte ich mich beinahe wohl und geborgen.
»Fitz?« Burrich beugte sich über mich.
Die Wirklichkeit brach über mich herein, die Erkenntnis, dass ich ein verstümmeltes, bedauernswertes Geschöpf war, eine Marionette an verworrenen Schnüren oder ein Pferd mit durchschnittenen Sehnen. Ich würde nie wieder sein wie zuvor. Für mich war kein Platz mehr in der Welt, deren Teil ich einmal gewesen war. Burrich hatte gesagt, Mitleid sei nur ein kläglicher Ersatz für Liebe. Ich wollte kein Mitleid, von keinem Menschen.
»Burrich?«
Er beugte sich tiefer zu mir hinab. »Es war nicht so schlimm«, log er. »Ruh dich jetzt aus. Morgen …«
»Morgen wirst du nach Bocksburg aufbrechen«, unterbrach ich ihn.
Er runzelte die Stirn. »Erhole dich ein paar Tage, dann werden wir …«
»Nein.« Ich stemmte mich hoch, bis ich aufrecht saß, und sprach die nächsten Worte mit allem Nachdruck, den ich aufzubringen vermochte. »Ich habe eine Entscheidung getroffen. Morgen machst du dich auf den Rückweg nach Bocksburg. Es gibt Menschen und Tiere, die dort auf dich warten. Du wirst gebraucht. Es ist dein Zuhause, deine Welt. Aber ich gehöre nicht dorthin. Nicht mehr.«
Er schwieg einen langen Moment. »Und was wirst du tun?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das braucht dich nicht mehr zu kümmern. Dich nicht und auch sonst niemanden. Von nun an ist das allein meine Angelegenheit.«
»Das Mädchen?«
Wieder schüttelte ich entschieden den Kopf. »Sie hat schon ihre Kindheit und Jugend an einen hilflosen Krüppel vergeudet, nur um festzustellen, dass er sie in Schulden zurückließ. Soll ich in meinem Zustand zu ihr gehen? Soll ich sie bitten, mich zu lieben, und ihr dann eine Bürde sein, wie ihr Vater es war? Nein. Allein oder als Frau eines anderen wird sie glücklicher sein.«
Das Schweigen zwischen uns dehnte sich endlos. Jonqui war in einer Ecke des Zimmers damit beschäftigt, zum wiederholten Male einen Kräutertrank zuzubereiten, der mir nicht helfen würde. Burrich stand finster und drohend wie eine dunkle Gewitterwolke neben meinem Bett. Ich ahnte, wie gerne er mich geschüttelt hätte, wie sehr es ihn in den Fingern juckte, mir mit ein paar Ohrfeigen die Halsstarrigkeit auszutreiben. Doch er hielt sich zurück. Burrich legte nicht Hand an einen Krüppel.
»Gut«, sagte er schließlich. »Dann bliebe nur noch die Sache mit deinem König. Oder hast du vergessen, dass du des Königs Gefolgsmann bist?«
»Ich habe es nicht vergessen«, erwiderte ich schnell. »Und hielte ich mich selbst noch für einen Mann, ginge ich mit dir zurück. Aber ich bin keiner mehr, Burrich. Ich wäre nur eine Bürde. Auf dem Spielbrett bin ich eine der Figuren, die beschützt werden müssen. Eine wehrlose Geisel, unfähig, sich oder andere zu verteidigen. Nein. Der letzte Dienst, den ich meinem König erweisen kann, besteht darin, mich selbst aus dem Spiel zu nehmen, bevor jemand anders es tut und meinen König damit in Bedrängnis bringt.«
Burrich wandte sich ab. Er erschien mir wie eine schwarze Silhouette in dem halbdunklen Raum. Der Ausdruck seines Gesichts im Feuerschein war nicht zu deuten. »Morgen sprechen wir uns«, setzte er an.
»Nur um Lebewohl zu sagen«, fiel ich ihm ins Wort. »Mein Entschluss steht fest, Burrich.« Ich berührte den silbergefassten blauen Stein in meinem Ohrläppchen.
»Wenn du hierbleibst, bleibe ich auch.« In seiner Stimme lag wilde Entschlossenheit.
»Nein, so läuft das nicht«, widersprach ich. »Einst hat mein Vater dir befohlen, zurückzubleiben und einen Bastard für ihn großzuziehen. Nun befehle ich dir fortzugehen, um einem König zu dienen, der deiner bedarf.«
»Fitz-Chivalric, ich werde nicht …«
»Bitte.« Ich weiß nicht, was er aus meiner Stimme heraushörte, nur dass er plötzlich verstummte. »Ich bin so müde. So unendlich müde. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nicht fähig bin zu tun, was man von mir erwartet. Ich kann es einfach nicht.« Meine Stimme klang brüchig wie die eines alten Mannes. »Was immer meine Pflicht wäre. Welche Schwüre ich auch geleistet habe. Es ist nicht genug von mir übrig, um mein Wort zu halten. Das mag nicht recht sein, aber ich kann es nicht ändern. Anderer Leute Pläne, anderer Leute Ziele. Niemals meine eigenen. Ich habe mich bemüht, aber …« Das Zimmer schwankte, als spräche durch mich ein anderer und als wäre ich entsetzt über das, was dieser sagte. Doch die Wahrheit seiner Worte ließ sich nicht leugnen. »Ich möchte jetzt allein sein«, sagte ich einfach. »Um mich auszuruhen.«
Burrich und auch Jonqui schauten mich wortlos an. Sie verließen den Raum, langsam, als hofften sie, ich würde mich besinnen und sie zurückrufen. Ich tat es nicht.
Doch nachdem sie fort waren und ich mit mir allein war, gestattete ich mir einen tiefen Seufzer. Die Ungeheuerlichkeit der Entscheidung, die ich getroffen hatte, machte mich ganz benommen. Ich würde nicht nach Bocksburg zurückkehren. Was nun werden sollte, wusste ich nicht. Ich hatte die Scherben meines bisherigen Lebens vom Tisch gefegt, jetzt war Platz zu sichten, was mir geblieben war, und neue Pläne zu schmieden. Allmählich kam mir zu Bewusstsein, dass ich von keinerlei Zweifel befallen war. Mein Bedauern kämpfte zwar an gegen meine Erleichterung, aber bei allem hatte ich keinerlei Zweifel. Irgendwie erschien es mir sehr viel erträglicher, in eine Zukunft zu gehen, in der niemand wusste, wer ich gewesen war. Eine Zukunft, die keinem fremden Willen Untertan war. Auch nicht dem Willen meines Königs.
Es war vollbracht. Ich legte mich hin, und zum ersten Mal seit Wochen fühlte ich mich vollkommen entspannt. Lebt wohl, dachte ich müde. Ich hätte gerne allen Lebewohl gesagt, hätte gerne ein letztes Mal vor meinem König gestanden und gesehen, wie er mir zunickte: Du hast richtig gehandelt. Vielleicht hätte ich ihm meine Beweggründe für meinen Abschied erklären können. Es sollte nicht sein. Zu Ende dieser Teil meines Lebens, unwiderruflich zu Ende. »Es tut mir leid, mein König«, flüsterte ich und starrte in die tanzenden Flammen des Kaminfeuers, bis der Schlaf mich übermannte.
Kapitel 1
Sylthafen
Thronfolger oder Kronprinzessin zu sein, bedeutet, den Bogen zwischen Verantwortung und Autorität richtig zu spannen. Es heißt, die Position wurde dafür geschaffen, das Streben eines Thronerben nach Macht zu befriedigen und ihn gleichzeitig in deren Ausübung zu schulen. Der älteste Spross der königlichen Familie wird an seinem sechzehnten Geburtstag in diesen Rang erhoben. Von dem Tag an trägt der Thronfolger oder die Thronfolgerin in vollem Maße mit an der Verantwortung für die Sechs Provinzen. Im Allgemeinen übernimmt er oder sie jene Pflichten, die dem jeweiligen Monarchen am missliebigsten sind, weshalb die Aufgabenbereiche von Thronfolgern naturgemäß erheblichen Veränderungen unterworfen sind.
Unter König Listenreich wurde Prinz Chivalric Thronfolger. Sein Vater übertrug ihm alles, was mit den Grenzen und der Außenpolitik zu tun hatte. Dabei handelte es sich um das Militär und die Diplomatie sowie um die Unbequemlichkeiten langer Reisen und die erbärmlichen Bedingungen auf Kriegszügen. Als Chivalric abdankte und Prinz Veritas die Thronfolge antrat, erbte dieser die ganze Last des Seekriegs mit den Fernholmern und den daraus entstandenen Unfrieden zwischen den Inland- und Küstenprovinzen. Seine Aufgabe wurde nicht gerade dadurch erleichtert, dass seine Entscheidungen jederzeit von König Listenreich widerrufen werden konnten. Oft sah er sich vor Situationen gestellt, die er zum einen nicht selbst geschaffen hatte und zu deren Bewältigung er zum anderen nicht mit eigenen Mitteln gerüstet war.
Möglicherweise noch prekärer war die Stellung der Kronprinzessin Kettricken, die als Tochter des Königs aus dem Bergreich eine Fremde am Hof der Sechs Provinzen war. In friedlichen Zeiten hätte man sie vielleicht mit weniger Vorbehalt aufgenommen, doch in Bocksburg herrschte die gleiche angespannte, düstere Stimmung wie im übrigen Reich. Die Roten Piratenschiffe der Fernholmer suchten unsere Küsten heim wie seit Generationen nicht mehr. Und sie zerstörten dabei weit mehr, als sie raubten. Der erste Winter von Kettrickens Herrschaft als Thronfolgerin brachte auch den ersten winterlichen Raubzug, den wir je erlebt hatten. Die unablässige Bedrohung durch die Überfälle von See her und der Gedanke an die durch nichts zu lindernden Qualen der Entfremdeten in unserer Mitte unterhöhlten das Fundament der Sechs Provinzen. Das Vertrauen in die Monarchie erreichte einen nie da gewesenen Tiefstand, und Kettricken war eines wenig geachteten Thronfolgers fremdländische Gemahlin.
Dabei spaltete ein Interessenkonflikt den Hof. Die Inlandprovinzen weigerten sich, mit ihren Steuern den Schutz einer Küste zu finanzieren, an der sie keinen Anteil hatten. Die Küstenprovinzen schrien nach Kriegsschiffen und Soldaten und einer wirksamen Strategie gegen die Korsaren, die unweigerlich dort zuschlugen, wo wir am wenigsten damit rechneten. Der durch seine Mutter den Inlandprovinzen verbundene Prinz Edel bemühte sich, durch alle möglichen Zuwendungen in diese Richtung Einfluss zu gewinnen. Der König-zur-Rechten Veritas, der davon überzeugt war, dass seine Gabe nicht länger ausreichte, die Korsaren in Schach zu halten, widmete alle Kraft dem Bau einer Flotte und hatte wenig Zeit für seine junge königliche Gemahlin. Über allem hockte wie eine große Spinne König Listenreich, bestrebt, die Macht zwischen sich und seinen Söhnen zu verteilen, alles im Gleichgewicht zu halten und die Einheit der Sechs Provinzen zu bewahren.
Ich erwachte, weil jemand meine Stirn berührte. Mit einem verärgerten Knurren drehte ich den Kopf zur Seite. Während mich zunächst noch meine Decken gefangen hielten, kämpfte ich mich von ihnen frei und setzte mich auf, um zu sehen, wer es wagte, mich zu stören. König Listenreichs Narr hockte ängstlich auf einem Stuhl neben meinem Bett. Ich starrte ihn an, und er duckte sich unter meinem Blick. Mich befiel eine gewisse Unsicherheit.
Der Narr hätte in Bocksburg sein sollen, bei meinem König, viele Meilen und Tagesritte von diesem Ort entfernt. Ich hatte nie erlebt, dass er abgesehen von der Nachtruhe für länger als einige wenige Stunden von des Königs Seite wich. Sein Hiersein bedeutete nichts Gutes. Der Narr war mein Freund, soweit seine Absonderlichkeit es ihm gestattete, jemandes Freund zu sein, doch ein Besuch von ihm verfolgte stets einen Zweck, und selten handelte es sich um eine Banalität oder etwas Angenehmes. Sein Gesicht wirkte müde, und er trug eine rot-grüne Tracht, die ich an ihm noch nicht gesehen hatte, sowie ein von einem Rattenkopf gekröntes Narrenzepter. Die bunte Kleidung stach grell von seiner bleichen Hautfarbe ab; er sah aus wie eine mit Stechpalmenzweigen umwundene durchscheinende Kerze. So wirkten die Kleider lebendiger als er. Sein spinnwebfeines helles Haar bauschte sich unter dem Rand der Kappe wie der Schopf eines Ertrunkenen im Wasser, und in seinen Augen spiegelten sich die tanzenden Flammen des Kaminfeuers.
»Hallo.« Ich strich mir das wirre, verschwitzte Haar aus dem Gesicht. »Es ist eine Überraschung, dich hier zu sehen.« Mein Mund war trocken, die Zunge dick und pelzig. Und eine verschwommene Erinnerung sagte mir, dass ich mich übergeben hatte.
»Wo sonst?« Er betrachtete mich sorgenvoll. »Für jede Stunde, die Ihr geschlafen habt, seht Ihr weniger erholt aus. Legt Euch nieder, Majestät, ich werde es Euch bequem machen.« Er zupfte umständlich an meinem Kissen, aber ich gebot ihm mit einem Wink, damit aufzuhören. Irgendetwas stimmte hier nicht. Nie zuvor hatte er auf diese Art mit mir gesprochen. Freunde mochten wir zwar sein, allerdings blieb mir seine Rede immer so schwer verdaulich und sauer wie unreifes Obst. Falls er aus Mitleid diese plötzliche Freundlichkeit an den Tag legte, war mir seine frühere Art doch lieber gewesen.
Ich betrachtete mein besticktes Nachtkleid und die kostbaren Bettdecken. Wieder hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, aber ich war zu müde und matt, um zu überlegen, was mich daran so befremdete. »Was tust du hier?«, fragte ich ihn.
Er atmete tief ein und seufzte. »Ich sorge für Euch. Wache über Euch, während Ihr ruht. Ich weiß, Ihr haltet es für närrisch, aber schließlich bin ich ein Narr. Also wisst Ihr, dass ich nicht anders kann, als närrisch zu sein. Dennoch stellt Ihr mir jedes Mal, wenn Ihr erwacht, dieselbe Frage. So erlaubt mir denn, ein weiser Narr zu sein und Euch zu raten: Lasst mich nach einem anderen Heiler schicken.«
Ich lehnte mich gegen die Kissen. Sie waren feucht vom Nachtschweiß und verströmten einen schalen Geruch nach Krankheit. Der Narr würde sie mir gegen frische tauschen, wenn ich ihn darum bat, doch wozu? Nicht lange, und das neue Bettzeug wäre ebenso klamm und dumpf wie das jetzige. Ich grub meine knorrigen Finger in die Daunendecke und fragte ihn ohne Umschweife: »Weshalb bist du gekommen?«
Er nahm meine Hand und streichelte sie. »Mein König, mir gefällt diese plötzliche Schwäche nicht, die Euch überkommen hat. Die Maßnahmen dieses Heilers scheinen Euch nicht gutzutun. Ich fürchte, sein Wissen ist weit geringer als die Meinung, die er davon hat.«
»Burrich?«, fragte ich ungläubig.
»Burrich? Wäre er nur verfügbar, Majestät! Er mag Stallmeister sein, doch ich wette, er ist ein besserer Medikus als dieser Wallace, der Euch mit Pulvern und Schwitzkuren traktiert.«
»Wallace? Burrich ist nicht hier?«
Ein Schatten fiel über das Gesicht des Narren. »Nein, Majestät. Er blieb im Bergreich zurück, wie Ihr wisst.«
»Majestät«, wiederholte ich und versuchte zu lachen. »Du machst dich lustig über mich.«
»Nie und nimmer, Majestät«, antwortete er ernst. »Nie und nimmer.«
Seine Sanftmut verwirrte mich. Dies war nicht der Narr, den ich kannte, voller Wortspiele und Rätsel, Doppeldeutigkeiten und raffinierter Seitenhiebe. Plötzlich fühlte ich mich merkwürdig angespannt. »Dann bin ich in Bocksburg?«
Er nickte schwerfällig. »Selbstverständlich.« Sein Gesicht war von tiefer Besorgnis erfüllt.
Ich schwieg und versuchte das Ausmaß des Verrats zu erfassen. Man hatte mich nach Bocksburg zurückgeschafft. Gegen meinen Willen. Und Burrich hatte es nicht einmal für nötig gehalten, mich zu begleiten.
»Erlaubt mir, dass ich Euch zu essen bringe«, bat der Narr. »Ihr fühlt Euch immer besser, wenn Ihr gegessen habt.« Er stand auf. »Ich habe bereits vor Stunden etwas am Feuer warmgestellt.«
Mein müder Blick folgte ihm. Er hockte vor dem Kamin und zog vorsichtig eine zugedeckte Terrine zu sich heran, hob den Deckel, und der Duft von herzhaftem Rindergulasch stieg auf. Er schöpfte eine Kelle voll in einen Essnapf. Seit Monaten hatte ich kein Rindfleisch mehr gegessen. In den Bergen gab es nichts als Wild, Schaf- und Ziegenfleisch. Ich schaute mich im Zimmer um. Da waren die schweren Tapisserien und die geschnitzten Lehnstühle. Die großen Steine der Kamineinfassung, die kostbaren, gewebten Bettvorhänge. Ich kannte das alles. Dies war das Schlafgemach des Königs in Bocksburg. Weshalb lag ich in des Königs eigenem Bett? Ich wollte den Narren danach fragen, doch dann war es so, als spräche ein anderer durch meinen Mund. »Ich weiß zu viele Dinge, mein närrischer Freund, und ich kann mich diesem Wissen nicht länger verschließen. Manchmal ist es, als hätte ein anderer Macht über meinen Willen und zwänge mich wahrzunehmen, was ich nicht wahrnehmen möchte. Meine Dämme sind geborsten. Wie eine Flut strömt alles in mich hinein.« Ich holte tief Atem, doch ich konnte es nicht länger aufhalten. Erst ein Frösteln, dann ein Gefühl, als stünde ich in rasch ansteigendem kaltem Wasser. »Die Flut«, stieß ich hervor. »Bringt Schiffe. Rote Schiffe …«
Die Augen des Narren weiteten sich erschreckt. »In dieser Jahreszeit, Majestät? Das kann nicht sein! Nicht im Winter!«
Meine Kehle war wie zugeschnürt, nur mit Mühe konnte ich weitersprechen. »Der Winter war zu gnädig mit uns, er hat uns seine Stürme vorenthalten und seinen Schutz. Sieh. Sieh doch, draußen auf dem Wasser. Sie kommen. Aus dem Nebel tauchen sie auf.«
Ich streckte den Arm aus. Der Narr trat zu mir ans Kopfende des Bettes und bückte sich, um in die Richtung zu schauen, in die ich wies, doch ich wusste, er konnte nichts sehen. Dennoch legte er mir guten Willens die Hand auf die schmale Schulter und kniff angestrengt die Augen zusammen, als vermöchte sein Wille die Mauern und Meilen zwischen ihm und meiner Vision zu überwinden. Gerne wäre ich so blind gewesen wie er. Unwillkürlich betrachtete ich meine abgehärmte Hand, die nach der seinen auf meiner Schulter griff. An einem knochigen, dünnen Finger trug ich an meinen grotesk verdickten Knöcheln den königlichen Siegelring. Dann wurde mein abwesender Blick von etwas angezogen, das sich in der Ferne abspielte.
Meine ausgestreckte Hand deutete auf den stillen Hafen. Ich richtete mich höher auf, um mehr zu sehen. Wie ein Flickenteppich lagen die Häuser und Gassen der schlafenden Stadt vor meinem Blick ausgebreitet, dichter Nebel hing in Bodensenken und über der Bucht. Das Wetter wird umschlagen, war mein erster Gedanke. Ein kalter Luftzug ließ mich frösteln. Trotz der tiefschwarzen Nacht und trotz des Nebels hatte ich keine Schwierigkeit, alles deutlich zu erkennen. Die Weitsicht der Gabe, sagte ich mir und stutzte. Denn ich war eigentlich nicht fähig, von der Gabe gezielt oder willentlich Gebrauch zu machen.
Vor meinen Augen lösten sich zwei Schiffe aus der Nebelwand und liefen in das Hafenbecken ein. Ich vergaß, mich über meine plötzliche Beherrschung der Gabe zu wundern. Diese Schiffe waren schlank und schnittig, und obwohl im Mondlicht keine Farben zu erkennen waren, wusste ich, dass sie einen roten Kiel hatten. Rote Korsaren von den Fernen Inseln. Die Schiffe schnitten durch die sich kräuselnde Wasseroberfläche wie Messer, zerteilten den Nebel und glitten in den geschützten Hafen wie eine dünne Klinge in den Bauch eines Schweins. Die Ruder hoben und senkten sich lautlos in perfektem Gleichtakt. Lumpen in den Dollen erstickten jedes Geräusch. Das Anlegen erfolgte mit der Selbstverständlichkeit ehrbarer Handelsfahrer. Vom ersten Boot sprang ein Matrose leichtfüßig an Land und machte das Tau am Poller fest. Einer der Ruderer hielt das Schiff vom Kai fern, bis auch die Heckleine ausgeworfen und festgemacht war. Alles wirkte so gelassen, so kaltblütig. Das zweite Schiff vollführte das gleiche Manöver. Mit der Unverfrorenheit von Raubmöwen waren die Roten Korsaren in den Ort gekommen und hatten am Heimathafen ihrer Opfer angelegt.
Kein Ausguck stieß einen Warnruf aus. Kein Wächter blies das Horn oder warf eine Fackel in den vorbereiteten Holzstoß, um ein Signalfeuer zu entzünden. Ich hielt nach ihnen Ausschau und entdeckte sogleich, dass sie mit auf die Brust gesunkenem Kinn müßig auf ihrem Posten verharrten. Jedoch hatte sich guter grauer Wollstoff unter dem Blutstrom aus ihren durchschnittenen Kehlen rot gefärbt. Ihre Mörder waren unbemerkt gekommen, von Land her und mit genauer Kenntnis der einzelnen Standorte, um die Warner verstummen zu lassen. Es gab niemanden mehr, um den schlafenden Ort zu wecken.
Viele Wächter waren es nicht gewesen. Das kleine Städtchen, eher ein Dorf, hatte nicht sonderlich viel zu bieten, kaum genug, um einen Punkt auf der Landkarte zu rechtfertigen. Weil es nichts zu holen gab, hatte man geglaubt, vor derartigen Überfällen sicher zu sein. Zwar lieferten ihre Schafe beste Wolle, die zu feinem Garn versponnen wurde; man fing und räucherte den Lachs, wenn er den Fluss hinaufkam; die Äpfel der Gegend waren kleingewachsen, aber süß und gaben einen guten Wein; ein Stück die Küste entlang nach Westen lag eine ertragreiche Muschelbank. Solcherart waren die kleinen Reichtümer von Sylthafen, und deshalb lohnte es keinesfalls den Aufwand, sich ihrer mit Fackel und Schwert bemächtigen zu wollen. Welcher verständige Mensch konnte annehmen, ein Fass Apfelwein oder ein paar Räucherlachse wären einem Korsaren der Mühe wert?
Aber dies waren Rote Korsaren, und ihnen gelüstete es nicht nach Reichtümern oder Schätzen. Sie hatten es nicht auf Zuchtvieh abgesehen, sie legten es nicht einmal darauf an, Frauen zu verschleppen oder junge Knaben zu rauben, um sie als Rudersklaven zu missbrauchen. Die Wollschafe würden sie verstümmeln und abschlachten, die Lagerhäuser mit Pelzen und Weinfässern in Brand stecken. Gefangene machten sie zwar, aber dann doch nur, um sie in einer magischen Verwandlung zu entfremden und jeglicher Menschlichkeit beraubt als Pestgeschwür in unserer Mitte zurückzulassen. Jene vernunft- und erinnerungslosen Kreaturen, die nur noch von primitivsten Instinkten beherrscht waren, plünderten danach ihr Heimatland mit der Erbarmungslosigkeit von Vielfraßen und erfüllten all jene mit Leid und Verzweiflung, denen sie teuer gewesen waren. Uns zu zwingen, unsere eigenen Landsleute als Mörder und Wegelagerer zu verfolgen, das war die grausamste Waffe der Fernholmer gegen uns.
Ich schaute zu, wie diese Flut des Todes stieg und die kleine Stadt in Besitz nahm. Die Korsaren sprangen von den Schiffen auf den Kai und sickerten in den Ort, verteilten sich in den Gassen wie tödliches Gift in Wein. Einige blieben zurück, um die anderen Schiffe im Hafen zu durchsuchen, zumeist offene Kähne, aber auch zwei Fischerboote und ein Frachter. Deren Mannschaften fanden einen schnellen Tod. Ihre panische Gegenwehr war so erbärmlich wie das Flattern und Gackern in einem Hühnerstall, in den ein Wiesel eingedrungen ist. Der dichte Nebel verschluckte unbarmherzig ihre Schreie, und unter der Nebeldecke war das Sterben eines Menschen nicht mehr als der verlorene Ruf eines Seevogels. Anschließend wurden die Boote achtlos in Brand gesetzt, ohne dass man einen Gedanken an ihren Wert verschwendet hätte. Diese Piraten scherten sich um keine Beute. Vielleicht nahmen sie sich eine Handvoll Münzen, wenn es sich so ergab, oder die Kette vom Hals einer Frau, die sie vergewaltigt und getötet hatten, aber das war schon alles.
Ich konnte nichts anderes tun, als zuzusehen. »Wenn ich sie nur verstehen könnte«, sagte ich zu dem Narren. »Ihre Beweggründe. Was diese Roten Korsaren tun, ist ohne Sinn und Ziel. Wie sollen wir gegen einen Angreifer Krieg führen, der nicht preisgibt, weshalb er unsere Küsten verheert? Wenn ich sie nur verstehen könnte …«
Der Narr schürzte seine blutleeren Lippen. »Sie sind von dem Wahnsinn besessen, der sie antreibt. Verstehen kann man sie nur, wenn man sich ebenfalls darauf einlässt. Ich für meine Person hege nicht den Wunsch, sie zu verstehen. Dass man versteht, weshalb sie tun, was sie tun, wird sie nicht hindern, damit fortzufahren.«
»Nein.« Ich wollte nicht mit ansehen, was geschah. Zu oft war ich Augenzeuge dieser Gräueltaten gewesen. Doch nur ein herzloser Mensch hätte sich abwenden können wie von einem schlecht in Szene gesetzten Puppenspiel. Das Mindeste, was ich für mein Volk tun konnte, war, seinem Sterben zuzusehen. Das Mindeste und das Einzige. Ich war krank und gebrechlich, ein alter Mann, ein Betrachter aus weiter Ferne. Mehr konnte man von mir nicht erwarten. Also saß ich in meinem Bett und schaute zu.
Ich sah das Dorf aus seinem friedlichen Schlummer zu grausiger Wirklichkeit erwachen: durch den rohen Griff einer fremden Hand an Kehle oder Brust, durch einen über der Wiege gezückten Dolch oder durch das Weinen eines aus dem Schlaf gerissenen Kindes. Viele Lichter flammten auf und erhellten das Dorf mit einem glühenden Schein – ob durch rasch angezündete Kerzen, weil jemand sehen wollte, was der Aufschrei aus der Nachbarschaft zu bedeuten hatte, oder durch Fackeln, die zusammen mit den ersten Flammen aus brennenden Häusern grell aufleuchteten. Obwohl die Roten Korsaren seit mehr als einem Jahr die Sechs Provinzen heimsuchten, hatte man in Sylthafen geglaubt, auf alles vorbereitet zu sein. Man hatte die Schreckensmeldungen vernommen und beschlossen, einem selbst werde das nicht widerfahren. Aber die Häuser brannten, und die Schreie gellten zum Himmel wie vom Rauch emporgetragen.
»Sprich, Narr«, verlangte ich heiser. »Tu einen Blick in die Zukunft für mich. Was erzählt man von Sylthafen? Einem Überfall auf Sylthafen im Winter.«
Er holte stockend Atem. »Es ist nicht einfach zu sehen und auch nicht deutlich«, sagte er zögernd. »Alles ist verschwommen, im Wandel begriffen. Zu viel ist im Fluss, Majestät. Die Zukunft ergießt sich von dort in alle Richtungen.«
»Verkünde mir alles, was du sehen kannst«, befahl ich.