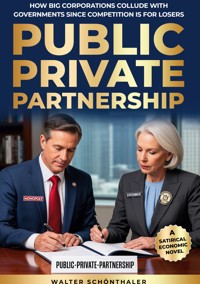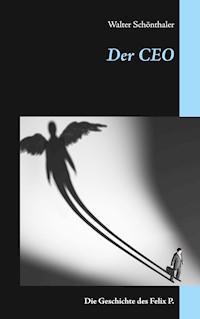
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf im Waldviertel anno 1969: für den dreizehnjährigen Felix Penzinger bricht die Welt zusammen, als sein Vater, der Besitzer eines Mühlenbetriebes, in den Bankrott schlittert. Felix bekommt die Gnadenlosigkeit des sozialen Räderwerks dörflicher Gemeinschaften zu spüren. Denn in Ellend, dem Dorf an der tschechischen Grenze, gibt es kaum jemanden, der vom Konkurs des väterlichen Mühlenunternehmens nicht betroffen ist. Durch den Bankrott seines Vaters stürzt der dreizehnjährige Bub vom geachteten Bürger auf die Nullposition der dörflichen Gemeinschaft. Eine besonders aktive Rolle bei der Demontage der Unternehmerfamilie Penzinger spielt der Konkursverwalter Varus, der bei seiner ersten offiziellen Amtshandlung keine Gelegenheit auslässt, um den Buben zu demütigen. Im Sommer 2009, vier Jahrzehnte danach, treffen Felix und Varus wieder aufeinander. Felix ist inzwischen Geschäftsführer und Miteigentümer einer Papierfabrik. Varus, inzwischen CEO einer Unternehmensgruppe, will Felix Penzingers Papierfabrik kaufen, um sie für seinen EGT-Konzern wirtschaftlich auszubeuten und anschließend in den Bankrott zu führen. Wird es Felix gelingen, sich vierzig Jahre nach dem Konkurs des väterlichen Unternehmens an Varus zu rächen und seine Papierfabrik zu retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Realwirtschaft gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil
Oktober 1969
Das Bild des Bundespräsidenten
Ellend
Varus
Härtling
Stille Reserven
Sonntagsgewand
Verschüttete Milch
Der Kretzenberg
Der Holzbottich
Konkursmasse
Katzenschmaus
Die Jäger
Superbenzin
Im Dorfgasthaus
Die Schraube
Konkursordnung
Die Reifeprüfung
Teil
Vierzig Jahre Später
Schickelgruber
Discontclub
Der Ceo
Klimt
Public Relations
Kretzenberger
Markenartikel
Einundzwanzig Cent
Der Auftrag
Cohiba
Pjotr
Das Attentat
Video Stars
Big Brother
Abidjan
Virtualismus
Epilog
VORWORT
Die Geschichte des Felix Penzinger beginnt im Jahre 1969, als noch das Bild des ehrbaren Kaufmannes die Vorstellung von Unternehmern prägte. In einer Zeit, als die Unternehmer noch dafür geachtet und geschätzt wurden, dass sie vielen Menschen Arbeit gaben.
Vor vierzig Jahren war die Strategie des Personalabbaus als betriebswirtschaftliche Methode zur Steigerung von Effizienz und zum Pushen der eigenen Aktienkurse von der Öffentlichkeit noch nicht allgemein akzeptiert, sondern hatte zur Konsequenz, dass der betreffende Unternehmer seinen guten Ruf verlor. Ein Konkurs oder Ausgleich war für den Unternehmer und seine Familie, insbesondere in den Dörfern der Provinz, automatisch mit gesellschaftlicher Ächtung verbunden.
Als der Mühlenbetrieb von Felix´ Vater von einem Tag auf den anderen in die Insolvenz schlittert, zweiundsechzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit und die Unternehmerfamilie Penzinger ihre komplette Existenz verlieren, bekommt der erst dreizehnjährige Felix die Schattenseite dieser unternehmerischen Ethik und die Gnadenlosigkeit des soziale Räderwerks der Siebziger-Jahre zu spüren.
Im Juni 2009, vierzig Jahre nach dem schicksalhaften Ereignis des Konkurses wird die Erzählung fortgesetzt. Felix ist inzwischen Geschäftsführer und Miteigentümer einer Papierfabrik und muss einen Übernahmeversuch des EGT-Konzerns abwehren. Sein Gegenspieler ist der frühere Konkursverwalter Varus, der Felix vor vier Jahrzehnten gedemütigt und unter Druck gesetzt hat.
Der Zeitsprung von vier Jahrzehnten in der Erzählung ermöglicht es, fundamentale Unterschiede zwischen der realwirtschaftlich dominierten Wirtschaft der siebziger Jahre dem überwiegend finanzwirtschaftlich geprägten System der Jetztzeit bewusst zu machen.
Welche allgemeinen Erkenntnisse kann man nach vier Jahrzehnten in der Wirtschaft beobachten, sodass man sich motiviert fühlen kann, darüber einen Roman zu schreiben?
Da ist zunächst die wenig überraschende Tatsache, dass die Entscheidungen in Unternehmen nicht – wie in den Lehrsälen der Handelsakademien, Fachhochschulen und Wirtschaftsuniversitäten oft behauptet wird – ausschließlich nach dem Prinzip der Rationalität und des ökonomischen Prinzips getroffen werden. Dass es nicht immer der Beste ist, der sich in der Marktwirtschaft durchsetzt. Dass sich die Märkte nicht in Form einer unsichtbaren Hand zum Wohl der Gemeinschaft von selbst regulieren. Und dass es nicht den Tatsachen entspricht, dass große Unternehmen und Konzerne keinen ideologischen Unterbau hätten und nur nach dem ökonomischen Prinzip funktionierten.
Ein Vergleich der heutigen Medienberichte mit jenen der Siebziger Jahre zeigt, dass sich der wirtschaftliche Focus der Medien in den letzten vier Jahrzehnten grundlegend verschoben hat. Beim Blick auf die Wirtschaftsseiten der Online- und Print-Medien springen heute folgende Schlagwörter entgegen: Investoren, Bankenrettung, Eurorettung, Nullzinspolitik.“ Diese Themen haben in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle gespielt. Denn in dieser Zeit dominierte der Begriff des Unternehmers.
Die gerade die Unternehmer haben gegenüber den Investoren in den letzten Jahrzehnten in der Öffentlichkeit deutlich an Bedeutung verloren. Sie können diese Tatsache selbst ganz einfach überprüfen: Googeln Sie auf Ihrem Smartphone die beiden Begriffe Investor und Unternehmer. Nehmen Sie nur die deutschsprachigen Ergebnisse, damit die Vergleichbarkeit beider Begriffe gegeben ist. Zum Suchbegriff „Investor deutsch“ spuckt die Suchmaschine von Google ca. 140 Mio. Ergebnisse aus. Wenn Sie den Suchbegriff „Unternehmer“ in die gleiche Suchmaschine eingeben, erhalten Sie nur ca. 50 Mio. Hits. Über Investoren wird im deutschsprachigen Raum des Internets also fast drei Mal so viel berichtet wie über Unternehmer. Der Unterschied zwischen Unternehmer und Investoren ist allerdings nicht gering, sondern er ist fundamental. Warum?
Alle Unternehmer sind Investoren. Aber sind alle Investoren auch Unternehmer? Es wird oft so behauptet und auch in den Medien berichtet. Aber es ist falsch und es ist eine fatale Verwechslung. Jeder Unternehmer ist auch ein Investor, aber nicht jeder Investor ist auch ein Unternehmer. Im Gegenteil: Finanzinvestoren agieren selten wie klassische Unternehmer. Denn die Geschäftsmodelle von Investoren und Unternehmern sind so gegensätzlich wie Credit Default Swaps und die Entwicklung einer neuen Spitzen-Technologie.
Der Unternehmer will ein überlegenes Produkt oder Dienstleistung anbieten und mit Gewinn verkaufen. Dazu benötigt er einen überlegenen Kundennutzen. Deshalb hat der Unternehmer unablässig den Markt, seine Kunden und den Nutzen seiner Produkte und Dienstleistungen im Auge.
Der Finanzinvestor hingegen ist Experte für Kredit und Geld, er orientiert sich am Shareholder Value. Er muss von der Führung der Unternehmen selbst überhaupt nichts verstehen. Bei Schwierigkeiten verkauft er seine Papiere. Das ist auch in Ordnung so, solange man die beiden Geschäftsmodelle nicht miteinander vermischt, indem man etwa Unternehmen ausschließlich nach Kriterien des Investors beurteilt.
Der Unternehmer im Sinne des Eigentümers kümmert sich um sein Unternehmen bei jedem Wetter, er kämpft bei Schwierigkeiten, denkt in Generationen, kann und will auch nicht verkaufen, sein persönliches Schicksal ist mit seinem Unternehmen eng verbunden. Auch der Unternehmer wirtschaftet nicht aus edlen Motiven. Er will und muss Gewinne machen, um wieder investieren zu können. Aber der Focus des Unternehmers liegt auf dem Markt, seinen Produkten und Dienstleistungen, der permanenten Verbesserung seiner Produkte oder Dienstleistungen, der Innovation und dem Marketing der Value Proposition.
Natürlich hat auch der Unternehmer ein Interesse am Wert seiner Aktien, aber der Aktienkurs genießt nicht sein primäres Interesse. Ein Unternehmer richtet seine Aufmerksamkeit nicht auf das kurzfristige Steigen des Aktienkurses, sondern auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens am Markt. Wichtiger als der Aktienkurs sind dem Unternehmer die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens und seine Stellung am Markt. Auch wenn ihm das nicht immer passt und nicht immer leichtfällt. Denn der Unternehmer hat gar keine andere Wahl. Er darf sich nicht, wie ein Investor, nur am Shareholder Value orientieren – der Unternehmer muss sein Unternehmen danach ausrichten, den Nutzen für seine Kunden zu schaffen und ihn permanent zu verbessern. Um das zu erreichen, wird der Unternehmer viele unterschiedliche Parameter im Unternehmen beobachten und aktiv verändern: Deckungsbeiträge, Investitionen, Qualitäts-Management, Forschung und Entwicklung, Cash Flow, Liquidität. Der Unternehmer braucht dazu keine Stock Exchange. Unternehmen haben schon existiert, bevor Börsen überhaupt entstanden waren. Die Marktwirtschaft braucht also in erster Linie tüchtige Unternehmer. Ohne Unternehmer können die Investoren und die Finanzmärkte kein Wachstum schaffen, indem sie Kapital für Innovationen auch in sehr frühen Phasen der Entwicklung bereitstellen.
Die Marktwirtschaft funktioniert nur in Freiheit. Aber Freiheit bedeutet nicht Regellosigkeit. Wettbewerb bedarf klarer Regeln, deren Einhaltung durchgesetzt werden muss. Regelsetzung ist ein notwendiger Bestandteil von Innovations- und Entwicklungspolitik. Das trifft in besonderem Maße auf die Finanzwirtschaft zu, die sich seit der Finanzkrise 2008 immer mehr von der Realwirtschaft abgekoppelt hat und versucht, den Zusammenbruch des Fiat-Money-Systems durch Nullzinspolitik und Schuldensozialismus zu verhindern.
1. Teil OKTOBER 1969
OKTOBER 1969
Gestern, am 25. Oktober 1969, war Barbara, das Dienstmädchen weggegangen. Felix wusste, dass sie nie wieder in das Haus zurückkehren würde. Barbara hatte ihn jeden Abend in einem großen Aluminiumbottich gewaschen, der in der Küche neben dem Holzofen stand. Es gab keinen Warmwasserspeicher im Haus, und so musste das kalte Wasser auf den konzentrischen Platten des Holzofens erwärmt werden. Jeden Abend um halb sieben, wenn das Abendessen begann, nahm Barbara den großen metallenen Bottich, stellte ihn auf die etwa einen Meter hohe, massive Holzkiste und füllte den Bottich mit warmem Wasser. Dann musste sich Felix ausziehen und hineinstellen. Nachdem die Holzkiste für den zwölfjährigen Buben zu hoch war, benutzte Felix einen kleinen Schemel, um auf die Kiste und den Aluminiumbottich zu gelangen.
Felix stand auf der Holzkiste wie auf einem Podest. Sozusagen unter den Augen der Öffentlichkeit fing Barbara an, den Buben mit Schwamm, Seife und dem Wasser des Bottichs zu waschen. Eigentlich war es mehr eine Massage als eine Wäsche. Oben, als bewegliches Monument auf seiner Holzkiste, war er zwar nackt und schutzlos den Blicken der Abendgesellschaft ausgesetzt, aber er profitierte auch von der erhöhten Perspektive des Beobachters. Während Barbara ihren Schwamm in das lauwarme, allmählich abkühlende Wasser tauchte, um seinen Körper von oben bis unten abzuwaschen, beobachtete Felix seinen Vater, Hubert Penzinger und seine Stiefmutter Stephanie beim Abendessen.
Auch den Prokuristen Härtling hatte Felix früher da unten beobachtet. Der Prokurist aß gern eine bestimmte Sorte Schinkenwurst, aber er war stolz auf seine schlanke Figur und hasste Fett nicht nur aus Eitelkeit, sondern auch, weil er alles was fett war, nicht gut verdauen konnte. Messer und Gabel benutzte er mit erlesener Eleganz, er agierte lässig, mit beinahe aristokratischer Gelassenheit. Sein roter Jaguar stand frisch gewaschen und hochglanzpoliert vor der Garage. Auf dem Teller des Prokuristen lag immer die gleiche Art von Schinkenwurst - oder das was davon noch übriggeblieben war, nachdem Barbara die weißen, kreisrunden Fettteilchen mit einem Messerchen säuberlich entfernt hatte. Es gehörte zu einer der zahlreichen Marotten Härtlings, dass er seine abendliche Wurst ausschließlich in dieser entfetteten, gesäuberten Form zu sich nahm. Das auf diese Weise verstümmelte Fleisch sah so erbärmlich aus, dass der Junge sich fragte, ob es möglich war, dass man mit einer gemarterten Wurst Mitleid empfinden konnte. Dort, wo zuvor die weißen Fettaugen waren, klafften nach der Radikal-Exstirpation durch Barbaras Messer kleine, kreisrunde Löcher im Fleisch, die wie schwere Verletzungen aussahen. Vielleicht war es aber gerade diese eigentümliche Spleenigkeit Härtlings, der so großen Eindruck auf Stephanie machte.
Auf der erhöhten Position seines Zuschauerpodiums konnte Felix also jeden Abend ein Schauspiel verfolgen. Solcherart waren die Verhältnisse also auf merkwürdige Weise umgekehrt, verdreht. Die Schauspieler saßen unten, auf ihren Sesseln, der einzige Zuschauer hingegen stand nackt auf der Bühne. Es war absurd, so wie vieles in dem kleinen Ort Ellend irgendwo im österreichischen Waldviertel, hart an der toten Grenze zur Tschechoslowakei, ein Jahr nach dem Ende des Prager Frühlings. Felix empfand es als ein seltsam ambivalentes, mehrschichtiges Gefühl, dass er Abend für Abend das Benehmen der Tischgesellschaft beobachten konnte, während er gleichzeitig nackt war und dabei mit einem weichen Schwamm von einem Mädchen sanft massiert wurde.
Sein Vater, der Besitzer eines Mühlenbetriebs, besaß eine kraftvolle Vitalität, die er nicht zu verbergen trachtete. Mit verlässlicher Regelmäßigkeit verschwand er nach dem Abendessen zum Kartenspielen ins Wirtshaus. Aufgrund seiner Körpergröße und seiner guten Konstitution vertrug der Mühlenbesitzer Hubert Penzinger ein erstaunliches Quantum an Alkohol. Zur Durchsetzung seiner Argumente prügelte er sich gelegentlich mit seinen Zechbrüdern, zumeist Bauern aus dem Ort. Seinen schlechten Ruf als naturburschiger Machtmensch trug er in der ganzen Gemeinde wie eine exklusive Auszeichnung mit sich herum.
Hubert Penzinger war der erste im Ort gewesen, der ein Motorrad besessen hatte. Eines Abends war er auf dem Heimweg nach einem triumphalen Erfolg beim Bauernschnapsen nach dem Einkippen von sieben Krügel Bier mit seinem Motorrad frontal gegen eine Schwarzföhre gerast. Anschließend war er dann elf Tage im Koma gelegen und vier Wochen im Rollstuhl gefahren. Nach seiner wundersamen Genesung hatte er jedoch keinen Anlass dafür gefunden, sein Leben zu ändern. Einmal mehr hatte er die kraftvolle Unbeugsamkeit seines ausgeprägten Charakters eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hubert Penzinger war weiterhin ins Wirtshaus gegangen, hatte diejenigen, die sich wider besseres Wissen darauf eingelassen hatten, mit ihm Karten zu spielen mit wachsender Routine über den Tisch gezogen, ging in seiner tausendfünfhundert Hektar Jagdpacht der Jagd nach den Gamsbärten, den Geweihen der Hirsche und den Röcken der Mädchen nach und war, für alle augenscheinlich, der erste Mann im Ort.
Der Mühlenindustrielle Hubert Penzinger war der uneheliche Sohn eines Waldviertler Erdäpfelbauern. Als rotznasiger Bastard hatte er schon früh lernen müssen, sein Leben in die Hand zu nehmen. Seine Mühle hatte er demzufolge allein, gänzlich ohne fremde Hilfe und ohne Startkapital aufgebaut.
Nach dem Krieg war das Geschäft rasch gewachsen, hatte sich prächtig entwickelt, und bald beschäftigte die Penzinger-Mühle fünfundfünfzig Arbeiter und sieben Angestellte.
Aber heute, an diesem Spätherbstmorgen des Jahres 1969, war das alles zu Ende gegangen. Die Sozialversicherung der Arbeiter hatte den Konkurs der Penzinger-Mühle beantragt. Hubert wusste noch nicht, was das bedeuten würde. Er konnte ja keine Bilanz lesen. Die bei ihm im Betrieb beschäftigten Arbeiter würden eben noch ein paar Tage warten müssen, bis ihr Lohn in Form der abgezählten Geldscheine und Münzen in Papiersäckchen mit Abrechnungsstreifen ausgezahlt wird, dachte Penzinger.
“Die Leute sollten doch froh sein, dass sie überhaupt etwas zu arbeiten haben!” hatte Penzinger vor ein paar Tagen dem Gewerkschaftsfunktionär ins Telefon gebrüllt. Und jetzt war der Konkurs eingeleitet, und er konnte die Löhne nicht zahlen, weil ihm die Hausbank als Reaktion auf den Konkursantrag der Anstalt für Sozialversicherung alle Kredite fällig gestellt hatte.
Seit der Buchhalter Härtling die Firma fluchtartig verlassen hatte - das war vor etwa einem halben Jahr gewesen - herrschte Chaos in den Büchern, und Hubert hatte nicht die leiseste Ahnung von Finanzen. Er war ein Meister im Umgang mit seinesgleichen, mit den Bauern, die ihm den Weizen und den Roggen für seine Mühle verkauften. Der Einkauf der Rohware und das tiefe Verständnis seiner bäuerlichen Lieferanten war Huberts ureigenes Metier, hier hatte er seiner Mühle den entscheidenden Vorteil verschafft. Vom Rechnungswesen verstand er jedoch so gut wie nichts. Heute, im Herbstnebel 1969, war er am Ende angelangt. Der ganze Ort wusste es. Viele Gegenstände im Haus und in der Fabrik waren bereits verpfändet oder wurden von Gläubigern unverzüglich abgeholt.
Am raschesten hatte die Telefongesellschaft reagiert. Die Techniker der Post waren bereits am frühen Morgen da gewesen. Der Anschlusskasten des Telefons wurde kurzerhand abgeschraubt und mitsamt dem Apparat mitgenommen.
Beim Hinausgehen räusperte sich der ältere der beiden Monteure und stammelte in ungeschickter Verlegenheit: “Tut mir leid. Was uns angeschafft wird, müssen wir erledigen. Auf Wiederschauen.”
Der jüngere, offenbar noch Lehrling, packte den Montagekoffer und folgte wortlos seinem Meister. Felix schien es, als ob die beiden sich während des Hinausgehens insgeheim zulächelten. Mit Beklemmung dachte er an die nächste Unterrichtsstunde in Maschineschreiben. Bis jetzt war es ja noch relativ einfach gewesen. Für seine Übungen hatte er sich die Schreibmaschine im Büro ausgeborgt. Um ins Büro, zu seiner Schreibmaschine zu gelangen, brauchte er nur die Stufen von der Küche, welche im ersten Stock der Villa gelegen war, zum Büro ins Erdgeschoß hinuntergehen.
Aber heute war die Tür zum Büro verschlossen. Felix blieb vor der verschlossenen Türe stehen. Unwillkürlich, ohne dass er erklären konnte warum, betrachtete er seine Hände. Schlimm genug, dass ich nicht Schreibmaschine schreiben kann, dachte Felix. Aber er konnte nicht nur nicht Maschine schreiben, er hatte auch noch schmutzige Hände, wie ein Kohlenarbeiter, der seine Handschuhe vergessen hatte. Er dachte an Barbara, das Dienstmädchen. Dabei stellte er sich vor, wie sie sich vor seinen schmutzigen Händen ekeln würde. Er ging wieder hinaus in seine Wohnung, um seine Hände gründlich mit Bürste und Schichtseife zu waschen. Barbara war neunzehn. Ihre Eltern hatten sie schon zu den Penzingers in die Arbeit geschickt, als sie erst sechzehn war.
Gestern war Barbara weggegangen – für immer. Felix hatte man nicht gesagt, warum. Aber es hatte großen Krach gegeben. Seine Stiefmutter war zuerst hysterisch geworden, später hatte sie geweint und sich schließlich in ihrem Zimmer eingeschlossen.
Felix suchte mit wachsender Verzweiflung nach einer Möglichkeit, um an die Schreibmaschine heranzukommen. Er wusste, die Prüfung nächste Woche würde entscheidend sein. Seine bisherigen Leistungen im Maschineschreiben waren allesamt mit Nichtgenügend beurteilt worden. Es war grotesk. Er würde der erste Schüler der Handelsakademie sein, der nur deshalb durchfallen würde, weil er nicht Maschineschreiben konnte. Wenn er jetzt keine Schreibmaschine bekäme, würde er seine Hausaufgaben nicht tippen können, und es war ihm klar, dass er im Maschineschreiben hoffnungslos in Rückstand geraten würde, denn die fehlenden Übungen ließen sich in der kurzen Zeit bis zur nächsten Klassenarbeit ohne Schreibmaschine nicht durchführen.
Zuerst dachte er daran, über das Fenster von der Bachseite in das Büro einzusteigen, um die Schreibmaschine in die Wohnung mitzunehmen. Aber das Risiko, dabei ertappt zu werden, war groß. Er hatte keine Angst, dabei abzustürzen, aber man würde ihn des Diebstahls bezichtigen, denn die Schreibmaschine war ein Teil der Konkursmasse geworden, sie gehörte nun den Gläubigern, wie der Sozialversicherungsanstalt oder den Banken oder den Arbeitern, die auf ihren Lohn warteten.
Es gab nur eine einzige Möglichkeit, legal an die Schreibmaschine heranzukommen: Er musste seinen Vater bitten, sie aus der Konkursmasse herauszulösen.
Felix stieg die Holzstufen hinauf ins Wohnhaus. Der Vater lag auf der kleinen roten Couch im ungeheizten Nebenzimmer. Er lag regungslos auf dem Rücken und starrte auf den Plafond.
“Papa. Bitte entschuldige die Störung. Ich möchte dich was fragen...” krächzte Felix, dessen Stimme vor Aufregung heiser war.
“Was willst du? Falls du das noch nicht bemerkt hast: wir sind bankrott - erledigt, kaputt. Die Krankenkasse hat Konkurs angesagt. Am liebsten tät ich mich erschießen, aber ich bin ja kein Feigling. Sogar das Telefon haben sie mir abgedreht. Und für dich wird es Zeit, was Anständiges zu lernen. Du musst Geld verdienen. Oder glaubst du etwa, dass wir dich hier unter diesen Umständen noch länger durchfüttern können!”
Enttäuschung, Verzweiflung und Zorn packten Felix mit einer Kompromisslosigkeit, die keine Gegenwehr erlaubte. Aber er hatte Pech, denn er war noch zu klein. Felix konnte sich noch nicht so wehren, wie er es vermocht hätte, wäre er ein paar Jahre älter gewesen. Seine Stimme kam ihm irgendwie überhöht vor, etwas zu kindlich, um Eindruck zu machen. Jetzt, im entscheidenden Augenblick, konnte er kaum sprechen. Alles, was er herausbrachte, war ein flüsterndes Zischen. Felix hasste seine helle Sopranstimme. Die meisten seiner Schulkollegen hatten bereits den Stimmwechsel bekommen und waren im Schulchor der Handelsakademie in die männlichere Tenorgruppe versetzt worden, nicht aber Felix, der dies mit aller Kraft wollte, ja brauchte. Mit dieser Stimme, das wurde ihm klar, hatte er keine Möglichkeit, zu gewinnen. Jeder Kampf würde unweigerlich verloren gehen. Hoffnungslos war es, Hubert herauszufordern. Aber Felix wusste, dass das nur ein Teil der ganzen Katastrophe war. Das Unglück würde erst richtig ausbrechen in den nächsten Tagen, wenn der Konkurs nach und nach überall bekannt wurde. Am Ende würde die Schande unerträglich sein.
“Papa…”, flüsterte Felix in hellem Sopran, “bitte kauf die alte Schreibmaschine, die unten im Büro steht, oder löse sie wenigstens aus der Konkursmasse heraus. Ich habe in ein paar Tagen eine Prüfung in Maschineschreiben, in der Handelsakademie, dort lernt man genau das vermeiden, was uns jetzt passiert ist.”
Im selben Augenblick schon wurde ihm bewusst, dass er sein flehentliches Ersuchen in seiner Aufregung mit der falschen Argumentation vorgetragen hatte, aber da hatte er es schon ausgesprochen, oder genauer gesagt, er hatte es ausgestoßen, er hatte es reflexhaft herausgewürgt, ohne dass er es ihm vorher gewusst geworden war.
Die Dissonanz zwischen dem, was er gesagt hatte, und der Art, wie er es gesagt hatte, ließ die naive Aufrichtigkeit seiner Bitte komisch aussehen. Er hatte seinen Vater um etwas bitten müssen, in einer Situation höchster Verzweiflung. Wer in höchster Verzweiflung bittet, das hatte er nun auf schmerzhafte Weise lernen müssen, der macht sich lächerlich. Ja, Felix war auf dem Weg, allmählich eine lächerliche Figur zu werden. Seine Bewegungen wirkten linkisch, denn er war in letzter Zeit viel zu schnell gewachsen und bei weitem zu leichtgewichtig, im Verhältnis zu seiner Körpergröße. Beim Fußballspiel hatten sie ihn erst nach längeren, umständlichen Beratungen in die erste Klassenmannschaft aufgenommen, er stellte einen schwierigen Fall dar, einen Grenzfall eben. Ein Fußballteam besteht halt nur aus elf Spielern, und er war der unbedankte Zwölfte. Aber es gab eine Sportart, die Felix ausgezeichnet beherrschte: Er war Spitzensportler im Hochspringen und im Laufen. Leider machte ihm die Ausübung dieser Disziplinen solche Freude, dass er nicht selten auf den eigentlichen Zweck des Fußballspieles vergaß. Irgendwann kam irgendeiner seiner Mitspieler auf die Idee, ihm den Spitznamen Drachensteiger zu verpassen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte seine langen Beine beim Kicken etwas weniger hochgeschleudert. Er schämte sich wegen seiner linkischen Bewegungen, und die Komik des leptosomen Extremismus, die er Tag für Tag in ungewollter Weise verkörpern musste, empfand er als tiefe Demütigung. Leider blieb er von diesen Empfindungen auch in dem Augenblick nicht verschont, als er seinen Vater um etwas bitten musste. Wie so oft, so hatte auch diesmal wieder sein Unbewusstes den Archetypus des Drachen Steigers in ihm aufsteigen lassen, um ihn für die Verletzung seiner Würde zu bestrafen.
Hubert Penzinger wusste keinen Ausweg aus der Situation, in der er sich jetzt befand. Jahrelang hatte er geschuftet, um das Unternehmen aufzubauen. Und jetzt war er Bankrott und als Mensch war er war vernichtet. Das ganze Dorf, ja das ganze Tal verachteten ihn. Hubert liebte seinen Sohn, aber er konnte es ihm nicht sagen. Denn er wusste nicht, wie er mit ihm kommunizieren konnte. Der Bub war ihm ein Rätsel. Nicht nur, dass der jeden Sonntag zum Pfaffen in die Messe ging, er musste dort auch noch den Oberministranten abgeben. Jeden Sonntag verlas Felix die Lesung aus der Bibel. Der ganze Ort wunderte sich. Er hätte diesen Unfug nicht zulassen sollen.
Auch diesmal fand er nicht den richtigen Einstieg, fand nicht den richtigen Inhalt und Modus, um mit seinem Sohn zu sprechen:
“Als ich in deinem Alter war …”, sagte Hubert Penzinger, “…hab‘ ich Tag und Nacht schuften müssen. Es wird Zeit, dass auch du jetzt was lernst. Ich kann dich wirtschaftlich nicht mehr erhalten. Die Schreibmaschine im Büro unten, die solltest du vergessen. Ist ja eh egal, denn in der Handelsakademie kannst Du sowieso nicht mehr bleiben. Der Doktor Van Russ, oder wie der heißt, dieser Amtswalter, oder wie man das nennt, hat das ganze Büro, den Zugang zur Werkshalle und zur Lagerhalle versiegeln lassen und auf alle Gegenstände einen Kuckuck gepickt. Sonst hätte ich ja längst ein paar Maschinen herausgenommen und verkauft. Aber glaubst ich geh ins Gefängnis wegen einer Schreibmaschine, die du sowieso nicht mehr brauchen wirst? Geh einfach arbeiten in die Fabrik oder wandere nach Australien aus – ich habe‘ zwar kein Bargeld mehr, aber ein paar Golddukaten kann ich dir noch geben, die reichen für die Reise.”
Felix war geschockt, entsetzt, grenzenlos enttäuscht, er griff an die Türklinke, wollte hinauslaufen, aber er konnte sich im ersten Augenblick nicht bewegen. Das Blut pulsierte in den Fingern, irgendwas schob ihm Tränen in die Augen, er war nahe daran, sich einfach fallen zu lassen. Aber dann drückte er die Türklinke nach unten, so ruckartig, dass sie beim Loslassen mit einem unangenehmen Geräusch nach oben schnappte, drehte sich um, ging wie in Trance aus dem Zimmer.
Wie sollte er den morgigen Tag überstehen? Felix umrundete mehrmals den staubbedeckten Biedermeiertisch, klopfte während des Gehens mit der Faust auf den Tisch, zwei Schritte, eins, zwei, klopf, eins, zwei, klopf. Eins und zwei und klopf auf den Tisch, klopf auf den Tisch, schlag´ auf den Tisch, auf den schwarzen Biedermeiertisch und eins, zwei geht er jetzt im Kreis und immerfort im Kreis um den Tisch. Ob sich durch das fortwährende Gehen im Kreis Trittspuren bildeten, Gehpfade, kreisförmige Fußpfade der Verzweiflung? Die Jahresringe auf der großen runden Tischplatte waren trotz der schwarzen Imprägnierfarbe deutlich zu sehen. Auf dem weichen Holz konnte man die Maserung des Holzes mit dem Fingernagel nachziehen, verstärken oder durchkreuzen. Es kam ihm immer schon merkwürdig vor, dass sie zwar alte Biedermeiermöbel besaßen, die auf dem Dachboden verstaubten, aber kein warmes Wasser in der Küche.
Erst in diesem Augenblick war ihm vollständig bewusst geworden, dass die Penzingers jetzt entweder etwas noch nicht, oder etwas nicht mehr besaßen, denn alles Vermögen gehörte nun den Gläubigern. Manche Leute haben einen Boiler, andere wiederum haben keinen Boiler. Wir sind die einzigen im Ort, folgerte Felix, deren Warmwasserspeicher der Krankenkasse gehörte.
“Ja, wir haben keinen Boiler - einen Boiler hab‘ ich nicht…”, intonierte Felix, überwältigt vom Triumph seiner hoffnungslosen Verzweiflung, den Refrain in der Melodie der sozialistischen Internationale. Seltsam, dass er sich gerade jetzt an seinen ersten und zugleich letzten Besuch bei den Roten Falken erinnern musste, bei der er diese Melodie gehört hatte.
Er war bei der sozialistischen Jugend nicht aufgenommen worden, weil er der Sohn eines Unternehmers gewesen war. Würde man ihn jetzt aufnehmen, wo er der Sohn eines Bankrotteurs war? Jetzt würde man ihn erst recht nicht aufnehmen, folgerte Felix. Man würde ihn nirgendwo aufnehmen.
Eine plötzliche Anwandlung von Scham stoppte seinen Anfall. Er hatte sich von seiner Verzweiflung überwältigen lassen und dafür schämte er sich jetzt. Er schämte sich über sein Weinen und dann schluchzte über seine Beschämung, über die Schande, über die Zerstörung seiner Existenz. Jetzt, in der vollkommenen, intensiven Verzweiflung musste der liebe Gott herhalten. Ja, er musste ihm jetzt helfen. Hatte er ihm nicht ewige Unschuld geschworen, würde er seine Keuschheit nicht eintauschen können gegen ein bisschen Macht, ein bisschen Auserwähltsein, war er nicht der Oberministrant, war es nicht Felix, der die Lesung lesen durfte? Konnte er nicht immer noch Pfarrer oder wenigstens ein Mönch werden, wenn es mit der Handelsakademie nicht klappen würde? Immer noch hatte er die Chance. Im Kloster würde man ihn brauchen, Mönche würden ihm Latein, Griechisch, Hebräisch lernen, er würde in Würde existieren. Ein Ehrenmann sein, in Würde leben können, geachtet werden, das wollte er.
Draußen im Ort war es bereits dunkel geworden, das Zimmer war nicht geheizt, Felix legte sich aufs Bett, er putzte sich nicht die Zähne, wusch sich nicht im blechernen Lavoir. Aber er zog seinen Pyjama an und dachte noch lange an die Mönche, an Barbara und an die bevorstehende Prüfung in Maschine Schreiben - an alles zunächst abwechselnd, dann durcheinander.
Auch im Schlaf kam er nicht davon los, es vermischte sich alles, so dass er schließlich davon träumte, dass ein Mönch das Evangelium von einer Schreibmaschine herunterlas, auf dem der Kuckuck des Gerichtsvollziehers klebte.
Allmählich, nach dem unablässigen Betrachten der Schreibmaschine bemerkte er, dass es seine Büroschreibmaschine war.
Ein Zettel mit dem Evangelium war eingespannt, der sah aus wie frisch getippt. Barbara stand neben dem Tabernakel, unter dem ewigen roten Licht. Sie trug ein kunstvoll besticktes Kleid und eine zierliche goldene Krone. Ihr dickes, dunkelbraunes Haar war in Zöpfen geflochten und hochgesteckt.
Sie lächelte wie die Jungfrau Maria auf dem uralten Altarbild in der Pfarrkirche, das Herz voller Liebe, die Augen sehnsüchtig nach oben, auf den Altar gerichtet.
Felix schwebte wie ein Kosmonaut, schwerelos und lässig über dem Altar, er breitete die Arme aus, ein Durchlauferhitzer mit bläulicher Flamme sprang an, hunderte blaue Gasflammen stiegen nach oben, Blut tröpfelte aus Felix´ Handflächen und von seinen Füßen auf das Papier, das in der Schreibmaschine auf dem Altar eingespannt war, aber die Blutstropfen verwandelten sich in Wörter, sobald sie auf das Papier gefallen waren.
„Willkommen, Abu Pecuniarius!“ stand auf dem Pergamentpapier.
Felix konnte sich nicht erklären, was dieser Text bedeuten sollte. Plötzlich hatte er eine verrückte Idee, die ihn im Traum nicht mehr losließ.
Ist es möglich? fragte sich Felix unablässig. War es wirklich möglich?
Hatte Felix ein neues Kapitel des Evangeliums geschrieben?
DAS BILD DES BUNDESPRÄSIDENTEN
Keiner im Klassenzimmer hatte eine Ahnung, wer es getan hatte. Fakt war, und das konnte jeder mit freiem Auge sehen, dass auf dem Wappen des österreichischen Bundesadlers ein Werbekleber für die Kondommarke Olla klebte.
Das seltsame Arrangement bekam eine skurrile Note durch die Tatsache, dass schräg gegenüber das huldvoll lächelnde Bildnis des Herrn Bundespräsidenten hing. Und es schien, als hätte Unser sehr geehrter Herr Bundespräsident jetzt endlich einen Grund gefunden für sein unerklärliches Grinsen, welches zuvor durch nichts motiviert erschien. Eigentlich war die Tragweite der ganzen Aktion niemanden bewusst geworden. Schüler denken in der Regel nicht politisch. Aber diese Sache hatte offenbar eine politische Dimension, zumindest für den Buchhaltungsprofessor Berger.
“Wer hat den Aufkleber auf das österreichische Bundeswappen geklebt!”
Noch nie zuvor war Berger so aufgebracht gewesen, jedenfalls konnte sich Felix an keine vergleichbare Situation erinnern. Was jetzt kam, war nicht mehr der bloße Tadel des Lehrers die Rede eines ehrgeizigen politischen Beamten, der Schuldirektor oder vielleicht sogar mehr werden wollte.
“Der österreichische Staat hat für euch diese Schule gebaut. Wir haben dieses Land aus dem Schutt des Krieges wieder errichtet, damit die nachfolgende Generation darauf aufbauen kann. Das Bundeswappen ist das Symbol unserer freiheitlichen Demokratie. Einer von euch hat das Staatswappen beschädigt. Wer von euch ist es gewesen?”
Nur mit Mühe konnte sich Berger beherrschen. Sie saßen auf ihren Sesseln vor ihren Holzbänken und hielten den Atem an. In solchen Sekunden ist man sich selbst der nächste. Niemand meldete sich. Die Luft im Zimmer war zum Schneiden. Vierundzwanzig pubertierende Buben und Mädchen, die Buben erst ziemlich am Anfang, die Mädchen beinahe schon am Ende ihrer Entwicklungsphase zum Erwachsenen. Schon wieder hatten sie in der Pause vergessen, das Fenster zu öffnen.
Es war nicht Felix, der den Aufkleber auf das Bundeswappen geklebt hatte. Aber er hätte es sein können. Mutig genug war er ja und seine anarchistischen Tendenzen kannte jeder in der Klasse. Mit seinem gepunkteten Acrylpullover im Leopardenmuster war er sowieso jedes Mal das Zentrum der Aufmerksamkeit. Zudem kam noch, dass er seit seinem Bankrott irgendwie von den anderen abgerückt war. Aber den Aufkleber hatte er nicht aufs Bundeswappen geklebt.
Berger hat mich im Verdacht, natürlich glaubt er, dass ich es war, dachte Felix.
“Falls sich derjenige, der es getan hat …”, insistierte Dr. Berger, noch um eine Spur gereizter, aber bereits am Höhepunkt seines Zorns, – denn Berger begann sich in diesem Augenblick zu fragen, ob er sich noch unter Kontrolle hatte – und ein zukünftiger Schuldirektor, davon war Berger überzeugt, musste sich immer und in jeder Situation unter Kontrolle haben,
“...sich nicht meldet, werde ich ein paar spezielle Fälle prüfen.”
Die Stille war quälend. Die nervöse Transpiration der Schüler intensivierte den schlechten Geruch, der in der Luft stand.
“Felix Penzinger!”, sagte Berger schließlich und öffnete das Klassenbuch.
“Erkläre mir mal den Unterschied zwischen einem Konkurs und einem gerichtlichen Ausgleich. Ist ja nicht so schwer, die Frage, für den Praktiker, nicht wahr?”
Felix war – und das wunderte ihn selbst – gar nicht überrascht. Er war, und das wusste er mit erstaunlicher Sicherheit, am absoluten Tiefpunkt seiner menschlichen Würde angekommen. Berger hatte ihn, bewusst oder unbewusst, an seinem empfindlichsten Punkt getroffen. Was niemand wusste, in diesem Raum mit den fest montierten Klappsesseln, in diesem überheizten Zimmer mit der stickigen Luft:
Der Schüler und Oberministrant Felix Penzinger hatte seine Würde in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt, ja seine ethische Integrität war der unverrückbare Fixpunkt, war die Basis von Felix´ individueller Lebensphilosophie.
Warum das so war, wusste er selbst nicht. Es war einfach immer schon so gewesen, es musste schon da gewesen sein. Keinesfalls bildete seine Erziehung die Ursache für diesen selbst auferlegten moralischen Imperativ, ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht hatte er zu viele dieser illustrierten Rittergeschichten über Prinz Eisenherz gelesen?
War Prinz Eisenherz, der edle Ritter, erhältlich in kleinformatigen, kolorierten Heftchen in jeder Trafik um drei Schilling, für die moralische Ausrichtung des Felix Penzinger verantwortlich?
Jedenfalls war der Konkurs nicht mehr der Konkurs seines Vaters, er war in Felix´ persönliche Verantwortung übergegangen. Felix hatte den Konkurs seines Vaters quasi adoptiert.
Als Dr. Berger Schritt für Schritt näher kam, eröffnete sich ihm eine Allegorie, die ihm in diesem Augenblick skurril und absurd vorkam:
Der Konkurs hatte sich eigenmächtig als Felix´ Privatvermögen auf der Aktivseite seiner persönlichen Handelsbilanz gestellt, sich selbst in seinem ganzen Umfang buchmäßig erfasst und schwerstens bewertet. Und das geschah, ohne dass er es so wollte.
Es war ihm plötzlich klar geworden: er war die Karikatur eines Handelsschülers, er war die materialisierte Antithese zum wirtschaftlich handelnden Menschen, zum homo oeconomicus, geworden.
Über Nacht hatte er den Alptraum des Kaufmannes erreicht, in noch nie dagewesener Rekordzeit. Andere würden Jahre brauchen, um Bankrott zu gehen. Felix hatte es von einem Tag auf den nächsten, ganz ohne eigenes Zutun, gänzlich ohne Anstrengung geschafft. Schon in der ersten Klasse Handelsakademie hatte er seine Unfähigkeit überzeugend demonstriert.
Wozu geht man denn in die Handelsakademie, fährt täglich beinahe zwei Stunden mit der Eisenbahn vom Hundert-Seelen-Kaff Ellend in die Kleinstadt Altenstätt?
War er täglich bloß deshalb um sechs Uhr früh aus dem Bett gekrochen, hatte sich hastig mit kaltem Wasser im Lavoir die Hände gewaschen, war er bloß deshalb im Morgengrauen, in aller Herrgotts Früh zum Bahnhof von Ellend gegangen, mechanisch, die Schultasche auf dem Rücken, den Kopf voller ungemachter Hausaufgaben? Bloß um seinen Konkurs anzusagen? Vor all seinen Mitschülern?
Uninteressant und lächerlich gemacht, nicht mehr ernst genommen mit seinem viel zu engen, durch zu heißes Waschen eingegangenen Pullover mit dem Leopardenmuster?
Mit seinen viel zu langen, ungewaschenen strohblonden Haaren, mit der speckigen Schnittlauch-Frisur, seinen dunklen Augen, den zu großen Drachensteiger-Füßen, mit seinen Abortdeckel-Händen, viel zu groß und breit, seinem untergewichtigen, wenig gepflegten, leptosomen Körper und der zwitschernden Sopranstimme?
Erst durch das leise klackende Geräusch des hochschwingenden Klappsessels war ihm aufgefallen, dass er sich erhoben hatte, so wie es sich für einen Schüler gehörte, im Jahre 1969. Wenn man sich schon nicht die Haare schneidet, so kann man sich ja wohl wenigstens aus seinem Sitz erheben, wenn man etwas gefragt wird.
Sollte Felix dem Lehrer oder der an ihn gestellten Frage die Referenz erweisen, oder beiden in ihrer Kombination, dem synergetischen Effekt der Qual, die Felix nun durchstehen musste?
Natürlich wusste er die Antwort auf die gemeine Frage des Buchhaltungsprofessors. Ja, es stimmte, dass der Konkurs keinen Neuanfang erlaubte. Ein Konkurs war etwas Endgültiges, er drang in die Privatsphäre. Der Konkurs nimmt Besitz von allem, was ein Mensch hat und ist. Der Konkurs stürzt den ersten Mann im Dorf und setzt ihn an die letzte Position.
Felix hatte in einem Soziologiebuch gelesen, dass man diese Position als Nullposition bezeichnete. Man war in seinem sozialen Umfeld nichts mehr wert, man hatte seine Identität, den Bezugsrahmen zur Umgebung verloren.
Beruf des Vaters: Mühlenbesitzer? – nein. Mühlenarbeiter? – nein. Konkursit? – ja! Konkursit - das war der richtige Ausdruck.
Ein Konkursit ist der Detaillist des Konkurses. Ein bäuerlicher Kleinunternehmer, der bankrott gemacht hat. Ein Konkursit eben. Eine Null. Bitte sehr, er war kein Bankrotteur. Das wäre zu viel der Ehre gewesen.
Ein Bankrotteur, Herr Professor Doktor Berger, ein Bankrotteur würde den Konkurs elegant, umsichtig und raffiniert geplant und implementiert haben. Oder es wäre ihm zufolge eines Casinobesuches passiert, als lässliche Malaise, als mode de vivre, oder so. Ein Bankrotteur würde in Ausgleich gehen, die Schuldner würden ihm gestatten, seinen Betrieb weiterzuführen, man kann doch einen Gentleman nicht im Stich lassen?
Aber Hubert Penzinger, dem Emporkömmling, diesem Parvenü, würde niemand helfen. Fast jeder freute sich über sein Unglück, man mochte ihn nicht leiden. Die richtige Ordnung der Dinge war wiederhergestellt.
Felix stand aufrecht vor der Schulbank, blickte auf den ewig lächelnden Herrn Bundespräsidenten und brachte kein Wort heraus. Aber jedermann im Klassenzimmer konnte ihm beim intensiven Nachdenken zusehen. Zwei, drei, vier Sekunden vergingen und Felix sagte nichts und Dr. Berger sagte auch nichts mehr.
Eine allmählich definitiv werdende Gewissheit legte sich ins Klassenzimmer, zwischen die schlechte, mehrfach ein- und ausgeatmete Luft der vierundzwanzig Schulkinder – oder waren es schon Erwachsene – niemand vermochte es mit Sicherheit zu sagen – die Gewissheit, dass Berger zu weit gegangen war. Auch Berger selbst begann es allmählich zu bemerken.
Felix sagte so intensiv nichts, dass es beklemmend still wurde und nachdem im gesamten Zimmer keiner mehr eine Bewegung oder wenigstens ein Geräusch machte, wurde die Stimmung unerträglich.
Wenn zwei Dutzend Menschen auf 80 Quadratmetern alle dasselbe tun, nämlich nichts als bloß zu atmen, zu denken, zu fühlen, ihre Jausenbrote und die in den Mägen halbvergorene Schulmilch zu verdauen, und wenn diese perfekte Gleichförmigkeit auch nur für den verhältnismäßig kurzen Zeitraum von Sekunden abläuft, dann entsteht eine wahrhaftige Stimmung.
Wahrscheinlich war es diese spürbare Wahrhaftigkeit, die das plötzliche Geständnis des wirklichen Staatswappenschänders auslöste:
Der Schüler Walter Leitenbauer hob seinen Arm, stand auf und erklärte mitten in die schneidende Stimmung und in die schlechte Luft hinein:
“Ich bin´s gewesen, Herr Professor. Ich habe das Kondompickerl auf das Staatswappen gepickt. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte, es tut mir leid.”
Mit einem Satz hatten sie jetzt alle die Rollen getauscht, denn Berger – er konnte es nicht verhindern, dass es passierte – hatte sich mit seinem falschen Verdacht vor der ganzen Klasse blamiert und folglich, wie im Zwang, flüsterte Berger aus einem plötzlichen, inneren Impuls heraus:
“Schande!”
Obwohl er das Wort nur leise ausgeatmet hatte, wussten alle im Klassenzimmer, dass er sich selbst damit gemeint war. Und daher ahnten sie alle, dass Doktor Berger verloren hatte, sein Angriff gegen Felix war ins Leere gegangen und die ganze Klasse hatte es mitbekommen.
Und so hatte Felix im Augenblick einer bitteren Lebenserfahrung einen triumphalen Sieg errungen. Auf irgendeine Weise war dies allen bewusst, nur Felix selbst wusste es noch nicht.
ELLEND
“Du bist ja wachsbleich, Bub!”
Frau Meisinger war wie üblich jeden Freitag in die Altenstätt hinausgefahren, wie die ländliche, vorwiegend bäuerliche Bevölkerung im weiteren Umkreis von Altenstätt ihre Bahnreisen in die Kleinstadt bezeichnete.
Anna Meisinger hatte sich in der Stadt ein neues Bügeleisen gekauft. Eines jener sündteuren, neumodischen Geräte, mit denen man die Wäsche mit Dampf behandeln konnte. Ihre Schwiegermutter würde natürlich wieder keppeln. Anna Meisinger aber war keine Frau, die sich auf eine Streiterei mit ihrer über achtzigjährigen, bettlägerigen Schwiegermutter einließ.
Der Gescheitere gibt nach hatte sie zeit ihres Lebens, unablässig, zu jeder passenden wie unpassenden Gelegenheit gehört. Und kaum eine Bäuerin nahm diesen Leitspruch ernster als Anna Meisinger, und von den vielen angeblichen Lebensweisheiten, welche einem Menschen vom Land nun einmal unaufgefordert eingetrichtert werden, war ihr diese die liebste geworden.
Die Standardausrede der bequemen Verlierer war ihr Leitspruch geworden. Anna wollte ihre Ruhe haben, sie wollte keinen Streit, und im Laufe der Jahre war sie etwas dicklich geworden, und so fesch wie vor zwanzig Jahren beim Kirtag mit Dominik war sie auch nicht geblieben. Das viele Arbeiten und das viele Ruh-Haben-Wollen hatte sich halt auch äußerlich ein wenig niedergeschlagen.
Aber der junge Bursch neben ihr im Abteil sah wirklich so schlecht aus, dass er sie neugierig machte.
“Ist dir nicht gut? Du schaust krank aus. Du wirst mir doch nicht erbrechen, hier im Abteil, gell? Vielleicht sollte man ein Fenster öffnen.”
Anna Meisinger zog kräftig an dem dicken Lederriemen, den man zum Öffnen des Waggonfensters benutzte. Oft musste sie sich darüber ärgern, dass man einige Waggonfenster überhaupt nicht mehr öffnen konnte, weil die Herren Studenten die speckig glänzenden Lederriemen mit ihren Taschenmessern zerschnitten und die Holzgriffe an ihren Enden herausgenommen hatten.
In Wirklichkeit waren die meisten von diesen sogenannten Studenten bloß freche Halbstarke. Die wenigsten standen von ihrem Sitz auf und ließen die älteren Bauersfrauen Platz nehmen, wenn sie mit ihren Rucksäcken und den Kunstledertaschen vom Jahrmarkt wieder in ihr Tal hineinfuhren. Trotzdem tat ihr dieser blasse Bub mit dem gespitzten Gesicht leid.
Felix hörte das Rucken des Waggonfensters und spürte die frische, kalte Luft, ein wenig durchsetzt mit der typischen Eisenbahnluft, die entsteht, wenn Braunkohle durch den Schornstein der Eisenbahn in die kalte Winterluft verbrannt wird und der Zug in eine Biegung des Friessnitztals einfährt.
“Zu wem gehörst du denn?” fragte Anna dreist. Im Bewusstsein ihrer situationsbedingten Überlegenheit befragte sie ihn in der Art der Landwirte des neunzehnten Jahrhunderts, die Kinder als ihren Besitz betrachteten, eine Reminiszenz auf die jahrhundertelange Leibeigenschaft, welche sich von Generation zu Generation, allerdings in jeweils leicht abschwächender Form, fortsetzte. Über all die Jahrhunderte hatten die Bauern das ihnen von außen aufgezwungene System der Leibeigenschaft auch auf ihre Familie übertragen und solcherart verinnerlicht, und über Jahrhunderte hindurch unsterblich gemacht. Aber der verärgerte Gesichtsausdruck des Burschen erschreckte sie, und sie korrigierte sich sogleich, denn dieser Bursch war ja eigentlich schon kein Kind mehr, und daher war die Fragestellung in dieser Form unangebracht.
“Also, wo sind S’ denn Zuhause. Wo müssen S’ denn aussteigen, junger Herr?” verbesserte sie sich.
“Ich fahre nach Ellend” flüsterte Felix. Wieder dieses Gefühl, nichts wert zu sein, nirgendwo zugehörig zu sein, kein Arbeiterbub zu sein, kein Juniorchef eines Unternehmers, kein Handwerkersohn, kein anständiger Mensch zu sein, keinen Wert zu haben, keine Würde, nicht mal eine Schreibmaschine, nicht einmal das Öffnen des Eisenbahnfensters wert zu sein, ein Konkursit und Versager sein zu müssen. Und in dem Moment schon wusste Felix, dass er sehr dumm gewesen war und einen Fehler gemacht hatte.
“In Ellend wohnen Sie? Da kenn ich mich gut aus.” Anna war neugierig geworden auf den hageren Burschen, dessen zarte Gesichtszüge mit seinem ernsthaften, dunklen Blick in einem eigentümlichen Gegensatz standen. Ein hübsches Milchgesicht mit dem Blick eines Vierzigjährigen, dachte sie.
Aber jetzt sagte Felix nichts mehr, er betrachtete sein Gegenüber wie ein Botaniker ein Blatt mit Läusen. Von da an sagte die arme Anna Meisinger nichts mehr, und sie saßen sich eine halbe Stunde gegenüber, ohne ein Wort zu sagen.
“Auf Wiedersehen.” Felix griff hastig nach seiner Schultasche und stand abrupt auf.
Er konnte sich noch vage an das erstaunte Gesicht der Frau Meisinger erinnern, aber nicht mehr ans Aussteigen. Bei der kleinen Zughaltestelle verlor er die Orientierung, obwohl er hundertmal den Weg nach Hause gegangen war. Es waren die gleichen Bäume, das gleiche Wartehäuschen mit den obszönen Sprüchen voller Rechtschreibfehler, das gleiche Bahngleis, der gleiche Weg, aber der Winkel hatte sich geändert. Ja, das Bild war gesprungen, die Winkel hatten sich von außen nach innen gebogen und die Gegenstände standen vollkommen ohne Bezug da.
Etwas fehlte. Es musste etwas Wichtiges sein, denn Felix fühlte sich selbst wie ein Gegenstand, ohne Zugriff, ohne Einfluss auf seine Umwelt. Vor wenigen Augenblicken noch war jedes Ding durch ihn mit seiner individuellen Bedeutung gefüllt worden und dadurch mit Felix´ höchstpersönlichen Hoffnungen, Absichten und Zwecken besetzt gewesen.
Jetzt hatte er die Kontrolle über seine dingliche Umgebung verloren. Es war nicht mehr Felix selbst, der die Bedeutung seiner Wahrnehmungen festlegte, die Machtverhältnisse hatten sich umgekehrt. Das Umfeld definierte und beherrschte ihn. Die Wirklichkeit hatte ihre Eignung als Gestaltungsmittel seines Bewusstseins verloren. Er konnte seine Umwelt nicht mehr ausreichend mit gedanklichen Inhalten füllen. Das kleine Wartehäuschen war nicht mehr – so wie früher – ein Symbol der Hoffnung. Es war nicht mehr geeignet, Felix daran zu erinnern, dass er vielleicht schon in ein paar Jahren von Zuhause wegziehen und sein eigenes Leben gestalten könnte.
Das Aktive, Gestaltende hatte sich von Felix entfernt und – was alles noch schlimmer machte – die Energie war von ihm weg und auf seine Umgebung übergegangen. Jeder Mensch, jeder Gegenstand war in der Perspektive von Felix´ Bewusstsein um die Gestaltungsdimension reduziert worden. Felix stand neben dem Bahngleis und drehte sich im Kreis. Es war ihm, als wäre er neuerlich, als ein zweites Wesen neben ihm selbst in seinem Kopf entstanden. Dieses Wesen konnte kein Mensch sein, denn es fehlte ihm die Fähigkeit zum vorausschauenden Denken, es übte über die Umgebung keine psychische Macht aus, beherrschte sie nicht, im Gegenteil, er wurde von ihr beherrscht, und weil Felix sich diesem Zustand nicht entziehen konnte und sich bei vollem Verstand seines reduzierten Bewusstseinszustandes bewusst war, quälte ihn eine dumpfe Angst.