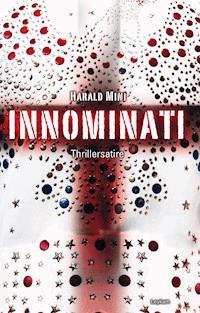Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rupert Plankton – der Welt berühmtester und einziger Speisologe (= Spezialist für alles, was mit Speis und Trank zusammenhängt) – weilt in Linz. Er will den zahlreichen Geheimnissen, die sich um die Linzer Torte ranken, auf die Spur kommen und sein Freund und Mentor aus alten Zeiten, Gisbert Landauer, soll ihm dabei helfen, denn seine Tochter Lisbeth arbeitet in einer Tortenproduktionsfi rma. Doch da wird Gisbert Landauer entführt und die Entführer fordern von Plankton einen Gegenstand – er wisse schon, welchen. Nun, Plankton hat zwar keine Ahnung, ist aber wild entschlossen, seinen Freund zu retten, und ein „Da-Linzi-Code“ (was auch immer das sein soll) soll ihm dabei helfen. Gemeinsam mit Lisbeth macht er sich auf eine atemberaubende und aberwitzige Schnitzeljagd quer durch Linz und dabei ist ihm nicht gerade hilfreich, dass er offenbar von einem ganz in Schwarz gekleideten, glatzköpfi gen Hünen verfolgt wird und sich auch eine kirchliche Geheimorganisation (so geheim, dass sie selbst im Vatikan weitgehend unbekannt ist) einmischt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelseite
Harald Mini
Der Da-Linzi-Code
Thrillersatire
Leykam
PROLOG
Am 22. Juni 1978 im Restaurant Wienerwald am Freinberg in Linz
Es war schon lange nach Mitternacht, als die beiden Männer in die schummrig beleuchtete Küche des Restaurants zurückkehrten. Sie hatten sich zuvor vergewissert, dass sie allein waren, und ihre Kellnerkleidung anbehalten. In der Ecke lief leise das Fernsehgerät – offenbar hatte der Letzte der Küchenbediensteten, als er seine Arbeitsstätte verlassen hatte, seine Pflichten verletzt und vergessen, den Fernsehapparat und auch das Licht auszuschalten.
Der ältere der zwei Kellner, der ein Brandeisen in der Hand hielt, wandte sich nun an den jüngeren: „Bist du bereit?“
Der Jüngere nickte nur, sodass der Ältere nachsetzte: „Du musst es sagen! Bist du bereit, Auserwählter, die Weihen zu empfangen und in die Korporation einzutreten? Bist du bereit, alle jahrhundertelang überlieferten Geheimnisse zu bewahren und sie zu gegebener Zeit dem von dir selbst erwählten Nachfolger anzuvertrauen, so wie ich sie dir anvertraut habe?“
Der Jüngere sagte feierlich „Ja, Meister, ich bin bereit“, worauf nun der Ältere nickte und ihm ein Zeichen gab, niederzuknien.
„Du weißt, dass alle Mitglieder der Korporation ein Zeichen tragen“, sagte er sanft und salbungsvoll. „Ich muss dir nun das Zeichen einbrennen, auf dass dein Körper für alle Zeiten ein sichtbares Zeichen für deine Mitgliedschaft in der Korporation trägt.“ Er hielt das glühende Eisen ein wenig in die Höhe und der Jüngere erschauderte beim Gedanken an die Schmerzen, die er nun bald empfinden würde. „Du kannst dir die Stelle deines Körpers aussuchen. Die alten Überlieferungen sehen keinen bestimmten Platz für die Anbringung des Zeichens vor.“
„Ich habe mich dafür entschieden, das Zeichen an meiner rechten Pobacke zu empfangen“, sagte der Auserwählte mit leiser Stimme und zog auch schon die Hose hinunter.
Der Ältere nickte wohlwollend. Das Gesäß war eine gute Wahl. Dort war das Zeichen sichtbar am Körper angebracht, wie es das Gesetz forderte, aber doch so gut versteckt, dass die meisten Unwürdigen es nie zu sehen bekommen würden. Auch er selbst hatte sich das Zeichen von seinem Vorgänger auf die rechte Pobacke einbrennen lassen.
„Dann ist es nun soweit“, sagte der Ältere und trat hinter seinen Schützling.
Und während im Fernsehen zum wiederholten Mal das Tor gezeigt wurde, das am Tag davor einen gewissen Hans Krankl in Cordoba unsterblich gemacht hatte (und mit ihm im Schlepptau einen gewissen Edi Finger), fragte der Auserwählte sich, ob die Unsterblichkeit, die er aufgrund der Aufnahme in die Korporation möglicherweise erlangen würde, ein gerechter Ausgleich für den brennenden Schmerz war …
ERSTES (UND EINZIGES) BUCH Fast 35 Jahre später im Mai in Linz Erster Tag (Freitag)
1. Kapitel – 08:42
Als Rupert Plankton den Frühstückssaal des 3,9-Sterne-Hotels in der Innenstadt von Linz betrat, beachtete ihn niemand.
Das ging Plankton meist so. Er war dermaßen durchschnittlich und unauffällig, dass er sich schon eine bunte Feder ins Haar stecken oder – noch besser – splitternackt durch die Gegend laufen hätte müssen, um wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Nicht nur, dass er durchschnittlich alt war (46½, um genau zu sein), war er auch durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer und von derart durchschnittlichem Aussehen, dass die meisten Leute, sofern sie überhaupt Notiz von ihm nahmen, ihn auch schon wieder vergessen hatten, sobald er ihrem Blickfeld entschwunden war.
Plankton nahm an einem Tisch für zwei Personen Platz und winkte eine Servierkraft herbei.
„Äh, Fräulein“, sagte er und offenbarte dabei, dass er auch eine höchst durchschnittliche Stimme hatte (sie erinnerte ein wenig an den deutschen Synchronsprecher von Tom Hanks), „ich hätte gern zwei weichgekochte Eier, eines mit dreieinhalb Minuten und eines mit vier Minuten, das Dreieinhalbminutenei in einem weißen Eierbecher, das Vierminutenei in einem mit einer anderen Farbe, die Sie sich selbst aussuchen dürfen – zum Auseinanderhalten, wenn Sie verstehen – und dann …“
„Entschuldigen Sie“, unterbrach ihn die Kellnerin mit einem fremdländisch klingenden Akzent, „aber wir haben Frühstücksbuffet.“ Sie wies ans andere Ende des Raumes, wo sich Speisenberge auftürmten, vor denen Menschenmassen geduldig Schlange standen. „Dort finden Sie Spiegeleier, Ham and Eggs, Eierpampe und natürlich auch weich-, mittelweich- und hartgekochte Eier. – Kaffee?“
„Kaffee?“, wiederholte Plankton überrascht. „Ach ja, Kaffee. Natürlich. Nur her damit. Wussten Sie eigentlich, dass das Ursprungsgebiet des Kaffees die Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens ist? Dort wurde er bereits im 9. Jahrhundert erwähnt. Von Äthiopien gelangte der Kaffee vermutlich im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler nach Arabien und im 15. Jahrhundert eroberte er dann Persien und das Osmanische Reich. Um 1511 entstanden in Mokka äh Mekka die ersten Kaffeehäuser. Nach Europapa gelalalalala äh ge-langlang-langte der Kaf-kaf …“
Er brach ab, von einem schweren Anfall von Dozenteritis geplagt. Plankton litt schon seit längerer Zeit an dieser eher unbekannten und, wie es schien, unheilbaren Krankheit. Sie befiel nur Menschen, die einerseits etwas Wichtiges und Lehrreiches zu sagen hatten, andererseits – meist aufgrund bitterer Erfahrungen – befürchteten, die Zuhörerschaft durch zu viele Fakten zu langweilen oder gar in Tiefschlaf zu versetzen. Sobald sie begonnen hatten, über ein bestimmtes Thema lehrerhaft zu sprechen – zu dozieren, um es wissenschaftlich korrekt auszudrücken –, verfielen sie nach einigen Sätzen in ein Stottern, vertauschten und verschluckten Silben, erfanden Worte und dergleichen. So viel zum Krankheitsbild der sogenannten „Dozenteritis“, an der Plankton schwer erkrankt war.
Im vorliegenden Fall erwies sich das jedoch nicht als allzu schlimm, denn die Serviererin hatte schon nach der ersten Erwähnung des Landes Äthiopien rasch Kaffee aus ihrer Kanne in die Tasse des Hotelgasts gegossen und war fluchtartig an den nächsten Tisch weitergeeilt.
Plankton nahm einen Block und einen Bleistift aus seiner Jacketttasche und machte sich missbilligend eine Notiz.
Rupert Plankton war von Beruf Speisologe.
Zum einen war er Gastrokritiker und lebte davon, in der Welt herumzureisen, in teuren Lokalen zu speisen und noch teureren Hotels zu nächtigen und dann über seine Eindrücke zu schreiben und diese in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern zu veröffentlichen – was abgesehen davon, dass er sich am Abend meist satt in ein sauberes Bett legen konnte, auch den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass er die nicht unerheblichen Kosten des feinen Lebens von der Einkommensteuer absetzen durfte.
Und zum anderen war er noch der weltweit anerkannte Sachverständige für alle Fragen, die in Zusammenhang mit Speis und Trank standen, weshalb er als einziger Mensch im Universum den Berufstitel „Speisologe“ tragen durfte.
Zurzeit arbeitete Plankton an einem Buch, das den Titel „Mehlspeisen mit Geschichte – Geschichten über Mehlspeisen“ erhalten sollte. Oder so ähnlich. Zuletzt hatte er mehrere Monate in Italien verbracht, um die zahlreichen Rätsel des dort unerklärlicherweise so beliebten „Panettone“ endgültig zu lösen, und das war ihm auch so gründlich gelungen, dass seine Erkenntnisse, sobald veröffentlicht, einen Aufschrei in der internationalen Gastronomie hervorrufen würden, und er hatte dabei dermaßen viele Panettoni verspeist, dass ihm schon beim bloßen Gedanken an einen dieser seltsamen Kuchen die Lust aufs Frühstück verging und er Mühe hatte, das Abendessen nicht hochkommen zu lassen. Da blieb als letzter Ausweg nur die Flucht, und so hatte er sich in den nächstbesten Flieger gesetzt, diretissima Milano–Linz/Hörsching. Linz war nämlich die nächste Etappe von Planktons Reise durch Orte mit geschichtsträchtigen Mehlspeisen. Hier gedachte er, der weltberühmten Linzer Torte ein Kapitel seines Buches zu widmen.
Gleich am Nachmittag würde er seine Recherchen beginnen. Der Vormittag war noch dem Zusammentreffen mit seinem alten Freund und Mentor gewidmet. Irgendwie hatte Gisbert I. Landauer in Erfahrung gebracht, dass sich Plankton in Linz aufhielt und ihm, da er – Landauer – seine – Planktons – Handynummer kannte, eine SMS geschickt, ob er Lust hätte, sich mit ihm zu treffen, und Plankton hatte sofort zugesagt. Für Punkt zehn Uhr hatten sie ein Treffen am Taubenmarkt vereinbart, wo Landauer einen Gastronomiebetrieb besaß.
Gisbert I. Landauer war Rupert Planktons Lehrmeister gewesen, als dieser Anfang der 1980er-Jahre eine Kochlehre in einem Linzer Gasthaus begonnen hatte. Landauer, gut zwanzig Jahre älter als Plankton und in dem Gasthaus als Koch und Kellner beschäftigt, war es gewesen, der Plankton in die Geheimnisse der bodenständigen oberösterreichischen Küche eingeweiht hatte, und bis heute vergaß Plankton es ihm nicht, dass er ihm beigebracht hatte, wie man Frankfurter Würstel erhitzte, ohne dass deren Haut aufplatzte. Für Planktons Kochkünste hatte sich dann Linz als zu klein erwiesen und er war in die weite Welt gezogen, um dort als Küchenmeister berühmt zu werden. Gallneukirchen, Gramastetten und Eidenberg rühmen sich heute noch, Rupert Plankton in einigen ihrer besten Häuser aufkochen gesehen zu haben. Dann allerdings hatte er Oberösterreich verlassen und war ins Ausland, in eine der gastronomischen Metropolen Deutschlands – nach Dingolfing – gegangen, und als er einmal rein zufällig einem Freund aushalf, der bei einer Zeitung arbeitete und einen Bericht über ein neu eröffnetes China-Restaurant schreiben sollte (Din-gol-fing klang ja auch irgendwie Chinesisch und war daher prädestiniert für China-Restaurants), aber an dem Abend verhindert war, da erwies sich dieses Freundes Ausfall für Rupert Plankton als unerwarteter Glücksfall. Plankton hatte sich auf Redaktionskosten den Magen vollgeschlagen und dann eine vernichtende, aber gastronomisch fundierte und stilistisch ausgefeilte Kritik geschrieben und damit den Grundstein für seine unaufhaltsame Karriere als Gastrokritiker gelegt. Nun galt er als der Star der Branche, was nicht nur Tausende von in renommierten Zeitschriften veröffentlichten Kritiken belegten, sondern auch ein paar Koch-Bestseller, die jeweils monatelang unter den Top 3 der meistverkauften Sachbücher rangiert hatten – zwar hinter dem aktuellen Abnehmkochbuch von Sasha Walleczek, aber noch vor dem jeweiligen Gartenbuch von Karl Ploberger. Oder auch umgekehrt. Seit etwa einem Jahr war Plankton überdies Gastprofessor an einer renommierten deutschen Universität (bezeichnenderweise in Essen), wo er drei Mal die Woche die gutbesuchte Vorlesung Von der Pasta zur Pizza und retour in einem Gemisch aus Deutsch und Italienisch hielt, sodass er sich nun auch noch „Professor“ nennen durfte – und dies auch tat, sooft sich ihm die Gelegenheit dazu bot.
Plötzlich griff sich Plankton an die Kehle. Was war das für ein abscheulicher Geschmack? Wollte man ihn vergiften? Er versuchte, den Schluck Kaffee, den er soeben getrunken hatte, wieder auszuspucken, aber zu spät! Ein bitterer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus, der ihn fast zu ersticken drohte. Er rang nach Luft.
„Ist Ihnen nicht gut?“, wandte sich ein Kellner an ihn. „Soll ich eine Ambulanz holen? Oder lieber einen Priester? Eventuell auch einen Notar?“ Er hatte erst vor Kurzem ein vom Hotel veranstaltetes Pflichtseminar über Verhaltensmaßregeln in Notsituationen absolviert und dieses mit ausgezeichnetem Erfolg und einer besonderen Belobigung vonseiten der Hoteldirektion bestanden.
„Zu spät“, ächzte Plankton, sich auf seinem Sessel windend. Schlagartig war ihm klar geworden, was hinter der Attacke steckte. In melancholischen Erinnerungen an seine Anfängerzeit versunken, hatte er seinen Kaffee zum Mund geführt, ohne ihn vorher gezuckert zu haben. (Den Kaffee, nicht den Mund.) Er gab in seinen Kaffee grundsätzlich mindestens zwei Löffel Zucker, und nun hatte er ihn ganz ohne getrunken. Grässlich.
Zucker ist schon ein seltsamer Stoff, sinnierte Plankton, während er sich langsam wieder erholte, verleiht dem Kaffee einen abscheulichen Geschmack, wenn man vergisst, ihn hineinzutun.
2. Kapitel – 10:04
Einige Sechstelstunden später stieg Plankton bei der Haltestelle Taubenmarkt aus. Um Punkt zehn Uhr sollte er Landauer bei dessen Gastronomiebetrieb – einem Würstelstand – treffen, doch obwohl es schon einige Minuten nach zehn war, war von seinem Freund und Mentor nichts zu sehen.
Planktons Verspätung resultierte übrigens daraus, dass er wertvolle Minuten verloren und einen Bus versäumt hatte, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er besser eine einfache Langstreckenkarte lösen sollte, mit der er die Strecke vom Hotel bis zum Taubenmarkt zurücklegen durfte, oder die natürlich deutlich teurere Tages- bzw. Vierundzwanzigstundenkarte, die ihm das Herumgondeln mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln von Linz bis dreiviertel zehn am nächsten Tag erlaubt hätte. So viel Auswahl hatten wir damals noch nicht, überlegte Plankton, an seine Linzer Zeit in den Achtzigerjahren zurückdenkend. Kompliziert war es geworden, das Leben in Linz.
Die Minuten verstrichen, ohne dass von Landauer etwas zu sehen war. Plankton begann, sich Sorgen zu machen, denn er hatte Landauer als überaus pünktlich in Erinnerung. Wenn der damals Nudeln gekocht hatte, die laut Verpackungsaufschrift vier Minuten zu kochen waren, damit sie so richtig „al dente“ waren, hatte er sie auch genau vier Minuten gekocht und nicht etwa dreieinhalb oder gar viereinviertel Minuten. Auch diese Pünktlichkeit und Genauigkeit hatte Plankton von Landauer gelernt und darum wunderte es ihn, dass … In diesem Moment umschlossen zwei Hände von hinten seine Augen, sodass er nichts sehen konnte. Zwei sehr nasse Hände übrigens. Plankton erschrak. Wer um Himmels willen … „Rupert“, rief da der Besitzer der Hände auch schon, dieselben wieder von Planktons Kopf lösend. „Wie freu’ ich mich, dich zu sehen!“
„Gisbert!“, rief Plankton zurück. „Na, und wie ich mich erst freue!“ Die beiden Männer umarmten einander.
„Wartest du schon lange?“, fragte Landauer. Er war ein großer, massiger Mann Mitte sechzig mit kurz geschnittenem Haar. „Ich musste rasch aufs Klo, leider hab’ ich eine schwache Blase, ich muss mindestens einmal pro Stunde, wenn du verstehst, und da bei meinem Würstelstand kein Klo ist, geh’ ich immer beim McDonalds auf die Toilette, und das hat ein bisschen gedauert, weil sie da meist Schlange stehen. Jedenfalls vor dem Klo.“
„Aha.“ Plankton, für den das Rätsel der feuchten Hände damit gelöst war (wobei er der Detailfrage, um welche Art von Feuchtigkeit es sich gehandelt hatte, lieber nicht näher auf den Grund gehen wollte), fragte: „Woher wusstest du denn, dass ich in Linz bin?“
„Ach, ein Freund von mir kellnert im Hörschinger Flughafenrestaurant. Und als er dich in der Flughafenhalle einchecken sah – du bist ja jetzt eine wirkliche Berühmtheit, Rupert –, da hat er mich angerufen, weil er weiß, dass du und ich … von früher …“ Er stockte, von Rührung übermannt. „Ach, Rupert. Professor Rupert, muss ich ja jetzt fast sagen!“ Er umarmte ihn neuerlich, wobei Plankton beruhigt feststellte, dass Landauers Hände mittlerweile getrocknet waren.
„Das ist also dein Würstelstand“, sagte Plankton beeindruckt. „Weit hast du es gebracht. Von einem einfachen Koch und Kellner zu einem echten Unternehmer.“
„Ja“, sagte Landauer stolz. „Ich werde dir dann nachher alles zeigen, dich herumführen. Aber was hältst du davon, wenn wir erst einmal einen Kaffee trinken gehen. Ganz in der Nähe ist ein Kaffeehaus, dort haben sie auch ein WC für den Fall, dass – du weißt schon, was ich meine …“
Und so begaben sich Gisbert Landauer und Rupert Plankton in das nicht weit vom Taubenmarkt entfernte Café Traxlmayr.
Das Traxlmayr war ein Kaffeehaus mit Tradition.
Hier hatte im Frühjahr 2010 die Gründung der Gruppe Krimi7(krimihochsieben) stattgefunden – jener mittlerweile in Linz und Umgebung weltberühmten Truppe von sieben in Linz ansässigen Autoren von Kriminalromanen, die seit 2010 alljährlich die „Linzer Kriminacht“ veranstalteten* und die man, wenn man Glück hatte, an manchen Samstagvormittagen im Café sitzen sehen konnte, wie sie gemeinsam neue Mord- und noch viel schlimmere andere Pläne austüftelten.
* Für Interessierte: http://linz-krimi.net
Landauer und Plankton verschwendeten allerdings an die Geschichte des Kaffeehauses keinen Gedanken, als sie im Inneren Platz nahmen und je einen Cappuccino bestellten.
„Was führt dich nach Linz?“, fragte Landauer.
„Ich arbeite an einem neuen Buch“, sagte Plankton. „Ich ergründe die Geheimnisse berühmter Mehlspeisen. Soeben war ich in Mailand und habe die Geschichte erforscht, die hinter dem Panettone steckt, und nun ist die Linzer Torte dran. Angeblich – ich sage, angeblich, denn meine Forschungen beweisen das Gegenteil! – also angeblich geht der Panettone ja auf einen Mailänder Bäckerlehrling namens Antonio zurück. Der soll verliebt gewesen sein und sich ein Gebäck für seine Angebetete ausgedacht haben – den pane di Antonio, auf Deutsch Tonis Brot. Bald schon wollte jeder in Mailand dieses pane di Antonio. Aus dieser Bezeichnung wurde späpäpä äh später dadadann Tonnepane äh Pannetonne immer ohne kanone …“
„Alles klar, hab’ schon verstanden“, kürzte Landauer Planktons Panettone-Monolog rasch ab, da er mit Planktons Krankheit vertraut war und ihn die Enthüllungen über diese rätselhafte italienische Möchtegernmehlspeise ohnehin nicht sonderlich interessierten. „Und welches Geheimnis steckt hinter der Linzer Torte?“
Plankton räusperte sich, um frischen Anlauf für den nächsten Monolog zu nehmen. „Nun, die Zutaten und die Zubereitung der Linzer Torte sind ja allgemein bekannt. Man nehme ¼ Kilo Mehl, ¼ Kilo Zucker, 250 Gramm gemahlene …“
„Ja, ja, gut“, unterbrach ihn Landauer eilig, einen neuerlichen Anfall von Dozenteritis befürchtend. „Aber welchem Geheimnis willst du auf die Spur kommen?“
„Nun, neueste Forschungen behaupten ja, dass die Torte mit Linz überhaupt nichts zu tun hat, sondern von einem Wiener erfunden wurde, der Linzer hieß. Brauchst nur im neuen Kleinen Lexikon der unglaublichen Lügen und Irrtümer nachlesen. Diese Herkunftsfrage will ich klären und vor allem, was den Original Linzer Torten – und damit meine ich die, die hier in Linz produziert werden – ihren unverwechselbaren Geschmack verleiht. Weißt du, Gisbert, ich bin weit in der Welt herumgekommen und habe an vielen schönen Stellen der Erde die seltsamsten Dinge verspeist – ich habe sogar einen dreiwöchigen Englandaufenthalt überlebt! – und dabei habe ich auch an manchen Orten eine Linzer Torte serviert bekommen, aber diesen einzigartigen, unverwechselbaren, nicht nachzumachenden Geschmack hat nur die Original Linzer Torte. Und ich will herausbekommen, welche Zutat dafür verantwortlich ist. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.“ Er hieb mit der Faust energisch auf den Tisch, sodass ihn die in der Nähe herumflanierende Kellnerin missbilligend anschaute.
„Du liebst Herausforderungen“, stellte Landauer, im Schaum seines Cappuccinos rührend, fest.
„Ja. Weißt du, ich hab’ das Geheimrezept von Coca-Cola herausgefunden und sie haben mir fünf Millionen Dollar bezahlt, damit ich es nicht in meinem übernächsten Buch enthülle, aber das war gar nichts gegen die Herausforderung, der ich mich nun stelle, um hinter das Geheimnis der echten Linzer Torte zu kommen.“
„Vielleicht kann ich dir dabei helfen.“
„Was? Wie?“ Vor Überraschung vergaß Plankton, Zucker in seinen Cappuccino zu geben, bevor er die Tasse zum Mund führte.
„Vielleicht kann ich dir helfen“, wiederholte Landauer. „Meine Tochter – Lisbeth – arbeitet in der größten Produktionsstätte von Linzer Torten, die wir hier in Linz haben.“
„Lisbeth ist bei den Linzer Torten!“, rief Plankton verblüfft aus.
Er wusste zwar, dass Gisbert I. Landauer eine Tochter hatte, war aber nicht auf dem Laufenden, was aus ihr geworden war. Er wusste auch, dass Gisbert der Erste immer auf einen Stammhalter (Gisbert II.) gehofft hatte, aber daraus war nichts geworden, Lisbeth war das einzige Kind von Gisbert Landauer und seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau geblieben.
„Ja“, sagte Landauer. „Lisbeth ist dort Stellvertreterin der Gitterverantwortlichen.“
„Der Gitterverantwortlichen?“ Plankton runzelte verständnislos dreinblickend die Stirn.
„Ja. Jetzt sag bloß, dir sagt diese Berufsbezeichnung nichts!“ Und als Plankton noch immer verblüfft den Kopf schüttelte: „Du kennst doch das typische Gitter der Linzer Torten. Für dieses Gitter braucht es einiges Fingerspitzengefühl – und das hat meine Lisbeth. Sie hat sich in den letzten Jahren zur Stellvertreterin der Gitterverantwortlichen hinaufgearbeitet, und wer weiß, falls diese einmal befördert wird oder in Pension geht oder von einem Auto erschlagen wird, vielleicht kann sie dann deren Stelle übernehmen.“ Träumerisch und von Stolz erfüllt, sah er in die Ferne.
„Und sie kann mich bei der Suche nach dem Geheimnis der Linzer Torte unterstützen?“, fragte Plankton aufgeregt. „Das wäre toll. Wann kann ich sie besuchen, sie sehen, sie sprechen, mit ihr reden, sie fragen, sie …?“
„Nur mit der Ruhe, mein lieber Freund“, lachte Landauer. „Ich ruf’ sie gleich an.“ Er griff nach seinem Handy, wobei Plankton auffiel, dass er an der rechten Hand einen verkürzten Mittelfinger hatte. Das Fingerglied mit dem Fingernagel fehlte.
Und während Gisbert Landauer die Nummer seiner Tochter in sein Handy tippte und Plankton den Schluck Kaffee, den er in den Mund bekommen hatte, wieder ausspuckte, starrte im Hintergrund des Kaffeehauses ein riesiger, ganz in Schwarz gekleideter, glatzköpfiger Mann, vor einem Glas Tee mit Milch sitzend, mit seinen strahlend blauen, aber eiskalten Augen auf einen Zettel, ließ dann seinen Blick durch das Café schweifen, wo er schließlich an Rupert Plankton hängen blieb.
3. Kapitel – 16:41
Nachdem Rupert Plankton an der Hand von Gisbert Landauer in ein großzügig ausgestattetes, aber fensterloses Büro geführt worden war, durfte er endlich die Augenbinde abnehmen.
„Du verstehst hoffentlich, Rupert“, sagte Landauer zum wohl schon dritten Mal. „Die Industriespionage macht auch vor Konditorwaren nicht halt und sie haben hier sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. Es bedurfte schon einiger Überredungskunst meinerseits, dass uns überhaupt gestattet wurde, ins Büro meiner Tochter vorgelassen zu werden. Na, und natürlich hat auch dein international überragender Ruf etwas dazu beigetragen.“
Während Plankton nickte und sich die aufgrund der zu fest zugezogenen Binde schmerzenden Augen rieb, wandte sich Landauer an den in einen Kampfanzug gekleideten, großgewachsenen Security-Beamten, der mit stoischer Miene und einer Maschinenpistole die beiden Männer vom Betreten des Firmengeländes an überwacht hatte: „Ich glaube, Aron, Sie können uns jetzt hier allein lassen. Meine Tochter kommt gleich, sie wurde schon ausgerufen.“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Ich habe meine Anweisungen“, sagte er mit einem leichten Akzent, den Plankton als Vorarlbergerisch, möglicherweise auch Schwyzerdütsch einstufte. „Ich darf Sie auf gar keinen Fall allein auf dem Gelände lassen und das Büro der stellvertretenden Gitterverantwortlichen ist nun einmal Teil des Geländes. Bitte rühren Sie sich nicht von der Stelle, sonst müsste ich Gebrauch von meiner Waffe …“ Er ließ den Satz vielsagend unvollendet und überprüfte den Sitz seines Gürtels, von dem einige Messer, ein Schlagstock und ein Paar Handschellen baumelten.
Landauer zuckte die Achseln. Da ging auch schon die Tür auf und seine Tochter trat ein.
Falls Plankton insgeheim erwartet hatte, Lisbeth Landauer wäre das – aus biologischen Gründen natürlich jüngere – Abbild ihres Vaters (groß, massig, Kurzhaarschnitt, verstümmelter Mittelfinger), so wurde er auf das Angenehmste überrascht. Zwar trug auch Lisbeth Landauer, die wohl Mitte dreißig sein mochte, ihr rotblondes Haar relativ kurz geschnitten, jedoch war sie mit ihren knapp 1 Meter 64 Körpergröße eher klein zu nennen und sie war auch im Unterschied zu ihrem Vater äußerst zierlich und wirkte beinahe zerbrechlich, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte und ihrem Vater mit den Worten „Hallo Paps“ einen Kuss auf die Wange drückte. Sie war in einen unförmigen weißen Kittel gekleidet, wie ihn sonst Ärzte tragen, weshalb es für Plankton nicht möglich war, ihre Figur einer genaueren Überprüfung zu unterziehen, etwa was so wichtige Details wie Busen und Hüften betraf. Abgesehen davon war seine Sehkraft noch nicht zu hundert Prozent zurückgekehrt.
Plankton ahnte noch nicht, dass er keine vierundzwanzig Stunden später Gelegenheit bekommen würde, den Körper von Lisbeth Landauer ganz genau in Augenschein zu nehmen …
Lisbeth deutete dem Wachmann mit einer energischen Handbewegung, er solle gehen, worauf dieser auch sogleich mit einem knappen, aber ehrfürchtigen Nicken und dem befohlenen Verlassen des Zimmers reagierte, und streckte Plankton die Hand zum Gruß hin.
„Sie sind also der berühmte Rupert Plankton, von dem mein Vater immer so viel erzählt hat“, sagte sie. „Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.“
„Ganz meinerseits“, sagte Plankton, ihre Hand ergreifend und fest schüttelnd. „Und Sie sind also seine Tochter Lisbeth, von der er mir nie etwas erzählt hat. Hübsches Büro haben Sie hier.“ Er ließ, nachdem sich seine Augen wieder einigermaßen erholt hatten, seinen Blick durch den Raum schweifen. Auffallend waren – abgesehen von einer teuren Ledergarnitur, die offenbar wichtige Gäste oder Kunden beeindrucken sollte, und einem riesigen Schreibtisch, auf dem ein moderner Computer samt Drucker stand – die vielen Bilder, die an der Wand hingen und neben dem berühmten Gemälde Das letzte Abendmahl (eine Kopie, wie Plankton vermutete) vor allem Gitter zeigten. Gitter in allen Farben und Variationen.
„Ja, es geht. Die Firma tut einiges für ihre Angestellten in gehobeneren Positionen. Obwohl ich ein dermaßen großes Büro ja eigentlich nicht bräuchte, weil ich ja die meiste Zeit im Produktionsraum die Arbeiterinnen überwachen muss, die mit der Formung der Gitter beschäftigt sind. Manchmal experimentiere ich allerdings hier am Computer mit neuen Gitterformen. Aber – wie unhöflich von mir, Sie hier stehen zu lassen! Nehmen Sie doch Platz.“
„Gern, Frau Landauer“, sagte Plankton, während er im Ledereinsitzer versank. „Oder Fräulein?“
„Sagen Sie doch einfach Lisbeth zu mir“, sagte Lisbeth. „Es reicht, wenn mich die Gitterverantwortliche dauernd Fräulein nennt.“
„Gern. Also Lisbeth.“
„Fein.“ Sie wartete, und als Plankton nichts sagte, setzte sie dazu: „Und Sie?“
„Wie? Ach ja, ich. Nun, Sie müssen natürlich nicht ‚Herr Plankton‘ zu mir sagen. ‚Professor‘ wäre als Anrede wohl angemessen.“
„Oh! Aha. Okay. Vater hat mir gesagt, Professor, dass Sie dem Geheimnis der Linzer Torte auf der Spur sind“, sagte Lisbeth und ein leicht ironischer Tonfall lag in ihrer Stimme. „Ich wüsste aber nicht, was für ein Geheimnis es da noch zu entdecken gäbe. Es ist ja doch alles bekannt. Die Zutaten. Das Rezept. Der Produktionsprozess. Die Geschichte. Die Größe. Wir produzieren mit Durchmessern von 10 Zentimetern, 15 Zentimetern und für die, die es gern etwas größer haben, 18, 20½ und 26 Zentimetern. Ganz schöne Dinger, die mit 26 Zentimetern.“ Sie zeigte die Größe, indem sie ihre Hände vor den Körper streckte und zwischen ihnen eine Entfernung von exakt 26,0 Zentimetern ließ.
„Ja schon, aber …“
„Als international anerkannter Experte wissen Sie ja wohl wahrscheinlich, dass die Linzer Torte die älteste Torte der Welt ist. Schon 1653 wird sie in einem Kochbuch erwähnt und schon im Römischen Reich kannte man Torten, die ähnliche Zutaten enthielten oder zumindest ähnlich aussahen. Wie bei fast allen Rezepten gibt es mehrere Varianten, doch einige Dinge haben alle gemeinsam: Die Linzer Torte besteht immer aus einem Mürbteig, der viele gemahlene Haselnüsse enthält. Auf den Tortenboden kommt eine Füllung aus Johannisbeermarmelade und als Krönung erhält die Torte ein kunstvolles Teiggitter …“
Plankton hörte ihr nur mit einem Dreiviertel-Ohr zu, weil ihm die Fakten ohnehin bekannt waren. Viel mehr interessierte ihn, ob auch Lisbeth an Dozenteritis litt und wann spätestens sie anfangen würde, zu stottern oder Silben und Worte zu vertauschen, aber Lisbeth brachte ihren Linzer-Torten-Vortrag fünf Minuten später völlig unfallfrei zu Ende und versank erschöpft in Schweigen, worauf das leise Schnarchen ihres Vaters, der im Lederfauteuil eingenickt war, etwas deutlicher zu hören war.
„Nun, es muss eine Zutat geben, die in den Büchern nicht geschrieben steht“, sagte Plankton stur. „Auf der ganzen Welt versucht man, unter Verwendung der allseits bekannten Zutaten und auf die gleichermaßen bekannte Art und Weise Linzer Torten zu backen, aber so richtig gelingt das niemandem und nirgends – außer hier in Linz. Und daher gibt es eine geheime Zutat …“
„Und selbst wenn es die erstens gäbe, Professor“, sagte Lisbeth leise lachend, „und selbst wenn ich sie zweitens kennen würde, erwarten Sie wohl nicht drittens allen Ernstes, dass ich sie Ihnen viertens verraten würde?“
„Doch“, widersprach Plankton. „Genau das erwarte ich mir. Darum bin ich ja hier. Ich würde Sie auch in meinem Buch lobend erwähnen. Im Vorwort etwa. Das liest ohnehin nie wer.“
Das Lächeln gefror in Lisbeths Gesicht. „Aber es gibt sie nicht, diese geheimnisvolle Zutat. Das ist ein Märchen.“
„Alle Märchen haben einen wahren Kern“, beharrte Plankton. „Denken Sie nur an Schneewittchen und die sieben Geißlein.“
„Nun, wenn Sie auf der Suche nach der geheimnisvollen Zutat sind, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich kann Ihnen die Produktionsstätten zeigen und unsere Gitterversuchsanstalt, wo wir versuchen, die optimale Passform der Tortengitter den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts anzupassen – wobei Sie mir allerdings schriftlich bestätigen müssten, dass Sie über alles, was Sie zu sehen bekommen, Stillschweigen bis zum Tod bewahren, selbst wenn Sie gefoltert würden …“
„Kein Problem“, sagte Plankton. „Gehen wir!“
„Gut, Professor, folgen Sie mir.“ Und als Plankton, sich mühsam aus dem Ledersessel schälend, einen Seitenblick auf seinen nach wie vor daneben dahindösenden Freund und Mentor warf: „Paps kann einstweilen hier weiterschlafen, er findet dann selbst hinaus.“
Plankton folgte Lisbeth durch weitverzweigte Gänge des Gebäudes. Mehrmals wechselten sie Stockwerke und Gehrichtungen und Plankton musste sich eingestehen, dass er ohne fremde Hilfe nie mehr aus diesem Labyrinth herausgefunden hätte.
„Und Sie haben nach der Lehre bei meinem Vater Linz verlassen?“, fragte Lisbeth, um Smalltalk während der Wanderung bemüht.
„Ja. Dafür gab es mehrere Gründe. Obwohl ich mich bei Ihrem Vater – meinem Lehrmeister – sehr wohl fühlte. Die World in Linz wurde mir zu small. Und dann dieser Gestank.“
„Gestank?“, setzte Lisbeth überrascht nach.
„Ja. Die Linzer Luft. In den Achtzigerjahren war die sprichwörtlich schlechte Linzer Luft noch echt ein Problem. VÖEST und Chemie, Grenzwerte, Überschreitungen, Luftverpestung, Ozon, all das, Sie wissen schon. Das mag jetzt besser geworden sein, aber die Linzer Luft war auch einer der Gründe, dass ich es damals vorzog, aus Linz wegzuziehen.“
„Aha. So. Wir sind da.“ Lisbeth ging auf Planktons Äußerungen über die schlechte Linzer Luft nicht näher ein, aber es war ihr anzumerken, dass sie über seine Worte verstimmt war. Sie gehörte zu den Linzerinnen und Linzern, die zwar selbst auch manchmal über die Linzer Luft lästern, aber der Ansicht sind, dieses Schimpfen stünde nur den Einheimischen zu.
Lisbeth zog einen Schlüsselbund hervor und öffnete, nachdem ein Scanner ihren Fingerprint analysiert und sie einen Code eingetippt hatte, mit drei verschiedenen Schlüsseln eine Tür.
Dann traten Plankton und sie in den Produktionssaal ein.
Plankton verschlug es vor Überraschung die Sprache.
Da er aber zuvor notariell beglaubigt geschworen hatte, bei sonstiger Todesstrafe über das, was er in den Räumlichkeiten der Linzer-Torten-Produktionsstätte zu sehen bekam, kein Wort zu verlieren, wollen wir sein Leben nicht gefährden und müssen wohl darüber schweigen, was es hier zu sehen gab …
4. Kapitel – 23:47
In seinem kleinen Hotelzimmer am Stadtrand stand der kahlköpfige Hüne kurz vor Mitternacht unter der Dusche und ließ eiskaltes Wasser über seinen erhitzten nackten Körper laufen.
Der Mann war von den Fußsohlen aufwärts bis zum Hals tätowiert. Motive aus Grimms Märchenwelt zierten seinen kräftigen, an der entscheidenden Stelle übrigens sehr männlichen Körper – Rotkäppchen und der böse Wolf, Rumpelstilzchen, der Froschkönig …
Er bückte sich und griff nach der Peitsche, die er auf den Boden des Badezimmers gelegt hatte.
Es musste wieder einmal sein. Montag war Knödeltag, Dienstag Nudeltag, Samstag war Badetag und heute war eben Geißelungstag.
Und während er mit der rechten Hand seine Brust geißelte und mit der linken Hand die Beschädigungen, die die Peitsche an den Tätowierungen anrichtete, wieder notdürftig ausbesserte, dachte er an seine Mission.
Die Mission, die sich aus dem Zettel ergab, den er wie einen wertvollen Schatz verwahrte.
Er war bereit.
Zweiter Tag (Samstag)
5. Kapitel – 08:17
Am nächsten Morgen saß Rupert Plankton im Frühstückssaal des Hotels und blickte wohlwollend auf die zwölf Schälchen Marmelade, die er in einem perfekten Halbkreis vor sich platziert hatte. Angeblich war die Marmelade hier ja hausgemacht und Plankton hatte vor, diese Behauptung zu überprüfen. Von links nach rechts standen da vor ihm, wenn er das noch richtig in Erinnerung hatte, Kirsche, Himbeere, Heidelbeere, Marille …
„Herr Plankton!“
Ein Angestellter der Rezeption, der seinen Arbeitsplatz verlassen und die dem Frühstücksgenuss gewidmeten Räumlichkeiten betreten hatte und sich nun prüfend umsah, hatte dies gerufen.
… Orange, rote Ribisel …
„Herr Rupert Plankton! Ein dringender Anruf!“
… schwarze Ribisel, weiße Ribisel, Erdbeere, Hagebutte …
„Herr Professor Rupert Plankton!“
Na also, warum nicht gleich! „Ja?“ Plankton winkte den Mann zu sich.
„Gott sei Dank, dass Sie da sind!“, war der Rezeptionist erleichtert. „Sie sind Herr Plankton?“
„Ja, ich bin Professor Plankton. Was gibt es?“
„Ein Anruf, Herr Professor. Eine Dame. Sie behauptet, es sei dringend, es gehe um Leben und Tod.“
Plankton runzelte die Stirn. Eine Dame? Seitdem er in Linz angekommen war, hatte er – abgesehen von Dienstpersonal – eigentlich nur die Bekanntschaft eines einzigen weiblichen Wesens gemacht, und das war Lisbeth Landauer.
„Hat sie ihren Namen genannt?“
„Nein, Herr Professor. Darf ich Ihnen den Anruf übergeben?“ Er zog ein Handy aus seiner Hosentasche.
„Ja, natürlich. Geben Sie her.“
Der Hotelangestellte gab Plankton sein Handy, verbeugte sich kurz und verschwand wieder in der Rezeption.
„Ja? Rupert Plankton hier“, meldete sich Plankton, vor Verwirrung auf seinen Professorentitel vergessend.
„Bin ich froh, dass ich Sie erwische, Professor“, erklang unverkennbar die aufgeregte Stimme Lisbeth Landauers.
„Lisbeth!“, rief Plankton. „Was ist denn los?“
„Paps ist verschwunden!“
„Verschwunden? Was heißt das – verschwunden?“
„Wir wohnen ja im selben Haus. Seit Mama tot ist und ich mich von meinem letzten Kurzzeitlebensabschnittsgefährten getrennt habe, teilen wir uns ein Zweifamilienhaus. Und er ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen!“
„Na ja, Lisbeth, Ihr Vater ist ein erwachsener Mann, sehr erwachsen sogar schon, und da wird es wohl das eine oder andere Mal vorkommen, dass er … wie soll ich das ausdrücken …“
„Sie meinen, dass er irgendwo versumpft ist?“, unterbrach ihn Lisbeth. „Nein, nein, ganz sicher nicht, so gut kenne ich meinen Vater. Ich würde mir auch gar nicht so große Sorgen machen, wenn nicht …“ Sie brach ab, offenbar den Tränen nahe.
„Was denn? Was ist denn passiert?“
„Ich habe vor ein paar Minuten ein Päckchen erhalten …“
„Na, das ist doch schön! Haben Sie Geburtstag?“
„Zuvor hatte ich eine SMS auf mein Handy bekommen – Absender Paps oder zumindest Paps’ Handy – und die lautete: SCHAU VOR DIE TÜHR.“
„Äh, Sie haben jetzt Tür mit einem stummen H ausgesprochen“, bemerkte Plankton feinfühlig. „Absichtlich?“
„Ja, weil es mit einem stummen H geschrieben war. T-Ü-H-R.“
„Okay. Gut. Wahrscheinlich ein Ausländer. Davon gibt es hier ja einige. Und Sie haben dann wahrscheinlich vor die Tühr, äh Tür geschaut?“
„Natürlich. Und da lag eben das Päckchen.“
„Was denn für ein Päckchen?“
„Na, ein Päckchen halt“, rief Lisbeth, offenbar einem hysterischen Ausbruch nahe. „Ach, es ist zu schrecklich!“ Sie begann zu schluchzen. „Können wir uns irgendwo treffen? Ich muss es Ihnen zeigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ob ich die Polizei einschalten soll – oder ob es nicht sowieso schon zu spät ist.“
„Na gut“, sagte Plankton, etwas verärgert darüber, dass er seinen Marmeladenechtheitstest wohl auf einen anderen Morgen verschieben musste. Vielleicht konnte er sich die Marmeladen in Alufolien einpacken lassen …? „Wo wollen wir uns treffen?“
„Um neun Uhr im Neuen Dom. Ist Ihnen das recht?“
„Ja, gut. Ich komme.“ Er unterbrach die Verbindung.
Und er dachte daran, dass er am Vortag die falsche Entscheidung getroffen hatte, als er bloß eine Langstreckenkarte gekauft hatte.
Denn mit einer Vierundzwanzigstundenkarte wäre die Öffi-Fahrt zum Neuen Dom noch inklusive gewesen …
6. Kapitel – 08:59
Mit fast 20.000 Plätzen ist der Neue Dom zwar die größte, nicht aber die höchste Kirche Österreichs. Mit 134,8 Metern ist sein Turm um rund zwei Meter niedriger als der des Stephansdoms in Wien. Diese sozusagen körperliche Unterlegenheit war nicht auf dem Mist des damaligen Bischofs von Linz, Franz Joseph Rudigier, gewachsen, unter dessen Regentschaft 1862 mit dem Bau begonnen worden war, nein, das war von ganz, ganz oben verordnet, weil im Kaiserlich-Königlichen Österreich-Ungarn kein Gebäude höher sein durfte als der Südturm des Stephansdomes.
Diese Fakten, die er irgendwo in einer entfernten, selten benützten Ecke seines Gehirns gespeichert hatte, gingen Rupert Plankton durch den Kopf, als er kurz vor neun Uhr, korrekt in lange Hose und langärmeliges Hemd gekleidet, durch den Haupteingang die monumentale Kirche betrat.
Der Linzer Neue Dom muss nicht nur bei seiner Höhe etwas hinter dem Wiener Stephansdom zurückstehen. Auch beim Touristenzustrom belegt er im direkten Vergleich nur Platz zwei. Während der „Steffl“ zu jeder Tages- und Jahreszeit von Besuchern aus aller Herren Länder frequentiert wird, ganz gleich ob römisch-katholisch oder nicht, Hauptsache eine Digicam ist mit dabei, verirren sich in den Linzer Dom nicht gar so viele Touristen.
Für Plankton war dies nun von Vorteil, denn so befanden sich höchstens zwanzig Leute in der Kirche, als er, gleich einem hohen Würdenträger auf dem roten Teppich durch den Mittelgang schreitend, nach links und rechts Ausschau nach Lisbeth Landauer hielt.
„Pst! Professor! Hier bin ich!“, flüsterte ihm plötzlich aus einer Sitzbank eine leise Frauenstimme zu.
„Lisbeth!“, flüsterte Plankton zurück und setzte sich zu ihr in die Bank. „Was ist denn los?“
„Paps ist nicht nach Hause gekommen“, wiederholte Lisbeth, was sie Plankton bereits am Telefon mitgeteilt hatte. „Das allein würde mir ja noch nicht allzu große Sorgen bereiten, das kann ja schon mal vorkommen …“
„Ja, ja, das sagten Sie schon. Aber warum flüstern wir eigentlich?“
„In einer Kirche flüstert man halt. Das gehört sich so.“
„Und warum mussten wir uns dann ausgerechnet in einer Kirche treffen? Noch dazu in einer so großen?“
„Ich dachte mir halt, dass Sie auch ein paar Sehenswürdigkeiten von Linz sehen wollen, wenn Sie nach so vielen Jahren wieder einmal nach Linz kommen“, verteidigte Lisbeth die Wahl ihres Treffpunkts. „Aber wenn Sie wollen, gehen wir woanders hin. Nicht weit von hier gibt es ein Café, das Café **, ein ausgezeichnetes Kaffeehaus mit hervorragenden Mehlspeisen, dort können wir ganz normal sprechen.“
** Hier könnte in der 2. Auflage dieses Buches IHRE WERBUNG stehen!
„Gute Idee“, meinte Plankton. „Ich werde von so viel Flüstern leicht heiser und wenn ich heiser bin, leidet die Qualität meiner Vorlesungen …“
Und so zwängten sich die zwei aus der Sitzreihe.
Plankton bemerkte dabei, dass Lisbeth heute – im Unterschied zu gestern, als er sie in einen Arztkittel gekleidet kennengelernt hatte (wobei sie den Arztkittel getragen hatte und nicht er) – sehr weiblich angezogen war. Sie trug eine kurzärmelige, farbenfrohe, großzügig ausgeschnittene Bluse, die nun endlich auch erkennen ließ, dass Lisbeth trotz ihrer zierlichen Figur doch eine beachtliche Oberweite aufzuweisen hatte, und einen kurzen – sehr kurzen – knallroten Lederrock, aus dem schlanke, braun gebrannte Beine herauswuchsen. Plankton überlegte, welch Glück es war, dass die Eingänge zu den Linzer Kirchen nicht bewacht wurden. In Italien etwa wäre sie derart kurzgerockt nie im Leben in eine Kirche eingelassen worden und hätte wahrscheinlich sogar eine Verhaftung wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses riskiert.
Sie verließen eilig den Dom und begaben sich nur wenige Hundert Meter weiter in ein Kaffeehaus, in dessen Innerem sie Platz nahmen.
In dem Moment, als die beiden die Tür des Cafés hinter sich schlossen, trat der glatzköpfige schwarzgekleidete Hüne aus dem Schatten des Kirchenportals.
7. Kapitel – 09:14
„Also, wie war das?“, fragte Plankton, nachdem sie den bestellten Kaffee samt einem Gramastettner Krapferl serviert bekommen hatten. „Gestern, nach dem Besuch der Linzer Torten-Produktionsstätte, als wir in Ihr Büro zurückkamen – ja ja, ich weiß schon, ich muss Stillschweigen bis zum Tod bewahren –, da hatte Ihr Vater das Büro schon verlassen.“
Lisbeth nickte. „Ja. Das war nicht weiter ungewöhnlich. Er hat mich schon ein paar Mal in meinem Büro besucht. Aron wird ihn hinausgeleitet haben.“
„Und Sie haben ihn dann am Abend nicht mehr gesehen?“
„Aron?“
„Nein, Ihren Vater.“
„Ach so. Nein. Aber auch das ist mir nicht weiter seltsam erschienen. Ich habe mir gedacht, er ist bei seinem Würstelstand oder er verbringt den Abend bei Freunden, eventuell auch mit Ihnen.“
„Nein, mit mir hat er ihn nicht verbracht. Und heute früh?“
„Nun, wir frühstücken immer gemeinsam, Paps und ich, das ist schon jahrelange Tradition. Und als er nicht zum Frühstück kam, habe ich in seinem Schlafzimmer nachgesehen. Sein Bett war unbenützt. Daraufhin habe ich versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Es ist niemand rangegangen.“
„Und dann?“
„Dann kam auch schon die SMS von seinem Handy.“
„Schau vor die Tühr.“
„Ja.“
„Und vor der Tür haben Sie dann ein Päckchen gefunden.“
„Ja.“ Lisbeth holte aus ihrer Handtasche eine kleine Schachtel hervor, 12 Zentimeter lang, 9½ Zentimeter breit und 2 Zentimeter hoch. „Das hat man mir vor die Tür gelegt, in ein Geschenkpapier verpackt.“
„Aha“, sagte Plankton nur. „Eine Kartenspielschachtel. Pippi Langstrumpf macht, was ihr gefällt. Und was ist drin in der Schachtel? Karten, wie es sich für ein Kartenspiel gehört?“
„Nein. Keine Karten.“ Plötzlich standen Tränen in Lisbeths Augen. „Jemand muss Vater entführt und ihm etwas angetan haben. Aber warum? Was wollen sie von ihm, von mir, von uns?“
Plankton runzelte die Stirn. Wie kam Lisbeth nur darauf, dass man Gisbert Landauer entführt und ihm etwas angetan hatte? Als John Paul Getty III. 1973 entführt worden war und sich sein Großvater zunächst geweigert hatte, Lösegeld zu bezahlen, hatten die Entführer dem 17-Jährigen ein Ohr abgeschnitten und es an eine Zeitung geschickt.
Sollte sich in der Kartenspielschachtel etwa das Ohr von Gisbert Landauer befinden?
Plankton nahm Lisbeth die Schachtel aus der Hand und machte sie auf.
Nein, in dem Kinderspiel lag nicht das Ohr von Gisbert Landauer.
Planktons entsetzter Blick fiel auf einen notdürftig in Zeitungspapier eingewickelten Mittelfinger mit einem verkürzten Fingernagelglied.
8. Kapitel – 09:20
„Jemand hat ihm einen Finger abgeschnitten?“, rief Plankton angewidert.
„So sieht es aus. Es ist unverkennbar Paps’ Mittelfinger. Das oberste Glied mit dem Fingernagel hat er sich einmal beim Holzhacken abgehackt, ich weiß es noch genau, er hat geblutet wie ein Schwein, daher ist es verkürzt – und eben unverkennbar sein Finger.“
„Aber warum? Was will derjenige, der das getan hat, damit bezwecken? Haben Sie schon eine Lösegeldforderung erhalten?“
„Nein. Und ich verstehe auch nicht, was der oder die Entführer sich bei uns erwarten. Sicher sind wir finanziell nicht schlecht gestellt, Vater gehört der Würstelstand, ich bin –“
„Stellvertretende Gitterverantwortliche, ich weiß.“
„Zusammen gehört uns ein Haus, aber das stammt auch schon aus den 1980er-Jahren und ist keine Millionen wert …“
„Wahrscheinlich haben Sie auch noch einen Bausparvertrag“, mutmaßte Plankton. „Und eine Überraschungseierfigurensammlung.“
„Ja, natürlich, aber insgesamt kann man uns nicht gerade als reich bezeichnen. Dass ich ein hohes Lösegeld bezahle, ist ausgeschlossen.“ Lisbeth führte ihr schon recht mitgenommen aussehendes Taschentuch an ihre Augen.
„Aber irgendein Motiv müssen die Entführer ja doch haben!“, rief Plankton beinahe vorwurfsvoll.
In diesem Moment erfüllte der Tarzan-Schrei die Räumlichkeiten des Cafés, sodass alle Gäste erschrocken zusammenzuckten.
„Oh! Mein Handy!“, erklärte Plankton. „Das ist mein Klingelton, der anzeigt, dass eine SMS eingelangt ist.“
Als Tarzan ein zweites Mal zu schreien ansetzte, schlug Lisbeth vor: „Wollen Sie nicht vielleicht nachsehen …?“
„Wenn Sie erlauben“, sagte Plankton. „Vielleicht ist es ja mein Verlag. Oder die Universität, wegen meiner Vorlesung. Oder der gute Jamie Oliver, der ruft immer so früh an …“
„Na, dann sehen Sie doch endlich nach!“
Plankton tippte einige Zeit auf seinem Handy herum, bis schließlich die soeben eingelangte Nachricht auf dem Display erschien.
Er erstarrte.
„Was haben Sie, Professor?“, fragte Lisbeth, der Planktons veränderter Gesichtsausdruck aufgefallen war.
„Lesen Sie!“ Plankton hielt Lisbeth das Handy vors Gesicht.
„WIR HABEN IHN – KEINE POLIZEI – SIE WISSEN, WAS WIR WOLLEN – SIE HABEN 24 STUNDEN ZEIT, SONST SCHICKEN WIR DAS NÄCHSTE GLIED“, las sie laut vor.
„Nicht zu vergessen der Smiley am Schluss“, ergänzte Plankton.
„Aber was soll das heißen: ‚Sie wissen, was wir wollen‘?“
„Keine Ahnung“, sagte Plankton. „Aber die SMS kommt zweifellos von den Entführern Ihres Vaters.“ Er nannte Lisbeth die Nummer des Geräts, das als Absendehandy aufschien, und Lisbeth bekräftigte, dass es sich dabei um Gisbert Landauers Handy handelte.
„Es sieht also wirklich so aus, als habe jemand Ihren Vater entführt“, sagte Plankton schließlich. „Mit Haut und Haaren und Handy. Bis jetzt hatte ich ja gehofft, alles würde sich vielleicht als Irrtum herausstellen, aber da meint es offenbar jemand bitter ernst. Hm. Ob wir nicht doch die Polizei beiziehen sollten? Die Linzer Kriminalpolizei genießt einen ausgezeichneten Ruf. Ihre Aufklärungsquote insbesondere bei Mordfällen beträgt beachtliche –“
„Verzeihen Sie, Professor, wenn ich Sie unterbreche, aber glauben Sie nicht, dass wir dann Paps unnötig in Gefahr bringen? Schließlich schreiben die Entführer ausdrücklich ‚Keine Polizei‘! Und ich möchte nicht, dass sich aus der Entführung meines Vaters ein in der Kriminalstatistik als gelöst aufscheinender Mordfall entwickelt!“
„Nun, wenn Sie meinen, dass wir es ohne Polizei schaffen … Die hätte allerdings – anders als wir – die technischen Möglichkeiten, den derzeitigen Aufenthaltsort des Handys Ihres Vaters zu orten, und dann wüssten wir, wo die Entführer stecken.“
„Und wenn die Polizisten dann diesen Ort stürmen, bringen die Entführer meinen Vater um!“
„Eine derartige Reaktion ist natürlich nicht auszuschließen“, gab Plankton zu. „Gut, versuchen wir es ohne Polizei. Denken wir selber nach.“
„Was ist das bloß, was die Entführer haben wollen?“ Lisbeth zitierte nochmals den Text der SMS: „‚Sie wissen, was wir wollen‘.“
„Interessant ist“, behauptete Plankton, „dass die SMS mir geschickt wurde und nicht Ihnen.“
„Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und das bedeutet?“
„Dass die Entführer offenbar meinen, dass ich weiß, was sie wollen.“
9. Kapitel – 09:30
Gisbert Landauer erwachte aus einem unruhigen, traumlosen Schlaf.
Das Erste, was er wahrnahm, waren nicht die Schmerzen in seiner rechten, verbundenen Hand, sondern dass die Luft in dem Raum, in dem er auf einem Sofa geschlafen hatte, stickig und abgestanden war. Kein Wunder, hatte der Raum doch keine Fenster und die Tür zum Gang oder Vorzimmer (oder wo auch immer sie hinführte) war geschlossen. Das Zimmer wurde nur durch eine flackernde Neonleuchte, die längst schon ausgetauscht gehört hätte, schwach beleuchtet.
Landauer setzte sich mühsam auf und rieb sich die Augen, was einen Schmerzensschrei zur Folge hatte, als seine verletzte Hand den Kopf berührte.
Ach ja, der Finger, schoss es Landauer durch den Kopf, als die wunde Stelle auch schon zu pochen anfing. Die Verletzung war von der Frau nur notdürftig versorgt worden, dann hatte sie die Hand mit einem provisorischen Verband versehen, durch den die Schnittstelle leicht nachblutete.
Langsam kamen Landauer die Ereignisse der letzten Nacht wieder ins Gedächtnis und er griff instinktiv zu seiner linken Hosentasche, wo er sonst immer sein Handy verwahrte.
Sein Handy war weg.
Er hatte auch nichts anderes erwartet. Die Frau hatte ihm sein Handy abgenommen.
Er sah auf seine Armbanduhr. Halb zehn. So lange hatte er geschlafen!
Landauer sah sich in dem Zimmer um. Es war ein typischer, karg eingerichteter und anscheinend unbenützter Büroraum. Schreibtisch, Drehsessel, Schrank, kein Teppich auf dem abgetretenen Parkettboden, keinerlei Blumenschmuck und – mit Ausnahme eines Bildes, das offenbar von der Wand abgenommen worden war und mit der Bildseite zur Wand lehnte – keine Bilder. Lediglich das Sofa, auf dem Landauer mehr schlecht als recht geschlafen hatte, verlieh dem Raum ein wenig Behaglichkeit. Dass das Büro nicht benutzt wurde, war daraus zu schließen, dass sich auf dem Schreibtisch keine Utensilien befanden, die man sonst in einem Büro üblicherweise erwartete – kein Computer und auch kein Telefon.
Gisbert Landauer schlich zur Tür und drückte vorsichtig die Klinke nach unten.
Die Tür öffnete sich nicht, Landauer war in dem stickigen Raum eingesperrt.
Seufzend ging Landauer zum Sofa zurück und setzte sich wieder darauf. Wenigstens das Pochen in seiner wunden rechten Hand ließ nun ein wenig nach.
Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als hier zu sitzen und zu warten.
10. Kapitel – 09:31
„Und wissen Sie es?“, bohrte Lisbeth nach.
„Ich habe nicht den blassesten Schimmer“, gestand Plankton und kratzte sich am Hinterkopf, was bei ihm ein Zeichen höchster Konzentration darstellte.
„Aber die Entführer meinen, dass Sie es wissen.“
„Ja. Offenbar.“ Plankton schlug mit der Hand auf den Tisch, dass die Schachtel mit dem Finger darin einen kleinen Luftsprung machte. „Aber woher soll ich es wissen! Lisbeth, ich habe Ihren Vater jahrelang nicht gesehen. Ich bin in der Welt herumgereist und hatte keinen Kontakt zu ihm, außer ab und zu einem Anruf oder eine E-Mail. Bis gestern.“
„Und gestern?“
„Haben wir uns am Vormittag am Taubenmarkt getroffen, waren dann im Traxlmayr und haben dann am Nachmittag Sie besucht, Lisbeth. Daran müssen Sie sich doch erinnern!“
„Ja, natürlich. Und dabei hat Paps Ihnen nichts übergeben? Irgendeinen Gegenstand, den die Entführer nun haben möchten?“
„Lisbeth, Sie sehen zu viele Spionagefilme.“
„Aber es muss irgendetwas geben!“
„Zeigen Sie mir noch einmal die Schachtel.“
Lisbeth reichte sie ihm, Plankton besah sie sich von allen Seiten. „Hm. Eine Spieleschachtel.“
„Ja, das sagten Sie schon.“
„Das soll wohl heißen, der Entführer – gehen wir einmal davon aus, dass es nur ein Entführer ist – der Entführer will mit uns spielen. Er lädt uns zu einem Spiel ein. Ein Spiel um das Leben und die Freiheit Ihres Vaters!“
Lisbeth schluchzte kurz auf.
„Weiter. Pippi Langstrumpf macht, was ihr gefällt ist ein sehr bekanntes Kinderkartenspiel vom berühmten oberösterreichischen Spieleautorenduo Mini/Reindl nach einem gleichfalls relativ bekannten Kinderbuch. Es heißt Pippi Langstrumpf. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal von Astrid Lindgren gehört haben. Sie ist die Autorin der Buchvorlage. Sie wurde am 14. November 1907 auf Näs bei Vimmerby – in Schweden – als Astrid Anna Emilia Ericsson geboren und …“
„Professor, das ist doch jetzt wohl nicht weiter wichtig!“
„Oh. Mag sein. Jedenfalls will uns der Entführer durch die Übersendung eines Kinderspiels wohl sagen, dass es ein Kinderspiel ist, das Rätsel um das Verschwinden Ihres Vaters zu lösen.“ Plankton kratzte sich am Kopf und öffnete die Spieleschachtel neuerlich.
„Hm. Der Finger ist in ein Stück Papier eingewickelt. In ein Zeitungspapier.“
Er wickelte den Finger aus, ließ ihn in die Schachtel zurückfallen, gab auch aus Pietätsgründen den Deckel wieder darauf und besah sich dann das Zeitungspapier.
„Hm, das ist ein Kreuzworträtsel … Ob das nicht ein Hinweis ist …“
„Sie meinen doch nicht etwa, dass uns die Entführer mit dem Kreuzworträtsel einen Hinweis auf den gesuchten Gegenstand geben wollen?“, fragte Lisbeth skeptisch.
„Wissen Sie einen besseren Anhaltspunkt, dem Rätsel um die Entführung Ihres Vaters auf die Spur zu kommen, als erst einmal dieses Kreuzworträtsel zu lösen?“
Lisbeth schüttelte den Kopf.
„Solange uns also nichts Besseres einfällt …“, sagte Plankton. „Haben Sie einen Kugelschreiber?“
Lisbeth fischte einen Kugelschreiber aus ihrer Handtasche hervor und Plankton machte sich ans Lösen des Rätsels.
„Es ist ein Kreuzworträtsel, wo dann einige Buchstaben richtig aneinandergereiht ein Lösungswort ergeben“, erklärte er, während auch schon hurtig der Schreibstift über das Papier flog. „Ein Lösungswort mit elf Buchstaben.“
„Und Sie glauben, dieses Wort sagt uns dann, was die Entführer von uns wollen? Also etwa SCHATZKARTE?“
„Möglich wäre es. Ja, Schatzkarte würde übrigens passen, das hat elf Buchstaben.“ Und als er sah, dass Lisbeth nach wie vor zweifelte, setzte er leicht verärgert dazu: „Haben Sie eine bessere Idee?“
Da Lisbeth im Augenblick tatsächlich keinen besseren Vorschlag anzubieten hatte, schwieg sie nur, einige Minuten lang, bis Plankton triumphierend ausrief: „So! Da haben wir es!“
„Sie haben das Rätsel gelöst?“
„Ja. Das Lösungswort heißt –“
Er brach ab.
„Ja? Wie?“
„Das Lösungswort heißt DA LINZI CODE.“
11. Kapitel – 09:45
Auch Josef Pieringer erwachte aus einem unruhigen Schlaf, der anders als der von Gisbert Landauer aber ganz und gar nicht traumlos gewesen war. Nach dem Frühstück hatte er sich wieder ein wenig hingelegt. Er war dann eingenickt und nun hatte ihn derselbe schlimme Traum, der ihn schon seit einigen Wochen quälte, wieder aus dem Schlaf gerissen.
Der Traum war immer gleich, höchstens belanglose Nuancen brachten ein wenig Abwechslung. Ein großer, dunkel gekleideter Mann mit einer Sense in der Hand und einer Kapuze über dem Kopf erschien im Zimmer und winkte ihm, er solle mit ihm gehen. Die feinen Nuancen bestanden darin, dass der Mann das eine Mal die Sense links trug, dann wieder rechts, dass er konsequenterweise einmal mit der freien linken Hand winkte, dann wieder mit der rechten, dass er einmal gleich bei der Tür stehen blieb und auf Pieringer wartete, das andere Mal ein paar Schritte ins Zimmer hinein machte, aber diese kleinen Unterschiede in den Details waren für Pieringer ohne Bedeutung. Geistig baute er zwar seit ein paar Jahren stetig ab und er verbrachte deshalb seinen Lebensabend auch im Pflegeheim, jedoch selbst für ihn war der Sinngehalt des Traumes klar: Seine Zeit war abgelaufen, der Tod – in Gestalt des Sensenmannes – wollte ihn holen.
Als Pieringer sich mühsam zur Wand drehte, in der Hoffnung, bis zum Mittagessen ein wenig, wenn möglich traumlos, weiterschlafen zu können, wusste er noch nicht, dass dieses Mittagessen seine letzte Nahrungsaufnahme sein würde …
12. Kapitel – 09:46
„Da Linzi Code?“, rief Lisbeth ungläubig. „Was soll das heißen?“
„Na, Da Linzi Code eben.“
„Ich kenne einen Da Vinci Code, aber keinen Da Linzi Code.“
„Hm, da haben Sie recht. Allerdings – wir sind hier in Linz. Es muss ein Hinweis auf Linz sein. Und ein Code ist eine Vorschrift, mit der Nachrichten oder Befehle zur Übertragung oder Weiterverarbeitung für ein Zielsystem umgewandelt werden können. Das Wort Code geht ja auf das lateinische Wort Codex zurück, das ‚Verzeichnis, Urkunde, Hausbuch‘ bebebebe-bedeutet. Der Corsemod, äh Morsecode speibstielsweise sti-, sta- stellt …“
„Professor, ich weiß, was ein Code ist“, unterbrach ihn Lisbeth. „Wenn Ihre Theorie stimmt, dass uns die Entführer mit diesem Kreuzworträtsel einen Hinweis auf das gesuchte Objekt geben wollen, müssen wir also den Da-Linzi-Code entschlüsseln.“
„Das hört sich einfacher an, als es ist“, stellte Plankton fest. „Wo wollen Sie ansetzen? Linz ist groß. Natürlich bei Weitem nicht so groß wie die Städte, in denen ich die letzten Jahre verbracht habe, aber groß genug, um einen Hinweis auf Linz als nicht gerade eindeutig erscheinen zu lassen. Hm.“
„Was haben Sie?“
„Mir kommt gerade eine Idee. Bei diesen Rätseln muss man ja oft um die Ecke denken.“
„Wie meinen Sie das – um die Ecke denken?“
„Nun, man meint beispielsweise, Linzi bedeutet Linz, und in Wirklichkeit bedeutet Linzi nicht Linz, sondern Linzi.“
„Ich verstehe nicht …“
„Mir ist gerade eingefallen, dass es eine Stadt namens Linzi gibt.“
„Noch nie gehört.“
„Ja, Sie sind auch nicht so weit herumgekommen wie ich.“
„Und wo soll dieses Linzi sein?“
Und nun erwies sich die Wahrheit der Bemerkung von Günther Jauch, der in einer seiner 50.000 Sendungen Plankton als „wandelndes Wikipedia“ bezeichnet hatte (oder war es Johannes B. Kerner gewesen? Plankton, der in der besagten Sendung zum Thema Darf man zu Neuburger wirklich nicht Leberkäse sagen? eine fachkundige Stellungnahme abgegeben hatte, verwechselte die beiden immer).
„Der Stadtbezirk Linzi“, sagte er nämlich wie aus der Pistole geschossen, „auf Chinesisch 临淄区, liegt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Zibo in der chinesischen Provinz Shandong. Linzi hat eine Fläche von 668 km² und zählt 590.000 Einwohner – also deutlich mehr als Linz aufzubieten hat! Während der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen – einer Epoche während der chinesischen Antike – war Linzi sogar Hauptstadt des Staates Qi. Jetzt sagen Sie nicht, Sie hätten noch nie davon gehört!“
„Jetzt, wo Sie es erwähnen, bilde ich mir ein, schon einmal darüber gelesen zu haben …“
„Na also.“ Plankton griff nach seinem Handy.
„Was haben Sie vor?“
„Zwei Tickets buchen. Wir fliegen nach China!“
13. Kapitel – 09:55
„Aber, Professor, sind Sie sicher, dass wir das Richtige tun?“, fragte Lisbeth zum bereits zweiten Mal, während sie auf der Herrenstraße auf das von Plankton mittels Handy bestellte Taxi warteten, das sie zum Linzer Flughafen bringen sollte.
„Haben Sie einen besseren Vorschlag?“, antwortete Plankton wie auch beim ersten Mal auf Lisbeths Frage.
„Nein, nicht, aber vielleicht hat Paps Entführung mit den Chinesen gar nichts zu tun und wir verlieren wertvolle Zeit! Schließlich haben uns die Entführer nur 24 Stunden gegeben, dann wollen sie uns einen weiteren Körperteil von ihm schicken.“ Lisbeth war wieder den Tränen nahe.