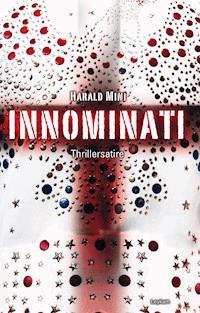
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rupert Plankton, der Welt berühmtester und einziger „Speisologe“ (= Spezialist für alles, was mit Speis und Trank zusammenhängt), weilt wieder in Linz. Diesmal hat er das Geheimnis um das Rezept der Gramastettner Krapferl gelüftet und wird dies im Zuge einer ORF-Veranstaltung für Licht ins Dunkel unter Beweis stellen. Dort tritt auch der weltbeste Elvis-Presley-Interpret („Imitator“ hört er nicht gar so gern) Sly Slender auf, der prompt Opfer eines Mordanschlags wird – verübt mit einem von Plankton gebackenen, mit Vatikanzucker vergifteten Gramastettner Krapferl. Und wieder gerät Rupert Plankton nicht nur selbst unter Mordverdacht, sondern stößt auf das große, streng unter Verschluss gehaltene Geheimnis um die Innominati. Gemeinsam mit der attraktiven Veronika folgt er der Spur bis ins Innerste des Vatikans und gerät dabei selbst in Lebensgefahr … Harald Mini gelingt mit seinem neuesten Wurf eine explosive Mischung: spannend und witzig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelseite
Harald Mini
Innominati
oder
Wie der Speisologe Rupert Plankton zwar schon vor Beginn der Geschichte den Gramastettner-Krapferl-Code knackt, aber trotzdem in einen rätselhaften Mordfall verwickelt wird ...
Thrillersatire
Leykam
Statt einem VORWORT
oder einem
PROLOG
(oder sonst etwas Unnötigem, das nur von der Handlung abhält)
ein
HINWEIS:
Dieses Buch enthält Produktplatzierungen!
(Dafür wird im gesamten Buch kein einziges Mal geraucht, sodass der Autor zwar wieder nicht den „Glauser“-Krimipreis gewinnen wird, aber möglicherweise den Nichtraucherliteraturpreis …)
Seitenwechsel
1. Kapitel
Als „The Voice“ Sly Slender um 21 Uhr 12 dieses verhängnisvollen Sonntags mit seiner samtweichen Stimme die letzten Töne des Elvis-Presley-Songs Always on my Mind verklingen ließ, hatte er noch sechseinhalb Minuten zu leben.
Vor Always on myMind hatte er übrigens Love Me Tender zum Besten gegeben und dadurch zahlreiche Zuhörer in der Linzer Eishalle in Ratlosigkeit versetzt, weil sie mit dem Begriff Tender den Vorratsbehälter einer Dampflokomotive verbanden und sich sehr darüber wunderten, dass sich der Interpret des Liedes wünschte, von so einem unhandlichen Ding geliebt zu werden.
Um aber zum Thema zurückzukommen und nicht gleich auf der ersten Seite zu Nebenaspekten abzuschweifen: Nachdem Sly Slender den erstens gebührenden und zweitens tosenden Applaus für seine Darbietung empfangen hatte, verschwand er hinter der Bühne und der Moderator des LinzerEiszaubers, Reinhard Waldenberger, trat wieder vor das Publikum.
Waldenberger war Programm- und Sportchef des ORF Landesstudios Oberösterreich und hatte 1988 den Linzer Eiszauber erfunden. Bei dieser Veranstaltung, die alljährlich zugunsten der ORF-Aktion Licht ins Dunkel stattfindet, treten nationale und internationale Künstler und Sportler auf und bieten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Musik- und Eiskunstlaufprogramm.
„Bevor ich nun zum Abschluss alle Sponsoren auf die Bühne bitte, damit sie Ihnen ihre Grußworte überbringen“, sprach Waldenberger ins Mikrofon, und im Publikum machte sich augenblicklich hörbar Unruhe breit, „bitte ich noch einmal unseren Stargast aus dem ersten Teil der Show zu mir. Es war eine noch nie da gewesene Sensation, wie er uns bewiesen hat, dass er das über 100 Jahre alte Geheimrezept unserer Gramastettner Krapferln enthüllt hat, und nun wird er diese Sensation noch toppen, indem er den Hausfrauen unter Ihnen – und natürlich auch den paar Hausmännern – erstens enthüllt, wie man ein perfektes Vier-Minuten-Frühstücksei zubereitet, und dies zweitens auch noch auf Eislaufschuhen tut. Liebe Zuseher, begrüßen Sie mit mir nochmals – unseren Speisologen Rupert Plankton!“
Während langsam Applaus einsetzte, stieß sich am anderen Ende der Eishalle ein großer (aber nicht allzu großer), schlanker (aber nicht allzu schlanker) Mann mittleren Alters (er ging auf die 48 zu und sah höchstens eineinhalb Jahre jünger aus) von der Bande ab und trippelte unter langsam intensiver werdenden Beifallskundgebungen auf Schlittschuhen übers Eis.
Rupert Plankton war der Welt berühmtester Speisologe.
Er war – unter anderem, denn dieses Kapitel würde nicht ausreichen, um aufzuzählen, was er sonst noch alles war – Meisterkoch, Gastrokritiker, Restauranttester, Fernsehkochsendungspräsentator, Fernsehkochduellmoderator, gefeierter Buchautor (auf Amazon waren aktuell 28 seiner Bücher gelistet, die man allerdings auf eBay zum Teil weit günstiger erhalten konnte), und vor allem war er der weltweit anerkannte Sachverständige für alle Fragen, die in Zusammenhang mit Speis und Trank standen, weshalb er als einziger Mensch im Universum den Berufstitel „Speisologe“ tragen durfte. Seit Kurzem war er auch – worauf er besonders stolz war – Gault-Millau-Testertestertester. Für alle Leser, die meinen, hier hätte sich die Tastatur des Autors einen Spaß erlaubt und zumindest die Lektorin hätte den Fehler bemerken müssen, sei erklärt, dass der Gault-Millau ein nach seinen Herausgebern Henri Gault und Christian Millau benannter einflussreicher Restaurantführer ist, der die sogenannten Hauben vergibt – neben den Michelin-Sternen die begehrteste Auszeichnung der Haute Cuisine. Für diesen Führer sind nicht Soldaten, sondern Tester unterwegs – gelernte Feinschmecker fast wie du und ich. Natürlich gehören auch die Tester überwacht, ob sie tatsächlich objektive Urteile abgeben und nicht von den Restaurantbetreibern bestochen werden, so wie man es etwa von Politikern tagtäglich gewohnt ist. Dies erfolgt durch gut zwei Dutzend Testertester (= Tester, die die Tester testen). Und seit Kurzem hat Gault-Millau zur Überwachung der Testertester einen über jeden Verdacht erhabenen Testertestertester angestellt – Rupert Plankton.
Plankton war gebürtiger Linzer, hatte dann im Ausland gastronomische Karriere gemacht und weilte derzeit in Linz – nicht um zu überprüfen, ob die Kantine der Justizanstalt Linz endlich eine Haube erhalten sollte, wie von den dortigen (häufig wechselnden) Köchen seit Jahren vehement gefordert wurde, sondern weil er für die dritte, erweiterte Auflage seines 800.000-fach verkauften Bestsellers Mehlspeisen mit Geschichte – Geschichten über Mehlspeisen Recherchen für die Gramastettner Krapferln angestellt und dabei – wie von Herrn Waldenberger bereits oben angedeutet wurde – das Geheimrezept enthüllt hatte, was auch zur Einladung zum Eiszauber geführt hatte.
Ich hätte Waldenberger doch nicht sagen sollen, dass ich in meiner Jugend einmal bei einem Kindereislaufkurs mitgemacht habe, ging es Plankton während seiner Eistripplerei durch den Kopf. Und jetzt muss ich, Rupert Plankton, der Welt berühmtester Speisologe, mich hier vor Tausenden Zusehern für den guten Zweck zum Affen machen, überlegte er weiter, während er Schritt für Schritt – immerhin ohne hinzufallen – auf Reinhard Waldenberger zutänzelte. Schließlich war er nach endlosen 45 Sekunden bei der Bühne angekommen, stieg zum Moderator hinauf und übernahm das Mikrofon.
„Nun, das perfekte Vier-Minuten-Ei“, begann er mit fester, redegewohnter Stimme, „wobei es meines Erachtens unerheblich ist, ob es ein Frühstücksei ist oder eines zum Abendessen oder eines für Ostern oder Weihnachten oder ganz einfach eines zum Nachmittagskaffee …“
In Reihe 5, Platz 7 in Sektor C sah eine warm angezogene Frau ungeduldig auf die Uhr. Viertel nach neun. Nun musste die Vorstellung bald aus sein. Es konnte ja nicht mehr allzu lang dauern, bis dieser selbst ernannte Speisologe mit seinem Referat über die Zubereitung eines Eis zu einem Ende kam. Wenn dann die Sponsoren die Bühne betraten, um mehr oder minder dezent Werbung für ihre Firmen zu machen, würde ohnehin die Hälfte der Zuseher fluchtartig die Halle verlassen, dann war der Weg frei in den Backstagebereich, zu ihm … zu Sly …
Die Dame beschloss, das Ende der Show gar nicht mehr auf ihrem Platz abzuwarten, und stand auf. Sie war groß, Mitte bis Ende 30 und trug einen sicherlich wärmenden, aber verhältnismäßig unförmigen mausgrauen Mantel, sodass Figurdetails an dieser Stelle beim besten Willen noch nicht berichtet werden können.1 Gegen die Kälte hatte sie eine farblich perfekt zum Mantel passende – also ebenfalls mausgraue – Pelzhaube auf, unter der ihre langen blonden Haare steckten. Zum Missfallen ihres Sitznachbarn, der gespannt Planktons Ausführungen über das ideale Verhältnis der Menge des Leitungswassers zum Durchschnittsgewicht der darin zu kochenden Eier lauschte, kämpfte sie sich zum Ende der Sitzreihe vor und trat dabei einem Mann – unabsichtlich, wie angemerkt werden soll – auf die Füße. Sie beachtete seine Unmutsäußerungen aber nicht weiter und stieg die Stufen hinauf, dann wandte sie sich nach rechts, Richtung Bühne.
Es war saukalt in der Linzer Eishalle, schließlich war es Ende Februar und das Wetter noch sehr winterlich. Daher zog die Frau den Mantel enger um sich. Am Ende des Weges angelangt, stieg sie wieder nach unten, neben die Bühne, wo sich der Zugang zum Backstagebereich befand. Dass sie hier richtig war, wurde klar, als ein sehr kleiner, schmächtiger Mann in einem offiziellen ORF-Arbeitsanzug den Vorhang zur Seite schob, den Zuschauerbereich betrat und, nachdem er, ohne recht auf den Weg zu schauen, fast mit ihr zusammengestoßen wäre, im Eilschritt und mit einem gehetzten Gesichtsausdruck in der Menschenmenge verschwand.
Ja, hier war sie richtig, von hier kam man zum Backstagebereich, wenn man … ja, wenn man die Sicherheitskontrolle überwand ...
„Stopp! Sperrzone! Kein Zutritt!“ Eine ausgestreckte Hand zeigte der Frau unmissverständlich an, dass sie hier nicht weitergehen durfte.
Wenn man nun, wie es die Frau tat, der Hand mit Blicken, den Unter- und Oberarm entlang, zum dazu gehörenden Körper folgte und diesen sodann in Gesamtaugenschein nahm, war nicht zu übersehen, dass es sich bei der Hand um eine Kinderhand handelte.
„Burschi, geh weg und bring mich nicht zum Lachen!“, sagte die Frau zu dem Knaben, der eine viel zu große Army-Hose und -Jacke trug, auf der die Aufschrift „SECURITY“ prangte.
„Hier dürfen Sie nicht weiter, hier ist absolute VIP-Zone“, sagte der Bub ungerührt mit piepsiger Stimme (vom Stimmbruch war er noch ein paar Jahre entfernt).
Die Frau atmete tief ein. Sie wusste nicht, dass aus Kostengründen – um den Licht ins Dunkel zufallenden Reinerlös möglichst hoch zu halten – von den Eiszauber-Veranstaltern beschlossen worden war, heuer die Securitykräfte aus den Reihen der teilnehmenden Eiskunstlaufvereine zu rekrutieren, und da dort keine gestandenen Mannsbilder zur Verfügung standen, hatten ein paar Knaben diese Aufgabe übernehmen müssen.
„Burschi, ich will nur ein Autogramm vom Sly“, sagte die Frau geduldig, während Plankton auf der Bühne gerade die richtige Haltung des Löffels zeigte, mit dem man das Ei nach dem Kochen aus dem Wasser fischte. „Sly Slender. ,The Voice‘. Den kennst du sicher.“
„Jetzt nicht. Bitte gehen Sie weg!“ Der Bub war nun dem Weinen nahe. „Sonst müsste ich Gebrauch von meiner Waffe …“ Er zog einen Pfefferspray aus der Jacke und richtete ihn mit zitternder Hand gegen die Frau, die unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Als sie dabei wahrnahm, dass im Gürtel des Buben ein Gerät steckte, das wie ein Elektroschocker aussah, beschloss sie, doch noch bis zum Ende der Show auszuharren, um Sly Slender danach ihre Aufwartung zu machen. Es konnte nun ja nicht mehr lange dauern, der Speisologe auf dem Eis war gerade am Ende seines Eiervortrags angelangt, und ohrenbetäubender Applaus setzte ein, wobei nicht ganz klar war, ob dieser der phänomenalen Darbietung Planktons galt oder dem Wiederauftritt Waldenbergers mit den Vertretern der Sponsorfirmen im Schlepptau.
Plankton quälte sich auf der Bühne mühsam aus seinen Schlittschuhen, zog dort bereitstehende Plüschpantoffel an und schlurfte hinter die Bühne.
Dort umringten fünf trachtig gekleidete Herren einen weiteren Mann, der regungslos auf dem Boden lag. Während Plankton die fünf sofort als die Mitglieder der Volksmusikgruppe Die vier fidelen Sandler wiedererkannte, die vor etwa einer Viertelstunde ihren Auftritt absolviert hatten, benötigte er zur Identifikation des am Boden Liegenden einen zweiten Blick und musste dann feststellen, dass es sich bei dieser Person um – Sly Slender handelte!
„Was ist denn los?“, fragte Plankton, und ein ungutes Gefühl breitete sich in seiner Magengegend aus. „Wieso liegt Sly denn hier so rum? Ist er müde? Oder ist ihm schlecht geworden?“
„Ja, sehr schlecht sogar“, sagte einer der Volksmusikanten, und ein weiterer, rothaariger ergänzte: „Mich dünkt, er schied dahin.“ Er war für die Texte der Fidelen Sandler zuständig, sprachlich vorgeschädigt und wäre durchaus auch imstande gewesen, die Todesnachricht in Reime zu setzen.
Plankton sah erschüttert auf Sly Slender hinab. Weit geöffnete Augen hinter einer riesengroßen Brille starrten ihn an, ohne ihn wahrzunehmen. Der Mund des Sängers war halb geöffnet und erlaubte dadurch einen Blick auf seine Zunge, auf der friedlich ein paar angefeuchtete Brösel ruhten. Die rechte Hand hielt die Überreste eines Gramastettner Krapferls umklammert. Das Gesicht war seltsam bläulich verfärbt.
Sly Slender war zweifelsfrei tot.
Wer regelmäßig seinen Schäfer-Elmayer liest, weiß, wie man sich bei kalten Buffets benimmt, wenn sich der Vordermann die letzten vier Shrimpsbrötchen geschnappt hat, oder wenn man auf einem Flohmarkt der Geliebten seines Chefs vorgestellt wird, aber welche Worte man wählt, wenn man urplötzlich vor einer Leiche steht, wird in keinem Benimmseminar gelehrt. Und daher entfuhr Plankton nur ein verhältnismäßig unoriginelles und eigentlich auch auf keine Antwort abzielendes „Ja, ist denn das die Möglichkeit?“, worauf wieder der Rothaarige „Offenbar schon, ja tatsächlich, scheint so, zweifellos“ zur Antwort gab.
Doch nun ist es wohl an der Zeit, die Vier fidelen Sandler ein wenig näher vorzustellen. Wenn man den Begriff Sandler in eine einschlägige Internetsuchmaschine eingibt, deren Name hier nicht genannt werden soll, weil ohnehin jeder Google kennt, so gelangt man erstaunlicherweise zuallererst nicht zur Homepage des US-amerikanischen Schauspielers Adam Sandler, sondern zu einer gleichnamigen Wattefabrik. Gleichnamig in Bezug auf Sandler und nicht auf Adam. Da die Wattefabrik ein Sponsoring dieses Buches kategorisch abgelehnt hat, soll für sie hier nicht weiter Werbung gemacht und rasch zum nächsten Suchergebnis übergegangen werden. Sandler ist laut Wikipedia – und in diesem Fall stimmt das sogar – in Österreich und Bayern die Bezeichnung für einen Obdachlosen. Die fünf Mitglieder der Vier fidelen Sandler waren nun aber nicht vier – oder fünf, auch das wird noch erklärt werden – bayerisch-oberösterreichische Obdachlose, die gemeinsam volkstümliche Musik machten, um ihren tristen Alltag ein wenig aufzuhellen, nein, um den Namen der Truppe zu verstehen, muss man wissen, dass es in Oberösterreich einen Ort namens Sandl gibt. Dieses Sandl ist, wie jedem Menschen zwischen Stockholm und Palermo bekannt ist, eine auf 927 Höhenmetern im schönen Mühlviertel gelegene Gemeinde mit etwa 1500 Einwohnern. Berühmt ist Sandl nicht nur für seine denkmalgeschützten Objekte in der Stadt und für seine Naturdenkmäler,2 sondern auch für seine vor etwa einem Jahr ins Leben gerufene Volksmusikgruppe Die vier fidelen Sandler. Diese besteht, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, aus fünf Mitgliedern – vier Brüdern, die die Truppe gegründet haben, und einem „Zuagroasten“. Die vier Brüder heißen Parzeval, Alfred, Georg und Ronald Wieslinger, wobei Parzeval (oder Percy, wie er meist gerufen wird) mit 38 Jahren der Älteste und mit über 1 Meter 90 auch der größte ist, Ronald (zu dem alle Ron sagen und der auffallend rote Haare hat) mit 24 der Jüngste, und die Zwillinge Alfred (beziehungsweise Fred) und Georg (auch Schorsch genannt) liegen altersmäßig irgendwo dazwischen. Von den Zwillingen wiederum ist, was für den Fortgang der Handlung zwar ohne jede Bedeutung ist, aber trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnt werden soll, Fred der um fünf Minuten Ältere. Man kann die beiden Zwillinge leicht auseinanderhalten: Fred hat um eine Spur hellere Augen. Und wem dieses Unterscheidungsmerkmal noch nicht genügt, der behilft sich mit einem Blick auf das Kinn der beiden Männer: Während Schorschs Kinn ein gepflegter Vollbart schmückt, prangt auf Freds Kinn eine Narbe von einer Rauferei um die Gunst der Sandler Margaritenkönigin 2009. Ja, Fred ist das, was man landläufig einen Weiberer3 nennt.
Jedoch nicht an einen der vier Wieslingers wandte sich nun Plankton mit der Frage „Was ist denn passiert?“, sondern an den fünften der Truppe, den „Zuagroasten“.
Der fidele Sandler Nr. 5, Joseph Balongowatungo, stammte nicht aus Sandl, nein, er war von viel, viel weiter hergereist und unterschied sich von den anderen vier Mitgliedern der Volksmusikgruppe schon durch seine Hautfarbe. Er war nämlich dunkelhäutig und sah aus wie eine Mischung aus David Alaba und Roberto Blanco mit einer Prise Jimi Hendrix. Er war vor ein paar Monaten als Aushilfspfarrer nach Sandl gekommen und aufgrund seiner fröhlichen Art und Musikalität (und ein wenig auch, weil er für die Fahrten zu den Auftritten sein Wohnmobil gratis zur Verfügung stellte) hatten die vier Wieslis (wie die Wieslingers in Sandl allgemein genannt wurden) ihn vor Kurzem als fünften in ihre Gruppe aufgenommen. Seither war Gegenstand häufiger und heftiger Diskussionen, ob sie sich nicht von Die vier fidelen Sandler auf Die fünf fidelen Sandler umbenennen sollten, aber solange sie noch Autogrammkarten aus der Gründerzeit besaßen, als sie noch zu viert gewesen waren, behielten sie ihren alten Namen bei. Noch dazu waren sie, seitdem ihr aktueller (und bislang einziger) Hit An so an Sandler4 sofort nach Erscheinen auf Platz 107,3 der österreichischen Volksmusikhitparade eingestiegen war (um sich dann zwischen den Plätzen 80 und 90 einzupendeln), in eingeweihten Kreisen unter ihrer ursprünglichen Bezeichnung bekannt.
„Plötzlich ist ihm schlecht geworden“, sagte Joseph Balongowatungo (der von seinen Freunden Black Joe genannt wurde) zu Plankton. Plankton war überrascht über das beinahe akzentfreie Hochdeutsch, das Black Joe sprach. Er kannte die Sprachmelodie einiger Schwarzafrikaner, die sich bemühten, Deutsch zu sprechen (mit der sierra-leonesischen Haubenköchin Sarah Wambuto verband ihn sogar eine platonische Freundschaft), aber das Deutsch des Sandler Aushilfspriesters war beinahe makellos. Der leichte Akzent erinnerte ihn witzigerweise ein wenig an seinen italienischen Lieblingspizzabäcker Francesco aus Lignano (die Hauptstraße entlang und dann nach dem Eisgeschäft mit den großen Portionen das zweite Haus rechts).
„Er hat noch irgendwas vor sich hin geröchelt“, berichtete Black Joe weiter, „dann ist er umgefallen und wenig später war er tot. Ich hab ihn noch gefragt, ob er auf eine Letzte Ölung Wert legt, aber er sagte nur auf gut Oberösterreichisch: ‚Na!‘ Also nein.“
„Tja, dieser kirchenfeindlichen Haltung begegnet man heutzutage leider sehr häufig, vor allem im großstädtischen Bereich“, meinte Fred erklären zu müssen, und Black Joe ergänzte: „Nicht, dass ich auf eine Krankensalbung vorbereitet gewesen wäre, aber ich bin ganz gut im Improvisieren …“
„Irgendein Öl hätten wir schon aufgetrieben“, sagte Schorsch, und zu Plankton gewandt: „Sie haben doch am Anfang des Eiszaubers die Gramastettner Krapferln gekocht, da werden Sie ja wahrscheinlich ein Öl zum Backblechbefetten verwendet haben?“
Plankton zuckte zusammen.
Nicht der Zungenbrecher „Backblechbefetten“ erregte seinen Unmut,5 sondern das von Schorsch verwendete Tunwort „kochen“: Mehlspeisen werden nicht gekocht, sondern gebacken, die meisten zumindest. Daher strafte er den Volksmusikanten mit verachtender Ignoranz und lenkte seinen Blick auf das Stück Backwerk, das Sly Slender noch im Tode in der Hand hielt.
„Es möge der Nachwelt ein Trost sein“, sagte er salbungsvoll, „dass er im Sterben den unvergleichlichen Geschmack eines vom besten Speisologen der Welt gebackenen Stücks Mehlspeise im Mund verspürte.“
„Amen“, sagte Black Joe Balongowatungo automatisch.
„Woran er wohl gestorben ist?“, überlegte Percy.
„Herzinfarkt?“, schlug Schorsch vor.
„Gut möglich“, sagte Plankton. „Nach den mir bekannten jüngsten Zahlen von Statistik Austria starben im Jahr 2010 in Österreich knapp über 77.000 Personen mit österreichischem Wohnsitz, 52 Prozent davon Frauen, und in sage und schreibe 43 Prozent der Fälle führte eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zum Tod. Auch 2009 war der Anteil von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ...“
„Komisch ist das schon“, unterbrach Fred Planktons Vortrag.6 „Ein paar Minuten vorher war er noch taufrisch und quietschlebendig, und dann … kaum hat er das Krapferl im Mund …“
„Was wollen Sie damit sagen?“ Plankton sah Fred Wiesli grimmig an.
„Na ja, wir wissen ja alle, wie das mit Gramastettner Krapferln so ist …“, wich der Volksmusikant einer direkten Antwort aus.
Plankton gab sich mit dieser ausweichenden Antwort jedoch nicht zufrieden. „Und wie ist das so mit Gramastettner Krapferln?“, fragte er scharf, „speziell mit von mir gebackenen Gramastettner Krapferln?“
An dieser Stelle ist es möglicherweise nötig, dem einen oder anderen Leser die Gramastettner Krapferln ein wenig näherzubringen. Während in Gramastetten der Bekanntheitsgrad der Gramastettner Krapferln bei knapp über 100 Prozent liegt, sinkt dieser proportional mit der Entfernung zu ihrem Herkunftsort. In Dahab etwa, dem ehemaligen Fischerdorf im Süden der Halbinsel Sinai, können nur rund 18 Prozent der dort lebenden Beduinen mit dem Begriff Gramastettner Krapferl etwas anfangen.
Die Linzer Torte kennen rund 52 Prozent der dortigen Bevölkerung, ex aequo mit der Sacher-Torte, aber die Krapferln hinken diesbezüglich doch noch ein wenig hinterher. Daher sei nun erwähnt, dass Gramastetten eine Marktgemeinde im oberösterreichischen Mühlviertel ist, nicht weit von Linz entfernt. Vor über 100 Jahren wurden dort die Gramastettner Krapferln erfunden – ein handtellergroßes Mürbteiggebäck, und zwar – um ehrlich zu sein – ein sehr mürbes Mürbteiggebäck, das dazu neigt, bei der geringsten Berührung mit Menschenhand zu zerbröseln. Das Originalrezept von 1898 ist streng geheim. Immer nur zwei Menschen kennen es und würden selbst unter Folter das richtige Verhältnis der Zutaten und die perfekte Dauer des Rührens in der Rührmaschine nicht preisgeben. Angeblich liegt das Geheimnis des Geschmacks und der Konsistenz in der Wahl der Temperaturen, bei denen der Krapferlteig abgemischt, gerührt, dressiert und gebacken wird, aber auch dieses Detail wird natürlich von den beiden Geheimnisträgern nicht verraten.
Seit Kurzem waren es allerdings drei Menschen, die das Originalrezept kannten. Rupert Plankton hatte es nämlich in monatelanger Kleinarbeit allein anhand des Geschmacks entschlüsselt – ohne technische Hilfsmittel und chemische Analysen, nur durch permanente Zusichnahme von Gramastettner Krapferln, deren Produktionszahlen dadurch um für den oberösterreichischen Wirtschaftsraum höchst erfreuliche 3,9 Prozent gestiegen waren.
Zum Beweis seiner Behauptung, den „Krapferl-Code geknackt zu haben“ (so die Formulierung in seiner Presseaussendung), hatte Plankton live zu Beginn des Eiszaubers ein Blech voll Gramastettner Krapferln nach dem von ihm vermuteten Rezept gebacken. Die beiden noch lebenden Gramastettner Bäcker, die das Originalrezept immer von einer Generation zur nächsten weitergaben, hatten dann die von Plankton gebackenen Krapferln mit von ihnen selbst nach dem Traditionsrezept hergestellten verglichen und blind verkostet und keinen Unterschied gemerkt. Die Sensation war perfekt: Rupert Plankton hatte nach den Geheimrezepten von Coca Cola (am 15. Juni 2009, 16.37 Uhr) und der Linzer Torte (anno 2012) auch das der Gramastettner Krapferln enthüllt! Er war wirklich reif für einen Auftritt bei Wetten dass …7
„Und wie ist das nun so mit Gramastettner Krapferln?“, wiederholte Plankton seine Frage in scharfem Tonfall. „Speziell mit von mir gebackenen Gramastettner Krapferln?“
„Na ja, sie sind etwas trocken … mürb …“, wand sich Fred. „Zerfallen im Mund augenblicklich zu Bröseln.“
„Nicht nur die von Ihnen gebackenen“, beeilte sich sein Zwillingsbruder Schorsch zu sagen, „alle Gramastettner Krapferln tun das, ausnahmslos alle.“
„Man muss sie unbedingt mit irgendwas runterspülen“, mischte sich nun auch noch Percy ein. „Und wenn es an Trinkbarem ermangelt“, fuhr der Liedtexter unter den Wieslis, Ron, fort, „man sich mit dem ungeschützten Verzehr in Gefahr begibt …“
„An einem Brösel …“, setzte Percy vorsichtig den Satz fort.
„Zu ersticken“, brachte es Black Joe auf den Punkt.
„Sie meinen, er ist an einem Gramastettner Krapferl erstickt?“, rief Plankton ungläubig aus.
„Soll ja kein Vorwurf an Sie sein“, sagte Schorsch fröhlich. „Kann jedem passieren.“
„Liegt förmlich in der Natur der Gramastettner Krapferln“, bemerkte Fred.
„Nach der Obduktion wissen wir mehr“, meinte Percy beruhigend.
Noch bevor Plankton ausrufen konnte, was ihm auf der Zunge lag, nämlich „An von mir gebackenen Gramastettner Krapferln stirbt man nicht!“, betrat Reinhard Waldenberger den Bereich hinter der Bühne. Er legte das Mikrofon auf eine Ablage, lockerte den Sitz seiner Krawatte und murmelte: „Ich muss schon sagen, das war mit Abstand meine beste Eiszauber-Moderation seit dem letzten Eiszauber.“ Dann bemerkte er, dass die mittlerweile sechs Männer um einen auf dem Boden ruhenden weiteren Mann herumstanden, und fragte: „Was ist denn los?“ Als er erkannte, dass es sich bei dem Liegenden um seinen Star Sly Slender handelte, rief er: „Sly! Was ist mit dir?“, und kniete sich neben ihm nieder. „Was ist mit ihm? Hat schon jemand den Arzt verständigt?“
„Ja, ich!“, rief Ron, der in seltenen Ausnahmefällen auch zu kurzen, präzisen Äußerungen fähig war.
„Aber ich fürchte, ärztliche Hilfe kommt hier zu spät“, sagte Plankton. „Er ist tot.“
„Sly tot! Aber wieso?“ Waldenberger rappelte sich wieder hoch. „Das kann er mir nicht antun. Er hat doch einen Vertrag für die nächsten zehn Eiszauber!“
Plankton schüttelte den Kopf. „Den wird er wohl nicht einhalten können.“
„Aber vor einer Viertelstunde war er doch noch putzmunter“, wunderte sich Waldenberger. „Hat wieder einen sensationellen Auftritt hingelegt. Elvis – Gott hab ihn selig – wäre stolz auf ihn gewesen. Woran ist er denn gestorben? Also Sly, nicht Elvis.“
Noch bevor Plankton seine statistisch belegbare Vermutung eines Herzinfarkts äußern konnte (43 Prozent sind 43 Prozent, da fährt die Eisenbahn drüber), wies Black Joe auf die Hand des Toten.
„Was hat er denn da?“, fragte Waldenberger. „Ah, ein Gramastettner Krapferl! Davon hätte ich jetzt auch ganz gern eines. Sind noch welche da?“
Er sah auf den Tisch, der in einiger Entfernung stand und auf dem sich ein leeres Backblech befand. Plankton hatte nach seinem Auftritt – nachdem die beiden Gramastettner Bäckermeister die von ihm gebackenen Krapferln gekostet und sie als den ihren gleichwertig qualifiziert hatten – die restlichen auf dem Blech hinter die Bühne getragen und auf dem Tisch abgestellt.
„Alle weg?“, rief Waldenberger enttäuscht. „Wenigstens eines hättet ihr mir aufheben können!“
Die fünf Vier fidelen Sandler sahen etwas schuldbewusst zum Tisch mit dem krapferllosen Blech hin. „Ich hab mir nur eines genommen“, behauptete Schorsch, und Fred gestand: „Ich zwei.“ (In Wahrheit waren es vier gewesen.) Auch die übrigen Bandmitglieder gaben zu, sich vom Backblech bedient zu haben, sodass sich auf diesem nun nur noch Zuckerreste und ein paar Brösel befanden. „Wäre es uns etwa nicht gestattet gewesen, dies tun zu dürfen?“, fragte Ron Plankton.
„Doch, doch, warum denn nicht, ich hab in letzter Zeit genug davon gegessen. 437 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe.“
„Zumindest eines hättet ihr mir übrig lassen können“, wiederholte Waldenberger beleidigt.
„Sly hat sich das letzte genommen!“, platzte Percy heraus. Als er auf diese Anschuldigung hin einen verächtlichen Blick des ORF-Moderators erntete, der ausdrückte, dass er es sich zu leicht machte, alle Schuld auf einen Toten zu schieben, der sich gegen einen derartigen Vorwurf ja nicht mehr wehren konnte, setzte er dazu: „Ich wollte mir noch ein Krapferl holen und hab gesehen, dass das Blech leer ist, im selben Moment hat Sly zu jammern und zu röcheln angefangen, da bin ich hin zu ihm und hab ihn gefragt, ob eh alles okay ist und ob er weiß, welcher vermaledeite Schuft sich das letzte Krapferl genommen hat, und da hat er gesagt: ‚I‘.“
„I?“
„Ja, i. Mundart-Kurzform von ich.“
„Aha.“ Waldenberger gähnte und wandte sich an Plankton: „Apropos Krapferl: War wirklich sensationell, wie die beiden Gramastettner Bäcker mal von Ihren, mal von ihren eigenen Krapferln gekostet haben und dann zugeben mussten, dass sie keinen Unterschied merken. Ich glaube, damit stehen Sie morgen in allen Gratiszeitungen.“
Mit einem leisen „Danke“ und einer kleinen Verbeugung nahm Plankton das Lob bescheiden entgegen.
„Das gibt’s nicht!“, schrie Percy Wieslinger plötzlich auf. Er hielt sein Handy in der Hand.
„Was ist denn, Percy-Baby?“, wurde er von seinen Brüdern und von Black Joe bestürmt.
„Eine SMS!“, rief Percy, der sich kaum beruhigen konnte. „Unser Auftritt war so megageil, dass uns Franz Gumpenberger für kommenden Donnerstagabend in seine Sendung G’sungen und g’spielt einlädt! Wir sollen dort unseren An so an Sandler-Hit präsentieren.“
G’sungen und g’spielt – beziehungsweise unabgekürzt Gesungen und gespielt – ist das Radio Oberösterreich-Forum für alle Bereiche der Volkskultur mit vielfältiger Volksmusik, mit Brauchtum im Jahreskreis, Bauernregeln, Mundart, Neuem über Trachten, Handwerk einst und jetzt, traditionellen Rezepten sowie Tipps für Veranstaltungen. Gäste im Studio liefern Informationen aus erster Hand, Musikanten erzählen über neue Produktionen und Projekte.8 Einer der Moderatoren ist seit gut zwei Jahrzehnten Franz Gumpenberger, ein mittlerweile pensionierter Richter, der schon während seiner aktiven Berufszeit durch seine dem Dienstgeber pflichtgemäß gemeldete, einkommensteuerpflichtige Moderatorennebentätigkeit sein karges Bezirksrichtergehalt aufgebessert hatte.
„Gratuliere!“, sagte Reinhard Waldenberger und schüttelte den fünf Männern hintereinander überschwänglich die Hand. „Wer von Franz Gumpenberger in G’sungen und g’spielt eingeladen wird, der hat es wirklich geschafft!“
Während die Volksmusikanten noch mit strahlenden Gesichtern die Gratulation entgegennahmen, war von der Bühne her ein von einer Frau gesprochenes „Ich will jetzt nicht länger warten, ich will ja eh nur ein Autogramm von ihm“ zu hören, dann wurde der Vorhang zur Seite geschoben und eine große, winterlich gekleidete Dame betrat den Backstagebereich, verfolgt vom Security-Buben, der weinerlich ausrief: „Sie dürfen hier aber nicht hinein!“
„Was ist denn, Maxi?“, fragte Reinhard Waldenberger einfühlsam.
„Die Frau da … ich hab ihr gesagt, dass sie da nicht hinein darf, aber sie hört nicht auf mich“, berichtete der Bursche. „Und ich heiße nicht Maxi, sondern Kevin.“
„Ist schon gut, Maxi, ich übernehme das“, beruhigte Waldenberger den Buben. „Was wollen Sie denn?“, wandte er sich an die Frau, die aufgrund der Wärme im Backstagebereich ihre Haube abgenommen und dadurch ihre langen blonden Haare befreit hatte, die ihr nun dekorativ auf die Schultern fielen.
Plankton sah interessiert auf. Automatisch setzte sich sein FES in Gang.
FES ist nicht nur die allgemein bekannte Abkürzung für erstens das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Sondertechnologien in Schwabach und zweitens die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH9, sondern auch für das von Plankton entwickelte Frauen-Einstufungs-System (kurz F-E-S beziehungsweise noch kürzer FES). Aufgrund diverser, zum Teil auch leidvoller Erfahrungen mit weiblichen Groupies nach seinen Kochshows in den späten 1990er-Jahren speziell westlich von Mönchengladbach hatte Plankton ein System entwickelt, mit dem er Frauen hinsichtlich ihrer Eignung als mögliche Sexualpartnerinnen einstufte. In seinem Bewertungsverfahren wurden die sieben Komponenten Alter, Größe, Gewicht, Figur, Gesicht, Behaarung und Mundgeruch abgefragt und benotet. Für jeden Faktor gab es zwischen null und zehn Punkte zu erreichen, sodass eine Kandidatin also bestenfalls auf 70 Punkte kommen konnte. Ab einer Gesamtpunktezahl von 36 (ein Punkt mehr als die Hälfte) war man bei Plankton im positiven Bereich und somit „live dabei“. Arnold Schwarzenegger soll angeblich ein ähnliches System anwenden, das Women-Qualifying-System (abgekürzt WQS, ausgesprochen dablju-kju-es), wobei Frauen für einen Einsteig bei ihm allerdings nur 25 Punkte benötigen. So erzählt man sich zumindest in Hollywood.
Die blonde langhaarige Frau erweckte Planktons Interesse. Sie war zwar noch zu weit von ihm entfernt, als dass er die Mundgeruchskomponente verlässlich beurteilen hätte können, aber fürs Alter gab es schon einmal die volle Punktezahl von zehn. Die Frau war dem ersten Eindruck nach zwischen 34 und 38 Jahre alt, und das lag in Planktons Idealbereich von zwischen 21 und 39.
Auch für den Teilbereich Behaarung vergab sein FES zehn Punkte. Plankton mochte lange Haare, und diese Frau hatte mächtig lange Haare, die ihr zwar nicht bis zum Po reichten, aber doch deutlich über die Schultern. (Andere Aspekte weiblicher Behaarung spielten in Planktons System übrigens eine eher untergeordnete Rolle.)
Und weil wir gerade bei lang sind: Nicht nur die Haare der Frau waren lang, auch die Frau selbst war ganz schön lang, sprich groß, und zwar um einige Zentimeter größer als Plankton, und da nach Planktons Ansicht Frauen wenigstens ein paar Zentimeter kleiner sein müssen als die dazugehörigen Männer, gab es für den Wert „größer als Plankton“ nur vier Punkte. Gewicht und Figur waren, solange die Frau in den Wintermantel gehüllt war, schwer zu beurteilen. Planktons FES wartete einige Sekunden, ob die Frau nach der Haube auch den Mantel ablegen würde, aber sie tat dem System den Gefallen nicht, sodass es nur ganz allgemein feststellen konnte, dass die Frau weder augenscheinlich über- noch untergewichtig war.
Verblieb noch das Gesicht. Es war ein sauberes, pickel-, warzen- und muttermalfreies, weitgehend faltenloses, freundliches, wenn auch derzeit Aufregung verratendes Gesicht. Na ja, kein Wunder, schließlich wollte die Person ein Autogramm von einer Berühmtheit, wahrscheinlich von ihm, der Welt berühmtestem Speisologen, da konnte sie ruhig aufgeregt sein. Das Gesicht erhielt eine Neun. Wenn das System nun in Sekundenbruchteilen alle Einzelwertungen addierte und für Gewicht, Figur und Mundgeruch den Zweifelswert Sieben vergab, kam eine Summe von 54 heraus.
Er hob interessiert die Augenbrauen. „Äh, Sie wollen zu ...?“, fragte er und ging auf die Frau zu. Wirklich nettes Gesicht, auch bei schrittweiser Annäherung nach wie vor kein wahrnehmbarer Mundgeruch …
„Sly“, sagte die Frau und sank dadurch im FES augenblicklich auf 51,5. „Ich will zu Sly Slender. Nur ganz kurz. Er war wieder einmal großartig. Ich bin sein größter Fan und möchte ein Autogramm von ihm …“ In diesem Moment fiel ihr Blick auf die fünf Volksmusikanten, die sie bislang ignoriert hatte, weil ihr musikalischer Geschmack anderweitig orientiert war, und auf den regungslosen Körper, um den sie herumstanden.
„Aber … das ist doch … Sly!“, rief sie und stürmte auf die Männer zu. Die noch Lebenden wichen ihr erschrocken aus, sodass sie ungehindert zu dem Toten gelangte, neben dem sie auf die Knie sank.
Da besann sich Reinhard Waldenberger seiner Pflichten als Hausherr der Veranstaltung. „Gnädige Frau, Sie dürfen den Toten nicht berühren. Das sieht man doch in jedem Krimi. Nichts anfassen!, heißt es da doch immer. Solange er also von der Sanitätspolizei noch nicht freigegeben ist, muss ich Sie bitten …“
„Was ist ihm passiert?“, fragte die Frau. „Ein Herzinfarkt?“
Während Plankton heftig nickte (43 Prozent!), zuckten alle anderen Männer mit den Schultern. „Wir wissen es noch nicht“, sagte Fred.
„Wir wollen erst einmal die Obduktion abwarten“, erklärte Percy der Frau, aber unerwarteterweise schien sie das nicht sonderlich zu beruhigen.
„Apropos Obduktion und Ärzte und so“, warf Waldenberger ein, „der Notarzt lässt ziemlich lange auf sich warten. Ja, ja, ich weiß schon, er kann sich ruhig Zeit lassen, weil er sowieso nichts mehr tun kann außer den Totenschein auszustellen, aber trotzdem … wir müssen schließlich dann hier zusammenräumen …“
„Es erfordert viele Schritte zu tätigen den Weg von Sandl in die Metropole Linz“, stellte Ron ein paar Worte in den Raum. Nachdem die Wiesli-Brothers einige Sekunden dafür verwendet hatten, den Sinn des Gesagten zu erforschen, wandte sich Fred an seinen kleinen Bruder: „Ron-Baby, welchen Arzt hast du verständigt wegen Sly?“
Ron nannte daraufhin einen Namen, und Fred seufzte. „Das ist unser Zahnarzt in Sandl. Ach, Ron!“
„Kein Problem!“, sagte Reinhard Waldenberger und holte ein Handy aus seinem Anzug. „Bei unseren Veranstaltungen muss sowieso immer ein Arzt anwesend sein, ist nicht meine Idee, so sind nun mal die Vorschriften, der soll einmal was tun für sein Geld.“ Er wählte eine Nummer und sprach dann einige Worte ins Handy hinein.
Plankton war unterdessen an die Seite der Frau getreten, die noch immer neben dem Toten kniete, und hatte ihr sanft die Hände auf die Schultern gelegt. Wenn sie kniete, war sie ja immerhin kleiner als er, solange er stand.
„Frau, äh, wie auch immer“, sagte er mit einschmeichelnder Stimme, „Sie sollten sich nicht länger diesem Anblick aussetzen. Das verfärbte Gesicht … die aufgerissenen Augen … die aufgequollene Zunge …“ Er suchte den Körper des Toten nach weiteren schaurigen Details ab, die die Frau möglicherweise veranlassen konnten, vom toten Sly Slender abzulassen und sich ihm – dem höchst lebendigen Rupert Plankton – zuzuwenden. „Nehmen Sie jetzt Abschied von Ihrem Idol, und behalten Sie ihn in Erinnerung, so wie er im Leben war – voll Leben … lebendig … lebhaft … lebensfroh …“
Die Frau erhob sich tatsächlich, wodurch Plankton gezwungen war, die Hände wieder von ihren Schultern zu nehmen. Diese Aktion begleitete er mit den Worten: „Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Rupert Plankton.“
„Ich weiß schon, der Koch mit den Eiern“, sagte sie. Plankton zuckte zusammen, und auch sein FES überlegte einen weiteren Punkteabzug, wobei die Mundgeruchskomponente dafür allerdings keine Begründung lieferte.
In diesem Moment trat der Veranstaltungsarzt zu ihnen.
„Na, wo ist denn unser Patient?“, fragte er fröhlich, und als alle noch lebenden Anwesenden auf den am Boden Liegenden deuteten, trat er zu diesem, warf einen Blick auf ihn und fragte: „Hat schon wer die Polizei gerufen?“
„Die Polizei? Wieso?“
„Na, zieht man nicht üblicherweise die Polizei bei, wenn jemand vergiftet wurde?“
2. Kapitel
In einer Entfernung von 727,52 Kilometern Luftlinie von der Linzer Eishalle – in einer Stadt, die hier zur Erhöhung der Spannung noch nicht genannt werden soll – beugte sich Gioacchino Rissoni in einem unscheinbaren Haus in der Via della Madonna di Riposo, etwa einen Kilometer westlich der Vatikanstadt, über den im Bett vor sich hin röchelnden Mann.
Wenn Gioacchino Rissoni verreiste, was in Anbetracht seines Alters nicht mehr recht häufig vorkam, und er in einem Hotel den Anmeldezettel ausfüllte, musste er bei der Frage nach dem Beruf, wenn er diese wahrheitsgemäß beantwortete, nicht „Pensionist“, sondern „Kardinal“ eintragen. Und wenn genug Platz in dem Kästchen war, schrieb er auch schon mal voll Stolz hin: „Vatikanischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche“.
Kardinal Rissoni, der in Anbetracht seiner Vorliebe für ein Kaffeegetränk namens Cappuccino von den Tratschweibern und -männern im Vatikan auch Cardinale Cappuccino genannt wurde, hatte vor etwa einem halben Jahr ein paar Kilo innerhalb kürzester Zeit abgenommen und dann fast dieselbe Menge ebenso radikal wieder zugelegt. Diese Abspeck- und Zunehmprozedur war allerdings nicht Ergebnis einer Fastenkur samt anschließendem Jojo-Effekt, nein, man hatte dem an der Zuckerkrankheit leidenden Rissoni den rechten Fuß abnehmen müssen, wodurch er von einem Moment auf den anderen einige Kilo verloren hatte – leider an der falschen Stelle, denn der Schwimmreifen in der Bauchgegend war geblieben. Da die vatikanische Krankenversicherung für Kardinäle bessere Leistungen vorsieht als alle 22 österreichischen Sozialversicherungsträger zusammen, hatten ihm die vatikanischen Orthopäden in Windeseile eine hochmoderne, alle Stücke spielende Prothese verpasst, die sein Gesamtgewicht allerdings wieder in die Höhe schnellen ließ. Mittlerweile kam der Kardinal mit der Prothese ganz gut zurecht. Wenn er nicht gerade bei dem von der Schweizergarde geleiteten Morgensport für Kardinäle mitmachte (zweimal quer über den Petersplatz laufen, mit je einer Verschnaufpause beim Obelisken), merkte man gar nicht, dass er nur mehr einen echten Fuß besaß.
Eine Ordensschwester näherte sich dem Kardinal. Sie wartete gehorsam, bis er sie aufforderte zu sprechen, was er auch tat, nachdem er mit der Hand die Stirn des im Bett liegenden Mannes gefühlt hatte.
„Heute Nachmittag hatte er fast 40 Grad Fieber“, sagte die Schwester auf die Frage des Kardinals, wie der Tag verlaufen war. „Und er war sehr unruhig. Aber jetzt geht es ihm wieder besser. Wahrscheinlich macht das Eure Anwesenheit, Eminenz.“
„Wahrscheinlich.“
An dieser Stelle meldet der Simultandometsch, der vom Verlag dankenswerterweise beigestellt wurde, damit der Leser auch jene Stellen, die in der Stadt spielen, deren Name noch nicht genannt werden soll, sofort versteht und sich nicht erst ein Italienisch-Wörterbuch zulegen muss, wobei von den vielen auf dem Markt befindlichen jenes empfohlen werden kann, das … äh … Faden verloren, Satz zurück an den Anfang! An dieser Stelle meldet der Simultandolmetsch, dass Unterschiede in der Sprachmelodie der beiden italienisch sprechenden Personen bestehen. Während der Kardinal mit (Zitat Dolmetsch) „butterweichem, glasklarem Hochitalienisch“ spricht (wie er das aus einem einzigen gesprochenen Wort schließen kann, ist dem Autor ein Rätsel, aber gut), findet sich laut Dolmetsch im Italienisch der Frau ein leichter englischer Akzent. Dem Herrn Dolmetsch sei erklärt (was für die Handlung dieses Kapitels ohne jede Relevanz ist, sodass der eilige Leser diesen Absatz gern überspringen darf), dass der Akzent der Frau auf ihr Geburtsland Großbritannien hindeutete. Sie war erst seit etwa 15 Jahren im Orden, und da sie vorher viel in der Welt herumgekommen war, besaß sie ein natürliches Sprachentalent und hatte bald nach der Aufnahme in den Orden perfekt Italienisch gelernt, sodass ihr Akzent kaum mehr vernehmbar war. In den Orden war sie übrigens aufgrund einer unglücklichen beziehungsweise zukunftslosen Liebesaffäre mit einem Österreicher (!) eingetreten. So viel an Informationen für den Herrn Dolmetsch.
„Aber auch Ihre Pflege, Schwester Nadia“, sagte der Kardinal salbungsvoll, „wird dafür sorgen, dass Bruder Silve bald wieder genesen wird.“
„Hoffen wir es. Schließlich ist er schon Mitte 70 …“
Der Kardinal zuckte kurz zusammen, als er daran dachte, dass er etwa im selben Alter war wie der Mann, der vor ihm im Bett lag und nun endlich eingeschlafen war und ruhige Atemzüge von sich gab.
„Und wie geht es Ihnen hier, abseits der gewohnten Umgebung?“, erkundigte sich der Kardinal.
„Danke der Nachfrage, Eure Eminenz“, sagte Schwester Nadia. „Aber wer bin ich, dass ich es wagen dürfte, mich zu beschweren?“
Der Kardinal seufzte. „Ich weiß, ich weiß, in der alten Unterkunft war es geräumiger, ruhiger. Aber die Umstände haben eine Übersiedlung notwendig gemacht – eine hoffentlich nur vorübergehende Übersiedlung …“
„Ich bin die Magd des Herrn“, sagte Schwester Nadia mit einem leichten Knicks, „und mir geschehe …“
„Ja, ja“, winkte der Kardinal ein wenig ärgerlich ab. Er mochte diese demütigen Frauen nicht. Er hatte die lieber, die ein wenig aufbegehrten, die reschen ... Schwester Letizia etwa, die zwar 15 Jahre älter war als er, aber damals, als er in den Vatikan gekommen war, o, là, là! Schwester Nadia war ja, obwohl das in ihrer Tracht nicht zum Ausdruck kam, eine attraktive Frau, jedenfalls war sie das zum Zeitpunkt ihres Eintritts in den Orden gewesen, aber diese Untertänigkeit, die sie sich dann angewöhnt hatte … Aber egal wie schön die Frau war oder irgendwann einmal gewesen war, jetzt war sie auch schon über 50, und das war für Cardinale Cappuccino entschieden zu alt.
„Ich gehe jetzt“, sagte der Kardinal und reichte der Ordensfrau die rechte Hand, die diese küsste. „Halten Sie mich über den Gesundheitszustand unseres geliebten Bruders Silve auf dem Laufenden. Und wenn er dann wieder gehfähig ist, sorgen Sie dafür, dass er sich unbedingt die Haare schneiden lässt, so schaut er ja aus wie ...“ Ihm fiel offenbar kein passender Vergleich ein, sodass er den Satz unbeendet ließ und die Tür hinter sich schloss.
Grimmig schaute er in den Himmel. Es goss wie aus Kübeln. Schon seit ein paar Tagen regnete es beinahe ununterbrochen. Das war ja wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum sich Silve diese starke Grippe eingefangen hatte. In letzter Zeit achtete Silve, der geistig immer mehr abbaute, nicht auf derartige Kleinigkeiten wie Witterungsverhältnisse, oft verließ er nicht dem Wetter entsprechend gekleidet und manchmal sogar ohne Schuhe das Haus, was ihm ja eigentlich untersagt war. Aber sollte er ihn einsperren, anketten? Rissoni zog eine Grimasse. Wenn sich Silve weiterhin so unangemessen benahm und die Sicherheit des Ordens gefährdete, war es vielleicht wirklich unumgänglich, ihn in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Der Kardinal winkte seinem Sekretär zu, der vor dem Haus mit der vatikanischen Limousine auf ihn wartete. Während der Kardinalssekretär aus dem Auto sprang und einen Schirm aufspannte, meldete Rissonis Handy mit einem Klingelton (Händels Halleluja) das Einlangen einer SMS. Er sah auf das Display. Wer schickte ihm so spät am Abend noch eine Mitteilung, noch dazu auf das Handy, dessen Nummer nur ein paar Eingeweihte wussten? Er entzifferte die Nummer, die als Absender aufschien, und erkannte augenblicklich, wer ihn da so spät noch belästigte. Richtig, war heute nicht der Tag des Linzer Eiszaubers, wo vorgesehen war, dass … Er überlegte nicht lange weiter, sondern drückte die Taste, die ihm den Text der Mitteilung anzeigte.
Der Text bestand nur aus einem einzigen Zeichen. Dem verabredeten Zeichen. Einem Smiley.
Die Aktion in der Linzer Eishalle war also gelungen, der Feind geschlagen, die Gefahr abgewendet.
Und während Kardinal Gioacchino Rissoni unter den von seinem Sekretär dargebotenen Schirm schlüpfte, zog sich über sein Gesicht ein Grinsen, dem Smiley auf seinem Handy nicht unähnlich …
3. Kapitel
Als Oberinspektor Rätisch schwungvoll den Vorhang zur Seite schob, der den Backstagebereich von der Bühne trennte, sah ihn die Achtpersonengruppe, die rund um einen Campingtisch platziert war, erwartungsvoll an.
Die fünf Vier fidelen Sandler, Rupert Plankton, Reinhard Waldenberger und die Dame, die sich als größter lebender Fan des vor Kurzem verstorbenen Sly Slender geoutet hatte, hatten jede(r) einen Becher Kaffee vor sich, den irgendeiner der ORF-Crew von irgendwo hergeholt hatte, aber niemand getraute sich, davon auch nur einen Schluck zu trinken. Die Nachricht des Veranstaltungsarztes, dass Sly Slender offenbar genau an dieser Stelle vergiftet worden war, hatte sie so geschockt, dass sie hier keinerlei Nahrung – egal ob in fester oder flüssiger Form – zu sich nehmen wollten, und daher stand die braune Brühe unangetastet vor ihnen auf dem Tisch und kühlte langsam aus. Schade drum.
Die Frau hatte nach der ärztlichen Vergiftungsinformation mit der Bemerkung „Na, dann will ich nicht länger stören“ gehen wollen, aber Reinhard Waldenberger, der sich für alle Vorgänge rund um den Eiszauber verantwortlich fühlte, hatte gemeint, sie hätte den toten Sly zuvor möglicherweise berührt und daher sollte sie dableiben, bis ihr die Polizei die Fingerabdrücke abgenommen hätte, Spurensicherung und so. (Waldenberger hatte in seinem Leben schon sehr viele Krimis gesehen.) Die Frau hatte sich dieser, wenn schon nicht behördlichen, so zumindest ORF-lichen (und somit quasi behördlichen) Anordnung gefügt, und nun wartete sie gemeinsam mit den sieben Männern auf das Eintreffen der Polizei.
Immerhin hatte sie, bevor sie sich alle an den Tisch gesetzt hatten, den Mantel abgelegt und dadurch Planktons FES zu einem vorläufigen provisorischen Endergebnis verholfen. Die ursprünglichen sieben Punkte für Gewicht und Figur hatten sich auf neun verbessert. Die Frau war schlank, aber nicht zu schlank, und hatte Rundungen an genau den Stellen, an denen sie laut Planktons Meinung (und der von weiteren zirka 3,5 Milliarden Männern) vorhanden sein sollen.
Dummerweise war es Plankton bisher nicht gelungen, das Gespräch an sich zu reißen, denn Fred – der wie früher schon einmal erwähnt um fünf Minuten Ältere der beiden Wiesli-Zwillinge – flirtete ungeniert mit der doch im Vergleich zu ihm um ein paar Jährchen älteren Frau. Zu Planktons Freude hatte diese allerdings noch keine Anzeichen gezeigt, auf das Geflirte des Sandlers einzugehen. Schließlich hatte sie soeben ihr musikalisches Idol verloren und schien allein deshalb nicht aufgelegt für Frivolitäten nach Mühlviertler Art.
„Sie erinnern mich an die göttliche Veronica Ferres“, gurrte Fred Wiesli gerade, als der Oberinspektor die Szene betrat und versuchte, sich in dem für ihn ungewohnten Terrain zu orientieren, „natürlich an die Veronica Ferres von vor 15 Jahren. Groß, schön, vollbusig, blond, langhaarig, ein Gesicht zum Abbusseln und ohne jedes Wimmerl …“
In Plankton stieg der Verdacht auf, dass Fred Wiesli urheberrechtswidrig sein Fraueneinstufungssystem verwendete, weil er exakt dieselben Faktoren wie sein FES (und auch Schwarzeneggers WQS) anführte. Plankton fragte sich erstens, ob der Volksmusikant noch „mundgeruchlos“ dazufügen würde, und zweitens, ob er sein FES patentieren lassen sollte, um es vor weiterer unerlaubter Verwendung zu schützen, als sein Blick auf den Polizeibeamten fiel.
„Ja, das ist doch …“, sagte er und stand langsam auf. „Sind Sie’s … bist du’s wirklich? Theo?“
Der auf diese Weise Angesprochene wandte seinen auf der Suche nach der Leiche befindlichen Blick zu Plankton. Er runzelte die Stirn, dann hellte sich sein Gesicht auf und er fragte: „Ruppi? Du?“
„Theo! Du!“, erntete er als Antwort.
Die beiden Männer gingen aufeinander zu und umarmten sich lachend.
„Nach so vielen Jahren!“
„Ich hab dich gleich erkannt“, behauptete Plankton. „Schließlich sind wir in der Volksschule nebeneinander gesessen.“
„Genau. Erinnerst du dich noch an unsere Lehrerin, die … Dings …“
„Ja, natürlich. Und unser Religionslehrer, der … Dings …“
Sie lachten wieder, dann fragte der Polizist: „Und – was treibst du so beruflich? Damals wolltest du Astronaut werden, ist daraus was geworden?“
Planktons Miene versteinerte sich. War es möglich, dass dieser Polizist, sein Freund aus den frühen 1970er-Volksschultagen, dieser Idiot, nicht wusste, dass er – Rupert Plankton – der Welt berühmtester Speisologe war?
„Ich bin Speisologe“, sagte er mit kalter Stimme. „Der Speisologe.“
„Na ja, auch nicht schlecht“, gab der Inspektor zurück, „na, und ich bin bei der Polizei gelandet. Bei der Moko Linz.“
„Ja, du warst schon damals immer der Dümm ... äh ... Dünnste in der Klasse“, bemerkte Plankton. „Äh, Moko? Der Eidechsen-Gott in der polynesischen Mythologie?10 Oder dieses putzige Felsenmeerschweinchen?“11
„Weder noch. Mordkommission“, erklärte Oberinspektor Rätisch die Abkürzung. „Und leider befinde ich mich augenblicklich im Dienst“, wurde er förmlich. „Sonst könnten wir einen trinken gehen, um auszumachen, wann wir uns einmal treffen, um einen trinken zu gehen. Ein verdächtiger Todesfall bei einem gewissen …“ Er sah auf einen Zettel, den er eingesteckt hatte. „Sly Slender. Soll angeblich irgendein Sänger gewesen sein.“
Plankton schüttelte den Kopf. War es möglich, dass dieser Polizist überhaupt keine prominenten Leute kannte? Ihn nicht, Sly Slender nicht …
„Ja, ich weiß“, sagte Plankton. „Ich bin heute mit ihm aufgetreten.“
„Du mit ihm?“, wunderte sich Rätisch. „Ich wusste gar nicht, dass du singst. Aber als – wie hieß das? – Speibologe muss man wohl auch singen können.“
„Nicht direkt mit ihm“, klärte Plankton das Missverständnis auf und setzte den Kriminalbeamten auch kurz über die weiteren Umstände in Kenntnis – seinen Gramastettner-Krapferl-Wettbewerb und dass Sly Slender offenbar nach dem Verzehr eines von ihm gebackenen Krapferls gestorben war.
„Dann werde ich dich wohl nachher verhaften müssen“, sagte Rätisch. „Ich muss dich daher bitten, die Eishalle nicht ohne meine Erlaubnis zu verlassen. Doch zuerst will ich mir die Leiche anschauen. Du kannst gern mitkommen, sofern du nichts angreifst. Und sofern du mit deinen Plüschpantoffeln den Weg bewältigst.“
Die zwei begaben sich zum Gerichtsmediziner, einem enorm dicken Mann weit über 60, der über die Leiche gebeugt war und sich nun mühsam erhob und den beiden Männern die Hand reichte.
„Ah, Doktor Jatzosch!“, sagte Rätisch zur Begrüßung. „Dass Sie einmal vor mir am Tatort sind!“
„Reiner Zufall“, gab der Gerichtsmediziner schwer atmend zur Antwort. „Ich hatte mir mit meiner Sekretärin den Eiszauber angeschaut und war gerade in der Tiefgarage, um mit ihr zu ihr zu fahren, um dort mit ihr in ihr … also, na ja, das tut hier wohl weiter nichts zur Sache, und was noch nicht ist, kann ja noch werden … äh … ich war also gerade keine 200 Meter von hier entfernt in der Tiefgarage, als ich wegen dieses Todesfalls angepiepst wurde, sodass ich Ihnen gegenüber einen gewissen Tatortanreisevorteil hatte. Sie machen sich ja nach wie vor nichts aus derartigen Veranstaltungen, bei denen Prominente auftreten?“
„Ganz recht. Ich kann ganz gut ohne Stars und ohne Fernsehen leben. Und dieser Sly Stender ...?“ Er wies auf den Toten.
„Slender“, verbesserte ihn Dr. Jatzosch. „Dass es so was gibt … Die ganze Welt kennt Sly Slender, nur Sie offenbar nicht!“ Er schüttelte ungläubig den Kopf. „Selbst in China ist er aufgetreten und ein Star. Aber gut. Mr. Sly Slender wurde ohne jeden Zweifel vergiftet, und das Gift wurde ihm wohl mittels eines Gramastettner Krapferls zugeführt. Die Symptome deuten eindeutig auf eine Vergiftung hin. Beachten Sie nur die aufgequollene Zunge, die Verfärbung des Gesichts, die Erweiterung der Pupillen, die Verkrümmung der Nasenhärchen … Na, und die Reste der Tatwaffe liegen ja noch auf seiner Zunge. Ich würde anregen, dass Sie die dann einpacken lassen zwecks näherer Untersuchung.“
An dieser Stelle soll – nach dem Motto „Ehre wem Ehre gebührt“ – nicht unerwähnt bleiben, dass Univ.-Prof. Prim. DDr. Ferdinand Jatzosch trotz seines gewichtsmäßig bedingten eher behäbigen Auftretens eine über die engen Grenzen Oberösterreichs weit hinaus anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin war. Seine im Internet live übertragenen Obduktionen12 waren legendär. Wenn er eine Leiche aufschnitt und aus dem in ihr Vorgefundenen Rückschlüsse zog, hatte das vor Gericht Gewicht – fast so viel Gewicht wie der Mediziner selbst. Er war gewissermaßen ein Aufschneidologe.
„Also vergiftet“, resümierte Oberinspektor Rätisch.
„Ja. Der Tod ist in den letzten zwei bis maximal zweieinhalb Stunden eingetreten.“
„Äh, in den letzten zwei bis zweieinhalb Stunden? Aber, Doc … Vor einer halben Stunde ist dieser Mann noch aufgetreten … Hunderte, Tausende, wenn nicht Hunderttausende haben ihn auf der Bühne gesehen! Dann ist er von der Bühne gegangen und sechseinhalb Minuten später – um Punkt 21 Uhr 19 – war er tot.“ Diese Informationen hatte der Oberinspektor vorweg erhalten, als er zum Tatort gerufen worden war.13
„Ja, das mag schon sein, ich hab ihn ja selbst gesehen, wie er auf seine unvergleichliche Weise Love Me Tender gesungen hat – obwohl ich nicht ganz verstanden habe, was am Vorratsbehälter einer Dampflokomotive so liebenswert sein soll –, aber vom medizinischen Standpunkt her muss ich den Todeszeitraum auf zwei bis maximal zweieinhalb Stunden eingrenzen.“ Er sah auf seine Armbanduhr. „Beziehungsweise mittlerweile schon zwei bis zweieinhalb Stunden und eine Minute.“
„Danke, Doc“, sagte Rätisch und winkte seinen polizeilichen Mitarbeitern, die schon ungeduldig darauf warteten, endlich die Spuren sichern zu dürfen. Dann machte er sich mit Plankton, der dem Gespräch zwischen ihm und dem Gerichtsmediziner schweigend zugehört hatte, auf den Weg zurück zu dem Tisch, an dem die Frau und die sechs Männer weiterhin vor ihrem mittlerweile gänzlich erkalteten Kaffee saßen. Leise fragte er ihn: „Von den Leuten, mit denen du zuvor am Tisch gesessen bist – sollte ich von denen einen unbedingt kennen?“ Und noch bevor Plankton antworten konnte, schoss er eine zweite Frage nach: „Und warum sind die fünf Männer gleich und noch dazu so komisch angezogen?“
Plankton klärte seinen ehemaligen Schulfreund und nunmehrigen Kriminalinspektor auf, um wen es sich bei den fünf Gleichgekleideten handelte und dass die einzelnen Mitglieder einer Volksmusikgruppe üblicherweise die gleiche Tracht trugen. Er verwies auf diesbezügliche – was die Gleichbekleidung beziehungsweise Gleichbetrachtung betraf – Präzedenzfälle wie die Stoakogler, die Kastelruther Spatzen und den Innergebirg Viergsang aus dem salzburgerischen Pongau, deren einzelne Mitglieder man aufgrund ihrer identen Bekleidung ebenfalls nur schwer auseinanderhalten konnte (wobei allerdings weder die einen noch die anderen dem Inspektor bekannt waren), und sagte dann: „Die Frau stieß erst nachher zu uns, als Sly schon tot auf dem Boden lag. Sie ist ein Fan von ihm und wollte nur ein Autogramm. Und der eine Mann, der nicht zu den Fidelen Sandlern gehört, das ist Reinhard Waldenberger, der Moderator des Eiszaubers.“
„Aha, darum ist er wohl auch als Einziger so halbwegs normal angezogen.“ Beiläufig fiel sein Blick auf Planktons Plüschpantoffeln. „Sehr gut, alles klar. Äh … Moderator? So was wie der Armin Assinger?“
Plankton atmete auf. Es gab also doch einen Prominenten, der Rätisch nicht völlig unbekannt war. Und auch der Beruf des Moderators war ihm offenbar geläufig. „Ja, genau! Dass du den kennst?“
„Ja, natürlich. Schließlich sind wir Kollegen.“
„Du bist auch Moderator?“, wunderte sich Plankton.
„Wie? Wieso? Nein, er ist auch Polizist. Oder Gendarm, wie das früher hieß. Bei irgendeinem Gendarmerieseminar in den 1990er-Jahren hab ich ihn kennengelernt. Er hat damals angekündigt, dass er unbedingt zum Fernsehen und Moderator werden will. Ich hab ihm schon damals gesagt, dass das nichts wird – mit so einem ausgeprägten Kärntner Dialekt ... Ich hab ihn allerdings schon lange nicht mehr gesehen, an Polizeiseminaren nimmt er jedenfalls nicht mehr teil.“
Plankton rollte mit den Augen. „Hast du noch nie von der Millionenshow gehört?“, fragte er, und als Rätisch verneinte, meinte er: „Das gibt’s doch nicht, dass jemand so fern von jeder Zivilisation aufwächst. Dass du keinen einzigen Prominenten kennst! Nicht einmal die Sarkissova?“
„Ich mach mir halt nichts aus Promis, kann ganz gut ohne sie leben“, sagte Rätisch trotzig, um sich dann doch neugierig zu erkundigen: „Wer war denn der berühmteste Promi, den du in deinem Leben kennengelernt hast?“
Mittlerweile waren sie fast schon beim Campingtisch angekommen, wo Waldenberger für ein wenig mehr Action gesorgt hatte, indem er – es wird ein ewiges Rätsel bleiben, woher – eine Flasche Whisky, originalverschraubt, hervorgezaubert und mit den Worten „Wenn sich schon keiner über den Kaffee drübertraut, muss halt eine Alternative her“ auf den Tisch gestellt hatte. Er war gerade dabei, die Flasche aufzuschrauben, um die bernsteinfarbene Flüssigkeit in sieben Pappbecher zu gießen, als Plankton auf Rätischs letzte Frage antwortete: „Ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Vielleicht der Papst.“
„Du kennst den Papst?“, war Rätisch beeindruckt, wobei Plankton nicht minder beeindruckt war, dass Rätisch offenbar auch schon einmal vom Papst gehört hatte.
„Nicht den aktuellen. Aber zur Zeit des Pontifikats von Johannes Paul II. hatte ich einmal von einigen Mitgliedern des vatikanischen Kardinalskollegiums den streng geheimen Auftrag, herauszufinden, welche Zutaten der Papst für seine Oblaten verwendete, die er zu Ostern zur Heiligen Kommunion spendete. Da war nämlich eine geheimnisvolle Zutat mit hineingebacken, die dafür sorgte, dass jeder, der mehr als eine aß, in eine Art Rauschzustand …“
„Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber mich interessieren eher die geheimnisvollen Zutaten, die in deine Gramastettner Krapferln geraten sind.“
„Aha, natürlich, klar. Jedenfalls bin ich damals undercover im Vatikan ein und aus gegangen und habe dabei natürlich auch den Papst kennengelernt. Stell dir vor, er glaubte bis zu seinem Tod, dass ich der neue Küchenchef in der Kardinalskantine wäre!“ Da sie bereits vor dem Tisch standen, an dem die acht Personen gerade Bruder- beziehungsweise Schwesternschaft tranken, beschloss Plankton, das Thema Vatikan nicht näher zu vertiefen und stattdessen die Vorstellung der handelnden Personen zu übernehmen: „Darf ich bekannt machen: Reinhard Waldenberger, die fünf Vier fidelen Sandler und Frau ... äh ... Dings – Oberinspektor Theo Rätisch von der Moko Linz.“
„Theoretisch?“ Waldenberger warf, einigermaßen überrascht, einen zweifelnden Blick in seinen bereits zu 90 Prozent geleerten Becher. Üblicherweise spürte er Alkohol nicht so schnell. „Sie sind nur theoretisch Oberinspektor? Und praktisch? Was sind Sie praktisch?“
„Theophil Rätisch“, wiederholte der Oberinspektor grimmig seinen Namen. „Theo dürfen nur meine Freunde zu mir sagen.“
„Oh, verstehe. Und Moko? Die bronzene sanduhrförmige Ritualtrommel der ostindonesischen Insel Alor?“14
„Nein, Mordkommission.“
„Aha. Okay. Kommen Sie, Herr Mordkommissar, setzen Sie sich zu uns. Auch ein Becherchen?“
„Nein, danke, ich bin im Dienst.“
„Ich eigentlich auch“, schoss es Waldenberger schlagartig durch den Kopf. „Daher … Könnten wir das rasch hinter uns bringen? Wir müssen auch noch alles abbauen, hier staubsaugen und die Spiegel putzen und die Vorhänge waschen und all das und dann rasch zur After-Show-Party … Wobei mir gerade einfällt, dass wir den Platz und das Essen für Sly wohl stornieren müssen …“ Er griff nach seinem Handy, um in dem Restaurant, in dem die Teilnehmer am Eiszauber die gelungene Veranstaltung nachfeierten, anzurufen, dass ein Gast umständehalber auf ewig ausfiel.
„Später“, sagte der Polizist streng, und Waldenberger steckte sein Handy unverrichteten Anrufs wieder ein. „Sie sind also der Moderator des Eiszaubers? Herr Reinhard Waldenberger?“
„Ganz recht. Ich bin noch immer ganz erschüttert über Slys Tod. Gerade noch sang er Love Me Tender ...“
„Als Sie nach Ihrer Moderation hierher zurückkamen, war er schon tot?“, unterbrach ihn Oberinspektor Rätisch, darauf bedacht, die Ermittlungen zügig voranzutreiben.
„Ja. Die Fidelen Sandler haben ihn offenbar sterben gesehen.“
Rätisch lenkte sein Interesse sofort auf die Volksmusikanten. „Wer kann mir Genaueres berichten?“
Alle fünf Männer begannen gleichzeitig zu sprechen, sodass Rätisch die Hand hob. „Einer nach dem anderen bitte. Vielleicht Sie als Erster?“ Er sah den Bärtigen an. Männer mit Bart waren immer verdächtig.
„Ich? Na gut. Gern. Also, so um dreiviertel neun hatten wir unseren Auftritt mit unserem Hit An so an Sandler, den kennen Sie sicher …“ Schorsch summte den Refrain an, setzte aber, als Rätisch eine ungeduldige Geste machte, rasch fort: „Im Anschluss daran sind wir hierher hinter die Bühne. Wir haben dem ORF-Backstage-Reporter, der für die Seitenblicke ein paar Aufnahmen machte, ein Interview gegeben, dann …“
„Dann hat der seine Kamera weggestellt“, fiel sein Zwillingsbruder Fred ein, „und ist gegangen, ein Bierchen zischen, wie er sagte, und wir waren einige Zeit allein hier.“
„Wir haben uns hierher an diesen Tisch gesetzt“, erzählte Percy weiter, „und unseren Auftritt kritisch hinterfragt. Fred hatte nämlich in der fünften Strophe in der dritten Zeile einen Texthänger …“
„Stimmt nicht“, wehrte sich Fred. „Die dritte Zeile reimt sich nicht richtig mit der ersten, und daher hab ich ein kurzes Überlegungspäuschen eingefügt, das möglicherweise eventuell vielleicht ein klein wenig wie ein Hängerchen gewirkt haben mag …“
„Egal“, mischte sich Rätisch leicht ungehalten und schwer ungeduldig in den Bruderzwist ein. „Was war weiter? Wann kam Sly Slender hinter die Bühne?“
„Nachdem tobender Jubel sein Eigen geworden war, betrat der Hochgelobte stolzerfüllt den staubigen Boden hinter den knarrenden Brettern, die das Universum der Welt bedeuten“, antwortete Ron, und Percy sagte zu ihm: „Bitte, Ron, lass mich weitererzählen, sonst werden wir hier nie fertig. Also, nachdem er hier hereinkam, winkte er uns zunächst einmal zu und zog sein Jackett aus, das er dort auf den Sessel hängte.“ Der Wiesli-Musikus deutete auf den Platz, wo tatsächlich ein Jackett hing, das der Größe und dem Aussehen nach zu Sly Slender passte. „Dann setzte er sich hin.“
„Zu Ihnen?“, fragte Rätisch.
„Nein, nicht zu uns. Ich glaube, er wollte uns in unserer Auftrittsbesprechung nicht stören. Ja, er war ein sensibler Künstler, der selige Sly Slender. Nein, er setzte sich in den Sessel, vor dem er jetzt noch liegt.“
„Und dann? Wie kam er zu dem Gramastettner Krapferl?“
„Das weiß ich nicht“, sagte Percy. „Da hab ich nicht darauf geachtet.“
„Hat er es sich vom Blech geholt?“
Synchrones Schulterzucken von fünf fidelen Männerkörpern war die Antwort.
„Aufgestanden ist er schon irgendwann einmal“, sagte Fred.
„Und herumgegangen.“
„Kann schon sein, dass er sich vom Blech ein Krapferl holte.“
„Als ich mir noch eines holen wollte, war das Blech jedenfalls schon leer“, berichtete Percy. „Zu der Zeit begann Sly schon mit dem Jammern.“
„Ich dachte mir noch, ihm ist das Krapferl im Hals stecken geblieben“, erwähnte Fred. „Die Krapferln sind ja recht bröselig, man braucht unbedingt was zum Trinken dazu, und daher hab ich ihn gefragt, ob ich ihm was zum Runterspülen bringen soll.“
„Sie haben mit ihm vor seinem Tod noch gesprochen?“, hakte der Kriminalbeamte sofort ein. „Und? Was hat er gesagt? Wollte er etwas zu trinken?“
„Ja, er wollte Tee“, sagte Fred. „Ich hatte aber keinen Tee bei mir. Ja, Jägermeister hätte ich ihm einen geben können, eventuell auch Rum, oder Rum mit Jägermeister gemischt, aber Tee …“
„Er wollte Tee?“, wunderte sich Rätisch.
„Ja“, bestätigte Fred. „Ich war auch etwas erstaunt über diesen Wunsch. Erstaunt und auch ein wenig verärgert.“
„Verärgert? Wieso verärgert?“
„Weil Slys Bestellung so unexakt formuliert war. Schließlich gibt es so viele Sorten Tee, und woher sollte ich wissen, was für einen Tee er wollte! Da gibt es schwarzen Tee, grünen Tee, blauen Tee … Fragen Sie mal unseren Speisologen, wie viele Teesorten es gibt!“
Noch bevor sich der Kriminalbeamte weigern konnte, den Speisologen nach der Anzahl der Teesorten zu fragen, griff Plankton, der kurz (aus Gründen, die später noch erklärt werden) abgelenkt gewesen war und dem Gespräch zwischen dem Polizisten und den Fidelen Sandlern





























