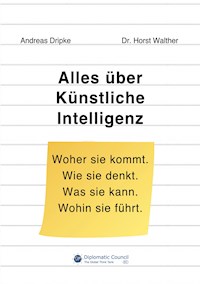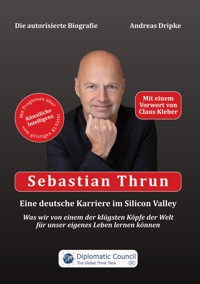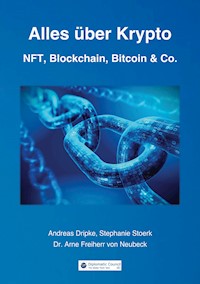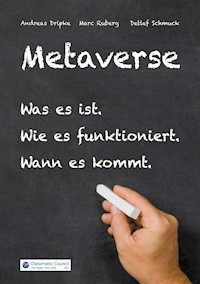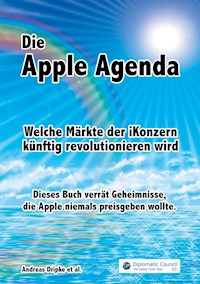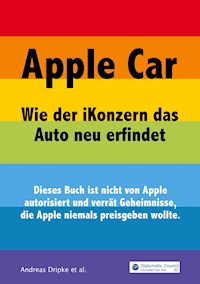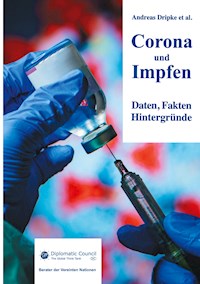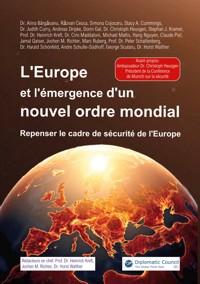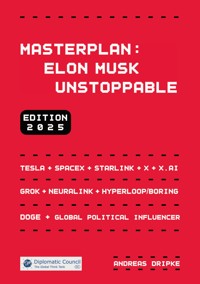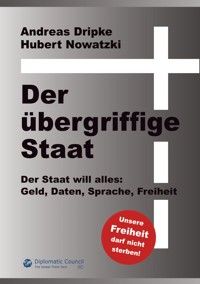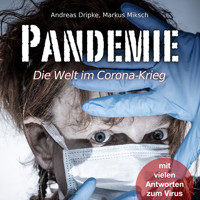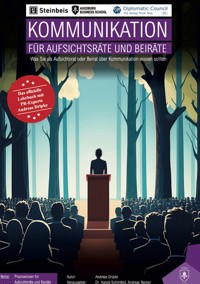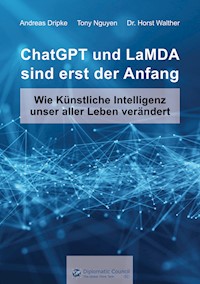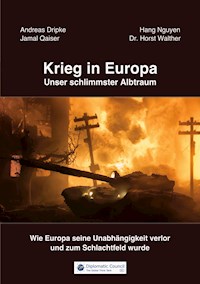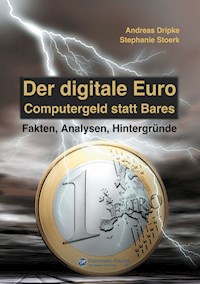
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 14. Juli 2021 stellte die Europäische Zentralbank EZB den digitalen Euro offiziell vor. Die Ankündigung erfolgte klammheimlich, mitten in der Corona-Pandemie, in der Urlaubszeit und während der Fußball-EM, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei handelt es sich beim digitalen Euro um eine der fundamentalsten Änderungen der gemeinsamen Währung aller 26 Staaten der Europäischen Union. EZB und EU-Kommission geben sich seitdem alle Mühe, den digitalen Euro kleinzureden. Selten wurde die Bevölkerung der Euro-Zone derart dreist über die Zukunft ihrer Währung getäuscht. Die Autoren des vorliegenden Buches vertreten die Auffassung, dass die Menschen in Europa ein Recht haben zu wissen, was auf sie zukommt. Sie öffnen daher den Vorhang der Verharmlosung durch die offiziellen Stellen und werfen einen detaillierten Blick hinter die Kulissen. Dabei nehmen sie nicht nur die Ankündigung des digitalen Euro genau unter die Lupe, sondern decken auch die Hintergründe, die mutmaßlich dahintersteckende Technologie und vor allem die möglichen Auswirkungen auf. Was dabei zum Vorschein kommt, ist erschreckend. Die Abschaffung des Bargelds steht fest. Mit der Digitalisierung der Währung wird das Finanzgebaren der Bevölkerung bis ins kleinste Detail vollkommen transparent. Es ist ein Riesenschritt hin zum gläsernen Bürger. Die Beteuerung der EZB, der digitale Euro hätte nichts mit Kryptowährungen wie etwa Bitcoin zu tun, ist purer Hohn. Ganz im Gegenteil gehört der digitale Euro zu einem ganzen Maßnahmenbündel, um das herkömmliche Prinzip der Staatswährungen vor dem Angriff der Kryptowelle zu schützen. Denn der Bitcoin wurde als Inbegriff des Misstrauens gegen staatliche Zentralbanken wie die EZB ins Leben gerufen. Im digitalen Euro manifestiert sich der Versuch der Staatsbanken, ihre Vorherrschaft über unser Geld in die digitale Welt zu retten. Ob das gelingt, ist ungewiss. Der digitale Euro ist somit das größte Experiment mit unserer Währung seit ihrer Einführung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Beruhigungspille statt Aufklärung
Bargeld wird sukzessive abgeschafft
2100 ist der Euro nichts mehr wert
Der digitale Euro hat etwas mit Krypto zu tun
TEIL 1: VORSTELLUNG/ANALYSE
Der digitale Euro kommt!
Warum ein digitaler Euro?
Welche weiteren Vorteile hätte ein digitaler Euro?
Wann wird es so weit sein?
Wie geht es weiter?
Wie könnte ein digitaler Euro aussehen?
Wird ein digitaler Euro von der EZB verwaltet?
Warum wäre ein digitaler Euro kein Krypto-Asset?
Ein neuer Horizont für europaweite Zahlungen
Ein digitaler Euro für das digitale Zeitalter
Häufige Fragen zum digitalen Euro
Würde ein digitaler Euro das Bargeld ersetzen?
Welche Folgen hätte ein digitaler Euro für Banken?
Warum wäre ein digitaler Euro besser als Krypto?
Distributed Ledger Technology wie Blockchain?
Wäre ein digitaler Euro eine Alternativwährung?
Warum ein digitaler Euro für Verbraucher?
Digitalwährungen außerhalb des Eurosystems?
Wie sieht der Zeitplan für den digitalen Euro aus?
Warum eine Obergrenze für die erste Guthabenstufe
Welche Daten werden beim Bezahlen verarbeitet?
Analyse der offiziellen Ankündigung
Geld so wichtig wie das eigene Leben
Beruhigungspillen für die Bevölkerung
Verzweiflungstat der EZB
TEIL 2: HINTERGRÜNDE
Von Vertrauen und Disruption
Vertrauen ist die Basis für alles
Euro hat ein Viertel an Kaufkraft eingebüßt
Parallelen zwischen Internet und Kryptogeld
Digitalisierung trifft Finanzwesen
Kampf um die digitale Disruption
Wem vertrauen die Menschen?
Vom Mythos zur Realität
Vom Tauschhandel zum Bankgeld
Vom Warengeld zum Fiatgeld
Vertrauen in die Bundesbank und in die EZB
Der große Crash
Der erste Börsencrash der Welt durch Tulipomanie
Aktien und Scheine ohne Gold sind nichts als Papier
Hyperinflation: Das Geld zerrinnt
Black Friday 1929 und Währungsreform 1948
Das Ende der Golddeckung des US-Dollars
Euro-Einführung 2002
Von der Immobilien- zur Hypothekenkrise
Wir sind hochverschuldet
Der Corona-Crash
Bazooka-Hilfe mit Folgen
Coronomics – die Folgepolitik der Pandemie
Ewige Anleihen wie zu Napoleons Zeiten
Experiment der ungebremsten Geldvermehrung
Unser Finanzsystem ist nicht so sicher wie es scheint
Neue Währungswelt
„Riders on the Storm“
Staatliche Kryptowährungen als Dominanzfaktor
Nationale Digitalwährung als machtvolles Instrument
Abschreckend in Deutschland, nichts Neues in China
Totale Überwachung des Finanzwesens
Europa wird China folgen
Geostrategischer Wettbewerb
Zentralbank der Zentralbanken
Kampfansage an digitale Zahlungssysteme
Bitcoin in Deutschland
Keiner gibt sein Bargeld freiwillig her
Geburt und Entwicklung des Bitcoin
Das White Paper des Satoshi Nakamoto
Keine Instanz des Vertrauens
2009: das Geburtsjahr des Bitcoin
Altcoins sind nicht alt, sondern alternativ
Schneller und preiswerter Transfer
Offen und doch anonym
Sind Kryptowährungen kriminell?
Wundersame Geldvermehrung
Frau Müller geht in eine Bank
Kryptowährungen und das „Fräulein vom Amt“
Kryptotechnik Blockchain
Vom Kerbstock zur Distributed-Ledger-Technologie
Verteilte Buchhaltung ohne Notar
Von der Geheimhaltung bis zur Honigbiene
Blockchain: unbestreitbar und universell einsetzbar
Urknall einer Kryptowährung
Digitaler Goldrausch
Gefahrenstelle Mining
Difficulty – vorprogrammierte Schwierigkeiten
Alle zehn Minuten entsteht ein neuer Bitcoin-Block
Der letzte Bitcoin entsteht 2140
Tokens sind nicht gleich Coins
Rechenleistung wie der Energiebedarf ganzer Länder
Blockchain ähnlich wie Internet
Weltweite Kryptonervosität
Das künftige Finanzsystem
Quadratur des Kreises
Besitz von Bitcoins könnte illegal werden
Krypto chaotisch wie das Internet
Das Internet wurde 1968 geboren
Den Atomkrieg überleben
Das Internet gehört uns allen
Wer im Internet etwas zu sagen hat
USA: Die Daten im Internet gehören uns
USA räumen sich digitale Weltherrschaft ein
Edward Snowden: Globaler Machtmissbrauch
Viele Parallelen zwischen Internet und Kryptowelt
USA und China im Ring, EU weit abgeschlagen
Europas digitale Dekade bis 2030
Europas digitaler Kompass
Mehrländerprojekte
Digitale Rechte und Grundsätze
Ein digitales Europa in der Welt
Lehren aus der Pandemie
Welt ohne Bargeld
Bargeld schon lange auf dem Rückzug
Tausche Einkaufsverhalten gegen Bonuspunkte
Von der Kreditkarte zur Online-Zahlung
Digitales Bezahlen und Überwachen
Smartphone für den Ausweis und zum Bezahlen
Ziel ist der gläserne Bürger
Blockchain-Überwachung besser als Bargeld
Hacker bestehlen uns
Chaos, Macht, Terror oder Geld
Kein Hack ohne Nordkorea
WannaCry – größter Kryptoangriff aller Zeiten
Am 23. Oktober 2020 wird die EZB lahmgelegt
Bitcoin-Börsen werden geknackt
Ausblick
Über die Autoren
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Am 14. Juli 2021 stellte die Europäische Zentralbank EZB offiziell den digitalen Euro vor. Die Ankündigung erfolgte mitten in der Corona-Pandemie zwischen der dritten und vierten Infektionswelle und während der Fußball-Europameisterschaft 2021, um möglichst keine Aufmerksamkeit auf eine der fundamentelsten Änderungen der gemeinsamen Währung aller 26 Staaten der Europäischen Union zu ziehen. Man könnte auch sagen: Die Vorstellung des digitalen Euro erfolgte klammheimlich.
Vorausgegangen war zwar ein öffentliches Konsultationsverfahren vom 12. Oktober 2020 bis zum 12. Januar 2021. Hierzu hatte die EZB 18 Fragen formuliert, auf die insgesamt 8.221 Antworten eingegangen waren. Die Ergebnisse dieser Konsultation wurden am 14. April 2021 vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments erläutert.1
Aber zur Vorstellung des digitalen Euro am 14. Juli 2021 gab es kein großes politisches Manifest, nicht einmal eine Pressekonferenz, sondern lediglich eine Presseerklärung und eine überschaubare Reihe von Onlinetexten, um eine der wichtigsten Weiterentwicklungen der Währung aller Europäer der Öffentlichkeit vorzustellen.
Das deutsche und das französische Finanzministerium ließen lapidar verlauten: „Deutschland und Frankreich unterstützen die Arbeit der EZB zum digitalen Euro und den heutigen Beschluss des EZB-Rats [07/14] zur Einleitung der sogenannten Untersuchungsphase.“2
Beruhigungspille statt Aufklärung
Man muss schon arg blauäugig sein, um das für Zufall zu halten. Die mehrfach geäußerte Feststellung der EZB, dass es vor 2026 keineswegs zur Einführung des digitalen Euro kommen werde, darf ebenfalls eher als „Beruhigungspille“ für die Bevölkerung denn als Aufklärung betrachtet werden. 2026 ist praktisch morgen.
Die Autoren des vorliegenden Buches haben diese Ankündigung vom Juli 2021 zum Anlass genommen, hinter die Kulissen des digitalen Euro zu schauen. Wir vertreten die Auffassung, dass die Bevölkerung Europas ein Recht hat zu wissen, was auf sie zukommt.
Daher ist uns sehr daran gelegen, in diesem Buch nicht nur die Ankündigung des digitalen Euro genau unter die Lupe zu nehmen, sondern darüberhinausgehend die geneigte Leserschaft auch über die Hintergründe, die mutmaßlich dahintersteckende Technologie und vor allem die möglichen Auswirkungen umfassend zu informieren.
Daher haben wir dieses Buch in zwei Teile aufgesplittet:
die Ankündigung des digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank und die Analyse dieser Vorstellung der EZB,
eine informative und für die Leserschaft hoffentlich erhellende Darstellung der Hintergründe digitaler Währungen.
Wir vertreten die feste Überzeugung, dass sich die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung unserer europäischen Währung nur abschätzen lässt, wenn man verstanden hat, was Kryptowährungen bedeuten, was die Gründe für die Erschaffung des Bitcoin als erste Digitalwährung waren, was es mit der Blockchain-Technologie auf sich hat, wie es um die Stabilität von Währungen generell bestellt ist, was die Ursachen für den Crash von Finanzsystemen sind und welche Auswirkungen die Coronakrise auf unser Wirtschafts- und Finanzsystem haben kann. Alle diese Aspekte werden im zweiten Teil dieses Buch ausführlich dargestellt.
Bargeld wird sukzessive abgeschafft
Denn soviel ist klar: Allen Beteuerungen der EZB zum Trotz, dass das Bargeld weiterhin erhalten bleiben wird, lässt sich mit Sicherheit voraussagen, dass das Bargeld in Zukunft sukzessive abgeschafft werden wird. Wer dem widerspricht, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Man mag das als zeitgemäße Entwicklung entlang der allgegenwärtigen und scheinbar unaufhaltsamen Digitalisierung unseres gesamten Lebens akzeptieren. Doch es lässt sich wohl kaum leugnen, dass für viele Menschen ein über Jahrzehnte hinweg erarbeitetes kleines Vermögen die Grundlage für ein Leben ohne Armut im Alter darstellt. Bei allem Fortschrittsglauben muss man sich vergegenwärtigen, dass Geld für die Menschen eine fundamentale Grundlage für ihr gesamtes Leben darstellt. Daher kommt der Digitalisierung dieses Lebensbereichs eine besondere Bedeutung zu.
2100 ist der Euro nichts mehr wert
Deswegen geht es in diesem Buch auch um Vertrauen und um Vertrauen, das bitter enttäuscht wurde. Wenn die EZB bei der Vorstellung des digitalen Euro nicht müde wird zu betonen, dass dieser die gleiche Stabilität wie der althergebrachte Euro aufweist, so sollte man wissen, dass die Euro-Währung seit ihrer Einführung rund 25 Prozent an Kaufkraft verloren hat. Damals 100 Euro sind heute nur noch 75 Euro wert. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzen würde, wäre der Euro – gleichgültig ob als Geldschein oder digital – in 75 Jahren, also sagen wir im Jahr 2100, nichts mehr wert, gar nichts. Es wäre ein Crash binnen 100 Jahren – falls es überhaupt solange dauert.
Wir wollen nicht schwarzsehen. Aber wir wollen, dass unsere Leser informiert sind, dass sie verstehen, was der digitale Euro bedeuten könnte und was das alles für ihre persönliche Lebensplanung bedeutet. Die Vorstellung des digitalen Euro im Juli 2021 durch die Europäische Zentralbank erfolgte beiläufig, beinahe so, als ob das Thema unwichtig sei. Doch das ist falsch! Ganz im Gegenteil bringt ein digitaler Euro für 340 Millionen Europäer fundamentale Änderungen mit sich.
Der digitale Euro hat etwas mit Krypto zu tun
Daher ist es höchste Zeit, sich mit dem digitalen Euro und Kryptowährungen generell zu befassen. Die EZB versucht den Eindruck zu erwecken, dass der digitale Euro rein gar nichts mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu tun habe – doch das ist schlichtweg falsch. Wer den digitalen Euro verstehen will, muss wissen, was es mit dem Bitcoin auf sich hat. Denn der Bitcoin wurde als Inbegriff des Misstrauens gegen staatliche Zentralbanken wie die EZB ins Leben gerufen. Alles dreht sich um die grundlegende Frage, ob wir staatlichen Institutionen wie der EZB mehr vertrauen als dezentralen Strukturen wie dem Internet. Was das bedeutet, wollen wir auf den kommenden Seiten erläutern.
Lesen Sie, verstehen Sie und bilden sie sich eine eigene Meinung basierend auf Fakten, Wissen und Verständnis.
Andreas Dripke, Stephanie Stoerk
TEIL 1: VORSTELLUNG/ANALYSE
In diesem ersten Teil stehen die offizielle Ankündigung des digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB) und eine Analyse eben dieser Vorstellung im Mittelpunkt. Bei der Darstellung der Ankündigung stützen sich die Ausführungen in weiten Teilen auf die Erklärungen der EZB vom 14. Juli 2021 und die offiziellen Stellungnahmen der EZB sowie die Erklärungen von EZB-Chefin Christine Lagarde und EZB-Vorstandsmitglied Fabio Panetta.
Dazu gehört auch ein recht umfangreicher Katalog von Fragen und Antworten. Alle dort genannten Fragen hat die Europäische Zentralbank selbst aufgeworfen; es handelt sich also durchweg um Fragestellungen, die die Notenbank selbst als relevant einstuft. Umso erstaunlicher ist es, wie dürftig und geradezu nichtssagend viele Antworten ausfallen.
Warum das so ist und was es für den digitalen Euro bedeutet, ist im ersten Teil des vorliegenden Buches einer umfassenden und kritischen Analyse unterzogen.
Um das Wesen eines digitalen Euro verstehen zu können, bedarf es einer ganzen Menge an Hintergrundwissen und Einschätzungen. Beides wird im zweiten Teil des Buches vermittelt.
Nur wer das Prinzip von Krypowährungen versteht und weiß, was es mit der Blockchain-Technologie überhaupt auf sich hat, kann die Ankündigung des digitalen Euro sowie die Fragen und Antworten der EZB in voller Tragweite begreifen.
Der digitale Euro kommt!
Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, gab im Juli 2021 eine ausführliche Begründung, warum sie die Einführung des digitalen Euros für unerlässlich hält.3 Sie erklärte hierzu:
Die Digitalisierung ist mittlerweile in allen Bereichen unseres Lebens spürbar und hat auch verändert, wie wir bezahlen. In diesem neuen Zeitalter würde ein digitaler Euro sicherstellen, dass die Menschen im Euroraum weiterhin kostenlosen Zugang zu einem einfachen, allgemein akzeptierten, sicheren und verlässlichen Zahlungsmittel haben.
Auch ein digitaler Euro wäre ein Euro – genau wie Euro-Banknoten, nur eben digital. Er würde als Geld in elektronischer Form vom Eurosystem (der EZB und den nationalen Zentralbanken des Euroraums) ausgegeben und er könnte gleichermaßen von Privatpersonen und Unternehmen verwendet werden.
Das Bargeld würde durch ihn nicht ersetzt, sondern ergänzt. Das Eurosystem wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass Bargeld überall im Euroraum zur Verfügung steht.
Mit einem digitalen Euro würde eine weitere Zahlungsart zur Auswahl stehen. Der digitale Euro würde das Bezahlen einfacher machen und so zu Verfügbarkeit und Inklusion beitragen.
Warum ein digitaler Euro?
Mit einem digitalen Euro könnten alltägliche Zahlungen schnell, einfach und sicher erledigt werden.
Er würde den Übergang der europäischen Wirtschaft in das digitale Zeitalter unterstützen und Innovationen im Massenzahlungsverkehr aktiv fördern.
Derzeit prüfen die EZB und die nationalen Zentralbanken des Euroraums, welche Vorteile und Risiken ein digitaler Euro hätte. Denn das Geld soll seine Funktion für die Menschen in Europa auch in Zukunft gut erfüllen.
Welche weiteren Vorteile hätte ein digitaler Euro?
Ein digitaler Euro würde die Effizienz eines digitalen Zahlungsmittels bieten und wäre gleichzeitig sicheres Zentralbankgeld.
Er würde sich dort anbieten, wo Menschen nicht mehr lieber mit Bargeld bezahlen. Außerdem würde er verhindern, dass wir von digitalen Zahlungsmitteln abhängig werden, die in Ländern außerhalb des Euroraums ausgegeben und von dort aus kontrolliert werden. Denn dies könnte die finanzielle Stabilität und die geldpolitische Souveränität untergraben.
Der Schutz der Privatsphäre hätte beim digitalen Euro einen hohen Stellenwert. So kann der digitale Euro dazu beitragen, das Vertrauen in Zahlungen auch im digitalen Zeitalter aufrechtzuerhalten.
Wann wird es so weit sein?
Im Juli 2021 haben wir beschlossen, ein Projekt zum digitalen Euro zu starten. Das bedeutet nicht, dass wir zwangsläufig einen digitalen Euro einführen, sondern dass wir uns darauf vorbereiten, ihn möglicherweise einzuführen.4
Wie geht es weiter?
Seit Oktober 2021 untersucht die EZB, wie ein digitaler Euro aussehen könnte. Diese Untersuchungsphase soll rund zwei Jahre dauern.
Die EZB prüft, wie ein digitaler Euro gestaltet und an Händler und Privatpersonen verteilt werden könnte. Zudem wird untersucht, welche Auswirkungen er auf den Markt hätte und welche Änderungen gegebenenfalls an den europäischen Rechtsvorschriften erforderlich wären.
Sobald die Untersuchungsphase abgeschlossen ist, wird die EZB entscheiden, ob sie mit der Entwicklung eines digitalen Euro beginnt. Im Anschluss sollen mögliche Lösungen erarbeitet und getestet werden. Dabei würde die EZB mit Banken und Unternehmen zusammenarbeiten, die die Technologie und die Zahlungsdienstleistungen bereitstellen könnten.
Die bisherige praktische Erprobung hat gezeigt, dass es keine größeren technologischen Beschränkungen hinsichtlich der Einführung eines digitalen Euro gibt und dass viele Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.5
Wie könnte ein digitaler Euro aussehen?
Fachleute der EZB und der nationalen Zentralbanken des Euroraums haben eine Reihe grundlegender Anforderungen für einen digitalen Euro festgelegt. Beispielsweise muss er leicht zugänglich, robust, sicher und effizient sein. Außerdem muss die Privatsphäre gewahrt und geltendes Recht eingehalten werden. An diesen Eckpfeilern werden wir uns bei der Gestaltung des digitalen Euro orientieren.
Bei der Entwicklung eines digitalen Euro würde darauf geachtet werden, dass er mit den Lösungen von Anbietern privater Zahlungsdienste kompatibel ist. Dies würde die Bereitstellung von gesamteuropäischen Lösungen und zusätzlichen Dienstleistungen für Verbraucherinnen und Verbraucher erleichtern.
Wird ein digitaler Euro von der EZB verwaltet?
Die EZB ist die Hüterin des Euro. Ob es sich um Banknoten und Münzen oder um einen Euro in digitaler Form handelt, spielt dabei keine Rolle. Ihre Aufgabe ist es, den Wert der gemeinsamen Währung zu erhalten. Unabhängig von seiner Form soll ein digitaler Euro schließlich von der zuständigen Zentralbank geschützt und reguliert werden.
Warum wäre ein digitaler Euro kein Krypto-Asset?
Krypto-Assets unterscheiden sich grundlegend von Zentralbankgeld: Ihre Preise unterliegen häufig Schwankungen, sodass sie nur schwer als Zahlungsmittel oder Rechnungseinheit zu verwenden sind. Auch steht hinter ihnen keine vertrauenswürdige Institution.6
In einen digitalen Euro hingegen könnten die Menschen dasselbe Vertrauen setzen wie in Euro-Bargeld. Denn hinter beiden stünde eine Zentralbank.7
Ein neuer Horizont für europaweite Zahlungen
Der Zahlungsverkehr befindet sich im Umbruch, und die Zentralbanken spielen dabei eine wichtige Rolle.
Grundlage des europäischen Zahlungsverkehrs muss ein wettbewerbsfähiger und innovativer Zahlungsmarkt sein, der die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher erfüllt und die Souveränität Europas wahrt. Vor diesem Hintergrund haben wir eine umfassende Strategie für Zahlungen im digitalen Zeitalter ausgearbeitet.8
Ein digitaler Euro für das digitale Zeitalter
Ein digitaler Euro wäre ein digitales Symbol für den Fortschritt in Europa und die europäische Integration. Mit diesen Worten präsentierte Fabio Panetta, Mitglied des Direktoriums, den Bericht über einen digitalen Euro.
Seit der Einführung des Euro ist es die Aufgabe der EZB, das Vertrauen der Menschen in die gemeinsame europäische Währung zu wahren. Als Ergänzung zum Euro-Bargeld könnten alle den digitalen Euro verwenden. Die Auswahl an Zahlungsarten würde durch ihn erweitert.9
Soweit EZB-Chefin Christine Lagarde. An diesen Aussagen ist vieles bemerkenswert, wie in diesem Buch in weiteren Kapiteln ausführlich erläutert wird. Doch auf auffälligsten ist die Aussage: Der digitale Euro ist keine eigene Währung, schon gar keine Kryptowährung wie Bitcoin, sondern nur eine digitale Repräsentanz des herkömmlichen Euro. Es ist schon richtig, dass Kryptowährungen wie Bitcoin stärkeren Schwankungen als der Euro unterliegen. Doch über die letzten sagen wir 20 Jahre betrachtet, hat der Bitcoin in atemberaubender Weise an Wert gewonnen, während der Euro etwa ein Viertel an Wert verloren hat. Wer im Jahr 2011 sagen wir einen Euro in Bitcoin investiert hat, hatte 2021 einen Gegenwert zwischen 30.000 und 60.000 in der Hand. Wer am 1. Januar 1999, dem Jahr der Euro-Einführung, einen Euro in der Hand hatte, verfügt heute nur noch über 75 Cent an Kaufkraft. Nehmen wir den niedrigsten Bitcoin-Wert aus 2021, also 30.000 Euro, halbieren wir ihn, weil er wie Lagarde sagt, volatil ist, kommen wir auf 15.000 Euro. Nehmen wir „einfach so“ weitere 90 Prozent Wertverlust (!) aufgrund seiner Volatilität an, kommen wir auf 1.500 Euro. Ziehen wir ein Resümee: Aus einem Euro, den man im Vertrauen auf die EZB seit der Euro-Einführung als Bargeld liegen gelassen sind, sind 75 Cent an Kaufkraft geworden. Hätte man den Euro wenige Jahre danach in Bitcoin investiert, würde man nach Abzug aller Unwägbarkeit und eines 90prozentigen Kursverlustes bei 1.500 Euro Gegenwert landen. Die Beispielrechnung zeigt: Es stimmt schon, dass der Bitcoin äußerst volatil ist, aber er ist in seiner Kaufkraftentwicklung dem Euro um ein Vielfaches überlegen.
Häufige Fragen zum digitalen Euro
Die Europäische Zentralbank hat einen eigenen Fragenkatalog entwickelt, in dem sie auf die häufigsten Fragen zum digitalen Euro Antworten formuliert.10 Offensichtlich handelt es sich um diejenigen Fragen, von denen die EZB meint, dass sie am wichtigsten oder am häufigsten gestellt werden.
Würde ein digitaler Euro das Bargeld ersetzen?
Nein, er würde das Bargeld ergänzen, es aber nicht ersetzen. Es wird im Euroraum wie bisher Bargeld geben. Mit einem digitalen Euro, der neben dem Bargeld genutzt werden könnte, würden wir auf die steigende Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher nach schnellen und sicheren digitalen Bezahlmöglichkeiten reagieren.
Welche Folgen hätte ein digitaler Euro für Banken?
Ein digitaler Euro sollte keine negativen Folgen für den Finanzsektor haben. Darum werden wir die folgenden Anforderungen berücksichtigen: a) Ein digitaler Euro sollte in erster Linie als Zahlungsmittel und nicht zur Geldanlage verwendet werden, und b) beaufsichtigte Intermediäre sollten beim konkreten Umgang mit dem digitalen Euro eine Rolle spielen.
Warum wäre ein digitaler Euro besser als Krypto?
Ein digitaler Euro wäre Zentralbankgeld. Hinter ihm würde eine Zentralbank stehen und er wäre so gestaltet, dass er den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird: Ein digitaler Euro wäre also risikofrei und Privatsphäre wie auch Datenschutz würden gewahrt. Aufgabe von Zentralbanken ist es, die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Ob es sich um physisches oder digitales Geld handelt, spielt dabei keine Rolle.
Die Stabilität und Zuverlässigkeit von Stablecoins hängt letzten Endes davon ab, von wem sie ausgegeben werden. Und sie hängt davon ab, wie glaubwürdig zugesichert wird, dass der Wert im Zeitverlauf erhalten bleibt, und inwieweit diese Zusicherung durchsetzbar ist. Private Emittenten können personenbezogene Daten auch für kommerzielle Zwecke nutzen.
Im Falle von Krypto-Assets gibt es keine identifizierbare Instanz, die haftet. Dementsprechend gibt es auch keine Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen.
Distributed Ledger Technology wie Blockchain?
Das Eurosystem testet gerade verschiedene Ansätze und Technologien zur Bereitstellung eines digitalen Euro, darunter auch zentralisierte und dezentralisierte Lösungen wie die Distributed Ledger Technology. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
Wäre ein digitaler Euro eine Alternativwährung?
Nein, er wäre keine Alternativwährung im Eurosystem, sondern lediglich eine Möglichkeit mehr, in Europa mit dem Euro als gemeinsamer Währung, zu bezahlen. Er könnte 1:1 in Banknoten umgetauscht werden. Ein digitaler Euro wäre die Antwort auf das zunehmende Interesse der Menschen und Unternehmen an digitalen Zahlungsmöglichkeiten.
Warum ein digitaler Euro für Verbraucher?
Ein digitaler Euro wäre ein digitales Zahlungsmittel, das genauso sicher, einfach und günstig zu verwenden ist wie das heutige Bargeld. Er könnte von allen Menschen kostenlos für den grundlegenden Zahlungsbedarf verwendet und überall im Euroraum genutzt werden.
In einer Welt, in der immer häufiger elektronisch bezahlt wird und der Markt für den digitalen Zahlungsverkehr immer weiter wächst, wäre ein digitaler Euro eine zusätzliche Möglichkeit für alle, mit Zentralbankgeld zu bezahlen – sowohl für die privaten Haushalte als auch für kleine Betriebe und Großunternehmen.
Für Zahlungsempfänger wie Händler und kleine Unternehmen wäre er eine zusätzliche Möglichkeit, Zahlungen von ihren Kunden zu erhalten.
Ein digitaler Euro könnte auch erweiterte Funktionalitäten wie automatisierte Zahlungsfunktionen bieten. Denkbar wäre außerdem die Nutzung einer Form von digitaler Identität.
Digitalwährungen außerhalb des Eurosystems?
Was ist, wenn eine Zentralbank außerhalb des Euroraums schon vor dem Eurosystem ihre Digitalwährung ausgibt?
Alle großen Zentralbanken prüfen aktuell die Möglichkeit, eine digitale Zentralbankwährung auszugeben. Hier geht es aber nicht darum, Erster zu sein. Auf Ebene der G20 ist man sich einig, dass es ohne Zusammenarbeit keine internationale Verwendung von digitalem Zentralbankgeld geben kann.
Außerdem sind Gründlichkeit und Sicherheit wichtiger als Schnelligkeit. Wir brauchen ein System, das für alle funktioniert und von Anfang an stabil ist. Für einen digitalen Euro muss bei Zentralbanken und den beaufsichtigten Intermediären eine gewisse Infrastruktur vorhanden sein.
Das Eurosystem arbeitet mit anderen Zentralbanken zusammen, um zu verstehen, welche Auswirkungen die Einführung einer digitalen Währung für die Wirtschaft in den verschiedenen Ländern hätte. Wenn wir unsere jeweiligen Überlegungen und Erfahrungen austauschen, haben alle etwas davon.
Mit dem Projekt eines digitalen Euro reagieren wir auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und wollen auf eine europäische Zahlungsoption bauen. Das ist eine Frage der Souveränität und der Autonomie.
Wie sieht der Zeitplan für den digitalen Euro aus?
Bevor der Beschluss gefasst wird, ob ein digitaler Euro eingeführt wird, müssen wir über seine potenzielle Gestaltung entscheiden und testen, ob er die Endnutzerbedürfnisse erfüllen kann. Es müssen noch einige Schritte unternommen werden, bis ein digitaler Euro eingeführt werden kann.
Der EZB-Rat entscheidet 2021/22, ob im Hinblick auf die mögliche Einführung eines digitalen Euro eine formelle Untersuchungsphase eingeleitet wird. Das würde bedeuten, dass eine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten und Nutzeranforderungen zu prüfen ist. Wir würden auch untersuchen, unter welchen Voraussetzungen Finanzintermediäre Front-End-Dienste auf der Grundlage eines digitalen Euros anbieten könnten. Die EZB rechnet damit, dass diese Analyse etwa zwei Jahre dauern wird. Das wäre im Jahr 2023.
Danach würde der EZB-Rat darüber entscheiden, ob man zur nächsten Phase übergeht, in der man an der Entwicklung von integrierten Dienstleistungen arbeiten, Tests durchführt und den digitalen Euro möglicherweise live erproben würde.
Diese Aufgabe hat Vorrang, man muss sich jedoch auch die Zeit nehmen, es richtig zu machen. Die Auswirkungen eines