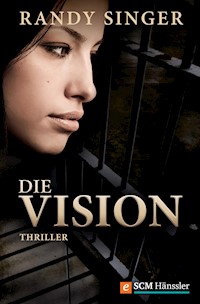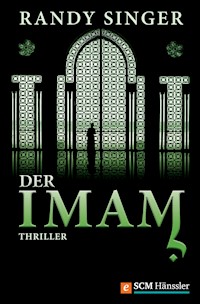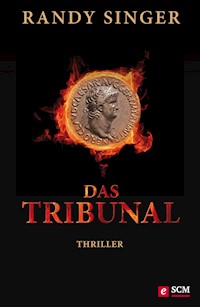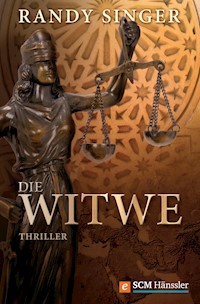Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jusitzthriller
- Sprache: Deutsch
Der kleine Joshua Hammond hat hohes Fieber. Als seine Eltern ihn erst nach mehreren Tagen in die Notaufnahme bringen, kann Dr. Sean Armistead ihn nicht mehr retten. Plötzlich sehen sich die Hammonds einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegenüber. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die Verblendung durch eine Kirche, die lehrt, Gott heile durch Gebet nicht durch Ärzte. Rechtsanwalt Charles Arnold glaubt jedoch an die Unschuld der Eltern. Allerdings hängt der Ausgang des Falls von den Aussagen zwielichtiger Zeugen ab. Erst nach und nach decken Charles und seine Assistentin Nikki Moreno eine grausame Intrige auf, die kaltblütig mit dem Leben von Menschen spielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der SCM-Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book-Shop, gekauft hat.Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
ISBN 978-3-7751-5612-7 (E-Book)ISBN 978-3-7751-7261-5 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2015SCM-Verlag GmbH & Co. KG · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scmedien.de · E-Mail: [email protected]
Originally published in the U.S.A. under the title: Dying DeclarationCopyright © 2009 by Randy SingerGerman edition © 2015 by SCM-Verlag GmbH & Co. KG with permissionof Tyndale House Publishers, Inc. All rights reserved.
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006SCM-Verlag GmbH & Co. KG.
Übersetzung: p.s. words (Nicola Peck und Lea Schirra)Umschlaggestaltung: OHA Werbeagentur GmbH, Grabs, Schweiz; www.oha-werbeagentur.chTitelbild: istockphoto.com, shutterstock.comAutorenfoto: Eric LusherSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Inhalt
Stimmen zu Der Doktor
Stimmen zu Randy Singers weiteren Büchern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Stimmen zu Der Doktor
»Singer verfolgt mit diesem Justizthriller einen völlig neuen Ansatz; dabei präsentiert er tiefgründige Figuren und ethische Fragen auf anspruchsvolle Weise, gekrönt von einer packenden Handlung.«
Booklist
»Mit diesem spannenden, intelligenten Thriller trifft Singer erneut ins Schwarze.«
Publishers Weekly
»Mit jedem Roman wird Singer besser, doch mit Der Doktor legt er eine wahre Glanzleistung hin …«
Faithfulreader.com
»Und wieder hat es Randy Singer geschafft. Von der ersten Seite an zieht Der Doktor den Leser in seinen Bann und lässt ihn nicht mehr los … Singer liefert eine Handlung, die den Vergleich mit Grisham nicht zu scheuen braucht. Singer schafft es, Konflikte in den Mittelpunkt zu stellen, denen wir täglich gegenüberstehen. Dieses Buch sollten Sie auf keinen Fall verpassen.«
Hugh Hewitt, Autor, Kolumnist und Moderator der amerikaweit ausgestrahlten Radiosendung Hugh Hewitt Show
»Eine explosive Mischung aus juristischen Taktiken, Leidenschaft und Macht. Mit Der Doktor macht Singer seinem wohlverdienten Ruf für meisterhaft konstruierte Geschichten und fesselnde Figuren alle Ehre.«
Brandilyn Collins, Autorin von Violet Dawn
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Stimmen zu Randy Singers weiteren Büchern
»Singer … liefert einen weiteren Spitzentitel ab … Seine zahlreichen Fans werden die Buchläden stürmen.«
Booklist über Die Rache
»Die Figuren sind sympathisch und wie aus dem Leben gegriffen; die Handlung ist vielschichtig und rasant; das Thema regt zum Nachdenken an und geht unter die Haut – ich würde Die Rache eigentlich als Singers besten Roman bezeichnen, wenn ich damit nicht seinen anderen Büchern unrecht täte.«
lifeisstory.com
»Der Klon ist ein absolut gelungener Roman. Randy Singer verbindet eine spannende Handlung mit einer eindringlichen Botschaft. Sehr zu empfehlen.«
T. Davis Bunn, Autor von My Soul To Keep
»Das Thema Klonen, Stammzellforschung, raffgierige Geschäftsführer und Anwälte mit schillerndem Charakter lassen eine fesselnde Geschichte entstehen, welche die Schlagzeilen von morgen vorwegnimmt.«
Mark Early, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Virginia über Der Klon
»Die Figuren sind so gut ausgearbeitet und die Dialoge so interessant, dass man diesen Thriller kaum aus der Hand legen kann.«
Bookreporter.com über Der Code des Richters
»Eine Geschichte, die unterhält, überrascht und den Leser dazu bringt, sein Verständnis von Recht und Gnade zu überdenken … Singer beschert uns einen weiteren großartigen Justizthriller, der auch diesmal den Vergleich mit Grisham nicht scheuen muss.«
Publishers Weekly über Die Staatsanwältin
»Singers juristische Kenntnisse sind genauso überzeugend wie seine beeindruckende Erzählkunst. Erneut drängt er uns bis über den Abgrund hinaus und lässt uns dort zappeln, bevor er uns souverän zurückzieht.«
Romantic Times über Der Imam
»Gerade als ich dachte, Singers Geschichten könnten nicht mehr besser werden, erschien dieses Buch, das noch besser ist als sein letztes. Das dürfen Sie nicht verpassen!«
Aaron Norris, Fernseh- und Filmproduzent und Regisseur, über Das Spiel
Für Keith und Jody.Diesem Buch liegt eine ganz besondere Beziehungzwischen einem Bruder und seiner Schwester zugrunde.Diese Geschichte zu schreiben,hat mich unsere umso mehr wertschätzen lassen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1
Ihr Anblick war mitleiderregend.
Sie war eine unscheinbare Frau mit großer Nase und durchschnittlichem Gesicht, das dank ihrer Abneigung gegen Make-up umso mehr von ihren Mitmenschen übersehen wurde. Ihr schwarzes Haar hing in Strähnen herab, ihre Augen waren verquollen, und am Hals konnte man überall rote Striemen sehen, da sie sich vor Nervosität die Haut zerkratzt hatte. Sie ließ den Tränen, die über ihre Wangen strömten und auf Joshies Kopf tropften, freien Lauf. Fest an ihre Brust gedrückt, schaukelte sie ihn sanft in ihrem Lehnstuhl vor und zurück, summte leise vor sich und hielt nur inne, um die Stirn des Kindes mit einem kühlen, feuchten Waschlappen abzutupfen.
Dann legte sie den Waschlappen auf die Armlehne des abgenutzten Sessels zurück und küsste Joshies Wange. Sein kleiner Körper zuckte hin und her, so als ahme er die Bewegung des Sessels nach. Als sie wieder anfing, sich vor und zurück zu wiegen, hörte das Zucken auf.
Der kleine Kerl glühte förmlich. Regungslos, fast leblos bis auf das leise Stöhnen, lag er in ihren Armen. Sie fühlte seinen Schmerz, als wäre es ihr eigener. Und was diesen Schmerz noch verschlimmerte, war das Gefühl von Machtlosigkeit, ihre Unfähigkeit, sowohl den unaufhaltsamen Anstieg des Fiebers zu bekämpfen als auch seine verheerenden Auswirkungen.
Mittlerweile brachte sie es nicht mehr über sich, die Temperatur ihres jüngsten Kindes, das erst in vier Monaten zwei Jahre alt werden würde, zu messen. Vor zwei Stunden hatte das Thermometer noch 39,5 °C angezeigt, doch das Fieber war seitdem mit Sicherheit gestiegen. Aber das machte keinen Unterschied, denn es gab nichts, das sie dagegen hätte tun können. Also weinte sie, wiegte ihr Kind und betete.
Thomas Hammond kniete bereits seit einer halben Stunde auf dem Boden. Er gab ein seltsames Bild ab, dieser untersetzte Mann mit dem runden, schmuddeligen Gesicht, den kräftigen Unterarmen und schwieligen Händen, die kraftlos auf seinen Knien ruhten – eine Haltung, die Demut ausdrückte. Er befand sich auf einem spirituellen Kriegspfad und war fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen.
Er betete neben seinem Bett im Elternschlafzimmer, das sich am anderen Ende des extra-breiten Wohnwagens befand, und hatte das Gesicht in seinen riesigen Händen vergraben.
»Nimm dieses Fieber von uns. Verschone meinen Sohn, Jesus.« Er sprach die Worte kaum hörbar, doch mit tiefer Inbrunst aus. Wieder und wieder formulierte er dieselben einfachen Bitten. Ihm ging das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe durch den Kopf. Wenn ich nur oft genug bete. Innig genug bete. »Stärke meinen Glauben. Rette meinen Sohn. Bestrafe ihn nicht für meine Fehler.« Er versuchte mit Gott zu verhandeln – alles hätte er ihm versprochen. »Ich werde hingehen, wohin immer Du willst, Jesus. Tun, was immer Du verlangst. Dir mit meinem ganzen Herzen dienen. Erhöre nur diese eine Bitte. Bestrafe nicht Josh …«
»Dad!«, ertönte die Stimme des fünfjährigen John Paul, Thomas’ ältestem Sohn, dem er den Spitznamen »Tiger« verpasst hatte. Der Junge rief ihn aus seinem Kinderzimmer, das den Flur hinunter lag.
»Die Bibel lehrt uns, dass Du schwer zu erzürnen und voller Liebe, Gnade und Barmherzigkeit bist.« Thomas hielt inne, die geflüsterten Worte blieben ihm im Hals stecken. In diesem Moment hatte er nicht das Gefühl, einem barmherzigen Gott zu dienen. Er spürte Wut über all die unbeantworteten Gebete in sich aufsteigen, dann folgten Schuldgefühle. Sollte es etwa sein Ärger sein, der Gott davon abhielt, Seine heilenden Hände wirken zu lassen? »Zeig Josh Deine Barmherzigkeit …«
»Hey, Dad!« Der Ruf wurde lauter, fordernder.
»Einen Moment, Tiger.« Thomas fuhr sich mit der Hand durch sein lichter werdendes Haar, stand zögernd auf und stapfte durch den Flur zum Zimmer der Jungs, während er sich mit dem Handrücken über die Augen wischte. Er musste jetzt stark sein.
Vorsichtig schob er die Tür auf, wodurch das Licht aus dem Flur auf die beengten Verhältnisse im Zimmer fiel, das Tiger stolz als sein eigenes bezeichnete, obwohl er es sich mit Josh teilte. Tiger saß aufrecht im Bett, seine abgewetzte Schmusedecke fest umklammert, die strahlend blauen Augen weit aufgerissen.
»Nicht so laut, mein Junge. Du weckst sonst noch Stinky auf.«
»Stinky« war Tigers sieben Jahre alte Schwester. Sie hatte sich ihren Spitznamen verdient, als sie noch Windeln trug. Damals redete Thomas immer mit ihr, wenn er sie wickelte, und stellte dann naserümpfend fest, dass sie eine richtige »Stinky« sei. Der Ausdruck blieb haften, und so wurde Stinky zum Kosenamen, der allerdings nur von der Familie und nie vor anderen Leuten benutzt wurde. Alle anderen nannten sie Hannah.
»Ich kann nicht schlafen, Daddy. Ich hab wieder slimm geträumt.«
Thomas ließ sich auf das Bett fallen und fuhr Tiger durch das zerzauste blonde Haar. »Nun, damit ist jetzt Schluss, weil ich jetzt bei dir bin.« Er wusste, was Tiger jetzt hören wollte, und an diesem Tag fand Thomas Trost in der gleichen Leier, die an anderen Abenden so nervenaufreibend sein konnte. »Dem alten Monster unter dem Bett verpass ich rechts und links eine«, grollte er und bemerkte, wie sich der Ansatz eines Grinsens auf dem Gesicht des kleinen Jungen abzeichnete. Er kitzelte Tiger an den Seiten und sah zu, wie das Grinsen immer breiter wurde. »Jetzt leg dich einfach hin und denk an was Schönes.«
»Hab ich ja«, erklärte Tiger. »Aber dann bin ich eingeschlaft. Daaaaddy?« Tiger zog das Wort für den maximalen Effekt lang und schenkte seinem Vater dann seinen berühmt-berüchtigten Hundeblick.
»Ja, Kumpel?«
»Legst du dich zu mir?« Tiger rutschte in seinem kleinen Bett zur Seite, um seinem Vater Platz zu machen. Das hatten sie schon viele Male gemacht. Dabei passte Thomas’ großer Körper nie ganz in den kleinen Teil des Bettes, der nicht von Tiger in Beschlag genommen wurde. Aber Thomas gab stets sein Bestes. Er versuchte dann immer eine halbwegs bequeme Position zu finden, wobei er zur Hälfte aus dem Bett raushing und sich mit einer Hand am Boden abstützen musste, während er Geschichten aus der Bibel erzählte, bis er das gleichmäßige Atmen des schlafenden kleinen Jungen hören konnte.
»Heute Nacht geht es leider nicht, mein Junge.«
»Bitte, Dad, nur eine Geschichte!«, jammerte Tiger. »Erzähl mir von Abe-ham und seinem Sohn und wie Gott ihnen eine Ziege geschickt hat.«
Thomas lächelte. Selbst an normalen Abenden fiel es ihm schwer, dem kleinen Kerl etwas abzuschlagen, und heute Nacht sehnte er sich besonders nach der tröstlichen Routine der Gute-Nacht-Geschichten – er wollte dabei zusehen können, wie Tigers Augen immer schwerer wurden. Aber er wusste auch, wie sehr Theresa ihn heute Abend brauchte. Und er hatte seine Gebete für Josh noch nicht beendet. Gott hatte ihm noch keine Antwort gegeben.
»Ich kann gerade nicht, mein Sohn. Ich muss noch nach Mom und Josh sehen. Wenn du immer noch wach bist, wenn ich wiederkomme, erzähle ich dir die Geschichte von Abraham.«
»Okay«, gab sich Tiger fröhlich zufrieden. Der Kleine hatte offensichtlich keinerlei Absicht einzuschlafen.
Thomas küsste ihn auf die Stirn, zog ihm die Decke bis zum Hals hoch und wandte sich dann zur Tür.
»Daddy?«
»Was denn?«, fragte Thomas schärfer als beabsichtigt. Ein wenig beschämt darüber, seinen Frust an dem Jungen ausgelassen zu haben, blieb er stehen.
»Is hab Durst.«
Wenige Minuten später gesellte sich Thomas zu seiner Frau in das kleine Wohnzimmer. Aufgewühlt lief er auf dem fleckigen Teppich auf und ab und sah ihr hilflos dabei zu, wie sie über ihren Sohn wachte – ihn wiegte, über seine Stirn wischte, ihm etwas vorsummte und dabei die ganze Zeit betete. Thomas’ Anwesenheit ignorierte sie.
»Geht das Fieber langsam runter?«, fragte er schließlich.
Theresa schüttelte den Kopf.
»Hast du in letzter Zeit noch einmal gemessen?«
»Warum sollte ich?« Ihre Stimme war kalt, das Gesicht von Sorge gezeichnet. Der Druck, an Dinge zu glauben, die man nicht sehen konnte, forderte seinen Tribut.
Thomas stellte sich hinter den Fernsehsessel und begann, Theresas Schultern zu massieren. Er spürte die verspannten und knotigen Muskeln in ihrem schlanken Rücken und bearbeitete sie mit seinen kräftigen Fingern. Ein Versuch, die Anspannung herauszustreichen. Ohne Erfolg.
»Wann hast du das letzte Mal seine Temperatur gemessen?«, bohrte er hartnäckig nach.
»Vor zwei Stunden.«
»Meinst du nicht, wir sollten sie noch mal messen?«
»Nur wenn wir vorhaben, ihn ins Krankenhaus zu bringen, wenn es nicht besser geworden ist.« Sie drehte den Kopf, sah Thomas über die Schulter mit ihren großen braunen Augen flehend an und stoppte ihre Wiegebewegung. Joshie regte sich nicht.
Thomas wich dem Blick seiner Frau aus, sah zu Boden und schüttelte langsam den Kopf. Er ging um den Sessel herum, bis er vor ihr stand. Dann sank er auf die Knie und legte seine großen Hände auf Theresas Beine.
»Hab Vertrauen«, sagte er sanft. »Gott wird ihn wieder gesund machen.«
Theresa schnaubte angesichts dieses Vorschlags. »Ich habe Vertrauen, Thomas. Ich hatte immer Vertrauen. Aber es geht ihm immer schlechter … Wag es nicht, mich über meinen Glauben zu belehren.« In ihrer Stimme schwang ein scharfer Unterton mit, den Thomas nie zuvor gehört hatte.
Joshie stöhnte auf. Er zuckte kurz; dann rollte er sich noch enger zusammen und schmiegte sich an die Brust seiner Mutter.
»Willst du, dass ich Pastor Beckham und die Ältesten herbestelle? Sie könnten kommen und ihn wieder mit Öl salben, für ihn beten …«
»Ich will, dass du einen Krankenwagen rufst«, verlangte sie mit zitternder Stimme. »Manchmal wirkt Gott durch die Hand eines Arztes. Wie kannst du einfach nur da knien und tatenlos dabei zusehen, wie dein Sohn leidet?«
»Theres…«
»Da!«, schluchzte sie, als sie den kleinen Joshie ihrem Mann entgegenschob. Wie eine Opfergabe hielt sie den kleinen Körper in ihren ausgestreckten Armen. »Halt du ihn. Sieh deinem Sohn ins Gesicht und erklär ihm, warum er sterben muss, nur damit du der Welt beweisen kannst, wie stark dein Glaube ist.« Einen Moment lang hielt sie ihn so hin – ihren Jüngsten, ihr Baby –, dann wandte sie das Gesicht ab.
Thomas fehlten die Worte. Er streckte die Hände aus, nahm seinen Sohn und drückte ihn an seine Brust. Das Fieber war selbst durch Joshies Pyjama spürbar.
Seinen Sohn vorsichtig im Arm haltend, kam Thomas auf die Füße. Erst jetzt bemerkte er aus dem Augenwinkel, dass Stinky und Tiger in ihren Schlafanzügen Händchen haltend im Türrahmen des Wohnzimmers standen. Tiger klammerte sich noch immer an seine Schmusedecke, Stinky hatte ihre Lieblingspuppe im Arm.
Während er sich zu seinen Kindern umdrehte, fragte er sich, wie viel sie wohl von der Unterhaltung mitbekommen haben mochten. Tigers Unterlippe zitterte, und seine großen Augen waren tränenerfüllt. Stinky, die gegen ihre schweren Augenlider ankämpfte und deren blonde Locken in alle Richtungen abstanden, sah verwirrt aus.
»Wird Joshie sterben?«, fragte sie.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2
Er lehnte sich vor und sammelte all seine Kraft, um die große grüne Mülltonne den Atlantic Boulevard hinunterzuzerren. Unten an der Tonne waren zwar zwei Räder angebracht, dennoch musste er sich mächtig ins Zeug legen, sodass seine Drahtseilmuskeln vor Schweiß glänzten. Es war eine typische Juninacht in Virginia Beach – glühend heiß mit einer erstickend hohen Luftfeuchtigkeit.
Er bot einen interessanten Anblick, dieser junge schwarze Mann mit dem kantigen Kiefer, den durchdringenden braunen Augen und dem beeindruckend weißen Lächeln. Selbst auf einem Gehweg, auf dem der Wahnsinn in all seinen Facetten vertreten war, zog er die Blicke auf sich. Aber er war es gewohnt und betrachtete sich als Teil dieser bunten Schar von Persönlichkeiten, die die Atlantic Avenue zum Leben erweckten. Hier gab es Skateboarder, Punker, Südstaaten-Proleten, Strandpenner, Surfer und sonnenverbrannte Touristen. Sie trugen weite Shorts, Bikinis, obszöne T-Shirts, Tank-Tops und Schirmmützen. Es gab keine Haarfarbe und keinen Haarschnitt, die nicht vertreten waren. Sein eigener kurz geschorener Bürstenhaarschnitt, der seine kantigen Gesichtszüge noch stärker betonte, stellte bei dieser Vielfalt nichts Besonderes dar.
Vom Parkplatz aus hatte er bereits einen knappen Kilometer hinter sich gebracht, aber immer noch ein paar Blocks vor sich. Seine Fracht hinter sich herziehend, kam er an einer Hip-Hop-Band vorbei, die mit weiten Hosen, einer Stereoanlage, Lautsprechern und Verstärkern ausgestattet war.
Das hier war ihre Straßenecke, und sie hatten bereits eine kleine Menschenmenge angezogen, die klatschend und tanzend im Halbkreis um sie herumwirbelte. Mit fliegenden Dreadlocks rappten und tanzten die Jungs; machten einfach nur Party.
»Yo, Prediger«, rief der Kerl am Mikrofon.
Der Mann mit der Mülltonne blieb stehen, zeigte mit dem Finger auf seinen Hip-Hop-Kumpel und lächelte. »Was geht, Bruder.«
»Wir legen jetzt mal 'n kleinen Freestyle für unseren Prediger hin«, verkündete der Typ am Mikro. Ohne aus dem Rhythmus zu kommen, ging er zu einem neuen Text über. »B-boys in the front, back, side, and middle. Check out my b-boy rhyme and riddle.« B-Boys vorne, hinten, links und rechts, zieht euch meinen Reim rein, hieß das in etwa übersetzt. Dann legten die B-Boys, also die Breakdancer, unter dem Beifall der Menge einen Zahn zu. »Rev teach the black book smooth as butt-ah, but po-lece and white folk dis the broth-ah.« Was so viel bedeutete wie: Der Reverend predigt aus dem schwarzen Buch geschmeidig wie But-taa, aber die Bullen und Weißen dissen den Bru-daa.
Der Mann mit der Mülltonne lächelte und nickte, während er die Energie der Performance in sich aufsaugte. Angefacht vom eigenen wütenden Elan, steigerte sich der Rapper in seinen improvisierten Sprechgesang hinein, wobei der Text von Zeile zu Zeile immer derber wurde. Nach ein paar erhebenden Zeilen über den Prediger kehrte der Song wieder zurück zu althergebrachten Themen wie Sex, Drogen und dem nächsten Kerl, der eine verpasst kriegt. Als der Prediger genug gehört hatte, schlug er sich mit der Faust auf die Brust und richtete den Finger auf den Rapper. »Man sieht sich«, rief er.
Der Rapper nickte ihm zum Abschied zu, ohne seinen Text zu unterbrechen, der nun, da der Prediger im Begriff war zu gehen, immer vulgärer wurde. Und der Mann mit der Mülltonne zog weiter die Straße hinunter.
Als er seine Lieblingsstraßenkreuzung erreichte, hatten sich auf seinem T-Shirt unter den Armen und seinen Rücken hinunter bereits Schweißflecken gebildet. Er zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich über die Stirn. Auf beiden Seiten liefen die Leute an ihm vorbei. Während er seine Anlage auspackte, grüßte er die Touristen und lächelte ihnen zu.
»Lobe den Herrn, Bruder. Wie geht’s?«
Keine Antwort.
»Gottes Segen sei mit Ihnen, Sir.«
Er erntete einen befremdeten Blick.
»Was geht?«
»Hi.« Endlich eine Reaktion, ein erwidertes Lächeln.
Der Prediger hielt dem Mann ein Traktat hin. »Bleib noch ein bisschen«, sagte der Prediger. »Der Gottesdienst geht gleich los.«
Der Tourist lief weiter.
Charles Arnold griff in die Mülltonne und lud seine Geräte aus. Eine Karaoke-Anlage. Zwei große Lautsprecher. Eine abgenutzte Bibel. Ein verknotetes Knäuel aus Kabeln. Ein Mikrofon und eine Zwölf-Volt-Autobatterie von Wal Mart. Er schloss die Anlage an, legte eine CD ein und verwandelte seine Mülltonne in eine Kanzel, seine Straßenecke in eine Kirche.
»Es ist Zeit, unseren Lobgesang anzustimmen!«, rief er halb schreiend, halb singend in sein Mikrofon. Die Gospelklänge dröhnten wegen der billigen Lautsprecher verzerrt aus der Stereoanlage. Charles begann zu singen und sich im Takt der Musik zu wiegen. Die Touristen machten einen weiten Bogen um ihn.
»He’s an on-time God – oh yes He is … He’s an on-time God – oh yes He is … Well, He may not come when you want Him, but He’ll be there right on time … He’s an on-time God – oh yes He is …« Er ist ein pünktlicher Gott, o ja, das ist er. Vielleicht kommt er nicht, wenn du ihn rufst, aber zur rechten Zeit wird er da sein.
Langsam, aber sicher bildete sich eine Menschentraube um ihn. Charles drehte die Musik auf und passte die Lautstärke seiner Stimme entsprechend an. Vor seiner zur Kanzel umfunktionierten Mülltonne stellte er eine leere Kaffeedose mit der Aufschrift Kirchenbeiträge und Spenden auf, in der noch keine einzige Münze lag.
Einige Menschen blieben stehen und sangen mit, andere gaben sich nur ihrer Schaulust hin. Aus vorbeifahrenden Autos schallten anfeuernde Rufe oder Beleidigungen.
Er reckte seine Hände den Touristen entgegen und forderte sie auf abzuklatschen; wurde er ignoriert, unterbrach er seinen Gesang für ein schnelles »Gott segne Sie«. Jedem Passanten schenkte er ein Lächeln, die Beleidigungen der Teenager in ihren aufgemotzten Autos tat er mit einem Schulterzucken ab.
Ein paar Nachzügler fanden ihren Weg zu ihm, sein Publikum wuchs stetig. Etwas abseits begann eine Gruppe junger Mädchen mitzusingen und zu tanzen. Eine von ihnen nahm er bei der Hand und führte sie nach vorne ans Mikrofon. Ihre Freundinnen folgten ihr, sodass er nun einen Chor hatte. Die Autofahrer auf der Straße hupten. Einige drehten ihre Radios lauter, doch gegen Charles’ Lautsprecher kamen sie nicht an. Langsam füllte sich die kleine Blechdose für Kirchenbeiträge und Spenden.
Dann stimmte plötzlich eine kräftige ältere Dame mit viel zu engen Shorts und einem bösen Sonnenbrand ein stimmgewaltiges Solo an. »Amazing Grace«, die Hymne der Straße. Charles bemerkte, wie die Menschen in den ersten Reihen zu lächeln begannen und zustimmend mit den Köpfen nickten. Der Ehemann der Solistin hatte Tränen in den Augen. Zeit für eine Predigt. Charles dankte der Dame, die vom Publikum tosenden Applaus erntete.
»Ihr fragt euch vielleicht, warum ich dieses Treffen einberufen habe«, setzte Charles an, was die Menge mit einem Lachen quittierte. »Heute Abend will ich mit euch über die Sündhaftigkeit der Menschen sprechen, über die ewige Treue Gottes und die Vergebung Christi. Nicht meinem Aufruf ist es zu verdanken, dass ihr euch heute hier versammelt habt, sondern göttlichem Geheiß. Dies könnte die bedeutendste Nacht eures Lebens werden.«
Während er sprach, lief er ständig auf und ab, schüttelte Hände und passte seine Stimme dem Rhythmus der Musik an. Langsam kam er auf Touren und seine Leidenschaft in Wallung.
»Du bist verrückt, Mann«, riefen zwei vorbeilaufende Jugendliche von hinten.
»Das nennt sich die Torheit des Kreuzes«, antwortete er ins Mikrofon. »Ist es verrückt, hier an dieser Straßenecke zu stehen und zu predigen, anstatt an der nächsten zu feiern?« Einige Zuschauer schüttelten verneinend die Köpfe. Die zwei Jugendlichen blieben stehen und schauten zu.
»Ist es etwa verrückt, mich an Christus zu berauschen, anstatt an Crack?«
»Nein, Bruder«, sagte jemand in der Menge.
»Ist es dann vielleicht verrückt, die himmlischen Belohnungen des Paradieses den vergänglichen Reichtümern dieses irdischen Daseins vorzuziehen?«
»Das ist alles andere als verrückt!«, rief eine andere Stimme.
»Menschen, die das geben, was sie nicht behalten können, um etwas zu gewinnen, das sie nicht wieder verlieren können, sind wohl kaum töricht.«
»Amen, Bruder.«
Charles hatte ein paar Leute in der Menge für sich gewinnen können, doch die skeptischen Jugendlichen zeigten sich wenig beeindruckt. Er konnte sehen, wie sich auf ihren Gesichtern ein zynisches Grinsen ausbreitete. Sie winkten ab und gingen kichernd weiter. »Der Typ hat echt ’ne Schraube locker«, murmelte einer von ihnen.
Charles zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder den Gläubigen. Er fand seinen Rhythmus wieder, und sein Publikum wuchs um ein weiteres Dutzend Menschen. Die meisten der Neulinge bedachten ihn aus sicherer Entfernung irritiert mit neugierigen Blicken. Doch ein paar – ein paar gab es immer – drängten sich weiter zu ihm vor. Sie feuerten ihn an mit gut platzierten Rufen wie Amen und Ja, genau und Erzähl es uns.
Charles war so sehr in seinem Element, dass er das Polizeiauto hinter sich nicht bemerkte. Als es anhielt, brach die Verbindung zu seinem Publikum ab, die Blicke der Leute wanderten an ihm vorbei über seine Schulter. Die Gläubigen zogen sich zurück.
Er drehte sich um und sah, wie zwei Polizisten aus dem Wagen stiegen, sich mit verschränkten Armen gegen die Motorhaube lehnten und den Prediger mit grimmigen Blicken in Augenschein nahmen. Der ältere der beiden war ein Mann mittleren Alters mit schroffem Gesicht, bei dem die weiße, pockennarbige Haut auffiel, die schon länger keine Sonne mehr gesehen hatte. Über seine schlaffen Wangen zog sich auf der linken Seite eine Narbe. Er schien mindestens ein Meter neunzig groß zu sein und erinnerte Charles an eine mächtige Eiche, die jedes Jahr einen weiteren Ring an Umfang zulegt.
Der jüngere Polizist versuchte den strengen Blick seines Partners zu imitieren, nur wirkte er bei ihm nicht annähernd so einschüchternd. Dieser Beamte hatte offensichtlich einige Zeit auf der Hantelbank verbracht. Die blaue Uniform spannte über seinem massiven Bizeps und der breiten Brust. Er sah aus wie jemand, der schon sein ganzes Leben zur Polizei wollte – der Schlag Gesetzeshüter, der nur darauf wartete, dass sich ein schwarzer Mann der Verhaftung widersetzte.
Charles musste sich sehr zusammennehmen, um gegen die in ihm aufkeimenden Gefühle anzukämpfen. Bullen … Weißbrote … Cops … die auf dieses schwarze Gesindel von der Straße herabblickten. Überdeutlich wurde ihm der Graben bewusst, der zwischen den Rassen in diesem Land herrschte. Er spürte das dringende Verlangen, diese beiden Männer, die ihn mit ihren selbstgefälligen und arroganten Blicken niedermachten, verbal anzugreifen, doch er wusste, dass sie genau darauf warteten.
Charles Arnold erlebte das nicht zum ersten Mal.
»Nehmen wir nur als Beispiel unsere uniformierten Freunde dort hinten«, sagte er stattdessen in freundlichem Tonfall, während er auf die Beamten zuging. »Wird man von ihnen bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt, verpassen sie einem einen Strafzettel. Da hilft es auch nichts, zu sagen, dass die anderen noch schneller gefahren sind, stimmt es nicht, Officers?«
Keine Reaktion, nur versteinerte Mienen.
Charles wandte sich wieder seinem Publikum zu. »Genauso verhält es sich mit Gott. Es ist keine Entschuldigung zu sagen, dass die anderen schlimmer sind. Das ist kein Wettstreit. ›Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.‹ Und alle heißt wirklich alle …«
Plötzlich war der Ton weg. Charles drehte sich um und sah die Hand des Muskelprotzes am Lautstärkeregler, das hämische Grinsen noch immer im Gesicht. Der ältere Mann, der am Auto lehnte, winkte Charles mit seinem Zeigefinger zu sich heran.
»Entschuldigt mich einen Augenblick«, sagte der Prediger zu dem sich langsam zurückziehenden Publikum. »Ich glaube, ich werde gerade ausgerufen.«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
3
Thomas Hammond legte Joshie sanft in den Schoß seiner Mutter zurück, durchquerte das Wohnzimmer und ging vor seinen beiden anderen Kindern auf die Knie. Er legte seine kräftigen Arme um Tiger und Stinky und drückte sie fest an sich. Dann setzte er sich auf seine Fersen, um mit ihnen zu sprechen.
»Joshie wird nicht sterben«, erklärte er ihnen. »Er war die letzten Tage ziemlich krank, aber in der Bibel gab es viele Leute, die auch krank waren, doch Jesus hat sie wieder gesund gemacht. Wir müssen einfach nur weiter für ihn beten. Versteht ihr das?«
Die beiden kleinen Köpfe nickten so eifrig, dass Stinkys Locken auf und ab sprangen.
»Werden wir ihn zu einem Doktor bringen?«, fragte Stinky.
»Liebling, du weißt doch, was wir von Ärzten halten«, erwiderte Thomas streng. »Wir werden uns lieber an Jesus wenden.«
»War Jesus ein Arzt?«, fragte Tiger.
»Nein, Tiger«, antwortete Thomas mit einem Stirnrunzeln. »Von wem hast du das denn?«
»Jesus hat Leute geheilt«, versuchte Stinky ihrem Bruder zu helfen. Mit großen leuchtenden Augen sah sie ihren Vater an.
Er öffnete den Mund, um ihr die gleichen stur einstudierten Antworten zu geben, die man ihm in der Kirche eingetrichtert hatte, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken.
Er war stark gewesen, ja sogar stur. Drei lange Tage war er in seinem Glauben standhaft geblieben und hatte fast rund um die Uhr gebetet. Zweiundsiebzig quälende Stunden lang. Ihm kam die Geschichte von Abraham in den Sinn, der von Gott dazu aufgefordert worden war, seinen eigenen Sohn zu opfern – wobei Gott dies natürlich nie zugelassen hätte. Im allerletzten Moment, als Abraham das Messer hob, um seinen Sohn zu töten, griff Gott ein und stellte ein anderes Opfer zur Verfügung.
Rief Gott Thomas nun etwa ins Krankenhaus? Das ginge gegen alles, was er in der Kirche gelernt hatte, und schien Gott keineswegs ähnlich zu sehen, aber dasselbe konnte man auch von seiner Forderung Abraham gegenüber behaupten.
Wenn Thomas nun gehorchte, würde Gott dann in letzter Sekunde auf wundersame Weise einschreiten und Joshie heilen? Vielleicht sogar auf dem Weg ins Krankenhaus oder kurz bevor ein Arzt sich das Kind ansehen konnte? Vielleicht war es so. Vielleicht stellte Gott ihn in diesem Moment auf die Probe.
Vielleicht rief Gott ihn ins Tidewater General Hospital.
Während Thomas mit diesem Gedanken rang, wurden Tiger und Stinky immer unruhiger. Thomas konnte ihnen ihre Angst deutlich ansehen, die Sorge um ihren kleinen Bruder, der so reglos wie eine Stoffpuppe in den Armen seiner Mutter lag.
»Zieh deine Cowboystiefel an, Tiger. Stinky, hol deine Turnschuhe. Wir werden nicht einfach nur zu einem Arzt gehen. Wir fahren in ein Krankenhaus, wo es von Ärzten nur so wimmelt.« Thomas sah ihre Augen aufleuchten und lächelte. »Joshie wird wieder gesund werden.«
Stinky schlang die Arme um den Hals ihres Vaters. Tiger rannte den Flur hinunter, um nach seinen Cowboystiefeln zu suchen.
»Superduper!«, rief er. »Wir fahren ins Trantenhaus.«
Hinter Thomas und Stinkys Rücken drückte Theresa im Wohnzimmer Joshie noch fester an ihre Brust. Sie legte ihre Wange an seine Stirn und spürte die glühende Hitze seines Fiebers. Ihr Blick ging zur Decke, während sich ihre Augen erneut mit Tränen füllten.
»Ich danke Dir, Jesus«, flüsterte sie.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
4
Der ältere Cop lehnte am Wagen, während Charles folgsam mit dem in seiner rechten Hand baumelnden Mikrofon vor ihm stand und geduldig die Belehrung zum Thema Genehmigungen und Lärmschutzverordnungen über sich ergehen ließ. Charles warf einen Blick auf das Namensschild des Mannes – der Kerl hieß Thrasher, also Drescher. Passt wahrscheinlich, dachte er.
Aus dem Augenwinkel bemerkte Charles, wie sich seine kleine Gemeinde langsam auflöste. Die wirklich Überzeugten würden bleiben, doch die Schaulustigen waren schon lange weitergezogen. Thrasher schien das auch zu bemerken und ließ sich Zeit. Er zog jedes Wort in die Länge und hielt immer wieder inne, um auf den Gehweg zu spucken, wo sich bereits eine schaumig-weiße Pfütze gebildet hatte.
»Du kennst die Vorschriften, Prediger-Knabe. Das hörst du nicht zum ersten Mal.« Thrasher legte eine Pause ein und spuckte erneut genau in den sich auftürmenden Haufen zu seinen Füßen. »Du hast keine Genehmigung für diese Anlage, und du störst die Händler hier. Warum will das einfach nicht in deinen kleinen kraushaarigen Kopf gehen?«
In meinen kleinen kraushaarigen Kopf?! Charles spürte, wie die Adern an seinem Hals anschwollen. Er versuchte, sich auf den kleinen Spucke-See zu konzentrieren, doch er konnte nur noch an die Strandfest-Aufstände denken, bei denen sich Tausende von afroamerikanischen Studenten während des Springbreak in Virginia Beach Straßenschlachten mit der Strandpolizei geliefert hatten. Noch Jahre später war man damit beschäftigt gewesen, die brutalen Übergriffe, die seitens der Polizei verübt worden waren, aufzuklären. Dieser Typ war damals wahrscheinlich auch mit von der Partie gewesen.
Bleib ruhig. Lass dich nicht provozieren.
»Officer, ich versuche lediglich, den Strand zu einem besseren Ort zu machen.« Er hielt inne, löste seinen Blick vom Boden, sah zu dem Polizisten auf und wartete darauf, dass der Mann blinzelte. »Sind Sie gläubig, Sir?«
Der Muskelprotz trat nun unangenehm dicht an Charles heran, um ihn einzuschüchtern. Charles ging einen Schritt zur Seite und wies den Muskelprotz mit einem eisigen Blick in die Schranken.
»Freundchen, so brauchst du uns gar nicht erst zu kommen«, schnappte Thrasher. »Du kannst predigen, bis du blau anläufst, aber wenn du noch einmal deine Stereoanlage so weit aufdrehst, werden wir das Ding als Beweismittel beschlagnahmen und dich einbuchten. Und so schnell kommst du nicht wieder auf freien Fuß, das verspreche ich dir, Prediger-Knabe.«
Charles seufzte. Warum mussten diese Typen auch immer so dämlich sein. »Drohen Sie mir nicht mit dem Gefängnis, Officer. Glauben Sie, nur weil ich ein schwarzer Straßenprediger bin, bin ich dumm? Ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung …«
Mit einem Satz schnellte Thrasher vor – sehr behände für so einen beleibten Kerl. Er drückte Charles seine Nase ins Gesicht, und auch der Muskelprotz rückte näher und positionierte sich dicht hinter Charles' Schulter.
Thrashers Stimme war nur noch ein bedrohliches Knurren, er betonte jede Silbe. »Komm mir nicht mit diesem Scheiß … Deine Rechte interessieren mich einen feuchten Kehricht.« Der Mann stieß einen übel riechenden heißen Atem aus, der Charles zurückweichen ließ. »Du packst jetzt zusammen und verschwindest, oder du handelst dir eine Menge Ärger ein, habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Hey, lassen Sie den Mann in Ruhe«, schallte es aus der kleinen Gruppe, die noch von der Versammlung übrig geblieben war.
»Ja genau, der hat niemandem etwas getan«, rief ein anderer Zuschauer.
»Wollen Sie sagen, dass ich hier jetzt gar nicht mehr predigen darf, selbst ohne meine Stereoanlage nicht?«, fragte Charles in bewusst ruhigem Tonfall nach.
»Ich will sagen: Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann packst du jetzt einfach deine Sachen und gehst nach Hause.« Thrasher sprach noch immer langsam und in einfachen Sätzen, als würde er mit einem Kind reden. Doch Charles bemerkte, dass der Mann langsam die Kontrolle verlor. Ihm gefiel es ganz und gar nicht, dass die Menge sich gegen ihn wandte. »Und außerdem rate ich dir, dass du dieses Ding nie wieder ohne Genehmigung hierher bringst, wenn du keinen Ärger willst.« Der Polizist zog die Augenbrauen hoch und nickte zum Zeichen, dass die Belehrung zu Ende war und Charles jetzt verschwinden durfte.
»Das habe ich so weit verstanden«, sagte Charles gleichmütig. Er machte auf dem Absatz kehrt, ging um den Muskelprotz herum und beugte sich dann zu seiner Karaoke-Anlage herunter.
Dann warf er den Polizisten einen Blick über die Schultern zu, schob den Lautstärkeregler hoch, erhob sich wieder und fing an mitzusingen. »He’s an on-time God, oh yes He is …«
Das war anscheinend der Moment, auf den der Muskelprotz gewartet hatte. Er kam auf Charles zu, riss ihm das Mikrofon aus der Hand und warf es zu Boden. Dann drehte er Charles mit weit mehr Gewalt als nötig beide Arme auf den Rücken und legte ihm Handschellen an. Unter den Buhrufen der wenigen verbleibenden Zuschauer zog er die Handschellen so fest, dass sie Charles das Blut abschnürten, und begann dann, ihm seine Rechte vorzulesen.
»Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden …« Während er sprach, schob er Charles auf den Rücksitz des Polizeiwagens, nicht ohne ihn vorher noch mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu rammen. In der Zwischenzeit hatte der Beamte namens Thrasher die Musikanlage auseinandergenommen und in den Kofferraum geworfen. Bis auf die Mülltonne würden sie alles als Beweisstücke für ihren Fall beschlagnahmen.
»Ihr Typen seid Schweine. Lasst ihn in Ruhe«, rief ein Mann mit Ziegenbart, als er sah, wie die Polizisten mit Charles umsprangen.
Der muskelbepackte Officer zeigte auf ihn, wie ein Wrestler, der seinen nächsten Gegner herausfordert. »Halt’s Maul oder du bist als Nächster dran«, warnte er ihn.
»Jetzt habe ich aber Angst«, erwiderte der Mann, drehte sich um und ging davon.
Während der Fahrt im Polizeiauto musste Charles sich sehr zusammennehmen, um nicht die Fassung zu verlieren. Thrasher saß am Steuer und meldete den Vorfall über Funk, wobei er Charles in der dritten Person beschrieb – der »Täter« dies und der »Täter« das, als wäre Charles ein großer Drogendealer. Von dem Schubser des muskulösen Beamten gegen den Türrahmen hatte Charles jetzt auch noch Kopfschmerzen.
»Ähm, Jungs, ihr habt mir die Handschellen etwas zu fest angelegt«, rief Charles durch das kugelsichere Glas, das ihn von den Beamten trennte. »Ich meine, es ist ja nicht so, als müsstet ihr Angst haben, dass ich mich gleich aus dem Staub mache oder so …«
»Halt’s Maul!«, bellte der Muskelprotz ihn an, der sich auf dem Beifahrersitz herumgedreht hatte und Charles nun böse anstarrte. »Für heute Abend haben wir genug von dir gehört.«
»Also greift das Recht auf freie Meinungsäußerung jetzt auch nicht mehr in diesem Polizeiwagen? Ist das so? Sollte Virginia Beach etwa mittlerweile eine verfassungsfreie Zone geworden sein?«
»Der Reverend da hinten hält sich wohl für besonders goldig«, sagte Thrasher zu seinem jüngeren Kollegen. »Ich finde ihn auch sehr goldig. Diese Art Typen sehen besonders goldig aus, wenn sie Ketten, Handschellen oder Dobermänner am Körper haben.«
Die Polizisten brachen in schallendes Gelächter aus. Charles unterdrückte das Verlangen, gegen die Scheibe zu spucken. Er wollte diesen Typen keine Entschuldigung liefern, ihn aufzumischen.
»Hey, Fettie, wie lautet die Anklage?«, rief Charles Thrasher entgegen. »Ist euch schon mal in den Sinn gekommen, den Leuten mitzuteilen, wofür ihr sie einbuchten wollt?«
»Hässlich sein in der Öffentlichkeit«, erwiderte Thrasher, woraufhin die Polizisten erneut in Gelächter ausbrachen, bevor der ältere Beamte wieder ernst wurde. »Hör zu, Reverend, du hast offensichtlich ganz unverhohlen gegen die Lärmverordnung verstoßen. Wir waren bereit, ein Auge zuzudrücken und es bei einer Verwarnung zu belassen, aber du wolltest ja nicht hören. Also … haben wir dich jetzt auch noch für Widerstand bei der Festnahme am Haken.«
»Das soll wohl ein Witz sein«, protestierte Charles. »Nie im Leben hält diese Anklage vor Gericht stand.«
Thrasher hob die Hand und blickte in den Rückspiegel. »Sag uns nicht, wie wir unseren Job zu machen haben«, brüllte er über seine Schulter. »Geh du deinem Job dort draußen auf der Straße nach – nur lass nächstes Mal die Anlage zu Hause – und wir machen unseren.«
»Das ist nicht mein Job«, erwiderte Charles. »Sondern mein geistliches Amt.«
»Willst du damit etwa andeuten, dass der Reverend einen richtigen Job hat, der ihm sogar Geld einbringt?«, spottete der Muskelprotz. »Sollte er etwa ein steuerzahlender Bürger sein – das ändert natürlich alles.«
»Wo arbeitest du, Bursche? Bei Kentucky Fried Chicken?«, schnaubte Thrasher verächtlich.
»Ich lehre«, sagte Charles schlicht.
»Ein Lehrer.« Der Muskelprotz grinste. »Stell dir vor, tagsüber Lehrer, nachts Prediger. Vielleicht sollten wir ihn ab jetzt Professor nennen. Wo lehrst du denn, Prof?«
»An der Rechtsfakultät der Regent University«, erwiderte Charles.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
5
Das war einer der Gründe, warum Thomas Hammond Krankenhäuser wie der Teufel das Weihwasser mied. Er besaß keine Krankenversicherung, nur den felsenfesten Glauben an Wunder. Und jetzt würde man ihn wie einen Kriminellen behandeln.
»Beruf?«, fragte die Dame hinter der gewaltigen Resopaltheke in der Aufnahme. Thomas jonglierte Tiger auf seinem Knie, während Stinky im Wartezimmer geblieben war, um fernzusehen.
»Selbstständig.«
»Versicherung?«
»Keine.«
»Wie bitte?« Sie hörte auf zu schreiben und sah zum ersten Mal von ihren Unterlagen hoch, eine Augenbraue hochgezogen. »Sie sind nicht krankenversichert?«
»Nein, wir werden selbst für die Behandlung aufkommen.«
Missbilligend schüttelte sie kaum merklich den Kopf und spitzte den Mund. »Wer ist der behandelnde Kinderarzt?«
»Wir haben keinen«, erklärte Thomas trotzig. Wieder sah er diesen Blick über das Gesicht der Dame huschen. Sie machte keinerlei Anstalten, ihn zu verbergen. Sie hätte die Worte auch laut aussprechen können. Weißer Abschaum.
»Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ihn hierhin zu bringen«, murmelte Thomas.
»Wie ist das denn gemeint?«, fragte die Bürokraft, während sie in die obere rechte Schublade ihres Schreibtisches griff und einen Stapel Formulare vom Gesundheitsdienst für Bedürftige hervorzog.
Dr. Sean Armistead blieb vor Behandlungsraum 4 der Notaufnahme stehen, um die Einschätzung der Triage-Schwester durchzulesen. Er sah sich immer erst das Behandlungsblatt an, bevor er persönlich mit einem Patienten sprach, selbst in einer Nacht wie dieser, wo sie in Arbeit förmlich ertranken. Armistead wollte wissen, womit er es zu tun bekam. Ein Arzt sollte stets selbstsicher wirken; Patienten ging es sehr viel besser, wenn der Arzt von Anfang an wusste, wovon er sprach.
Er war schon seit drei Uhr nachmittags im Dienst und hatte zusätzlich zu der üblichen Parade von Verletzungen, die man in der Notaufnahme zu Gesicht bekam, bereits zwei Not-OPs hinter sich. Eine Messerstecherei und eine Schussverletzung. In Virginia Beach herrschten zusehends amerikanische Großstadtverhältnisse.
Die Operationen hatten seinen bereits sehr gedrängten Terminplan vollends überlastet. Jetzt mussten er und sein Partner, so gut es ging, den Rückstand abarbeiten, da das Wartezimmer mittlerweile hoffnungslos überfüllt war. Das hier sollte daher besser schnell gehen und das Behandlungsblatt akkurat sein, für alles andere hatte er keine Zeit.
Zeitpunkt der Aufnahme: 9.04 Uhr. Jetzt war es 9.30 Uhr. Der Patient hatte etwas warten müssen, aber das ließ sich nicht vermeiden. Name des Patienten: Joshua Hammond. Alter: 20 Monate. Sein Blick wanderte zu dem Abschnitt, in dem die Beschwerden des Patienten aufgelistet wurden. Patient m Fieber 41°, ↓ Aktivität, lustlos, allgemeines Unwohlsein, n, v, seit 3 Tagen, empfindlicher und aufgeblähter Abdomen.
Diesem Kind ging es wirklich schlecht.
Das Fieber wurde wahrscheinlich rektal gemessen, dann fiel das Ergebnis immer ein Grad höher aus. Trotzdem war selbst eine Temperatur von 40 Grad mehr als besorgniserregend. Das Kind war energielos, schlapp. Dem Aufnahmeprotokoll zufolge zeigte es verminderte Aktivität und hatte keinerlei Interesse zu spielen. Ihm tat alles weh – daher der Vermerk über das allgemeine Unwohlsein –, sein Bauch besonders empfindlich und geschwollen. Der arme Kerl litt schon seit drei Tagen unter Übelkeit und Erbrechen. Drei Tage! Was für Eltern legten bei solchen Symptomen drei Tage lang die Hände in den Schoß, bevor sie einen Arzt aufsuchten?
Allein anhand des Krankenblatts konnte Armistead eine erste Diagnose formulieren. Es handelte sich wahrscheinlich um eine Bauchfellentzündung. Gift im Organismus. Kein Gift im wortwörtlichen Sinne, aber ebenso tödlich. Die schwere bakterielle Infektion konnte den Zusammenbruch des Nervensystems und lebenswichtiger Organe herbeiführen. In diesem Fall war die Wurzel allen Übels wahrscheinlich im Blinddarm zu finden, der wahrscheinlich geplatzt war und nun den Darminhalt in Joshuas Bauchraum und somit auch in seinen Blutkreislauf entleerte.
Am ersten Tag wäre sein Zustand noch nicht lebensbedrohlich gewesen. Selbst am zweiten noch nicht.
Doch jetzt, wo Joshua lethargisch geworden war, hohes Fieber hatte und einen erhöhten Puls von 118, dazu noch einen gefährlich niedrigen Blutdruck und eine Atemfrequenz von 28, konnte man für nichts mehr garantieren.
Armistead wusste, was zu erwarten war. Wenn sie das Kind operierten und den Blinddarm entfernten, würden sie auf unzählige Infektionsherde stoßen, die durch Eiter und Fäkalspuren im Inneren des Bauches hervorgerufen worden waren. Er hatte schon einige schwere Fälle von Bauchfellentzündung in die Notaufnahme wanken sehen, doch keinen so ernst zu nehmenden wie diesen. Das Kind war hypotonisch und in extrem schlechter Verfassung. Die drei Tage des vergeblichen Kampfes gegen die Bakterien hatten ihren Tribut gefordert.
Mit dem Krankenblatt unter dem rechten Arm machte Armistead sich kopfschüttelnd bereit, das Behandlungszimmer Nummer 4 zu betreten. Er drückte die Tür auf und reichte einer Mutter die Hand, die drei lange Tage gewartet hatte, bevor sie ihr sterbendes Baby zu ihm brachte, damit er helfen konnte.
Er zwang sich zu lächeln.
Theresa schaute auf, als die Tür sich öffnete.
»Ich bin Dr. Armistead. Wie geht es unserem kleinen Patienten?«, fragte der Arzt bemüht freundlich.
Theresa saß mit Joshie auf dem Schoß vor dem Untersuchungstisch. Ihr Sohn lag apathisch auf seiner linken Seite in ihren Armen und hatte die Knie angezogen. Theresa schüttelte Dr. Armistead die Hand und versuchte, sein dünnes Lächeln zu erwidern.
Er war jünger, als Theresa erwartet hatte. Und auch kleiner. Er hatte bereits licht werdendes hellblondes Haar, scharfe Wangenknochen, durchdringende Augen und einen kantigen Kiefer. Wenn er lächelte, kamen seine perfekt weißen Zähne zum Vorschein, die im extremen Kontrast zu seinen schmalen grauen Augen und dem intensiven Blick hinter der kleinen Drahtgestellbrille standen.
Sein perfektes Auftreten, die kerzengerade Haltung und der akkurat gebügelte Arztkittel führten Theresa vor Augen, wie schlampig sie aussah. Bis jetzt, wo sie diesem vor Selbstsicherheit und Haltung strotzenden Arzt gegenüberstand, hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht, welch erbärmlichen Anblick sie selbst bot.
»Nicht so gut«, gestand Theresa. »Er hat seit ein paar Tagen Fieber, und jetzt ist er ziemlich … leblos, denke ich.« Die eigene Wortwahl ließ sie das Gesicht verziehen. Irgendetwas an Dr. Armistead wirkte einschüchternd auf sie, rief in ihr ein Gefühl von Unzulänglichkeit hervor.
Er beugte sich zu ihr herunter und begann an Josh herumzudoktern. Er untersuchte Ohren, Nase und Hals. Dann überprüfte er Joshs Puls noch einmal persönlich und bestätigte den Wert von 118. Mit einem kalten Stethoskop horchte er über seine blanke Haut die Lungen ab.
»Beschleunigte und schwerfällige Atmung«, bestätigte der Arzt. Als er mit der Hand Druck auf die rechte Seite des Unterbauchs ausübte, reagierte Josh mit einem Stöhnen.
»Hey, Kumpel«, sagte Armistead, während er an dem kleinen Körper herumhantierte. »Kannst du mir sagen, wo es wehtut? Tut das weh? … Und das? …« Bei einigen Berührungen zuckte Josh zusammen, bei anderen blieb er stoisch. »O Mann, du bist echt ein tapferer kleiner Kerl.« Er strubbelte Joshie über den Kopf, wobei er die bereits zerzausten Haare noch mehr durcheinanderbrachte, und sah dann über den Kopf des kleinen Jungen Theresa direkt ins Gesicht.
»Wann ist Ihnen das Fieber zum ersten Mal aufgefallen?«
»Ähm … das war vielleicht vor etwa drei Tagen.«
»Sie wissen, dass wir es hier mit einer ziemlich hohen Temperatur zu tun haben, oder? Einundvierzig Grad rektal gemessen. Wann immer das Fieber über neununddreißig Grad steigt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, okay?«
»Ja, Sir. Heute Morgen war das Fieber erst bei 39,5 Grad. Ich habe alles versucht, damit es nicht höher steigt.«
Armistead war gerade dabei, ein paar Anmerkungen auf das Krankenblatt zu kritzeln. Jetzt hielt er inne, warf Theresa wortlos einen Blick zu und schrieb dann weiter.
»Wie lange ist er schon so lustlos und lethargisch wie jetzt?«
»Erst seit heute, höchstens seit gestern … Ich meine, Sie müssen wissen, dass er immer ganz schlapp ist, wenn er Fieber hat, aber heute Morgen erst habe ich bemerkt, dass er auf gar nichts mehr reagiert.«
Theresa starrte auf Joshies Kopf herunter, nicht willens, den vorwurfsvollen Augen des Arztes zu begegnen.
»Ich denke, dass wir es hier mit einer Bauchfellentzündung zu tun haben«, fuhr Armistead fort, während er weiter das Krankenblatt studierte. »Er zeigt alle entsprechenden Symptome. Wir sollten ein komplettes Blutbild und eine Urinuntersuchung machen, um die Leukozytenzahl zu bestimmen und andere Ursachen auszuschließen.« Er machte sich weitere Notizen und murmelte etwas, das mehr an sich selbst als an Theresa adressiert war. »Ich verstehe nicht, warum sie nicht schon längst Proben ins Labor gegeben hat, mir wäre es lieb gewesen, wenn die entsprechenden Schritte bereits in die Wege geleitet worden wären.«
Dann wandte er sich wieder Theresa zu; sein gekünsteltes Lächeln war einem Stirnrunzeln gewichen. Er zog sich einen Stuhl zu ihr heran, sodass sie sich nun Auge in Auge gegenübersaßen. »Normalerweise ist eine Blinddarmentzündung in Joshuas Alter nichts Lebensbedrohliches, vorausgesetzt, sie wird rechtzeitig behandelt«, belehrte er Theresa. Der emotionslose Tonfall ließ seine Worte noch vorwurfsvoller wirken.
»Doch wenn der Blinddarm eines Kindes platzt, wird sein gesamter Organismus vergiftet. Zögert man die Behandlung zu lange hinaus, kann das zu einer Bauchfellentzündung führen und letztendlich zu einem septischen Schock. Der gesamte Blutkreislauf und das zentrale Nervensystem können schwere Schäden davontragen, wenn die Ursache für die Bauchfellentzündung nicht bekämpft wird. Joshua zeigt die klassischen Anzeichen für einen septischen Schock. Wir werden ihn wahrscheinlich schnellstmöglich operieren müssen, doch zuerst wollen wir ihn mit einer Infusion aufpäppeln, ihm ein paar Antibiotika geben und seinen Zustand für die Operation stabilisieren. Sobald wir ihm die Flüssigkeit und die Medikamente verabreicht haben, werde ich Sie über die Risiken der Operation aufklären. Aber glauben Sie mir: Die Risiken sind unendlich viel höher, wenn wir die OP nicht durchführen und das Problem nicht behandeln.«
Armistead hielt inne und ließ die Stille wirken. Die unausgesprochene Kritik hing zwischen ihnen in der Luft und schrie förmlich nach einer Antwort. Es war offensichtlich, dass der Arzt nichts mehr sagen würde, bis Theresa seinen Vorwurf beantwortet hatte.
Warum? Warum hatte sie so lange gewartet?
»Unsere Kirche lehrt uns, dass Heilung nur durch die Hand Gottes und nicht durch die Hand des Menschen gewährt wird.« Sie sprach leise, während sie die Last der eigenen Schuld spürte und Joshuas Rücken streichelte. »Mein Mann und ich wussten, dass wir früher hätten kommen sollen, aber wir wussten auch, dass unsere Kirche es verbieten würde. Diese letzten Tage waren unfassbar schwer …« Ihre Stimme brach ab. Sie hatte genug gesagt.
Armistead ließ die strafende Stille noch ein wenig länger andauern, bis er schließlich sprach. »Die letzten Tage waren nicht nur für Sie und Ihren Mann schwer, sondern auch für Joshua. Ein geplatzter Blinddarm ist eine extrem schmerzhafte Angelegenheit. Beim heutigen Stand der Medizin sollte kein Kind wegen eines geplatzten Blinddarms drei Tage lang Schmerzen erdulden müssen. Aber jetzt sind Sie ja hier, und es war die richtige Entscheidung von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Lassen Sie uns jetzt versuchen, Joshuas Schmerzen zu lindern und ihn wieder auf den Weg der Genesung zu bringen.«
Wieder zerzauste er Joshua das Haar, dann stand er auf, um zu gehen.
»Wird er wieder gesund werden?«, fragte Theresa ängstlich. Es war mehr ein Flehen als eine Bitte.
»Wir werden unser Bestes geben«, versprach Armistead. »Schwester Pearsall wird gleich bei Ihnen sein.«
Mit diesen Worten griff er sich das Krankenblatt und verließ den Raum.
Im Gang schrieb Armistead schnell die Diagnose und seine Anordnungen nieder. Dx: Appendizitis, mit einsetzender Peritonitis und Sepsis. Harnwegsinfektion ausschließen. Für OP vorbereiten. Anweisung: Blutbild, Urinuntersuchung, Antibiotika und Hyperalimentation.
Er musste Joshua auf die OP vorbereiten, die Antikörper des Jungen aufbauen und alle anderen Ursachen für seine Schmerzen im rechten unteren Bereich seines Bauches ausschließen, wie z. B. eine Harnwegsinfektion. Eine ganz normale Standardprozedur. Das Einmaleins der Notfallmedizin.
Doch es war die eine Anweisung, die er nicht ins Krankenblatt schrieb, die ihn zögern ließ, bevor er zum nächsten Patienten überging. Sollte er das Kind hier am Tidewater General behalten oder es an das Kinderkrankenhaus in Norfolk überweisen?
Normalerweise wurden solche Fälle an das Norfolk Children’s Hospital weitergeleitet, das auf Kinderkrankenpflege und Kinderchirurgie spezialisiert war. Dort verfügte man über die neuste Technologie und entsprechende Spezialisten, die selbst Kinder mit den kritischsten Erkrankungen zu retten vermochten. Und so wie Armistead den Fall einschätzte, würde Joshuas Behandlung eine echte Herausforderung darstellen, da die Sepsis wahrscheinlich schon alle wichtigen Organe in Mitleidenschaft gezogen hatte.
Allein schon aus Gründen der Haftung, die keinen geringen Stellenwert bei dieser Überlegung einnahmen, wäre es ratsam, das Kind an eine Einrichtung wie das Norfolk Children’s zu überweisen, die als beste Kinderklinik im Südosten Virginias galt. Armistead selbst hingegen hielt diesen Ruf für nicht gerechtfertigt. Auch am Tidewater General gab es sehr gute Chirurgen, die seiner Meinung nach besser waren als die meisten des Kinderkrankenhauses von Norfolk. Außerdem sträubte er sich, das Kind diesen Großstadtkrankenhaus-Primadonnen zu überlassen, die später die Lorbeeren für die Heilung eines Kindes einheimsen würden, mit dem die Ärzte des Tidewater General überfordert gewesen waren.
Und was, wenn die Spezialisten am Kinderkrankenhaus von Norfolk den Jungen nicht retten konnten? Dann würden sie die Schuld mit Sicherheit auf die halbe Stunde Wartezeit schieben, die Joshua in der Notaufnahme des Tidewater General verbringen musste, bevor er endlich untersucht worden war. Trotz der dreitägigen gefährlichen Vernachlässigung seitens der Eltern würden diese großspurigen Angeber in Norfolk behaupten, dass diese zusätzliche halbe Stunde ausschlaggebend gewesen sei. Oder sie würden etwas anderes finden, an dem sie etwas auszusetzen hatten, wie z. B. Armisteads Anordnungen oder irgendetwas, das bei der Überstellung des Patienten schiefgelaufen war.
Nein, es machte keinen Sinn, Joshua an das andere Krankenhaus zu überweisen. Armistead würde den Jungen hierbehalten, wo er praktisch auf gleichem Niveau behandelt werden würde, ohne dass jeder von Armisteads Schritten hinterfragt wurde.
Ein Krankenhauswechsel war eine zeitintensive Angelegenheit – und diesem Patienten blieb keine Zeit. Selbst wenn er seine persönliche Abneigung gegen die Klinik außer Acht ließ und sich nur auf die beste Option für seinen Patienten konzentrierte, war seine Entscheidung noch immer sinnvoll.
Sie würden Joshua hier operieren. Auf keinen Fall würde Armistead eine Überweisung an ein Krankenhaus anordnen, das vor fünf Jahren seine Bewerbung zur Ausbildung als Facharzt abgelehnt hatte. Und das gleich zweimal.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
6
Wer auch immer das Wartezimmer der Notaufnahme entworfen hatte, wusste offensichtlich nichts über Kinder. Tiger war bereits zum dritten Mal von seinem Vater ermahnt worden, still zu sitzen, jedes Mal lauter. Er hatte es auch wirklich versucht, aber die Zeitschriften für Kinder waren einfach nicht interessant genug, sodass er herumgerannt war und nun zur Strafe sehr lange Zeit auf seinem Stuhl ausharren musste. Obwohl Tiger sich immer wieder lautstark räusperte, schien sein Vater inzwischen vergessen zu haben, dass sein Sohn noch immer auf diesem Stuhl festsaß. Es hatte nicht den Anschein, als würde er in nächster Zeit aufstehen können.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!