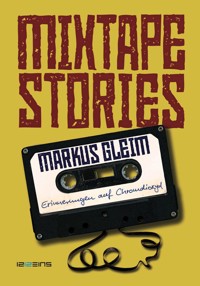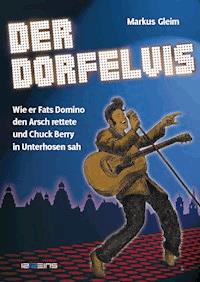
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon sehr früh infiziert sich Markus mit dem Virus Rock & Roll und Rockabilly. Unerwartet bekommt er die Chance bei einer Rock & Roll-Band einzusteigen, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Hobby wird zum Traum. Dann ein schwerer Unfall mit dem Motorrad. Der Aufschlag ist mörderisch. Brutal. Vollstreckend. Die Diagnose: Schwerbehindert. War es das mit der Rockstarkarriere? Markus beißt sich durch. Bei Auftritten im Fernsehen, unter anderem bei Stefan Raab und bei Gigs mit Chuck Berry oder Fats Domino, bei der Meisterschaftfeier des 1. FC Kaiserslautern, beginnt die Band sich einen Namen in der Clubszene in Deutschland zu machen. Sie rocken Deutschland von Flensburg bis Garmisch und Europa von Dänemark bis in die Schweiz. Dabei erleben die jungen Rockmusiker saukomische und skurrile Situation. Der schwerbehinderte Musiker Markus lernt eine Menge Leute kennen und bekommt zusammen mit den Haudegen seiner Truppe einen Einblick in das "Monkey Business".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Gleim
Der Dorfelvis
Wie er Fats Domino den Arsch rettete und Chuck Berry in Unterhosen sah.
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. „Damals“
2. „Ich glotz TV“
3. „Bonanzarad“
4. „Die schönste Zeit“
5. „Urlaub, mach mal Urlaub“
6. „Ganz normale Leben“
7. „Another Brick in The Wall“
8. „Alkohol“
9. „Musikanten, ihr seid Kerle“
10. „Magical Mystery Tour“
11. „BMW“
12. „Whiskey For The Roadies“
13. „Lass uns leben“
14. „Mein Konzert“
15. „Losing My Religion“
16. „Muss i denn zum Städtele hinaus“
17. „It´s All Over Baby“
18. „Die Zeit vergeht“
19. „Hier im Ort ist ein Gericht“
20. „Applaus, Applaus“
21. „I´m Still Loving You“
22. „Danke“
23. „Bonustrack - Gema“
24. „Bonustrack – CD“
25. „Bonustrack – Fernsehsendung“
26. „Bonustrack - Konzert“
27. „Nachwort“
Impressum neobooks
1. „Damals“
Fernseher aus Fenstern werfen.
Hotelzimmer verwüsten. Zimmerbars leer saufen und tonnenschwere Weiber stemmen.
Das alles wollte ich machen.
Ein Rockstar sein.
Auch wenn ich damals rein körperlich gar nicht in der Lage war, Fernseher zu heben, geschweige denn, sie aus Fenstern zu werfen. Mit meinen Eltern und meiner Schwester verbrachte ich die Schulferien immer in einem winzigen Wohnwagen an der Nordsee und hatte ein Hotelzimmer noch nie von innen gesehen. Mein Lieblingsgetränk war der Almdudler und von der Existenz diverser Zimmerbars hatte ich noch nichts gehört. Und mit der Aussage „tonnenschwere Weiber stemmen“ konnte ich auch nix anfangen. Warum, um Gottes Willen, sollte ich bitte Weiber stemmen? Und Tonnenschwere noch dazu?
Ich war damals so ungefähr 10 oder 11 Jahre alt, was sollte ich nur davon halten?
Aber es klang gut. Dinge kaputt machen und anderen Leuten ihre Sachen weg saufen. Über das mit den Weibern stemmen müsste man noch mal reden. Das klang irgendwie anstrengend.
1968, im Jahr der psychedelischen, rockigen und gitarrenlastigen Sounds der Flower-Power- und der Beatnik-Bewegung, wurde ich geboren. Somit waren also schon ein paar Weichen in Richtung Weltstar, im Fachbereich Musik, gelegt. Die Entscheidung, weltbekannter und bedeutender Rockstar zu werden, fiel letztlich Ende der 70er. Immer freitagabends auf Bayern 1 wurde das Telefonwunschkonzert mit Klaus Havenstein und Ruth Kappelsberger gesendet. So ein altes, schwarzes Bakelttelefon mit Wählscheibe rasselte wie ein alter Wecker in der laufenden Sendung und Herr Havenstein, mit seinem sonoren Bass und Frau Kappelsberger, mit angenehm weicher Stimme, erfüllten mit Münchner Lokalkolorit die telefonischen Musikwünsche der Anrufer. Während des Gesprächs, hastete ein Musikredakteur-Assi im Laufschritt in das Kellerarchiv der bayerischen Sendeanstalt, um die gewünschte Vinylscheibe rechtzeitig ins Sendestudio zu bringen. So versuchten die beiden Moderatoren es uns zumindest glauben zu machen und zumindest ich, mit meinen 11 Jahren, war mir sicher, dass das so auch stimmte. Festplatten, auf denen tausende von MP3-Dateien gespeichert waren, sollte es erst viele, viele Jahre später geben, um durch Flure sprintende Musikredakteure überflüssig zu machen.
Ganz oft wurden deutschsprachige Oldies gespielt. Zum Beispiel Gus Backus mit „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ oder „Brauner Bär und weiße Taube“. Das Hazy Osterwald Sextett mit dem „Kriminaltango“, „Ich möcht´ so gern Dave Dudley hör´n“ von Truck Stop oder natürlich Drafi Deutschers Gassenhauer „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und noch viele andere. Auch mein damaliges Lieblingslied der Saragossa Band „Zabadak“ konnte ich hören und die Hymne „Rom“ von Dschingis Khan.
Ich könnte es echt heute noch mitsingen. Grundsätzlich gefiel mir aber irgendwie alles. Ich konnte mich da gar nicht richtig festlegen. War es ein gutes Lied, gefiel es mir einfach, unabhängig seines Genres. Status Quo und „Whatever You Want“ oder AC/DC mit „T.N.T“ fand ich genauso gut wie Jonny Hill mit „Ruf Teddybär 1.4.“ Die Anrufer wünschten sich aber auch jeden Freitag Lieder der Beatles, von Elvis Presley oder von Bill Haley. Ebenso von Del Vikings und Dion And The Belmonts. Es wurden Lieder von Fats Domino, Chuck Berry oder Jerry Lee Lewis gespielt und noch vielen anderen amerikanischen Stars der 50er und 60er. Damals wurde ich schon mit dem Virus Rock & Roll geimpft, von dem ich nie mehr wirklich geheilt werden sollte. Hätte mir damals schon irgendjemand erzählt, dass ich mit einigen von ihnen mal auf einer Bühne stehen sollte, ich hätte es ihm sicher nicht geglaubt. Auf einem Regal an der Kopfseite meines Bettes stand ein Radiorekorder, mit dem ich mir all dieser Lieder aus dem Radio auf Kassette aufnahm. Später am Abend, wenn ich im Bett lag, führte ich diese Lieder auf meiner eigenen „Bühne“ auf und war Rockstar. Ich hatte Kopfhörer auf und war wahlweise Gitarrist und Sänger oder Schlagzeuger. Damals war ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich eher ein Frontmann werden wollte, der im gleißenden Scheinwerferlicht von hunderten, gleichaltrigen Mädchen umjubelt und mit BHs und Höschen beworfen werden wollte. Der Gedanke mit Unterwäsche beworfen zu werden, hatte aber irgendwie was leicht ekliges, ich kannte schließlich meine eigene Unterwäsche, auf die ich ab und zu nicht besonders stolz war. Daher tendierte ich des öfteren zum Schlagzeuger. Der Schlagzeuger saß mit seinem Instrument hinter der Band im Halbdunkel der Bühne, leicht erhöht, auf einem Podest, um die Kapelle mit seinem groovenden Rhythmus anzutreiben und so weit würden Mädchen nicht werfen können. Ich hatte eine aus Pappe ausgeschnittene E-Gitarre und zwei gleichlange Holzstäbe, zwischen denen ich je nach Lied wechselte. Wenn ich den Text mit meinen beschränkten Englischkenntnissen verstehen konnte und gab es ein cooles Gitarrensolo, war ich Sänger und Gitarrist. War es ein Lied, bei dem der Rhythmus wichtig war, mochte ich natürlich lieber Schlagzeuger sein. Der Queen-Klassiker „We Will Rock You“ löste da jedes mal einen echten Gewissenskonflikt aus. Nur vom Musikstil konnte ich das also nicht abhängig machen. Hardrock? Klar. Gitarrist und Sänger. Schlager? Könnte als Sänger peinlich werden. Lieber Schlagzeuger. Elvis Presley? Ganz klar: Sänger. Viele jubelnde Mädchen vor der Bühne waren schon klasse, da würde ich gebrauchte Unterwäsche gerne in kauf nehmen. Ich habe auch heute noch keinen fest gelegten Musikgeschmack. Auf meinem aktuellen USB-Stick folgt auf „Ain´t No Fun Waiting Round to Be A Millionär“ von AC/DC, José Carreras „Ave Maria“. Danach kommt das A cappella-Stück „Breakfast With Aliens“ von den Flying Pickets.
÷
Heute bin ich 45 Jahre alt und rase mit brachialer Geschwindigkeit auf direktem Weg auf meine Midlife-Crisis zu. Denke ich wenigstens.
Ich heiße Schlemmi. Also eigentlich heiße ich Markus. Den Spitznamen Schlemmi bekam ich schon in der Grundschule und ich hatte nie eine Chance gehabt, mich dagegen zu wehren. Schlemmi war irgendwann da und ich wurde von jedem so genannt. Tatsächlich gibt es aber wirklich eine Geschichte zum Schlemmi. Es war nämlich so, dass ich in der ersten Klasse einem Schulkumpel damals oft das Pausenbrot weg aß. Nicht, weil ich nichts von zu Hause mitbekam, nein, einfach weil ich immer so großen Hunger hatte. Also fragte ich ihn, ob er mir nicht etwas von seiner Stulle abgeben könnte, was er auch tat. Er meinte damals immer, ich würde zu viel schlemmen. Aus dem Schlemmer entwickelte sich dann eben mit der Zeit der Schlemmi. Es gibt aber auch die Variante, bei der irgendein netter Schulkamerad aus meinem Nachnamen „Gleim“, den „Schleim“ und dann den Schlemmi machte. Ich persönlich bevorzuge die erste Version, weil ich den Teil mit dem Schleim nicht mag. Außerdem weiß ich nicht mehr, wer das mit dem Schleim gesagt hat, so dass ich mich dafür rächen könnte. Aber bei der Butterstulle weiß ich sehr wohl, wer mir das eingebrockt hat und das war einer meiner Schulkumpels aus der ersten Klasse und den mag ich heute immer noch. Daher bestehen diesbezüglich keine Rachepläne. Na ja, jedenfalls verfolgt mich der Schlemmi bis heute und holt mich auch immer wieder beharrlich ein. Wahrscheinlich hätte selbst das Zeugenschutzprogramm der Polizei nichts daran ändern können, egal wie oft ich Schule, Stadt und Freunde gewechselt hätte.
Spitznamen sucht man sich in der Regel nicht selber aus, wie man hier sehen kann. Denn dann hätte ich wahrscheinlich so was wie „Big M.“, „M-Unit“, „M-Mashine“ oder „Cool Move M.“ gewählt, auch wenn ich in der Grundschule mangels Englischkenntnissen keine Ahnung gehabt hätte, was das bedeutete. Spitznamen erhält man meistens durch blöde Situationen.
Zum Beispiel durch Trinkspiele, die in irgendeiner Form aus dem Ruder laufen oder weil einem irgendwas Lustiges oder Peinliches passiert. Und das auch meistens erst im Alter von etwa 16 Jahren. Es hat aber mit ziemlicher Sicherheit irgendwas mit Alkohol und einer Party zu tun. Gehen Sie doch mal die Spitznamen Ihrer Freunde durch.
Einen Kumpel von mir nannten wir nur „Kotzi“. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Einen anderen nannten wir seit einer Party, bei der ein riesiger Topf Chili auf dem Herd vor sich hin köchelte, nur noch „den Furz“ Also eigentlich „Feuer-Furz“, aber das war zu lang. Darum nur „Furz“. Es wusste eh jeder, was gemeint war. Sie verstehen sicher den Zusammenhang zwischen Chili, Fürzen und Feuer und vor allem ihre chemische Reaktion miteinander.
In der ersten Klasse wurde uns an Hand der Vornamen der Zweck von Silben erklärt. Dazu teilte unsere Klassenlehrerin, Frau Beckert, die Klasse namentlich in Ein-, Zwei- und Dreisilber. Ich stellte fest, dass bei Namen wie Matthias mindestens noch drei andere „Hier“ riefen und wie langweilig außerdem die Namen der anderen waren und ab da war Schlemmi in Ordnung für mich. Es hatte etwas Unverwechselbares.
Da natürlich auch damals schon dem blödesten Erstklässler klar war, dass mehr immer besser als weniger war. Mit dieser Klassifizierung trieb Frau Beckert einen nahezu tödlichen Keil in die Klassengemeinschaft, der bis zum Ende des Schuljahres tief in unserem Fleisch stecken sollte. Drei war besser als zwei oder eine Silbe. Wie Klaus. Ein Ein-Silber. Arme Sau. Oder Jan. Gleiches Schicksal. Alle anderen waren Zwei-Silber. Thorsten, Peter oder Werner und wie sie alle hießen. Die Mädchen waren mindestens Zwei-Silber, meistens aber Drei bis Vier-Silber. Aber wen interessierten damals denn schon die Mädchen? Wir Jungs hatten sogar auch einen Vier-Silber. Cornelius. Der übernahm sozusagen freiwillig und mit Hilfe seiner Eltern, die ihm diesen Namen gaben, die Rolle des Quoten-Außenseiters und war damit zum Verarschen freigegeben. Conni wurde er genannt und wechselte folglich wegen des vermeintlichen Mädchennamens ins Lager der Mädchen über. Ich glaube, er hasste uns deswegen.
Viele Jahre später machte das Gerücht die Runde, er hätte eine Software für die Abrechnung in Büros oder so was in der Art geschrieben und sich mit 35 mit Porsche, Villa und Bomben-Frau in Italien zur Ruhe gesetzt. Wir hassen ihn noch heute dafür.
In der Klasse gab es noch zwei andere Markusse. Einen zweiten k-Markus und einen c-Marcus, der damals schon sehr viel Wert darauf legte, mit „c“ geschrieben zu werden. Drei Markusse. Wie die drei Musketiere. Oder wie die drei Fragezeichen, von Alfred Hitchcock, dessen Bücher wir damals verschlangen. Wobei nicht ganz klar war, wer von uns der etwas pummelige, dafür mit genialem Verstand ausgestattete Justus war, wer das Sportler-Ass Peter und wer Bob, zuständig für Recherche und Archiv. Zumindest schlossen wir aber mal vorsichtshalber wegen unserer Namensgleichheit Freundschaft. Eine Jugendfreundschaft, wie sie wahrscheinlich wirklich nur Jungs in unserem Alter schließen konnten. Und das, obwohl wir beiden k-Markusse Geha-Kinder und Marcus, der mit „c“, ein Pelikan-Kind war. Wer von uns wüsste nicht, dass sich früher ganze Klassengemeinschaften anhand der Füllerwahl entzweien konnten? Mal abgesehen von den blöden Montblanc-Kindern. Wer schrieb denn schon freiwillig mit nem Füller, der wie ein Berg hieß? Wir wussten ja noch nicht mal, wie man das richtig aussprach. Eigentlich waren wir ja eher eine Bande. Jungs in unserem Alter schlossen Banden. So mit Schwur auf die ewig währende Freundschaft, Bandenbuch und all dem. Ich weiß nicht, ob das Ritual, ein Bandenbuch zu führen, bundesweit üblich war, aber in unserer Schule, also, in unserer „Grundschul-Gang-Szene“ war es das jedenfalls. In diesem Bandenbuch, eigentlich nur ein billiges Vokabelheftchen für 50 Pfennig, standen üblicherweise nur die Namen der Bandenmitglieder drin. In unserem Fall der von Markus, Marcus, der mit „c“, und meiner. Bandenführer war der, dem das Bandenbuch gehörte und das war in aller Regel der, der auch an erster Stelle stand. Also Markus. Für den „Winnetou-und-Old-Shatterhand-Arm-aufritzen-und-Blutsbrüderschafts-Schwur“ waren wir zu feige.
Marcus, der mit „c“, vermeintliches Großmaul unserer Bande, schaffte es zwar tatsächlich, sich mit einem unglaublich stumpfen Küchenmesser den Unterarm ein wenig aufzuritzen. Unter unermesslichen Schmerzen presste er sich, ein bis zwei Blutstropfen hervor. Das zumindest glaubten wir aus seinem Mienenspiel herauslesen zu können. Allerdings gab Markus, vermeintlicher Klugscheißer unserer Bande, zu bedenken, dass er sich jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Blutvergiftung zugezogen hätte und nun binnen Wochenfrist sterben würde. Markus und ich nahmen dankend Abstand von dieser Zeremonie.
Natürlich waren wir bewaffnet. Das gehörte sich für eine gute Bande so. Zu unserer Standardbewaffnung gehörte eine Erbsenpistole aus blauem Plastik, mit schwarzem leicht gekrümmten Zusatzmagazin. Die legendäre SEKIDEN Automatik SAP 50, die wahrscheinlich in Thailand von zierlichen Frauenhänden zusammen geklebt wurde. Beim Kauf bekam man eine Ladung Bleikugeln dazu, die heute von vermummten Arbeitern mit schweren Atemschutzgeräten im Sondermüll, mit der Aufschrift „giftig“, entsorgt werden würden. Hatte man sie das erste Mal verschossen, fand man sie in der Regel nicht mehr wieder, weshalb man auf die traditionellen Erbsen umsattelte. Die Trefferquote lag irgendwo zwischen weit daneben und sauweit daneben. Waren die Erbsen etwas unrund und „eckig“, verkanteten sie sich im Lauf, in der Feder des Abschussmechanismus oder schon gleich im Magazin. Im Ernstfall hätte man uns einfach nur mit einer Kastanie bewerfen müssen, um uns zu überrumpeln. Der Treffpunkt unserer Bande war das „Lager“. Einfach nur das „Lager“. Grund dafür, ein Lager zu haben, war die Geschichte „Die Vorstadtkrokodile“. Kennen Sie sicher auch oder? Das Bandenlager der Vorstadtkrokodile war ein hochmodernes Reiheneckhaus, hoch in den Bäumen, in einem Wäldchen, irgendwo am Dortmunder Stadtrand. Aus Mangel an finanziellen Mitteln und sicher auch handwerklichen Fähigkeiten und im Gegensatz zu den Vorstadtkrokodilen, war unser Bandenlager allerdings einfach nur ein Gebüsch am Rande der Bahnlinie Frankfurt – Würzburg.
Unsere kleine Welt, die wir ja mittels großangelegter Bandenkriege beherrschen und an uns reißen wollten, schloss auch den Wald, der direkt hinter unserer Siedlung begann, ein. Ich bin nach der Schule, vollkommen unbeaufsichtigt und stundenlang, mit Freunden im Wald gewesen. Wir haben mit mitgebrachten Äxten und Sägen, aus gefundenen Brettern und Ästen, Baumhäuser und Hütten gebaut. Nur einmal wollten auch wir so eine Hütte für unsere Bande besitzen, wie die Vorstadtkrokodile.
In unserem Wald, so erzählten es sich zumindest die älteren Herrschaften im Ort, gab es früher mal eine kleine Burg, die Kugelburg, von der aus ein Gang existieren sollte, der bis ins weiter unten gelegene Dorf führte. Und der Sage nach sollten sich in diesem geheimen Gang unglaubliche Schätze und Reichtümer verstecken, nach denen wir selbstverständlich gruben. Im Nachhinein glaube ich, dass wir hier im ganzen großen Stil verarscht wurden. Dieser Gang, so wie man ihn uns beschrieben hat, hätte etwa 100 Meter steil, ja fast senkrecht nach unten, unter einer Siedlung, der Autobahn, der Eisenbahn, einem Flüsschen, einem Sportplatz, dem Recycling-Hof, einem Sägewerk und einem Penny-Markt, hindurch führen müssen. Alles in allem wahrscheinlich fünf Kilometer lang. Dass man diesen sagenhaften Gang, beim Bau der Eisenbahn, der Autobahn, des Recycling-Hofes, der Renaturierung des Flüsschens, des Penny-Marktes und des Sportplatzes, wahrscheinlich gefunden hätte, kam uns nicht in den Sinn. Aber zumindest haben wir in den Ferien mindestens eine Woche den Kugelberg umgegraben und hatten was zu tun. Fertig gestellt, haben wir freilich kein einziges dieser „Projekte“. Ist klar. Die erste Wand der Hütte fiel ständig um und nachdem wir in etwa einem Meter Tiefe weder auf einen Gang, noch auf sagenhafte Schätze stießen, erklärten wir auch diese Sache für gescheitert. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Wir brauchten keine Hütte und auch keine Schätze. Der gesamte Wald war unsere Hütte und das, was wir dort anfangen konnten, unser Schatz. Wir hatten riesig lange Messer und Streichhölzer dabei, mit denen wir Feuer machten und Kartoffeln brieten, die wir von den Feldern der Bauern stibitzten. Meine Mutter hat uns sogar einmal extra Bratwürstchen mit gegeben. Mein Papa erklärte uns, worauf wir beim Feuer machen zu achten hatten und wie ich mein Messer zu benutzen hatte. Damit war das Thema Verletzungsgefahr für meine Eltern erledigt. Was war das doch für eine unbeschwerte Zeit damals.
÷
Mädchen findet man im dem Alter grundsätzlich blöd. Saublöd. Da sind wir uns einig, denke ich mal. Meine Schwester Katja genoss sogar das Privileg, von mir supersaublöd gefunden zu werden. Ich finde, sie hätte das ein bisschen mehr würdigen können, aber oft beachtete sie mich noch nicht mal, ging einfach wortlos an mir vorbei. Katja war damals fünf Jahre älter. Das ist sie selbstverständlich heute immer noch. Ich habe sie weder altersmäßig eingeholt, noch überholt. Obwohl ich mir das immer so gewünscht habe. Sie hatte es teilweise nicht einfach mit mir. Das möchte ich gerne an dieser Stelle mal zugeben. Es gab zum Beispiel einen Vorfall, den sie noch heute bei Familienfeiern gerne zum Besten gibt. Ich kniete wohl auf ihrem Rücken, beide Hände in ihren Haaren vergraben und zog ihren Kopf, mit voller Kraft nach hinten, was ihr sicher große Schmerzen bereitete, weil ich sie dabei wie eine Banane verbogen haben muss. Geschrien habe aber ich. Nicht meine Schwester. Und als meine Mutter, angezogen von den Schreien, in ihr Zimmer kam, motzte sie Katja noch an, was sie denn bitte da gerade mit mir machen würde? Und außerdem wäre ich doch noch so klein und da müsse sie doch etwas Verständnis für mich aufbringen. Katja sagte nichts dazu. Kein: „Aber der hat doch....“ oder „Der will aber...“. Nichts. Heute glaube ich, dass sich Katja damals schon einen ganz perfiden Plan ausgedacht hatte, um es mir heimzuzahlen. Ich war schon sehr früh Brillenträger. Schon im Kindergarten trug ich eins dieser voll fiesen Hornbrillen-Kassengestelle, die erst viele Jahre später wieder durch Justin Bieber und die Big-Bang-Theory-Nerd-Sache modern werden sollten. Damals lachte man über solche Brillen nicht, denn es gab schlicht und ergreifend nichts anderes. Einfache und billige Hornbrillen und fertig. Ich bekam eine Brille, weil man feststellte, dass ich beim Spielen und Herumrennen immer gegen Schränke, Türrahmen und Stühle knallte. Irgendwie berechnete ich den Kurvenradius immer falsch und -BATZ- ballerte ich volle Möhre mit dem Kopf gegen ein Tischbein oder so was. Also beschloss man, der Junge ist nicht zu blöd zum Rennen, der braucht einfach nur eine Brille. Dass Katja diese Situation vielleicht selber provoziert haben könnte, indem sie mir einfach mal, bei vollem Lauf durch die Wohnung, ganz beiläufig, einen Tisch oder Stuhl in den Weg schob, hat niemand in Betracht gezogen. Ich bin mir da bis heute nicht sicher. Wer hätte schon unterscheiden können, ob das ein blauer Fleck vom Schrank-Rammen oder von meiner Schwester war? Ja, wer weiß denn so genau, ob ich überhaupt ein Brillenträger bin? Ist diese ganze Sache nicht vielleicht von ihr über Wochen und Monate eingefädelt worden?
Stimmt das überhaupt, dass Katja mal drei Jahre in einem Krankenhaus in der Schweiz gearbeitet hat oder ob sie in der Zeit nicht vielleicht vom Israelischen Mossad ausgebildet wurde? Heißt sie überhaupt Katja? Ist sie wirklich „meine Schwester“? Der Sache sollte ich vielleicht mal nachgehen....
Zu der damaligen Zeit reagierte man noch etwas entspannter auf solche Sticheleien unter Geschwistern. Sie regelten sich meistens von selber. Heute wird die Super-Nanny herbei zitiert, die einen dann eine Stunde auf die stille Treppe schickt. Keine Panik. Sie halten hier keinen verkappten Erziehungsberater in den Händen. Ich bin mir nur sicher, dass der eine oder andere von Ihnen solche Machtkämpfe mit den Geschwistern von seiner Kindheit her auch noch kennt.
Übrigens, weil wir gerade so gemütlich beisammen sitzen: In meinem ersten Schuljahr war es noch gang und gäbe von Frau Beckert, unserer Klassenlehrerin, bei Missachtung der von ihr aufgestellten Klassenregeln, ziemlich rustikal eins auf die Nuss zu bekommen. Hatte man in irgendeiner Form gegen ihre Regeln verstoßen, also nicht aufgepasst, herum geblödelt oder man war zu laut, bekam sie das mit. Das war so sicher, wie das Amen in der Kirche. Als ob sie auf dem Lehrerpult Harry Potters Spickoskop stehen gehabt hätte. Und mit der Karte des Rumtreibers fand sie denjenigen. Immer und überall.
Mit einem lautem „WHUMM“, apparierte sie nur Sekunden später neben einem. Sie griff dann mit der linken Hand ein Büschel Haare, um den Kopf still zu halten, was ihre Trefferquote auf nahezu 100 % brachte und verteilte mit der rechten Hand Ohrfeigen auf die linke und rechte Backe. Klatsch, klatsch, klatsch, klatsch. Immer vier Stück. Zwei links, zwei rechts. Wie beim Stricken. Und genauso schnell, wie sie aufgetaucht war, „WHUMM“, disapparierte sie auch wieder und ging zur Tagesordnung über. Ein gespenstisches Szenario. Und schmerzhaft. Jedes „Expecto Patronum“, jedes „Protego“ verhallte nutzlos im Nichts wie in einem leeren Butterbierglas. Das war zumindest in der ersten Klasse noch normal. Die Grenzen waren klar abgesteckt. Jeder wusste, wie weit er ins feindliche Land vordringen durfte. Nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen ist das keine geeignete Erziehungsmethode mehr und somit nicht mehr akzeptabel. Nach Intervention mehrerer moderner und gewaltfreier Waldorf-Eltern, wurde diese Form der „Grenzkontrolle“ allerdings ab der zweiten Klasse eingestellt. Und trotzdem. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wütende Emails und offene Schmähbriefe von eben diesen Waldorf-Eltern erhalte, geschadet hat mir das nicht. Heute bin ich aber der Meinung, dass es nicht mehr die richtige Art der Maßregelung ist. Heute nehmen die Lehrer der Ann-Marie-Jennifer und dem Hagen-Malte-Gonzales, das Handy oder den MP3-Player ab. Die Eltern der Kinder haben im Übrigen darum gebeten, wegen der Persönlichkeitsbildung, die Namen der Kinder ganz aus zu sprechen. Daheim heißt der Hagen-Malte-Gonzales allerdings nur Gonzo, weil die Mutter das so süß findet. Ann-Marie-Jennifer heißt nur Tschänni, weil es kürzer ist. Das mit den Handy oder dem MP3-Player beeindruckt Gonzo und Tschänni natürlich erwartungsgemäß nicht, weswegen sie in den Trainingsraum geschickt werden, dem neuzeitliche Pendant zum „in der Ecke stehen“ und auch hier wundert man sich, warum diese drastischen Erziehungsmaßnahmen keine Erfolge haben. Ich meine, klar, bei uns wurden die Eltern angerufen und dann gab´s daheim richtig Ärger. Hausarrest, Fernsehverbot, kein Taschengeld oder so. Im Trainingsraum sollen Gonzo und Tschänni mal darüber nachdenken, was sie gerade gemacht haben. „Nachdenken“, ok? Wow. Na, dass ist ja mal ne richtig fiese Strafe. Wie Waterboarding mit'm Zahnputzbecher. Wenn sie das aber nicht wollen und „Nachdenken“ wollen Jugendliche in dem Alter eher nicht so gerne, waren die Lehrer durch mit ihren Erziehungsmaßnahmen: „Deinen MP3-Player und Dein Handy können Deine Eltern heute Nachmittag beim Rektor abholen. Klar? Dann können die sich mal mit ihm über Dein Verhalten unterhalten“. Auch das wird nicht passieren, denn die Eltern werden es nicht erfahren, weil sie arbeiten gehen müssen und gar keine Zeit für so was haben. Darum würden auch irgendwelche Erziehungsmaßnahmen zu Hause im Nichts verpuffen. Einen neuen MP3-Player und ein Handy kann man sich auf dem Schulhof abziehen, wenn es mal „Beef“ für ein Opfer bei einer gemeinschaftlich geplanten Mobbing-Aktion gibt. Die Probleme fangen heute wo ganz anders an. Aber das wollen wir hier an dieser Stelle nicht klären. Hab ich recht? Dafür gibt´s doch die Schulermittler. Sollen die sich doch darum kümmern.
÷
Irgendwann während der ersten Schuljahre, stellten wir fest, dass amerikanische Film-Darsteller, besonders unsere Helden von „Krieg der Sterne“ irgendwie coolere Namen als Markus hatten. Egal ob Markus jetzt mit k oder mit c geschrieben wurde. Da gab es so Namen wie Ben Obi-Wan Kenobi, R2-D2, diese fiepende Coladose, C-3PO (dieser ständig nörgelnder Gold-Roboter mit leicht homosexuellen Tendenzen), Chewbacca und natürlich Han Solo und Luke Skywalker. Wir beschlossen, uns neue und coolere Namen zuzulegen. Ich begrüßte das sehr, weil ich irgendwie immer noch hoffte, den Schlemmi los zu werden. „Ben wär doch super oder? So wie Ben Kenobi, “ sagte Markus zu mir. „Nein, wäre nicht super. Das isn Ein-Silber, Mann“ sagte ich. „Na, dann halt Benny.“ „Ja, genau. Benny.“ Der Name Benny wurde dann noch vorsorglich das gesamte ABC durchverarscht, um zu sehen, ob Benny wirklich super wäre. Ich ahnte bereits, auf was das hinaus laufen würde. Cenny, Denny, Flenny, Menny, Penny, Renny. Bis hin zum Schlemmi. Klang wohl lustig, sodass es bei Schlemmi blieb. „Ich bin Chewie“ sagte Marcus, der mit „c“, was die Abkürzung von Chewbacca, dem hünenhaften Affen und treuen Weggefährten von Han Solo war. „Und ich bin dann Han Solo“, fügte Markus hinzu. Luke Skywalker zu sein oder zu heißen traute sich keiner. So dreist war keiner von uns. Die Spitznamen der anderen beiden Mark(c)usse waren nach etwa zwei Wochen erwartungsgemäß wieder vergessen. Mein Schicksal dagegen war besiegelt. Ich war Schlemmi. Für Jahre. Eigentlich bis heute. Um genau zu sein. Ach nee. In der Fünften stand ich mal kurz davor „der Schleim“ zu werden. Das kam von meinen Nachnamen. Gleim. Vorne mit G und hinten mit M. Die meisten Leute verstehen aber erst mal immer Klein. „Wie? Klein?“ „Nee. Gleim. Mit Gee und hinten mit Emm.“ Die Gleims haben sich angewöhnt, den Namen meistens gleich noch zu buchstabieren. „G-L-E-I-M.“ „Ach, GLEIN.“ „Nee-hee. Hinten noch mit Eee-heem.“ „Ach so. Gleim. Hab ich ja noch nie gehört.“ „Ja. Drum buchstabiere ich´s ja auch.“ Mein Papa buchstabierte den Nachnamen früher immer noch mit diesem Funkalphabet „Mein Name ist Gleim. Gustav-Ludwig-Emil-Ida-Martha“ und würzte das immer noch mit einem Mörder-Gag, „Ich bin aber heute alleine da.“ und erntete dafür meistens nur verwirrte Blicke. Papa lachte aber in sich hinein und freute sich diebisch über diese seltene Perle des Wortwitzes. Irgend so eine Sechstklässler-Hackfresse fand es lustig, mich auf dem Schulhof als „der Schleim“ zu beschimpfen. Als ich ihn daraufhin aufforderte, sich doch bitte mal umzudrehen, damit ich ihm dahin treten könne, wo die Sonne sicher nie hin scheinen würde und ich meinte nicht London, artete das in eine gepflegte Keilerei aus. Und nur weil ich kämpfte wie ein Tiger, nahm man respektvoll davon Abstand, mich in Zukunft „der Schleim“ zu nennen. Und mein „Kampfname“ auf dem Schulhof lautete fortan „der Tiger“. So zumindest nahm ich diese Situation wahr. Tatsache war allerdings, dass ich wie ein Meerschweinchen quiekte und wie ein Mädchen um mich schlug, was in etwa so aussah, als würde man versuchen, eine ganz böse Biene zu verscheuchen. Und nur weil ich kämpfte wie eben ein Mädchen, nahm man lachend davon Abstand, mich in Zukunft „der Schleim“ zu nennen. Mein „Kampfname“ auf dem Schulhof lautete demzufolge „Mädchen“. Aber eben, Gott sei Dank, nur auf dem Schulhof und auch nur bei Schulhofkeilereien, denen ich nach dieser Erfahrung sehr geschickt durch panische Flucht auf die Schultoilette aus dem Weg ging. Das brachte mir allerdings so ab der 7. Klasse ein gewisses Hoheitsrecht auf der Schultoilette ein. Das war meine Toilette. Ich war der Don Padre der Schultoilette im ersten Stock. Ich konnte dort schalten und walten, wie ich wollte. Ich machte dort die Regeln. Ich konnte dort Hausaufgaben abschreiben, Spickzettel verstecken, später sogar rauchen und jeden reinlassen oder rausschmeißen, ohne in irgendeiner Form belästigt oder angemotzt zu werden.
Ich blieb also bis heute der Schlemmi. Der 45-jährige Schlemmi, der unaufhaltsam auf seine Midlife-Crisis zurast.
So rundherum um die 45 beginnt man ja mal so über das Eine oder das Andere nachzudenken. Man sieht, hört, fühlt, riecht oder schmeckt etwas und schon bricht eine Flut der Erinnerungen über einen herein, die man glaubte schon lange vergessen zu haben oder hoffte, sie erfolgreich verdrängt zu haben. In aller Regel sind das Erlebnisse aus der eigenen Vergangenheit. Logisch. Aber vielleicht reagiert man auch inzwischen sensibler auf unterschiedliche Dinge, die einem so rechts und links auf seinem Weg durch das Leben auffallen. Das ist die milde Gabe der Altersweisheit, die uns Männern im mittleren Lebensabschnitt zu Teil wird. Was uns auffällt, sind vielleicht nur Belanglosigkeiten, für den einen, für den Anderen aber eventuell durchaus wichtige Dinge. Als ich neulich an der Rewe-Kasse stand, bemerkte ich eine Packung Brausepulver und sofort kam mir das prickelnd frische Gefühl der Ahoi-Brause in Erinnerung. Haben wir uns früher immer am Kiosk im Waldschwimmbad für 10 Pfennig die Tüte gekauft. Dieses Brause-Pulver wurde in ein Glas Wasser geschüttet oder aber, was noch viel cooler war, mit dem angefeuchtetem Zeigefinger direkt aus der Tüte gestippt. Ich erinnerte mich an das Esspapier, dessen Daseinsberechtigung ich bis heute nicht verstanden habe. Esspapier. Ich meine, was sollte das und wer aß schon Papier? Das hat ja noch nicht mal nach was geschmeckt. Absolut geschmacksneutral. Das waren einfach nur bunte DINA-4 große Blätter, die man eben essen konnte. Hat das eigentlich mal irgendjemand überprüft, ob man das echt essen konnte? So Stiftung Warentest oder so? Oder war das nur eine sehr clevere Idee, Altpapier zu entsorgen? Damit die von dem Schwimmbadkiosk nicht täglich zum Container fahren mussten. Da hat doch wahrscheinlich ein Schüler hinten im stillen Kämmerlein des Schwimmbadkiosks gesessen und das anfallende Altpapier mit einer Schere auf Maß geschnitten. Ein armer Sechstklässler, der nach Weisung seines Vaters einen Ferienjob in den ersten zwei Wochen der Sommerferien machen sollte: „Sohn. Damit du jetzt nicht sieben Wochen lang hier so blöd rumhängst und du mal lernst, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, hab ich dir einen Ferienjob im Waldschwimmbad besorgt.“ Genau da, wo alle Freunde nachmittags sieben Wochen lang blöd rumhingen. Ganz toll. Und vorne an der Theke wurde das zugeschnittene Zeug dann als Esspapier an Kinder, die doof genug waren so einen Mist zu kaufen, verscheuert. Also, quasi, an uns. Na, gestorben sind wir schließlich nicht dran. Dieses bitzelnde Brause-Gefühl auf der Zunge drückte irgendwelche Knöpfe bei mir, die bestimmte Erinnerungen weckten. Die legendäre Leckmuschel fiel mir noch ein, deren Name ich damals schon irgendwie zum Totlachen fand. Leckmuschel. Hehehe. Bringt mich heute noch zum Lächeln. Dabei ist die Muschel lediglich ein Schutzzeichen der Pilger, die sich auf dem Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela befinden. Sie hat also keinerlei versaute Hintergedanken. Auch wenn es einen etwa 10-Jährigen gerne dazu verleiten möchte. All meine vielen Spielsachen fielen mir ein und sogar, wo genau ich sie in meinem Zimmer immer aufbewahrte. Ich war übrigens ein Play Big- und kein Playmobil-Kind. Kennt die noch wer? Im Gegensatz zu den Playmobil-Figuren, konnten die Play Big-Figuren die Hände, die Beine und die Füße bewegen. Also, die Hände konnte man drehen, die Beine konnte man einzeln bewegen, was dann so aussah, als ob sie laufen würden und die Füße konnte man drehen und kippen, womit die Figuren dann auch schräg oder an einer Steigung stehen konnten. Die Playmobil-Figuren konnten ja eigentlich nur sitzen oder stehen und die Arme, inklusive der Hände, konnte man nur nach vorne strecken. Somit waren sie genau genommen die Schwerbehinderten der Plastikspielfiguren. Wenn man da zehn Figuren, so mit nach vorne ausgestreckten Armen hinstellte, sahen die aus wie die tanzenden Zombies aus dem Michael Jackson Video „Thriller“. Die Play Big-Figuren waren also viel realistischer. Man konnte mit ihnen viel echter und besser spielen. Man konnte ihnen Waffen oder Werkzeuge richtig in die Hände drücken. Eigentlich haben wir aber nie mit den Bauarbeiter- oder den Sanitäter-Figuren und ihren Werkzeugen, sondern mit den Cowboy- und Indianer-Figuren gespielt. Da man meistens auf Seiten der „Guten“ war, was wahrscheinlich eine Art genetische Vorprägung in uns ist, richtete man die Waffen auf die „Bösen“ und knallte sie ab. Das Abknallen sah so aus, dass man „Kawumm“ sagte und den „Bösen“ mit dem Finger umstieß und ihn damit über den imaginären Jordan beförderte. Nach einem Plagiatsprozess, der zu Gunsten der Play Big-Figuren ausging, stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die Play Big-Spielfiguren den Eindruck eines sportlichen, selbstbewussten und aggressiven Mannes vermittelten. Die Playmobil-Männchen hingegen, hätten die Wirkung von einem Kind. Nett und noch unsicher auf den Beinen. Das war 1974. Hätte der Bundesgerichtshof gewusst, dass vier Jahre später die martialisch aufgemachten Big Jim Figuren erscheinen würden, die sogar durch einen Druckknopf auf dem Rücken richtig zuschlagen konnten, hätten er seine Definition von aggressiven Spielfiguren sicherlich noch einmal überdacht. Mann, die waren so cool, diese Figuren. Es gab sie als Winnetou und Old Shatterhand, Karatekämpfer, Soldat, Pirat, Holzfäller und zig verschiedene Action-Figuren. Es gab sie als Skeletor, aus der Zeichentrickserie Master of the Universe und man konnte durch eine Bewegung des Armes, seinen Kopf in eine Knochenfratze und ein normales Gesicht verdrehen.
Natürlich spielte ich auch mit Lego. Klar. Wer spielte nicht mit Lego? War nicht Lego sogar irgendwie der kreative Einstieg in die Kindheit und damit auch der Einstieg in unsere ersten Erinnerungen? Kein Kind oder vielleicht eher Junge, hat seine früheste Kindheit ohne Lego verbracht und hat irgendwelche merkwürdigen Gebilde oder Fahrzeuge zusammen gebaut. Aber ich hatte nicht diese Fertig-Bausätze. Es gab doch immer diese kleinen Schachteln, in denen ein Flugzeug oder ein Auto oder sonst was zum Zusammenbauen drin war. Erinnern Sie sich? Die hat man dann anhand des Bildes, das vorne drauf war zusammengesetzt. Hatte man sie aber einmal zusammen gebaut, konnte man mit den Teilen nicht mehr so viel anfangen, weil man mit den Teilen eben nur dieses Auto bauen konnte. Ich hatte eine große Holzkiste, voller einzelner Lego-Teile. Die Einer-, Zweier-, Vierer- und Achter-Teile. Aber immer viel zu wenig Einer- und Zweier-Teile, weswegen an meinen Hauswänden immer Teile an den Ecken heraus ragten und ich keinen schönen Abschluss hinbekam. Meine Häuser sahen irgendwie immer aus, wie unsanierte Plattenbauten aus Jena. Der Sohn von Bekannten meiner Eltern, schenkte mir irgendwann mehrere Kisten Fischer-Technik. Auch ein Schritt vom ganz kleinen Kind zum nicht mehr ganz so kleinen Kind. Mit Fischertechnik konnte man richtig konstruieren. Man konnte graue Klötzchen miteinander verbinden und flache Querverbindungen mit kleinen roten Schräubchen verschrauben. Auch mit Fischertechnik konnte man irgendwelche Geräte und selbst entwickelte „Maschinen“ basteln. Boah, war das cool. Schätze mal, ich baute da die ersten Transformers, lange bevor sie berühmt werden sollten.
Sunkist fiel mir ein. Wer kennt es nicht mehr? Diese dreieckigen Trinktüten. Wo und wie zur Hölle sollte man sich die denn bitte in den Schulranzen stecken, hä? Mir ist so ein Teil mal in der Schultasche geplatzt. Diese ganze chemische Substanz, die wohl nach Orangensaft schmecken sollte, lief mir durch den Ranzen und versaute mir mein „Krieg der Sterne“-Mäppchen. Mein KRIEG DER STERNE MÄPPCHEN. Ok? Mit Luke, Han und Prinzessin Leia vorne drauf. Mann, was hätte ich diesem Designer der Verpackung damals gerne in den Arsch getreten. Ein großer Fan von Sunkist war ich deswegen nie.
Sehr früh, quasi schon im Kinderzimmer, wurde mein Interesse für die Musik geweckt, was sich nie mehr ändern sollte. Natürlich hat mich aber auch mit elf oder zwölf Jahren das Fernsehen sehr beeindruckt, wahrscheinlich sogar ein bisschen beeinflusst. Fernsehen war damals noch etwas Besonderes und nichts Alltägliches. Unendliche Weiten. Unbekannte Lebensformen. Fremde Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Oh Mann und was für neue Zivilisationen es da so gab, die wir entdecken konnten. Faszinierend.
2. „Ich glotz TV“
Es gab in den Familien nur ein Gerät und das wurde wirklich nur angemacht, wenn die Familie abends im Wohnzimmer zusammensaß und fern schaute. Tagsüber lief in der Küche ein Radio. Das war´s. Ansonsten war Ruhe mit medialer Dauerbeschallung. Wir lasen, spielten, beschäftigten uns mit uns selber oder waren draußen in der Natur unterwegs. Von daher war Fernsehen schauen etwas Tolles. Das damalige Programm konnte man sicher nicht annähernd mit dem heutigen vergleichen. Auch der Ablauf eines Fernsehtages hat sich in den letzten 30 Jahren grundlegend verändert. Es wurden nicht während oder zwischen zwei Sendungen irgendwelche Werbespots abgeschossen oder kurze Trailer für noch kommende Sendungen gezeigt. Können Sie sich noch daran erinnern, dass nach den 20-Uhr-Nachrichten eine Ansagerin auf dem Bildschirm erschien und uns aus der Programmzeitschrift vorlas?: „Das ist ne ehemalige Miss World, Sohn“, sagte mein Papa in der Hoffnung, ich wüsste diese Information entsprechend zu würdigen. Was ich als kleiner Pimpf natürlich nicht konnte. Ich saß, eingemummelt in eine Decke und im weißen Frottee-Schlafanzug mit blauen Schiffchen drauf, vor der Glotze und wusste nur, dass die Frau mir erklärte, was wir gleich sehen werden. Es gab gerade mal sieben Sendeanstalten: ARD und ZDF und ihre jeweiligen dritten Programme: BR3, N3, S3, WDR3 und HR3. Und selbst diese sieben Sendeanstalten konnten nicht überall gleich gut und stark empfangen werden. Hatte man Pech und wohnte in einem entlegenen Tal oder auf einer Ostfriesischen Hallig, konnte es sein, dass wirklich nur ARD und ZDF empfangen wurde. In der Stellenbeschreibung der Ansagerin stand bestimmt, dass es sich hier um eine Halbtagsstelle handeln würde, denn das Programm begann ja erst so zwischen 16 und 17 Uhr und endete schon wieder um 24 Uhr. Nur mal so als Beispiel, Ihr lieben TV-Total-DSDS-Berlin-Tag-&-Nacht-Dauerfernseh-Kids:
Das Fernsehprogramm vom 13. 02.1979:
16.30 Mosaik: Für die ältere Generation.
17.00 Heute
17.10 Kinder und um die Welt
Heute werden drei Schwestern vorgestellt, die in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, leben. Aching (7) und Kaotusu (9) gehen jeden Morgen in die Schule. Die jüngste, Adiambo (5), besucht derweil den Kindergarten. Vater und Mutter arbeiten. Sie möchten, dass ihre Kinder es später einmal besser haben als die Eltern.
17.40 Die Drehscheibe
Wie viele Moderatoren hat eigentlich die „Drehscheibe“? Genau ein Dutzend, wie uns die Redaktion verraten hat. Dazu gehört Christine Westermann. Sie ist 30 Jahre alt und hat bei einer Tageszeitung Journalismus „von der Pike“ auf gelernt. Seit acht Jahren ist Christine beim ZDF, seit zwei Jahren moderiert sie die „Drehscheibe“ und dreht auch selber Beiträge.
18.20 Tom & Jerry Zeichentrickfilm
Eine Termitenplage ist ausgebrochen. Leider verschonen diese ungeheuer gefräßigen Tiere auch das Haus von Tom & Jerry nicht. Schnell alarmieren die beiden einen Ameisenbär. Ob der einen Rat weiß? Völlig aus dem Häuschen geraten Tom & Jerry jedoch, als ein kleines, komisches Monstrum auftaucht, das behauptet, vom Mars zu kommen.
19.00 heute
19.30 „Der Schwanz, der mit dem Hund wedelt“, ein Schwank von Herbert Berger.
21.00 heute -journal
21.20 ZDF-Hearing: Parteien und das Fernsehen
22.35 Sing Sing – Thanksgiving. Ein Konzert im Zuchthaus mit B.B. King, Joan Beaz, The Voices of East Harlem, Mimi Farina. (Wh. vom 15.07.1975)
23.35 heute
Das ist ein Hammer, oder? Und danach schalteten die Fernsehmacher von damals ihre Kameras aus, drehten das Licht runter und machten Feierabend. Das muss man sich mal vorstellen. Was haben denn damals nur die ganzen Schüler nachmittags gemacht? Haben die wirklich Hausaufgaben gemacht und ihre Schultaschen für den nächsten Tag gepackt? Es gab ja noch keine Play Station. Es gab noch keinen Computer oder Laptops, mit denen man mit seinen Klassenkameraden oder Freunden chatten konnte. Es gab auch kein YouTube, um sich die ganzen bescheuerten Fail-Videos anzuschauen, um sich über die Dummheit anderer kaputt zu lachen. Man hätte sich also mit sich selber oder mit den Freunden befassen müssen. Und was machten bitte die ganzen Arbeitslosen? Gut, es gab nur etwa 1,2 Millionen, aber auch die mussten doch unterhalten werden? Vera Int-Veen oder Oliver Geissen waren da ja noch nicht mal geboren. Es gab kein „Die Auswanderer“ oder „Vera am Mittag“. Weder Richterin Salesch noch Richter Hold sprachen Recht über irgendwas. Es gab kein „Köln 50667“ oder „Verklag mich doch“. Nix da. Verklagt euch doch gefälligst selber und beschäftigt euch mit was anderem. Sollten die denn wirklich bis 16 Uhr Bewerbungen geschrieben haben?
Ab 18.20 Uhr haben wir „Tom & Jerry“ geschaut. Eine Zeichentrickserie, in der verschiedene kurze Trickfilmchen wie zum Beispiel „Schweinchen Dick“ gezeigt wurden. In den 80ern wurde „Tom & Jerry“ aber wegen zu großer Brutalität wieder abgesetzt. Wirklich. Kein Witz, jetzt. Was man da als Brutalität bezeichnete war, dass der Kater Tom die Maus Jerry jagte, dabei auf die Zinken eines Besens trat, der ihm daraufhin erwartungsgemäß volle Kanne auf die Möhre ballerte. Dem Kater schwurbelten Kreise um den Kopf, es zwitscherten kleine, gelbe Vögelchen dazu und es ploppten winzige Sternchen auf. Tom schüttelte sich kurz und jagte weiter Jerry hinterher. Das war´s.
Lassen Sie uns doch stattdessen mal kurz in eine Folge von „Southpark“ reinschauen. Ein sinnvoller Handlungsstrang war jetzt erst mal nicht zu erkennen. Soweit, so gut. Wie bei „Tom & Jerry.“ Nur das der kleine Cenny im Laufe einer jeden Folge gekillt wird. Mit dem Kommentar: „Oh mein Gott, sie haben Cenny getötet. Ihr Schweine“, befördert man ihn auf unterschiedlichste Weise in den gezeichneten Comic-Himmel. Er explodiert, wird geköpft, wird platt gefahren, gehängt, erschossen, verbrannt, ersäuft, in den blauen Himmel katapultiert, in den Boden gestampft, zersägt, tranchiert, geteert, gefedert, geviertelt, halbiert, in Scheiben, in Würfel oder in Stücke geschnitten. Kurz: Ihm wird auf jede nur erdenkliche Art und Weise das Lebenslicht ausgeknipst. Aber Tom & Jerry wurde wegen Brutalität abgesetzt. Schon klar. Heute laufen irgendwelche 3D-animierten Mangas, mit
Figuren, die so riesige Augen haben, als würden sie LSD-Trips wie Gummibärchen einwerfen. Es läuft „Marvin, das steppende Pferd“, „Monsters vs. Aliens“, „Family Guy“ und „SpongeBob Schwammkopf.“ SpongeBob Schwammkopf! Mal ehrlich, Leute. Eine Sendung über einen Schwamm, der mit seinen Wasserkumpels in einer Stadt auf dem Meeresboden lebt? Ein Schwamm, ok? Und wir machen uns echt Gedanken, warum unsere Schulkinder bei der PISA-Studie nur auf Platz 16 landen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei TV-Sendungen über einen Schwamm, der mit seinen Homies auf dem Grund des Meeres lebt, drängt sich mir der klitzekleine Verdacht auf, ob es da nicht eventuell einen direkten Zusammenhang geben könnte? Da hätte man doch auch eine Zeichentrickserie über, was weiß ich, von mir aus über ein Brot machen können. Wie bitte? Gibt´s schon? „Bernd, das Brot?“ Heilige Mutter Gottes.
Zu meiner Zeit liefen „Unsere kleine Farm“ und die „Waltons“ auf unterschiedlichen Sendern. Aber man sah irgendwie lieber die „Waltons“. Zumindest mir ging es so. Die Großfamilie „Waltons“, die all ihren Kindern Doppelnamen, wie John-Boy, Jim-Bob und Marie Allen gaben. Die Zeit und die Arbeit in dem kleinen Sägewerk waren hart, anstrengend und ehrlich und genau das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir die „Waltons“ gerne sahen. Keine Gewalt, keine Verbrechen, kein unermesslicher Reichtum und keine Intrigen. Das einfache und normale Leben auf dem Lande. Der alte Lastwagen kam im Vorspann heran gefahren, hupte mit der lustigen „Wooohiiioooo – Wooohiiiooo“ – Hupe und man lud den ersten Radioempfänger, groß wie ein Wohnzimmerschrank, aus. John und Olivia Walton schickten ihren einzigen intelligenten Sohn in die große Stadt hinaus, um ihn zum Journalisten ausbilden zu lassen. Und daheim schickte die aufkommende Dämmerung das gesamte Tal in den Waltons Mountains in die Betten und man wünschte sich gemeinsam mit „Gute Nacht, John-Boy“ und „Gute Nacht, Jim-Bob“ eine geruhsame Nacht. Ein Kind namens „Heidi“, mit dem die strenge Frau Rottenmeier aus Frankfurt, erzieherisch nicht mehr fertig wurde, schickte man weit, weit weg, hoch in die Schweizer Berge. Dort lernte sie einen „Peter“ kennen. Ich persönlich glaube ja, diese „Heidi“ war eine schwer erziehbare Berliner Punkgöre mit ADHS und verweigerte aktiv den Schulbesuch. Sie rannte ständig hyperaktiv den Tieren nach, lief selbst im Winter nur barfuß herum und ging nicht zur Schule. Dieser ständig völlig bekiffte „Peter“ war ein illegaler Sprayer aus Dortmund, der seine Schmierereien immer mit dem Namen „Geissenpeter“ taggte. Ein krimineller und drogenabhängiger Rotzlöffel, der per richterlicher Verfügung eine Verhaltenstherapie machte. Ich meine, Heidi kam schließlich aus Frankfurt. Hallo? Klingelt da was bei Ihnen? Frankfurt? Bahnhofsviertel, Rotlichtmilieu, Drogen? Alles klar? Wer sonst, glauben Sie, hätte diesen „Geissenpeter“ mit Stoff versorgen sollen? Die sogenannte „Almhütte“ war ein offener Jugendtreff mit erlebnispädagogischen Angeboten, so mit Klettergarten, Wut- und Klangzimmer und Werkstätten und so. Heidi und Geissenpeter lernten da, ihren Namen zu klatschen und Gefühle, wie „Freude“ aus Lehm zu formen. Geleitet wurde der Jugendtreff vom „Alpöhi“, den Mann, den die Kinder alle nur Großvater nannten. Er war eigentlich ein Sozialpädagoge und Antiaggressionstrainer und arbeitete in der sozialen Einrichtung, hoch droben, in den Schweizer Bergen. Wenn nachmittags das Kinderprogramm los ging, fragte ich meine Mutter, ob ich diese oder jene Sendung sehen durfte. Sie informierte sich, um was es da gehen würde und sie entschied, ob oder ob nicht. Ich schätze, das lief damals in den meisten anderen Familien auch so. Die Entscheidung darüber war jetzt auch keine Diskussionsbasis, sondern eine klare Ansage. Da gab es kein: „Och menno...“, kein „Ach, bitte.....“ oder „Nur ne halbe Stunde....“ Ein Nein, war ein Nein und fertig. Ganz oft gab es stattdessen den Rat: „Willst du nicht lieber mal raus an die frische Luft? Es regnet nicht, also geh raus und beschäftige dich dort mit irgendwas. Spiel was mit deinen Freunden oder so.“ Haben Sie es gemerkt? Nicht: „Das Wetter ist gut. Die Sonne scheint. Es ist warm. Geh mal raus.“ Nein, nein, es reichte schon, wenn es nicht regnete. Es konnte scheiß-kalt sein, aber solange es nicht regnete, war das Wetter immer noch gut genug, um draußen zu spielen. Und auch dieser Rat war kein Vorschlag, über den man jetzt mal in Ruhe sprechen konnte, sondern eigentlich eher eine weisungsgebundene Ansage. Heute würde so manche Mutter froh sein, nicht wegen solcher Nichtigkeiten gestört zu werden und weiter in Ruhe Farmerama spielen zu können.
Mein Interesse für die Musik machte sich mehr und mehr bemerkbar und daher war die „Reiner-fahr-das-Band-ab-Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck eine Pflichtveranstaltung. Alle bekannten Musiker und Bands aus Deutschland gaben sich dort die Klinke in die Hand. An einen Auftritt von Nena kann ich mich heute noch erinnern. Künstler traten dort auf und sangen ihre Lieder zu einem Halbplayback dazu. Nena sollte ihren Nummer-eins-Hit „99 Luftballons“ singen, hatte aber das Problem, sich wegen eines technischen Fehlers selber nicht singen zu hören und musste das Lied zwei Mal abbrechen. Zur damaligen Zeit ein echter Skandal. Dabei hatte Reiner „Fahr-das-Band-ab“ Reiser, der Tontechniker der Sendung, einfach nur an den falschen Reglern gedreht. Hinter vorgehaltener Hand wurde allerdings gemunkelt, Nena wäre damals schon zu oft als Gewinnerin aus der Hitparade hervor gegangen. Darum hätte man diesen „Fehler“ absichtlich eingebaut, sodass Nena nicht nochmal gewinnen konnte. Klappte natürlich nicht. Sie gewann erneut den Zuschauerpreis, erntete aber „Buh“-Rufe und Pfiffe aus dem Publikum.
÷
"I love you baby and you love me
that´s a big thing, you know what I mean
I´m happy, I´m happy.
She loves me, man, no matter what I do
if I´m over the top or down on my knee
I´m happy, I´m happy"
(Ich: „I´m Happy“, unveröffentlicht.
Erstes eigenes, aufgenommenes Lied für
ganz frische Teenager-Liebe mit schwarzhaarigem Mädchen)
Einmal im Monat kam „Disco“. Licht aus „WHOM“. Spot an „YEAH“. Ilja Richter, talentierter Sänger und eigentlich Radiomoderator, begrüßte uns in jeder Sendung mit „Hallo Freunde“, während wir ihm „Hallo Ilja“ entgegen schmetterten. Im Gegensatz zu Hecks Hitparade, traten bei Ilja die internationalen Stars auf. Zwischen den Liedern zeigte Herr Richter uns in kleinen gespielten Sketchen sein komödiantisches Talent und bewies uns damit, dass er nämlich tatsächlich ernst zu nehmender Künstler und Schauspieler war und „Disco“ nur moderierte, weil er halt gerade zufällig Zeit hatte. Und auch diese Sendung hatte ihren Skandal. In der gesamte Schule wurde darüber noch tagelang hitzig gesprochen. Welche Gruppe das damals war, weiß ich nicht mehr, aber in Anbetracht des Vorfalles auch vollkommen unwichtig. Einer der beiden Sängerinnen verrutschte nämlich während des Auftrittes das Oberteil und es blitzte, für den Bruchteil einer Sekunde, ihre nackte Brust in die Kamera. Für die damalige Zeit pure Pornografie und Gesprächsstoff auf allen Pausenhöfen Deutschlands. Markus und Marcus, der mit „c“ erzählten es wieder und wieder und ich hörte zu. Denn: Ich hatte es nicht gesehen. Eine nackte Brust im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der 80er und ich hatte es nicht gesehen. Die ganze Schule hatte es gesehen. Aber ich nicht. Vermutlich sah das ganz Deutschland, die ganze Welt, das gesamte Universum, inklusive sämtlicher Aliens. ABER ICH NICHT. Ein Ereignis, welches sich unwiderruflich auf die Festplatte eines pubertierenden Jungen einbrannte: „Titten. Wir haben richtige, echte Titten gesehen.“ Am Samstagabend kam dann „Verstehen Sie Spaß“ mit dem vollkommen spaßfreien Moderatorenpärchen Kurt und Paola Felix aus dem Schweizer St. Gallen. Die beiden verschwanden sogar schon zum Schmunzeln in die Katakomben der Sendeanstalt. Zum Lachen flogen K. und P. aus S. extra in die östliche Hochebene von Paraguay. Trotzdem habe ich es mit meinen Eltern geschaut und trotzdem habe ich mich mit meinen Eltern kaputt gelacht. So war eben der Humor von damals. Als große Samstagabend-Show schickte zuerst die ARD ihr Flaggschiff „Am laufenden Band“ in die Schlacht. Der niederländische Show-Master Rudi Carrell und sein Assi Heinz Eckner führten uns durch die Sendung und Rudi Carrell sang in jeder seiner Show ein Lied. So richtig erfolgreich war er damit aber nicht. Seine größten Erfolge waren ´75 „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ und 1978 das Lied „Goethe war gut“, aber das war es dann auch schon. „Goethe war gut“ hat sich mir bis heute ganz tief ins Gedächtnis gehämmert. Wahrscheinlich, weil ich ihn damals schon so richtig scheiße fand oder weil ich diesen niederländischen Wortwitz nicht verstanden habe:
"... Er sagte zu ihr, Du mein name ist Sepp,
ich seh´ zwar so aus, doch ich bin gar kein – Lehrer.
Bin Bauer, der heiraten muss“,
darauf gab sie ihm einen ganz heißen – Kaffee,
der dünn war, doch Liebe macht blind.
Er nahm sie ins Heu und sie kriegte ein – Schnupfen....“
Als der Reiz dieser Show langsam verflogen war, trat der ZDF-Quotenhammer „Wetten, dass….?“ in den Ring. Frank Elstner, Radiomoderator der ersten Stunde bei RTL plus und Urgestein der Fernsehunterhaltung, erdachte, entwickelte und produzierte diese Sendung, verkaufte seine Idee rund um den Globus und wurde damit wahrscheinlich reicher als Gott. Die Idee, dass jemand behauptete, etwas Außergewöhnliches zu können und ein prominenter Wettpate musste dafür oder dagegen wetten, war völlig neu und fegte die Straßen am Samstagabend leer. Wer glaubte schon, dass es möglich wäre, einen schweren Lkw auf Biergläser abzustellen? Oder das es tatsächlich Menschen geben könnte, die Wärmflaschen aufblasen und zum Platzen bringen würde? Also, jetzt mal echt. So´n Quatsch! Wo gibt’s denn so was? Später übernahm die Sendung ein merkwürdig gekleideter, aber recht locker daher plaudernder Thomas Gottschalk. Und Sie werden es mir nicht glauben, aber auch bei „Wetten, dass...“ gab es einen Eklat. Ein Wettkandidat behauptete, er würde am Geschmack von Buntstiften, die Farbe erkennen können. So‘n Quatsch. Konnte er natürlich auch nicht. Bernd Fritz, Redakteur der Frankfurter Zeitschrift „Titanic“ schummelte sich unter falschen Namen in die Sendung, lugte unter der abgedunkelten Brille hervor und sah so, an welchen Buntstiften er gerade lutschte und hatte so seine großen 15 Minuten. Ha, einmal den großen Gottschalk verarschen. Wirklich Freunde machte er sich mit dieser Aktion auf jeden Fall nicht. Das Saalpublikum pfiff und buhte ihn aus. Herr Gottschalk reagierte sehr besonnen, humorvoll und professionell in diesem Augenblick. Das Fernsehen entwickelte sich weiter und weiter. Und mit der größer werdenden Anzahl von Fernsehgeräten in der Bevölkerung, wurde Werbung im TV für große Konzerne natürlich immer interessanter. Es gab einen Werbespot, der mich damals regelmäßig in ungläubiges Staunen versetzte. Allerdings muss man bedenken, dass ich da gerade mal etwa zwölf Jahre alt war und auch nicht den Hauch einer Ahnung von den technischen Möglichkeiten eines TV-Studios hatte. Heute wären solche technischen Spielereien wahrscheinlich mit jeder Handy-Kamera machbar. Es war der Werbefilm von Merz Spezial Dragees. Es wurden da immer zwei dieser rosafarbenen Dragees auf ein Porzellantellerchen geworfen und das innerhalb des Filmchens mehrere Male. Das Verrückte war, diese Dragees fielen immer gleich. Immer und immer wieder. Ein ums andere Mal. Und ich stellte mir die Frage: „Wie zum Teufel machen die das nur? Wie schaffen die es, dass diese Dinger immer genau gleich fallen und immer an der genau gleichen Stelle liegen bleiben?“ Ich testete das mit zwei Münzen, indem ich sie immer wieder in die Höhe warf. So oft ich sie auch warf, nie kamen sie an der gleichen Stelle nach unten und ich war ein guter Münzenwerfer. Ich war damals der festen Überzeugung, dass Werbespots live gesendet wurden. Also, dass just im Augenblick des Werbespots jemand mit einer Kamera dieses Tellerchen filmte, während jemand dahinter stand und diese beiden Dragees in die Luft warf. Ein Sprecher stand etwas abseits des Tellerchens und sprach: „Wahre Schönheit kommt von innen“, in ein Mikrofon.
Das es damals schon die Möglichkeit einer Aufzeichnung gab und Teile eines Films kopiert und mehrmals hintereinander zusammen gefügt werden konnten, war mir nicht bewusst. Also war ich jedes Mal über die militärische Präzision des Werfers erstaunt und zog ernsthaft in Erwägung, später professioneller und natürlich hoch bezahlter Dinge-Werfer zu werden. Es würde ja bestimmt genug Werbefilme geben, in denen irgendwelche Dinge hin und her geworfen werden müssten, um sie entsprechend bewerben zu können. Früchte, Bälle, Lebensmittel, vielleicht Autos?
Was wusste denn ich...?
÷
Mit den schönsten Werbeslogans die sich Werbeagenturen ausdenken konnten, versuchte man mich zu überzeugen, ihre Produkte zu kaufen. Man gab sich da echt ganz schön viel Mühe, wenn man bedachte, dass ich keinen Pfennig Geld besaß, um mir auch nur eins dieser Dinge zu kaufen. Ich bekam zu der Zeit etwa zwei Mark Taschengeld in der Woche und die musste ich mir redlich verdienen, indem ich am Samstagmorgen die Straße fegte oder Papa beim Rasen mähen half. Und ich würde einen feuchten Kehricht tun, meine Kohle für Merz Spezialdragees auszugeben. Auch wenn sie immer so schön geworfen wurden: „Raider heißt jetzt Twix.“ So. Bitte. In your face. Eat this. Einfach so. Von einem Tag auf den anderen Ich verstand nicht, warum ich das tun sollte? Wir kannten Raider seit jeher als Raider, warum sollten wir ab heute dazu Twix sagen, nur weil sich das irgendwelche Werbemenschen ausgedacht hatten? Mich hatte niemand gefragt, ob ich dazu überhaupt Bock hätte. Mann, ich hatte mir doch auch jetzt schon genug zu merken. Was hatte ich heute in Mathe auf? Wann musste mein Deutsch-Aufsatz fertig sein? Was sollte ich dem c-Markus für seine Geburtstagsparty kaufen? Und nun sollte ich mir noch merken, dass Raider nun Twix heißt? Außerdem können Sie mir erzählen, was sie wollen, Raider schmeckte besser, als Twix. Eine Frau fragte mich ständig, wo denn nur der Deinhardt sei, worauf ich allerdings nie eine Antwort wusste und ich hoffte inständig, dass sie ihn irgendwann finden würde. Was sollte ich denn noch alles wissen?: „ADO - die mit der Goldkante“ war ne glatte Lüge. Ich habe nie eine Goldkante an einer Gardine gefunden und ich bin, weiß Gott, auf genug Böden herum gekrochen, um Goldkanten zu suchen. Hätte doch eine recht ertragreiche Sache werden können? Ich meine, welche Hausfrau kontrollierte schon regelmäßig ihre Goldkanten? Militärisch stramm marschierendes Gemüse skandierte zur rhythmischen Marschmusik: „Bonduell ist das famose Zartgemüse aus der Dose“.
Ein knopfäugiger Teddybär belehrte uns, dass nichts über Bärenmarke gehen würde, aber auch gar nichts, außer Bärenmarke im Kaffee. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet ein Bär. Warum der Kühe molk, entschloss sich mir damals völlig. Den Almbauer mit dem weißen Rauschebart, der uns warnte: „Aber Vorsicht. It´s cool, man“ fand ich aber schon lustig. Zumindest verstand ich, was der, im Gegensatz zu dem Problem-Bär, in den Bergen zu tun hatte. Viele Jahre später würde er dafür ab geballert werden. Der Bär, nicht der Opi: „Persil – Da weiß man, was man hat. Guten Abend“.
Irgendwann kam man auf die Idee, doch auch internationale Musiker bei der Werbung mitspielen zu lassen. Immerhin hatten die doch schon Lieder. Da brauchte sich kein Texter die Mühe zu machen, noch extra ein Lied zu komponieren, einen Text zu schreiben, es für hohe Studiokosten produzieren und es von einem unbekannten Künstler singen zu lassen. Und am Ende würde niemand wissen, ob dieses Lied und letztlich auch das Produkt ankommen würde. Mein persönlicher Lieblingswerbesong war David Dundas´ „Jeans on“, der für Jeans der Firma Brutus verwendet wurde. Das Lied wurde für den Werbespot etwas umgetextet und aus „Jeans on“ wurde eben „Put My Brutus Jeans on“. Ich mag das Lied heute noch. Der US-Sänger Barry Manilow sang für Tchibo das Lied „Mandy“ und Robin Beck hatte mit dem Lied „First Time, First Love“ für einen Coca-Cola-Werbespot sogar eigentlich erst ihren richtigen Durchbruch. Sie durfte dann noch mal mit dem englischen Titel „Close to You“ und der deutschen Übersetzung „Einfach gut“ für McDonalds werben. Daran, dass bekannte Musiker ihre Lieder für TV- und Kinowerbung hergeben, hat sich bis heute nichts geändert. Und mit Künstlern wie zum Beispiel Phil Collins, Bon Jovi, Pink Floyd, Depeche Mode, Joe Cocker, Johnny Cash, Melanie Thornton, Gott hab sie selig, sind das durchaus Künstler aus der ersten Reihe und nicht etwa irgendwelche Hinterbänkler, die sich dadurch erst einen Durchbruch oder mehr Erfolg versprechen.
Auch bekannte Größen aus dem Sport sollten da mal ran. Die Firma Esso wollte gerne mit den Spielern des FC Bayern München werben. Ging aber nicht. Franz „Der Kaiser“ Beckenbauer hatte schon einen Werbevertrag mit Aral. Also gab das Bayern-Management die Anfrage an die Nationalmannschaft weiter, die den Job gerne übernahm. Und so warb die gesamte 74er Fußballnational-Mannschaft für einen Werbespot zum Selbsttanken bei Esso, wofür jeder Spieler 35.000 DM für seine Arbeit erhielt. Mit bekannten Namen wirbt es sich eben besser und einfacher, als mit unbekannten Gesichtern. Das hatte der Herr Beckenbauer schon 1971 verstanden, als er für 12.000 DM eine Knorr-Suppe löffelte. Im Jahr 2000 ließ ihn die Werbeabteilung von e-plus: „Jo is denn heit scho Weihnachten?“ fragen. Das aber sicher nicht mehr für 12.000 Tacken, da können Sie mal sicher sein.
Was die Fernsehnation damals schon faszinierte, war das Leid und die Not anderer zu sehen. Schön gemütlich daheim im Fernsehsessel sitzen und bei Chips und Bierchen zusehen, wie das Leben fremder Menschen aus den Fugen gerät. Das ist so, wie uns ein Unfall auf der anderen Autobahnseite fasziniert. Wir wissen eigentlich ganz genau, wir sollten da jetzt nicht hin schauen, denn dann wären wir Gaffer. Niemand mag Gaffer. Aber von den vielen blinkenden Lichtern der Einsatzfahrzeuge und dem regen Treiben der Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten sind wir so gebannt, dass wir den Blick nicht abwenden können. Und wehe, zwei Feuerwehrmänner halten als Sichtschutz eine Decke oder Plane hoch. Ja, dann ist es völlig vorbei mit der Contenance. Da könnte ja ein zerschmetterter Körper oder sogar ein Toter dahinter liegen. Uiuiui, da gucken wir doch mal etwas genauer hin. Vielleicht kann man ja noch einen Fuß oder einen Arm unter der Plane hervor lugen sehen. Holy Moley, da hätte man aber heute Abend beim Abendbrot was zu erzählen, hab ich Recht? Schnell noch ein Selfie, mit Daumen hoch und Unfallstelle im Hintergrund und weiter geht die Fahrt. Dieses Phänomen des Gaffens machte sich Eduard Zimmermann zu nutze. Ede Zimmermann war im Grundschulalter schon etwas dicklich, war extrem unsportlich und trug noch dazu eine dicke Hornbrille. Grund genug für seine Klassenkameraden, ihn auf das Übelste zu verarschen und ständig seinen Turnbeutel zu verstecken. Um sich zu wehren, fehlte dem jungen Eduard schon damals der Mut, außerdem wollten ihm die Lehrer seine Mobbing-Geschichten auch nicht so recht glauben. Später, als junger Erwachsener, träumte er davon, sich ein Kostüm, eine Maske und ein Cape zu schneidern, um wie der Held seiner Jugend, Peter Parker, alias Spiderman gegen das Unrecht in den Kampf zu ziehen. Aber mit 43 Jahren war Eduard nun fett, trug eine noch dickere Hornbrille mit dicken Brillengläsern und hatte seinen ersten Bandscheibenvorfall hinter sich. Kein Spinnfaden der Welt hätte den fetten Spiderman in der Luft gehalten. Darum petzte er sich im ZDF zwölfmal im Jahr durch den Fernsehfreitagabend, um jeden Verbrecher Deutschlands, mit der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“, zur Strecke zu bringen. Edes späte Form der Rache und der Wiedergutmachung. Herr Zimmermann war der einzige Moderator, der es sich im Fernsehen leisten konnte, mit verdrießlicher Miene, immer schlecht gelaunt in die Kameras zu blicken, denn seine Themen waren immer ernst und erschütternd. Urvater war aber eigentlich die Vorgängersendung „Vorsicht Falle!“, beziehungsweise „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“. Lustigerweise sind das Namen, die heute durchaus wieder erfolgversprechend wären. Der Sat1-Film-Film am Donnerstagabend, beruhend auf einem wahren Drama: „Das Wunder von Korschenbroich – Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ein Dorf setzt sich zur Wehr“. In den Hauptrollen Heino Ferch und Monika Ferres. Weil die immer mitspielen, wenn es irgendwo in Deutschland ein Wunder gab, das es Wert war, verfilmt zu werden. Zugegebenermaßen hat Herr Zimmermann mit Hilfe seiner Sendung so einigen Verbrechern das Handwerk gelegt, was ihr ihre Daseinsberechtigung gab.