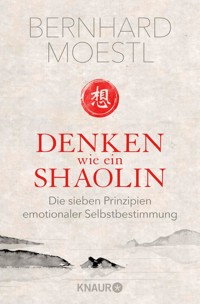12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Shaolin-Experte Bernhard Moestl präsentiert einen Roman über das Leben im dem berühmtesten Kloster für Kampfkunst. Ein mythisches Kloster in den heiligen Bergen Chinas – im Haupttempel eine Schar buddhistischer Mönche, die sich in der Kampfkunst übt. Für einen Neuling aus Europa und seine Sinnsuche scheint da kein Platz zu sein. Warum nur geht von dem Tempel und den gleichförmigen Bewegungen der Kampfübungen so eine Faszination aus - und können diese Mönche tatsächlich etwas über den Sinn des Lebens preisgeben? Wie aber soll man etwas begreifen, wenn der Alltag aus harten Übungen besteht, kaum jemand die eigene Sprache spricht – und dann auch noch der Meister verschwindet? Bestseller-Autor Bernhard Moestl lässt seine Hauptfigur und mit ihr uns Leser eintauchen in diese fremde Welt. Wir erleben und lernen in dieser faszinierenden Umgebung, wie sehr ein jeder von uns selbst nicht nur über das eigene Denken und Fühlen bestimmt, sondern dass wir mit einer geschulten Wahrnehmung unseren eigenen Weg finden können. Aber warum üben sich die Mönche überhaupt in der Kunst des Kämpfens? Und was bedeutet das wirklich für uns? Bestsellerautor Bernhard Moestl gelingt es in diesem Roman über eine Sinnsuche und die weisen Lehren eines charismatischen Mönchs, die buddhistischen und daoistischen Quellen asiatischer Weisheit mit dem altehrwürdigen Szenario des Shaolin-Klosters zu verschmelzen und einen besonderen Weg des Loslassens aufzuzeigen. Ein weiser Shaolin-Roman, der Antworten gibt auf die großen Lebensfragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bernhard Moestl
Der Drachentempel
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Shaolin-Experte Bernhard Moestl präsentiert einen Roman über das Leben im dem berühmtesten Kloster für Kampfkunst.
Ein mythisches Kloster in den heiligen Bergen Chinas – im Haupttempel eine Schar buddhistischer Mönche, die sich in der Kampfkunst übt. Für einen Neuling aus Europa und seine Sinnsuche scheint da kein Platz zu sein. Warum nur geht von dem Tempel und den gleichförmigen Bewegungen der Kampfübungen so eine Faszination aus – und können diese Mönche tatsächlich etwas über den Sinn des Lebens preisgeben? Wie aber soll man etwas begreifen, wenn der Alltag aus harten Übungen besteht, kaum jemand die eigene Sprache spricht – und dann auch noch der Meister verschwindet?
Bestseller-Autor Bernhard Moestl lässt seine Hauptfigur und mit ihr uns Leser eintauchen in diese fremde Welt. Wir erleben und lernen in dieser faszinierenden Umgebung, wie sehr ein jeder von uns selbst nicht nur über das eigene Denken und Fühlen bestimmt, sondern dass wir mit einer geschulten Wahrnehmung unseren eigenen Weg finden können. Aber warum üben sich die Mönche überhaupt in der Kunst des Kämpfens? Und was bedeutet das wirklich für uns?
Bestsellerautor Bernhard Moestl gelingt es in diesem Roman über eine Sinnsuche und die weisen Lehren eines charismatischen Mönchs, die buddhistischen und daoistischen Quellen asiatischer Weisheit mit dem altehrwürdigen Szenario des Shaolin-Klosters zu verschmelzen und einen besonderen Weg des Loslassens aufzuzeigen.
Ein weiser Shaolin-Roman, der Antworten gibt auf die großen Lebensfragen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Danksagung
Für Caroline
Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann das und niemand darf das. Wir müssen selbst unseren Weg gehen.
Buddha
Kapitel eins
Verlorensein
Denkt man an die großen Ereignisse des Lebens zurück, dann sind es oft scheinbare Kleinigkeiten, die einem als Erstes ins Gedächtnis kommen. Es kann ein Geruch sein, ein Gespräch oder ein Geschmack, der spontan die Vergangenheit lebendig werden lässt. Für mich ist es ein Geräusch, das mich zurückbringt in die Welt von Meister Shi Yang He und zu den Mönchen von Shaolin. Ein leises, sattes Klatschen, wie es entsteht, wenn jemand mit der flachen Hand auf seinen ausgestreckten Fußrücken schlägt. Wann immer ich etwas Ähnliches höre, habe ich umgehend den Klosterhof vor Augen, und ich sehe mich selbst, versteckt hinter einer dünnen Säule, wie ich auf eine kleine Gruppe Menschen in orangefarbenen Mönchsgewändern starre.
Zwar war die rote Stütze, hinter der ich mich notdürftig verbarg, viel zu schmal, um meinen ganzen Körper zu verdecken. Doch sie gab mir ein Gefühl der Sicherheit, während ich die jungen Männer beobachtete, die sich wenige Meter von mir zu einer beängstigenden Choreografie bewegten. Die Reihenfolge ihrer Bewegungen schien einem klar definierten Muster zu folgen. Zuerst stießen sie mit einem kurzen Schrei die rechte Faust nach vorne, ließen dann die linke folgen und zogen schließlich beide Fäuste blitzartig zurück an die Hüfte. Ein kurzes Verharren, wieder ein Schrei. Dann ein hoher Sprung, und die Männer ließen sich rücklings auf den Steinboden fallen. Reflexartig schloss ich die Augen. Doch kaum hatte ich sie wieder geöffnet, da war auch die Truppe schon auf den Beinen, und der Ablauf begann von vorne.
Ich beobachtete die Männer mit einer Mischung aus Angst und Faszination. Mir fiel auf, dass die Mitglieder nicht nur in ihren Bewegungen eine perfekte Einheit bildeten. Auch sonst waren sie kaum zu unterscheiden. Alle hatten das schwarze Haar gleich kurz geschoren. Am Körper trugen sie ein orangefarbenes Oberteil und dazu eine weit geschnittene Hose in derselben Farbe. Die Beine waren unten von weißen Strümpfen bedeckt, die ein schwarzes, im Zickzack gebundenes Band eng an den Unterschenkeln hielt, und die Füße steckten in weißen, flachen Turnschuhen einer mir unbekannten Marke. Einzig derjenige, der die Gruppe zu befehligen schien, wich etwas von dieser Norm ab. Zwar war auch er mit der orangefarbenen Hose, weißen Stutzen und den gleichen Schuhen bekleidet, doch trug er trotz der empfindlichen Kälte obenherum nur eine weiße, ärmellose Weste, von der grimmig die gestickten Embleme eines Tigers und eines Drachen herabblickten.
Nachdem der Trainer eine Zeit lang schweigend seine Schützlinge beobachtet hatte, gab er ein kurzes Kommando. Augenblicklich unterbrachen die Männer die Übung und stellten sich in Viererreihen vor ihm auf. Sichtlich zufrieden ließ der Meister den Blick über die Gruppe schweifen. Dann setzte ein weiteres Kommando die Mönche erneut in Bewegung. In exaktem Gleichschritt hoben die Männer nun das rechte Bein so weit in die Höhe, dass die Zehenspitzen über den Kopf ragten, und schlugen sich dabei mit der Handfläche auf den Fußrücken. Dann stellten sie den Fuß zurück und wiederholten die Übung mit dem zweiten Bein. Rechts. Klatsch. Links. Klatsch. Rechts. Klatsch. Klatsch. Klatsch.
Während ich das Geschehen beobachtete, begannen meine Gedanken abzuschweifen. Ich dachte an zu Hause. Wie es wohl meinen Kollegen ging, von denen keiner geglaubt hatte, dass ich jemals diesen Ort erreichen würde? Bald zwei Monate war ich jetzt unterwegs und hatte mich kein einziges Mal daheim gemeldet. Kurz verspürte ich ein schlechtes Gewissen und nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit zumindest eine Postkarte zu schreiben. Die Mönche marschierten weiter mit diesem Klatschen im Hof herum, und ich dachte lächelnd daran, dass sich in diesem Moment ein Traum erfüllt hatte.
Begonnen hatte alles an einem dieser dunklen, trüben Herbstabende, an denen ich nichts anderes tun konnte, als mir die Zeit bis zum nächsten Arbeitstag mit Lesen zu vertreiben. Gelangweilt nahm ich eine der Zeitschriften in die Hand, die mir jeden Monat geliefert wurden, weil ich zu bequem war, das Abonnement zu kündigen. Ich blätterte lustlos durch die Seiten und wollte sie gerade wieder zurück auf den Stapel legen, als mein Blick an einem leicht unscharfen Porträt hängen blieb. Das Bild nahm die ganze Seite ein und zeigte einen Mann, der offensichtlich aus Asien stammte. Gebannt starrte ich auf das Foto. Etwas faszinierte mich an dem Mann. Angestrengt versuchte ich, dahinterzukommen, was es war. Der Bildunterschrift konnte ich entnehmen, dass es sich um einen chinesischen Mönch handelte. Doch allein die Tatsache, dass der Fotografierte Asiate war, reichte nicht, um mich derart anzusprechen. Es musste noch etwas anderes sein. Ich legte mir die Zeitschrift auf die Knie und ließ das Foto auf mich wirken. Langsam wurde mir klar, wo die Faszination herrührte. Der Abgebildete strahlte eine Ruhe und Überlegenheit aus, die sich selbst über das Foto auf mich übertrug. Obwohl ich müde war, beschloss ich, die zu dem Bild gehörende Geschichte zu lesen.
Nach den ersten Zeilen war meine Müdigkeit wie weggeblasen. Der Artikel handelte von einem Reisenden, der in den heiligen Bergen Chinas ein im Westen bis dahin unbekanntes Kloster entdeckt haben wollte. Angeblich verfügten dessen Mönche über ein geheimnisvolles Wissen, das sie seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergaben. War das der Grund für die Ruhe, die dieser Mann ausstrahlte? Ungeduldig überflog ich die Beschreibung der abenteuerlichen Anreise, bis ich zu der Stelle kam, an der es um die Bewohner des Tempels ging. Aufgeregt richtete ich mich auf. Die Mönche, so schrieb der Verfasser, verfügten über Fähigkeiten, mit denen sie ihren Tempel seit mehr als eineinhalb Jahrtausenden gegen alle Angreifer verteidigt hatten. Unsicher, ob ich die Geschichte glauben sollte, unterbrach ich die Lektüre. Konnte so etwas ernsthaft existieren? Oder versuchte hier jemand, mit einer gut erfundenen Story Geld zu verdienen? Andererseits, wie sonst hätte mich der Mönch auf dem Foto derart berühren können?
Es folgten einige Zeilen über die Geschichte des Tempels, welche der Legende nach auf einen indischen Mönch zurückging. Dann blieb mein Blick an einer fett gesetzten Zwischenüberschrift hängen. »Seit der Gründung des Klosters galten die Mönche von Shaolin als unbesiegbare Meister des waffenlosen Nahkampfes.« Die Worte brummten in meinem Kopf. Unbesiegbare Meister. Ich blätterte zurück zu dem Porträt. War der Mann auf dem Foto tatsächlich unbesiegbar? Wirkte er vielleicht deshalb so glücklich? Ich zwang mich, den Blick von dem Mönch zu nehmen und weiterzulesen. »Seit der Gründung des Tempels im fünften Jahrhundert arbeiteten die Mönche unablässig an der Entwicklung und Vervollkommnung von Techniken, mit denen sie ihre Körper in tödliche Waffen verwandeln konnten.« Erneut legte ich die Zeitschrift zur Seite und schloss verwirrt die Augen. Seit wann gab es kämpfende Mönche? Hatte der Verfasser des Artikels zu viel mit den falschen Drogen experimentiert? Oder hielt er seine Leser einfach zum Narren? Doch sofort kam mir wieder das Foto in den Sinn.
»Die Mönche feilten auch an Methoden, die es ihnen erlaubten, ihren Geist zu stählen. Schließlich schien dieser ihnen die einzige wirklich bedeutende Kraft. Schnell hatten die fernöstlichen Meister nämlich erkannt, dass selbst die größte körperliche Stärke nutzlos ist, sobald der Kämpfer auch nur für einen Augenblick die Kontrolle über seinen Geist verliert. Dann richtet sich nämlich seine eigene Kraft gegen ihn selbst.« Gierig las ich weiter. Nur wer imstande sei, sein Denken und seine Gefühle in jedem Augenblick zu kontrollieren, könne nach Ansicht der Mönche einen Kampf bereits beenden, bevor dieser begonnen hatte.
Wieder ließ ich das Heft sinken. Der Satz, der langsam in mein Bewusstsein sickerte, machte mich schwindlig. Ein Meister konnte einen Kampf beenden, bevor er begonnen hatte. Wenn das stimmte, dann musste ein Mensch, der einmal das Bewusstsein eines solchen Meisters erreicht hatte, nie wieder kämpfen.
Automatisch stellte ich mir meinen Alltag vor, in dem ich mich weder mit den Kollegen auseinandersetzen musste noch mich mit ihnen messen. Ich sah mich diesen ständigen Vergleichen aus dem Weg gehen, bei denen ich ohnehin jedes Mal den Kürzeren zog.
Doch so beeindruckend mir diese Überlegungen auch erschienen, so groß waren meine Zweifel.
Wer hatte denn schon sein Lebensglück wirklich selbst in der Hand? Sogar wenn ich mir mein Bankkonto ansah, war es damit trotz der vielen Arbeit nicht weit her. Bisher war noch nie so viel Geld darauf gewesen, dass es mich richtig glücklich gemacht hätte. Worauf aber waren die Mönche dann aus?
Gedankenverloren klappte ich die Zeitschrift zu und legte sie zu den anderen auf den Stapel. Einerseits schien mir klar, dass die beschriebenen Methoden nicht funktionieren konnten, jedenfalls nicht für mich. Das Leben war nun einmal ein ewiger Kampf – gegen einen selbst und gegen jene, die es nicht gut mit einem meinten. Bereits als Kind hatte ich gelernt, dass jeder Versuch, etwas daran ändern zu wollen, vergeudete Zeit war, in der man besser seinen Pflichten nachging. Dagegen konnten weder heilige Berge noch chinesische Mönche etwas ausrichten. Ich musste eben wie jeder andere mein Geld verdienen, wenn ich meine Kosten begleichen und nicht eines Tages auf der Straße landen wollte. Andererseits ging mir die Frage nicht mehr aus dem Kopf, woher der Mönch auf dem Foto diese beeindruckende Ruhe hatte.
In diesem Moment beschloss ich, mich auf die Suche zu machen. Zumindest herauszufinden, ob es nicht vielleicht doch möglich war, dem ewigen Kampf ein Ende zu bereiten. Was hatte ich denn schon groß zu verlieren? Hatte ich nicht ohnehin schon viel zu viel Zeit mit einem Leben verschwendet, das nie meines gewesen war und immer nur daraus bestanden hatte, es möglichst allen anderen recht zu machen?
Aus der Entfernung mischte sich in das rhythmische Klatschen und meine Erinnerungen ein ruhiger, tiefer Gesang. Gebannt lauschte ich dem Chor der Männerstimmen, der einstimmig und durchdringend bis in den Bauch, von rhythmischen Schlägen auf ein hölzern klingendes Instrument begleitet wurde. Der Text des Gesanges schien zwar nur aus zwei Worten zu bestehen, die sich ständig wiederholten, aber meine Sprachkenntnisse reichten nicht aus, um zu verstehen, was sie bedeuteten.
Ich schloss die Augen und ließ den wohltuenden Klangteppich auf mich wirken. Bereits nach kurzer Zeit spürte ich, dass meine Atmung, mein Puls und schließlich meine Gedanken ruhiger wurden. Vielleicht war ja ohnehin alles gar nicht so schlimm.
Ein scharfes Kommando ließ mich unwillkürlich zusammenzucken. Jemand musste mein Eindringen entdeckt haben! Panisch öffnete ich die Augen und starrte hellwach auf den Mann, der die Kampftruppe kommandierte. Was, wenn er die Männer gegen mich schickte? Erleichtert stellte ich fest, dass meine Furcht unbegründet war. Weder der Trainer noch sonst jemand machte den Eindruck, als würde er sich für mich interessieren. Er deutete nur mit dem Zeigefinger auf seine geschlossene Faust und schien der Gruppe etwas zu erklären.
Dann zeigte er wortlos auf einen Schüler. Dieser trat vor, ohne eine Miene zu verziehen. Er nahm vor dem Meister Aufstellung, hob die rechte Faust auf Höhe des Kinns und umschloss sie mit den Fingern der linken Hand. Zu meinem Erstaunen erwiderte der Meister die Geste, die ich eigentlich als Reverenz wahrgenommen hatte. Auf meiner Reise durch China hatte ich diese Form der Ehrerbietung zwar bereits oft gesehen, wobei ich immer ein klares hierarchisches Gefälle wahrgenommen hatte. Warum aber zollte hier der Ältere dem Jüngeren die gleiche Achtung, als begegnete er ihm auf Augenhöhe?
Nun trat der ältere Mönch wortlos zur Seite. Der junge Mann, der alleine vor der Gruppe stand, verharrte kurz, als wolle er Energie sammeln. Auf einmal stieß er ohne Vorwarnung einen Schrei aus und machte einen gestreckten Salto seitwärts. Kaum auf den Füßen, sprang er wieder in die Höhe und riss im Sprung den rechten Arm hoch. In diesem Moment sah ich, dass eine dünne, mehrgliedrige Kette in meine Richtung schwang, die der Kämpfer zuvor in seiner Faust verborgen gehabt haben musste. Nun verstand ich die Geste, die der Meister zuvor erklärt hatte, als er auf seine geschlossene Faust gedeutet hatte. Ein aggressives Surren überlagerte den beruhigenden Gesang der Mönche, als die Waffe durch die Luft und direkt auf mich zuschnellte. Instinktiv duckte ich mich hinter die Säule, wagte es aber dabei nicht, die Mönche aus den Augen zu lassen. Doch stellte ich fest, dass der Angriff gar nicht mir gegolten hatte, denn bis jetzt schien mich noch niemand bemerkt zu haben. Eigentlich wollte ich nur noch weg, doch die Faszination für das, was dann geschah, war stärker als jede Furcht.
Der Schüler war inzwischen wieder in die Höhe gesprungen und hatte sich noch in der Luft die Kette um Brustkorb und Bauch gewickelt. Zurück auf dem Boden verharrte er einen kurzen Augenblick in vorgebeugter Haltung, um dann mit einem einzigen, unerwarteten Ruck die ganze Kraft der eisernen Kette zu entfesseln. Noch nie hatte ich eine so schnelle Bewegung gesehen. Das anfänglich leise Surren der Waffe schwoll nun zu einem bedrohlichen Dröhnen an, das mir Angst einflößte. Niemand, so schoss es mir durch den Kopf, war jemals als Sieger aus einem Kampf gegen die Bewohner dieses Klosters hervorgegangen. Ich schloss erneut die Augen und versuchte, meine Aufmerksamkeit auf den beruhigenden Gesang zu richten. Mehr konnte ich im Moment ohnehin nicht tun. Wäre ich weggelaufen, hätte man mich erst recht bemerkt.
Ein süßlicher Geruch biss mir in die Nase, den ich sofort erkannte. Jemand hatte ein Räucherstäbchen entzündet. Aber wo? Vorsichtig drehte ich mich um. Nur nicht auffallen. Auf der rückwärtig gelegenen Seite des Hofes sah ich einen älteren Mann, der dem Haarschnitt nach auch ein Mönch sein musste. Er ähnelte den Mönchen auf dem Foto. War er der Mann, der mich zu dieser Reise veranlasst hatte? Anders als die Mitglieder der Kampfgruppe und die Mönche in der Zeitschrift war er jedoch mit einem grauen, weit fallenden Gewand bekleidet, das mich entfernt an einen Schlafanzug erinnerte. In tiefster Konzentration bewegte er ein rauchendes Bündel auf und ab, das er zwischen seinen gefalteten Händen hielt. Dabei verneigte er sich im Rhythmus des Gesanges vor einer riesigen, furchterregenden Statue, die streng auf ihn herabblickte.
Mein leises Husten brachte umgehend Leben in den Mann. Ich hielt mir sofort den Mund zu, aber der Mönch unterbrach die Anbetung und wandte mir langsam den Kopf zu. Mir lief es kalt den Rücken herunter. Der Alte sah mich kopfschüttelnd an, als wolle er mich fragen, was ich dort zu suchen hatte. Ich fühlte mich so verloren, als stünde ich im Wohnzimmer eines wildfremden Menschen, in das ich ohne Erlaubnis eingedrungen war. Meine Hände zitterten. Welcher Teufel hatte mich geritten, als ich einfach durch das offen stehende Tempeltor gegangen war?
Der Mönch wandte den Blick wieder von mir ab. Dann machte er ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge. Augenblicklich erstarb das Surren der Waffe. Ich drehte mich unwillkürlich um und sah, dass sowohl die Blicke der jungen Männer als auch der ihres Trainers auf mich gerichtet waren. Jener Schüler, der gerade noch die Kette durch die Luft hatte schwirren lassen, zeigte auf mich und sagte etwas zu seinem Meister. Plötzlich sah ich, wie dieser gemächlich auf mich zukam. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Was, wenn man mich für einen Spion hielt? Wenn ich etwas gesehen hatte, das ich niemals hätte sehen dürfen? Geheimnisvolle, geheime Lehren, es war doch in der Zeitschrift so viel um eine geheime Botschaft gegangen. Ich schluckte. Was, wenn dieser Ort nur als Tempel getarnt war, in Wirklichkeit aber dazu diente, eine verbotene Kampfkunst zu lehren? Nicht einmal der Mönchschor konnte mich mehr beruhigen. Verzweifelt versuchte ich, mein Zittern unter Kontrolle zu bekommen. Mein hastiges Keuchen hallte mir in den Ohren.
Kaum einen Meter von mir entfernt, blieb der Trainer stehen. Dann faltete er ruhig die Hände vor der Brust und verbeugte sich, wobei er etwas murmelte, das wie ein Gruß klang. Ich versuchte, es ihm gleichzutun, so gut ich konnte. Doch meinen ungeschickten Versuch, seine Geste und den Klang seiner Worte zu imitieren, quittierten die Schüler mit schallendem Gelächter. Tief in meinem Inneren war ich erleichtert. Zumindest wurde hier gelacht.
Mein Gegenüber betrachtete mich mit einem Blick, der eine Mischung aus Skepsis und unfreiwilliger Bewunderung verriet. Offensichtlich hatten noch nicht viele Ausländer die Frechheit besessen, ungefragt in das Innere dieses Tempels vorzudringen. Ich fragte mich, was in seinem Kopf vorging. Auch wenn er einen freundlichen Eindruck machte, hatte ich gerade erst gesehen, wie rasch so etwas umschlagen konnte. Ich stellte mich darauf ein, so schnell wie möglich das Weite zu suchen.
Einige Sekunden lang musterte mich der Mönch schweigend. Dann lächelte er plötzlich, und ich vernahm etwas, das nach einer Frage klang. Auch das noch. Wie sollte ich ihm nur klarmachen, dass ich kein Wort verstand? Doch mein Gegenüber hatte die Frage bereits wiederholt und sah mich nun erwartungsvoll an. Ich durfte jetzt nur nicht die gute Stimmung zerstören und beschloss, es einfach mit Kopfschütteln zu versuchen. Das hatte bis jetzt noch überall funktioniert. Zu meiner Erleichterung schien mein Gegenüber zu verstehen, was ich ihm sagen wollte. Mit einer knappen Handbewegung bedeutete er mir, zu warten, und ging hinüber zu seinen Schülern.
Kurz darauf kam er mit einem schmutzigen Stück Papier zurück. Dann bedeutete er mir mit einer lebhaften Geste, ihm einen Stift zu geben. Nervös kramte ich in meinem Rucksack und reichte ihm meinen guten Tintenfüller. Der Meister nickte wortlos und kritzelte etwas auf das Blatt. Dabei drückte er so fest auf, dass die Spitze des Füllers das Papier durchstach. Ich konnte mich in letzter Sekunde zurückhalten, ihm das Schreibgerät aus der Hand zu nehmen. Besser ein kaputter Tintenfüller, als aus dieser Situation nicht mehr lebend herauszukommen! Niemand würde mich hier suchen!
Einige Striche später hielt mein Gegenüber mir auffordernd das Papier hin. Angespannt blickte ich auf den Zettel und fühlte, dass mir flau im Magen wurde. Chinesische Zeichen. Offenbar wusste der Mönch nicht, dass man in Europa nicht mit Zeichen schreibt. Wie aber sollte ich ihm zu verstehen geben, dass ich das Geschriebene nicht lesen konnte? Resigniert betrachtete ich die Krakel auf dem Blatt. Auf einmal fiel mein Blick auf etwas, das mir bekannt vorkam. Ein Viereck aus schwarzen Tintenstrichen, darin drei waagerechte, senkrecht verbunden, und ein Klecks. Die eingeschlossene Jade. Das war doch das Schriftzeichen für Königreich! Der eine Teil der Schriftzeichen im Namen von China, dem »Reich« der Mitte. Dazu ein Fragezeichen am Ende. Ich atmete durch. Der Mönche wollte offenbar wissen, woher ich kam! Das konnte ich sogar sagen. Schließlich hatte ich diese Frage in den letzten Wochen auf der Reise bereits unzählige Male beantwortet. Doch auf einmal war mein Mund so trocken, dass ich keinen Laut herausbrachte. Nervös rieb ich meine Handflächen gegeneinander. Was, wenn ich es falsch aussprach und statt des Namens meiner Heimat ein Schimpfwort herauskam?
»De guo«, sagte ich leise und wartete mit gesenktem Blick auf eine Reaktion.
Doch nichts geschah. Der Meister sah mich nur weiterhin mit diesem durchdringenden Blick an.
»De guo«, sagte ich noch einmal, diesmal lauter. Vielleicht hatte er es einfach nicht gehört.
Wieder keine Reaktion, nicht von ihm, auch nicht von den anderen Mönchen. Es war zum Verrücktwerden. Was bitte war an meinem Chinesisch so schwer zu verstehen? Plötzlich kam mir eine Idee. Ich deutete mit der Spitze meines Zeigefingers auf das Zeichen für »Reich« und hielt dem Mönch den Zettel entgegen.
»Guo«, sagte er und nickte.
Jetzt musste ich nur noch die erste Silbe richtig hinbekommen. »De«, sagte ich mit Nachdruck und deutete danach auf das Zeichen.
Kopfschütteln.
Blieb noch eine Chance. Ich hob die Stimme, als wollte ich eine Frage stellen. »De?«
In diesem Moment kam Leben in die Gruppe. »Ah, ta shi deguo ren!«, rief einer der Schüler hörbar begeistert. Auch der Meister klopfte mir anerkennend auf die Schulter.
Mit einer energischen Geste zeigte mir der Mönch, dass ich warten solle. Dann verließ er den Klosterhof durch ein kleines rotes Tor, das genau meiner Position gegenüberlag. Ich sah ihm nach. Was mochte sich wohl dahinter verbergen? Auf meinem Weg vom Tempeltor hierher war ich an vielen dieser kleinen Türen vorbeigekommen, hatte mich jedoch nicht getraut, sie zu öffnen. Ein leises Kichern ließ mich zu den Schülern schauen. Ihren Blicken nach zu schließen, unterhielten sie sich gerade über mich. Ich sah mich vorsichtig um. Der Hof, in dem wir uns befanden, war von kleineren Tempeln umschlossen, von denen jeder einer anderen Gottheit geweiht zu sein schien. Fasziniert betrachtete ich die Figuren. Manche machten einen durchaus freundlichen Eindruck, während andere aussahen, als wäre mit ihnen eher weniger zu spaßen.
An der Stirnseite des Hofes befand sich eine große Halle. Durch das offen stehende Tor erhaschte ich einen Blick auf drei goldene Statuen, die auf den ersten Blick alle gleich aussahen. Sie hatten die Beine so im Lotossitz verschränkt, dass ihre Fußsohlen nach oben zeigten. Den halb geschlossenen Augen nach zu urteilen, befanden sie sich im Zustand tiefer Versenkung. Die unbeirrbare Ruhe, welche die Statuen ausstrahlten, ließ mich unwillkürlich an den Mönch aus der Zeitschrift denken. Als ich die lang gezogenen Ohren und die an eine Warze gemahnende Haartolle auf der Stirn sah, wusste ich, dass es sich um Darstellungen Buddhas handeln musste, wie ich sie unterwegs schon öfter gesehen hatte. Nur das kurze, knallblaue Haar, das die Köpfe der Standbilder wie ein Helm bedeckte, erinnerte mich daran, dass ich an einem besonderen Ort war. Ich fragte mich, seit wie vielen Hundert Jahren die drei wohl schon so dasaßen.
Ich ließ den Blick weiterschweifen. Der alte Mönch, der mich entdeckt hatte, schien seine Anbetung beendet zu haben. Zumindest war er nirgends mehr zu sehen. Auf der linken Seite führten Treppen, die von einem kunstvoll verzierten Steingeländer gesäumt waren, in einen etwas tiefer gelegenen, nächsten Hof. Ich überlegte, ob ich versuchen sollte, Kontakt zu den fröhlichen jungen Männern aufzunehmen.
Da verstummte das Kichern. Wie auf einen unhörbaren Befehl hin nahm die Gruppe Haltung an. Gebannt blickte ich in Richtung der roten Tür, die der Trainer gerade hinter einem älteren Mann schloss, den ich auf um die siebzig Jahre schätzte. Er musste eine besondere Stellung im Kloster haben, denn anders als jene Mönche, die ich bisher gesehen hatte, war er in einen orange roten Umhang gehüllt. Auch sein aufrechter Gang war beeindruckend, seine Ausstrahlung – ich starrte ihn an. Dies war schon eher ein Mönch wie jener, den ich aus der Zeitschrift kannte. Doch ich versuchte vergeblich, ihn mir beim Zweikampf vorzustellen.
Die beiden kamen zielstrebig auf mich zu. Ich starrte den Älteren an. Sein Kinn zierte ein spitzer, weißer Bart, um den Hals hingen drei Ketten aus riesigen braunen Holzperlen, und auch seine Handgelenke waren derart geschmückt. Eine tiefe Unruhe erfasste mich. Wer war dieser Mann?
Die Männer kamen etwa auf zwei Meter an mich heran und blieben stehen. Der Trainer deutete mit ausgestreckter Handfläche in meine Richtung und sagte etwas zu dem Älteren. Mir rutschte das Herz in die Hose. Wahrscheinlich würde man mich jetzt festnehmen und der Polizei übergeben. Was hatte ich mir aber auch dabei gedacht, hier einfach einzudringen? Warum um alles in der Welt war ich nicht einfach weggelaufen, als der alte Mönch mich entdeckt hatte? Weil ich ohnehin keine Chance gehabt hätte. Nicht gegen diese Kämpfer. Ich versuchte, mich zu beruhigen: Als Mönche waren die Männer hier sicher dem Frieden verpflichtet.
Wie in Trance verfolgte ich, wie der Ältere sich tief verneigte. Es dauerte einen Moment, bis mir aufging, dass die Verbeugung mir galt. Sofort hob ich meine gefalteten Hände so weit vor mein Gesicht, dass meine Zeigefinger die Nase und die Daumen das Kinn berührten, und erwiderte ungelenk die Verbeugung.
Ein Blick auf mein Gegenüber verriet mir, dass die Position meiner Hände viel zu hoch war. Stumm schimpfte ich mit mir. Warum nur war es mir so wichtig, hier alles richtig zu machen? War es die Ausstrahlung dieses Mönches? Es war etwas an ihm, das in mir den Wunsch erweckte, von ihm gemocht zu werden. Dabei war ich nicht einmal in der Lage, mich richtig zu verbeugen. Hatte ich das jetzt wirklich auch noch falsch machen müssen?
Resigniert richtete ich mich auf und blickte in das freundlichste Gesicht, das ich je gesehen hatte. Eine Mischung aus Erleichterung und tiefem Respekt durchströmte mich. Wieder musste ich an das Foto des Mönchs denken, das mich hierhergeführt hatte. Wie durch einen Nebel beobachtete ich, dass sich die Lippen des Alten bewegten. Offenbar versuchte er, mir etwas zu sagen. Ich wollte ihm gerade freundlich klarmachen, dass ich kein Wort verstehen konnte, als ich zu meiner Überraschung das Gefühl hatte, den Namen meiner Heimat in meiner Muttersprache zu hören. Träumte ich, oder sprach der Mönch tatsächlich Deutsch? Warum aber sollte ausgerechnet hier jemand meine Sprache verstehen?
Ich rang mir ein verblüfftes Lächeln ab und sagte: »Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht verstanden.«
»Sprichst du denn nicht Deutsch?«
Die Belustigung im Gesicht meines Gegenübers war unübersehbar.
»Ich … äh … Natürlich, ich bin ja Deutscher!«
Der Mönch sah mich an. »Ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Aber lange nicht gesprochen haben.«
Ich traute meinen Ohren nicht. Auch wenn er etwas schwierig zu verstehen war, das war eindeutig Deutsch! Wo nur hatte er denn diese Sprachkenntnisse aufgeschnappt? Jetzt konnte ich die Begeisterung der Schüler und des jungen Meisters nachvollziehen und verstand, dass er sofort den alten Mönch geholt hatte. Die Jungen standen im Kreis um mich herum und starrten mich an. Der Spitzbart musterte mich mit einem freundlichem Blick. Ich atmete auf. Vielleicht würde ja doch noch alles gut.
Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und sagte verwundert:
»Wie kommt es, dass Ihr meine Sprache sprecht?«
Der alte Meister zog die Augenbrauen zusammen. »Langsam, bitte langsam sprechen!«
Ich bemerkte, dass ich mich reflexartig verbeugte. »Natürlich.« So deutlich als möglich sagte ich: »Wieso könnt Ihr Deutsch?«
»Mein Vater hat gearbeitet für die Besatzer. Ich habe durch Kontakt mit den Kindern die Sprache gelernt.«
Besatzer. Das hatte gerade noch gefehlt. Dunkel erinnerte ich mich daran, dass neben den Engländern auch die Deutschen einmal Teile Chinas besetzt hatten. Meine Erleichterung wich einer erneut aufkeimenden Unsicherheit. Was hatte man wohl mit mir vor? Bestimmt freuten sie sich, dass sie endlich ein lebendes Exemplar dieser verhassten Spezies gefangen hatten und an diesem nun ein Exempel statuieren konnten! Wenn ich mich recht erinnerte, waren die Deutschen in Tsingtao nicht zimperlich gewesen.
Der alte Mönch schien meine Gedanken zu erraten. »Besatzer sind lange her. Heute es gibt keine mehr. Heute bin ich der Abt des Klosters. Ich möchte glauben, du kommst als Freund.« Sein Blick schien mich zu durchdringen.
Er machte eine Pause, als suche er nach den passenden Worten. »Du musst entschuldigen. Ich habe lange nicht mehr in der deutschen Sprache gesprochen.« Noch eine Pause. »Was möchtest du hier?«
Nervös senkte ich den Blick. Der Abt von Shaolin. Nun verstand ich die Reaktion der Gruppe auf sein Erscheinen tatsächlich. Verlegen betrachtete ich den unregelmäßigen Steinboden rund um meine staubigen Schuhe. Was sollte ich ihm denn sagen? Sollte ich ihm von dem Artikel erzählen, der mich hatte aufbrechen lassen? Von meiner Suche nach einem Sinn in meinem Leben? Davon, dass ich endlich unbesiegbar sein wollte? Wie ich mich darauf freute, dass mir meine Gegner bald voller Angst aus dem Weg gingen? So würde es jedenfalls sein, wenn es so kam, wie ich es mir erträumt hatte, und man mich hier als Schüler akzeptierte. Doch mit einem Mal kam ich mir dumm und einfältig vor. In meinen Tagträumen hatte ich mich beim Gespräch mit den Mönchen nie so unsicher gefühlt. Ich stammelte: »Ich möchte … Ich möchte von Euch lernen.« So, jetzt war es heraus. Ich hob den Kopf und stellte fest, dass mein Gegenüber mich die ganze Zeit über beobachtet hatte.
»Was möchtest du von uns lernen?«
»Man sagt, dass Ihr ein Geheimnis kennt.«, sagte ich flüsternd. »Das Geheimnis des glücklichen Lebens.«
Der Abt antwortete nicht. Hatte er mich nicht verstanden? Ich versuchte es noch einmal. »Ich möchte lernen, zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Endlich einen Sinn finden in dem, was ich tue.« Ich senkte den Kopf wieder. »Es heißt, Ihr kennt den Weg dorthin.« Als ich meine stotternd vorgebrachten Worte gehört hatte, wäre ich am liebsten im Boden versunken. Warum blieb mein Gegenüber so ruhig, während ich so nervös war? Ich fühlte den Blick des Abtes auf mir ruhen. Natürlich war er hier zu Hause, und ich war ein Fremder. Aber das allein war es nicht. Der Mönch hatte etwas an sich, das mich beruhigte, während es mir gleichzeitig einen ungeheuren Respekt abnötigte. Wahrscheinlich war er tatsächlich unbesiegbar und wusste das auch. Ich verbeugte mich noch einmal linkisch. »Ich möchte so werden, wie Ihr es seid.«
Der Abt nickte bedächtig und sah mir direkt in die Augen. »Das ist ein langer Weg, mein Freund. Und er ist so verborgen, dass er für viele schwierig zu finden …«
»Dann zeigt ihn mir doch einfach. «
Erschrocken schlug ich mir mit der Hand auf den Mund. Wie hatte ich es wagen können, den Abt einfach zu unterbrechen! »Entschuldigt bitte«, sagte ich. »Ich wollte nicht unhöflich sein.«
»Es ist ein langer Weg«. Der Abt klang ungerührt.
»Ich weiß es. Aber wenn Ihr ihn mir zeigen wollt, dann werde ich ihn bis zum Ende gehen.«
»Du hast es zu eilig. So schnell geht das nicht.«
Ich antwortete nicht. Wie oft hatte ich diese Worte schon gehört? Waren sich denn darin alle einig? Der Mönch hier genauso wie meine Freunde in Deutschland? Mein ehemaliger Chef? »Warte einfach ab. Kommt Zeit, kommt Rat.« Wie oft hatte ich diesen Spruch schon gehört! Jedem Versuch, etwas an meinem ewig gleichen Leben zu verändern, war gebetsmühlenartig mit diesen Worten die Kraft entzogen worden. In meinem Kopf drehte es sich. Waren diese unnützen Sprüche jetzt schon bis hierher vorgedrungen?
Dem Abt schien meine Enttäuschung nicht entgangen zu sein. »Nehmen wir einmal an, ich könnte dir zeigen, wie du deinen Weg findest. Was könntest du uns als Gegenleistung bieten?«
In meinem Kopf ratterte es, als ich meinen Lebenslauf durchging. Zwei staatlich anerkannte Berufsausbildungen, eine davon mit Auszeichnung abgeschlossen. Acht Zusatzausbildungen in den verschiedensten Bereichen. Ich hatte in drei namhaften Unternehmen bis zu achtzig Wochenstunden gearbeitet, und auch wenn ich nicht wirklich reich geworden war, hatten mich viele meiner Bekannten um den Lebensstil beneidet, den ich mir leisten konnte. Doch am Ende war ich nichts als ein fleißiger Untertan gewesen, der alles dafür gegeben hätte, genau das System, das ihn langsam zugrunde richtete, am Leben zu erhalten. Unwillkürlich zitterte ich, denn ich musste daran denken, dass selbst meine langjährige Beziehung zerbrochen war, als meine Partnerin einen Mann gefunden hatte, der ihr mehr Geld, Komfort und Luxus versprochen hatte.
»Nichts«, hörte ich mich selbst wie durch einen Schleier sagen. »Ich habe Euch nichts zu bieten. Rein gar nichts. Nichts von dem, das ich in meinem bisherigen Leben geleistet habe, hatte einen bleibenden Wert.« Ich beschrieb mit den Schuhspitzen Kreise auf dem Boden.
»Ich würde Euch aber selbstverständlich für Eure Dienste bezahlen!«
Die Augen des Abtes funkelten belustigt. »Du willst uns bezahlen?«
Ich sah ihn erstaunt an. »Ja! Warum nicht?«
»Weil wir dein Geld nicht brauchen können.« Er drehte sich um und machte ein paar Schritte in Richtung der roten Tür. Dann blieb er stehen und drehte sich noch einmal zu mir um. »Ist materieller Besitz denn wirklich das Einzige, was ihr habt? Was sollen wir uns denn von deinem Geld kaufen?« Er machte eine kurze Pause. »Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, dass der Tausch von Lebenszeit gegen Geld ein sehr einseitiger ist und euch immer weiter von dem Weg wegführt, den ihr alle so verzweifelt sucht?«
Ich starrte ihn irritiert an.
»Du kannst dein ganzes Leben gegen Geld tauschen. Immer wirst du jemanden finden, der die Tage, Wochen und Jahre deines Lebens nimmt und dir dafür Geld gibt. Zuerst viel, dann immer weniger. Weil du irgendwann so süchtig bist, dass du Geld mit Glück verwechselst. Und am Ende trägst du alles auf die Bank – und hast doch nichts.«
Mir lief es kalt über den Rücken. Wie konnte dieser Mönch wissen, dass ich gearbeitet hatte, bis ich fast umgefallen war, nur um die von der Geschäftsführung vorgegebenen Ziele zu erreichen und bei der nächsten Gehaltserhöhung sicher dabei zu sein?
»Aber wehe«, hörte ich den Abt wie aus der Ferne weitersprechen, »aber wehe du kommst eines Tages darauf, was für ein schlechter Handel dieses Geschäft ist, und möchtest dir Zeit zurückkaufen, weil du doch noch etwas leben möchtest. Dann ist die Wechselstube, in die du alle dir zur Verfügung stehende Zeit getragen hast, um sie gegen noch mehr Geld zu tauschen, plötzlich geschlossen, und der immer lächelnde Berater ist längst dabei, dem Nächsten die Zeit aus der Tasche zu ziehen.«
Obwohl der Mönch nicht lauter geworden war, spürte ich, dass seine Worte eine entsetzliche Unruhe in mir auslösten. Noch niemand hatte mein Leben so präzise beschrieben wie dieser Mann.
»Genau deshalb möchte ich ja …«
Der Blick des Abtes ließ mich verstummen. »Geh nach Hause. Bleib bei deinem Geld, mein Freund.«