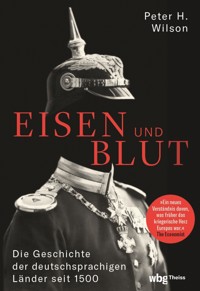23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kampf um Macht und Glauben: der Krieg, der Europa prägte Was mit dem Prager Fenstersturz im Mai 1618 begann, sollte sich zu einem jahrzehntelangen Konflikt auswachsen, der die religiöse und politische Landkarte Europas für immer veränderte: Der Dreißigjährige Krieg hinterließ Millionen Tote und prägte die Überlebenden für Generationen. Peter H. Wilson hat die unzähligen Einzelstränge der Geschichte dieses Krieges kenntnisreich und detailliert zu einer Gesamtdarstellung verwoben. - Ursachenforschung: europäische Machtverhältnisse am Vorabend des Kriegs - "Nur" ein Religionskrieg? Motivationen und Kriegsstrategien aus drei Jahrzehnten - Kaiser, Feldherren und Geistliche: Kurzporträts der wichtigsten Akteure - Das Schicksal der Zivilisten und Soldaten: die Folgen des Dreißigjährigen Krieges für das Volk - Der Westfälische Frieden: Geburt einer neuen internationalen Ordnung oder nur Ende eines sinnlosen Konflikts? Detailliert, gründlich, umfassend: das Standardwerk zum Dreißigjährigen Krieg Einen nahezu gesamteuropäischen Krieg in seiner Gänze zu erfassen, ist ein riesiges Unterfangen. Peter H. Wilson ist es mit seinem monumentalen Werk gelungen. Aufgeteilt in die Vorgeschichte, den Verlauf der Kampfhandlungen, die Friedensschlüsse und die weitreichenden Folgen, bereitet er den Dreißigjährigen Krieg umfassend und verständlich auf. Dabei werden die Beweggründe der Entscheidungsträger ebenso unter die Lupe genommen wie die Rolle einfachen Soldaten, die auf den zahlreichen Schlachtfeldern ihr Leben ließen. Damit ist ihm ein gut zu lesendes Standardwerk zum Thema gelungen, das anschaulich den neuesten Forschungsstand zu einem Krieg präsentiert, der Europa nachhaltig prägte und traumatisierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2205
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Familie
Die englische Originalausgabe ist bei Penguin Books Ltd., London erschienen.
© Peter H. Wilson 2009
The author has asserted his moral rights
All rights reserved
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung
des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.
Sonderausgabe 2020
© der deutschen Ausgabe 2017 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.
Lektorat: Daphne Schadewaldt, Wiesbaden
Gestaltung und Satz: primustype Hurler GmbH, Notzingen
Einbandgestaltung: Harald Braun, Berlin
Einbandabbildung: Jacques Callot (1592–1635), „Der Galgenbaum“, Blatt 2 der Folge „Les Grandes
Misères de la Guerre“ (Die großen Schrecken des Krieges), 1632/33. Radierung. akg-images / Erich Lessing
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4135-8
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-8062-4136-5
eBook (epub): 978-3-8062-4137-2
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Stammbaum der Habsburger
Vorwort
Erster Teil: Die Anfänge
1.Einleitung
Drei Mann im freien Fall
Interpretationen
Was dieses Buch will
2.Aufruhr im Herzen der Christenheit
Das Heilige Römische Reich
Der Prozess der Konfessionalisierung
Religion und Reichsrecht.
3.Die Casa de Austria
Besitz und Dynastie
Stände und Konfession
Das Wiedererstarken des Katholizismus.
4.Der Türkenkrieg und seine Folgen
Die Türkengefahr
Kriegsgebräuche
Der Lange Türkenkrieg (1593–1606).
Bruderzwist im Hause Habsburg
5.Pax Hispanica
Die spanische Monarchie
Der Aufstand der Niederlande (1568–1609)
Die Spanische Straße
Die spanische Friedenspolitik.
6.Dominium Maris Baltici
Dänemark
Das uneinige Haus Wasa
Polen-Litauen
7.Von Rudolf zu Matthias (1582–1612)
Die deutschen Fürsten und die Religion
Die Konfessionen und die Reichspolitik bis 1608
Union und Liga (1608/09).
Der Jülich-Klevische Erbfolgestreit (1609/10)
8.Am Rande des Abgrunds?
Kaiser Matthias
Der Uskokenkrieg und die habsburgische Erbfolge (1615–17)
Die Pfalz spielt mit dem Feuer
Zweiter Teil: Der Konflikt
9.Der Böhmische Aufstand (1618–20)
Für Libertät und Privilegien
Der Kampf um die Kronen
Ferdinand sammelt seine Kräfte.
Am Weißen Berg.
Auf wessen Konto ging das Scheitern?
10.Ferdinand triumphiert (1621–24)
Die pfälzische Sache
Protestantische Söldnerführer
Die katholische Vormachtstellung (1621–29).
11.Olivares und Richelieu
Olivares
Richelieu
Das Veltlin
12.Dänemarks Krieg gegen den Kaiser (1625–29)
Wirren in Niedersachsen.
Wallenstein
Dänemarks Niederlage (1626–29)
13.Die Gefahr eines europäischen Krieges (1628–30)
Die Ostsee
Die Niederlande
Mantua und La Rochelle
Das Restitutionsedikt
Der Regensburger Kurfürstentag von 1630
14.Der Löwe des Nordens (1630–32)
Die schwedische Intervention.
Zwischen Löwe und Adler.
Das schwedische Imperium
Hilferufe.
Auf dem Zenit
15.Ohne Gustav Adolf (1633/34)
Stabilisierungsbemühungen
Spannungen am Rhein.
Spanien interveniert.
Wallenstein: der letzte Akt.
Die beiden Ferdinands.
16.Für Deutschlands Freiheit (1635/36)
Richelieu beschließt Krieg.
Der Krieg im Westen (1635/36)
Der Prager Frieden von 1635
Patriotische Appelle
Erneuerte Friedensbemühungen
17.Die habsburgische Flut (1637–40)
Pattsituation.
Entschlossenheit am Rhein
Frieden für Norddeutschland?
18.In der Schwebe (1641–43)
Die französisch-schwedische Allianz (1641)
Der Krieg im Reich (1642/43).
Die Krise in Spanien spitzt sich zu (1635–43)
Von Breda nach Rocroi (1637–43)
19.Verhandlungsdruck (1644/45)
Der Westfälische Kongress
Frankreich in Deutschland (1644)
Der Ostseeraum wird schwedisch (1643–45)
1645.Annus horribilis et mirabilis.
20.Krieg oder Frieden (1646–48)
Eine Vertrauenskrise
Der Konsens kommt in Sicht
Spanien schließt Frieden mit den Niederlanden
Die Endrunde 1648
Dritter Teil: Nach dem Frieden
21.Das Westfälische Friedensabkommen
Die internationale Dimension
Ein christlicher Frieden
Demobilisierung
Das Reich erholt sich
22.Die Kosten des Krieges
Eine alles verzehrende Wut?
Demografische Folgen
Wirtschaftliche Auswirkungen
Die Krise des Territorialstaats.
Kulturelle Auswirkungen.
23.Die Erfahrung des Krieges
Das Wesen der Erfahrung
Militär und Zivilbevölkerung
Wahrnehmungsweisen.
Gedenken.
Anhang
Anmerkungen
Zu den Währungsangaben
Verzeichnis der Karten und Schlachtenpläne
Karten.
Schlachtenpläne
Legende
Bildnachweis
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Quellen.
Literatur
Personenregister
Zusammenspiel
Vorbemerkung
Die in diesem Buch erwähnten Orte werden mit ihrem in der Fachliteratur gebräuchlichen Namen bezeichnet; in den meisten Fällen ist dies ihre deutsche Bezeichnung (die inzwischen mitunter selbst historisch ist). Der in den jeweiligen Ländern gebräuchliche Name wird, wo dies notwendig erscheint, bei der ersten Erwähnung in Klammern angegeben. Die im Text erwähnten Personen werden mit ihren jeweils gebräuchlichsten Namen und Titeln vorgestellt. Vollständige Namen und Titel sowie die Lebensdaten bietet das Register. Seit Friedrich Schillers 1799 abgeschlossenem Dramenzyklus kennt man den „Generalissimus“ Ferdinands II. allgemein als „Wallenstein“. Diese Namensform des Mannes, der als Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein geboren wurde, wird deshalb auch im Folgenden verwendet. In zeitgenössischen Dokumenten wird Wallenstein in der Regel „der Friedländer“ genannt, nach seinem Schloss und Herzogtum Friedland in Nordböhmen. Mit Bezug auf das Herrschaftsgebiet der englisch-schottischen Stuartmonarchie wird bisweilen der Begriff „britisch“ verwendet, der eigentlich einen Anachronismus darstellt; „englisch“ wäre in den betreffenden Fällen jedoch noch irreführender und wird nur dort gebraucht, wo es tatsächlich um England im engeren Sinne geht. Alle Daten sind nach dem „neuen Stil“ des gregorianischen Kalenders angegeben, der in katholischen Territorien Europas und des Heiligen Römischen Reiches um 1582 eingeführt wurde. Dieser war dem „alten Stil“ des julianischen Kalenders, der von den meisten Protestanten des deutschsprachigen Raums bis etwa 1700 beibehalten wurde, um zehn Tage voraus.
Vorwort
Zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges gibt es viele Detailstudien, aber nur wenige umfassende Gesamtdarstellungen. Bei den meisten Büchern, die den ganzen Krieg zum Gegenstand haben, handelt es sich um knappe Einführungen für Schule und Studium. Das leuchtet ein: Um tatsächlich alle Aspekte des Dreißigjährigen Krieges angemessen behandeln zu können, müsste man mindestens 14 europäische Sprachen beherrschen – und bräuchte wohl ebenso viele Menschenleben und mehr, um die Masse des verfügbaren Archivmaterials zu bewältigen. Selbst die Literatur zum Thema umfasst Millionen von Seiten; es gibt allein 4000 Titel zum Westfälischen Frieden, der den Krieg beendete. Diese unglaubliche Materialfülle hat die bisherigen Darstellungen des Dreißigjährigen Krieges auf verschiedene Weise beeinflusst. Manche schlagen eine Schneise durch das Dickicht der Details und versuchen, den Krieg in eine umfassendere Erklärung des europäischen Modernisierungsprozesses einzubetten. Andere Darstellungen geben den handelnden Individuen und den Ereignissen größeren Raum, aber nicht selten bemerkt man eine gewisse Erschöpfung des Autors oder der Autorin, sobald die Geschehnisse sich der Mitte der 1630er-Jahre nähern. Bis zu jener Zeit waren nämlich die meisten der Helden und Schurken tot, die den ersten Kapiteln der Geschichte so viel Spannung und Leben eingehaucht hatten. Andere, deren Namen die Nachwelt längst vergessen hat, waren an ihre Stelle getreten. Aus diesem Umstand folgt nicht selten eine gewisse Beschleunigung, um nicht zu sagen Hastigkeit in der Darstellung, und die letzten 13 Jahre eines 30-jährigen Krieges werden in ein Viertel des Textes (oder noch weniger!) gepresst, wovon noch einmal ein Großteil auf die Erörterung des Friedensschlusses und der Kriegsfolgen entfällt.
Das vorliegende Buch möchte dieses Missverhältnis durch eine ausgewogenere Darstellung des gesamten Kriegsverlaufes beheben. Einige Besonderheiten dieses Ansatzes werden im Einführungskapitel erläutert. Entscheidend ist dabei, dass der Dreißigjährige Krieg als ein eigenständiger Konflikt betrachtet wird, der um die politische und religiöse Ordnung Mitteleuropas geführt wurde – und nicht als Teil eines großen europäischen „Gesamtkonflikts“ während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Zwar bringt diese Betrachtungsweise des Krieges als Einzelkonflikt eine gewisse Vereinfachung mit sich; aber andererseits lenkt sie die Aufmerksamkeit auf seine Ursprünge in den komplexen Verhältnissen, die das Heilige Römische Reich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts prägten. Der erste Teil des Buches soll diese Hintergründe erklären und den Krieg gerade dadurch, auf eine andere Weise als die gerade beschriebene, in seinen europäischen Kontext einbetten. Der zweite Teil folgt dem Verlauf der Tragödie in annähernd chronologischer Ordnung. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, warum jegliche Friedensbemühungen vor Mitte der 1640er-Jahre scheiterten. Im dritten und letzten Teil geht es um die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Folgen des Dreißigjährigen Krieges sowie um seine langfristige Bedeutung. In allen drei Teilen des Buches werden strukturale Erklärungsansätze mit der Betrachtung von Macht und Ohnmacht der handelnden Personen verknüpft. Neben den altbekannten „Hauptfiguren“ der Erzählung sollen dabei auch weithin unbekannte Zeitgenossen Beachtung finden – mehr Beachtung, als ihnen üblicherweise zuteilwird. Die Literaturangaben bieten eine Auswahl aus der bereits erwähnten Fülle an Material, wobei ein Schwerpunkt auf neueren Werken liegt: Sie sind für viele Leserinnen und Leser leichter zugänglich und enthalten noch dazu weitere Hinweise auf die aktuellste Fachliteratur.
Nur zu gern bedanke ich mich für die Unterstützung des Arts and Humanities Research Council, das mir durch ein Forschungsstipendium in den Jahren 2007 und 2008 die Fertigstellung dieses Buches ermöglicht hat. An der University of Sunderland hat ein hervorragendes Forschungsumfeld meine Arbeit um vieles leichter gemacht, und dasselbe gilt für den Fachbereich Geschichte an der University of Hull, wo ich so herzlich aufgenommen wurde und die letzten Kapitel des Buches entstanden sind. Leopold Auer und seine Mitarbeiter am Haus-, Hof- und Staatsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs in Wien haben mir bei meinem allzu kurzen Aufenthalt 2006 wertvolle Unterstützung zukommen lassen. Ich danke Scott Dixon, Robert Evans, Ralph Morrison und Neil Rennoldson für ihre Hilfe bei der Beschaffung seltener oder unbekannter Literatur und vor allem Kacper Rękawek für seine Hilfestellung bei der Sichtung polnischer Quellen und Forschungsbeiträge. Clarissa Campbell Orr, Tryntje Helfferich, Michael Kaiser, Maureen Meikle, Géza Pálffy und Ciro Paoletti haben mir in einigen Detailfragen unendlich weitergeholfen. Zu besonderem Dank bin ich Trevor Johnson verpflichtet, der mir sein Manuskript über die Gegenreformation in der Oberpfalz schon vor Veröffentlichung des Buches zur Verfügung gestellt hat. Leider kann ich mich bei ihm, der 2007 viel zu früh verstorben ist, nicht mehr dafür revanchieren.
Mein Lektor Simon Winder hat mir immer wieder Mut zugesprochen und so meinen Glauben daran gestärkt, dass dieses Buch tatsächlich irgendwann fertig werden würde. Durch seinen guten Rat und seine umsichtigen Verbesserungsvorschläge hat das Manuskript beträchtlich an Klarheit gewonnen. Charlotte Ridings hat mit ihrer gründlichen Korrekturarbeit Unstimmigkeiten und Fehler beseitigt. Cecilia Mackay hat meinen Illustrations-Wunschzettel Wirklichkeit werden lassen.
Eliane, Alec, Tom und Nina haben es geduldig ertragen, dass ich immer wieder in die Vergangenheit „abgetaucht“ bin, und haben mir – wie schon so oft – die größte Hilfe und Inspiration zukommen lassen. Ihnen sei dieses Buch in Liebe gewidmet.
Peter H. Wilson
ERSTER TEILDIE ANFÄNGE
1. Einleitung
Drei Mann im freien Fall
Kurz nach neun Uhr früh am Morgen des 23. Mai 1618, es war ein Mittwoch, fand sich Wilhelm Slavata in einer äußerst misslichen Lage, denn er hing aus einem Fenster der Prager Burg. In einer solchen Klemme hatte der 46-jährige Adlige noch nie gesteckt. Als Präsident der Böhmischen Kammer, vormaliger Hofrichter und nun königlicher Statthalter war er immerhin ein führender Vertreter der Obrigkeit in den Ländern der böhmischen Krone und konnte auf eine glänzende Karriere in habsburgischen Diensten zurückblicken. Seine Heirat mit der reichen Erbin Lucie Ottilie von Neuhaus hatte aus ihm zudem einen der wohlhabendsten Männer des ganzen Königreiches gemacht.
Nur Augenblicke zuvor hatten fünf Bewaffnete seinen ähnlich illustren Amtskollegen Jaroslav Martinitz ergriffen und – von dessen Flehen, sie möchten ihn doch zuerst noch die Beichte ablegen lassen, nur noch wütender gemacht – kurzerhand aus dem Fenster geworfen, kopfüber aus demselben Fenster, an dessen Sims sich nun Slavata festklammerte und, in 17 Metern Höhe über dem Burggraben, gefährlich umherbaumelte. Ein zorniges Stimmengewirr, das aus dem Inneren des Gemaches drang, ließ ihn menschliche Hilfe kaum erhoffen. Im selben Moment durchfuhr ein scharfer Schmerz Slavatas Finger: Jemand hatte mit dem Griff seines Schwertes daraufgeschlagen. Die Schmerzen wurden unerträglich, sein Griff löste sich, er verlor den Halt und stürzte ab, wobei er sich am steinernen Fenstersims eines unteren Geschosses den Hinterkopf aufschlug. Als Slavata in der Tiefe verschwand, richteten seine Angreifer ihre Aufmerksamkeit auf den Sekretär des Statthalters, Philipp Fabricius von Rosenfeld, der einen von ihnen – vermutlich ein weniger bedrohliches Mitglied des Trupps – fest umklammerte. Auch Fabricius flehte um Gnade; auch ihm half es nichts: Ohne viel Federlesens warf man ihn aus dem Fenster, seinem Herrn und dessen Schicksal hinterher.
Das jedoch entwickelte sich anders als gedacht. Während Slavata am Boden des Burggrabens aufschlug, war Martinitz weiter oben gelandet und rutschte nun die Böschung hinab, um seinem Freund zu helfen. Unterwegs verletzte er sich noch mit seinem eigenen Schwert; die Angreifer hatten versäumt, es ihm abzuschnallen. Vom Fenster oben hallten Schüsse. Irgendwie gelang es Martinitz, dem benommenen Slavata auf die Beine zu helfen, und gemeinsam konnten sie sich in den nahe gelegenen Palast des böhmischen Oberstkanzlers Lobkowitz retten, der an ihrem so jäh unterbrochenen Treffen nicht hatte teilnehmen können, weil er sich auf Reisen befand. Von der Burg wurden zwei Männer hinübergeschickt, die Slavata und Martinitz liquidieren sollten, doch Lobkowitz’ Frau Polyxena verriegelte die Tür und konnte die Häscher schließlich zum Abzug überreden. Gleich am nächsten Tag flüchtete Martinitz über die Grenze nach Bayern. Slavata war zu schwer verletzt, als dass er gleich hätte aufbrechen können, und musste sich vorerst verstecken. Fabricius, der erstaunlicherweise auf beiden Beinen gelandet war, eilte derweil nach Wien, in das pulsierende Herz der Habsburgermonarchie und politische Zentrum des Heiligen Römischen Reiches, um den Kaiser zu alarmieren.1
Der geschilderte Vorfall ist als „Prager Fenstersturz“ in die Geschichte eingegangen. Er löste den Böhmischen Aufstand aus, der gemeinhin als Beginn des Dreißigjährigen Krieges gilt – eines Krieges, der acht Millionen Leben kosten und die politische wie religiöse Landkarte Europas vollkommen verändern sollte. Der Dreißigjährige Krieg nimmt in der deutschen und der tschechischen Geschichte einen ähnlich wichtigen Platz ein wie die Bürgerkriege Englands, Spaniens und der Vereinigten Staaten oder die Revolutionen in Frankreich und Russland in der Geschichte dieser Länder. Wie sie alle ist er ein prägendes Moment und ein nationales Trauma, das die Sicht der betroffenen Staaten auf sich selbst und auf ihren Platz in der Welt entscheidend mitgeformt hat. Die Schwierigkeit, die für spätere Generationen darin lag, mit dem schieren Ausmaß der Verwüstung zurechtzukommen, hat man mit der schwierigen geschichtlichen Aufarbeitung des Holocausts verglichen.2 In den Augen der meisten Deutschen sollte der Dreißigjährige Krieg schließlich eine Zeit der nationalen Schmach darstellen, die den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt gehemmt und Deutschland 200 Jahre lang zu innerem Streit und internationaler Machtlosigkeit verdammt hatte.
Interpretationen
Die gerade angesprochene Interpretation hat ihren Ursprung in einer sehr viel späteren Niederlage, die nicht nur das Interesse am Dreißigjährigen Krieg erneuert, sondern auch die Sichtweise auf denselben grundlegend verändert hat. Für die Erlebnisgeneration des Dreißigjährigen Krieges und ihre Kinder jedoch behielten die Kriegsereignisse ihre zeitgeschichtliche Unmittelbarkeit. Von Anfang an erregte der Konflikt großes Interesse in ganz Europa und beschleunigte so jene „Medienrevolution“ des frühen 17. Jahrhunderts, aus der auch die moderne Zeitung hervorgehen sollte (siehe Kapitel 23). Der Vertragstext des Westfälischen Friedens, der am Ende des Krieges stand, entwickelte sich zum internationalen Bestseller, der innerhalb eines einzigen Jahres mindestens 30 Auflagen erlebte. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts nahm das Interesse langsam ab, aber da rutschte Mitteleuropa auch schon in einen weiteren 30-jährigen Konflikt hinein – diesmal vor allem mit Frankreich und dem Osmanischen Reich. Die Erinnerung an den „ersten“ Dreißigjährigen Krieg wurde jedoch wachgehalten – durch alljährliche Feste zur Erinnerung an den Friedensschluss von Münster und Osnabrück, aber auch durch eine (vergleichsweise kleine) Anzahl von Büchern für ein breites Publikum. Wie die öffentlichen Feierlichkeiten vermittelten diese Werke eine im Großen und Ganzen positive Sicht der Kriegsergebnisse, schließlich seien die Freiheiten der deutschen Protestanten bewahrt und die Reichsverfassung gestärkt worden.3
Die Französische Revolution und dann die Zerstückelung des Heiligen Römischen Reiches durch Napoleon trübten diese Sichtweise drastisch ein. Der österreichisch-preußische Gegenangriff auf das revolutionäre Frankreich zog die Deutschen 1792 erneut in den Kreislauf aus Invasion, Niederlage, Aufruhr und Verwüstung hinein. Diese Erfahrungen fielen mit neuen geistigen und kulturellen Strömungen zusammen, die zusammenfassend als „Sturm und Drang“ und „Romantik“ bezeichnet werden. Grell-entsetzliche Episoden aus dem Dreißigjährigen Krieg – Geschichten von Massakern, Vergewaltigungen und Folter – stießen beim Publikum sofort auf Resonanz, während die dramatischen Biografien von Figuren wie dem kaiserlichen Heerführer Wallenstein oder dem schwedischen König Gustav Adolf durch den Vergleich mit Napoleon und anderen Männern der Gegenwart mit neuer Bedeutung aufgeladen wurden. Der maßgebliche Vertreter des „Sturm und Drang“, Friedrich Schiller, fand ein nur zu begieriges Publikum vor, als er 1791 seine Geschichte des dreißigjährigen Krieges veröffentlichte, der er in den Jahren 1797–99 seine Wallenstein-Trilogie folgen ließ.
Die romantische Umdeutung des Dreißigjährigen Krieges brachte drei Motive hervor, die sich in Darstellungen des Konflikts noch heute beobachten lassen. Das erste war eine düstere Faszination durch Tod, Verfall und Zerstörung, wobei Deutschland in der Regel als hilfloses Opfer fremder Aggressoren dargestellt wurde. Schauerliche Geschichten von Kriegsgräueln entnahm man Sagen und Märchen aus dem Volk, aber auch der Literatur des 17. Jahrhunderts, allen voran Grimmelshausens Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch, der von den Dichtern der Romantik als „erster echt deutscher Roman“ wiederentdeckt und im frühen 19. Jahrhundert in zahlreichen „verbesserten“ Ausgaben neu aufgelegt wurde.4
Die Wiederkehr solcher Kriegsgeschichten in historischen Romanen, in Historiengemälden sowie als Gegenstand des schulischen Geschichtsunterrichts verstärkte die mündliche Überlieferung zum Dreißigjährigen Krieg in Familien und Gemeinden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die unter den Kampfhandlungen gelitten hatten. Der Dreißigjährige Krieg wurde zum Maßstab für die Beurteilung aller späteren Kriege. So interpretierten die Bewohner des östlichen Frankreich jede weitere Invasion ihrer Heimat im Lichte alter Geschichten von Schweden und Kroaten, die die Gegend in den 1630er-Jahren verwüstet hatten. Auch Soldaten, die an der Ostfront des Ersten Weltkriegs kämpften, meinten in ihren Schützengräben ein Grauen zu erleben, wie es die Welt seit 300 Jahren nicht mehr gesehen hatte. In seiner Rundfunkansprache vom 3. Mai 1945 verkündete Hitlers Architekt und Rüstungsminister Albert Speer: „Die Verwüstungen, die dieser Krieg Deutschland brachte, sind nur mit denen des Dreißigjährigen Krieges vergleichbar. Die Verluste der Bevölkerung durch Hunger und durch Seuchen dürfen aber niemals das damalige Ausmaß annehmen.“ Nur aus diesem Grunde sehe sich, wie Speer fortfährt, Großadmiral Dönitz genötigt, die Waffen nicht niederzulegen. In den 1960er-Jahren ergaben Meinungsumfragen, dass die Deutschen den Dreißigjährigen Krieg als die größte Katastrophe ihrer Geschichte ansahen, noch vor den beiden Weltkriegen, dem Holocaust und dem Schwarzen Tod.5
Der Einfluss des Fernsehens hat diese Wahrnehmung im späteren 20. Jahrhundert zweifellos verschoben, insbesondere durch die weite Verbreitung von Film- und Fotoaufnahmen der Gräuel aus jüngerer Vergangenheit. Dennoch konnten deutsche Historiker noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts behaupten: „Niemals zuvor und auch niemals nachher, nicht einmal während der Schrecken der Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges, wurde das Land so verheert und die Menschen so gequält“ wie zwischen 1618 und 1648.6
Das zweite Motiv, das die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat, ist die Vorstellung von einer geradezu tragischen Unvermeidlichkeit des Dreißigjährigen Krieges. Dies fällt schon in Schillers Wallenstein auf. Schiller zeichnet die Hauptfigur seiner Trilogie als einen idealistischen, den Frieden suchenden Helden, dessen unabwendbares Schicksal jedoch darin liegt, von seinen engsten Vertrauten ermordet zu werden. Nach den Napoleonischen Kriegen fand dieses Gefühl eines unaufhaltsamen Versinkens im Chaos allgemeine Verbreitung. Die frühere, positive Wahrnehmung des Westfälischen Friedens erschien nun, da das römisch-deutsche Reich 1806 aufgelöst worden war, nicht mehr angemessen. Davon, dass der Dreißigjährige Krieg letztlich sogar die Reichsverfassung gestärkt habe, konnte jetzt keine Rede mehr sein; stattdessen erschien er als der Anfang vom Ende des Alten Reiches. Neuere Forschungen bekräftigen diesen Eindruck, indem sie die Aufmerksamkeit von einzelnen Akteuren und einem möglichen Verfassungsversagen weglenkten und sich stattdessen dem langfristigen Wandel der europäischen Wirtschaft vom Feudalismus zum Kapitalismus zuwandten, der angeblich eine „allgemeine Krise des 17. Jahrhunderts“ heraufbeschwor.7 Andere sehen diese Krise als wesentlich politisch oder ökologisch an, oder als Ausdruck zweier oder mehrerer Faktoren zugleich. In allen ihren Varianten jedoch behauptet die „Krisenthese“, ein tief liegender Strukturwandel am Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit habe Spannungen verschärft, die sich in den Jahren nach 1600 überall in Europa in gewaltsamen Aufständen und internationalen Konflikten entladen hätten.8
Im 19. Jahrhundert brachten verschiedene Sichtweisen dieser Ereignisse im Heiligen Römischen Reich schließlich das dritte und wohl einflussreichste Motiv in der deutschen Diskussion über den Dreißigjährigen Krieg hervor, indem die Erinnerung an 1618/48 mit der Auseinandersetzung um die „deutsche Frage“ ab 1814/15 verwoben wurde. Es entstanden zwei konkurrierende Narrative, die jeweils mit einer Variante des zukünftigen Deutschland in Verbindung gebracht wurden. Die „großdeutsche Lösung“ sah einen losen Staatenbund vor, dem das habsburgische Österreich und das hohenzollerische Preußen angehören sollten, aber auch das „dritte Deutschland“ der Mittel- und Kleinstaaten, darunter etwa die Königreiche Bayern und Württemberg oder das Herzogtum Nassau. Die „kleindeutsche Lösung“ hingegen schloss Österreich aus, was vor allem an den Schwierigkeiten lag, mit denen die Einbindung der habsburgischen Untertanen in Italien und auf dem Balkan verbunden gewesen wäre. Mit dem preußischen Sieg über Österreich im Deutschen Krieg von 1866 setzte die kleindeutsche Lösung sich durch; durch den deutschen Sieg über Frankreich im Krieg von 1870/71, aus dem das Deutsche Kaiserreich hervorging, wurde sie gefestigt. Beide Zukunftsvisionen, die großdeutsche wie die kleindeutsche, waren eindeutig religiös konnotiert, was auch auf den Streit über die Vergangenheit des Landes übertragen wurde. Die Annahme, der Dreißigjährige Krieg sei ein Religionskrieg gewesen, erschien nun so selbstverständlich, dass sie nur selten infrage gestellt wurde.
Als überaus bedeutsam sollte sich herausstellen, dass der Streit um die deutsche Frage mit der Geburt der modernen Geschichtswissenschaft zusammenfiel. Leopold von Ranke, der Gründervater der historisch-kritischen Schule der deutschen Geschichtsschreibung, nahm sich Wallenstein zum Gegenstand der einzigen großen Biografie unter seinen zahlreichen Schriften. Ranke und seine Zeitgenossen scheuten keine Mühen, das erhaltene Archivmaterial zu studieren, und vieles von dem, was sie geschrieben haben, besitzt auch heute noch großen Wert. Zu ihrer Zeit hatte die Ranke-Schule prägenden Einfluss darauf, wie die Historiker anderer Länder über den Dreißigjährigen Krieg dachten, obwohl natürlich ein jeder den Konflikt in seine eigene Nationalgeschichte einzupassen suchte. Die französischen Historiker betrachteten ihn in der Regel durch die Brille von Richelieu und Mazarin, deren Politik angeblich die Grundlagen einer „französischen Vorherrschaft“ auf dem europäischen Kontinent gelegt hatte, die von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die Zeit Napoleons andauerte. In der spanischen Geschichtsschreibung hingegen stand das Motiv eines nationalen Niedergangs im Vordergrund, schien Spanien sich doch nach 1618 deutlich übernommen zu haben. Historiker aus der Schweiz, den Niederlanden und Portugal wiederum verbanden den Dreißigjährigen Krieg mit der Unabhängigkeit ihrer Nationen (jeweils von der Herrschaft der Habsburger), während Dänen und Schweden ihn im Kontext ihrer gegenseitigen Rivalität im Ostseeraum einordneten. Die Sicht der britischen Geschichtsschreibung wich am wenigsten von der deutschen Perspektive ab, was unter anderem daran lag, dass die im 17. Jahrhundert über England und Schottland herrschende Dynastie der Stuarts wegen der Heirat Elisabeth Stuarts mit dem pfälzischen Kurfürsten mit dessen folgenreicher Entscheidung in Verbindung gebracht wurde, sich nach dem Prager Fenstersturz an die Seite der böhmischen Aufständischen zu stellen. Viele britische Historiker des 19. Jahrhunderts betrachteten die Verbindung der beiden Adelshäuser in religiösen Begriffen, nämlich als Ausdruck eines gemeinsamen Kampfes für die „protestantische Sache“; ähnliche Ansichten finden sich auch in den deutlich konfessionell gefärbten Arbeiten deutscher Historiker derselben Zeit, deren Werke wiederum die hauptsächlichen Quellen ihrer britischen Fachkollegen darstellten.9
Die Vorstellung vom Dreißigjährigen Krieg als einem Religionskrieg harmonierte zudem mit der protestantischen Meistererzählung, die hinter einem großen Teil der Historiografie des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts stand und der zufolge die Reformation mitsamt ihren Folgen als Befreiung vom katholischen Joch gedeutet wurde. Dieselbe progressive Entwicklungslinie ließ sich aber auch ohne konfessionelle Einfärbung zeichnen, nämlich als rein säkularer Modernisierungsprozess. In einer neueren Darstellung wird der Dreißigjährige Krieg so zur „Entwicklungs- oder … Modernisierungskrise“ der europäischen Zivilisation, zu einem „Inferno“, das die moderne Welt hervorgebracht habe.10
Es ist ein Gemeinplatz der geschichts- und politikwissenschaftlichen Literatur, dass der Westfälische Friedensschluss am Ursprung jenes Systems souveräner Staaten stehe, das in den kommenden Jahrhunderten die zwischenstaatlichen Beziehungen auf der ganzen Welt prägen sollte und deshalb auch als das Westfälische Staatensystem bekannt ist. Unter Militärhistorikern gelten Schlüsselfiguren wie Gustav Adolf gemeinhin als die „Väter“ der modernen Kriegführung. Auf politischer Ebene, heißt es, habe der Dreißigjährige Krieg die Ära des Absolutismus eingeläutet, die das Schicksal weiter Teile Europas bis zur Französischen Revolution bestimmt habe. Die Europäer ihrerseits exportierten ihre Konflikte in die Karibik, nach Brasilien, Westafrika, Mosambik, Ceylon, Indonesien, weit über den Atlantik und den Pazifik. Das Silber, mit dem die Soldaten des katholischen Europa entlohnt wurden, förderten indigene Mexikaner, Peruaner und Bolivianer unter entsetzlichen Bedingungen aus den Minen Südamerikas; viele Tausende von ihnen sollten deshalb zu den Opfern des Dreißigjährigen Krieges gezählt werden. Afrikanische Sklaven plagten sich auf den Plantagen niederländischer Zuckerrohrpflanzer, deren saftige Gewinne zur Finanzierung des Unabhängigkeitskampfes ihrer Republik gegen die Spanier beitrugen, neben Einnahmen aus dem Ostseegetreidehandel und der Befischung der Nordsee.
Oft dominiert in der englischsprachigen Forschung zum Dreißigjährigen Krieg mittlerweile das Interesse an diesem weiteren Kontext; die Geschehnisse innerhalb des Heiligen Römischen Reiches werden entsprechend als Teil eines größeren Machtkampfes zwischen Frankreich, Schweden und den englischen, niederländischen und deutschen Protestanten auf der einen Seite und den Kräften der spanisch-habsburgischen Hegemonie auf der anderen dargestellt. Nach dieser Lesart war der Krieg innerhalb des Reiches entweder von Anfang an nur das „Anhängsel“ eines größeren Konflikts – oder wurde es doch spätestens, sobald in den 1630er-Jahren Schweden und Frankreich in Deutschland eingriffen. Ein führender britischer Vertreter dieser internationalen Perspektive auf den Dreißigjährigen Krieg hat deshalb die national fokussierte Auffassung in Teilen der älteren Geschichtsforschung zurückgewiesen und insbesondere manchen deutschen Historikern vorgeworfen, sich provinziell zu gebärden, neigten sie doch dazu, „den Krieg fast ausschließlich unter lokalem und regionalem Blickwinkel darzustellen“. Dennoch bleibt auch die „internationale Schule“ tief von der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts geprägt: etwa, indem sie den Ausbruch des Konflikts als unvermeidlich darstellt und den weiteren Kriegsverlauf als stetige Eskalation von Gewalt und konfessionellem Ressentiment beschreibt.11
Was dieses Buch will
Das Geschehen des Dreißigjährigen Krieges war außerordentlich komplex. Die angesprochenen Interpretationsprobleme ergeben sich aus dem Versuch, diese Komplexität zu reduzieren und das Kriegsgeschehen zu vereinfachen – meist durch die übermäßige Betonung einer einzelnen Facette des Konflikts zulasten aller anderen. Das vorliegende Buch soll, erstens, die unterschiedlichen Aspekte wieder miteinander verknüpfen, und zwar durch den ihnen gemeinsamen Bezug zur Reichsverfassung. Der Krieg innerhalb der Reichsgrenzen hing mit anderen Konflikten zusammen, aber er blieb doch immer klar umrissen. Selbst außerhalb des Heiligen Römischen Reiches waren viele Zeitgenossen der Ansicht, es sei ein und derselbe Krieg, der mit dem Böhmischen Aufstand begann und mit dem Westfälischen Frieden endete. In den frühen 1620er-Jahren begannen sie, von einem „fünfjährigen“ oder „sechsjährigen Krieg“ zu sprechen, und so zählten sie bis 1648 immer weiter.12
Gleichwohl betraf der Konflikt ganz Europa, und die europäische Geschichte wäre wohl sehr viel anders verlaufen, wenn es den Dreißigjährigen Krieg nicht gegeben oder dieser zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Unter den führenden Mächten Europas blieb allein Russland unbeteiligt. Sowohl Polen als auch das Osmanische Reich übten beträchtlichen Einfluss aus, ohne direkt einzugreifen. Den Niederländern gelang es gerade so, ihren eigenen Kampf gegen die Spanier von dem gesamteuropäischen Geschehen getrennt zu halten; zugleich bemühten sie sich aber, das Geschehen im römisch-deutschen Reich durch begrenzte, indirekte Hilfeleistungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das Engagement der englisch-schottischen Krone auf dem Kontinent war substanzieller; ein formeller Kriegseintritt fand jedoch gleichfalls nicht statt. Frankreich und Spanien mischten sich zwar ein, trennten ihre Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg allerdings deutlich von dem Konflikt, den sie zur selben Zeit gegeneinander ausfochten; dieser hatte seine eigenen Ursprünge und sollte nach 1648 noch elf weitere Jahre andauern. Dänemark und Schweden waren vollwertige Kriegsparteien, obgleich ihre Beteiligung kaum etwas mit den Ursprüngen des Konflikts zu tun hatte. Auch andere benachbarte Territorien, wie etwa Savoyen oder Lothringen, wurden in die Auseinandersetzung hineingezogen, ohne darüber ihre eigenen Ziele und lokalen Streitigkeiten aus dem Blick zu verlieren.
Die zweite Hauptthese der vorliegenden Studie ist diese: Der Dreißigjährige Krieg war nicht in erster Linie ein Religionskrieg.13 Religion und Konfession stellten wirkmächtige Identifikationsmerkmale dar, keine Frage; doch mussten sie sich dabei gegen politische, soziale, sprachliche, geschlechtliche und andere Unterscheidungen durchsetzen. Die meisten zeitgenössischen Beobachter sprachen von kaiserlichen, bayerischen, schwedischen oder böhmischen Truppen, nicht von katholischen oder protestantischen – überhaupt sind „katholisch“ und „protestantisch“ anachronistische Kennzeichnungen, die sich seit dem 19. Jahrhundert aus Gründen der Bequemlichkeit eingebürgert haben, um zu einer einfacheren Darstellung des Geschehens zu gelangen. Der Dreißigjährige Krieg war nur insofern ein Religionskrieg, als der Glaube in der Frühen Neuzeit das leitende Prinzip in allen Bereichen öffentlichen oder privaten Handelns lieferte. Um den tatsächlichen Zusammenhang zwischen dem militärischen Konflikt und den theologischen Streitigkeiten innerhalb des Christentums zu verstehen, müssen wir zwischen militanten und gemäßigten Gläubigen unterscheiden. Fromm waren sie jedoch alle, und wir sollten die Moderaten unter ihnen nicht gleich für die rationaleren, vernünftigeren oder gar säkulareren Menschen halten. Der Unterschied zwischen Moderaten und Militanten lag nicht im Ausmaß ihres religiösen Eifers, sondern darin, wie eng Glauben und Handeln für sie miteinander verbunden waren. Alle waren sie davon überzeugt, dass ihre eigene Spielart des christlichen Glaubens die einzig seligmachende sei, dass sie allein zur Richtschnur in allen Fragen der Gerechtigkeit, der Politik und des alltäglichen Lebens tauge. Die Moderaten allerdings waren pragmatisch gesinnt; für sie stellte die ersehnte Wiedervereinigung aller Christen in einer einzigen Kirche eher ein grundsätzliches Fernziel als ein konkretes Handlungsmotiv dar. Ganz anders die Militanten: Ihnen schien dieses Ziel bereits in Reichweite, und so waren sie nicht nur gewillt, zu seiner Erreichung Gewalt statt guter Worte einzusetzen, sondern verspürten dazu sogar einen göttlichen Auftrag. Die biblische Botschaft sprach zu ihnen mit der Stimme der Vorsehung, als Ankündigung einer bevorstehenden Endzeit, und sie setzten die Ereignisse ihrer Gegenwart in einen direkten Zusammenhang mit dem biblischen Text. Für sie war der Konflikt ein Heiliger Krieg – ein kosmischer Showdown zwischen Gut und Böse, in dem der Zweck fast jedes Mittel heiligte.
Wie wir noch sehen werden, blieben die Militanten in der Minderheit. Den Krieg erlebten sie meist als Beobachter oder als Opfer von Kampf und Vertreibung. Dennoch erwies sich, damals wie heute, Militanz genau dann als besonders gefährlich, wenn sie mit politischer Macht in eins fiel. Dann nämlich erzeugt sie bei den Herrschenden das wahnhafte Gefühl, sie seien Gottes Auserwählte, erfüllten Gottes Willen und dürften schließlich auch mit göttlichem Lohn rechnen. Wer so denkt, der glaubt an die absolute und alleinige Geltung der eigenen Normen, an die unbedingte Überlegenheit der eigenen Regierungsform und die alleinige Wahrheit der eigenen Religion. Wenn solche Fundamentalisten „die anderen“ als von Grund auf böse dämonisieren, ist das die psychologische Entsprechung zu einer militärischen Kriegserklärung, die jede Möglichkeit zu Dialog oder Kompromiss torpediert. Einmal radikalisiert meinen sie, ihre Gegner nicht mehr als Menschen behandeln zu müssen. Probleme, die sie vielleicht selbst mitverursacht haben, werden ausschließlich dem Feind in die Schuhe geschoben. Ein derart übersteigertes Selbstbewusstsein birgt freilich Gefahren für beide Seiten. Der Glaube an den göttlichen Beistand ermuntert Fundamentalisten, Risiken einzugehen. Wenn die Chancen auf Erfolg verschwindend gering erscheinen, sehen sie darin lediglich die Absicht der göttlichen Vorsehung, ihren Glauben auf die Probe zu stellen. An ihrer festen Überzeugung, dass der Sieg ihnen am Ende sicher sei, kann nichts rütteln. Eine solche Einstellung kann zu wilder Entschlossenheit oder verbissenem Widerstand führen, aber für einen langfristigen militärischen Erfolg taugt sie kaum. Fundamentalisten haben keine wirkliche Kenntnis ihrer Gegner, denn sie geben sich nicht die geringste Mühe, diese zu verstehen. Gewiss haben fundamentalistische Auffassungen einigen Schlüsselmomenten des Dreißigjährigen Krieges ihren Stempel aufgedrückt, etwa dem Prager Fenstersturz oder der Entscheidung des pfälzischen Kurfürsten, sich dem Böhmischen Aufstand anzuschließen. Der Einfluss militanter Kräfte mag bisweilen in einem Missverhältnis zu ihrer tatsächlichen Zahl gestanden haben; das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Konflikt durch ihre Augen betrachten und interpretieren sollten.
Die dritte entscheidende These dieses Buches ist, dass der Dreißigjährige Krieg keineswegs unvermeidlich war. Der Einfluss ökologischer und ökonomischer Probleme auf das gesamteuropäische Kriegsgeschehen im 17. Jahrhundert ist bestenfalls marginal gewesen. Es war ja auch nicht so, dass tatsächlich der gesamte Kontinent von einer Welle der Gewalt überrollt worden wäre: Weite Teile des Heiligen Römischen Reiches blieben nach 1618 friedlich, obwohl sie bestimmte fundamentale Probleme mit den Kriegsgebieten gemein hatten; erst als der Konflikt 1631/32 eskalierte, brach die Gewalt sich hier ebenfalls Bahn. Auch aus dem Augsburger Religionsfrieden von 1555, der die Spannungen der Nachreformationszeit beilegen sollte, ergab sich nicht zwangsläufig gleich ein Krieg. Zwar folgten ihm einige wenige, über das gesamte Reich verstreute Gewaltausbrüche, aber vor 1618 eben doch kein allgemeiner Konflikt. Wir sprechen hier immerhin von der auf lange Zeit längsten Friedensperiode der neueren deutschen Geschichte – erst 2008, 63 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sollte dieser Rekord gebrochen werden! Was das bedeutet, wird noch deutlicher, wenn wir dem relativen Frieden im Heiligen Römischen Reich des späteren 16. Jahrhunderts etwa die brutalen Bürgerkriege gegenüberstellen, die von den 1560er-Jahren an Frankreich und die Niederlande erschütterten.
Angesichts des großen Erfolges der Augsburger Regelung von 1555 erscheint der allgemeine Kriegsausbruch ab 1618 umso erklärungsbedürftiger. Der erste Teil dieses Buches soll eine solche Erklärung liefern; außerdem legt er die allgemeine Situation im damaligen Europa dar und stellt die Hauptproblematik sowie zahlreiche Hauptfiguren des Dreißigjährigen Krieges vor. Im zweiten Teil folgt dann eine weitgehend chronologische Betrachtung der Kriegsereignisse, wobei dem Geschehen ab 1635, das in der bisherigen Forschung zu Unrecht vernachlässigt worden ist, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird – wer die Jahre nach 1635 außer Acht lässt, wird nie verstehen, warum ein Friedensschluss lange Zeit unerreichbar blieb. Die abschließenden Kapitel beleuchten die politischen Konsequenzen des Dreißigjährigen Krieges, seine immensen Kosten (an Material und Menschenleben) sowie die Frage, was der Krieg bedeutete – für jene, die ihn erlebten, aber auch für nachfolgende Generationen.
2. Aufruhr im Herzen der Christenheit
Das Heilige Römische Reich
Auch vor 1618 war das Geschehen im Heiligen Römischen Reich durchaus nicht undramatisch – aber das Drama, von dem hier die Rede ist, war doch eher im Gerichtssaal als auf dem Schlachtfeld angesiedelt. Die Mitteleuropäer des 16. Jahrhunderts sahen sich in diverse langfristige – und oft auch langatmige – Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die von späteren Generationen als ermüdend und belanglos abgetan worden sind. Stattdessen verdichtete man die Jahrzehnte vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges zu einem griffigen Narrativ, demzufolge es eine fortschreitende, konfessionelle wie politische Polarisierung gewesen sei, die unausweichlich zum Krieg geführt habe. Da es mitunter sehr schwerfällt, die Komplexitäten des Alten Reiches angemessen darzustellen, ist ein solches Vorgehen nur zu verständlich.
Im 18. Jahrhundert musste selbst der unermüdliche Johann Jakob Moser (der neben seiner Juristenkarriere auch noch die Zeit fand, 600 protestantische Kirchenlieder zu schreiben und acht Kinder großzuziehen) seine Gesamtdarstellung der Reichsverfassung nach immerhin mehr als 100 Bänden abbrechen. Anscheinend besteht die einzige Möglichkeit, sich dem Problem zu nähern, tatsächlich darin – wie T.C.W. Blanning so treffend bemerkt hat –, eine Vorliebe für das Anomale zu kultivieren, denn das Alte Reich und seine Teile passten in keine denkbare Schublade.14 In eine ähnliche Richtung geht die viel zitierte Einschätzung des Naturrechtsphilosophen Samuel Pufendorf, der 1667 erklärte, das Reich sei weder eine „reguläre Monarchie“ noch eine Republik, sondern sei „unregelmäßig“ und gleiche einem „Monstrum“. Doch vielleicht bietet eine andere zeitgenössische Metapher den besseren Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts begannen Naturphilosophen wie René Descartes, die Welt auf mechanische Weise zu erklären. Alles, lebendige Wesen wie die Bewegung der Himmelskörper, interpretierten sie als komplexe mechanische Apparate. Vor diesem ideengeschichtlichen Hintergrund erscheint das Alte Reich als ein träger, sperriger Schwertransporter, in dessen Innerem gleichwohl eine ausgefeilte und komplizierte, dabei überraschend robuste Maschinerie von Gewichten und Gegengewichten ihr Werk tat. Die Könige von Frankreich, Schweden und Dänemark mochten mit ihren Schwertern auf dieses Gefährt einschlagen, indessen der osmanische Sultan es mit seinem Szepter traktierte: So zerbeulten sie vielleicht seine äußere Hülle und brachten auch ein paar der empfindlicheren Teile im Inneren durcheinander – aber den gemächlichen, schwerfälligen Gang des großen Ganzen hielten sie nicht auf.
Mauern, Türme, Herrschaftssitze Was diesen Koloss vorantrieb, war die harte Arbeit von Millionen von Kleinbauern und anderen einfachen Leuten, die in den 2200 Städten, den mindestens 150 000 Dörfern, den zahlreichen Mönchs- und Nonnenklöstern sowie anderen Gemeinschaften im ganzen römisch-deutschen Reich lebten. Dort, auf der Ebene der Gemeinschaften, spielte sich das wirkliche Leben ab: Menschen heirateten, bekamen Kinder, gaben und nahmen Arbeit, brachten die Ernte ein, stellten Waren her und trieben Handel. Diese Gemeinschaften sind es auch, die Matthäus Merians berühmte Kupferstichsammlung Topographia Germaniae dominieren, ein monumentales Verlagsvorhaben, das zur Hochzeit des Krieges in den 1630er-Jahren begonnen und erst 40 Jahre später abgeschlossen wurde.15 Die zuletzt 30 Bände der Topographia enthalten kaum eine Schilderung der natürlichen Umgebung, sondern versammeln, nach Gegenden gruppiert und alphabetisch geordnet, Beschreibungen all jener Ortschaften, die Merian und seine Mitarbeiter entweder selbst besucht oder von denen sie gehört oder gelesen hatten. Die zahlreichen beigegebenen Kupferstiche liefern mit ihren Mauern, Kirchtürmen und Herrschaftsbauten eine perfekte Veranschaulichung der drei Elemente, aus denen sich jedes der abgebildeten Gemeinwesen zusammenfügte, und lassen zudem erkennen, wie diese mit den Machtstrukturen des gesamten Reiches zusammenhingen.
In der Darstellung wird jeder Ort deutlich von der ihn umgebenden Landschaft abgesetzt; die Merian-Ansichten zeigen die Stadtgemeinschaft in ihrem klar umgrenzten sozialen Raum. Die meisten der gezeigten Städte und Siedlungen liegen an Flüssen, die für die Kommunikation mit dem Rest der Welt unerlässlich waren, aber auch zur Abfallentsorgung und als erste Barriere gegen Angreifer dienten. Anders als die meisten heutigen Flüsse folgten die Flüsse des 17. Jahrhunderts noch ihrem natürlichen Lauf. Während der Schneeschmelze oder nach starkem Regen schwollen sie an, traten über die Ufer und ergossen sich über Auen und Niederungen. Größere Flüsse änderten mit der Zeit ihren Lauf, schufen Inseln und Nebenarme, die kluge Brückenbauer in die Planung ihrer weit gespannten Meisterwerke einbezogen. Aus dem Mittelalter stammende Mauern umschlossen Städte und größere Dörfer, nach außen oft ergänzt durch einen Verteidigungsgraben, der mit dem Wasser aus Flüssen und Bächen gefüllt wurde. Zu diesen hohen, aber vergleichsweise dünnen Mauern mit ihren markanten Türmen und Torwerken gesellten sich mit der Zeit weitere, modernere Verteidigungsanlagen, die vor der Stadt angelegt wurden, um diese vor Artilleriebeschuss zu schützen. Einige Städte hatten sich schon im 16. Jahrhundert derartige Befestigungen zugelegt, aber in den meisten Fällen geschah dies erst in den zunehmend kriegsgeprägten 1620er-Jahren – entweder durch völlige Neubauten oder durch die Modernisierung bestehender Anlagen. Die nunmehr dicken, gedrungenen Festungswälle mit ihren mächtigen, steinernen Bastionen erstreckten sich in einigem Abstand rings um den mittelalterlichen Stadtkern. Neuere Vorstädte schlossen sie bisweilen ein, mitunter wurden diese aber auch rigoros niedergerissen, um ein rundherum freies Schussfeld zu erhalten. Nur ein geübtes Auge konnte die ausgeklügelten geometrischen Muster erkennen, mit denen die neuen Befestigungsanlagen die Landschaft überzogen, denn das Geflecht von Wällen, Vorwerken und Gräben wurde, betrachtete man es aus Bodensicht, meist von zusätzlichen Erdwällen verdeckt, die sich bis weit in das Umland erstreckten. Bei den wenigen Gebäuden, die außerhalb der Befestigungsanlagen verblieben, handelte es sich entweder um Gewerbebauten wie Sägemühlen oder Ziegelöfen oder um kirchliche Stiftungen wie Mönchs- oder Nonnenklöster, die ihrerseits wieder eigene Gemeinschaften bildeten.
Sogar kleinere Dörfer und Weiler wurden eingezäunt – einerseits, um wilde Tiere fernzuhalten, aber andererseits auch, um dem Orts- und Heimatgefühl der Bewohner Ausdruck zu verleihen. Die Stadttore wurden bei Einbruch der Dunkelheit verschlossen und waren selbst in vergleichsweise friedlichen Zeiten stets bewacht. Wer sie durchschritt, wurde nach dem Woher und Wohin seines Weges gefragt; mitgeführte Waren mussten nicht selten verzollt werden. Die Stadtmauern – genauer gesagt: die Schwierigkeit ihrer Erweiterung und die damit verbundenen hohen Kosten – sorgten dafür, dass sich in ihrem Inneren die Häuser dicht an dicht drängten, in größeren Städten mit einem dritten oder sogar weiteren Stockwerken versehen wurden und überhaupt jeglicher verfügbare Raum – ob im Keller oder unter dem Dach – genutzt wurde. Stein oder Backstein kamen oft nur im Erdgeschoss zum Einsatz; den Rest des Hauses errichtete man als Fachwerkbau. Feuer war eine ständige Gefahr und richtete oft wesentlich größeren Schaden an als der Krieg. Die Enge in den Städten schärfte so auch die Neugier und Wachsamkeit ihrer Bewohner: Ein allzeit betrunkener Nachbar war nicht nur ein Ärgernis, sondern im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Zudem waren die Gemeinwesen der Frühen Neuzeit nur in den seltensten Fällen groß genug, um auch nur den Anschein von Anonymität zuzulassen. Das gesellschaftliche Leben spielte sich weitgehend von Angesicht zu Angesicht ab, und Fremde oder Außenseiter zogen Blicke, Erkundigungen, nicht selten auch Verdächtigungen auf sich. Das Herannahen des Krieges brachte ganze Scharen von bewaffneten Fremden, die von den Hügeln oder aus dem Dunkel der Wälder in Richtung der Siedlungen zogen. Sie sprachen ungewohnte Dialekte, vielleicht sogar fremde Sprachen. Jeder neue Soldatentrupp bedeutete weitere hungrige Mäuler in der Stadt; oft waren es am Ende mehr Soldaten als Stadtbewohner, die verpflegt sein wollten. Stellte man sich dem Eindringen der fremden Truppen entgegen, riskierte man die Beschädigung oder gar Zerstörung wohlvertrauter Bauten. Schlugen die Soldaten eine Bresche in die Mauer, war der Schutzraum der Stadtgemeinschaft verletzt. Der folgende Einfall endete für gewöhnlich in Plündern, Brandschatzen und Schlimmerem.
Die Kirchtürme, die sich so imposant über die Mauern und Dächer der Stadt erhoben, verwiesen auf eine zweite, spirituelle Dimension der Siedlung, die immer auch eine Gemeinschaft der Gläubigen war. Kirchen wurden in der Regel aus Stein errichtet und zählten zu den größten Bauten am Ort. In den Kupferstichen Merians sind sie mit großer Sorgfalt abgebildet und beschriftet; jede Kirche wird dort mit ihrem Namen bezeichnet, die bedeutenderen unter ihnen erhalten manchmal sogar eine eigene Bildtafel. Selbst eher kleine Städte konnten vier oder mehr Kirchen haben, die jeweils das Zentrum eines Pfarrbezirks bildeten. Größere (Kirch-)Dörfer deckten auch den Seelsorgebedarf der umliegenden Weiler, mit Mönchs- und Nonnenklöstern standen weitere Gotteshäuser bereit. Die Anzahl und Größe dieser Bauten belegt nicht nur die große Bedeutung des Glaubens in der damaligen Zeit, sondern auch die wirtschaftliche Stärke einer frühneuzeitlichen Amtskirche, die in allen maßgeblichen Gemeinwesen vertreten war.
Die andere Sorte von Gebäuden, die ein Reisender schon von fern entdeckt haben würde, waren die repräsentativen Bauten der weltlichen Macht. Rathäuser, Paläste oder Vogteien waren die neben den Kirchen größten Gebäude in den Städten der Frühen Neuzeit. Sie waren in der Regel weit massiver konstruiert als gewerblich genutzte Gebäude; wesentlich schmuck- und eindrucksvoller waren sie ohnehin. Wie die Kirchen standen auch sie symbolisch für alle Einwohner: sowohl als klar umrissene Gemeinschaft von Ortsansässigen wie auch als Angehörige eines größeren Gemeinwesens. Die Städte und die meisten Dörfer erfreuten sich einer beträchtlichen Autonomie, was die Regelung ihrer inneren Angelegenheiten betraf, die in den Händen von gewählten Vertretern der wahlberechtigten Einwohnerschaft lag; wahlberechtigt waren in der Regel männliche, verheiratete Hausbesitzer und Familienväter. Die Befugnisse der gewählten Gemeindevertreter konnten sich im Einzelnen stark unterscheiden, umfassten aber in der Regel die niedere Gerichtsbarkeit, begrenzte Vollmachten zur Erhebung von Abgaben und Diensten für gemeinschaftliche Aufgaben sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Besitzes an Grund und Gütern. Entscheidend war, dass zu diesen Befugnissen meist das Recht gehörte, über die Niederlassung ortsfremder Personen zu entscheiden sowie all jene zu bestrafen, die gegen die Regeln der Gemeinschaft verstießen. Dennoch war keine Dorf- oder Stadtgemeinschaft vollkommen autark: Jeder, der ein Rathaus, den Amtssitz eines Dorfvorstehers oder ein anderes zentrales Verwaltungsgebäude aufsuchte, würde dort ein geschnitztes, gemeißeltes oder aufgemaltes Wappen vorfinden, das auf eine höhere Macht als die der städtischen oder dörflichen Obrigkeit verwies – eine höhere Macht, der ebenjene Rechenschaft schuldig war.
Die Reichsverfassung war es, die Tausende von Städten, Dörfern und anderen Gemeinschaften in einem hierarchisch geordneten System überlappender Jurisdiktionen miteinander verknüpfte. Obwohl sich der Titel von Merians Topographia Germaniae auf Deutschland zu beziehen scheint, ist ihr Gegenstand doch das Heilige Römische Reich – ein Gebiet, das auf einer Fläche von noch immer rund 680 000 Quadratkilometern nicht nur das gesamte heutige Deutschland, Österreich, Luxemburg und Tschechien umfasste, sondern weite Teile Westpolens sowie Lothringen und das Elsass, die heute in Frankreich liegen, noch dazu. Obwohl sie in Merians Topographia fehlen, waren auch die heutigen Niederlande und Belgien um 1600 noch größtenteils mit dem Heiligen Römischen Reich verbunden, genauso wie – auf einer Fläche von weiteren 65 000 Quadratkilometern – diverse Territorien in Oberitalien; in den Institutionen des Reiches waren diese Gebiete gleichwohl nicht vertreten.16
Der Kaiser und die Fürsten Das Reich als Ganzes symbolisierte das spätmittelalterliche Ideal einer geeinten Christenheit. Sein Herrscher war der einzige christliche Monarch, der den Kaisertitel trug, was ihn über alle anderen gekrönten Häupter des Abendlands erhob. Der kaiserliche Anspruch auf die weltliche Oberherrschaft in Europa entsprang der Vorstellung, das Heilige Römische Reich stelle die lückenlose Fortsetzung des Römischen Reiches der Antike dar und sei somit, wie dieses, mit dem letzten der vier großen Weltreiche zu identifizieren, die im biblischen Buch Daniel prophezeit worden waren. Dieses Ideal einer allumfassenden Herrschaft war jedoch von den Schauplätzen ihrer praktischen Umsetzung, von der „Politik vor Ort“, denkbar weit entfernt – eine unmittelbare Herrschaft des Kaisers über die zahlreichen ihm untertanen Territorien war ausgeschlossen. Stattdessen wurde die kaiserliche Autorität über das Reich durch eine Stufenfolge von Zuständigkeiten und Befugnissen vermittelt, die letztlich auf mittelalterlich-feudale Ursprünge zurückging. Der Kaiser war der oberste Lehnsherr einer Heerschar ihm untergebener, geringerer Autoritäten, die untereinander ebenfalls durch Lehnseide verbunden waren. Mit der Zeit waren die Rangunterschiede zwischen den verschiedenen Fürsten des Reiches immer schärfer hervorgetreten, insbesondere weil sich das Reich in den Jahren nach 1480 einer Vielzahl von inneren wie äußeren Problemen hatte stellen müssen. Namentlich war es zu einer grundsätzlichen Trennung gekommen zwischen jenen Autoritäten, Fürsten und anderen, die dem Kaiser direkt unterstellt waren – die reichsunmittelbar waren –, und jenen mittelbaren Reichsständen, die einer dem Kaiser nachgeordneten Instanz unterstanden.
Die reichsunmittelbaren Landesherren waren im Besitz kaiserlicher Volllehen (Reichslehen), die ihnen der Kaiser in seiner Eigenschaft als ihr Lehnsherr verliehen hatte. Diese setzten sich in der Regel aus mehreren sogenannten Unter- oder Afterlehen zusammen, die ihrerseits von Lehnsleuten der reichsunmittelbaren Landesherren – mittelbaren Lehnsleuten des Kaisers also – gehalten wurden, oder aus Jurisdiktionen, die andere, dem kaiserlichen Lehnsnehmer untergebene Körperschaften innehatten. Auf diese Weise waren Städte, Dörfer und andere Gemeinschaften durch ein komplexes, juristisch und politisch definiertes Netz von Rechten, Privilegien und Machtbefugnissen miteinander verknüpft. Diese Rechte wiederum verliehen ihren Inhabern Anspruch darauf, von ihren Untergebenen respektiert und loyal unterstützt zu werden, sowohl materiell als auch mit Dienstleistungen. Der Grundherr eines Dorfes etwa, dem dort auch die (niedere) Gerichtsbarkeit zukam, durfte von dessen Bewohnern Folgsamkeit und Treue erwarten, dazu einen Anteil ihrer Ernte sowie – in einem bestimmten Umfang – auch ihrer Zeit und Arbeitskraft zur Erfüllung gewisser Aufgaben. Im Gegenzug erwartete man von ihm, dass er seine Untertanen gegen äußere Übel verteidigen, ihr Gemeinwesen als solches auch im weiteren Rahmen des Reiches beschützen sowie – im Innern – Streitigkeiten schlichten und ernstere Probleme lösen werde.
Die Bedeutung einer solchen Gemeinschaft als sozialer und politischer Raum ging damit einher, dass alle diese Rechte letztlich im Grund und Boden verwurzelt waren: Wem sie zukamen, der hielt auch die Macht über das dazugehörige Gebiet in Händen. Herrschaftstitel verschiedener Herkunft und Qualität schlossen sich dabei nicht zwangsläufig aus: Wer im Besitz eines reichsunmittelbaren, mithin vom Kaiser verliehenen Lehens war, konnte zugleich auch Lehnsnehmer eines anderen Adligen sein. Auch hatte der große Einfluss und Reichtum der Kirche ein Heer von geistlichen Herren hervorgebracht, die traditionell eine enge Verbindung zum Kaisertum pflegten und sich deshalb gemeinsam auch als „Reichskirche“ betrachteten. Die materielle Grundlage dieser Reichskirche bestand in den Siedlungen und Gütern, die ihr kraft kaiserlicher und anderer Lehen und Hoheitsrechte unterstellt waren. Allerdings waren diese territorialen Machtbefugnisse der Kirche keineswegs deckungsgleich mit ihrem geistlichen Machtbereich, der sich auch auf die Kirchsprengel in den Territorien weltlicher Herrscher erstreckte. Schließlich konnten sich mehrere Herren die Macht in ein und demselben Hoheitsbereich teilen oder innerhalb eines Geltungsbereiches je unterschiedliche Hoheitsrechte halten.
Die meisten der beschriebenen Rechte wurden durch Erbschaft erworben und innerhalb der 50 000 bis 60 000 Adelsfamilien des Reiches weitergegeben. Die überwiegende Mehrheit dieser Familien gehörte dem Landadel an, dessen niedere Gerichtsbarkeit der höheren Gerichtsbarkeit des (wesentlich exklusiveren) reichsunmittelbaren Adels unterstellt war. Insgesamt gab es auf der obersten Ebene der Lehnsordnung etwa 180 weltliche und 130 geistliche Lehen, die zusammen die Territorien des Reiches ausmachten. Ihre Größe variierte beträchtlich, wobei kein direkter Zusammenhang zwischen der Ausdehnung eines bestimmten Territoriums und seinem politischen Einfluss bestand. In der Entstehungszeit des Heiligen Römischen Reiches hatte sich dessen Bevölkerung vor allem im Süden und Westen des deutschen Sprachraums konzentriert. Die Bevölkerungsdichte in diesen Gebieten ermöglichte es, dort eine größere Anzahl von Grundherrschaften aufrechtzuerhalten als im dünner besiedelten Norden und Osten; die letztgenannten Regionen traten erst Anfang des 16. Jahrhunderts vollständig in den Geltungsbereich der Reichsverfassung ein.
Bis 1521 hatte die Konsolidierung der Reichsverfassung die weltlichen und geistlichen Herren in drei Gruppen gegliedert. Die kleinste, aber ranghöchste bildeten die sieben Kurfürsten, also jene sieben Reichsfürsten, deren Lehen in der Goldenen Bulle von 1356 mit dem exklusiven Recht verknüpft worden waren, den Kaiser zu „küren“. Die herrschende Gesellschaftsordnung räumte dem Klerus als „erstem Stand“ den Vorrang noch vor dem Adel ein – erfüllten doch die Kleriker durch ihr beständiges Gebet für das Seelenheil der ganzen Christenheit eine unentbehrliche gesellschaftliche Funktion. Der ranghöchste Kurfürst war deshalb der Erzbischof von Mainz, gefolgt von seinen Amtsbrüdern in Köln und Trier; keiner der drei herrschte über mehr als 100 000 Untertanen. Unter den weltlichen Kurfürsten stand der böhmische König an erster Stelle (Böhmen war das einzige Territorium des Reiches, das mit einer eigenen Königswürde verbunden war, siehe Kapitel 3). Das Königreich Böhmen war außerdem das größte Kurfürstentum; es erstreckte sich über 50 000 Quadratkilometer, und seine 1,4 Millionen Einwohner lebten in 102 Städten, 308 Marktgemeinden, 258 Burgen und Schlössern sowie 30 363 Dörfern und Weilern, die insgesamt 2033 Pfarrkirchen vorweisen konnten. Das zweitgrößte – wenn auch rangniedrigste – Kurfürstentum war Brandenburg mit 36 000 Quadratkilometern Fläche, aber nur 350 000 Einwohnern. Kursachsen war kleiner, mit rund 1,2 Millionen Einwohnern aber dichter bevölkert. Die Kurpfalz, rangmäßig an zweiter Stelle hinter den Ländern der böhmischen Krone platziert, erstreckte sich über insgesamt rund 11 000 Quadratkilometer mit etwa 600 000 Einwohnern, die sich auf zwei räumlich getrennte Territorien verteilten: die am Rhein gelegene Unter- oder Rheinpfalz sowie die nördlich des Herzogtums Bayern gelegene Oberpfalz. Zusammen herrschten die Kurfürsten über etwa ein Fünftel des Gebietes und rund ein Sechstel der Bewohner des Heiligen Römischen Reiches.
Die restlichen Reichslehen lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Zu der ersten gehörten 50 geistliche und 33 weltliche Lehen, deren Inhaber im Fürstenrang standen (wobei ihre konkreten Titel und Adelsprädikate vom Bischof und Erzbischof über den Herzog bis zum Landgrafen und Markgrafen reichten). Die Lehen der weltlichen Fürsten wurden formal durch Erbschaft oder Kauf erworben; in beiden Fällen war die Zustimmung des Kaisers nötig, um die Übertragung zu legitimieren. Die geistlichen Fürsten wurden von den Dom- oder Stiftskapiteln der jeweils bedeutendsten Kirche ihres Territoriums gewählt. Auch dabei musste, zumindest der Form nach, der Kaiser sowie in diesem Fall zusätzlich der Papst seine Zustimmung geben. Die Anzahl der Reichsfürsten lag stets unter der Gesamtzahl der Reichslehen, da sowohl die Kurfürsten zusätzliche Lehen an sich ziehen konnten als auch andere Reichsfürsten mehr als ein Reichslehen zur selben Zeit halten konnten; selbst Fürstbischöfe besetzten zuweilen mehr als einen Bischofsstuhl zugleich. Unter den Fürstendynastien des Reiches erwiesen sich die Habsburger als die Geschicktesten, was diese Art der Einflussmaximierung betraf: Schließlich herrschten sie nicht nur über ihre österreichischen Erblande, sondern auch über das Königreich Böhmen mit seinen Nebenländern sowie über ihre 17 niederländischen Provinzen – alles in allem über ein Territorium von 303 000 Quadratkilometern, was rund 40 Prozent der Gesamtfläche des Heiligen Römischen Reiches entspricht. Einschließlich der 1526 unter habsburgische Herrschaft gekommenen ungarischen Gebiete lag die Zahl der habsburgischen Untertanen um 1600 bei über sieben Millionen – gegenüber rund 17 Millionen Einwohnern im restlichen Reichsgebiet. Diese Hausmacht war es, die den Habsburgern zwischen 1438 und dem Ende des Alten Reiches 1806 im Ringen um den Kaiserthron eine beinah unangefochtene Monopolstellung sicherte. Den anderen Fürsten, von denen die wenigsten über mehr als 100 000 Untertanen geboten, waren die Habsburger haushoch überlegen.
Zur zweiten Klasse von Reichslehen, der etwa 220 Lehnsnehmer angehörten, zählten wesentlich kleinere Territorien, deren Inhaber nicht im Fürstenrang standen. Sie waren Grafen, Prälaten oder sonstige Herren; selten hatten sie mehr als ein paar Tausend Untertanen. Daneben gab es noch rund 400 niederadlige Familien – Ritter und Freiherren –, die als Reichsritterschaft zusammen 1500 weitere kaiserliche Lehen hielten. Jeweils für sich betrachtet, waren ihre Herrschaften auch nicht größer als die des – wesentlich zahlreicheren – landständischen Adels, dem der Distinktionsgewinn der Reichsunmittelbarkeit versagt geblieben war, und bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts spielte der reichsritterschaftliche Adel in der Politik des Reiches keine nennenswerte Rolle mehr.
Die Reichsstädte Die übergroße Mehrheit der Stadt- und Landgemeinden unterstand in der ein oder anderen Form fremder Jurisdiktion, doch eine Minderheit blieb von herrschaftlicher Lenkung und Kontrolle frei. An erster Stelle sind hier die etwa 80 „Freien und Reichsstädte“ zu nennen, die größtenteils in Schwaben und Franken lagen, den alten Kernlanden des Reiches im Süden und Westen. Zu ihnen zählten die meisten urbanen Zentren des Reiches, namentlich Augsburg, mit rund 48 000 Einwohnern größte Stadt des Reiches und etwa viermal so groß wie Berlin zur selben Zeit. Augsburg führte eine kleine Spitzengruppe aus Nürnberg, Hamburg, Köln, Lübeck und Straßburg an, die jeweils rund 40 000 Einwohner hatten. Es folgten Städte wie Frankfurt, Bremen, Ulm und Aachen mit jeweils rund 20 000 Einwohnern sowie eine wesentlich größere Anzahl von Reichsstädten wie Nordhausen, Heilbronn, Rothenburg oder Regensburg, deren Einwohnerzahl unter 10 000 lag. Die meisten zählten sogar weniger als 4000 Einwohner, obwohl manchen (wie etwa Schwäbisch Hall) eine stattliche Anzahl von Dörfern der Umgebung unterstand. Der Einfluss der Reichsstädte beruhte zum Teil auf ihrer unmittelbaren Beziehung zum Kaisertum, die sie vor der Eingliederung in die umgebenden Territorien bewahrte. Jeder, der im Jahr 1619 den Vogt des Dorfes Eriskirch am Bodensee aufsuchte, erblickte über dem Portal des Amtshauses das Emblem der Reichsstadt Buchhorn, des heutigen Friedrichshafen (das noch immer dasselbe Wappen führt). Das „redende“ buchhornische Wappen – eine Buche und ein Signalhorn – zeigte an, dass Eriskirch unter der Herrschaft der nahe gelegenen Reichsstadt stand, die das Dorf 1472 erworben hatte. Der prominent darüber platzierte Reichsadler symbolisierte die Loyalität der Buchhorner Bürgerschaft zu Kaiser und Reich, wobei der doppelköpfige Reichsadler für die Verbindung der Kaiserkrone mit dem römisch-deutschen Königtum stand. Rund um den Reichsadler war die Ordenskette des Ordens vom Goldenen Vlies zu sehen, eines 1429 zum Schutz und zur Verteidigung der Kirche gestifteten, ursprünglich burgundischen Ritterordens. Die Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies war die höchste Auszeichnung, die die Habsburger zu vergeben hatten; sie unterstrich den Anspruch ihrer Familie auf die traditionelle Rolle des Kaisers als Hüter der Christenheit. Auf der Brust des Adlers verwies der Bindenschild in den rot-weiß-roten Farben Österreichs noch einmal auf die Habsburger, auf deren Anspruch auf die Kaiserkrone und die Zugehörigkeit der Stadt Buchhorn zu dem habsburgisch regierten Reich.17
Die Reichsverfassung Der Kaiser und seine Vasallen teilten sich die Lenkung des Reiches, doch angesichts des hierarchischen Charakters der Reichsverfassung konnten die damit verbundenen Rechte und Pflichten nur ungleich verteilt sein. Der Kaiser war oberster Lehnsherr und Souverän; er verfügte über eine beträchtliche Anzahl von Hoheitsrechten, die sich nicht von seiner Herrschaft über bestimmte Territorien herleiteten, sondern direkt mit der Kaiserkrone verbunden waren. Unter diesen stachen die sogenannten Reservatrechte hervor, die der Kaiser ohne Mitwirkung oder Zustimmung des Reichstages ausüben durfte. Der genaue Umfang der kaiserlichen Vorrechte blieb absichtlich vage – schließlich hätte eine rechtliche Festlegung den misslichen Eindruck erweckt, dem universalen Herrschaftsanspruch des Kaisers seien irgendwelche Grenzen gesetzt. Allerdings sahen sich der Kaiser und die reichsunmittelbaren Fürsten gezwungen, zur besseren Bewältigung dringlicher Aufgaben die Einzelheiten ihrer Lehnsbeziehung genauer zu bestimmen. Hierdurch entstanden zusätzliche Autoritäten auf diversen niederen Ebenen der Reichshierarchie, die zwischen dem Kaiser und den einzelnen Bestandteilen seines Reiches vermittelten. Wenn mit der Kaiserkrone auch ein habsburgisches Quasi-Monopol verbunden schien, so musste die Betonung doch auf dem „Quasi-“ liegen: Einen tatsächlichen Rechtsanspruch auf den Thron besaßen die Habsburger nicht. Stattdessen mussten sie vor jeder Kaiserwahl mit den Kurfürsten verhandeln, um die Bestätigung des jeweils nächsten habsburgischen Thronanwärters sicherzustellen. Man konnte die Kurfürsten nämlich dazu bewegen, einen bereits vorab designierten Kaiser anzuerkennen, der als „erwählter römischer König“ bezeichnet wurde und der nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft übernehmen würde. Andernfalls war ein Interregnum vorgesehen, dessen Einzelheiten die Goldene Bulle regelte: Die kaiserlichen Vorrechte würden in einem solchen Fall vom sächsischen (im Norden) beziehungsweise dem pfälzischen Kurfürsten (im Süden) ausgeübt, bis sich die sieben Kurfürsten innerhalb einer bestimmten Frist – die die Goldene Bulle ebenfalls festlegte – versammelt haben würden, um unter dem Vorsitz des Mainzer Kurfürsten (in seiner Eigenschaft als Reichserzkanzler) einen neuen Kaiser zu wählen. Hierfür konnte freilich nicht jeder Beliebige kandidieren; das Kaiseramt war schließlich keine repräsentative Staatspräsidentschaft auf Lebenszeit, sondern die Würde eines souveränen Monarchen. Gewisse „monarchische Qualitäten“ (nicht zuletzt der Abstammung) musste man also, dem Verständnis der Zeit entsprechend, schon mitbringen.
Das Anwachsen seiner Macht und Güter prädestinierte das Haus Habsburg geradezu, einen Kaiser nach dem anderen zu stellen – schließlich autorisierten die kaiserlichen Prärogativen ihren Träger zwar, weitreichende Exekutiventscheidungen zu fällen, gaben ihm aber nur spärliche Mittel an die Hand, diese auch durchzusetzen. Die Kurfürsten erwarteten deshalb vom Kaiser, dass dieser nicht nur zur Finanzierung des kaiserlichen Hofes und diverser Reichsinstitutionen seinen eigenen Besitz aufwenden, sondern auch bei der Verteidigung des Reiches gegen die Osmanen und andere, christliche Feinde einen Großteil der Kosten tragen würde. Allerdings erkannten die Kurfürsten, dass Veränderungen in der Kriegführung dies zunehmend unmöglich machten, wenn nicht auch der Rest des Reiches sein Scherflein beitrug. Die Reichsfürsten und -städte sahen dies ebenfalls ein, und die Bereitschaft, Reichssteuern zu zahlen, wurde zur entscheidenden Voraussetzung der Reichsunmittelbarkeit: Wer Reichssteuern zahlte, war anders als die große Mehrheit der Grundherren und Städte, die lediglich in die Staatskassen der ihnen übergeordneten Territorien einzahlten. Zahlungen in die Reichskasse waren als „Römermonate“ bekannt – nach den Kosten der Eskorte, die Karl V. zu seiner Krönung nach Rom geleiten sollte. Ein jedes Territorium wurde nach einem Schlüssel veranlagt, durch den sein spezifischer Zahlungsanteil am Monatssold von 24 000 Soldaten festgelegt wurde. Abgaben wurden entweder als Bruchteile oder als Vielfaches dieses Basistarifs erhoben; eingetrieben wurden sie entweder als Einmalzahlungen oder in Raten über mehrere Monate, manchmal sogar Jahre.
Bis 1521 war die Einschreibung in das Reichssteuerregister zum entscheidenden Faktor dafür geworden, ob ein bestimmtes Territorium auf den Reichstagen vertreten war oder nicht, mithin ob es als Reichsstand anerkannt wurde oder nicht. Der Reichstag war kein Parlament im heutigen Sinne, sondern verkörperte das frühneuzeitliche Repräsentationsprinzip: Sobald es um Angelegenheiten ging, die alle betrafen, war der Monarch verpflichtet, sich mit den „edelsten“ seiner Untertanen – dem Adel – darüber zu beraten. Entsprechend der hierarchischen Gesamtstruktur des Reiches fanden die Beratungen des Reichstages in drei gesonderten Kollegien (oder Kurien) statt: Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädte blieben in ihren Kurien jeweils unter sich. Insbesondere die Zusammensetzung des Reichsfürstenrates befand sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch im Wandel; die bestehenden Mitglieder des auch als Fürstenbank bekannten Gremiums, die über jeweils eine Virilstimme verfügten, zögerten, den wesentlich zahlreicheren Grafen und Prälaten, die sich bislang eine Handvoll Stimmen (die sogenannten Kuriatstimmen) geteilt hatten, einen gleichberechtigten Platz in ihren Reihen zu gewähren. Die Initiative im Reichstag lag beim Kaiser, der die Themen der Beratung vorschlug. Im Anschluss an diese fällten die einzelnen Kurien einen Mehrheitsentscheid, wobei der Reihe nach jeder Stimmberechtigte seine Meinung zum Gegenstand kundtat (oder durch einen bevollmächtigten Vertreter mitteilen ließ); es galt eine strenge Rangfolge. Anschließend berieten sich jeweils zwei Kollegien miteinander: In der Regel sprachen die Kurfürsten zuerst mit dem Reichsfürstenrat, bevor sie sich den Vertretern der Reichsstädte zuwandten. Wenn dann schließlich – in einem nicht selten langwierigen Prozess – ein für alle Seiten akzeptabler Kompromiss formuliert worden war, wurde dieser gemeinsame Beschluss aller drei Kurien als „Empfehlung“ dem Kaiser vorgelegt – und in der Tat konnte dieser frei entscheiden, ob er seine Zustimmung erteilte oder nicht. Stimmte er zu, so wurde der betreffende Entschluss als „Reichsschluss“ in den bei Ende des Reichstages erlassenen „Reichsabschied“ aufgenommen und erlangte so bindende Wirkung. Als Reaktion auf neu entstandene Probleme hatte sich das System der Reichstage nach 1480 verhältnismäßig rasch herausgebildet, und seine Gesetzgebung schuf Präzedenzfälle, die dann in die Reichsverfassung aufgenommen wurden. Wenngleich der Kaiser formal nicht verpflichtet war, den Reichstag zu konsultieren, so wurden die Reichsabschiede mit der Zeit doch zur einzigen Möglichkeit für ihn, reichsweit verbindliche Abmachungen zu treffen; außerdem erlaubten es die Reichstagsberatungen dem Kaiser, sich ein Bild von der Meinungs- und Stimmungslage unter den Reichsständen zu machen, und verliehen seinen Entscheidungen größere Legitimität. Obwohl der Reichstag eine so schwerfällige Institution war, beriefen die Kaiser des 16. Jahrhunderts doch mit einiger Regelmäßigkeit Reichstage ein, die ein insgesamt beträchtliches Korpus von Gesetzen verabschiedeten sowie – wegen der kostspieligen Verteidigung gegen die Osmanen – immer regelmäßigere Steuerzahlungen bewilligten (siehe Kapitel 4).