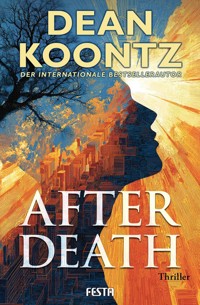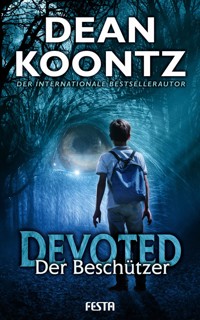5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Joanna Chase wuchs auf einer Ranch in Montana auf, bis eine Tragödie ihr Leben auf den Kopf stellte. Jetzt ist sie 34, lebt in Santa Fe und hat nur noch undeutliche Erinnerungen an die Vergangenheit … Bis sie per Telefon, über ihren Fernseher und in ihren Träumen seltsame Bitten erhält: Ich bin an einem dunklen Ort, Jojo. Bitte komm und hilf mir. Joanna muss nach Montana zurückkehren. Doch sie ist nicht die Einzige, die gerufen wird. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten finden sich auf der abgelegenen Ranch ein. Ihre Leben sind miteinander verwoben durch den herannahenden Schrecken, dem Joanna bereits als Kind begegnet ist. Währenddessen lauert in der Nähe der Ranch ein Verrückter mit einer Vision zur Rettung der Zukunft … Kirkus Reviews: »Nonstop-Action mit kosmischen Untertönen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Big Dark Sky
erschien 2022 im Verlag Thomas & Mercer.
Copyright © 2022 by The Koontz Living Trust
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: didiwahyudi.trend/99design
Lektorat: Joern Rauser
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-147-9
www.Festa-Verlag.de
Wo die Liebe herrscht, da gibt es keinen Machtwillen, und wo die Macht den Vorrang hat, da fehlt die Liebe. Das eine ist der Schatten des anderen.
Carl Gustav Jung
TEIL 1
RUSTLING WILLOWS
Unglaubliche Zufälle ohne erkennbaren Grund nennt man Synchronizitäten. Vielleicht wäre es besser, sie den Stoff des Lebens zu nennen.
Ganesh Patel
1
24 Jahre früher
In jedem Leben gibt es seltsame Zufälle, solche Ereignisse, die uns unerklärlich sind, und sogar Momente, die übernatürlich erscheinen. Bei dieser Begebenheit in der einsamen Weite Montanas, als die Himmel mondlos waren, sich das blinde Gesicht der Nacht gegen die Fenster presste und das einzige Licht im Zimmer aus dem Fernseher strömte, saß ein junges Mädchen im Einklang mit den Toten da.
Die neunjährige Joanna Chase, von allen nur Jojo genannt, war ein glückliches Kind, dem aller Kummer fremd war – bis vor zwölf Tagen, als ihre Mutter Emelia starb. Sie waren mehr als Mutter und Kind gewesen. Emelia hatte Jojo das Lesen und Träumen beigebracht. Zusammen lebten sie viele Leben in Büchern nach, in denen sich Fantasien wie Ranken verflochten. Jojos Überschwang war eine Inspiration für Emelia, die sich allen anderen gegenüber zurückhaltender gab.
Allein im Wohnzimmer um zwei Uhr in der Nacht saß Jojo zusammengekauert in einem Sessel, in ihren Pyjama gekleidet und in eine bunte Pendleton-Decke eingewickelt, und sah sich auf dem Fernsehbildschirm Familienvideos an, so wie es in den letzten sieben Tagen zu ihrer nachmitternächtlichen Gewohnheit geworden war. Jojo brauchte dieses Abtauchen in die Vergangenheit, denn sie erwachte regelmäßig aus hässlichen Träumen, voller Sehnsucht nach dem wunderschönen Gesicht, Geist und Herzen ihrer Mutter.
Tränen flossen und versiegten und strömten dann doch wieder. Während der ersten fünf Nächte dieser Chase-Familienvideos waren Jojos Tränen bitter gewesen und ihr Elend allumfassend. Dieses Mal jedoch, ebenso wie in der Nacht zuvor, gab es Momente, in denen sie lächelte und Freudentränen vergoss, sobald etwas, das ihre Mutter sagte oder tat, sie an einen kostbaren Augenblick erinnerte, der niemals vergessen werden durfte.
Genau genommen war dies auch der Grund, warum sie sich diesen Videos überhaupt aussetzte. Sie hoffte, dass der Schmerz, den sie auslösten, ihren Kummer irgendwann erschöpfen und wie eine Art Impfung gegen die endlose Qual wirken würde. Vielleicht wäre sie dann gegen die Tränen geschützt und würde immer nur lächeln, wenn sie an ihre Mom dachte. Sie würde es nicht ertragen können, den Rest ihres Lebens von dieser tiefen Trauer niedergedrückt zu werden.
Unter den Momenten, die sie zum Lächeln brachten, war auch eine Szene, die erst vor ein paar Monaten aufgenommen worden war. Mit der Kamera in der Hand befragte Jojo ihre Mutter, die in einem Schaukelstuhl auf der Veranda saß und ein Buch las.
»Warum liest du so viel?«, fragt Jojo.
»Zum einen, weil es meinen Verstand schärft.«
»Ist dein Verstand schon sehr scharf?«
»Wie eine Rasierklinge.«
»Gibt es noch einen Grund?«
»Ich lese, um unterhalten zu werden.«
»Gibt es noch einen Grund?«
Schließlich blickt ihre Mutter von dem Buch auf und lächelt und sagt: »Ich lese, damit ich nicht traurig bin.«
»Du bist doch niemals traurig. Oder bist du traurig? Warum bist du traurig?«
»Manchmal bin ich traurig, wenn ich daran denke, dass du erwachsen wirst und heiratest und von der Ranch wegziehst und ich ohne meine Jojo sein muss.«
»Tja, das wird aber nie passieren. Ich brauch keinen blöden Jungen, solange ich Pferde habe.«
»Vielleicht findest du einen Jungen, der Pferde mag.«
»So wie Daddy.«
»Genau.«
Die Kamera macht einen Dreiviertelkreis um den Schaukelstuhl, und der Kopf ihrer Mutter bewegt sich mit ihr, während Jojo sagt: »Und wenn ich doch mit irgendeinem blöden Jungen weggehe, was würdest du am meisten vermissen?«
»Die Art, wie du mich piesackst, wenn ich zu lesen versuche.«
»Oh, sehr komisch. Wenn ich bis ins Mark böse wäre, würde ich dir meine Zunge rausstrecken.«
»Nur meine Jojo würde glauben, dass solch ein Verhalten bis ins Markböse ist.«
Mutter legt das Buch auf einem Tisch ab und lehnt sich in ihrem Schaukelstuhl vor. »Gib mir die Kamera. Ich habe eine Frage an dich.«
Jojo reicht die Kamera hinüber, und dann erscheint ihr Gesicht im Vollbild, als ihre Mutter fragt: »Versprichst du mir etwas?«
»Was denn versprechen?«
»Dass du dich niemals änderst.«
»Warum sollte ich mich ändern?«
»So etwas passiert den Menschen.«
»Hast du dich verändert, als du erwachsen geworden bist?«
»Vollkommen. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich nur einen Hund haben. Als ich erwachsen wurde, wollte ich eine Tochter.«
Jojo sagt: »Hunde sind toll, aber Töchter sind noch besser.«
»Vielleicht. Aber das sehen Hunde anders, und Hunde lügen nicht.«
»Krass! Das tat weh. Kann es sein, dass meine eigene Mutter bis ins Mark böse ist?«
Mutter zwinkert.
In die Pendleton-Decke eingewickelt und durch ihre Tränen lächelnd, spulte die mutterlose Jojo das Video zurück und sah sich den Ausschnitt noch einmal an. Als sie erneut zurückspulte, um ihn sich ein drittes Mal anzusehen, lief alles so ab wie zuvor, bis Mutter, die Kamera haltend, ihre Tochter fragte, ob sie ihr etwas versprechen würde. Und Jojo erwiderte: »Was denn versprechen?«
Das Video fror während einer Nahaufnahme von Jojo ein.
Obwohl das Bild stehen blieb, lief der Ton weiter, doch das Gespräch zwischen den beiden war verschwunden. Stattdessen sagte die unverkennbare Stimme ihrer Mutter: »Du wirst bald fortgehen, Jojo, und irgendwo anders aufwachsen. Vielleicht werde ich mich in vielen Jahren an dich wenden und dich bitten, nach Hause zu kommen.«
Wie elektrisiert rutschte Jojo in ihrem Sessel nach vorn und die Decke glitt von ihren Schultern.
Mutter sagte: »Vor dir ist es hier schrecklich einsam gewesen und ich hatte kaum Hoffnung. So unglaublich lange hatte ich kaum Hoffnung.«
Jojo erhob sich. Die Decke fiel um ihre Füße. »Mommy?«
»Eines Tages werde ich vielleicht weit genug sein, um zu tun, wofür ich geboren wurde«, sagte Mutter. »Und dann brauche ich dich womöglich an meiner Seite.«
Jojo zitterte unkontrolliert. Ihre Mutter war tot und vergangen, und doch war sie irgendwie auch hier. Ihre Mom würde ihr niemals wehtun. In den gerade gesprochenen Worten lag keine Bedrohung, trotzdem zitterte Jojo genauso sehr vor Furcht wie vor Staunen. Eine seltsam belebende Angst hatte sie gepackt.
Das eingefrorene Videobild taute auf. Auf dem Bildschirm sagte Jojo: »Was denn versprechen?« Ihre Mutter sagte: »Dass du dich niemals änderst«, und dann fuhr die Aufnahme fort, so wie sie es die ersten beiden Male getan hatte, als das Mädchen sie sich ansah.
Mit der Fernbedienung spulte sie zurück, drückte dann die Play-Taste und sah zu und wartete. Doch wenn beim dritten Mal, als sie sich die Szene angesehen hatte, irgendein Spuk geschehen und eine Nachricht von der anderen Seite zu ihr durchgedrungen war, wiederholte sie sich nicht während der vierten Betrachtung. Oder während der fünften oder sechsten.
Jojo wusste, dass es wirklich geschehen war. Sie hatte es sich nicht nur eingebildet, weil ihr Schlaf fehlte oder weil der Kummer sie in den Wahnsinn getrieben hatte. Sie würde niemandem davon erzählen, als wäre die Erscheinung zu heilig, um sie mit irgendjemandem zu teilen.
Du wirst bald fortgehen, Jojo, und irgendwo anders aufwachsen.
Vier Tage später wurde sie nach Santa Fe gebracht, um bei ihrer Tante Katherine, der Schwester ihrer Mutter, zu leben.
Vielleicht werde ich mich in vielen Jahren an dich wenden und dich bitten, nach Hause zu kommen.
Die Jahre vergingen, und die Lebhaftigkeit dieses Zwischenfalls in einer mondlosen Nacht in Montana verblasste unweigerlich. Sie vergaß ihn zwar nicht völlig, doch schließlich kam sie zu der Überzeugung, dass das, was geschehen war, nicht das war, was es damals zu sein schien, und dass es sich um ein Hirngespinst handeln musste, ausgelöst von verzweifelter Trauer. Sie hatte schon immer eine blühende Fantasie gehabt.
Eines Tages bin ich vielleicht so weit, das zu tun, wofür ich geboren wurde. Und dann brauche ich dich womöglich an meiner Seite.
Das ergab doch keinen Sinn. Ihre Mutter war zweimal geboren worden, einmal in die Welt der Lebenden hinein und einmal in die Welt der Toten, und aus der würde sie nie zurückkehren und niemals einen Grund haben, ihre Tochter an ihre Seite zu rufen.
Und so vergingen die Jahre, und die Jahre vergingen …
2
Schließlich sollte Joanna Chase erkennen, dass der Wahnsinn an einem Montagabend, dem 13. Tag im Juli, begonnen hatte.
Während sie das Dinner zubereitete – Palmherzensalat, Butternudeln mit Pinienkernen und Erbsen –, glaubte sie zu hören, wie ihr Wagen ansprang und der Motor aufheulte.
Weil sie in einer sicheren Gegend in einer friedlichen Stadt lebte, unabhängig war und nicht anfällig für Paranoia, und weil ihre Alarmanlage gerade im Haus-Modus lief, machte sie sich keine Sorgen, dass irgendjemand in ihre Garage eingebrochen sein könnte, um das Fahrzeug zu stehlen. Außerdem hingen beide elektronischen Schlüssel an der Werkzeugwand in der Waschküche, und der Wagen würde sich ausschließlich für jemanden öffnen, der einen dieser Schlüssel bei sich trug.
Eher verwundert als besorgt – und schon gar nicht ängstlich – schritt Joanna durch die Waschküche und öffnete die Tür zur Garage. Ihr schwarzer Lincoln Continental lief im Leerlauf, die Abblendlichter leuchteten hell und die Frontscheinwerfer strahlten auf die Wandregale. Niemand saß in dem Wagen.
Hinter dem Sedan stand ihr SUV, ein weißer Lincoln Aviator, so still und düster, wie er sein sollte.
Vorher hatte sie einen Lexus gehabt, bei dem es immer wieder zu Problemen mit der Elektrik gekommen war. Ihre Lincolns hingegen waren erstklassige Maschinen, die ihr nie Schwierigkeiten machten – wenigstens bis jetzt nicht.
»Was zum Teufel?«, sagte sie.
Sie lief hinter dem Continental entlang zur linken Seite, öffnete die Vordertür und schlüpfte auf den Fahrersitz. Das Navigationsgerät hatte eine Karte geladen. Auf dem Bildschirm forderten ein orangefarbenes Viereck und das Wort START sie zu einer Berührung auf, als wäre eine Adresse in das Navi eingegeben worden.
Sie reagierte zwar nicht auf diese Anweisung, doch die ruhige weibliche Stimme des Wagens riet ihr trotzdem, sich an die Verkehrsregeln zu halten und alle verbalen Anweisungen zu befolgen, bis sie ihr Ziel erreicht hatte.
»Mein Ziel ist mein Dinner, Schätzchen, und dahin kann ich laufen«, sagte sie und drückte den Startknopf.
Der Motor verstummte, und der Bildschirm wurde schwarz, nachdem sich der Wagen mit seinem voreingestellten Abschaltvideo verabschiedet hatte.
Sie stieg aus und lief zu der Verbindungstür zwischen der Garage und dem Haus zurück. Dort blieb sie stehen und warf einen Blick zurück, bis die Lampen erloschen waren. Sie wartete noch ungefähr eine Minute, in der sie fürchtete, dass sich der Continental den Lexus-Virus eingefangen hatte und sie verspotten würde, indem er wieder ansprang.
Als der Sedan jedoch still und düster blieb, kehrte sie in die Küche zurück, wo sie sich eine gute Flasche Cabernet öffnete. Sie gönnte sich nicht an jedem Abend Wein, doch der Gedanke, dass sie sich noch so eine Gurke auf vier Rädern zugelegt hatte, ließen ein oder zwei Gläser notwendig erscheinen. Vielleicht auch drei.
Während sie aß, lauschte sie Rubinstein, der Mozart spielte, und las in den Erzählungen aus Kolyma von Warlam Schalamow. Er hatte 17 Jahre damit zubringen müssen, in einem sowjetischen Todeslager im tiefsten Sibirien ganz allmählich zu verhungern, nur um dann, als er 1951 doch entlassen wurde, noch einmal 30 Jahre unter dem Stiefel des Kommunismus zu leben. Die Musik füllte ihr Herz mit Freude, und die Geschichten erfüllten sie mit Dankbarkeit für das Essen, das vor ihr stand.
In den meisten Nächten schlief sie gut, und an diesem Abend zog der Wein sie in einen Schlummer, der tiefer war als üblich. Sie war zwar nicht bei eingeschaltetem Fernseher eingeschlafen, doch als sie um zwei Uhr nachts die Augen öffnete, strahlte das graue Licht eines toten und stummen Senders vom Bildschirm. Sie tastete nach der Fernbedienung und schaltete den Apparat aus. Schlaftrunken und nicht einmal halb wach konnte sie nicht so recht ausmachen, ob der ferne Klang eines dröhnenden Motors echt war oder nur Teil eines nachklingenden Traums. Sie döste wieder ein, bevor die Neugier sie anspornen konnte, die Decke beiseitezuwerfen und aus dem Bett zu steigen.
3
Manchmal bot der Sonnenaufgang in Santa Fe, New Mexico, einen pfauenblauen Himmel, der das Herz für Wunder öffnete, selbst wenn der Tag einen Termin für eine Wurzelbehandlung bereithielt oder, wie in Joannas Fall, die Aussicht auf eine Diagnose ihres Automechanikers, die fast genauso beunruhigend wie die schlechten Nachrichten von einem Onkologen war. Sie stand in der Morgendämmerung dieses Dienstags in dem kleinen, ummauerten Hof ihres Hauses und trank Kaffee, während sie zusah, wie der neue Tag sein buntes Gefieder über dem Osthimmel ausbreitete.
Um acht Uhr brachte sie den Continental in die Werkstatt des Lincoln-Händlers, wo man ihr einen Leihwagen gab. Den Vormittag verbrachte sie mit Besorgungen, doch um halb zwölf fuhr sie nach Hause zurück.
Sie aß ihr Mittagessen – ein Truthahn-Sandwich – an dem Schreibtisch in ihrem Arbeitszimmer, während sie an ihrem neuesten Roman arbeitete. Die Geschichte handelte von einem grausamen Verbrechen, und sie war fest entschlossen, so wie immer, die Kriminellen nicht zu verherrlichen oder zu romantisieren, was, so fand sie, in vielen zeitgenössischen Romanen und Filmen ein großes Problem war. Die Geschichten von Warlam Schalamow, die sie gerade las, handelten oft von Gangstern, die die sowjetischen Gulags leiteten, und beschrieben sie mit einer Wut und Schärfe, die so bitter wie die Wahrheit selbst waren. Das half ihr, ehrlich zu bleiben.
Am Mittwochmorgen rief der Werkstattleiter des Autohändlers an, um ihr zu sagen, dass sie keinen Fehler an ihrem Continental finden konnten. Sie brachte den Leihwagen zurück und nahm ihren Sedan mit. Während der kurzen Fahrt nach Hause machte das Navigationsgerät keine Anstalten, ungebetene Richtungsanweisungen von sich zu geben.
In dieser Nacht bemerkte Joanna nicht, ob der Wagen in der Garage spontan ansprang, denn auch ohne Wein war sie in einen tiefen Schlaf gesunken. Irgendwann, während der Mittwoch mit dem Donnerstag verschmolz, begannen die seltsamen Träume. Vielleicht öffnete sie die Augen und sah das blassgraue Licht, das aus dem Fernsehbildschirm strömte, oder vielleicht war das doch nur ein Teil des Traums. Nur ein Teil des Traums. Ja, entspann dich, Jojo, es ist nur ein Teil des Traums.
4
Harley Spondollar hätte einen gewaltsamen Tod erlitten, wäre er nicht am Donnerstag nachts um 1:10 Uhr nach draußen gegangen, um über den Gartenzaun zu klettern und auf die preisgekrönten Rosen seiner Nachbarin zu urinieren. Er hatte die Rosen schon seit fünf Wochen jede Nacht mit seinem Blasenwasser versorgt, und endlich zeigte all die Harnsäure ihre erwünschte Wirkung: Die Blätter wurden fleckig, die Zahl der Rosen schrumpfte und die Blumen warfen ihre Blüten ab, noch bevor die Knospen sich so richtig geöffnet hatten.
Spondollar hatte nichts gegen Rosen. Sein Hass galt einzig und allein Viola Redfern, die nebenan wohnte. Sie war 70 Jahre alt, vielleicht auch 90 – wer zum Teufel wusste das schon? Spondollar war sich sicher, dass das alte Miststück niemals sterben würde. Unermüdlich versorgte sie ihre Nachbarn mit selbst gebackenen Keksen und Kuchen, mit Rosen aus ihrem Garten und mit Pullovern, die sie strickte. Als Spondollar krank war, brachte sie ihm einen Topf mit hausgemachter Suppe. Sie beschwerte sich nie, wenn er seine Musik in voller Lautstärke hörte oder draußen auf seiner Veranda hockte und alles – von Eichhörnchen bis zu vorübergehenden Kindern – aus Leibeskräften beschimpfte. Sie hatte scharenweise Enkel und Urenkel, die sie ständig besuchten und so höflich und leise und artig waren, dass Spondollar sich am liebsten übergeben hätte.
Am Mittwochabend und früh in der Nacht zum Donnerstag hatte sich Spondollar besonders viel Mühe gegeben, so viel Bier zu trinken, dass er imstande sein würde, den kostbaren Rosen seiner Nachbarin den Todesstoß zu versetzen. Viola war so langweilig und berechenbar wie jede andere alte Schachtel. Jeden Abend ging sie um Punkt neun Uhr ins Bett und sank unter der Last ihrer Falten und Hautlappen in den Schlaf, während sie in einem Buch las. Heute jedoch blieb sie über Nacht bei einer Enkelin, um den zehnten Geburtstag einer Urenkelin zu feiern.
Eine von Harley Spondollars größten Freuden im Leben war es, andere Leute zur Weißglut zu bringen und dann so lange psychologische Spielchen mit ihnen zu spielen, bis sie ihre Ungeduld und Empörung dermaßen bedauerten, dass sie sich schließlich dafür entschuldigten, sich gegen seine Rüpelhaftigkeit aufgelehnt zu haben. Viola ließ sich nicht zur Weißglut bringen. Sie schien Beleidigungen gar nicht wahrzunehmen und verfügte über einen schier unendlichen Vorrat an Geduld. Neben jemandem wie ihr zu wohnen war kein Spaß.
Und so stand er in der zweiten Stunde dieses Donnerstags in ihrem Garten, das Gesicht auf sein eigenes Haus gerichtet, und bedachte ihre Rosen in dieser milden Sommernacht an der Küste Oregons mit dem kräftigsten Strahl, den er aufbringen konnte, als sich die Luft plötzlich mit einem elektronischen Brummen füllte, das sich wie die Rückkopplung eines riesigen Verstärkers anhörte. Zuerst war das Geräusch ohne erkennbare Quelle das einzige Vorkommnis. Ein knisterndes Rauschen erhob sich, als würde man ein 100 Meter langes Stück Zellophanfolie zu einem Ball zusammenknautschen, und wurde lauter als das Brummen. Die Lichter erloschen. Dann implodierte sein Haus. Die Veranda und die Mauern und das Dach fielen wie eine nasse Sandburg am Strand in sich zusammen und stürzten mit einer Wucht ein, als befände sich in der Mitte des Gebäudes ein schwarzes Loch, das das Haus wie ein Staubsauger in ein anderes Universum beförderte. Zuerst hörte das Rauschen auf, dann das Brummen. Vielleicht 15 Sekunden nachdem die ganze Sache angefangen hatte, war sie schon wieder zu einem Ende gekommen. Dort, wo sein Haus gestanden hatte, lag nur noch ein Hügel aus Trümmern, der in seiner Form, wenn auch nicht in seiner Größe, einem riesigen Ameisenhaufen ähnelte.
Harley Spondollars Reaktion auf jeden Rückschlag in seinem Leben – und auch auf jede positive Entwicklung – war es, bis zur Erschöpfung zu fluchen, doch in diesem Fall ließen ihn alle Obszönitäten und Gotteslästerungen im Stich. Wie vor den Kopf geschlagen hörte er auf, die Rosen zu bewässern, packte sein bestes Stück ein und fand sich, ohne auch nur einen einzigen bewussten Schritt gemacht zu haben, durch die Ruine seines Hauses watend wieder.
Zuerst verdrängte die Fassungslosigkeit jeden Anflug von Angst. Er sank auf die Knie und hob eine Handvoll von dem auf, was von seinem Haus übrig geblieben war. Perlen. Perlen in verschiedenen Größen. Einige waren so klein wie Luftgewehrkugeln, andere so groß wie Erbsen, ein paar wie Trauben. Die meisten waren glatt. Im Licht des Mondes konnte er sie nicht allzu gut sehen. Ein paar fühlten sich wie Holz an, andere zerbröselten wie Gips und noch wieder andere waren hart wie Metall. Er bemerkte, dass in den Trümmern keine Hitze war, wie man es vielleicht vermuten würde, ja nicht einmal Staub. Wie gebannt von der Seltsamkeit der ganzen Situation grub er sich mit beiden Händen in den gewaltigen Haufen, um nach einem Nagel oder einer Schraube oder vielleicht nach einer Türangel zu suchen, nach irgendetwas, das er als einen Teil des Hauses wiedererkennen würde. Er grub schneller, mit noch mehr Nachdruck, und suchte nach einem Gegenstand, ganz gleich was es sein mochte, der früher einmal in dem Haus gewesen war: eine Schüssel, ein Löffel, eine DVD aus seiner Pornosammlung.
Plötzlich schlug ihm ein neues, erschreckendes Geräusch entgegen, und er sprang auf die Füße, drehte sich um und ließ seinen Blick über die Straße schweifen. Doch dann bemerkte er, dass das, was er hörte, nur sein eigener, verzweifelt stockender Atem war. Die Fassungslosigkeit machte der Angst und dem Unverständnis Platz. Er war völlig entsetzt, sein Bezug zur Realität bröckelte. Er stand dem Unbekannten gegenüber, etwas Geheimnisvollem, etwas Finsterem. Er hatte kein Interesse an dem Unbekannten, keinerlei Neugier, die ihn antrieb. Zur Hölle mit dem Unbekannten. Er wollte sein Haus zurück. Er wollte alles so haben, wie es den ganzen Abend lang gewesen war: Slasherfilme gucken, Bier trinken, auf Rosen pissen.
Als er dabei gewesen war, Violas Rosengarten zu vernichten, hatten in einigen der Häuser entlang der Straße noch die Lichter gebrannt. Jetzt schienen doppelt so viele Nachbarn wach zu sein. Vielleicht hatten das laute Brummen und das Rascheln sie aus den Betten getrieben. Er sah Gesichter an den Fenstern. Leute sahen zu ihm herüber und wunderten sich. Auch im Dunkeln würden sie erkennen können, dass sein Haus verschwunden war, und sie würden ihn bestimmt allein im Mondlicht stehen sehen. Und doch kam keiner von ihnen nach draußen, um nachzusehen, was geschehen war. Wäre er jemand anderes als Harley Spondollar gewesen, dann wären sie vielleicht mit Erste-Hilfe-Kästen und Mitgefühl herübergekommen, hätten Tische auf seinem Rasen aufgestellt und Schmorgerichte und Gebäck für ein zeitiges Zusammen-schaffen-wir-das-Frühstück bereitgestellt. Aber er war, wer er eben war, und so blieben sie in ihren Häusern. Das war Spondollar nur recht. Er konnte sie nicht ausstehen, alle miteinander. Unter ihnen war keiner, den er zu sich nach Hause einladen würde, wenn er noch ein Zuhause gehabt hätte.
Mit dem schneidenden Geheul der herannahenden Sirenen kehrte ein dringend benötigtes Gefühl der Realität in die Nacht zurück. Ein Feuerwehrwagen bog um die Kurve, obwohl gar kein Feuer wütete, das bekämpft werden musste. Ihm folgte ein Krankenwagen mit blinkenden Blaulichtern, obwohl niemand verletzt worden war. Den Rettungssanitätern dicht auf den Fersen waren drei Polizeiautos. Spondollar konnte Cops nicht ausstehen. Für ihn waren sie nicht mehr als die Vollstrecker eines tyrannischen Systems.
Keiner dieser Ersthelfer hatte je zuvor ein Haus gesehen, das zu einem Haufen aus kleinen Perlen zusammengeschrumpft war. Auch wenn sie vor einem Rätsel standen, fragten sie sich schnell, ob Spondollar sein Haus selbst zerstört hatte. Doch augenscheinlich war er das Opfer hier, nicht der Bösewicht, wenigstens nicht in diesem Fall, aber die Cops begannen schnell, seine Aussage anzuzweifeln, als er berichtete, dass er nach draußen gegangen war, um den Anblick der Sterne zu genießen, kurz bevor das mit dem Haus geschehen war. Er konnte ihnen doch schlecht erzählen, dass er auf Violas Rosen gepisst hatte. Anscheinend nahm ihm niemand ab, dass er ein Sternengucker war, denn es war diese Aussage, die ihn verdächtig machte. Im Angesicht des Unbekannten gaben sie sich jede Mühe zu leugnen, dass etwas Unerklärliches vorgefallen sein konnte, und versuchten, das Fantastische zu etwas Banalem zurechtzustutzen. Die Tatsache, dass er Chemiker von Beruf war, ließ sie hellhörig werden, auch wenn er seit Jahren nicht mehr in diesem – oder irgendeinem anderen – Feld tätig gewesen war. Noch nie war ein illegales Methamphetamin-Labor ohne Getöse und Feuer in die Luft geflogen, aber sie waren nicht bereit, von dieser lachhaften Theorie abzulassen.
Er hatte ihnen gar nicht erzählt, dass er Chemiker war. Das hatten sie selbst herausgefunden, was bedeutete, dass sie Nachforschungen über ihn angestellt haben mussten und deshalb von der Unterschlagungsklage wussten, die vor neun Jahren gegen ihn erhoben worden war. Er war schuldig gewesen, doch er hatte schlimmere Dinge über seinen Arbeitgeber gewusst, als der über ihn gewusst hatte, deshalb hatte der Mistkerl einen Waffenstillstand ausgerufen.
Als hätten sie noch nie von Grundrechten gehört, schafften ihn die Cops von einem Einsatzwagen zum nächsten, wahrscheinlich um ihn zu verwirren. Zuerst befragten sie ihn höflich, dann immer aggressiver. Als er sie beschuldigte, faschistoides Gesindel zu sein, drohten sie, ihn aufs Revier zu bringen und weiter zu verhören, was sie schon längst getan hätten, wenn sie nicht fürchteten, dass er nach einem Anwalt verlangen würde.
Darüber hätten sie sich keine Sorgen machen müssen, denn das Letzte, was Spondollar wollte, war, sein Schicksal in die Hände eines Anwalts zu legen. Er konnte Anwälte nicht ausstehen und betrachtete sie entweder als skrupellose Schadensersatzjäger oder als Dienstleute der herrschenden Klasse.
Sie nannten dieses Von-einem-Streifenwagen-in-den-nächsten-Spielchen »Tatortbefragung in situ«, obwohl es gar kein Verbrechen gegeben hatte, sondern bloß einen spektakulären Ausbruch des Unbekannten während einer Nacht wie jeder anderen in Oregon. Nach mehr als vier Stunden, als Harley Spondollar schon glaubte, dass sie ihn schließlich doch mitnehmen und wegen irgendeiner fabrizierten Anklage einbuchten würden, kam der geheimnisvolle Mann, woraufhin die Nadel auf der Seltsamkeitsskala bis ganz nach oben ausschlug.
Vier schwarze Suburbans fegten in die Straße. Es waren Fahrzeuge von der Art, wie sie das FBI in Filmen benutzte, nur dass keines von ihnen ein offizielles Hoheitsabzeichen trug oder überhaupt Nummernschilder hatte. 16 Agenten irgendeines Geheimdienstes, Männer und Frauen, stiegen aus den Fahrzeugen. Sie alle trugen schwarze Anzüge, weiße Hemden und schwarze Krawatten. Wer immer diese Leute auch sein mochten, rangmäßig standen sie über den Typen in den Uniformen. Spondollar wurde von einer attraktiven Blonden mit Augen, die so grau wie gebürsteter Stahl waren, zu einem Suburban geführt. »Das Schlimmste ist vorüber, Mr. Spondollar. Alles wird wieder in Ordnung kommen.« Sie klang so unaufrichtig wie ein Politiker und ließ ihn auf dem Beifahrersitz allein zurück. Die Streifenwagen fuhren ab.
Vielleicht zwei Minuten später kam ein Umzugswagen angefahren und parkte vor dem Grundstück, auf dem vorhin noch Spondollars Haus gestanden hatte. Männer in schwarzen Stiefeln und schwarzen Uniformen, wieder ohne Insignien, schwappten aus dem großen Truck, während sich die Agenten in den Anzügen jeweils zu zweit zu allen Häusern in der Nachbarschaft aufmachten, aber mit welcher Absicht, das konnte Spondollar nur vermuten. Bald darauf errichteten die Männer in den Uniformen einen zweieinhalb Meter hohen Bauzaun um das Grundstück. Ein Stofftuch war über den Maschendraht gespannt, der allzu neugierige Blicke auf das, was hinter ihm lag, verhinderte.
In den letzten Minuten der Dunkelheit, als diese fleißigen Arbeiter gerade ein blickdichtes Tor auf Spondollars Auffahrt errichtet hatten, kam ein weißer Suburban an. Er fuhr durch das Tor, um den großen Hügel aus den säuberlich angefertigten Trümmerteilen herum, zu denen sein Haus gemacht worden war, und verschwand auf dem Hinterhof. Einer von dem Bautrupp schloss das Tor und stellte sich wie eine Wache daneben.
Harley Spondollar beobachtete all dies mit einem Erstaunen und Interesse, das kurzzeitig sogar seine Angst verdrängte. Aber nach und nach breitete sich wieder ein tiefgründiges Gefühl von Unbehagen in ihm aus.
Die eisige Blonde mit den grauen Augen kehrte in dem Halblicht, das dem Sonnenaufgang vorausging, zu ihm zurück. Sie eskortierte ihn durch das Tor und um die Ruine herum. Er stellte ihr Fragen, während sie ihn herumführte, doch sie ignorierte ihn. Fast hätte er ihr das F-Wort und ein paar weniger schlimme Beleidigungen an den Kopf geworfen, doch seine Intuition mahnte ihn, dass er solch ein Verhalten vielleicht bitter bereuen würde.
Das Haus war verschwunden, doch die Betonterrasse dahinter war noch intakt, und auf ihr parkte der Suburban. Neben dem Fahrzeug standen ein weißer Klapptisch, eineinhalb Meter im Quadrat, und zwei weiße Klappstühle aus Holz. Die Blonde wies ihn an, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Er sagte: »Und was, wenn ich’s nicht mache?« Sie sagte, als würde sie zu einem sturen Hund sprechen: »Hinsetzen.« Während er im Polizeigewahrsam gewesen war, hatte man ihm erlaubt, hinter einem Baum auszutreten, doch seine Blase fühlte sich schon wieder halb voll an, und er zog ihre Schuhe als ein mögliches Ziel in Betracht. Noch einmal gab er mit einer gewissen Enttäuschung seiner Intuition nach und setzte sich auf den Stuhl.
Als ihn die Frau allein ließ, füllte sich der Himmel im Osten mit Pfirsichlicht und ein Mann lief vorn um den SUV. Er war groß und schlank, sein Gesicht und seine Hände hatten die Farbe von Tee, sein Haar und seine Augen waren pechschwarz. Weiße Schuhe, weißer Anzug, weißes Hemd, knallrote Krawatte. Sein Lächeln war weißer als seine Kleidung. Er schien aus Indien zu kommen.
Fast sah es aus, als würde er auf seinen Stuhl hinunterschweben. Er hatte ein Bündel Papiere und einen weißen Kugelschreiber dabei und legte beides auf den Tisch. Seine Finger waren lang und gepflegt. Seine Hände bewegten sich mit derselben Anmut wie die Hände eines Zauberers in Nahaufnahme. Er war der Inbegriff von Eleganz. Spondollar hatte während seines chaotischen Lebens immer mal wieder versucht, sich elegant zu geben, einen guten Geschmack zu entwickeln und Raffinesse an den Tag zu legen, hatte es aber nie so recht hinbekommen. Er hasste Menschen, die, so wie dieser Typ, von Natur aus anmutig und geschmeidig waren und sich in ihrer Haut augenscheinlich wohlfühlten.
»Mr. Spondollar, mir wurde berichtet, dass sich Ihr Handy im Haus befand, als der Vorfall geschah. Ist das korrekt?«
»Wer zum Teufel sind Sie?«
»Mein Name ist nicht wichtig. Hat sich Ihr Handy im Haus befunden?«
»Scheiße, ja. Zerstört, genau wie alles andere – das Haus, die Garage, mein Auto. Was spielt das für eine Rolle? Was ist mit meinem Haus passiert?«
»Mr. Spondollar, tragen Sie eine Apple Watch, ein Gerät zur Gesundheitsüberwachung oder irgendeinen Apparat mit Internetverbindung?«
»Ich bin völlig gesund und stark wie ein Stier. Bei mir muss nichts überwacht werden. Und meine Uhr ist ein billiges Stück Scheiße vom Grabbeltisch. Warum ist das wichtig?«
»Es ist wichtig, dass Sie kein GPS-Signal aussenden, damit Ihr Angreifer Sie nicht ins Visier nehmen kann und vielleicht glaubt, Sie wären schon tot.«
»Mein Angreifer? Was für ein Angreifer?«
Der Fremde hob eine Augenbraue, deutete beiläufig auf den Haufen, der einmal ein Haus gewesen war, und sagte: »Sie glauben doch nicht, dass dies eine spontane und natürliche Zersetzung war, oder?«
Die erhobene Augenbraue war so unterschwellig ironisch, die Geste so lässig und elegant, dass Spondollar die rote Krawatte am liebsten greifen und an ihr ziehen wollte, um das Gesicht des Typen hart auf die Tischplatte knallen zu lassen.
Doch er riss sich zusammen. »Was zum Henker ist mit meinem Haus passiert?«
»Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen, Mr. Spondollar. Dies ist eine Angelegenheit von nationaler Sicherheit und größter Geheimhaltung.«
»Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Zu wem gehören Sie? FBI, CIA?«
»Ich selbst bin kein staatlicher Agent. Ich gehöre einer der seltenen Kooperationen zwischen der Bundesregierung und dem privaten Sektor an. Sie sind beide vonnöten, um einer einzigartigen Bedrohung zu begegnen.«
»Welche einzigartige Bedrohung?«
»Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen. Außerdem würden Sie es gar nicht wissen wollen, Mr. Spondollar, denn wenn Sie es wüssten, würden Sie nie wieder gut schlafen können.«
»Ich habe keinen Platz zum Schlafen, selbst wenn ich es könnte.«
»Genau darum werde ich mich kümmern. Wir werden Sie in einem Zeugenschutzprogramm verschwinden lassen und Ihnen eine neue Identität besorgen, die nicht zurückverfolgt werden kann. Wir werden …«
Spondollar unterbrach ihn: »Wovon bin ich denn Zeuge geworden? Ich habe einen Scheißdreck gesehen, abgesehen von dem, was mit dem Haus passiert ist, und ich habe keinen Schimmer, was das war.«
»Es heißt nur deshalb Zeugenschutzprogramm, weil es wie eines funktioniert. Wir werden Sie nach Arizona schaffen …«
»Hey, aber … Wissen Sie, ich habe hier ein Leben.«
»Und was für ein Leben«, sagte der Fremde ohne auch nur den Hauch eines abfälligen Tonfalls, Lächelns oder Nickens, als würde er tatsächlich glauben, dass Spondollar mit dieser Stadt tief verwurzelt und ein echter Segen für seine Nachbarn war. »Darum werden wir Sie mit dem zweifachen Wert dieses Anwesens entschädigen – den es hatte, als das Haus noch existierte. Wir werden Ihnen ein besseres Haus in Arizona besorgen, eines ohne Hypothek. Wir werden Ihnen eine monatliche Vergütung von 4000 Dollar zahlen, und zwar für den Rest Ihres Lebens. Außerdem erhalten Sie eine Barzahlung, die doppelt so hoch ist wie Ihr derzeitiges Guthaben bei der Bank und das auf Ihrem Anlagenkonto.«
»Sind Sie verrückt? Das ist ein Vermögen.« Er beugte sich vor und deutete mit dem Finger anklagend auf den Fremden. »Das heißt, Sie wollen etwas von mir. Was wollen Sie von mir?«
»Wir wollen die Kollateralschäden begrenzen. Wenn Sie versuchen, Ihr Leben weiter als Harley Spondollar zu leben, würden Sie wieder angegriffen werden, und dann gibt es womöglich Kollateralschäden. Darf ich offen sein, Sir?«
»Seien Sie, was Sie wollen.«
Der Mann in Weiß lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Wir verspüren keine besondere Zuneigung für Sie, Mr. Spondollar. Aber wenn Sie jetzt zur Bank gingen, um Geld abzuheben, würde die Transaktion eine Verifizierung über das Internet mit sich bringen. Noch bevor Sie den Barscheck entgegennehmen könnten, würden Sie und die ganze Bank und alle darin vernichtet werden. Ich kenne zwar niemanden in der Bankfiliale, die Sie benutzen, aber als deren Mitmensch verspüre ich eine besondere Zuneigung für sie.«
Spondollar kaute einen langen Augenblick auf seiner Unterlippe, bevor er sagte: »Das war Ihrer nicht würdig.«
»Ich weiß. Ein Schlag unter die Gürtellinie. Ich bedaure es. Aber es stimmt. Sie sind kein Mann, der Zuneigung erweckt. Alles, was ich von Ihnen brauche, ist Ihre Unterschrift auf den Dokumenten, die ich mitgebracht habe. Darunter befindet sich auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die, wenn Sie sie brechen, zu Ihrer sofortigen Verhaftung führen kann.«
»Das ist aber verdammt heftig.«
»Ja, nicht wahr?«
»Und wenn ich nun alles annehme, was Sie mir anbieten, und auch mein Geld auf der Bank behalte?«
Der Fremde seufzte. »Ich weiß ja, dass diese Geldmittel einen sentimentalen Wert für Sie haben, weil Sie sie einem Mann unterschlagen haben, der den Fehler gemacht hat, Sie wie einen Sohn zu behandeln. Aber die Antwort ist Nein.«
Spondollar zuckte zusammen. »Das war noch unwürdiger. So etwas hätte ich nicht von Ihnen gedacht.«
»Es tut mir leid, aber ich bereue nicht, es gesagt zu haben. Ich verliere langsam die Geduld, Mr. Spondollar.« Er schob das Papierbündel und den Kugelschreiber über den Tisch. »Unterschreiben Sie dort, wo die gelben Etiketten kleben.«
Spondollar nahm den Kugelschreiber, zögerte aber noch. »Es ist nur so, dass ich nicht so gut auf die Obrigkeit zu sprechen bin.«
»Das ist mir bewusst. Ich fasse es auch nicht als persönliche Beleidigung auf.«
Nachdem er fünf Dokumente unterzeichnet hatte, hielt Spondollar inne. »Okay, es muss wohl ein paar Leute geben, die mich tot sehen wollen, nicht bloß einen.«
»Kein Zweifel«, sagte der Fremde.
»Aber was zum Teufel ist mit meinem Haus passiert, und wer in Gottes Namen hat die Macht, so etwas zu tun?«
»Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen.«
»Das heißt … Sie wissen nicht, wer es war, stimmt’s?«
»Wir wissen, wie es gemacht wurde, mit welcher Technologie. Sie müssen nur wissen, dass diese Macht außergewöhnlich ist – und wer die Kontrolle darüber gewonnen hat, ist skrupellos. Unterschreiben Sie die Papiere und kommen Sie mit mir, oder lassen Sie sich auslöschen.«
Während Spondollar die verbliebenen Dokumente unterschrieb, öffnete der Fremde einen breiten weißen Umschlag und entnahm daraus ein 20 mal 25 Zentimeter großes Foto. »Ich bin mir sicher, die Antwort zu kennen, aber ich muss Sie trotzdem fragen, ob Sie wissen, wer dieser Mann ist.«
Auch wenn er Stunden damit zugebracht hätte, die Identität der Person auf dem Bild zu erraten, bevor es ihm gezeigt wurde, Spondollar wäre wahrscheinlich nicht auf den richtigen Namen gekommen. »Er? Asher Optime? Er ist ein wertloser Schwachkopf. Ich könnte ihm den Hals mit einer Hand brechen.«
»Er hat Ihr Haus nicht zerstört. Aber er wird wissen, wer es getan hat. Wir müssen ihn finden. Es sind Menschen wie Sie, seine Feinde, die ins Visier genommen werden.«
»Ich habe diesen kranken Hundesohn schon seit Jahren nicht gesehen. Kein Schimmer, wo zum Teufel er steckt.«
»Das dachte ich mir.«
Weil er anscheinend keine Wahl hatte, unterzeichnete Spondollar die Dokumente, ohne sie zu lesen. Doch als er sah, dass Blue Sky Partners als »Veräußerer« eingetragen war, runzelte er die Stirn, las die ersten beiden Wörter laut und sagte: »Was ist das?«
»Die Körperschaft, die das Haus für Sie kauft und die monatliche Vergütung zahlt.«
»Der Name meiner Mutter war Skye. Sie wurde in Arizona geboren, wohin Sie mich schicken wollen. Der Geburtsname meiner Ex-Frau war Blue.«
»Synchronizität. Ein jungianischer Zufall«, sagte der Fremde.
»Was für ein Zufall?«
»Carl Jung, der berühmte schweizerische Psychiater und Psychologe. Er vertrat die Theorie, dass bedeutungsvolle Zufälle enthüllen, wie unser gemeinsames Bewusstsein die Wirklichkeit bestimmt, wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Zusammen erschaffen wir die Wirklichkeit, und die Wirkung kann vor der Ursache eintreten.«
»Klingt nach einem großen Haufen Dünnschiss«, sagte Spondollar.
»Ja, nicht wahr? Hier ist ein Beispiel, das mir gut gefällt. Edgar Allan Poe schrieb eine Geschichte über einen Schiffbruch, in der die hungernden Matrosen einen Schiffsjungen namens Richard Parker töteten und aßen. 50 Jahre später kam es tatsächlich zu einem Schiffsunglück, das dem in der Geschichte auf unheimliche Weise bis ins Detail ähnelte – und die hungernden Matrosen töteten und aßen einen Schiffsjungen namens Richard Parker. Hunderttausende Menschen haben diese Geschichte im Laufe dieser 50 Jahre gelesen und waren darüber entsetzt. Ist es möglich, irgendwie zumindest, dass sie diese Geschichte unbewusst in das Gewebe der Realität geträumt haben?«
Spondollar machte ein mürrisches Gesicht. »Wie zur Hölle konnte so was passieren?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Mechanismus funktioniert. Ich habe mich nur gewundert.«
»Sie sind ein seltsamer Mistkerl.«
»Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal.«
Während der Fremde das Foto wegsteckte und die unterschriebenen Dokumente einsammelte, machten sich die Singvögel daran, den bunten Pfirsich-und-Sahne-Wolkenhimmel mit ihren Lobliedern zu erfüllen.
Das Gezwitscher ließ Spondollar traurig werden, denn es verdeutlichte ihm, dass nichts in seinem Leben jemals wieder so sein würde, wie es gewesen war. Manchmal hatte er mit seinem Luftgewehr auf seiner Terrasse gesessen und Vögel abgeknallt, wenn sie sich hinhockten, und manchmal sogar im Flug. Seine Waffen waren zusammen mit dem Haus und allem anderen, was sich darin befunden hatte, zerstört worden. Er konnte sich ein neues Luftgewehr kaufen, und auch in Arizona gab es Vögel, doch es würde einfach nicht mehr dasselbe sein.
5
Seit drei Wochen träumte Joanna Chase jede Nacht von Rustling Willows, von der Ranch und auch von dem Baumbestand an raschelnden Weiden, nach dem sie vor langer Zeit benannt worden war. Selbst wenn keine der Ausgeburten ihres schlummernden Verstands die Form von Albträumen annahm, waren sie doch unheilvoll und erfüllten sie mit einer Vorahnung, die auch noch nachklang, wenn sie erwachte. Diese Träume spielten sich in der Fülle der Nacht oder im Halbdunkel ab, aber auch am helllichten Tag, in den purpurnen Schatten des Waldes, der sich wie ein immergrünes Meer an den nördlichen und östlichen Küsten der grasbewachsenen Prärie brach, die den Großteil des Anwesens bedeckte.
In diesen Träumen war sie immer ein Kind, manchmal nur sechs Jahre alt, dann wieder neun, so wie sie es während des letzten Jahres gewesen war, das sie auf der Ranch verbracht hatte. Sieben Nächte lang waren da nur die Bäume und die kleine Joanna, die zwischen ihnen umherschweifte oder unter ihrem duftenden Astwerk und den belaubten Zweigen dahineilte. Raschelnde Bäume, rauschende Bäume, flüsternde Bäume …
Nach einer Woche, als die Träume nicht vergehen wollten, wurden sie von Tieren eingenommen: riesige Schwärme von Felsentauben, die im letzten orangefarbenen Licht des Tages durch das Nadelgehölz flogen, eine Gruppe von Elchen, die sie in ihre Mitte nahmen, als sie mit ihnen durch die dunstige Dämmerung lief. Hin und wieder wuselte ein Rudel Kojoten mit laternengroßen Augen unter einem schimmernden Perlenmond um sie herum, und auch wenn die Stimmung unheilvoll war, rührte die Bedrohung, die sie verspürte, nicht von diesen Kreaturen her, sondern von etwas Unbekanntem in den sternenklaren Strömungen der tiefen, kühlen Nacht.
Nie schreckte sie aus diesen unheimlichen Traumwelten hoch, bis der Grizzlybär in ihnen auftauchte. Manchmal sah sie ihn in der Dämmerung im Wald, wo er, zweieinhalb Meter groß, an einer Baumreihe entlangstapfte, die parallel zu dem Wildwechsel verlief, dem Joanna folgte. Seine feuchten schwarzen Nasenlöcher waren geweitet, um ihre Fährte besser wittern zu können, und seine Augen funkelten vor goldgelbem Licht, wenn er sie beobachtete.
In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, dem 6. August, in einer weiteren vom Schlaf geschaffenen Fantasie, in der sie Wildblumen an einem Berghang 100 Meter jenseits der Pferdeställe pflückte, während die Sonne wie ein apokalyptischer roter Ball auf dem Horizont hinter ihr balancierte, ließ sie ein langes, kräftiges Schnauben von dem blättrigen Farbenmeer aufblicken und sehen, dass sich der Bär, keine fünf Meter entfernt, vor ihr aufgetürmt hatte. Sie war ein kleines Mädchen, vielleicht sieben Jahre alt, und der Grizzly war gewaltig, bestimmt 20-mal so schwer wie sie und mit zehn Zentimeter langen Klauen bestückt, die sie mit einem einzigen Hieb töten konnten. Genau wie bei den knochigen Kojoten fürchtete sie sich nicht vor dieser Kreatur, zumindest nicht in dem Traum, und lächelte sie an und streckte ihr den Blumenstrauß entgegen. Der Bär neigte seinen Kopf, als wäre sie in seinem Erfahrungsschatz etwas Einzigartiges, ein Rätsel, das es zu lösen galt. Als sich das Tier ihr nicht näherte, lief sie langsam mit erhobenen Blumen zu ihm hinüber. Der Koloss hob seinen Kopf und stieß ein wildes Geräusch aus – teils Ruf, teils Rasseln, teils grimmiges Blöken –, das die kleine Joanna zum Kichern brachte. Unverdrossen folgte sie ihrem zarten Schatten in dem karminroten Licht der untergehenden Sonne, bis sie nur wenige Schritte vor der monströsen Gestalt stand. Sie hielt den Blumenstrauß in die Höhe, und der Bär …
Joanna erwachte mit einem Schreckensschrei. Sie setzte sich hin, warf die Bettdecke beiseite, sprang auf ihre Füße und stand zitternd da.
Normalerweise schlief sie im Dunkeln, doch kürzlich hatte sie die Tür zum Badezimmer einen Spalt offen gelassen, was eine einfache geometrische Form aus blassem Licht auf den schwarz-roten Navajo-Teppich warf. Noch immer wurde das Zimmer von Schatten beherrscht, doch keiner davon war tief genug, um einen Eindringling zu verbergen.
Sie hatte in T-Shirt und Höschen geschlafen, unter einer dünnen Bettdecke und Oberdecke, denn im Zimmer war es nicht kalt. Die Gänsehaut, die sich kühl über sie legte, war eine Reaktion auf den Traum und nicht auf die Lufttemperatur.
Während der mehr als neun Jahre auf Rustling Willows war sie nicht ein einziges Mal von einem Tier bedroht worden, weder von einem Kojoten noch von einem Bären, ja nicht einmal von einer der Klapperschlangen, die in der Gegend recht häufig vorkamen. Die Anschaulichkeit dieser Träume und die Intensität ihrer Reaktion darauf hatten nichts mit Bedrohungen zu tun, die sie irgendwann einmal überlebt hatte. Doch obwohl sie – außer auf Fotografien – noch nie einen Grizzly gesehen hatte, wusste sie, warum ausgerechnet dieses Tier sie in ihren Träumen heimsuchte.
Die Uhr neben dem Bett zeigte ihr eine Zeit, die sie nicht wahrhaben wollte. 2:40 Uhr in der Nacht. Jedes Mal wenn sie aus diesen Träumen aufwachte, schaffte sie es nicht, wieder einzuschlafen. Dies würde also wieder so eine Nacht werden, in der sie weniger als fünf Stunden Schlaf bekam.
Der Fernseher war nicht eingeschaltet. Sie hatte keine Ahnung, warum sie glaubte, dass er es sein sollte.
Sie schlüpfte in ihre Yogahose, lief barfuß durch das Haus zu ihrem Arbeitszimmer und schaltete auf dem Weg dorthin die Lampen ein.
In diesen Stunden des verlorenen Schlafs war Joanna nach Kaffee zumute, dem sie Zimtaroma zusetzte, bevor sie ihn aufbrühte und dann schwarz trank, nicht etwa weil sie ihn brauchte, um wach zu bleiben, sondern weil der Duft und der Geschmack sie an die Morgenstunden auf Rustling Willows erinnerten, in der Küche mit ihrer Mutter, die sie verlor, als sie neun Jahre alt war, in demselben Jahr, in dem sie auch ihren Vater verloren hatte. Ihre Mutter, Emelia, hatte ihren Kaffee immer auf diese Weise getrunken, und als Joanna sechs war, hatte sie auch eine Tasse davon trinken dürfen, obwohl ihr Kaffee mit viel Kondensmilch verdünnt war.
Auf einem Ecktisch in ihrem Arbeitszimmer stand eine Kaffeemaschine. Sie kochte sich acht Tassen. So viel würde sie zwar nicht trinken, doch der Anblick des Kaffees in der Pyrex-Kanne beruhigte sie, ebenso wie das Aroma, das in der Luft hing, solange die jamaikanische Mischung auf der Warmhalteplatte stand.
Sie fuhr den Computer auf ihrem Schreibtisch hoch und öffnete ein Dokument mit dem Titel The Color of Never, ein Buch, an dem sie gerade arbeitete. Mit gerade einmal 33 Jahren hatte sie in den elf Jahren seit dem College bereits sechs Romane geschrieben. Die beiden letzten hatten sich recht gut verkauft. Mit jedem ihrer Romane hatte sie ihre Verkäufe steigern können, und das in einer Zeit der Hightech-Barbarei, in der es schien, als würden Bücher womöglich völlig aus der Mode geraten und als riesige digitalisierte, aber kaum noch genutzte Informationsfelder schon bald zu Friedhöfen verkommen, voll mit Wissen, das früher einmal grundlegend gewesen war.
Sie nippte an dem Kaffee, der ihr Frösteln wegwärmte, aber ihre Kreativität war immer noch wie eingefroren. Ihre Finger fanden keine Worte auf den Tasten. Ihr neuer Roman hatte zwar gute Fortschritte gemacht, auch als die seltsamen Träume sie jede Nacht heimgesucht hatten, kam aber nicht mehr vorwärts, seit die Tiere darin aufgetaucht waren.
Noch nie zuvor hatte Joanna eine Schreibblockade gehabt. Die frustrierende Unfähigkeit, etwas zu erschaffen, deutete darauf hin, dass die außergewöhnlich lebhaften Träume entweder das Symptom eines körperlichen Leidens waren – vielleicht etwas, das mit dem Gehirn zu tun hatte – oder der Beleg für einen psychologischen Knoten, der gelöst werden musste. Langsam, aber sicher überlegte sie mit jedem neuen Tag, dass es an der Zeit war, sich Hilfe zu suchen.
Sie fürchtete sich nicht vor Ärzten oder Therapeuten. Und doch steigerten sich ihre Bedenken jedes Mal, wenn sie das Telefon nahm, um John Wong, ihren Hausarzt, anzurufen, zu einem sonderbaren und nachdrücklichen Angstgefühl. Wenn sie in dieser Angelegenheit nach Hilfe suchte, dessen war sie sich sicher, würde sich ihr Leben, so wie sie es kannte, auf drastische Weise zum Schlechten verändern. Sie war keine abergläubische Frau und neigte auch nicht zu irrationalen Ängsten. Ihre Haltung hatte sie zuerst überrascht, dann verärgert und schließlich genauso besorgt, wie die Träume es taten.
Als sie auf den Bildschirm und dort auf den letzten Satz starrte, den sie vor fast zwei Wochen geschrieben hatte, klingelte das Telefon auf ihrem Schreibtisch. Nur ein paar Freunde kannten ihre Handynummer; ihre Festnetznummer hatte sie öfter weitergegeben. Sie hatte noch immer Festnetztelefone zur Absicherung, weil … Na ja, manchmal brach eben alles auseinander. An dem einen Tag ist deine Mutter noch an deiner Seite, am nächsten Tag ist sie schon tot. Auch wenn es einen zuverlässigen Eindruck machte, war das ganze Mobilfunksystem für Hacker anfällig, für Sonneneruptionen und für andere Störungen. Sie hatte zwei Festnetzanschlüsse, wobei die zweite Nummer nur dazu diente, dass sie keinen Anruf von einem Lektor oder Agenten verpasste, wenn sie gerade über die erste telefonierte. Das Lämpchen des ersten Anschlusses blinkte beharrlich, doch das Display des Telefons zeigte nur UNBEKANNTER ANRUFER an.
Automatisierte Anrufe waren ein Problem, aber normalerweise nicht um drei Uhr nachts. Sie ließ den Anrufbeantworter anspringen, doch der Anrufer legte auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Eine halbe Minute später klingelte die zweite Leitung. Wieder zeigte die Anruferkennung nichts an. Keine Nachricht.
Ihr Handy, das rechts neben dem Computer lag, klingelte. Obwohl der Anrufer schon wieder unbekannt war, war Joanna neugierig genug, um ranzugehen. »Hallo?«
Die Stimme der Frau kam ihr vage bekannt vor, doch sie gehörte zu keiner engen Freundin. »Jimmy Zweiauge. Erinnerst du dich an ihn?«
»Nein. Wer spricht dort?«
»Du warst sechs, Jimmy Zweiauge neun.«
»Ich kenne ihn nicht. Was wollen Sie?«
»Nun, wo du seinen Namen gehört hast, wirst du dich bald erinnern.«
»Wer spricht dort?«
»Ich brauche deine Hilfe.« Diese vier Worte wurden nicht so sehr als ein emotionaler Hilferuf ausgesprochen, sondern mehr wie eine einfache Aussage. Die Anruferin klang so gefasst wie jemand, der eine Umfrage zu bevorzugten Waschmitteln machte, auch als sie sagte: »Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Nur du fällst mir ein, Jojo.«
Als sie ein Kind war, hatte ihr ihre Mutter den Spitznamen Jojo gegeben. Doch wer auch immer die Anruferin sein mochte, sie war nicht Emelia, ihre Mutter. Die Toten führten schließlich keine Telefongespräche aus dem Jenseits.
Dies war das Jahrhundert der Lügner, Betrüger und Halsabschneider. Joanna hatte ihre Erfahrungen mit ihnen gemacht. Sie hatte keine Geduld mit diesen Schwindlern. Und doch schien die Wunderlichkeit dieses Anrufs irgendwie mit den Träumen, die sie in letzter Zeit plagten, in Verbindung zu stehen. Anstatt einfach aufzulegen, fragte sie noch einmal: »Wer spricht dort?«
Noch immer in einem sachlichen Tonfall sagte die Anruferin: »Ich bin an einem dunklen Ort, Jojo.«
»Und wo ist das?«
»Es ist eine mentale Dunkelheit.«
»Ach so? Okay. Aber von wo rufen Sie an?«
»Du weißt schon.«
»Woher soll ich das wissen?«
»Du weißt schon.«
»Ich werde dieses blöde Spiel nicht mitspielen. Sagen Sie mir, wer Sie sind, oder ich rufe die Polizei.«
»Nur du kannst mir helfen, Jojo.«
Joanna drückte den Anruf weg. Ihre Hand zitterte. Das Frösteln, mit dem sie aufgewacht war, kehrte zurück.
Sie lief durch das Zimmer zu dem Ecktisch und schenkte sich Kaffee nach. Sie stand dort, die Tasse in beiden Händen haltend, und nippte an dem heißen Gebräu.
Sie kannte niemanden mit dem Namen – oder Spitznamen – Jimmy Zweiauge. Aber als sie den Namen in den Dampf hauchte, der von ihrem Kaffee aufstieg, verstärkte sich das Frösteln und rieselte ihr von der Schädelbasis über den ganzen Rücken bis hinunter zum Steißbein.
Von wo rufen Sie an?
Du weißt schon.
Woher soll ich das wissen?
Du weißt schon.
Mit einer plötzlichen neuen Einsicht betrachtete sie die Gegenstände in dem Zimmer, mit denen sie die letzten zwölf Jahre verbracht hatte. Der farbenfrohe Navajo-Teppich schien auf dem blassgoldenen Ahornboden zu schweben; sein Muster deutete auf eine mystische Bedeutung hin. Ein dekorativ bemaltes, kolonialzeitliches trastero stand an einer Wand, die Türen waren geöffnet, die Regalböden mit volkstümlichen Kunstobjekten beladen: Pueblo-Keramiken; raffinierte Zinnrahmen, in denen Schwarz-Weiß-Fotos des alten Santa Fe steckten; eine Figur des Jesuskindes, aus Pappelholz geschnitzt, mit feinem Gips überzogen und von Luis Tapia bemalt. Mit Fransen besetzte Pendleton-Decken in einem weichen beigebraunen, roten und blauen Design lagen über zwei gemütlichen Ledersesseln.
Sie hatte dieses Haus nicht einfach möbliert; sie hatte es kuratiert, als wäre es eine über mehrere Räume verteilte Installation in einem Museum. Sie hatte geglaubt, dass sie es im Stil von Santa Fe zusammengestellt hatte, zu etwas, das diese geschichtsträchtige Stadt, die sie so liebte, widerspiegelte. Doch nun begriff sie, dass das Ergebnis ein rustikales und doch anspruchsvolles Dekor war, das sich in gewissem Maße auch jenseits der Grenzen von New Mexico finden ließ und das für die bescheidenen ländlichen Häuser in weit entfernten Gegenden wie Wyoming und Montana eigentlich gar nicht so untypisch war, also für diesen Teil des wahren Westens, der sich noch nicht ganz der Moderne hingeben wollte, wie der neue Westen jenseits der Rockies es schon getan hatte.
Sie sah jetzt auch, was sie noch mehr erstaunte, dass sie sich mit Dingen umgeben hatte, die der Einrichtung in dem Natursteinhaus von Rustling Willows ähnelten, wo sie die ersten neun Jahre und vier Monate ihres Lebens verbracht hatte.
Obwohl sie die Ranch vor 24 Jahren verlassen hatte und ihre Kindheitserinnerungen wenigstens teilweise vom Staub der Zeit verdeckt waren, fand sie es unglaublich, ja geradezu unerklärlich, dass sie bis zu diesem Augenblick nicht bemerkt hatte, wie groß der Einfluss von Rustling Willows auf dieses Haus war, das sie sich eingerichtet hatte. Fast schien es, als hätte sie ihre Erinnerung an den Ort unbewusst verdrängt, vielleicht als Schutz vor dem emotionalen Schmerz der Tragödien, die dort vorgefallen waren.
Die liebste Form der körperlichen Übung war es für ihre Mutter gewesen, in einem Skiff über den Lake Sapphire, der vor ihrem Haus lag, zu rudern. Fast jeden Morgen ging sie beim ersten Tageslicht aufs Wasser hinaus – und eines Tages kehrte sie nicht zurück. Der 240 Hektar große See war an manchen Stellen fast 100 Meter tief, doch die Behörden mussten kein Netz hindurchziehen, um ihren Leichnam zu finden, denn sie wurde an einen Kiesstrand im Schatten der Pappeln geschwemmt. Der Gerichtsmediziner befand, dass das Boot ins Wanken geraten und sie über Bord gestürzt sein musste, wobei sie sich den Kopf an dem Seitendeck stieß und dann ertrank, während sie bewusstlos war.
Nach dem Verlust ihrer Mutter und – zwei Wochen später – dem Tod ihres Vaters Samuel verbrachte Joanna die nächsten zwölf Jahre bei der unverheirateten Schwester ihrer Mutter, Katherine, in Santa Fe in einer Art viktorianischem Haus, das voller schwerer Möbel und Trödel stand, in einem Anwesen, das einige vielleicht als Affront gegen die anmutigen, von Pueblos beeinflussten Gebäude betrachteten, die den Großteil der sagenumwobenen Stadt ausmachten. Kurz nachdem sie ihren Abschluss am St. John’s College gemacht hatte, erbte Joanna einen Treuhandfonds, der auch den Ertrag aus der Lebensversicherung ihrer Mutter enthielt. Damit hatte sie ihr Haus gekauft und eingerichtet, wo sie so lange genügsam lebte, bis ihr Versuch, einer Karriere als Schriftstellerin nachzugehen, erste Früchte trug.
Sie konnte nicht begreifen, dass der geheimnisvolle Anruf einer namenlosen Frau genügen konnte, um die Farben der verblassten Erinnerungen an Rustling Willows wieder aufleuchten zu lassen. Aber vielleicht war es kein Zufall, dass das leise Bitten der Anruferin ihren kürzlichen Träumen folgte.
Und das bedeutete – was? Dass ihre Träume irgendwie hervorgerufen worden waren? Mit Drogen? Absurd. Schließlich schrieb sie keine von Paranoia durchzogenen Erzählungen. Sie hatte nichts mit Verschwörungstheorien, die wie eine endlose Abfolge von Tsunamis im Internet wüteten, am Hut. Bestimmt war der Zeitpunkt des Anrufs rein zufällig und hatte überhaupt nichts mit ihren Träumen zu tun.
Nur du kannst mir helfen, Jojo.
Von wo rufen Sie an?
Du weißt schon.
Woher soll ich das wissen?
Du weißt schon.
Und natürlich wusste Joanna es. Die unbekannte Frau rief aus Rustling Willows an – oder hatte es zumindest angedeutet.
Doch der Ort lag 24 Jahre in Joannas Vergangenheit, und sie war niemandem in Montana in irgendeiner Weise verpflichtet. Dort konnte es keinen Menschen geben, der in einer Notlage steckte, die nur sie in der Lage war zu lösen.
Sie stellte die Kaffeetasse ab, machte einen Rundgang durch das Haus und staunte – mit wachsender Beklommenheit –, wie viele ihrer Besitztümer den Gegenständen, so wie sie sich jetzt an sie erinnerte, auf einer Ranch ähnelten, die 1200 Meilen und ein Vierteljahrhundert weit entfernt lag.
Wenn sie andere Erinnerungen unterdrückt hatte, irgendeine Begebenheit oder eine Bekanntschaft, die den Telefonanruf erklären würde, so hatte sie bestimmt einen guten Grund dafür gehabt. Auch wenn ihre Vorstellungskraft sie gern mit schillernden Theorien verwirren wollte, wäre sie besser beraten, der Versuchung zu widerstehen, nach einer Erklärung zu suchen. Doch bei all ihrer natürlichen Schönheit hatte die Ranch eine Waise aus ihr gemacht. Es war nicht gerade wahrscheinlich, dass dieser Ort eine freundliche Aussicht auf ihre Zukunft bereithielt.
Trotz alledem musste etwas an der Zeit, die sie in Rustling Willows verbracht hatte, ein unerklärliches Heimweh in ihr ausgelöst haben. Sonst hätte sie dieses Haus in Santa Fe nicht so wie das in Montana hergerichtet.
Sie hatte ihre Mutter oft in dem Skiff begleitet und die Ausflüge auf das Wasser genossen. Doch obwohl ihr der Anblick von Emelias aufgedunsenem Leichnam erspart geblieben war, erschien ihr der See in der Folgezeit verschmutzt und unerträglich.
Auch den Leichnam ihres Vaters hatte sie nicht zu Gesicht bekommen, zwei Wochen später, doch der Schrecken seines Todes hatte der Ranch jeglichen Charme genommen, über den sie noch verfügte. Samuel war mit Spirit, seinem Lieblingspferd, ausgeritten. Die Theorie lautete, dass sie auf einen Bären mit seinem Jungen gestoßen waren – oder auf einen, der halb verhungert gewesen sein musste. Der Hengst geriet in Panik, warf seinen Reiter ab und machte sich davon, und der Bär machte Jagd auf Samuel. Nur die grausamen Klauen eines Bären hätten derart schlimme Wunden reißen können, und nur ein ausgehungerter, 800 Pfund schwerer Grizzly hätte so viel von seinem Riss aufgefressen.
Dies waren triftige Gründe, nie mehr nach Rustling Willows zurückzukehren, und doch überkam sie ein seltsames Verlangen nach Montana, als sie in ihr Arbeitszimmer zurückging und auf den Navajo-Teppich zu ihren Füßen blickte.
Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Es war der erste Anschluss.
»Nein«, sagte Joanna.
Als der Anrufbeantworter ansprang, legte der Anrufer auf.
Der zweite Anschluss schrillte. Wieder hinterließ der Anrufer keine Nachricht – und versuchte es auf ihrem Handy.
Sie nahm die Tasse, die sie vorhin abgestellt hatte. Der Kaffee darin war kalt. Sie schenkte sich heißen Kaffee aus der Pyrex-Kanne nach.
Sie ging zum Fenster und schob die Vorhänge beiseite. Hinter dem Fenster lag der von einer Stuckmauer umgebene Innenhof. Durch den Zauber des Mondlichts erstrahlten mehrere Kakteen – einige waren groß, andere gedrungen – und schienen von tierischem Leben erfüllt worden zu sein. Sie standen oder kauerten da, auf sie wartend – augenlose Wächter, ein paar mit mehreren Köpfen, ein paar mit zahlreichen Gliedmaßen, die vom Mondschein mattierten Gesichter unversöhnlich, die Körper mit Stacheln versehen.
Nachdem sie die Vorhänge wieder zugezogen hatte, setzte sie sich an ihren Schreibtisch, starrte auf den Bildschirm und las den letzten Satz, den sie geschrieben hatte: Intelligenz ohne Vernunft ist gefährlich, doch eine Vernunft kann nicht von jemandem erlernt werden, der zur Arroganz erzogen wurde und dem die Demut fehlt, an seine Intuition zu glauben und auf sie zu vertrauen.
Jedes Mal wenn sie diese Worte las, wusste sie, dass sie stimmten, doch sie spürte auch, dass der Aussage, die sie bildeten, noch etwas fehlte.
Widerwillig – oder auch nicht – nahm sie ihr Handy und sah, dass der Anrufer diesmal eine Nachricht hinterlassen hatte.
Die Stimme gehörte wieder zu der Frau, mit der sie vorhin gesprochen hatte, und sie war angesichts der Worte, die sie verwendete, noch immer sonderbar ruhig. »Ich bin mental an einem dunklen Ort. Ich bin verloren. Ich bin eine Gefahr für mich und andere. Nur du kannst mir helfen, Jojo. Bitte komm und hilf mir.«
6
Die Montana-Nacht ist still, von den gelegentlichen Rufen der Kojoten oder den Fragelauten der Eulen oder dem Kreischen von unbekannten Nachtvögeln, die das Schicksal der Erde beklagen, einmal abgesehen.
Die Sterne brennen auf den Hitzetod zu, den das Universum in wer weiß wie vielen Milliarden Jahren sterben wird, und der tote Mond wirft sein kaltes Licht auf die düsteren Gebäude, die den Wahnwitz der menschlichen Rasse bezeugen.
Asher Optime läuft die von Unkraut überwucherte Hauptstraße – die einzige Straße – entlang und genießt die frische, saubere Luft. Er erfreut sich an der Beschaulichkeit und bedauert schon jetzt das Geschrei, das später kommen muss, wenn es auch nur kurz sein wird.
In den meisten Nächten ist er um diese Uhrzeit nicht mehr wach. Üblicherweise schläft er von Mitternacht bis zum Sonnenaufgang, und zwar so tief und fest wie ein Ungeborenes im Mutterleib. Seine aufregenden Träume finden in solchen Versionen der Kunstwerke von Marcel Duchamp, Joan Miró, Robert Rauschenberg und anderen statt, die sich dreidimensional entwickeln können. In den Träumen zerren oder schneiden oder löschen diese Künstler der Dekonstruktion Teile von ihm heraus, bis es so scheint, als hörte er auf zu existieren, bevor er aufwacht. Diese freudige Erwartung wird aber jedes Mal enttäuscht, denn jeder Traum endet, während noch Teile von ihm übrig sind: eine Hand, die an einer schweren, von Mauerwerk umgebenen Tür vorüberkriecht; ein trauriges Auge, das durch eine Leere schwebt, in der ein Hund im Dunkeln bellt; Bruchstücke seines Gesichts, die durch ein Farbenfeld gleiten. In dieser Nacht wird er nicht schlafen oder träumen, denn er wird der Künstler sein, der den Sinn des Lebens auslöscht – das Leben einer 28-jährigen Frau namens Ophelia Poole.
Vor fünf Monaten, eine Woche vor seinem 42. Geburtstag, hatte Asher die Straße nach Nirgendwo gefunden, und sie hatte ihn zu all dem geführt, was er jemals wollte.
In Montana erscheinen die Prärien schier endlos, und die Täler erstrecken sich so weit wie die Ebenen. Die gewaltigen Wälder sind derart urweltlich, dass leicht zu glauben ist, dass sich Kreaturen, die schon viele Jahrtausende lang ausgestorben sein sollen, noch immer in diesen dicht bewachsenen und von tiefen Schatten durchzogenen Gebieten tummeln. Die hoch aufragenden, burgartigen Berge gleichen abweisenden Bollwerken, die, wenn sie schemenhaft im blutigen Sonnenuntergang stehen, gut und gern die Festung eines bösen Königreichs in einem Fantasyroman sein könnten, und die Schluchten reichen in Tiefen hinab, wo sich der Nebel sammelt, als wollte er die Wege zu geheimen Zivilisationen unterhalb der Erdkruste verbergen.