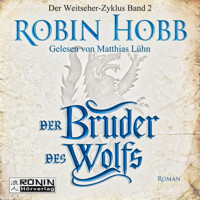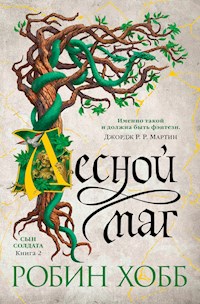9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chronik der Weitseher
- Sprache: Deutsch
Die Legenden erwachen zum Leben.
Fitz Chivalric hat versagt. Sein skrupelloser Onkel hat den Thron der sechs Provinzen an sich gerissen, und der wahre Herrscher, Prinz Veritas, gilt als tot. Fitz bleibt nur noch eines: Rache! Doch wie soll er bis zu dem Mann vordringen, der ihm alles genommen hat? Einem König, geschützt von Soldaten und Magie? Ohne Rücksicht auf sich selbst, treibt Fitz seine Pläne voran. Da erreicht ihn der Ruf eines Todgeglaubten – Prinz Veritas!
Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Die Magie des Assassinen« im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und unter dem Titel »Der Nachtmagier« im Heyne Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1717
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Fitz-Chivalric hat versagt. Sein skrupelloser Onkel hat den Thron der Sechs Provinzen an sich gerissen, und der wahre Herrscher, Prinz Veritas, gilt als tot. Fitz bleibt nur noch eines: Rache! Doch wie soll er bis zu dem Mann vordringen, der ihm alles genommen hat? Einem König, geschützt von Soldaten und Magie? Ohne Rücksicht auf sich selbst treibt Fitz seine Pläne voran. Da erreicht ihn der Ruf eines Totgeglaubten – Prinz Veritas!
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit Die Gabe der Könige, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz-Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Der Erbe der Schatten
Die Chronik der Weitseher 3
Roman
Deutsch von Eva Bauche-Eppers
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Assassin’s Quest« bei Bantam, New York.Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Die Magie des Assassinen« im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und unter dem Titel »Der Nachtmagier« im Heyne Verlag.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 1997 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Covergestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, InkcraftCovermotiv: von aleksm/Shutterstock.com
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-17764-5V003www.penhaligon.de
Für die ganz echte Kat Ogden,die in zartem Alter drohte, erwachsen und dabei Folgendes zu werden:Eine stepptanzende,fechtendeJudoka,Filmstar,ArchäologinundPräsidentin der Vereinigten Staaten.Inzwischen ist sie dem Ende ihrer Liste schon erschreckend nahe.Verwechsele nie den Film mit dem Buch.
Prolog
Das Nichterinnerte
Ich erwache jeden Morgen von neuem mit Tinte an meinen Fingern. Manchmal liege ich weit ausgestreckt auf meinem Schreibtisch, inmitten von Schriftrollen und Pergamenten. Mein Gehilfe, wenn er mit meinem Tablett hereinkommt, mag sich die Freiheit nehmen, mich zu schelten, weil ich wieder einmal nicht den Weg ins Bett gefunden habe. An anderen Tagen schaut er mir ins Gesicht und sagt kein Wort. Ich erkläre ihm nicht, weshalb ich tue, was ich tue, denn dies ist kein Geheimnis, das man an einen Jüngeren weitergibt; er sollte durch eigene Mühe zu der Erkenntnis gelangen.
Ein Mann muss eine Aufgabe haben. Heute weiß ich das, doch ich brauchte die ersten zwanzig Jahre meines Lebens, um das zu lernen. Darin halte ich mich kaum für einzigartig. Dennoch, es ist eine Lektion, die mir, einmal gelernt, immer gewärtig geblieben ist. Deshalb wollte ich mich dieser Tage nicht nur mit meinen Schmerzen beschäftigen, sondern habe mich bemüht, eine Aufgabe zu finden. Ich habe mich einem Unterfangen zugewandt, das mir schon vor langer Zeit von sowohl Prinzessin Philia als auch Fedwren, dem Schreiber, ans Herz gelegt worden war. Diese Seiten sollten der Anfang einer umfassenden Geschichte der Sechs Provinzen sein, doch es fällt mir schwer, mich länger auf ein einziges Thema zu konzentrieren, deshalb verschaffe ich mir Abwechslung mit kürzeren Essays: Theorien über Magie, Betrachtungen über politische Strukturen sowie Reflexionen über andere Kulturen. Wenn die Beschwerden mich am meisten quälen und ich nicht die Kraft habe, meine Gedanken zu ordnen und niederzuschreiben, arbeite ich an Übersetzungen oder befasse mich damit, alte Dokumente zu kopieren und zu vervollständigen. Ich beschäftige meine Hände in der Hoffnung, meinen Verstand abzulenken.
Das Schreiben hilft mir, so wie das Zeichnen von Karten seinerzeit Veritas geholfen hat. Die detailreiche Arbeit und die Konzentration, die dazu aufgebracht werden muss, lassen mich das drängende Verlangen der Sucht beinahe vergessen wie auch deren Nachwirkungen, unter denen jeder leidet, der ihr einst verfallen war. Man kann in solcher Arbeit versinken und sich selbst vergessen. Man kann darin sogar noch tiefer eintauchen und trifft dann auf zahlreiche Erinnerungen an dieses frühere Selbst. Nur allzu häufig stelle ich fest, wie ich von einer Geschichte der Sechs Provinzen abgeirrt bin zu Leben und Taten des Fitz-Chivalric. In diesen Erinnerungen sehe ich mich konfrontiert mit dem, der ich war, und mit dem, der ich geworden bin.
Wenn man derart in eine Aufarbeitung der Vergangenheit vertieft ist, wird man überrascht sein, an wie viele Einzelheiten man sich zu entsinnen vermag. Nicht alle Erinnerungen, die ich heraufbeschwöre, sind schmerzlich. Das Leben hat mir wahrlich viele Freunde geschenkt, und ihre Treue war größer, als ich es je hätte erwarten können. Mein Leben war von Schönheit und Freude erfüllt, was jedoch mein Herz und meine Seele nicht weniger auf die Probe gestellt hat als die traurigen und hässlichen Zeiten, die ich erlebt habe. Dennoch besitze ich, verglichen mit anderen, möglicherweise einen größeren Schatz an dunklen Erinnerungen, denn nur wenige dürften die Erfahrung teilen, den Tod im Kerker zu sterben oder im Inneren eines Sarges lebendig im Schnee zu sein. Der Verstand schaudert vor diesen Bildern. Es ist eine Sache, daran zu denken, dass Edel mich ermordete, eine andere, sich des Grauens der Tage und Nächte zu vergegenwärtigen, als er mich hungern und schließlich von seinen Schergen totschlagen ließ. Wenn ich es tue, gibt es Augenblicke, bei denen mir noch immer das Blut in den Adern gefriert, selbst nach all diesen Jahren. Ich erinnere mich an die Augen des Mannes und das Geräusch, als seine Faust meine Nase zermalmte. Ich habe immer noch einen ständig wiederkehrenden Traum, in dem ich darum kämpfe, aufrecht stehen zu bleiben und den Gedanken zu vermeiden, Edel in einem letzten Versuch zu töten. Ich erinnere mich, wie er mir mit dem Handrücken ins Gesicht schlug und die Haut aufplatzte. Davon ist mir die Narbe auf der Wange geblieben.
Niemals kann ich mir vergeben, zu welchem Triumph ich ihm damit verhalf, dass ich Gift nahm und starb.
Doch schmerzlicher als die Ereignisse, an die ich mich erinnere, empfinde ich jene, die für mich verloren sind. Als Edel mich tötete, löschte er mich vollkommen aus. Fitz-Chivalric war für alle tot, und zerrissen waren die Bande zu den Menschen von Bocksburg, die mich gekannt hatten, seit ich ein Knabe von sechs Jahren gewesen war. Niemals wieder bezog ich mein Quartier in der Burg, machte Prinzessin Philia meine Aufwartung, saß am brennenden Kamin Chade zu Füßen. Verloren waren für mich die vielen Lebensfäden, die mit meinem verwoben gewesen waren. Freunde starben, andere heirateten, Kinder wurden geboren, andere wuchsen heran, und ich erlebte nichts davon mit. Obwohl ich nicht länger den Körper eines gesunden jungen Mannes besitze, leben noch viele, die mich einst Freund nannten. Manchmal überkommt mich das Verlangen, sie anzusehen, ihnen die Hand zu reichen, die Einsamkeit von Jahren abzuwerfen.
Es bleibt mir versagt.
Diese wie auch alle künftigen Jahre ihres Lebens sind für mich verloren. Verloren ist für mich auch die Zeit meiner Gefangenschaft im Kerker und dann im Sarg. Es war kaum ein Monat, doch es erschien mir viel länger. Mein König war in meinen Armen gestorben, aber man trug ihn ohne mich zu Grabe. Auch bei der Ratsversammlung nach meinem Tod war ich nicht zugegen, als man mich für schuldig befand, die Alte Macht praktiziert zu haben, und damit meine schändliche Ermordung als Tat nach Recht und Gesetz deklarierte.
Philia kam und erhob Anspruch auf meinen Leichnam. Es war ausgerechnet meines Vaters Gemahlin, die einst so tief verletzt worden war, als sie erfahren musste, dass er vor ihrer Vermählung mit einer anderen einen Bastard gezeugt hatte, die mich aus jener Zelle holte. Ihre Hände waren es, die meinen toten Leib wuschen und in Grabtücher hüllten. Unbeholfene, exzentrische Prinzessin Philia. Ich weiß nicht, aus welchem Grund sie meine Wunden reinigte und sie so sorgfältig verband, als lebte ich noch. Sie allein gab Befehl, für mich ein Grab auszuheben, und sah, wie mein Sarg darin verschwand. Sie und Litzel, ihre Zofe, trauerten um mich, als alle anderen sich aus Angst oder Abscheu vor meinem Verbrechen von mir abwandten.
Doch sie wusste nicht, dass Burrich und Chade, mein Lehrer und Mentor als Assassine, in einer späteren Nacht zu diesem Grab kamen und den frisch gefallenen Schnee und die gefrorenen Erdschollen wegschaufelten, die man auf meinen Sarg geworfen hatte. Nur diese beiden waren zugegen, als Burrich schließlich den Deckel aufbrach und meinen leblosen Körper heraushob und sodann mittels der auch ihm innewohnenden Alten Macht den Wolf herbeirief, der noch meine Seele in sich barg. Sie entrissen dem Tier diese Seele und geleiteten sie zurück in den zerschlagenen Körper, aus dem sie geflohen war. Sie erweckten mich zum Leben, auf dass ich wieder in Menschengestalt umhergehen und mich erinnern möge, was es heißt, einen König zu haben und durch einen Schwur gebunden zu sein. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, ob ich ihnen dafür dankbar bin. Es mag sein, wie der Narr behauptet, dass sie keine andere Wahl hatten. Vielleicht kann es dafür keinen Dank und keine Schuld geben, sondern nur die Anerkennung der Mächte, die uns an unser Schicksal binden und es bestimmen.
Kapitel 1
Auferstehung
In Chalced hält man Sklaven. Sie verrichten die niederen Arbeiten. Sie stellen die Bergleute, die Ruderer auf den Galeeren, die Besatzung der Müllwagen, die Feldarbeiter und die Huren. Merkwürdigerweise sind Sklaven auch die Kindermädchen, Hauslehrer, Köche sowie Schreiber und meisterliche Handwerker. Chalceds gesamte glanzvolle Zivilisation, von der großen Bibliothek in Jep bis zu den sagenhaften Wasserspielen und Bädern in Sinjon, gründet auf der Existenz von Sklaven.
Die Händler aus Bingstadt sind die Hauptzulieferer von Sklaven. Früher waren die meisten Sklaven Kriegsgefangene, und offiziell behauptet Chalced, daran habe sich nichts geändert. In jüngerer Zeit hat es allerdings nicht genügend Kriege gegeben, um die Nachfrage nach gebildeten Sklaven zu befriedigen. Die Händler aus Bingstadt sind jedoch äußerst tüchtig darin, andere Quellen aufzutun, und oft wird in diesem Zusammenhang das Piratenunwesen erwähnt, das zwischen den Handelsinseln herrscht. Wer in Chalced Sklaven besitzt, kümmert sich wenig darum, woher die unfreiwilligen Diener kommen, solange sie nur gesund sind.
Sklaverei ist ein Brauch, der in den Sechs Provinzen niemals Fuß gefasst hat. Wer eines Verbrechens überführt wird, der mag dazu verurteilt werden, dem zu dienen, dem er geschadet hat, doch dies immer nur für eine festgesetzte Zeitspanne, und er wird nicht geringer angesehen als jemand, der freiwillig Buße tut. Ist ein Verbrechen zu furchtbar, um durch Arbeit gesühnt zu werden, bezahlt der Schuldige mit dem Leben. In den Sechs Provinzen muss niemand befürchten, versklavt zu werden. Ebenso wenig unterstützen unsere Gesetze den Gedanken, dass Zuwanderer Sklaven mitbringen und sie weiterhin als solche halten dürfen. Aus diesem Grund wählen viele Sklaven aus Chalced, die auf die eine oder andere Weise ihre Freiheit gewonnen haben, die Sechs Provinzen als neues Zuhause.
Sie bringen die vielfältigen Traditionen ihrer Heimatländer mit und ihren Sagenschatz. Eine Geschichte, die ich in Erinnerung behalten habe, handelt von einem Mädchen, das eine »Vecci« war oder – wie wir sagen würden – mit der Alten Macht begabt. Sie hatte den Wunsch, ihr Elternhaus zu verlassen, um dem Mann zu folgen, den sie liebte und heiraten wollte. Ihre Eltern fanden ihn nicht würdig und verweigerten ihr die Erlaubnis. Als folgsame Tochter widersetzte sie sich nicht, aber sie war auch eine zu leidenschaftliche Frau, um sich von ihrer wahren Liebe einfach loszusagen. Sie legte sich auf ihr Bett und siechte vor Kummer dahin, bis sie starb. Ihre Eltern begruben sie in großer Trauer und voller Selbstvorwürfe, dass sie ihr nicht erlaubt hatten, der Stimme ihres Herzens zu folgen. Doch ohne die Ahnung der Eltern war ihre Tochter durch die Alte Macht mit einer Bärin verschwistert gewesen, und als das Mädchen starb, nahm die Bärin ihre Seele in Obhut, so dass sie nicht aus dieser Welt fliehen konnte. Drei Nächte nach dem Begräbnis des Mädchens grub die Bärin den Sarg aus und gab der Toten ihre Seele zurück. Durch ihre Auferstehung aus dem Grabe galt das Mädchen als neugeboren und aller früheren Verpflichtungen, auch des kindlichen Gehorsams, ledig. Also stieg sie aus ihrem zertrümmerten Sarg und ging fort, um ihren Liebsten zu suchen. Das Märchen hat jedoch ein trauriges Ende, denn nachdem sie eine Zeitlang eine Bärin gewesen war, vermochte sie nie wieder ganz menschlich zu werden, worauf ihr Liebster sich von ihr lossagte.
Diese kleine Geschichte war der Hintergrund für Burrichs Entschluss, den Versuch zu wagen, mich aus Edels Verlies zu befreien, indem er mich vergiftete.
Der Raum war zu warm. Und zu klein. Mein Hecheln brachte keine Kühlung mehr. Ich stand vom Tisch auf und ging zum Wasserfass in der Ecke, nahm den Deckel ab und trank voller Durst. Rudelherzhob den Kopf und verzog böse das Gesicht. Es war fast ein Zähnefletschen. »Nimm einen Becher, Fitz.«
Wasser lief über mein Kinn. Ich starrte ihn unverwandt und dann lauernd an.
»Wisch dir das Gesicht ab.« Rudelherz schaute wieder auf seine Hände. Er hatte Fett an den Fingern und rieb es in irgendwelche Lederriemen. Ich schnüffelte dem Geruch nach und leckte mir die Lippen.
»Ich habe Hunger«, sagte ich zu ihm.
»Setz dich hin und beende deine Arbeit. Dann werden wir essen.«
Ich versuchte mich zu erinnern, was das für eine Arbeit gewesen war. Er deutete mit der Hand zum Tisch, und es fiel mir wieder ein. Auch an meinem Platz lag ein Knäuel Lederriemen. Ich ging hin und setzte mich auf den harten Stuhl.
»Ich habe jetzt Hunger«, erklärte ich ihm. Wieder sah er mich auf die Art an, die einem Zähnefletschen gleichkam, ohne dass er eine Miene verzog. Die Warnung stand in seinen Augen. Ich seufzte. Das Fett, das er benutzte, roch sehr gut. Ich schluckte, dann senkte ich den Blick. Lederriemen und Metallteile lagen vor mir auf der Tischplatte. Ich betrachtete sie eine Zeitlang.
Nach einer Weile legte Rudelherz seine Arbeit beiseite und wischte sich an einem Tuch die Hände ab. Er trat neben mich. »Da«, sagte er und wies auf eine bestimmte Stelle. »Du warst dabei, das auszubessern.« Er blieb neben mir stehen, bis ich das Riemenzeug wieder aufhob. Ich bückte mich, um daran zu riechen, und er versetzte mir einen Schlag gegen die Schulter. »Lass das sein!«
Meine Lippen zuckten, aber ich knurrte ihn nicht an. Knurren machte ihn sehr, sehr wütend. Ratlos drehte ich die Riemen hin und her, doch plötzlich war es, als ob meine Hände wüssten, was von ihnen erwartet wurde, noch bevor mein Verstand sich erinnerte. Ich schaute meinen Fingern zu, die mit dem Leder hantierten. Als der Schaden behoben war, hielt ich den Riemen hoch und spannte ihn, und das mit einem Ruck, um Rudelherz zu zeigen, dass er halten würde, auch wenn das Pferd den Kopf zurückwarf. »Aber da ist kein Pferd«, sprach ich den Gedanken aus, der von irgendwoher gekommen war. »Alle Pferde sind fort.«
Bruder?
Ich komme. Ich stand von meinem Stuhl auf und ging zur Tür.
»Komm wieder her und setz dich hin«, befahl Rudelherz.
Nachtauge wartet, protestierte ich. Dann fiel mir ein, dass er mich so nicht hören konnte. Ich war überzeugt, dass er es gekonnt hätte, wenn er nur wollte, doch er wollte nicht. Ich wusste, wenn ich wieder mit den Gedanken zu ihm sprach, würde er mich bestrafen. Er ließ mich auch mit Nachtauge nur selten und wenig auf diese Art sprechen und bestrafte sogar den Wolf, wenn er zu viel mit mir redete. Ich begriff nicht, warum. »Nachtauge wartet«, wiederholte ich mit dem Mund.
»Ich weiß.«
»Jetzt ist eine gute Zeit, um zu jagen.«
»Es ist eine noch bessere Zeit für dich, um drinnen zu bleiben. Ich werde dir hier zu essen geben.«
»Nachtauge und ich wollen frisches Fleisch.« Bei dem Gedanken daran lief mir das Wasser im Mund zusammen. Ein Kaninchen mit aufgerissenem Leib, sein noch dampfendes Blut in der Winternacht. Danach gelüstete es mich.
»Nachtauge wird heute Abend allein jagen müssen.« Rudelherz ging zum Fenster und öffnete die Läden einen Spaltbreit. Frostige Luft strömte herein. Ich konnte Nachtauge sofort wittern und, etwas weiter entfernt, eine Schneekatze. Nachtauge winselte. »Fort mit dir«, sagte Rudelherz zu ihm. »Fort mit dir, geh jagen, such dir Beute. Ich habe nicht genug zu essen hier, um auch dich noch satt zu machen.«
Nachtauge zog sich ins Dunkel jenseits des Lichtscheins zurück, hielt sich aber in der Nähe. Er wartete dort draußen auf mich, aber ich wusste, lange würde er nicht ausharren. Ihn plagte der Hunger ebenso wie mich.
Rudelherz ging zu dem Feuer, das die unangenehme Hitze verströmte. Dort stand ein Topf, und er zog ihn mit dem Haken von den Flammen weg und hob den Deckel ab. Dampf quoll heraus und mit ihm Gerüche. Nach Getreide und Wurzeln und – kaum wahrnehmbar – ein klein wenig Fleisch. Aber ich war so hungrig, dass ich den guten Duft gierig einsog. Unwillkürlich entfuhr mir aus meiner Kehle ein Winseln, doch Rudelherz sah mich nur wieder mit diesem zähnefletschenden Blick an. Also ging ich zurück zu dem harten Stuhl. Ich setzte mich hin. Ich wartete.
Rudelherz nahm sich viel Zeit. Er räumte alles Lederzeug vom Tisch und hängte es an einen Haken. Dann stellte er die hölzerne Büchse mit Fett auf ein Bord. Anschließend brachte er den heißen Topf herüber und stellte zwei Schüsseln und zwei Becher auf den Tisch. Aus dem Schrank holte er Brot und ein kleines Glas mit Marmelade. Er schöpfte die dicke Suppe in meine Schüssel, aber ich wusste, ich durfte mich nicht einfach darüber hermachen. Ich musste stillsitzen und mich in Geduld üben, während er das Brot schnitt und mir ein Stück reichte. Es war erlaubt, das Brot in der Hand zu halten, aber ich durfte nicht hineinbeißen, bis er sich mit seiner Schüssel und seiner Suppe und seinem Brot ebenfalls hinsetzte.
»Nimm deinen Löffel«, ermahnte er mich. Dann ließ er sich bedächtig auf seinem Stuhl neben mir nieder. Ich hielt den Löffel und das Brot in den Händen und wartete, wartete, wartete. Ich ließ ihn nicht aus den Augen, doch ich konnte nicht verhindern, dass mein Mund Kaubewegungen vollführte. Er wurde zornig. Ich presste die Lippen zusammen. Endlich sagte er: »Jetzt wollen wir essen.«
Aber das Warten war noch nicht vorüber. Nur ein Bissen jeweils war gestattet. Er musste gekaut und hinuntergeschluckt sein, bevor ich weiteraß, andernfalls versetzte Rudelherz mir einen Stoß. Von der Suppe durfte ich nur so viel nehmen, wie auf den Löffel passte. Ich griff nach dem Becher und trank daraus.
Rudelherz lächelte mir zu. »Gut, Fitz. Guter Junge.«
Ich erwiderte das Lächeln, dann aber nahm ich einen zu großen Bissen Brot, und er runzelte die Stirn. Ich bemühte mich, langsam zu kauen, aber ich hatte solchen Hunger, und das Essen stand vor mir, und ich konnte nicht begreifen, weshalb dieses dumme Ritual mir verbot, es einfach hinunterzuschlingen. Er hatte die Suppe absichtlich zu heiß gemacht, damit ich mir den Mund verbrannte, wenn ich zu gierig darüber herfiel. Ich grübelte ein wenig darüber nach, dann sagte ich: »Du hast die Suppe absichtlich zu heiß gemacht. Damit ich mir den Mund verbrenne, wenn ich zu schnell esse.«
Diesmal dauerte es eine Weile, bis er lächelte. Er nickte bestätigend.
Trotzdem war ich früher fertig als er. Die Regeln verlangten allerdings, dass ich auf dem Stuhl sitzen blieb, bis auch er aufgegessen hatte.
»Nun, Fitz«, sagte er schließlich. »War kein schlechter Tag heute, was meinst du?«
Ich schaute ihn an.
»Gib Antwort«, forderte er mich auf. »Sag etwas.«
»Was?«, fragte ich.
»Irgendwas.«
»Irgendwas.«
Er runzelte die Stirn, und ich hätte gerne geknurrt, weil ich doch alles getan hatte, wie er es wollte. Nach einer Weile stand er auf und holte eine Flasche. Er goss etwas in seinen Becher und hielt mir die Flasche hin. »Willst du?«
Ich zuckte zurück. Ein stechender Geruch drang in meine Nase.
»Antworte«, mahnte er.
»Nein. Nein, es ist schlechtes Wasser.«
»Nicht ganz. Es ist schlechter Branntwein. Brombeerschnaps. Billiger Fusel. Ich habe das Zeug gehasst, aber du mochtest es immer.«
Ich schnaubte, um den Geruch loszuwerden. »Wir haben das nie gemocht.«
Er stellte Flasche und Becher auf den Tisch. Er stand auf, ging zum Fenster und stieß es erneut auf. »Geh jagen, habe ich gesagt!« Ich fühlte, wie Nachtauge erschrak und davonlief. Nachtauge fürchtete Rudelherz ebenso sehr wie ich. Einmal hatte ich Rudelherz angegriffen. Ich war lange krank gewesen, doch an dem Tag hatte ich mich besser gefühlt. Ich wollte hinausgehen, um zu jagen, und er wollte es nicht zulassen. Er stand vor der Tür, und ich sprang ihn an. Er schlug mich mit der Faust, und dann rang er mich nieder. Er ist nicht größer als ich, aber er ist brutaler und schlauer. Er kennt viele Griffe, um jemanden festzuhalten, und die meisten tun weh. Er hielt mich auf dem Boden, und ich lag so lange, lange vor ihm auf dem Rücken, während meine entblößte Kehle seinen Zähnen preisgegeben war. Jedes Mal, wenn ich mich bewegte, boxte er mich. Nachtauge hatte draußen geknurrt, sich aber nicht bis zur Tür gewagt und erst recht nicht versucht hereinzukommen. Als ich um Gnade winselte, schlug Rudelherz mich wieder. »Sei still!«, befahl er. Als ich verstummte, sagte er zu mir: »Du bist der Jüngere von uns beiden. Ich bin älter und weiß mehr. Ich kämpfe besser als du. Ich verstehe mich besser aufs Jagen. Ich stehe über dir. Du wirst alles tun, was ich will. Du wirst alles tun, was ich dir sage. Verstehst du das?«
Ja, hatte ich ihm geantwortet. Ja, ja, das ist Rudelgesetz, ich verstehe, ich verstehe. Doch er hatte mich wieder geschlagen und mich auf den Boden gedrückt, so dass meine Kehle ihm schutzlos ausgeliefert war, bis ich ihm auf die richtige Art versicherte: »Ja, ich verstehe.«
Als Rudelherz zum Tisch zurückkam, goss er Branntwein in meinen Becher und stellte ihn so vor mich hin, dass ich dem Geruch nicht ausweichen konnte. Ich schnaubte.
»Versuch’s«, drängte er mich. »Nur einen Schluck. Du warst ganz wild darauf. Als Halbwüchsiger, dem es eigentlich streng verboten war, ohne mich ein Wirtshaus zu betreten, hast du diesen Schnaps heimlich in der Stadt getrunken und dann Minze gekaut und geglaubt, ich würde nicht merken, was los ist.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich würde nicht tun, was du mir verbietest zu tun. Ich habe verstanden.«
Er machte dieses Geräusch, das sich anhört wie ein Mittelding zwischen Röcheln und Niesen. »Oh, früher pflegtest du oft genau das zu tun, was ich dir verboten hatte. Sehr oft.«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Ich erinnere mich nicht daran.«
»Noch nicht. Aber bald.« Er deutete erneut auf den Becher. »Komm schon. Probier’s. Nur einen kleinen Schluck. Vielleicht tut es dir gut.«
Und weil er es so wollte, probierte ich. Die Flüssigkeit brannte mir in Mund und Nase, und ich konnte den Geschmack nicht loswerden. Ich verschüttete den Rest aus dem Becher.
»Nun, daran hätte Philia bestimmt ihre helle Freude«, war alles, was er dazu sagte. Und dann hieß er mich, einen Lappen holen und aufwischen, was ich verschüttet hatte. Und anschließend musste ich das Geschirr in einer Wasserschüssel säubern und abtrocknen.
Manchmal geschah es, dass ich Zuckungen bekam und hinfiel. Aus heiterem Himmel. Rudelherz versuchte dann, mich festzuhalten, damit ich nicht um mich schlug. Manchmal bewirkten die Zuckungen, dass ich einschlief. Wenn ich dann später aufwachte, hatte ich Schmerzen. Meine Brust tat weh, mein Rücken tat weh. Manchmal biss ich mir in die Zunge. Ich mochte diese Anfälle nicht. Sie erschreckten Nachtauge.
Und manchmal, da war ein anderer bei Nachtauge und mir, ein Dritter, der mit uns dachte. Er war kaum zu spüren, aber er war da. Ich wollte ihn nicht bei uns haben. Ich wollte niemanden bei uns haben, niemals wieder, wir wollten ganz für uns sein, nur Nachtauge und ich. Er wusste es und machte sich so klein, dass seine Anwesenheit die meiste Zeit nicht zu spüren war.
Später näherte sich ein Besucher.
»Ein Mann kommt«, sagte ich zu Rudelherz. Es war Nacht und das Feuer heruntergebrannt. Die gute Jagdzeit war vorüber. Draußen herrschte tiefe Dunkelheit, und bald würde er verkünden, es sei Zeit, schlafen zu gehen.
Rudelherz gab mir keine Antwort. Stattdessen erhob er sich schnell und lautlos und griff nach dem großen Messer, das immer auf dem Tisch lag. Mit einem Wink bedeutete er mir, mich in eine Ecke zu drücken und ihm aus dem Weg zu bleiben. Er ging auf Zehenspitzen zur Tür und wartete. Draußen hörte ich den Schnee unter den Schritten des Fremden knirschen. Dann fing ich seine Witterung auf. »Es ist der graue Mann«, sagte ich. »Chade.«
Daraufhin öffnete Rudelherz sofort die Tür, und der graue Mann kam herein. Die vielfältigen Gerüche, die ihm anhafteten, brachten mich zum Niesen. Staubfeines Pulver zerstoßener, getrockneter Blätter und Räucherwerk verschiedener Art. Er war dünn und alt, aber Rudelherz benahm sich stets, als hätte er es mit einem Ranghöheren zu tun. Rudelherz legte mehr Holz aufs Feuer. Es wurde heller im Zimmer und wärmer. Der graue Mann schob die Kapuze zurück. Er musterte mich einige Atemzüge lang mit seinen hellen Augen, als ob er auf etwas wartete. Dann wandte er sich an Rudelherz.
»Wie geht es ihm? Besser?«
Rudelherz zuckte mit den Schultern. »Als er dich witterte, sagte er deinen Namen. Seit einer Woche hatte er keinen Anfall mehr. Vor drei Tagen hat er mir ein Zaumzeug ausgebessert und dabei ganz anständige Arbeit geleistet.«
»Er versucht nicht mehr, das Leder in den Mund zu stecken und darauf zu kauen?«
»Nein. Wenigstens nicht, solange ich ihn im Auge habe. Außerdem ist es eine Tätigkeit, die er von Jugend an kennt. Vielleicht rührt sie an eine Erinnerung.« Rudelherz stieß ein kurzes Lachen aus. »Wenn schon nichts anderes, geflicktes Zaumzeug ist immerhin etwas, das sich verkaufen lässt.«
Der graue Mann stellte sich ans Feuer und streckte die Hände über die Flammen. Seine Hände hatten braune Flecken. Rudelherz holte die Branntweinflasche. Sie tranken Branntwein aus Bechern. Auch ich bekam einen Becher mit einem Fingerhoch Branntwein darin, doch man zwang mich nicht, davon zu trinken. Sie redeten lange, lange, lange von Dingen, die nichts mit Essen oder Schlafen oder Jagen zu tun hatten. Der graue Mann hatte etwas über eine Frau erzählen hören. »Es könnte äußerst wichtig sein, die Sechs Provinzen kommen damit vielleicht an einen entscheidenden Punkt.«
Rudelherz sagte: »Ich werde in Gegenwart von Fitz nicht darüber reden. Ich habe es versprochen.« Der graue Mann fragte ihn, ob er denn glaube, dass ich verstünde, wovon gesprochen würde, und Rudelherz antwortete, das sei ohne Bedeutung, er habe sein Wort gegeben. Ich hätte gerne geschlafen, aber sie befahlen mir, ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Als der Ältere gehen musste, bemerkte Rudelherz: »Es ist äußerst gefährlich für dich herzukommen. Der weite Fußmarsch. Wird es dir gelingen, unbemerkt wieder hineinzugelangen?«
Der graue Mann lächelte nur. »Ich habe meine Schleichpfade, Burrich«, sagte er. Ich lächelte ebenfalls, denn ich erinnerte mich, dass er immer stolz auf seine Geheimnisse gewesen war.
Eines Tages ging Rudelherz weg und ließ mich allein zurück. Er legte mir keine Fesseln an. Er sagte nur: »Hier sind Haferflocken. Wenn du während meiner Abwesenheit hungrig wirst und essen möchtest, musst du dich erinnern, wie man sie kocht. Wenn du das Haus verlässt, ob durch Tür oder Fenster, ja, wenn du Tür oder Fenster auch nur öffnest, werde ich es wissen. Und ich werde dich totschlagen. Hast du mich verstanden?«
»Ich habe verstanden«, antwortete ich. Er schien sehr zornig auf mich zu sein, dabei konnte ich mich nicht entsinnen, etwas Verbotenes getan zu haben. Er machte einen Kasten auf und nahm ein paar Dinge heraus. Die meisten waren rund und aus Metall. Münzen. An einen Gegenstand konnte ich mich erinnern. Er glänzte und hatte die Form eines Halbmonds und roch nach Blut, als ich ihn einstmals bekam. Ich hatte mit einem anderen Mann darum gekämpft. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich besonders erpicht darauf gewesen wäre, aber ich hatte gekämpft und das Ding für mich gewonnen. Jetzt wollte ich es nicht. Er hielt es an der Kette hoch, um es zu betrachten, dann tat er es in einen Beutel. Mich kümmerte nicht weiter, was damit geschah.
Bald war ich sehr, sehr hungrig. Als Rudelherz wiederkam, haftete ihm ein Duft an. Der Duft eines Weibchens. Nur schwach und zudem vermischt mit dem grünen Geruch einer Wiese. Doch es war ein guter Duft, der ein Verlangen in mir weckte nach etwas, das nicht Nahrung oder Wasser oder Jagen war. Ich trat dicht an ihn heran, um den Duft tief einzuatmen, aber er bemerkte nichts davon. Er kochte den Haferbrei, und wir aßen. Dann saß er still vor dem Feuer und sah sehr, sehr traurig aus. Ich stand auf und holte die Branntweinflasche. Ich brachte ihm die Flasche und einen Becher. Er nahm beides, doch er lächelte nicht. »Vielleicht bringe ich dir morgen bei zu apportieren«, meinte er. »Vielleicht ist das etwas, wozu du imstande bist.« Dann trank er den ganzen restlichen Branntwein aus der Flasche und machte danach eine zweite auf. Ich saß da und schaute ihm zu. Nachdem er eingeschlafen war, nahm ich seinen Rock, dem der Geruch anhaftete. Ich breitete ihn auf dem Boden aus und legte mich darauf nieder und atmete den Duft, bis ich einschlief. Ich träumte, doch es ergab keinen Sinn. Es hatte eine Frau gegeben, die roch wie Burrichs Rock, und ich hatte nicht gewollt, dass sie fortging. Sie war mein Weibchen, doch als sie ging, folgte ich ihr nicht. Das war alles, woran ich mich erinnern konnte. Sich daran zu erinnern war nicht gut, auf die gleiche Weise, wie hungrig oder durstig sein nicht gut war.
Er zwang mich, im Haus zu bleiben. Schon einmal hatte er mich drinnen eingesperrt, eine lange, lange Zeit, als ich nichts anderes wollte als hinaus. Aber diesmal regnete es in Strömen, so dass bereits fast der ganze Schnee geschmolzen war. Plötzlich zog es mich nicht mehr so stark nach draußen. »Burrich«, sagte ich. Er hob ruckartig den Kopf und schaute mich mit durchbohrendem Blick an. Fast als wollte er mich angreifen, so heftig war seine Bewegung. Ich versuchte, mir den Schrecken nicht anmerken zu lassen. Denn manchmal erregte es seinen Zorn, wenn ich mich vor ihm duckte.
»Was ist, Fitz?«, fragte er, und seine Stimme klang freundlich.
»Ich habe Hunger«, antwortete ich. »Jetzt.«
Er gab mir ein großes Stück Fleisch. Es war gekocht, aber es war ein großes Stück. Ich verschlang es zu hastig, doch er schaute mir nur zu, ohne mich zur Ordnung zu rufen oder zu bestrafen. Dieses Mal.
Ich musste mich immer wieder im Gesicht kratzen. Mein Bart juckte. Schließlich stand ich auf und stellte mich vor Burrich hin. Ich kratzte meinen Bart, während er mich fragend musterte. »Ich mag das nicht«, sagte ich. Er sah verwundert aus, trotzdem gab er mir kochend heißes Wasser, Seife und ein sehr scharfes Messer. Er reichte mir eine runde Glasscheibe mit einem Mann darin. Ich betrachtete ihn lange Zeit. Er erfüllte mich mit Unbehagen. Seine Augen waren wie Burrichs Augen, nur dunkler und von Weiß umgeben. Nicht die Augen eines Wolfs. Sein Fell war schwarz wie Burrichs, aber das Haar an seinem Kinn war struppig und borstig. Ich berührte meine Barthaare und sah Finger im Gesicht des Mannes. Es war merkwürdig.
»Rasier dich, aber sei vorsichtig«, mahnte Burrich.
Mich überkam ein Hauch von Erinnerung. Der Geruch der Seife, das heiße Wasser auf meiner Haut. Aber die scharfe Klinge fügte mir Wunden zu. Kleine Schnitte, die brannten. Nachher betrachtete ich wieder den Mann in dem runden Glas. Fitz, dachte ich. Beinahe der alte Fitz. Ich blutete. »Ich blute überall«, sagte ich zu Burrich.
Er lachte mich aus. »Ganz wie früher. Dir geht nie etwas schnell genug.« Er nahm mir das Messer ab. »Sitz still. Du hast da ein paar Stellen ausgelassen.«
Ich hielt ganz still, und das Messer glitt über meine Haut, ohne mich zu verletzen. Es war nicht leicht stillzuhalten, wenn er mir so nahe kam und mich so genau ansah. Als er fertig war, umfasste er mein Kinn und hob mein Gesicht zu sich hoch. Er musterte mich eindringlich. »Fitz?« Er legte den Kopf schräg und lächelte, aber das Lächeln erlosch, als ich nur wortlos seinen Blick erwiderte. Er gab mir eine Bürste.
»Es ist kein Pferd zu striegeln«, sagte ich.
Meine Worte schienen ihn zu erfreuen. »Dann striegle das.« Damit zerzauste er mein Haar. Ich musste es bürsten, bis es glatt liegen blieb. Das Bürsten hinterließ schmerzende Stellen an meinem Kopf. Burrich runzelte die Stirn, als er sah, wie ich das Gesicht verzog. Er nahm mir die Bürste weg und hieß mich stillstehen, während er mein Haar teilte, um nachzuschauen, und prüfend die schmerzenden Stellen betastete. »Bastard!«, stieß er zähneknirschend hervor, und als ich mich duckte, fügte er hinzu: »Nicht du.« Er schüttelte langsam den Kopf, dann klopfte er mir auf die Schulter. »Der Schmerz wird mit der Zeit verschwinden«, tröstete er mich. Er zeigte mir, wie ich mein Haar nach hinten streichen und im Nacken mit einem Lederriemen zusammenbinden sollte. Es war gerade lang genug. »Das ist besser«, lobte er. »Jetzt siehst du wieder aus wie ein Mensch.«
Ich fuhr aus einem Traum hoch; dabei wimmerte ich vor mich hin und zitterte an allen Gliedern. Ich setzte mich auf und begann zu weinen. Burrich sprang von seinem Lager auf und kam zu mir. »Was ist los, Fitz? Fehlt dir etwas?«
»Er hat mich meiner Mutter weggenommen!«, klagte ich. »Er hat mich ihr weggenommen. Ich war noch viel zu jung, um ohne sie sein zu können.«
»Ich weiß«, sagte er, »ich weiß. Aber das ist lange her. Jetzt bist du hier und in Sicherheit.« Er sah besorgt aus.
»Er hat die Höhle ausgeräuchert. Er hat aus meiner Mutter und meinen Brüdern Häute gemacht.«
Sein Gesichtsausdruck veränderte sich, und seine Stimme klang nicht mehr fürsorglich. »Nein, Fitz. Das war nicht deine Mutter. Das war der Traum eines Wolfes. Der Traum von Nachtauge. Was du geträumt hast, mag ihm zugestoßen sein. Aber nicht dir.«
»O doch, o doch«, widersprach ich und war plötzlich zornig. »O doch, und es hat sich ganz genauso angefühlt, ganz genauso.« Ich sprang auf und ging in der Hütte auf und ab. Auf und ab, bis ich dieses Gefühl hinter mir gelassen hatte. Er saß da, beobachtete mich und leerte viele Becher Branntwein, während ich versuchte, dem Schmerz davonzulaufen.
An einem Tag im Frühling stand ich am Fenster und schaute hinaus. Die Welt roch gut, lebendig und neu. Ich reckte mich und rollte die Schultern. Meine Knochen knackten. »Was für ein herrlicher Morgen für einen Ausritt«, sagte ich. Ich drehte mich nach Burrich um, der am Feuer in dem Topf mit Haferbrei rührte. Er legte den Löffel beiseite und trat neben mich.
»In den Bergen ist immer noch Winter«, meinte er leise. »Ich frage mich, ob Kettricken unversehrt in ihre Heimat gelangt ist.«
»Wenn nicht, war es nicht Rußflockes Schuld«, entgegnete ich. Dann regte sich etwas in meinem Innern, etwas Gestaltloses, Furchteinflößendes, das mir den Atem abschnürte. Ich bemühte mich herauszufinden, was es war, doch es lief vor mir davon, und ich hatte nicht den Wunsch, es einzuholen. Gleichzeitig wusste ich, es war etwas, das ich nicht auf sich beruhen lassen konnte. Es wäre wie die Jagd auf einen Bären. In die Enge getrieben, würde er sich zum Kampf stellen und versuchen, mir Wunden zu schlagen. Doch ungeachtet dessen drängte mich etwas, die Verfolgung aufzunehmen. Ich atmete tief ein und aus, wobei mein Atem wie bei einem Schluchzen ins Stocken geriet. Neben mir stand Burrich regungslos und stumm da. Er wartete auf mich und darauf, was geschah.
Bruder, du bist ein Wolf. Bleib weg, bleib weg davon, es wird dich verletzen, warnte mich Nachtauge.
Ich scheute von der Fährte zurück.
Dann polterte Burrich durchs Zimmer, verfluchte alles und jeden und ließ den Haferbrei anbrennen. Wir mussten ihn trotzdem essen. Es gab nichts anderes.
Eine Zeitlang ließ Burrich mir keine Ruhe. »Erinnerst du dich?«, fragte er ständig. Er bedrängte mich, er nannte mir Namen, und ich sollte ihm sagen, wer sich dahinter verbarg. Manchmal tauchte etwas aus meinem Gedächtnis auf. »Eine Frau«, erklärte ich, als er Philia sagte. »Eine Frau in einem Zimmer voller Pflanzen.« Ich hatte mich bemüht, aber trotzdem war er nicht zufrieden.
Nachts träumte ich. Von einem flackernden Licht, einem unsteten Licht, und einer Mauer aus Steinen. Und von Augen hinter einem kleinen, vergitterten Fenster. Die Träume lagen schwer auf meiner Brust, so dass ich Angst hatte zu ersticken. Manchmal dauerte es eine qualvolle Ewigkeit, bis ich genug Atem in meine Lunge gesogen hatte, um schreien zu können. Davon erwachte ich, Burrich natürlich ebenfalls. Noch schlaftrunken griff er nach dem großen Messer auf dem Tisch. »Was ist denn? Was ist?«, fragte er mich jedes Mal. Aber ich konnte es ihm nicht sagen.
Es war sicherer, am Tage und draußen zu schlafen, wo ich vom Geruch des Grases und der Erde umfangen war. Dann wagten sich die Träume von steinernen Mauern nicht hervor. Statt ihrer erschien mir eine Frau, um sich zärtlich an mich zu schmiegen. Ihr Duft war der Duft der Wiesenblumen, und ihr Mund schmeckte nach Honig. Den Schmerz dieser Träume spürte ich beim Erwachen, als ich begriff, dass ich diese Frau für immer verloren hatte, verloren an einen anderen. Nachts saß ich vor dem Herdfeuer und starrte in die Flammen. Ich versuchte, nicht an kalte Steinmauern zu denken und auch nicht an dunkle Augen voller Tränen und einen süßen Mund, den bittere Worte hart gemacht hatten. Ich schlief nicht. Ich wagte nicht einmal, mich niederzulegen. Und Burrich ließ mich gewähren.
Eines Tages besuchte Chade uns wieder. Er hatte seinen Bart wachsen lassen und trug einen breitkrempigen Hut wie ein Hausierer, trotzdem erkannte ich ihn. Als er kam, war Burrich nicht zu Hause, aber ich ließ ihn ein. Ich wusste nicht, was ihn herführte. »Willst du Branntwein?«, fragte ich, weil ich dachte, das könnte der Grund sein. Er musterte mich aufmerksam, und ein schattenhaftes Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
»Fitz?« Sein Blick forschte in meinem Gesicht. »Wie geht es dir?«
Da ich darauf keine Antwort wusste, blickte ich ihn nur schweigend an. Chade packte sein Bündel aus. Zum Vorschein kamen Gewürztee, Käse, geräucherter Fisch und Päckchen mit Kräutern, die er in einer Reihe auf dem Tisch aufstellte. Aus einem ledernen Beutel holte er eine gelbe Kristallkugel hervor, groß genug für eine hohle Männerhand, dann eine flache Schale, die innen blau glasiert war. Er hatte sie auf den Tisch gestellt und mit klarem Wasser gefüllt, als Burrich kam. Burrich war angeln gewesen und brachte auf einer Schnur aufgefädelt sechs kleine Fische mit. Es waren Flussfische, keine Meeresfische. Sie waren schlüpfrig und glänzten. Er hatte sie bereits ausgenommen.
»Du lässt ihn neuerdings allein?«, fragte Chade Burrich, nachdem sie sich begrüßt hatten.
»Es geht nicht anders. Ich muss für unser Essen sorgen.«
»Dann vertraust du ihm?«
Burrich wandte den Blick ab. »Ich habe eine Menge Tiere ausgebildet. Einem Tier beizubringen, dass es tut, was man ihm befiehlt, ist nicht dasselbe, wie einem Menschen zu vertrauen.«
Burrich kochte die Fische in einer Pfanne, und anschließend aßen wir. Dazu gab es den Käse und den Tee. Dann, während ich die Pfanne und das Geschirr abwusch, setzten sie sich hin, um miteinander zu reden.
»Ich will es mit den Kräutern versuchen«, sagte Chade zu Burrich. »Mit dem Wasser oder mit dem Kristall. Egal was. Ich glaube allmählich, was wir haben, ist doch nur eine leere Hülle.«
»Nein«, erwiderte Burrich ruhig. »Lass ihm Zeit. Ich glaube nicht, dass die Kräuter gut für ihn sind. Bevor … bevor er sich veränderte, war er zu abhängig von den Kräutern geworden. Zum Ende hin war er ständig krank oder kurz vor dem Zusammenbruch. Dazu erschöpften ihn die ständigen Kämpfe und seine Aufgabe, für Veritas und Listenreich Königsborn zu sein. Dann griff er zu Elfenrinde, statt sich Ruhe zu gönnen. Er hatte einfach vergessen, wie man sich ausruht und dem Körper Zeit gibt, neue Kräfte zu sammeln. Ihm fehlte die Geduld. In jener letzten Nacht – du hattest ihm Carrissamen gegeben, nicht wahr? Fuchsrot sagte, sie hätte so etwas im ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich glaube, es wären ihm mehr Leute zu Hilfe geeilt, wenn er ihnen nicht solche Angst eingejagt hätte. Der arme alte Klinge dachte, er wäre toll geworden. Er hat sich nie verziehen, dass er ihn niederschlagen musste. Ich wünschte, man könnte ihn wissen lassen, dass der Junge nicht wirklich gestorben ist.«
»Es war keine Zeit, um wählerisch zu sein. Ich gab ihm, was zur Hand war. Woher sollte ich wissen, dass er von Carrissamen den Verstand verliert?«
»Du hättest dich weigern können, ihm etwas zu geben«, entgegnete Burrich ruhig.
»Das hätte ihn nicht aufgehalten. Erschöpft, wie er war, hätte er sich besinnungslos in den Kampf gestürzt und wäre auf der Stelle getötet worden.«
Ich stand auf und setzte mich vor der Feuerstelle auf den Boden. Burrich schaute nicht herüber. Ich legte mich hin und streckte mich. Gut. Ich schloss die Augen und genoss die Wärme des Feuers an meiner Flanke.
»Steh auf und setz dich auf den Stuhl«, sagte Burrich. Ich seufzte, aber ich gehorchte.
Chade sah mich nicht an, und Burrich setzte das Gespräch fort. »Ich halte es für das Beste, alles von ihm fernzuhalten, was ihn beunruhigen könnte. Er braucht nur Zeit. Manchmal erinnert er sich. Und dann sperrt er sich dagegen. Ich glaube nicht, dass er sich erinnern möchte, Chade. Ich glaube nicht, dass er wieder Fitz-Chivalric sein möchte. Vielleicht hat es ihm gefallen, ein Wolf zu sein. Vielleicht hat es ihm so gut gefallen, dass er für immer ein Wolf in menschlicher Gestalt bleiben wird.«
»Das darf nicht sein.« Chade legte die zu Fäusten geballten Hände auf die Tischplatte. »Wir brauchen ihn.«
Burrich setzte sich aufrecht hin. Er hatte die Füße auf den Holzstapel gestützt, aber jetzt stellte er sie auf den Boden. Er beugte sich vor. »Du hast Nachricht bekommen?«
»Nicht ich; aber Philia, glaube ich. Manchmal ist es äußerst unbefriedigend, der Lauscher an der Wand zu sein.«
»Was hast du gehört?«
»Nur Philia und Litzel, die sich über Wolle unterhielten.«
»Weshalb ist das wichtig?«
»Sie brauchten Wolle für einen besonders weichen Stoff. Für einen Säugling oder ein kleines Kind. ›Es wird zum Ende unserer Erntezeit geboren werden, aber das ist Anfang Winter in den Bergen. Deshalb muss der Stoff schön warm sein‹, sagte Philia. Vielleicht meinte sie Kettrickens Kind.«
Burrich hob die Augenbrauen. »Philia weiß über Kettricken Bescheid?«
Chade lachte. »Da fragst du mich etwas. Wer weiß, was diese Frau weiß? In letzter Zeit hat sie sich sehr verändert. Sie zieht die Wachen von Bocksburg auf ihre Seite, und Fürst Vigilant merkt nicht einmal etwas davon. Im Nachhinein denke ich, dass wir sie von Anfang an in unsere Pläne hätten einweihen sollen.«
»Für mich wäre es leichter gewesen.« Burrich starrte mit verschlossener Miene ins Feuer.
Chade schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Es musste so aussehen, als hättest du Fitz im Stich gelassen, dich wegen der Alten Macht von ihm abgewandt. Wenn du Anspruch auf seinen Leichnam erhoben hättest, wäre Edel unter Umständen misstrauisch geworden. Er sollte glauben, sie wäre die Einzige, die genug Mitleid hatte, um ihn zu begraben.«
»Sie hasst mich seitdem. Sie hat mir vorgeworfen, ich wäre ein Verräter, ein Feigling.« Burrich senkte den Blick. Seine Stimme klang rau. »Ich wusste, dass sie seit langem aufgehört hatte, mich zu lieben. Als sie Chivalric ihr Herz schenkte; das konnte ich ertragen. Er war ihrer würdig. Und ich war es schließlich gewesen, der gesagt hatte, für uns gäbe es keine Zukunft. Auch wenn ich auf ihre Liebe verzichten musste, ihrer Achtung konnte ich mir immer gewiss sein. Doch jetzt verabscheut sie mich. Ich …« Er schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Ein paar Herzschläge lang herrschte völlige Stille, dann richtete Burrich sich auf und sah Chade an. Mit gefasster Stimme fragte er: »So, du glaubst also, Philia weiß, dass Kettricken in die Berge geflohen ist?«
»Das würde mich nicht wundern. Natürlich ist offiziell nichts bekannt. Edel hat Boten zu König Eyod geschickt und verlangt zu erfahren, ob Kettricken sich am Hof von Jhaampe aufhält, aber Eyod erwiderte lediglich, sie wäre die Königin der Sechs Provinzen und ihr Tun und Lassen nicht die Angelegenheit des Bergreichs. Edel war so gekränkt, dass er danach die Handelsbeziehungen abgebrochen hat. Doch Philia scheint bestens über alles im Bilde zu sein, was nah und fern vor sich geht. Möglicherweise spinnt sie auch Fäden bis ins Bergreich. Ich für meinen Teil würde brennend gerne wissen, wie und auf welchem Weg sie den Stoff nach Jhaampe schicken will. Es ist eine lange und beschwerliche Reise.«
Burrich schwieg lange. Schließlich sagte er: »Mir hätte eine Möglichkeit einfallen müssen, Kettricken und den Narren zu begleiten. Aber da waren nur die zwei Pferde und auch nur Proviant für zwei. Es war mir nicht gelungen, mehr zu beschaffen. Deshalb mussten sie alleine fliehen.« Mit zugekniffenen Augen starrte er ins Feuer und fragte dann: »Ich nehme nicht an, dass jemand etwas vom König-zur-Rechten Veritas gehört hat?«
Chade schüttelte verneinend den Kopf. »König Veritas«, berichtigte er Burrich sanft. »Wäre er hier.« Er starrte ins Leere. »Wäre es ihm möglich zurückzukommen, dann hätte er es inzwischen getan. Noch ein paar milde Tage wie heute, und die Roten Korsaren werden sich vor unserer Küste tummeln. Ich glaube nicht mehr daran, dass Veritas zurückkehrt.«
»Dann ist Edel wirklich unser König«, erklärte Burrich verdrossen. »Zumindest, bis Kettrickens Kind geboren und herangewachsen ist. Und dann können wir uns auf einen Bürgerkrieg freuen, falls das Kind versucht, nach der Krone zu greifen … und falls es dann überhaupt noch ein Königreich der Sechs Provinzen gibt, um darüber zu herrschen. Veritas. Inzwischen wünschte ich, er wäre nicht ausgezogen, um die Uralten zu suchen. Solange er hier und am Leben war, sahen wir uns den Korsaren wenigstens nicht gänzlich schutzlos ausgeliefert. Bald schon aber wird es Frühling, und nichts steht zwischen uns und den Roten Schiffen …«
Veritas. Ich zitterte vor Kälte. Ich versuchte, die Kälte zu verdrängen. Aber sie kam zurück, und ich verdrängte sie erneut und hielt sie von mir fern. Nach diesem kurzen Moment atmete ich tief ein.
»Wenigstens das Wasser?«, fragte Chade Burrich, und ich bemerkte, dass sie weitergeredet hatten, während ich abwesend gewesen war.
Burrich zuckte mit den Schultern. »Was kann es schaden? Hat er früher schon im Wasser wahrgesehen?«
»Ich habe ihn nie auf die Probe gestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass er es kann, wenn er es versucht. Er besitzt die Alte Macht und die Gabe, weshalb sollte er nicht fähig sein wahrzusehen?«
»Nur weil jemand fähig ist, etwas zu tun, heißt das nicht, dass er es auch tun sollte.«
Ihre Blicke trafen sich. Schließlich zuckte Chade mit den Schultern. »Möglicherweise kann ich mir in meinem Gewerbe kein so empfindsames Gewissen wie deins leisten«, entgegnete er steif.
Nach einer Weile nickte Burrich widerwillig. »Nichts für ungut. Wir alle haben unserem König gedient, ganz wie es unseren jeweiligen Fähigkeiten entsprach.«
Chade akzeptierte die Entschuldigung mit einem Kopfnicken, dann räumte er den Tisch ab, bis nur noch die Wasserschale und einige Kerzen darauf standen.
»Komm her«, forderte er mich freundlich auf, und deshalb gehorchte ich. Er ließ mich auf seinem Stuhl Platz nehmen und stellte die Schale vor mich hin. »Schau hinein«, verlangte er. »Sag mir, was du siehst.«
Ich sah das Wasser in der Schale. Ich sah die blaue Glasur auf ihrem Grund. Beide Antworten stellten ihn nicht zufrieden. Er drängte mich, es nochmals zu versuchen, doch ich konnte ihm keine andere Auskunft geben. Er schob die Kerzen hin und her und forderte mich jedes Mal auf, erneut hinzuschauen. Schließlich sagte er zu Burrich: »Nun, wenigstens gibt er einem mittlerweile Antwort, wenn man mit ihm redet.«
Burrich nickte, aber er schaute ziemlich entmutigt drein. »Ja. Vielleicht braucht er nur noch etwas mehr Zeit.«
Ich wusste, sie waren fertig mit mir, und ich entspannte mich.
Chade fragte, ob er bei uns übernachten könne, und Burrich sagte, selbstverständlich. Dann holte er den Branntwein. Er füllte zwei Becher. Chade zog meinen Stuhl an den Tisch und setzte sich wieder hin. Ich saß bei ihnen und wartete, aber sie begannen eine Unterhaltung, von der ich ausgeschlossen blieb.
»Was ist mit mir?«, unterbrach ich sie schließlich.
Sie hörten auf zu reden und schauten mich an. »Ja, was ist mit dir?«, fragte Burrich.
»Bekomme ich keinen Branntwein?«
»Willst du welchen? Ich dachte, du magst das Zeug nicht.«
»Nein, ich mag es nicht. Ich habe es nie gemocht.« Ich überlegte. »Aber es war billig.«
Burrich starrte mich an. Chade blickte mit einem verstohlenen Lächeln auf seine Hände. Nach kurzem Zögern erhob sich Burrich, holte einen dritten Becher und goss mir ein. Eine Zeitlang saßen sie da und beobachteten mich, aber da ich nichts weiter tat, nahmen sie ihre Unterhaltung wieder auf. Ich trank einen Schluck. Der Branntwein biss mir noch immer in Nase und Mund, doch er wärmte mich auch gleichzeitig von innen. Eigentlich wollte ich nichts mehr davon. Oder doch? Ich nahm einen zweiten Schluck. Er schmeckte noch immer scheußlich. Er schmeckte wie etwas, das Philia mir früher gegen Husten verabreicht hätte. Nein. Ich verdrängte die Erinnerung und stellte den Becher hin.
Burrich schenkte mir keine Beachtung, sondern redete weiter mit Chade. »Auf der Jagd kommt man oft viel näher an ein Reh heran, wenn man so tut, als sähe man es nicht. Sie bleiben stehen und schauen einem entgegen und rühren sich nicht vom Fleck, solange man sie scheinbar nicht beachtet.« Er nahm die Flasche und goss mir wieder ein. Ich prustete, als der scharfe Geruch mir in die Nase stieg. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass sich etwas in mir regte. Etwas in meinem Bewusstsein. Ich spürte hinaus zu meinem Wolf.
Nachtauge?
Mein Bruder? Ich schlafe. Noch ist die gute Zeit zum Jagen nicht gekommen.
Burrich starrte mich mit bösen Augen an. Ich unterbrach die Verbindung.
Ich wusste, ich wollte keinen Branntwein mehr. Aber jemand anders wollte, dass ich wollte. Jemand drängte mich, den Becher zu nehmen und ihn einfach nur in der Hand zu halten. Ich ließ den Branntwein im Becher kreisen. Veritas hatte die Angewohnheit gehabt, den Wein in seinem Glas zu schwenken und sinnend hineinzuschauen. Mein Blick verlor sich in der Tiefe des Bechers.
Fitz.
Ich stellte den Becher hin. Ich stand auf und ging durchs Zimmer. Ich wäre gern ins Freie geflüchtet, aber Burrich ließ mich nie allein nach draußen, erst recht nicht in der Nacht. Deshalb unternahm ich einen Rundgang durch das Zimmer, bis ich wieder bei meinem Stuhl anlangte. Ich setzte mich hin. Der Becher Branntwein stand immer noch da. Schließlich griff ich danach, nur um das drängende Gefühl loszuwerden, ihn hochheben zu müssen. Er drängte mich. Und kaum hatte ich ihm einmal nachgegeben, drängte er mich weiter. Er gab mir den Wunsch ein, daraus zu trinken. Wie warm sich doch der Schnaps in meinem Bauch anfühlen würde. Trink es schnell hinunter! Der Geschmack wird nicht bleiben, dafür aber die warme, wohlige Glut in meinem Bauch.
Ich merkte, was er vorhatte. Ich wurde zornig.
Bloß noch einen kleinen wohltuenden Schluck. Ein Flüstern nur. Damit du zur Ruhe kommst, Fitz. Das Feuer ist warm. Du hast zu essen gehabt. Burrich wird dich beschützen, und auch Chade ist da. Du musst nicht ständig auf der Hut sein. Nur noch einen Schluck. Einen winzigen Schluck.
Nein.
Nur einmal nippen, um die Lippen zu benetzen.
Ich tat es, damit er aufhörte, mich zu quälen. Doch er hörte nicht auf, deshalb nippte ich wieder. Ich nahm einen großen Schluck und spürte, wie er brennend durch meine Kehle lief. Es wurde schwerer und schwerer, seinem Drängen zu widerstehen. Er zermürbte meinen Willen. Und Burrich sorgte dafür, dass mein Becher nicht leer wurde.
Fitz, sag: »Veritas lebt.« Das ist alles. Sag nur das.
Nein.
Fühlt sich der Branntwein in deinem Magen nicht gut an? So warm. Trink noch einmal.
»Ich weiß, was du willst. Du willst mich betrunken machen. Damit ich dir gehorche. Aber den Gefallen tue ich dir nicht.« Mein Gesicht war nass von Schweiß.
Burrich und Chade starrten mich beide an. »Er war früher nie einer von den weinerlichen Trinkern«, bemerkte Burrich. »Wenigstens nicht in meiner Gegenwart.« Das schienen sie interessant zu finden.
Sag es. Sag: »Veritas lebt«, dann lasse ich dich in Ruhe. Du hast mein Wort. Nur sag es. Ein einziges Mal. Und wenn du es nur flüsterst. Sag es. Sag es.
Ich blickte auf die Tischplatte. Sehr leise sagte ich: »Veritas lebt.«
»Was?« Burrich beugte sich schnell vor, um mir noch einmal einzuschenken. Doch die Flasche war leer. Er gab mir etwas aus seinem eigenen Becher.
Plötzlich wollte ich den Schnaps. Wollte ihn für mich selbst. Ich nahm den Becher und leerte ihn bis zur Neige, dann stand ich auf. »Veritas lebt«, wiederholte ich. »Er friert, aber er ist am Leben. Und das ist alles, was ich zu sagen habe.« Ich schritt zur Tür, hob den Riegel und ging hinaus in die Nacht. Sie versuchten nicht, mich aufzuhalten.
Burrich hatte recht. Alles war da wie ein Lied, das einem, zu oft gehört, nicht mehr aus dem Sinn geht. Es lief als roter Faden durch meine Gedanken und formte meine Träume. Es drängte sich in mein Bewusstsein und ließ mir keinen Frieden. Aus Frühling wurde Sommer. Alte Erinnerungen fingen an, die neuen zu überlagern. Mein früheres und mein neues Leben begannen sich miteinander zu verflechten. Es gab Erinnerungslücken und Gedächtnisschwächen an den Verbindungsstellen, doch es wurde für mich immer schwerer, die Dinge nicht zu erkennen. Namen hatten wieder Bedeutung und beschworen jeweils ein Gesicht herauf. Philia, Litzel, Zelerita und Rußflocke waren nicht mehr einfach nur Worte, sondern hallten wie Glocken wider in Erinnerungen und Gefühlen. »Molly«, sagte ich schließlich eines Tages laut vor mich hin. Burrich hob ruckartig den Kopf und ließ fast die aus Darm gezwirnte Schlinge los, an der er arbeitete. Ich hörte, wie er Luft holte, als ob er etwas sagen wollte, doch er schluckte die Worte herunter und wartete, ob von mir noch etwas kam. Aber ich schwieg, schloss die Augen, barg das Gesicht in den Händen und sehnte mich nach Vergessen.
Oft und lange stand ich am offenen Fenster und blickte über die Wiesen. Es gab nichts zu sehen, aber Burrich schimpfte mich weder aus, noch scheuchte er mich zurück an meine Arbeit, wie er es früher getan hätte. Eines Tages, als ich auf das fette Weideland hinausschaute, fragte ich Burrich: »Was tun wir, wenn die Schafherden kommen? Wo finden wir dann einen Unterschlupf?«
»Denk nach.« Er hatte ein Kaninchenfell am Boden ausgespannt und schabte Fleisch und Fett von der Haut. »Es werden keine Herden mehr kommen, die man auf die Sommerweide treibt. Das beste Vieh ist mit Edel landeinwärts gegangen. Er hat Bocksburg von allem geplündert, das sich wegschaffen ließ, auf welche Art auch immer. Ich möchte darum wetten, dass sämtliche Schafe, die er in Bocksburg zurückgelassen hat, bereits im Laufe des Winters in den Kochtopf gewandert sind.«
»Wahrscheinlich«, stimmte ich zu. Und dann drängte sich etwas Schreckliches in mein Bewusstsein, schrecklicher als alle verdrängten Erinnerungen. Es war die Flut der Dinge, die ich nicht wusste, und die Flut der unbeantworteten Fragen. Mit einem langen Spaziergang versuchte ich, mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden, und wanderte über die Wiesen bis zum Bach und dann am Ufer entlang zu der sumpfigen Stelle, wo die Binsen wuchsen. Ich pflückte ihre grünen Spitzen, um sie Burrich für den Haferbrei zu geben. Da waren mir plötzlich die Namen sämtlicher Pflanzen wieder geläufig; unwillkürlich wusste ich, welche von ihnen einen Menschen töten konnten und wie sie anzuwenden waren. Das alte Wissen war da und wartete darauf, erneut von mir Besitz zu ergreifen, ob ich das wollte oder nicht.
Als ich mit den Binsenspitzen heimkam, rührte Burrich im Kochtopf. Ich legte sie auf den Tisch und schöpfte aus dem Fass eine Schüssel mit Wasser. Während ich die Binsen säuberte und abzupfte, stellte ich endlich die Frage, die mir am meisten auf der Seele brannte: »Was ist geschehen? In der Nacht damals?«
Burrich drehte sich sehr langsam zu mir um, als wäre ich ein Stück Wild, das man durch eine hastige Bewegung verscheuchen könnte. »In der Nacht damals?«
»Die Nacht, in der König Listenreich und Kettricken aus Bocksburg fliehen sollten. Weshalb standen die Pferde und die Sänfte nicht bereit?«
»Oh, die Nacht.« Er seufzte, als erinnerte er sich an einen alten Schmerz, dann begann er sehr langsam und sehr ruhig zu sprechen, als hätte er Angst, mich zu erschrecken. »Sie haben uns beobachtet, Fitz. Die ganze Zeit. Edel wusste alles. Ich hätte nicht einmal einen Strohhalm aus dem Stall schmuggeln können, geschweige denn drei Pferde, eine Sänfte und ein Maultier. Überall lungerten Soldaten aus Farrow herum, die den Anschein zu erwecken suchten, sie wären nur gekommen, um die leeren Boxen zu inspizieren. Ich wagte nicht, zu dir zu gehen und dir Bescheid zu geben. Also wartete ich, bis das Fest in vollem Gange war, Edel sich die Krone aufgesetzt hatte und sich als Sieger fühlte. Dann schlich ich mich davon und holte die einzigen beiden Pferde, die ich auftreiben konnte, Rußflocke und Rötel. Ich hatte sie in der Schmiede untergestellt, damit Edel sie nicht ebenfalls verhökern konnte. Der einzige Proviant, den ich auftreiben konnte, stammte aus der Wachstube. Etwas Besseres wollte mir nicht einfallen.«
»Und Königin Kettricken und der Narr sind entkommen.« Die Namen gingen mir seltsam zögernd über die Lippen. Ich wollte nicht an sie denken, mich überhaupt nicht an sie erinnern. Als ich den Narren das letzte Mal gesehen hatte, hatte er geweint und mir vorgeworfen, ich sei der Mörder seines Königs. Auf mein Betreiben war er anstelle des Königs geflohen, um sein Leben zu retten. Es war nicht die beste Erinnerung an den Abschied von jemandem, den ich meinen Freund genannt hatte.
»Ja.« Burrich stellte den Topf auf den Tisch, um den Haferbrei quellen zu lassen. »Chade und der Wolf führten sie zu mir. Ich hätte sie gern begleitet, aber es wäre unklug gewesen. Ich hätte sie nur aufgehalten. Mein Bein … Ich hätte nicht lange Schritt halten können, und zwei Reiter zu tragen, bei dem Wetter, hätte die Pferde ermüdet. Ich musste sie allein auf den Weg schicken.« Schweigen. Dann knurrte er grimmig: »Wenn ich je herausfinde, wer uns an Edel verraten hat …«
»Ich war’s.«
Er starrte mich an, und auf seinem Gesicht zeichneten sich Entsetzen und Unglauben ab. Ich senkte den Blick auf meine Hände. Sie begannen zu zittern.
»Ich war unvorsichtig. Es war mein Fehler. Die kleine Zofe der Königin, Rosmarin. Allgegenwärtig und überall dabei. Sie muss Edels Spitzel gewesen sein. Sie hörte, wie ich der Königin sagte, sie solle sich bereithalten, König Listenreich werde sie begleiten. Sie bekam mit, wie ich Kettricken riet, für warme Kleidung zu sorgen. Daraus konnte Edel schließen, dass sie vorhatte, aus Bocksburg zu fliehen. Er wusste, dass sie Pferde brauchen würde. Und vielleicht war jene kleine Rosmarin noch zu anderem als zu Spitzeldiensten zu gebrauchen. Vielleicht war sie es, die einer alten Frau einen Korb mit vergifteten Leckereien brachte. Vielleicht strich sie Fett auf die Stufen einer Treppe, von der sie wusste, dass ihre Königin sie bald hinuntergehen würde.« Ich zwang mich, von den Binsen aufzuschauen und Burrichs verstörtem Blick zu begegnen. »Und was Rosmarin nicht hörte, erfuhren auf ihre Weise Justin und Serene. Sie hafteten wie Blutegel am Bewusstsein des Königs, saugten ihm die Kraft der Gabe aus und waren Mitwisser jeder Botschaft, die er zu Veritas dachte oder von ihm erhielt. Sobald sie wussten, dass ich dem König als Mittler diente, fingen sie an, auch meine Gedanken zu belauschen. Ich war völlig ahnungslos, dass so etwas möglich war. Doch Galen hatte eine entsprechende Methode entdeckt und seine Schüler darin unterrichtet. Du erinnerst dich an Will, den Sohn des Schankwirts? Mitglied der Kordiale? Er war ein Meister darin. Er brachte es fertig, sich in seinem Opfer einzunisten, ohne dass es etwas davon bemerkte.«