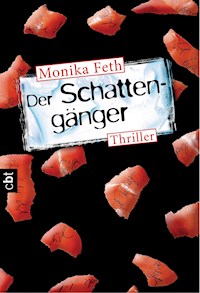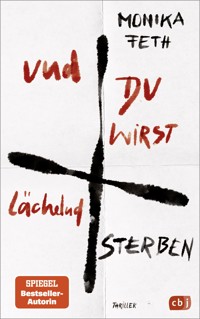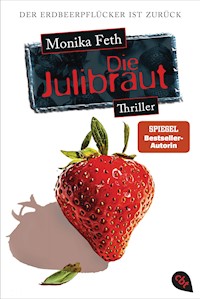SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Erdbeerpflücker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jettes Freundin Caro fällt in die Hände eines Serienmörders, der seinen Opfern die Haare abschneidet. Auf der Beerdigung schwört Jette, Caros Mörder zu finden. Damit weckt sie dessen Neugier und er sucht ihre Nähe. Jette verliebt sich in ihn. Zu spät erkennt sie, mit wem sie es zu tun hat.
Die fulminante Spiegel-Bestsellereihe von Monika Feth begeistert Millionen Leser:innen. Die Jette-Thriller sind nervenzermürbend, dramatisch und psychologisch brilliant erzählt. Atemberaubende Spannung der Extraklasse!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2008
4,5 (182 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Copyright
DIE AUTORIN
Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren. Nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium arbeitete sie zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in einem kleinen Dorf in der Voreifel, wo sie für Jugendliche, Erwachsene und Kinder schreibt.
»Der Erdbeerpflücker« und die Folgebände, »Der Mädchenmaler« und »Der Scherbensammler«, wurden zum Sensationserfolg und machten Monika Feth über die Grenzen des Jugendbuchs bekannt.
Weitere lieferbare Titel von Monika Feth bei cbt:
Der Mädchenmaler (30193)
Der Scherbensammler (30339)
Das blaue Mädchen (30207)
Fee - Schwestern bleiben wir immer (30010)
Nele oder Das zweite Gesicht (30045)
Die Presse über die »Erdbeerpflücker«-Thriller:
»Jugendliche Krimileser mit einer Vorliebe für realistische Alltagsschilderungen und psychologischen Hintergrund, wie wir sie in den Krimis aus Skandinavien kennen, finden in diesem Roman alles, was auch in Krimis für Erwachsene fasziniert: außergewöhnliche
Charaktere und einen Spannungsbogen, der... fesselt.« Süddeutsche Zeitung
»Keine billigen Effekte, einfach gut geschrieben und zum sofortigen Verschlingen geeignet.« Saarbrücker Zeitung
Ich danke
... Gerhard Klockenkämper, dessen großes Fachwissen mir bei meinen Recherchen sehr geholfen hat,
... meinem Mann für sein allzeit offenes Ohr,
... unserem Sohn dafür, dass er ist, wie er ist,
... dem Dorf, in dem wir leben, für seine Atmosphäre,
... den Erdbeerpflückern des vergangenen Sommers für die Inspiration.
Monika Feth
1
Es war einer dieser Tage, an denen man die Hitze riechen konnte. Die von der Sonne verbrannte Haut. Den Schweiß, der aus sämtlichen Poren trat, sobald man sich bewegte. Einer dieser Tage, die ihn kribblig machten und gereizt. An denen man ihm besser nicht in die Quere kam.
Die andern hatten sich allmählich daran gewöhnt. Sie ließen ihn in Ruhe arbeiten, sprachen ihn nicht an, dämpften sogar die Stimme, wenn er an ihnen vorbeiging.
Er konnte nicht verstehen, dass es Menschen gab, die immerzu redeten. Sie machten keinen Unterschied zwischen Wichtigem und Unwichtigem, überschütteten einfach alles mit ihren kleinen, dummen, aufgeregten Worten. Schon als Kind hatte er gelernt, sich dagegen zu wappnen, indem er sich in sich selbst zurückzog. Er liebte es zu sehen, wie die Lippen seines Gegenübers sich bewegten, ohne dass auch nur ein Ton seine Ohren erreichte. Wie ein Fisch, dachte er dann. Wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Früher hatte er für solche Rückzüge Schläge kassiert. Heute merkte niemand mehr, dass er abgetaucht war. Die meisten Menschen waren armselig und dumm wie ihre Worte.
Noch eine Stunde, dann würde es Mittagessen geben. Er würde das rasch hinter sich bringen und sich wieder an die Arbeit machen.
Er wusste, wohin diese Unruhe ihn brachte, wenn er sich nicht ablenkte. Was passierte, wenn seine Hände anfingen zu zittern. Wie jetzt.
Oh Gott. Er unterdrückte ein Stöhnen. Zwei Frauen drehten sich nach ihm um. Er kannte sie kaum. Finster starrte er sie an. Sie senkten den Blick und wandten ihm wieder den Rücken zu.
Die Sonne am Himmel war ein einziges Gleißen.
Brenn mir diese Gedanken aus dem Leib, dachte er. Bitte! Und diese Gefühle!
Aber die Sonne war nur die Sonne.
Sie hatte nicht die Kraft, ihm Wünsche zu erfüllen.
Diese Kraft hatte nur eine Fee.
Jung. Schön. Und unschuldig. Das vor allem.
Und nur für ihn auf der Welt.
Der Fahrtwind fächelte den Duft nach frischen Erdbeeren ins geöffnete Fenster. Und die Hitze, die in diesem Jahr viel zu früh gekommen war. Der Rock klebte mir an den Beinen. Auf meiner Oberlippe standen Schweißperlen. Ich liebte meinen alten, klapprigen Renault mit seinen Macken, aber an manchen Tagen sehnte ich mich heftig nach einem jüngeren Modell mit Klimaanlage.
Nach der Kurve konnte ich sie sehen - die Erdbeerpflücker auf den Feldern, wie sie sich über die Pflanzen beugten oder vorsichtig zwischen ihnen entlanggingen, gefüllte Kisten auf den Armen balancierend. Sie erinnerten mich an baumwollpflückende Sklaven. Bunte Tupfer auf der weiten grünen Fläche, braun gebrannt von der Sonne.
Sie waren Saisonarbeiter, viele von ihnen aus Polen, viele von anderswo, viele aus den entlegensten Winkeln Deutschlands, die letzten Abenteurer, eine alljährliche Invasion, vor der die Dorfbewohner Türen und Fenster verschlossen.
Abends trafen sich die fremden Frauen und Männer, die Jungen und Mädchen am Brunnen, dem Mittelpunkt des Dorfs, tranken, rauchten, redeten, lachten. Sie hielten sich abseits, grüßten die Nachbarn nicht, lächelten ihnen nicht mal zu.
Es stimmte schon mit manchen Sprichwörtern. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Die Dorfbewohner hatten Misstrauen gesät und ernteten nun die Zurückhaltung, die sie verdienten.
Ich fuhr die lange, gewundene Auffahrt zum Haus hinauf. Der weiße Kies knirschte unter den Reifen. Wie im Film, dachte ich. Alles viel zu perfekt, viel zu gut, um wahr zu sein. Was, wenn ich aufwachte und feststellte, dass ich nur träumte?
Sobald man sich dem Haus näherte, konnte man das Geld förmlich riechen, das hier in jedem Detail steckte. Die ehemalige Wassermühle war sorgfältig und kostspielig restauriert worden. Selbst den Bachlauf hatte der Architekt in die Innenausstattung mit einbezogen, indem er ihn angezapft und in einer schmalen Rinne durch die Eingangshalle geführt hatte.
Die Sonne spielte auf dem zweihundert Jahre alten roten Backstein, ließ den Kiesbelag erstrahlen und brach sich in der Glasfront des Anbaus, der aussah wie von einem Science-Fiction-Autor erdacht.
Das Haus meiner Mutter. Seine Schönheit fesselte mich bei jedem Besuch aufs Neue.
Ich schloss die Tür auf und betrat die Halle. Eine wohl tuende Kühle empfing mich. Und unser Kater Edgar, der seinen Namen der simplen Tatsache verdankt, dass meine Mutter die Geschichten von Edgar Allan Poe vergöttert.
Ich hob ihn auf und knuddelte ihn, wobei enorm viele Haare auf den Boden rieselten. Konnte es sein, dass er immer noch Winterfell verlor? Ich setzte ihn wieder ab und er leckte sich die Flanke und stolzierte vor mir her zur Treppe.
Auch im Innern des Hauses war alles erlesen und kostbar, von kundiger Hand zusammengestellt. Die Sonne warf ihr weiches Nachmittagslicht durch die hohen Fenster der Halle und brachte das Holz der Treppe zum Leuchten. Die Rattansessel auf dem Terrazzoboden weckten Sehnsucht nach Italien, ebenso die karg getünchten weißen Wände und die runden, mönchischen Nischen der Fenster.
Allein die Treppe war ein Kunstwerk für sich. Die Stufen schienen förmlich in der Luft zu schweben. Der Schreiner, der sie gebaut hatte, war dafür bekannt, dass er sich immer für ein Minimum an Material und ein Maximum an Wirkung entschied. Mit Erfolg. Es war übrigens mit allem hier so. Mit jedem Zimmer und jedem Einrichtungsgegenstand. Meine Mutter hatte grundsätzlich das Beste gewählt. Und das Teuerste. Sie konnte es sich leisten.
Am Ende der Treppe angelangt, durchquerte Edgar schnurstracks die obere Halle. Er wusste, dass mein erster Weg mich stets zu meiner Mutter führte.
Aus ihrem Zimmer drangen keine Geräusche. Vielleicht war sie eingeschlafen. Vorsichtig öffnete ich die Tür.
Meine Mutter saß an ihrem Schreibtisch vor einem Stapel Papier, die Lesebrille auf der Nase. Sie drehte sich zu mir um und lächelte. »Jette! Wie schön!«
Meine Mutter ist Schriftstellerin. Krimiautorin, um genau zu sein. Sie schreibt für die schwarze Reihe des Piepenbrink Verlags, und das äußerst erfolgreich.
Seit sie dem, was meine Großmutter und ihr Damenzirkel so unter echter Literatur verstehen, den Rücken gekehrt hat, verkaufen sich ihre Bücher wie warme Semmeln. Sie sind inzwischen in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt worden und um die Filmrechte reißen sich die Produktionsfirmen.
»Setz dich einen Augenblick. Bin gleich fertig.«
Man darf meine Mutter jederzeit und bei allem stören, nur nicht beim Notieren eines Einfalls oder beim Skizzieren einer Idee. Ich hatte mich längst daran gewöhnt und nahm es ihr nicht mehr übel. Früher war das anders gewesen. Es war mir immer so vorgekommen, als wären ihr die Worte wichtiger als ich.
Edgar war schon auf das Sofa gesprungen und wartete darauf, dass ich mich setzte. Er rollte sich auf meinem Schoß zusammen, schloss die Augen, schnurrte und bohrte mir zärtlich die Krallen in den Oberschenkel.
Ich kann mich noch an das Leben vor dem Erfolg meiner Mutter erinnern. Damals wohnten wir in einem Reihenhaus in Bröhl. Die Vorgärten sahen aus wie gut gepflegte Familiengräber, bepflanzt mit Nadelsträuchern, Rhododendren und einjährigen Pflanzen. Hier und da gluckerte Wasser über sauber gebürstete Quellsteine in ein Seerosenbecken mit einer Hand voll fetter Goldfische.
Im Souterrain, hinter von Efeu umspielten Fenstern, hatte mein Vater sein Büro. Rechts neben der Haustür hing, etwa in Augenhöhe, ein Messingschild mit der Aufschrift: Theo Weingärtner. Steuerberater. Das Schild war blank geputzt. Viele Kundinnen meines Vaters überprüften darin ihr Make up, bevor sie auf den Klingelknopf drückten.
Wir hatten eine Putzhilfe, die zweimal wöchentlich das Haus umkrempelte, und einmal pro Monat kam ein Fensterputzer. Meine Mutter schrieb und schrieb.
Ihr liebstes Betätigungsfeld neben ihrem Arbeitszimmer im ersten Stock war der Garten, der aussah wie ein Paradebeispiel für eine Hochglanzausgabe von Homes & Gardens, mit genau der richtigen Mischung aus gepflegten und verwilderten Ecken, die bei den Gartenzeitschriften gerade in Mode ist.
Meine Mutter pflegte ihre Schreibkrisen bei der Gartenarbeit auszukurieren. Vielleicht hätte sie es hin und wieder vorgezogen, ein Problem mit meinem Vater zu besprechen, statt es in der Erde zu verbuddeln oder an Spalieren festzubinden, doch er konnte den Konflikten, die meine Mutter auf dem Papier entstehen ließ, und der Sprache, mit der sie das tat, kein Interesse abgewinnen.
Wenn er über den Beruf meiner Mutter sprach, was selten vorkam, dann bezeichnete er ihn als Schreiberei und meine Mutter nannte er eine Schreiberin. Er tat das mit einem freundlichen Augenzwinkern, das man ihm nicht glaubte. Schriftstellerin oder Autorin brachte er nicht über die Lippen, denn das hätte bedeutet, dass er ihren Beruf ernst nahm.
Sein Verhalten änderte sich auch dann nicht, als meine Mutter in den ersten Talkshows auftauchte und Journalisten unser Haus für Fotoreportagen und Kurzfilme mit ihr auf den Kopf stellten.
Die Abrechnungen des Verlags jedoch nötigten selbst meinem Vater Respekt ab. Extras wurden davon angeschafft, der neue BMW, eine moderne, zweckmäßigere Einrichtung für das Büro meines Vaters, ein neuer Computer für meine Mutter, der lang ersehnte Wintergarten.
Das Schreiben meiner Mutter hatte mit unserem täglichen Leben wenig zu tun. Es geschah wie nebenbei, ohne dass wir viel davon mitbekamen.
Irgendwann tauchte sie dann mit der Bemerkung in der Küche auf, sie habe das neue Manuskript fertig. Einige Wochen später kam ihre Lektorin und sie setzten sich in den Wintergarten und besprachen das Manuskript und verteilten die Blätter überall, sodass es schwierig war, hin und her zu gehen, ohne ein heilloses Durcheinander zu verursachen.
Wieder später brachte der Postbote die Korrekturfahnen, den Entwurf des Umschlagbilds und irgendwann das fertige Buch.
Meine Mutter braucht das Schreiben. Um den Alltag auszuhalten, wie sie es ausdrückt. Das war schon immer so. Vielleicht brauchte sie das Schreiben damals noch nötiger, weil sie neben dem Alltag an sich auch noch meinen Vater aushalten musste.
Er mag keine Überraschungen und bastelt an dem perfekten Leben in einem perfekten Zuhause und einem perfekten Beruf. Manchmal kommt er mir vor wie der Bewohner einer überdimensionalen Puppenstube, wo nichts jemals verrückt wird, wo alles hübsch an seinem Platz bleibt.
Meine Mutter dagegen ist von Natur aus chaotisch. Bestimmt waren ihr Puppenstuben schon als Kind ein Gräuel und es war nur folgerichtig, dass sie die Pflege des Hauses anderen überließ.
Mehr und mehr wandte sie sich dem Garten zu. Er war ihr eigenes, überschaubares, eingegrenztes Universum, in dem sie schalten und walten konnte, wie sie wollte. Erfolge zeigten sich unübersehbar, Fehler konnten leicht korrigiert werden.
Ebenso war es mit dem Schreiben. Meine Mutter war fähig, eine komplexe Welt zu erschaffen, in der sie allein Macht über die Figuren und ihr Schicksal hatte. Menschen wurden geboren, Menschen starben, und es war meine Mutter, die an den Fäden zog.
Das fand hinter der geschlossenen Tür und in der Stille ihres winzigen Arbeitszimmers statt. Manchmal erzählte sie davon und ihre Augen schienen Funken zu sprühen. Doch meistens behielt sie ihre Schreiberlebnisse für sich und wir sprachen über andere Dinge.
Eine Illustrierte bezeichnete meine Mutter einmal als eine vom Schreiben besessene Frau, die es gelernt habe, ihre Sucht gut zu verbergen. Der das Leben zu wenig sei. Die sich in ihren Geschichten ein anderes Leben erfinde.
Ein anderes Leben. Vielleicht hätte mein Vater sie dorthin begleiten können, wenn er gewollt hätte. Aber er wollte nicht.
Und ich? Mich hat keiner gefragt.
Meine Mutter flüchtete sich auch in Lesereisen. Wochenlang war sie unterwegs, rief mich aus München an, aus Hamburg, Zürich und Amsterdam. Neben unserem Telefon lag ständig eine Liste der Hotels, in denen sie sich gerade befand. Mama: erreichbar unter...
Für die Dauer ihrer Abwesenheit verwandelte sich unsere Putzhilfe in eine Haushälterin, die von früh bis spät bei uns war und sämtliche Arbeiten erledigte, die anfielen. Sie kochte auch für uns, deftige Hausmannskost, die meinem Vater mit der Zeit zehn Kilo Übergewicht bescherte.
Meine Mutter wurde bekannt. In der Schule bekam ich allmählich einen Sonderstatus. Selbst manche Lehrer starrten mich ehrfürchtig an. Ich begann, Autogramme meiner Mutter zu verhökern, und verdiente ziemlich gut dabei.
Abends, sobald die Schatten in den Zimmern unruhig wurden, vermisste ich meine Mutter. Nicht, dass ich sie mir immer zu Hause gewünscht hätte. Im Gegenteil. Ich war nur daran gewöhnt, sie zu hören, wenn sie die Treppe rauf- oder runterlief. Wenn sie sich eine Stelle aus einem Manuskript halblaut vorlas. Wenn sie telefonierte. Ich vermisste auch den Duft ihres Parfüms, der wie ein unsichtbarer Schleier in einem Zimmer lag, in dem sie sich aufhielt oder das sie eben verlassen hatte.
Wir wurden reich. Meine Eltern kauften die alte Wassermühle in Eckersheim mit zwanzigtausend Quadratmetern Grund, idyllisch im Landschaftsschutzgebiet gelegen, und engagierten einen bekannten Architekten für die Renovierungs- und Umbauarbeiten. Mein Vater, der eine Villa am Stadtrand von Bröhl vorgezogen hätte, sich aber nicht durchsetzen konnte, stellte eine Sekretärin ein.
Sie hieß Angie und sah auch so aus, Mitte dreißig, aschblonder Pferdeschwanz, die Finger voller Ringe, die Röcke zu kurz und zu eng. Meine Mutter verbrachte jede freie Minute auf der Baustelle, mein Vater hatte keine freien Minuten mehr, weil er sich mit Angie in der Arbeit vergrub.
Ich pendelte irgendwo dazwischen, trieb mich herum, vernachlässigte die Schule und wurde mit einem Schlag erwachsen. Damals war ich fünfzehn.
Ein Jahr später ließen meine Eltern sich scheiden. Mein Vater zog nicht mit uns in die fertige Mühle ein. Er blieb im alten Haus, zusammen mit Angie, die schwanger war.
»So.« Meine Mutter nahm die Brille ab. »Du kommst gerade recht. Ich lechze nach einem Kaffee. Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?«
»So viel du willst. Und ich stör dich wirklich nicht?«
Sie legte den Stift weg. »Doch. Aber genau im richtigen Moment. Ich komme nämlich gerade nicht weiter. Den Computer hab ich längst ausgemacht. Weißt du, wie das ist, wenn man den letzten Satz anstarrt wie das Kaninchen die Schlange, und auf einmal stellt man fest, dass eine ganze Stunde vergangen ist?«
Meine Mutter wartete die Antwort nicht ab. Rhetorische Fragen sind ihre Spezialität. Sie stand auf, beugte sich zu mir herunter und gab mir einen Kuss.
Ihr Parfüm war mir so vertraut wie ihre Stimme oder die Wärme ihrer Haut. Calypso. Sie nahm nie ein anderes. Es war leicht und frisch und duftete nach Sommer. Meine Mutter ließ es sich in einer Parfümerie mischen. Der Duft wurde eigens für sie zusammengestellt und sie selbst hatte ihm den Namen gegeben.
Die einzige Extravaganz, die sie sich erlaubte, seit sie eine reiche Frau war, außer, dass sie ein kleines Vermögen für ungewöhnliche Ringe, Ketten und Armbänder ausgab, die sie dann nicht trug, weil sie sie zu auffällig fand.
»Stimmt was nicht?« Sie fuhr sich über das kurz geschnittene schwarze Haar, das von silbrig grauen Fäden durchsetzt war.
»Im Gegenteil.« Ich lächelte. »Du siehst klasse aus. Wie immer.«
Sie nahm mich am Arm und zog mich aus dem Zimmer. »Du auch.«
Das war eine glatte Lüge. Aber vielleicht merkte sie nicht mal, dass sie mich belog. Vielleicht belog sie sich selbst. Redete sich ein, dass ich schön sei. Ihr Ebenbild.
Doch das bin ich nicht. Und wollte es auch nie sein. Gegen keine Schönheit der Welt würde ich meine Einzigartigkeit eintauschen, selbst wenn sie nichts Besonderes ist. Ich bin ich selbst und das ist mehr, als manche von sich behaupten können.
Wir gingen nach unten. Sonnenflecken hatten sich auf dem Küchenboden ausgebreitet. Auf dem größten aalte sich Molly, unsere Katze, schwarzweiß wie die Schachbrettfliesen. Molly, die ihren stinknormalen, durch nichts und niemanden inspirierten Namen allein mir verdankt, begrüßte mich mit einem hellen Miauen, erhob sich und strich mir um die Beine. Dann verschwand sie mit Edgar durch die weit geöffnete Terrassentür in den Garten.
Meine Mutter machte uns Kaffee an dem schon etwas betagten Espressoautomaten. Mir fiel wieder auf, wie sehr sie allmählich meiner Großmutter ähnlich wurde. Sie ärgerte sich oft darüber, denn Großmutter und sie sind wie Feuer und Wasser und nichts scheint daran etwas ändern zu können.
»Wie kommst du mit dem neuen Buch klar?«, fragte ich und setzte mich auf die Tischkante, die warm war von der Sonne.
»Es wird mich Jahre meines Lebens kosten.« Meine Mutter bringt es locker fertig, die theatralischsten Sätze mit den banalsten Handgriffen zu verbinden. Konzentriert stellte sie Kaffeetassen, Zucker und eine Schale mit Orangenplätzchen auf ein Tablett, das ich noch nicht kannte oder aber noch nie wahrgenommen hatte, und trug alles auf die Terrasse hinaus. »Ich konnte besser schreiben, als du noch hier gewohnt hast. Mir fehlt die ruhige Regelmäßigkeit, die unser Leben hatte.«
»Und ich fehle dir nicht?«
Die Worte waren kaum heraus, da bereute ich sie schon. Machte es mir etwa immer noch etwas aus, ein eher unbedeutender Bestandteil im Leben meiner berühmten Mutter zu sein? Tat es mir immer noch weh, dass sie mich im Grunde nicht brauchte? Dass ihr jede Tochter recht gewesen wäre, beliebig und austauschbar?
»Vergiss es.« Ich wischte meine Frage mit einer Handbewegung beiseite. »War nicht ernst gemeint.«
Verletzt sah sie mich an.
»Kannst du dir diese Überempfindlichkeit nicht endlich abgewöhnen, Jette?«
Und das ausgerechnet von ihr! Wo man sich mit meiner Mutter stundenlang um eine Silbe streiten konnte.
Ich ließ mich auf einen der Gartenstühle fallen, lehnte mich zurück und atmete tief ein. Wenn ich es jemals bereuen sollte, nicht mehr hier zu wohnen, dann nur wegen dieser Landschaft. Der Blick ging über buckliges Land, auf dem die Schafe eines benachbarten Bauern weideten. Hier und da stand ein trotziger, krummer Obstbaum wie vergessen im Gras.
Niemand hatte diese Landschaft angerührt. Auch meine Mutter war dankenswerterweise nicht auf die absurde Idee verfallen, hier einen parkähnlichen Garten anzulegen oder anlegen zu lassen. Wie ich hatte sie den Zauber gespürt und ihn nicht angetastet.
Das Rauschen des Bachs machte die Idylle komplett. Ich verschränkte die Hände hinterm Kopf und schloss die Augen.
»Wann bist du wieder unterwegs?«, fragte ich.
Meine Mutter wartete mit der Antwort, bis ich die Augen öffnete. »Nur zu ein paar Einzellesungen. Du weißt doch, dass ich das Sommerloch immer zum Schreiben nutze.«
Sommerloch. Alles kreiste um ihr Schreiben. Sogar die Jahreszeiten. Seit sie sich von meinem Vater getrennt hatte, war das Schreiben noch wichtiger geworden. Als wäre es ein Schutz vor der Welt, dem Alleinsein oder den Gefühlen.
Ich sah meine Mutter genauer an. Und wenn ihr ganzes erlesenes Äußeres nur Fassade war? Ein perfekter Panzer? Ich spürte ihre nervöse Energie. Sie schien förmlich über den Tisch zu fließen. So war sie immer am Anfang eines neuen Buchs. Fuhr ihre Tentakel aus, tastete jeden Menschen ab, jedes Wort, jedes Geräusch, jeden Klang und jeden Geruch.
In solchen Augenblicken hatte es keinen Sinn, ihr irgendwas zu erzählen, denn sie war zwar körperlich anwesend, aber ihre Gedanken waren ganz woanders.
»Es ist eigenartig mit diesem Roman«, sagte sie zögernd. »Ich hab meinen Helden noch nicht gefunden. Dabei ist das erste Kapitel schon fertig.«
Ich nickte, weil ich nicht wusste, was ich darauf erwidern sollte. Allerdings erwartet meine Mutter meistens auch keine Antwort, wenn sie von Problemen bei der Arbeit erzählt. Sie denkt dann einfach nur laut und benutzt ihr Gegenüber wie einen Spiegel.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Klügste im ganzen Land?
Nein. Das war das falsche Märchen. Ich hatte kein Talent zu einem Schneewittchen. An einem einzigen vergifteten Satz könnte ich ersticken.
Schweigend tranken wir unseren Kaffee.
»Und warum bist du gekommen?«, fragte meine Mutter.
Gute Frage. Warum war ich gekommen? Vielleicht hatte ich es gewusst, doch inzwischen hatte ich es vergessen.
Die Tote lag unbekleidet im Unterholz. Sie lag auf dem Rücken. Die Arme hingen an ihrem Körper herab. Ihr rechtes Bein war leicht angewinkelt, das linke ausgestreckt.
Man hatte ihr die Haare abgeschnitten. Eine lose Strähne hatte sich an ihrer Schulter verfangen, andere waren weggeweht worden und hatten sich um Pflanzenstängel gewickelt oder an die raue Rinde von Bäumen geschmiegt.
Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten in den Himmel. Als wäre sie im Moment des Sterbens vor allem erstaunt gewesen.
Es waren Kinder, die sie fanden. Ein Junge und ein Mädchen, Geschwister, der Junge zehn, das Mädchen neun Jahre alt. Die Eltern hatten ihnen verboten, im Wald zu spielen. Sie hatten es trotzdem getan. Und waren entsetzlich dafür bestraft worden. Mit einem Anblick, den sie ihr Leben lang nicht vergessen würden.
Schreiend rannten sie davon. Schreiend stolperten sie über Wiesen und Weiden, kletterten über Zäune, krochen unter Stacheldraht hindurch. Als sie über den Hof der Ziegelei abkürzen wollten, wurden sie von einem Arbeiter aufgehalten. Er hörte sich an, was sie unter Schluchzen und Wimmern hervorbrachten, rief die Polizei und begleitete die Kinder ins Büro, wo ihnen die Sekretärin einen Kakao machte und die Mutter verständigte.
Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Toten um ein achtzehnjähriges Mädchen handelte. Dass sie vergewaltigt worden war. Man fand sieben Einstiche an ihrem Körper, von denen schon der erste, der direkt ins Herz getroffen hatte, tödlich gewesen war.
Die Tote stammte aus Hohenkirchen, einem Nachbarort von Eckersheim, eine Schülerin, die noch bei ihren Eltern gewohnt hatte. Einer der Beamten der Schutzpolizei, die am Fundort gewesen waren, hatte sie identifizieren können. Und da er die Eltern kannte, hatte er sich bereit erklärt, ihnen die Nachricht zu überbringen.
Die Mutter brach an der Tür zusammen. Ihr Mann führte sie zum Sofa im Wohnzimmer und legte ihr eine Decke über die Beine. Dann schlug er dem Polizisten auf die Schulter und bot ihm einen Schnaps an.
So etwas taten Menschen unter Schock. Sie taten die seltsamsten Dinge. Einmal hatte der Beamte eine Frau erlebt, die bei der Nachricht vom Unfalltod ihres Mannes in die Küche gegangen war, sich kalte Hühnersuppe auf einen Teller gefüllt und dann mit einer Gier gegessen hatte, als sei sie schon lange nicht mehr satt geworden.
Der Name des Mädchens war Simone. Simone Redleff. Der ganze Ort nahm an ihrer Beisetzung teil. Es war die größte Beerdigung, die man in Hohenkirchen je erlebt hatte.
Der komplette zwölfte Jahrgang der Schule erschien. Die Mädchen hielten Taschentücher vor den Mund gepresst, die Jungen wischten sich die Tränen verstohlen mit dem Handrücken ab. Alle standen noch unter Schock. Der Tod war zu plötzlich gekommen, zu unerwartet. Doch das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war seine furchtbare, ausweglose Gewalttätigkeit.
Man hatte oft von solchen Gräueltaten gehört, aber nur von fern. Wenn so etwas einem aus ihrer Mitte zustoßen konnte, schienen die Leute zu denken, wo waren sie dann noch sicher?
In der Trauerhalle spielten sie Popsongs, die eine Freundin der Toten ausgesucht hatte. Die Melodien erfüllten den Raum mit den flackernden Kerzen und den nach Tod riechenden Blumen mit einer verzweifelten Traurigkeit.
Draußen schien die Sonne, als sei nichts geschehen.
Aber nichts würde mehr sein wie zuvor.
Der Mord an der achtzehnjährigen Simone Redleff hat, wie Hauptkommissar Bert Melzig von der Kriminalpolizei Bröhl bei der Pressekonferenz erklärte, große Ähnlichkeit mit zwei Morden, die vor einem Jahr in den norddeutschen Städten Jever und Aurich an jungen Mädchen begangen wurden. Beide Morde wurden bislang noch nicht aufgeklärt. Nähere Angaben wollte Melzig, um die Ermittlungsarbeiten nicht zu stören, nicht machen.
Er war hundemüde. Trotzdem schlief er lange nicht ein. Er liebte diese Halbträume, die zwischen Schlaf und Wachen zu ihm kamen und ihn beschäftigten, aber er hasste und fürchtete sie auch. Im Augenblick fürchtete er sie.
Krampfhaft bemühte er sich, an etwas anderes zu denken.
Es gelang ihm nicht. Wie Bumerangs kehrten die Bilder zu ihm zurück.
Er spürte die Erregung noch immer. Es gab kein Gefühl, das nur annähernd so stark war.
Mädchen, dachte er, warum hast du mich getäuscht?
Sie war nämlich bei genauem Hinsehen überhaupt keine Fee gewesen. Nicht einmal wirklich schön. Ihre Stimme hatte vor Angst piepsig geklungen wie die eines Vogels. Das hatte ihn rasend gemacht. Er hasste dünne Stimmen, denen man die Furcht anhörte.
Und er hasste Angstschweiß.
Ihre Hände waren ganz glitschig gewesen.
Nicht, dass er tatsächlich an Feen geglaubt hätte. Er war ja kein Kind mehr. Außerdem hätte eine Fee mehr Macht, als ihm lieb sein konnte.
Sie sollte sein wie eine Fee. Wie die Fee in dem Märchenbuch, das er als Kind besessen hatte. Schlank. Mit weichem, glänzendem Haar.
Schön.
Große Augen. Die Wimpern lang.
Einzelheiten sah man nicht von weitem. Die erkannte man erst, wenn man sich auf einen halben Meter gegenüberstand. Und dann war es meistens schon zu spät. Immer entdeckte er eine Überraschung, auf die er nicht gefasst war. Schon ein Leberfleck an der falschen Stelle konnte das Bild zerstören.
Die in Jever hatte nach Rauch gerochen. Sie hatte ihm sogar eine Zigarette angeboten! Sie hatte kokett gelacht, den Kopf in den Nacken gelegt und den Rauch in die Luft geblasen und nicht geahnt, dass sie ihr Todesurteil längst unterzeichnet hatte.
Stöhnend drehte er sich auf die andere Seite. Er war froh, dass er sich ein Zimmer in dem kleinen Gasthof gemietet hatte und nicht mit den andern beim Bauern wohnte. Das Zimmer war klein und hässlich und hatte an Stelle eines Bads eine so genannte Nasszelle, die so eng war, dass er sich darin kaum rühren konnte. Es lag unterm Dach und war abends aufgeheizt von der Sonne. Aus dem Fenster sah man auf den Kamin des Nachbardachs. Aber die Miete war erschwinglich, und er musste nicht auf seine Freiheit verzichten.
Vor allem konnte er gefahrlos träumen.
Seine Träume waren nicht für Mehrbettzimmer geschaffen. Die Unruhe, die ihn oft schweißgebadet aufschrecken ließ, war nur schwer zu verbergen. Er durfte auch nicht riskieren, im Schlaf zu reden.
Nein, das hier war schon besser. Nahezu perfekt.
Wenn er nur endlich einschlafen könnte.
Er brauchte seinen Schlaf, um die Tage durchzustehen. Die Fassade zu wahren. Natürlich hatten die Bullen auch bei den Erdbeerpflückern herumgeschnüffelt. Und sie würden wiederkommen. Sobald sie einen Anhaltspunkt hätten.
Er drehte sich auf den Rücken und verschränkte die Hände hinterm Kopf.
Aber sie würden nichts finden.
Sie würden ihn nicht kriegen.
Das hatten sie nie geschafft.
Er lächelte in die Dunkelheit.
Und war bald darauf eingeschlafen.
2
Nach der Schule fuhr ich auf direktem Weg nach Hause. Ich hatte keine Lust, noch mit dem Physikkurs im Eiscafé herumzuhängen. Auf einmal war mir der Gedanke gekommen, dass ich das Leben vielleicht zu oft an den falschen Stellen gesucht hatte.
Irgendwie war ich aus der Schulzeit herausgewachsen. Eigentlich hätte ich in diesem Jahr mein Abi gemacht. Ich bereute es inzwischen sehr, in der Elften eine Ehrenrunde gedreht zu haben. Die Stundenpläne, die Klausuren, der Geruch nach Kreide, Schwamm und Schweiß, die ewig gleichen Gesichter, das alles ging mir so auf den Wecker, dass mir manchmal danach war, um mich zu schlagen.
Mir war an den Vormittagen so sterbenslangweilig, dass ich Mühe hatte, nicht vom Stuhl zu fallen.
Formeln. Zahlen. Gedichte. Floskeln.
Lärm. Schulhofgewimmel. Schlechte Luft.
Ich weiß nicht, welcher Architekt seinen schlechten Geschmack an unserer Schule ausgetobt hat. Wahrscheinlich einer, der selbst nie Schüler gewesen ist. Der Albtraum aus Glas und Beton war im Sommer ein Brutkasten, im Winter ein Eishaus.
Man konnte gar nicht schnell genug wieder hinauskommen.
In einem Stau, dessen Ursache nicht zu erkennen war, verlor ich eine halbe Stunde, bevor ich endlich in die Lessingstraße einbog. Ich besitze zwar einen Parkausweis für Anwohner, doch ohne eine freie Lücke ist er wertlos. Zweimal umkreiste ich fluchend den Block, dann machte mir jemand Platz und ich quetschte meinen Renault hinein.
Im Treppenhaus roch es nach einem abenteuerlichen Gemisch aus Kohl, Kaffee und gebratenem Speck. Ich riss die Fenster der einzelnen Zwischenetagen auf und wusste doch, dass man sie wieder zuschlagen würde, sobald ich die Wohnungstür hinter mir geschlossen hätte.
Du hast dir dieses Leben ausgesucht, sagte ich mir auf dem Weg nach oben. Du hast es genau so gewollt.
In der Mühle waren die Zimmer immer angenehm temperiert, im Sommer erfrischend kühl, im Winter kuschelig warm. Keine ausgetretenen Holzstufen, kein abblätternder Putz, keine verdurstenden Zimmerpflanzen auf den Fensterbänken, keine Fahrräder im Hausflur, keine Kinderwagen vor den Türen und keine hastig hingekritzelten Obszönitäten an den Wänden. Vor kurzem war ein neuer Spruch hinzugekommen, der erste, der Klasse hatte und mir gefiel: Heilige Jungfrau Maria, die du empfangen hast, ohne zu sündigen, lehre uns sündigen, ohne zu empfangen!
Jemand hatte versucht, ihn abzuwaschen, doch es war ihm nicht gelungen. Er hatte lediglich die Buchstaben ein wenig verwischt. Irgendwann würde das Treppenhaus gestrichen werden und dann, mit der Zeit, würden sich neue Sprüche ansammeln.
»Jemand zu Hause?«
Niemand antwortete, aber das hatte ich auch gar nicht erwartet. Ich brachte die Schultasche in mein Zimmer und ging ins Bad. Die Klobrille war hochgeklappt. Ich bemerkte es gerade noch rechtzeitig, bevor ich mich setzte.
Merle schleppte häufig irgendwelche Typen an, die sich zu schade waren, im Sitzen zu pinkeln. Sie hatte, was Männer anging, einen ziemlich unterentwickelten Geschmack. Obwohl sie einer der unabhängigsten Menschen war, die ich kannte, betete sie dominante Kerle an. Sie verachtete sich selbst dafür, konnte jedoch nichts dagegen tun. Allerdings hatte ich auch nicht den Eindruck, dass sie sich ernsthaft darum bemühte.
In letzter Zeit befand sie sich auf dem Weg zur Monogamie. Es war ein dorniger Weg und ab und zu strauchelte sie noch.
In der Küche herrschte das übliche Chaos. Keine von uns stand morgens früh genug auf, um ohne Hektik das Haus verlassen, geschweige denn, vorher noch Ordnung schaffen zu können. Eigentlich störte mich das nicht, doch es ärgerte mich, dass das Aufräumen meistens an mir hängen blieb, weil ich in der Regel als Erste nach Hause kam.
Merle hatte einen Nachmittagsjob bei Claudios Pizzaservice, wo sie als Fahrerin oder in der Küche arbeitete, je nachdem, was gerade anfiel. Caro hatte wieder mal Stress mit ihrem Freund Gil und wir kriegten sie kaum noch zu Gesicht.
Ich hatte Hunger und fühlte mich schlapp, aber wenn ich eines hasse, dann Mahlzeiten an einem Tisch mit schmutzigem Geschirr. Also machte ich mich daran, Ordnung zu schaffen.
Merle bereitete sich morgens meistens ein Müsli zu, für das sie einen Apfel rieb, eine Banane zerquetschte und eine halbe Zitrone ausdrückte. Ich gab die Obstschalen in den Eimer für Biokompost, kratzte verhärtete Apfelfasern aus der Reibe und weichte die Reibe mit der Zitruspresse in heißem Wasser ein.
Caro trank heißen Kakao und aß Toast mit Schinken, dazu ein weiches Ei. Die Eierschalen lagen zerbröselt neben ihrem Teller, die Brotkrümel zum großen Teil auf dem Boden, wo sie unter meinen Schuhsohlen knirschten. Den Kakao hatte sie nicht ganz ausgetrunken. Er hatte eine Haut gebildet, die mich an den Hals meiner Großmutter erinnerte, was mir ein schlechtes Gewissen machte, weil ich mich bei meiner Großmutter schon lange nicht mehr gemeldet hatte.
Ich bevorzugte zum Frühstück Tee und finnisches Knäckebrot mit Käse. Weil ich am Morgen fünf wertvolle Minuten an die Suche nach einem verlegten Buch verschwendet hatte, war nicht mehr genug Zeit gewesen, um den Käse wieder in den Kühlschrank zu legen. Die paar Stunden hatten ausgereicht, ihn glasig werden zu lassen und sich am Rand leicht zu wellen. Jetzt taugte er nicht mal mehr zum Überbacken. Ich konnte ihn nur noch wegwerfen.
Zum hundertsten Mal schickte ich ein Dankgebet zum Himmel, weil wir uns nach langen Diskussionen vor einigen Wochen endlich dazu entschlossen hatten, uns eine gebrauchte Geschirrspülmaschine zuzulegen. Sie verschluckte das schmutzige Geschirr, ich musste nur noch mit einem feuchten Tuch über Tisch und Arbeitsfläche fahren und die Küche war wieder einigermaßen bewohnbar.
Ich zauberte mir ein Rührei mit Pilzen und Tomaten, brühte mir einen Karamelltee auf und wollte gerade anfangen zu essen, als Caro in die Küche geschlappt kam.
»Aha«, sagte ich gereizt. »Die Ratten kriechen aus ihren Löchern.«
Caro sah mich verständnislos an.
»Leider einen Tick zu spät, um mir beim Aufräumen zu helfen.«
Caro gähnte. Sie fuhr sich mit gespreizten Fingern durch das struppige Haar. Schlurfte zum Kühlschrank. Öffnete ihn. Zog einen Jogurt heraus. Nahm sich einen Löffel. Setzte sich zu mir an den Tisch. Alles in Zeitlupentempo.
Sie trug ihren kürzesten Rock und ein Achselshirt, beides schwarz, darüber die graue Leinenbluse, um die ich sie glühend beneidete, von der sie sich aber nur leihweise trennte und das auch nur ganz selten.
»Ich hatte Besuch«, sagte sie.
»Das heißt, du warst nicht in der Schule.«
Caro schwänzte in letzter Zeit ständig den Unterricht. Manchmal kam sie gar nicht erst aus dem Bett. Manchmal machte sie sich auf den Weg und kehrte dann doch wieder um. Es grenzte an ein Wunder, dass man sie noch nicht gefeuert hatte.
Sie machte ihr Ich-hasse-es-wenn-du-redest-wie-eine-Mutter-Gesicht und begann ihren Jogurt zu löffeln.
»Besuch?«, fragte ich nach. »Jemand, den ich kenne?«
»Nö.«
»Ernste Sache?«
Sie hob die Schultern.
Also war wieder mal Schluss mit Gil. Ich schlug das Buch auf, das ich neben den Teller gelegt hatte. Wenn sie nicht reden wollte, gut, ich würde sie nicht dazu zwingen. Ich war sowieso ganz froh, wenn ich meine Ruhe hatte. Der Vormittag war anstrengend gewesen. Sechs lange, öde, verlorene Stunden, die mir keiner zurückgeben würde.
Caro machte sich an der Espressomaschine zu schaffen, die meine Mutter uns großzügig zum Einzug spendiert hatte. »Willst du auch einen?«
Ich schüttelte den Kopf und zeigte auf meine Teetasse.
Als Caro sich mit dem Espresso wieder an den Tisch gesetzt hatte und nach der Zuckerdose griff, rutschte ihr Ärmel hoch und gab den Blick frei auf einen hässlichen roten Streifen an ihrem linken Unterarm.
»Caro...«
Rasch schob sie den Ärmel hinunter.
Sie hatte sich schon lange nicht mehr selbst verletzt. Wann hatte sie wieder damit angefangen? Und warum?
»Möchtest du darüber reden?«
»Nö.«
»Aber wenn du doch mal...«
»... dann wende ich mich vertrauensvoll an dich und Merle. Versprochen.«
Sie schwor uns das immer wieder, doch es kam nie dazu. Man musste sie überraschen, ihren Widerstand überrennen und sie in ein Gespräch ziehen, bevor sie wusste, wie ihr geschah. Das funktionierte nicht immer, aber doch meistens. Jedes Mal erfuhren wir etwas mehr über sie. Und Stein für Stein setzten wir uns das Mosaik Caro zusammen.
Sie stammte aus einer völlig zerrütteten Familie. Zwar lebten die Eltern und Kalle, Caros jüngerer Bruder, noch zusammen in einer Wohnung, aber keiner hatte mit dem andern zu tun. Jeder ging seiner eigenen Wege.
Der Vater schlug die Mutter. Die Mutter schlug die Kinder. Die Kinder schlugen andere Kinder. So war es immer gewesen. Ein Teufelskreis von Gewalt, aus dem auch Caro nicht ausbrechen konnte. Allerdings verletzte sie niemand anderen, sie verletzte sich selbst.
»Ich würd mich gern verlieben«, sagte sie träumerisch.
»Tust du doch. Pausenlos.« Caro war dauerverliebt. Kaum hatte sie sich an den einen gewöhnt, hielt sie dem Nächsten schon die Tür auf.
»Nicht so. Richtig.« Sie steckte sich ein Stück Würfelzucker in den Mund und zerbiss es krachend. »Für immer und ewig, verstehst du? Ganz kitschig und wahrhaftig. Die große Liebe. Bis ans Ende unserer Tage.« Sie rollte mit den Augen. »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Amen.« Lachend angelte sie nach einem zweiten Stück Zucker. Bei ihrer Figur konnte sie sich das leisten. Sie war gertenschlank und aß normalerweise wie ein Spatz.
»Du willst sesshaft werden?« Ich trank von meinem Tee, den ich nicht gesüßt hatte. Er schmeckte, als hätte ich verdorrtes Gras mit heißem Wasser übergossen.
»Wie sich das anhört. Sesshaft. Aber meinetwegen nenn es so. Okay, vielleicht will ich sesshaft werden. Was dagegen?« Sie schickte mir einen provozierenden Blick über den Tisch.
»Wenn du mir erzählen würdest, du hättest einen Job als Hochseilartistin beim Zirkus Krone angenommen, hätte ich weniger Probleme, mir das vorzustellen.«
»Bei so einem Kapitalistenzirkus würde ich nie anheuern. Und wenn überhaupt irgendwo, dann nicht als Hochseilakrobatin, Feuerschluckerin oder sonst was, sondern als Clownin.«
Das passte zu ihr. Mit ihrem kurzen Haar und den großen Augen brauchte sie nicht mehr viel, um die Illusion perfekt zu machen.
Aber warum verletzte sie sich wieder?
»Lenk nicht ab«, sagte ich. »Was ist mit Gil?«
Sie stellte den leeren Jogurtbecher auf den Tisch und kippte ihn mit dem Zeigefinger um. Klirrend fiel der Löffel heraus. »Was soll mit ihm sein?«
»Willst du mit ihm sesshaft werden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben uns getrennt. Letzte Woche schon.«
»Und du hast gleich Ersatz gefunden?«
»Na und?« Angriffslustig sah sie mich an. »Muss ich jetzt wochenlang in Sack und Asche gehen?«
Ich mochte es nicht, wenn sie mich in die Position des Moralapostels drängte. »Hab ich dir einen Vorwurf gemacht?«
»Du? Du bist der Vorwurf in Person! Guck dich doch an!« Sie kickte den Jogurtbecher vom Tisch. Er landete auf dem Boden, rollte über die Fliesen und blieb neben einer großen Staubfluse liegen.
»Zufällig mag ich Gil.« Ich merkte, dass mein Rührei inzwischen kalt geworden war. Das nahm ich Caro übel. »Und ich finde, er hat eine Chance verdient.«
»Die hat er gekriegt.« Caro stand auf und machte sich noch einen Espresso. »Und nicht nur eine.«
»Er hatte nicht den Hauch einer Chance.« Ich schob meinen Teller weg und trank einen Schluck Tee. Lauwarm schmeckte er noch schauderhafter. Der Duft des Espresso stieg mir in die Nase. »Kann ich auch einen haben?«
Caro knallte die Tasse unfreundlich vor mich hin. »Wieso glaubst du das?«
»Weil du dich in deiner Sehnsucht nach der einen, einzigen, weltumfassenden Liebe so gemütlich eingerichtet hast, dass du die Liebe nicht mal erkennen würdest, wenn sie vor dir stünde.«
»Soweit eine Liebe vor einem stehen kann«, sagte Caro mit einem hässlichen Lächeln.
Ich antwortete ihr nicht und trank meinen Espresso. Das hier war der eine Teil von Caro. Kalter Zynismus. Der andere Teil waren Wärme, Zärtlichkeit und Mitgefühl. Doch davon sah man im Augenblick so gut wie nichts.
Merle und ich hatten beschlossen, ruhig abzuwarten. Irgendwann würden Caros verschüttete Qualitäten wieder zum Vorschein kommen. Bis dahin hieß es, Gelassenheit zu wahren. Wir hatten Zeit. Und Caro war es wert zu warten.
»Wie wär’s mit einem Besuch beim Reisebüro?«, fragte ich.
Caro war sofort Feuer und Flamme. Wir machten das oft - holten uns alle möglichen Prospekte und planten abenteuerliche Reisen, die wir uns nicht leisten konnten. Vielleicht würden wir sie später wirklich einmal machen, wenn wir genug Geld hätten.
Anfangs hatten Caro und Merle sich darüber gewundert, dass die Tochter der Bestsellerautorin Imke Thalheim (meine Mutter hatte schon immer unter ihrem Mädchennamen geschrieben und ihn nach der Scheidung von meinem Vater auch offiziell wieder angenommen) nicht in Geld schwamm. Später begriffen sie dann, dass mein Stolz der Grund dafür war. Ich ertrug es nicht, mehr als nötig von meinen Eltern abhängig zu sein.
Auf dem Weg zum Reisebüro hakte Caro sich bei mir ein. Die Ferien standen vor der Tür. Die letzten Sommerferien vor dem Abi.
»Und wenn du doch mal vorsichtig bei Mami anfragst?« Caro sah meinen Blick und winkte ab. »War ja bloß’ne Frage! Ich meine, die gute Frau weiß doch nicht, wohin mit der vielen Kohle, richtig?«
»Caro, verzeih mir!« Ich blieb stehen. »Offenbar hab ich dir Unrecht getan. Du denkst ja gar nicht nur an dich. Du willst meiner Mutter nur total selbstlos helfen, ihr Geld auszugeben.«
Caro nickte ernsthaft. »Ich kann einfach niemanden leiden sehen.«
Wir sahen uns an und prusteten los. Es kam überhaupt nicht in Frage, dass ich meine Mutter um Geld bat, doch das musste ich Caro nicht erklären, das wusste sie.
Die Tage verliefen eintönig. Das war gut für ihn. Er brauchte eine ruhige Grundlage für sein Leben. Damit er die Kontrolle behielt. So lange wie möglich.
Seine Lust war wie ein Tier, das immer gefräßiger wurde.
Aber es gab Parallelen. Er dachte über die Filme nach, die er schätzte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nosferatu. Frenzie. Bram Stokers Dracula. Das Schweigen der Lämmer. Die Nacht des Werwolfs. Und wie sie alle hießen.
Nach jedem dieser Filme hatte er sich ein wenig verstanden gefühlt. Und irgendwie gerechtfertigt.
Er hatte lange Zeit das Bedürfnis gehabt, mit den Regisseuren dieser Filme zu reden. Oder mit einem der Schauspieler. Doch dann hatte er eine Dokumentation über Hitchcock gesehen. Hatte den feisten, verklemmten, irgendwie ängstlich wirkenden Mann Dinge sagen hören, die ihn zutiefst enttäuscht hatten. Diesem in die Jahre gekommenen Muttersöhnchen hatte die Welt Frenzie zu verdanken?
Und was hätte er mit Klaus Kinski anfangen sollen, der die Hauptrolle in Nosferatu gespielt hatte? Diesem selbstverliebten Größenwahnsinnigen, der seine kreative Kraft am Ende damit vergeudet hatte, herumzupöbeln und sein Publikum zu provozieren?
Aber jeder dieser Regisseure hatte ihn erkannt. Mehr als irgendjemand sonst auf der Welt. Sie hatten ihm nie gegenübergestanden und doch hatten sie mit ihren Filmen das Wesentliche in ihm getroffen, von seinen geheimsten, verborgensten Ängsten und Hoffnungen gewusst. Und sie auf der Leinwand umgesetzt.
Er war altmodisch, was Filme anging, schätzte nur wenige von den modernen, überlegte genau, von welchen er sich eine Videokassette zulegte. Auf seine ganz private Sammlung war er stolz, so wie er auch auf seine ganz private Bibliothek stolz war. Dostojewskis Schuld und Sühne. Mary Shelleys Frankenstein. Patrick Süskinds Parfum. Akif Pirinçcis Felidae.
Er konnte sich die Filme nicht anschauen, weil er keinen Videorekorder besaß. Aber die Filme musste er besitzen. Es gab ihm ein Gefühl von Zuhause, sie bei sich zu haben.
Mit Schund gab er sich nicht ab. Er hasste die Leere, die solche Bücher oder Filme in seinem Kopf hinterließen.
Gute Bücher, schlechte Bücher. Gute Menschen, böse Menschen. Er hatte es seiner Mutter zu verdanken, dass er unterscheiden konnte zwischen Himmel und Hölle, Gott und Teufel. Seiner Mutter und ihrer jahrelangen Abwesenheit. Seine harte Kindheit hatte ihm alles beigebracht. Das Böse konnte sich verkleiden, wie es wollte, er würde es unter jeder Maske erkennen.
Wenige Menschen waren wie er. Diese wenigen waren Künstler. Sie schrieben Bücher, malten Bilder, drehten Filme.
Und er bewunderte sie aus der Ferne.
Mit angemessenem Abstand.
Sie waren wie er. Und doch ganz anders. Menschen einer höheren Sphäre. Niemals hätte er sich erdreistet, ihnen zu nahe zu kommen.
Vielleicht war es sowieso besser, sich vor Enttäuschungen zu schützen. Möglicherweise erginge es ihm sonst mit dem einen oder andern, wie es ihm mit Hitchcock und Klaus Kinski ergangen war.
cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
Verlagsgruppe Random House Das für dieses Buch verwendete FSC-zertifizierte Papier Super Snowbrightliefert Hellefoss AS, Hokksund, Norwegen.
1. Auflage Sonderausgabe Mai 2008 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2003 cbt/cbj Verlag in der Verlagsgruppe
Random House, München Alle Rechte vorbehalten Umschlagfoto: Getty Images, München Umschlagkonzeption: init.büro für gestaltung, Bielefeld st · Herstellung: CZ
eISBN : 978-3-894-80484-8
Printed in Germany
www.erdbeerpfluecker-cbj.de
Leseprobe
www.randomhouse.de