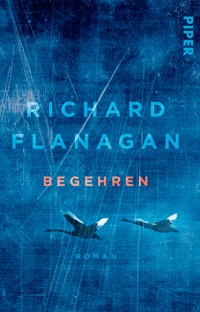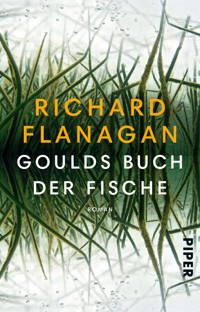9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den jungen, mittellosen Schriftsteller Kif Kehlmann erreicht mitten in der Nacht ein Anruf. Er soll die Memoiren des berühmtesten Kriminellen Australiens schreiben, Siegfried Heidl. Heidl hat den Banken siebenhundert Millionen Dollar abgenommen und muss sich nun vor Gericht verantworten. Bis zum Tag der Urteilsverkündung will sein Verleger das Manuskript auf dem Tisch haben. Trotz des enormen Drucks willigt Kehlmann ein, muss aber erkennen, dass Heidl sich gar nicht für das Buch interessiert. Also beginnt er zu erfinden. Je näher aber der Abgabetermin rückt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Heidl und ihm selbst, zwischen Erfindung und Erinnerung. Betreibt Heidl Sabotage, will er, dass Kehlmanns Leben selbst sich ändert, das erfundene und das wahre?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Für Nikki Christer
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Parlamentarischer Untersuchungsausschuss
Teil 1
1
2
3
4
5
6
Teil 2
1
2
3
4
5
6
Teil 3
1
2
3
4
5
6
Teil 4
1
2
3
4
5
Teil 5
1
2
3
4
Teil 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teil 8
1
2
3
Teil 9
1
2
3
4
5
Teil 10
1
2
3
4
5
6
Teil 11
1
2
3
4
5
6
7
Teil 12
1
2
3
4
5
Teil 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 15
1
2
3
4
5
6
7
Teil 16
1
2
3
Teil 17
1
2
3
4
5
6
Teil 18
1
2
3
4
5
6
7
Teil 19
1
2
3
4
Teil 20
1
2
3
4
5
6
Teil 21
1
2
3
4
Teil 22
1
2
3
4
Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu den Gefangenentransporten
Protokoll der Beweisaufnahme
London, am 5. Mai 1837
Frage:Gibt es dort viele Buchhandlungen?
James Mudie, Esq.:In Sydney ungefähr ein halbes Dutzend, würde ich sagen.
Frage:Was für Bücher gibt es dort zu kaufen? Sind sie von anderer Art als jene, wie wir sie aus den Londoner Buchhandlungen kennen?
James Mudie, Esq.:Sie sind ganz fraglos von minderer Qualität, zum Beispiel werden dort sehr viele Romane verkauft. Ich habe sogenannten Buchauktionen beigewohnt und nicht selten erlebt, dass auf höchst wertvolle Bücher ein Preis geboten wurde, der hier in England um ein Vielfaches höher gelegen hätte. Einmal ging ein regelrechtes Raunen durch den Raum, als der Almanach des Newgate-Gefängnisses präsentiert wurde und ein jeder sagte: »Oh, den muss ich haben!«
Ich habe vergessen, welchen Preis der Almanach erzielt hat, doch die Summe war ungeheuerlich … außerdem sind die Menschen dort verrückt nach Anekdoten von Wegelagerern und derlei Geschichten.
Aus den britischen Parlamentsprotokollen
Teil 1
1
Unser erster Kampf betraf die Geburt. Ich sagte rein, er sagte raus. Einen ganzen Tag und die Hälfte des folgenden stritten wir uns. Er sagte, die Geburt habe nichts mit ihm zu tun. Später konnte ich ihn besser verstehen, aber zu dem Zeitpunkt hielt ich ihn einfach nur für borniert. Sein unerklärliches Verhalten grenzte an Sabotage – als wollte er eigentlich gar nicht, dass seine Memoiren geschrieben wurden. Natürlich wollte er nicht, dass seine Memoiren geschrieben wurden, aber das war nicht der Punkt. Die Frage hatte überhaupt niemand gestellt. Aber das habe ich erst später begriffen, viel später, als mir dämmerte, dass der Anfang dieses Buches zugleich mein Ende sein könnte.
Zu spät also.
Heute gebe ich mich mit der Produktion von Reality-TV-Formaten zufrieden. Manchmal spüre ich eine ächzende Leere, eine Einsamkeit, die mich erschreckt. Der Gedanke, dass ich hätte leben können und es nicht getan habe, jagt mir Todesangst ein. Realityshows haben eine vergleichsweise beruhigende Wirkung auf mich.
Damals war ich einfach nur verwirrt. Die anderen fürchteten, ich könnte rückfällig werden und wieder zu schreiben anfangen. Ich spreche von Allegorien, Symbolen, tanzenden Tropen der Zeit, von Büchern, die keinen festgelegten Anfang und kein Ende haben, oder wenigstens nicht in dieser Reihenfolge. Mit den anderen meine ich auch meinen Verleger, einen Mann mit dem ungewöhnlichen Namen Gene Paley. In der Hinsicht hatte er sich nämlich äußerst klar ausgedrückt: Ich sollte mit einfachen Mitteln eine einfache Geschichte erzählen, und wo sie nicht einfach war – wo das spektakuläre Verbrechen sich in seiner Vielschichtigkeit offenbarte –, sollte ich sie mithilfe von Anekdoten anschaulicher machen. Außerdem sollte kein Satz länger sein als zwei Zeilen.
Im Verlag ging das Gerücht um, Gene Paley fürchte sich vor der Literatur – aus gutem Grund. Zum einen war sie schlecht verkäuflich. Zum anderen kann man zu Recht behaupten, dass die Literatur Fragen aufwirft, auf die sie keine Antworten hat. Und bei manchen erzeugt sie Befremden, was selten ein erwünschtes Gefühl ist. Sie erinnert die Menschen daran, dass zu leben vor allem zu scheitern ist, und die Unfähigkeit, das zu erkennen, ist die wahre Ignoranz. In ihrer Gesamtheit mag sie erhaben sein, zum Teil sogar weise, aber für das Erhabene fühlte Gene Paley sich nicht zuständig. Er mochte Bücher, in denen ein oder zwei Motive wieder und wieder durchgekaut wurden. Vorzugsweise eines.
Wo verkauft wird, sagte Gene Paley, da wird gelogen.
Ich wandte mich noch einmal dem Manuskript zu und las die ersten Zeilen.
Am 17. Mai 1982 unterschrieb ich meine Bewerbung um den Posten des stellvertretenden Sicherheitsbeauftragten (Abteilungsleitung, Sicherheitsfreigabe 4/5) bei der Australian Safety Organisation mit den beiden Wörtern Siegfried Heidl, und so begann mein neues Leben.
Erst viel später entdeckte ich, dass ein Siegfried Heidl bis zur Unterzeichnung des Bewerbungsschreibens nicht existiert hatte; so gesehen sagte er die Wahrheit. Doch die Vergangenheit ist immer unberechenbar, außerdem bestand sein Talent als Betrüger nicht zuletzt darin, dass er nur selten log.
Ziggy Heidl war der Meinung, sein Fünfzig-Seiten-Manuskript – ein dünner Papierstapel, auf den er immer wieder die gespreizte Hand legte, als wollte er es wie einen Basketball dribbeln und dann ins Spiel bringen – enthalte alles, was der geneigte Leser über Ziggy Heidl erfahren wollte. Meine Aufgabe als Ghostwriter sei es lediglich, seinen Sätzen den letzten Schliff zu verpassen und seine Schilderungen an der einen oder anderen Stelle zu ergänzen.
Er sagte das – wie so vieles andere auch – im Brustton der Überzeugung und voller Selbstbewusstsein, deswegen hatte ich große Mühe, ihn darauf hinzuweisen, dass seine Kindheit, seine Eltern und übrigens auch sein Geburtsjahr in dem Manuskript mit keinem Wort erwähnt wurden. Das alles ist jetzt viele Jahre her, aber seine Antwort ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben.
Das Leben ist keine Zwiebel, die sich häuten ließe, und kein Palimpsest, dem eine ursprüngliche Bedeutung abzugewinnen wäre. Das Leben ist eine endlose Erfindung.
Und weil diese geschliffenen Metaphern mich sprachlos machten, fügte Heidl im Tonfall eines Mannes, der einem anderen den Weg zur Toilette erklärt, hinzu: Das ist von Tebbe. Ein Aphorismus.
Ziggy Heidl glich jeden Mangel an Fakten durch bescheidene Gewissheit aus, und wo es ihm an Gewissheit fehlte, zog er die Fakten heran. Diese waren meistens erfunden, aber umso plausibler, weil er sie mir lässig und aus einer überraschenden Perspektive entgegenschleuderte.
Tomas Tebbe, ergänzte Heidl. Der bedeutendste deutsche Installationist seiner Zeit.
Ich hatte weder eine Ahnung, was ein Palimpsest war, noch kannte ich Tebbe oder den Beruf des Installationisten, was ich ihm auch sagte. Heidl gab keine Antwort. Vielleicht, sagte er bei einer anderen Gelegenheit, schlachten wir unsere Vergangenheit und die der anderen aus, um uns neu zu erfinden, samt unseren Erinnerungen. Tebbe, den ich erst viele Jahre später las, drückte es noch treffender aus: Mag sein, dass dort das Blut eines anderen im Staub versickert, schrieb er, aber ich bin der Staub.
Ich blickte auf.
Rein interessehalber, sagte ich. Wo genau in Deutschland sind Sie aufgewachsen?
In Deutschland?, fragte Ziggy Heidl und schaute dabei aus dem Fenster. Deutschland habe ich erstmalig im Alter von sechsundzwanzig Jahren bereist. Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Ich bin in South Australia aufgewachsen.
Sie haben einen deutschen Akzent.
Klar, sagte Ziggy Heidl. Er drehte sich zu mir um, und ich versuchte, nicht in sein fleischiges Gesicht zu starren, wo jedes Mal, wenn er lächelte, ein winziger Muskel in der eigentlich drallen Wange zu zucken anfing; ein harter Knoten auf weicher Haut, ein sanftes, beständiges Puckern.
Ich weiß, es klingt unglaubwürdig, aber was soll ich Ihnen sagen? Meine Eltern waren deutsch, und ich hatte keine australischen Spielkameraden. Aber ich war glücklich. Schreiben Sie das.
Er lächelte.
Sein Lächeln: ein verschwörerischer, dunkler Sog.
Wie bitte?, fragte ich.
Das.
Was?
Schreiben Sie: Ich war glücklich.
Dieses entsetzliche Lächeln. Die zuckende Wange.
Bumm-bumm, machte sie lautlos. Bumm-bumm.
2
Man stellte uns ein riesiges Eckbüro im Verlagshauptquartier in Port Melbourne zur Verfügung. Möglicherweise hatte es früher einem Cheflektor oder Vertriebsleiter gehört, der kürzlich gefeuert worden oder in Rente gegangen war. Wer wusste das schon? Niemand begründete die Wahl, aber der Raum gab Ziggy Heidl das Gefühl, wichtig zu sein, und darauf kam es an, nicht auf meine Scham. Wir schrieben das Jahr 1992, was nicht lange her ist und doch so weit entfernt; es war die Zeit, als Führungskräfte noch ein Eckbüro mit Hausbar bekamen, die Zeit vor Amazon und E-Book, als Begriffe wie Verkaufsanalyse, Kundenzufriedenheit und Lieferkettenoptimierung sich noch nicht zur Schlinge am Strick des Henkers zusammengezogen hatten; bevor der unaufhaltsame Anstieg der Immobilienpreise und der Zusammenbruch der Verlagsbranche die Lektoratsbüros in Schlachthöfe verwandelten, wo Fließbandarbeit geleistet wurde und die Mitarbeiter so dicht an dicht nebeneinandersaßen wie in einer Kantine der Roten Armee 1979 in Kabul.
Wie zuvor schon die Rote Armee war das Verlagswesen in eine tiefe Krise gerutscht, die aber weder als Krise noch als tief betrachtet wurde. In den Etagen unter den Verlagsbüros rissen die Entlassungen eine Lücke nach der anderen, Lücken, die sich in einigen Jahren zu einem riesigen Einsturzkrater zusammenschließen würden; die vielen Verlagsetagen fielen plötzlich und unerwartet hindurch, um im Erdgeschoss aufzuschlagen und zu einer einzigen Etage zusammengepresst zu werden. Und dann, eines Tages, würde auch jene verbliebene Etage zu schrumpfen anfangen, weil eine Welle aus Start-ups, Finanzfirmen und Onlineversandhäusern die Büros fluten und das Lektorat sich auf einer halben Etage zusammengedrängt finden würde. Auf jener bedrohten Insel wurden Bücher zu Content und die Autoren zu Textproduzenten degradiert, zu Sandsackbefüllern, die jetzt einer noch niedrigeren Kaste angehörten, falls das überhaupt möglich war.
Vermutlich erwecken meine Schilderungen den Eindruck, ich würde eine gewisse Wehmut empfinden, oder unser Eckbüro in Port Melbourne hätte Charme und Charakter gehabt.
Empfinde ich nicht.
Hatte es nicht.
Zwar waren die Wände von Regalen bedeckt, doch bei näherem Hinsehen entpuppte die Bücherwand sich als so deprimierend wie die ganze Branche damals. Das Regal war aus Sperrholz, das künstliche Teakfurnier in einem unangenehmen Kotbraun gehalten und völlig stumpf. Und die Bücher! In den Regalen fanden sich ausschließlich Werke, die der Verlag – das seinerzeit mächtige Medienhaus Schlegel TransPacific (TransPac oder STP, wie es damals hieß) – selbst herausgegeben hatte: Bücher über Schokolade, Gartengestaltung, Möbel, Militärgeschichte und abgehalfterte Prominente; öde Autobiografien und Schundromane, deren Erlöse jene wenigen Bücher finanzierten, die ich für echte Literatur hielt – Romane, Essaybände, Lyrik, Kurzgeschichten – und die in den furnierten Regalen nirgends zu finden waren. Zwischen Kochbüchern, Bildbänden und Nachschlagewerken (für die es damals tatsächlich noch einen Markt gab) stand Jez Dempsters Gesamtausgabe, jeder einzelne Jez-Dempster-Band ein dicker Ziegel, auf dessen Rücken in großen goldenen Lettern JEZ DEMPSTER prangte. Was für ein Müll. Wie entmutigend der Anblick. Mich befiel zum ersten Mal der Verdacht, dass meine Vorstellung von Büchern und vom Schreiben nur eine sehr kleine und größtenteils erfolglose Teilmenge dessen bildete, was bei STP in geheimnisvollem Expertentonfall die Branche genannt wurde.
Die Branche musste für alles herhalten. Sätze wie »so läuft das in der Branche nun mal« oder »die Branche ist heikel« waren nichtssagend und erklärten dennoch scheinbar alles. Gleich an meinem ersten Tag merkte ich, dass die Branche meine Nacherzählung von Heidls Leben für ein sehr viel echteres Projekt hielt als das echte Buch, an dem ich bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben hatte. Das echte Buch war mein erster, unvollendeter Roman.
Ich fand das unlogisch, dann wiederum war alles in der Branche unlogisch. Beispielsweise ergab es in meinen Augen keinen Sinn, dass die Arbeit an Heidls Memoiren aus unerfindlichen Gründen ein Geheimnis bleiben musste. Nicht einmal die Verlagsangestellten durften davon wissen, nur die paar Leute, die direkt mit uns zusammenarbeiteten – Gene Paley, der die Textarbeit allerdings einer Lektorin namens Pia Carnevale überließ, und noch ein oder zwei weitere Kollegen. Den anderen sollten wir erzählen, wir würden an einer Anthologie mittelalterlicher Volksdichtung aus Westfalen arbeiten. Ich bin nicht sicher, wer sich die Lüge ausgedacht hatte – Ziggy Heidl oder Gene Paley, ganz spontan, oder ich, einige Zeit später –, aber sie war ebenso überzeugend wie aberwitzig. Meines Wissens hat nie jemand hinterfragt, warum der Verlag ausgerechnet so ein Projekt finanzieren sollte. Es war einfach nur eine weitere Kuriosität in einem Haus der Wunder, und ohnehin – so lief es eben in der Branche.
Die Möbel passten sehr gut zum schäbigen Prunk des Eckbüros. Der Schreibtisch, von dem aus Ziggy Heidl seine Dauertelefonate erledigte, war eine Antiknachbildung und viel zu wuchtig; der Konferenztisch hingegen, an dem ich arbeitete, war zu klein, als dass er seinen eigentlichen Zweck hätte erfüllen und mehreren Menschen Platz bieten können. Die leicht verschmutzten Cocktailsessel, in denen wir manchmal saßen, hatten einen Kunstfaserbezug in Jacquardmuster, dessen Lachsrosa und Grau das Auge auf das Unangenehmste bedrängte. Berührte man den Stoff mit den Fingern, fühlte er sich wie geschmolzen an. Das Muster erinnerte mich grundlos an die Bilder von Francis Bacon. Ich hatte das Gefühl, auf einem erstickten Schrei zu sitzen.
3
Kif, Gene will dich sehen, sagte die junge Frau, die in der Tür zu unserem Büro stand. Du musst den Vertrag unterschreiben.
Gene Paley wollte nichts dergleichen von mir – den Vertrag hatte ich gleich am ersten Arbeitstag unterschrieben, am Montag, der mir unendlich fern erschien. Kaum zu glauben, dass erst Mittwoch war. Ich wusste, Gene Paley wollte hören, wie wir vorankämen.
Langsam, sagte ich, als ich im Verlegerbüro vor Gene Paley stand. Er saß über einen Stapel Endlosdruckpapier gebeugt, das gelöcherte Ränder hatte und den ganzen Schreibtisch bedeckte. Darauf abgebildet waren unzählige Kalkulationstabellen. Die Sache ist die, er gibt mir keine … Informationen.
Kindheit?
Vage Andeutungen über deutsche Eltern und ein abgelegenes Bergarbeiterdorf in South Australia namens Jaggamyurra, in dem er angeblich zur Welt gekommen ist.
Das ist alles?, fragte Gene Paley, ohne den Kopf zu heben.
Mehr oder weniger.
Mmmh.
Eigentlich eher weniger.
Und der Coup? Wie schon gesagt, er ist nicht ohne Grund unser berühmtester Krimineller. Siebenhundert Millionen Dollar, der größte Betrugsfall in der australischen Geschichte. Hat er erzählt, wie er es angestellt hat?
Andeutungsweise.
CIA?
Noch andeutungsweiser.
Mmmh, machte Gene Paley und schwieg dann. Er beendete seine Gesprächsbeiträge gern mit einem leicht abfallenden Murmeln, als wäre jeder Satz ein trauriges Urteil über die jeweils anwesende Person, außerdem hatte er eine Vorliebe für die Wendung »wie schon gesagt«. Seine Art zu sprechen war überhaupt sehr ungewöhnlich und geprägt von knappen, abwechselnd schnell und langsam vorgebrachten Sätzen. Manchmal klang er wie ein kaputter Fernschreiber.
Ja gut …, sagte ich und merkte selbst, wie zögerlich ich klang.
Gene Paley setzte ein paar präzise Zeichen auf das Endlospapier, das so breit war wie eine kleine Vorstadtstraße. Die nasse schwarze Tinte aus dem Füllfederhalter hob sich drastisch von dem blassblau-weiß-gestreiften Papier und den aschgrauen Kolonnen der Nadeldruckerzahlen ab.
Seine Geschichten sind gut, sagte ich, nur ein wenig …
Schwammig?
Schwammig? Kann sein.
Wie schon gesagt, Sie schreiben ganz hervorragend, sagte Gene Paley, ohne die Zahlenkolonnen aus den Augen zu lassen. Aber wir müssen ihn zum Reden bringen.
Gene Paleys seltsam glatte Lider, sein schmales Gesicht, seine Hakennase, sein staubbeiger Teint und mein Gefühl, er könnte irgendwann plötzlich auf mich losgehen, erinnerten mich an Suzys Indischen Halsbandsittich, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, mich zu beißen.
Er muss mir mehr erzählen, sagte ich. Er ist … Er interessiert sich gar nicht für das Buch.
Gene Paley hob den Kopf und begegnete meinem Blick. Er wirkte nun sehr streng.
Mmmh, machte er, streckte skeptisch den übergroßen Füllfederhalter von sich, der auf einmal so deplatziert wirkte wie ein Stück verchromtes Leitungsrohr, und ließ ihn auf die kilometerlange Zahlenbahn fallen. Zahlen wie diese bestimmten seit Jahrzehnten sein Leben – die gedruckte Stückzahl, die Zahl der vorbestellten, abverkauften, remittierten und verramschten Exemplare, die Margen der Händler, die Verkaufszahlen der Konkurrenz, welche selbstverständlich der Presse zuliebe geschönt waren, echte Zahlen, Traumzahlen, wahre Zahlen, falsche Zahlen, an gierige Handelsketten verlorene Zahlen, einfältigen Autoren und aufgeblasenen Agenten abgerungene Zahlen, die Verzweiflung und Schönheit und Magie der Zahlen – ihre Zahlen, unsere Zahlen, schlechte Zahlen, gute Zahlen, bei Gott, es gab sogar Zahlen zu den Zahlen – und all diese unzähligen Zahlen hatten Gene Paleys Empfindsamkeit dermaßen geschärft, dass er über einen zusätzlichen Nerv zu verfügen schien, mit dem er Gewinnchancen, aber auch Verluste deutlicher spüren konnte.
Ihre Aufgabe ist es nicht bloß zu schreiben, sagte er mit immer noch freundlicher, aber irgendwie festerer Stimme. Er klang resolut. Sie sollen mit ihm zusammen für uns schreiben. Sie sollen ihn zum Reden bringen. Wenn er nicht redet, haben wir kein Buch. Wenn wir in sechs Wochen kein Buch haben, bekommen Sie kein Geld. Nichts. Ja?
Nein, sagte ich. Ja.
Nein, sagte Gene Paley. Nichts.
Ja, wiederholte ich. Nichts.
Während er sprach, faltete Gene Paley das Endlospapier sorgfältig zu einem rechteckigen Haufen zusammen, stand vom Schreibtisch auf und zog ganz ohne Scham sein Hemd aus, unter dem ein weißes Unterhemd zum Vorschein kam, einen Hauch zu weit für seinen weißen Körper.
Angeblich gibt es beim Schreiben nur drei Regeln, sagte Gene Paley, und ich glaubte, den Staub riechen zu können, den die nun folgende Weisheit angesetzt hatte: Zu schade, sagte er, dass niemand sich dran erinnern kann!
An der Unterseite seiner schlaffen, dünnen Oberarme saßen winzige, leuchtend rote Muttermale, die aussahen, als hätte sie ihm jemand willkürlich mit einem Kugelschreiber zugefügt. Er hatte die Statur eines Menschen, der in seinem ganzen Leben nie körperlich hatte arbeiten müssen. Ein Mann, der den Vornamen Gene so unbekümmert trug wie Gene Paley, hatte sich, und das wurde mir jetzt klar, über alle maskulinen Selbstzweifel erhoben, mit denen ich groß geworden war. Ich arbeitete seit drei Tagen an Heidls Memoiren und ahnte zum ersten Mal, dass meine beschränkte Art zu denken nur eines von gleich mehreren persönlichen Hemmnissen war. Dennoch konnte ich nicht anders, als mich beim Anblick seines Körpers, Dackeltorso mit Nymphensittichkopf, für ihn zu schämen.
Gene Paley öffnete eine Schranktür und nahm ein frisches Hemd heraus.
Versuchen Sie, sagte er, möglichst schnell eine erste Fassung zu schreiben. Das wäre mein Rat.
Ohne jede Rücksicht auf meine Anwesenheit oder meine Meinung zog er das Hemd über; alles Weitere fasste er in einem Satz zusammen, der anscheinend selbsterklärend war.
Mittagessen mit Jez Dempster, sagte er und knöpfte sich die Manschetten zu.
Jez Dempsters Bücher verkauften sich in Auflagen von mehreren Hunderttausend, wenn nicht gar Millionen. Jez Dempster war eine Branchengröße.
Wie schon gesagt, ein Autor wie Sie könnte von den Jez Dempsters dieser Welt eine Menge lernen, sagte Gene Paley. Ja?
Ja, antwortete beziehungsweise wiederholte ich. Es schien auf dasselbe hinauszulaufen. Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass man, wenn man nur schlecht genug schreibt, einen Haufen Geld verdienen kann. Sie haben sich anscheinend fürs Gegenteil entschieden.
Ich schreibe gut?
Sie verdienen kein Geld.
Obwohl eine gewisse Sanftmut, vielleicht sogar Güte aus Gene Paleys schwer beliderten Augen und seinem müden Lächeln sprach, versteckte sich dort in dem mageren Körper mit den schlaffen Armen ein messerscharfer Instinkt, der auf Status und Geld geeicht war. Vor allem auf Geld. Möglicherweise war keiner seiner Sinne so hoch entwickelt wie dieser eine: Er hatte ein geradezu schamanisches Gespür für Geld – für das, was das Geld brauchte und forderte, für seine Ekstasen und Nöte; er hörte sein Flehen und wusste, welche Maßnahmen er ergreifen musste, um zwischen unserer Welt und der des Geldes zu vermitteln. Seine Entschlossenheit konnte, ich ahnte es damals schon, jederzeit ins Grausame umschlagen, denn ein Mann, dem egal war, was ein anderer über seine Figur dachte, war ein Mann, dem mehr oder weniger alles egal war.
Jez Dempster hat mir einmal verraten – Gene Paley knöpfte sich die Hose auf und zog den Reißverschluss halb herunter –, ein Klassiker sei ein Buch, das nie damit fertig werde zu sagen, was es sagen wolle.
Er stopfte sich das Hemd in den Hosenbund und knöpfte die Hose wieder zu.
Sie schreiben keinen Klassiker, sagte er, Sie schreiben einen Bestseller. Und ich möchte, dass in Ihrem Bestseller alles steht, was man jemals über Siegfried Heidl lesen möchte. Und dafür brauchen Sie bitte nicht länger als sechs Wochen.
Ich muss zugeben, es machte mich fassungslos, Gene Paley beim Hemdenwechsel zuzuschauen. Sein Verhalten verdeutlichte mir seine und meine Stellung unmissverständlicher als alles, was er hätte sagen können. Er war der König, der während des Defäkierens von Höflingen und Lieferanten umringt wurde und die Staatsangelegenheiten regelte. Gene Paley fehlten so viele Eigenschaften, die nach meinem Verständnis einen Mann ausmachten, dennoch hielt er sich für überlegen. Und obwohl ich mich dafür verachtete und mir einredete, ich wäre in Bezug auf unser Verhältnis ganz anderer Meinung, pflichtete ich ihm durch meine verunsicherte Haltung und meine zögerlichen Antworten bei.
Er hält sich für gar nichts, sagte Ray, als ich ihm später von dem Hemdenwechsel erzählte. Er weiß einfach, dass er was Besseres ist. Leute wie er saugen das entsprechende Bewusstsein mit der Muttermilch auf.
Ihre Schuhe, sagte Gene Paley, der sich jetzt fertig umgezogen hatte und mich mit ausgestrecktem Arm zur Tür scheuchte.
Sein Blick ruhte auf meinen Turnschuhen. Das Leder meines rechten Adidas Vienna hatte sich von der Sohle gelöst. Der Schuh fiel nicht gerade auseinander, noch nicht; ich hoffte, ihn irgendwie über die nächsten sechs Wochen zu retten, indem ich den Fuß nicht abrollte, sondern vorsichtig anhob und absetzte.
Haben Sie kein anderes Paar?
Da wurde mir klar, dass er mich die ganze Zeit, während der ich ihm zugeschaut hatte, beobachtet und für unzulänglich befunden hatte. Die Wahrheit war, dass ich keine anderen Schuhe besaß und mir auch keine neuen leisten konnte, und ich war zu beschämt, um ihm das – oder irgendetwas anderes – zu sagen. Mir blieb nichts übrig, als Heidl irgendwie zum Reden zu bringen, damit ich bezahlt wurde und mir unter anderem ein neues Paar Turnschuhe kaufen konnte.
4
Ich durchquerte abermals den langen Korridor – leicht humpelnd, um meinen Adidas Vienna zu schonen – und kehrte in das Eckbüro zurück, wo die Stimmung auf dem Tiefpunkt angelangt war. Heidl stand hinter dem Chefschreibtisch und sprach ins Cheftelefon. Er winkte mir knapp zu, und seine Haltung ließ sich am besten als chefmäßig beschreiben, sie war verächtlich, kontrollierend und gelassen zugleich, eine Geste der Macht. Ich setzte mich wieder an den zu kleinen Konferenztisch mit den drei schlichten Sesseln, die, wie ich mir jetzt überlegte, weniger an einen verschlungenen Francis Bacon erinnerten als an Edvard Munchs geradlinigen Schrei. Ohne Heidl aus den Augen zu lassen, startete ich meinen Mac Classic. Heidl legte den Hörer auf und setzte seinen Vortrag über die Toxoplasmose oder, wie er sie nannte, dieToxo fort.
Ziggy Heidl war von der Toxo fasziniert, zumindest behauptete er das. So oder so sprach er oft über das Thema, besonders gern darüber, wie der Toxoplasmoseerreger das Gehirn von Ratten befiel und ihnen die angeborene Angst vor Katzen austrieb. Die neuerdings furchtlosen Ratten wurden von Katzen gefressen; einmal im Körper des neuen Wirts, trat der Parasit ins nächste Entwicklungsstadium ein und vermehrte sich. Die Katzen wiederum lebten unter Menschen und gaben die Krankheit über ihre infizierten Ausscheidungen an diese weiter.
Vor allem faszinierte Heidl der Effekt, den die Toxo, die bereits das Verhalten der Ratten so krass veränderte, womöglich auf den Menschen hatte. Er konnte stundenlang über die Frage spekulieren, warum ausgerechnet die Verrückten oftmals viele Katzen hielten. Zwang der Parasit die Menschen dazu, sich um Katzen zu kümmern, damit seine Überlebenschancen stiegen? Waren die Verrückten immer schon verrückt gewesen, oder hatte die Toxo sie verrückt gemacht?
Wenn man seine Stimme ertrug, war Heidl auf seine ganz eigene Art ein angenehmer Redner; aber nichts von dem, was er sagte, war für mich von Nutzen. Und während er erzählte, inzwischen würden durch Regenwasser, das von landwirtschaftlich genutzten Flächen abfloss, sogar Delfine infiziert, kam mir zum ersten Mal der beunruhigende Gedanke, er könnte selbst so sein wie die Toxo, die ihn faszinierte. Ganz kurz hatte ich die lächerliche Befürchtung, etwas könnte von meinem Verstand Besitz ergreifen und mich gegen meinen Willen und meine Interessen handeln lassen. Da wurde mir klar, wie sehr er mich bereits verängstigt hatte und wie verrückt diese Angst war.
Ich beruhigte mich wieder und beschloss, an diesem Tag noch ein paar Seiten zu schreiben. Heidl erzählte mir zum dritten Mal – oder zum ersten? – die Geschichte von dem Zicklein, bloß dass er dem Tier diesmal so in den Kopf schoss, dass es, während er zuschauen musste, langsam verendete.
Auch das habe ich von Heidl gelernt: Es ist leicht, sich zu erinnern, und schwer zu beurteilen, ob die Erinnerung wahr ist. Die Aufrichtigkeit zieht die notwendige Lüge nach sich, und die Lüge erlaubt uns zu leben.
5
Ich weiß noch, dass ich, nachdem ich die Ziegengeschichte zum ersten – oder letzten – Mal gehört hatte, zum Fenster ging und nach draußen schaute. In der Ferne standen erschöpft gebeugte Baukräne, noch weiter dahinter schob sich die rote Sonne auf den Horizont zu und tauchte die Welt in ein fahles, blutiges Licht. Auf der Straße unter mir, drei Etagen tiefer, kickten sich zwei Arbeiter in Kaki-Overalls einen Football zu. Ich beneidete sie um diesen kurzen Moment der Freiheit; ich wusste ja nicht, dass ich immer noch frei war. Mein Blick wanderte weiter zum Eingang des Verlagshauses, wo ich Ray entdeckte. Er trug einen Lederblouson und rollte sich mit gelangweilter Miene eine Zigarette.
Ich wandte mich um. Heidl telefonierte immer noch. Ich bedeutete ihm mit einer Geste, dass ich eine kurze Pause machen würde, dann verließ ich das Büro, eilte die drei Treppen hinunter und durch die Lobby zum Haupteingang.
Draußen war alles genauso neu wie drinnen. Der Rollrasen neben dem Gehweg war frei von Abfall und Zigarettenkippen. Noch blühten keine Graffiti an den Fertigbetonwänden der Lagerhallen, keine Schnörkel zogen sich über den olivgrünen oder rostbraunen Putz der niedrigen Bürogebäude, deren erschreckende Gleichförmigkeit das gesamte Straßenbild prägte. Alles war ordentlich und sauber und wartete schon jetzt darauf, in trister Monotonie zu verkommen. Alles war so neu, dass auf den Fensterscheiben gegenüber noch die Schutzfolie klebte. Wo sie abgepellt und verdreht war, wedelte sie als blauer Hundeschwanz im Wind.
Die Bezeichnung Drecksloch wäre zu interessant für dieses Drecksloch, sagte Ray.
Ich sehnte mich nach etwas anderem – nach Aufregung, nach Emotionen, mit denen ich Heidls gefälschte Kindheit ausstaffieren könnte. Aber ich spürte nichts als eine enorme Langeweile. Wäre ich ein echter Schriftsteller gewesen, hätte ich die postmoderne Schönheit meiner Umgebung erkannt oder wenigstens ein paar Zeilen zustande gebracht, in denen ich vorgab, sie zu erkennen. Aber ich stammte von einer Insel am Ende der Welt, wo das Maß aller wichtigen Dinge nicht menschengemacht war; ein Anblick, der die moderne Literatur bewegte, ließ mich kalt. Ich stammte aus einem öden, provinziellen Kaff und konnte, wie man mir gesagt hatte, nicht einmal richtig sehen; wie wollte ich da richtig schreiben?
Ist doch scheiße, sagte Ray.
Er lehnte an einem länglichen, brusthohen Blumenkübel aus Beton. Der Kübel trug eine Art Aluminiummanschette, auf die im Siebdruckverfahren die Worte STP Publishing und daneben das berühmte Firmenzeichen aufgebracht waren, ein stilisierter weißer Wal, der aus dem Wasser sprang.
Heidl telefoniert schon wieder, sagte ich.
Der Wind ging in willkürlichen Böen und blies mir Sand ins Gesicht. Die Luft roch nach feuchtem Stein. Wahrscheinlich waren auch Geräusche zu hören, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Ferner Verkehrslärm vielleicht. Oder auch nicht. An einem Ort wie diesem hinterließ nichts einen Eindruck, weder der Klang noch die Stille.
Immerhin haben wir es bis nach Australien geschafft, ohne dabei draufzugehen, sagte Ray.
Ich besaß einen australischen Pass, wusste jedoch nicht viel über das Land, weil ich in Tasmanien aufgewachsen war, über das niemand irgendetwas wusste, schon gar nicht die Tasmanier selbst, die ihre Heimat für ein unlösbares Rätsel hielten. Melbourne war eine selbstbewusste Stadt, eine nach dem Dafürhalten ihrer Bewohner großartige Stadt, und auch manche Besucher teilten diese Meinung; eine Stadt, die an dem Glauben festhielt, sie sei von Goldgräbern gegründet worden und nicht von jenen Männern, die sich Jahre vor dem Goldrausch besonders hervorgetan hatten, indem sie an der tasmanischen Grenze Todesschwadronen befehligt und die letzten tasmanischen Ureinwohner abgeschlachtet hatten, nachts, an ihren Lagerfeuern.
Einige Tasmanier behaupteten, Melbourne sei wie Tasmanien, nur eben größer, was mir ebenso dumm vorkam wie zu sagen, Tasmanien sei wie New York, nur eben kleiner. Ehrlich, die Welt war voller Dummheiten, aber worüber sonst hätten wir reden sollen? Vielleicht besteht der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier darin, dass der Mensch seine Tage und sein Leben mit Unsinn füllen kann, er baut sich ein ganzes unsinniges Universum daraus, bis irgendwann das einzig Wahre kommt, der Tod, und dem Unsinn ein Ende macht. Inzwischen beneide ich jeden, bei dem die eine oder andere tödliche Krankheit diagnostiziert worden ist.
Ich gehe spazieren, sagte ich.
Der Straßenbelag war so schwarz und sauber wie die Küchenoberflächen einer Luxuswohnung. Frischer Betonstaub hatte sich als feiner Puder auf die hellgrauen Kantsteine gelegt, und die galvanisierten Gossengitter schimmerten in einem silbrigen Perlmutt. Ich konnte sehen, dass alles in dieser Gegend, Gene Paley hatte mich bei unserer ersten Begegnung darauf hingewiesen, für den Boom stand; dass die Nation trotz Flauten und Zinsen gedieh und wenigstens die Wirtschaft über den Berg war. Damals wurde überhaupt sehr viel über die Wirtschaft geredet, die Wirtschaft war eine Art Messias: Die Leute glaubten noch daran, so wie sie früher an die Politik geglaubt hatten und davor an Gott, und wenn die Börsenmakler sich draußen auf eine Zigarette trafen, redeten sie von der J-Kurve und frei schwankenden Wechselkursen, als könnten sie mit diesen Begriffen sich selbst und ihre Leben erklären.
Schon an der ersten Straßenkreuzung fragte ich mich, ob ich wieder mit dem Rauchen anfangen sollte, wenigstens für die Dauer des Projekts. Ich war mir nur einer einzigen Kurve bewusst, der Lederfalte in meinem rechten Adidas-Vienna-Turnschuh, der sich ein kleines Stückchen weiter von seiner Sohle gelöst hatte. In allen Straßen mehr vom Gleichen, ein Labyrinth der Monotonie, so absolut, dass ich kurz nicht mehr wusste, wo ich war und wie ich zum Verlagshaus zurückfinden sollte, das keine zweihundert Meter hinter mir lag. Ich machte kehrt, humpelte im Schongang zum Haupteingang zurück und bat Ray um eine Zigarette.
Verdammt, sagte Ray, du brauchst keine Zigarette, du brauchst eine neue Hüfte.
Er schaute den Arbeitern zu, die immer noch auf der Straße Football spielten. Einer trug einen Cowboyhut. Wenn er den Ball gefangen hatte, hielt er kurz inne, richtete sich auf, bückte sich, um seine Socken hochzuziehen, kickte etwas Kies in die Höhe und schlug den Ball dann mit großem Ernst zu seinem Mitspieler zurück. Während der andere fing, hob der Cowboy triumphierend den Zeigefinger und lief einen kleinen Kreis.
Scheiße, sagte Ray gedehnt. Er konnte so viel Ernst und Staunen in einem einzigen bedeutungslosen Wort unterbringen wie ein Nobelpreisträger in einer Rede über die Stringtheorie.
Was denn?
Es reicht, Mann.
Was reicht?
Es, sagte er.
Ich hatte keine Ahnung, was er meinte, aber so war es fast immer.
Du weißt schon, Mann, sagte Ray und beugte sich vor.
Er drehte mir lächelnd eine Zigarette aus seinem Champion-Ruby-Tabak und schaute dabei durch mich hindurch, als hätte er gerade eine Kneipenschlägerei gewonnen, oder als wollte er eine anfangen.
Das weißt du verdammt noch mal ganz genau, sagte Ray und zwinkerte mir zu. Er gab mir die Zigarette und beugte sich noch weiter vor, sodass seine Stirn fast meine berührte. Sein Blick huschte schnell nach links und rechts, und er zischte:
Er glaubt, die wollen ihn umbringen.
6
Sie wollen uns etwas sagen, die Toten. Etwas Gewöhnliches, Alltägliches. Manchmal kommen sie nachts zu mir zurück, und ich lasse sie herein. Ich leihe ihnen meine Zunge. Sie sprechen über das, was wir beobachten, sehen, hören und berühren, frei wie der Mond ziehen sie durch die wahre Nacht. Die körperlose Luft, schrieb Melville. Aber da ist kein Ziggy Heidl. Kein Ray. Da ist niemand. Früher, als ich noch nichts geschrieben hatte, wusste ich alles über das Schreiben. Heute weiß ich nichts. Über das Leben? Nichts. Das Leben? Nichts. Überhaupt nichts.
Teil 2
1
Die Banken, sagte Heidl am vierten Tag, als hätte er meine Gedanken gehört. Die Banken wollen mich umbringen.
Nach den verwirrenden, hoffnungsvollen, aufregenden ersten drei Tagen war die Lage mehr oder weniger festgefahren. Heidl antwortete allenfalls in Rätseln, die meiste Zeit war er abgelenkt oder, schlimmer noch, vollkommen desinteressiert. Sein wichtigstes Anliegen bestand darin, von Gene Paley möglichst schnell die nächste Vorschussrate zu kassieren.
Sie?, fragte ich. Warum in aller Welt sollten die Banken ausgerechnet Sie umbringen wollen?
Wegen dem, was ich getan habe. Und weil ich zu viel weiß. Ich könnte gewissen Leuten, nun ja, schaden. Berühmten Leuten. Mächtigen Leuten.
Er steigerte sich in eine Tirade hinein, völlig hingerissen von seinem eigenen tragischen Schicksal, bis ihm auf einmal – typisch für ihn – ein neuer Gedanke kam und er wie ausgewechselt war.
Glauben Sie, Paley würde mir die Vorschussrate auszahlen, wenn wir ihm ein paar Seiten zeigen?
Ich sagte ihm, dass wir keine Seiten hatten.
Aber ist das nicht Ihre Aufgabe?
Ich schüttelte den Kopf.
Die Seiten zu schreiben? Ist das nicht Ihr Job? Wozu sind Sie sonst hier?
Ich erklärte ihm, dass er mir zunächst etwas aus seinem Leben erzählen müsste, das ich dann erst in Seiten verwandeln könnte, die Gene Paley schließlich in Geld verwandeln würde.
Falls Heidl meine Bemerkung gehört hatte, ignorierte er sie.
Keine Bank will Sie umbringen, sagte ich, um das Gespräch irgendwie in Gang zu halten. Außerdem sitzen Sie sowieso bald im Gefängnis.
In Momenten wie diesen schaute er sich misstrauisch um und beugte sich vor, als wollte er mich ins Vertrauen ziehen.
Da gibt es ein paar Dinge, von denen gewisse Leute nicht wollen, dass Sie sie erfahren. Wer weiß, was ich vor Gericht aussagen werde?
Was denn zum Beispiel?
Heidl lachte. Seine Wangen warfen wütende Grübchen.
Ich werde Ihnen gar nichts verraten. Aber die glauben das Gegenteil – sie glauben, ich würde Ihnen alles verraten. Und manche Leute nähren diese Angst mutwillig.
Welche Leute?
Leute wie Eric Knowles. Er weiß alles über meine Verbindungen. Über meine Kontakte.
Kontakte zu wem?
Zu Leuten.
Zu welchen Leuten?
Zu Leuten, zischte er. Er schnaubte verächtlich und schüttelte den Kopf über so viel Naivität. Wie konnte ich nicht wissen, von wem die Rede war?
Und irgendwie schämte ich mich dafür, dass ich nicht wusste, wer gemeint war, dass ich in Bezug auf gewisse Leute nicht auf dem neuesten Stand war, so wie ich mich dafür schämte, über das meiste andere nicht auf dem neuesten Stand zu sein.
Ich will ja nicht behaupten, dass Sie solche Leute jemals getroffen hätten, sagte Heidl. Aber es gibt sie dennoch. Und in meiner Welt, in der Realität, muss man irgendwie mit ihnen fertigwerden – oder man delegiert die Aufgabe an jemand anderen.
Und?
Vielleicht war ich ja dieser andere.
Siegfried, falls Sie die CIA meinen, müssen Sie CIA sagen.
Offiziell habe ich für die nur bis Anfang der 1970er gearbeitet. In Laos. Und in der DDR. Aber danach nicht mehr. Nicht hier in Australien.
Und was haben Sie für die CIA in Laos gemacht?, fragte ich, und wieder flüchtete er sich in Ausreden, Rätsel und Worthülsen, die alles und nichts bedeuten konnten. Oder beides.
In Chile, sagte er, wie um mich zu foltern.
Chile?
Mein Codename war Jago, sagte er.
Er klang abermals verunsichert, als hätte er vergessen, was er wissen durfte oder wie viel er tatsächlich wusste. Den Geheimnisvollen spielen konnte er jederzeit, aber sobald man versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen, wies er alle Unterstellungen zurück. Heidls erste Finte bestand darin, seinen Gesprächspartner durch Ermutigung und Zustimmung zu fesseln und sogar dazu anzustiften, die Lüge in seinem Namen weiterzuspinnen. Anfangs fiel ich jedes Mal darauf herein, später dann nicht mehr. Später wurde ich selbst zur Lüge.
Ich bin nicht, was ich scheine, sagte ich.
Was?
Jago.
Das habe ich eben gesagt.
Das hat Jago gesagt. In Othello. Wenn mein Gesicht die wahre Gestalt meines Herzens zeigte, so würde mein Herz den Krähen zum Futter dienen. Ich bin nicht, was ich scheine, sagte ich.
Alles klar, sagte Heidl. Das bin ich.
Eine großartige Figur, sagte ich.
Ein großartiger Roman!
Und da waren wir wieder, hatten abermals den Faden verloren und drehten uns im Strudel von hätte sein können oder hätte nicht sein können; war nicht oder ist doch; wardoch oder ist nicht.
Niemand verlangt, dass Sie absolut alles über Ihr Privatleben ausplaudern, sagte ich.
Nein, sagte Heidl.
Aber es wäre schön, wenn wir wenigstens einen kleinen Blick darauf werfen könnten, aus Ihrer Perspektive.
Ja, sagte Heidl, aber ich habe keine Perspektive.
Dann lassen Sie uns über etwas Persönliches reden. Zum einen interessieren die Leser persönliche Dinge, zum anderen wird es Sie in einem sympathischeren Licht erscheinen lassen. Als einen Mann, der über sich und sein Leben nachdenkt. Ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert …
Sokrates.
… und erst recht nicht lesenswert, fügte ich hinzu. Ich war verwundert darüber, dass Heidl das Zitat erkannt hatte.
Das Problem ist, sagte Heidl, dass es über das geprüfte Leben nicht viel zu erzählen gibt.
Es klopfte, Pia Carnevale streckte den Kopf zur Tür herein.
Kif, Gene möchte dich sehen, sagte sie. Du sollst dir ein paar Ausdrucke ansehen.
2
Gene Paley wollte nichts dergleichen. Er wollte nur wieder wissen, wie wir vorankämen.
Noch langsamer, sagte ich.
Ich und Gene Paley standen in der Tiefgarage von TransPac, weil er mir einen Firmenwagen zeigen wollte, der demnächst ausgemustert würde. Ein neuer Nissan Skyline GTR, das begehrteste Auto seiner Zeit. Ich könne es fahren, sagte er, solange ich in Melbourne sei.
Wir machen das so, sagte Gene Paley und trommelte sanft mit seinen weißen, sehr kurzen Fingern, die mich an die Klauen eines Beuteltiers erinnerten, auf das Autodach. Ich möchte spätestens am Freitag das erste Kapitel sehen. Bis dahin sind Sie auf Bewährung. Falls das Kapitel unseren Erwartungen nicht entspricht, betrachten Sie unser kleines Experiment bitte als beendet. Wie Sie in Ihrem Vertrag nachlesen können, steht Ihnen ein Auflösungshonorar von fünfhundert Dollar zu. Wenn das Manuskript, wie wir alle hoffen, angenommen wird, machen wir weiter.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich konnte mich nicht erinnern, etwas Ähnliches – oder etwas anderes – in meinem Vertrag gelesen zu haben. Ich hatte fest damit gerechnet, früher oder später einen Scheck oder einen dicken Umschlag mit Bargeld überreicht zu bekommen. Darauf würde ich nun wohl verzichten müssen.
Ich hatte Gene Paley um einen Vorschuss bitten wollen, weil Suzy und ich noch genau zweihundertzwanzig Dollar auf dem Konto hatten und ich es nicht wagte, auch nur einen davon abzuheben. Aber ich wusste nicht, wie ich die Bitte in dieser Situation formulieren sollte, ohne unverschämt zu klingen. Das Ganze fühlte sich immer theoretischer an; ich hatte keine Ahnung, wie ich Heidl bis Freitag ein komplettes Kapitel abringen sollte. Ich spürte meine Zunge wie einen dicken Lappen in meinem Mund, während ich überlegte, wie ich Gene Paley die Wahrheit beibringen und ihm gleichzeitig ein vernünftiges Argument zum Weitermachen liefern könnte. Doch der Verleger war so allwissend, so entschlossen, er war so vieles – und wer oder was war ich im Vergleich?
Also hielt ich den Mund.
Gene Paley interpretierte mein ratloses Schweigen als Begeisterung für das Auto. Er interpretierte ständig alles Mögliche. Er fragte, welchen Wagen ich daheim führe.
Einen Holden EH Kombi, sagte ich.
Er lachte. Und wer hätte nicht gelacht? Ein fast dreißig Jahre altes Modell, zu gewöhnlich, um besondere Liebhaber zu finden, zu alt, um ansatzweise den heutigen Sicherheitsstandards zu entsprechen. Die Technik war so primitiv, dass selbst ich sie hätte reparieren können. Ich erzählte Gene Paley nicht, dass ich kürzlich erst einen neuen Unterboden angeschweißt hatte, weil der alte durchgerostet und herausgefallen war. Ich erzählte ihm nicht, dass es ins Auto hineinregnete, dass es kein Gebläse gab und im Winter die Scheiben beschlugen, dass der Wagen bei Nässe zur Todesfalle wurde.
Springen Sie mal rein, sagte Gene Paley und klopfte auf das funkelnde Dach des Nissan Skyline. Machen Sie eine Probefahrt.
Auf dem Fahrersitz fühlte man sich wie im Cockpit eines Luxuswohnmobils. Gene Paley nahm auf dem Beifahrersitz Platz, beugte sich vor, schwankte leicht, fixierte einen Punkt in der Ferne, und in seinen Augen sah ich die bleiche Gleichgültigkeit eines Geheimpolizisten, eines Serienmörders, eines Hedgefondsmaklers.
Wenn Sie wollen, sagte Gene Paley, bekommen Sie statt des Geldes diesen Wagen, ja?
Suzy und ich hatten uns lange darüber unterhalten, was wir mit den zehntausend Dollar alles anfangen könnten. Die Hälfte davon ins Haus stecken, einen Zwillingsbuggy kaufen und einen zweiten Stubenwagen; die tausend Sachen, die man für ein Baby braucht und von denen wir nun zweitausend brauchen würden.
Ich will kein Auto, sagte ich nicht ohne Bedauern. Ich will das Geld.
Mmmh, machte Gene Paley und verzog die Lippen zu einem freundlichen, möglicherweise aber auch bedrohlichen Lächeln. Er ließ den Blick sinken, als hätten die Schwerkraft und die Langeweile nun endgültig das schwache Interesse erlöschen lassen, das er anfangs an mir gehabt hatte.
Ich will keine Literatur, sagte er und richtete die traurigen Augen wieder auf mich. Ich will einen Bestseller, Kif. Und dieses Auto ist ein guter Tausch.
Wir gingen zurück in sein Büro. Er suchte gerade im Bücherregal nach irgendwelchen Footballermemoiren, die er mir als gutes Beispiel mitgeben wollte, als das Telefon klingelte. Er hob den Hörer ab. In der knackenden Leitung eine plärrende Stimme, Gene Paley verzog das Gesicht.
Jez Dempster!, rief er, und jede Silbe klang, als hätte ihn ein grausames Schicksal ereilt, dem er bis zuletzt zu entkommen gehofft hatte.
Mit der freien Hand zeigte er zur Tür.
3
Wenn wir an dem kleinen Konferenztisch saßen, war Heidl schwach und erschöpft und versuchte, mich hinzuhalten. Er wirkte körperlich geschrumpft und seltsam unbedeutend. Ich hatte ihn Hunderte Male zuvor gesehen, im Fernsehen und in der Zeitung, ohne dass ich irgendetwas in Erinnerung behalten hätte. Und selbst wenn ich ihm während der Arbeit gegenübersaß, war es schwierig, ihn zu sehen. Ich weiß noch, dass er fast kahl und sein Alter unmöglich zu schätzen war. Ein kleiner, leicht untersetzter Mann mit einem zuckenden Wangenmuskel, abgesehen davon könnte ich ihn heute nicht mehr beschreiben. Ray nannte ihn manchmal den Kobold, was den kleinen Hexer ziemlich gut auf den Punkt brachte, besser als alles, was mir eingefallen wäre.
Wenn ich aus Gene Paleys Büro zurückkam und er hinter dem breiten Chefschreibtisch saß, war er allerdings ein anderer Mensch. Dort wirkte er breiter und größer, gebieterisch und unglaublich selbstbewusst. Es war, als wäre er am Schreibtisch, der die Macht symbolisierte, plötzlich selbst mächtig geworden, und ich, der in einem Cocktailsessel neben dem Konferenztisch saß, war kein Gleichgestellter mehr, sondern nur noch ein elender Zwerg, ein Stenograf, ein unterwürfiger Angestellter. Das Ganze kam mir zunächst lächerlich vor, dann beschloss ich, es für meine Zwecke zu nutzen.
Heidl stand auf und schickte sich an, zum Konferenztisch zurückzukehren. Ich schlug ihm vor zu bleiben, wo er war.
Der Chefsessel ist doch bestimmt viel bequemer als die Stühle hier, sagte ich, was der Wahrheit entsprach. Außerdem können Sie sich dort besser um Ihre anderen Angelegenheiten kümmern.
Heidl lächelte, machte kehrt und setzte sich ohne zu zögern wieder in den Sessel hinter dem Chefschreibtisch. Noch nie hatte ich ihn so gelassen erlebt. Er entspannte die Schultern, und selbst seine Sprache veränderte sich; seine Ausdrucksweise wurde weniger formell, er schien auf einmal die Balance zu finden zwischen unserem Small Talk und der unangenehmen Aufgabe, meine Fragen beantworten zu müssen. Gleichzeitig gelang es ihm irgendwie, seine Größe und Überlegenheit zu halten. Am Schreibtisch war er, was er sein wollte – eine bedeutende Persönlichkeit vermutlich, und dennoch angepasst; ein Mann, den man in einer größeren Menschenmenge übersehen würde.
Sie leisten ganz ausgezeichnete Arbeit, Kif, sagte er und lehnte sich zurück. Ich habe Gene schon erzählt, wie begeistert ich von Ihnen bin.
Vielen Dank, Siegfried, sagte ich im Ton eines Untergebenen und tippte weiter.
Heidl hinter dem Chefschreibtisch legte die Fingerspitzen aneinander, wiegte sich langsam vor und zurück und ließ die Gelenke knacken. Es liegt nicht daran, dass der Hund auf dem Thron plötzlich wie ein König aussieht, dachte ich. Es ist bloß so, dass sich alle darauf geeinigt haben, er sei kein Hund mehr.
Vielleicht hatte ich da schon angefangen, ihn zu hassen.
Aber jetzt sollten wir uns wirklich ans Werk machen, sagte ich.
Selbstverständlich. Wozu bin ich sonst hier?
Die CIA? Schildern Sie, wie es dort war.
Habe ich bereits.
Laos. Der geheime Krieg. Erzählen Sie mir davon.
Ich war nie in Laos. Wer behauptet so einen Unsinn?
Langley?
Sie erwarten, dass ich Ihnen von diesen Dingen erzähle?
Also … ja, sagte ich. Für die zweihundertfünfzigtausend Dollar, die der Verlag Ihnen zahlt, kann ich das erwarten. Ich will ja nicht alles wissen, nur einen Teil. Bitte. Was ist mit Deutschland?
Während ich sprach, versuchte ich mich verzweifelt an irgendetwas zu erinnern, das ich vielleicht über das Deutschland der 1970er-Jahre aufgeschnappt hatte.
Wahrscheinlich waren Sie mit der Baader-Meinhof-Sache betraut?, fragte ich.
Den Schakal kannte ich persönlich. Er wurde Carlos genannt. Aber der war nicht unser Problem, wir haben uns hauptsächlich auf die Stasi konzentriert.
Der Schakal. Das ist gut.
Was?, fragte Heidl, und ich wusste: Was immer es war, es war weg.
Heidl stand auf, ging zum Lichtschalter und betrachtete ihn argwöhnisch.
Wissen Sie, was die tun werden, falls ich Ihnen etwas verrate?
Sagen Sie es mir.
Er lachte auf, ging zum Schreibtisch zurück und nahm den Telefonhörer in die Hand.
Sie müssen mich verstehen, sagte Ziggy Heidl. Das Leben allein liefert keine ausreichende Begründung für den Erfolg. Denken Sie nur an Papa Doc, sagte er. Augusto Pinochet, Walt Disney. Der Erfolg erfindet sich das Leben, das er zu seiner Begründung braucht.
Walt Disney?
Genau. Das habe ich eben gesagt.
Warum?, fragte ich.
Warum?, rief Heidl und knallte den Telefonhörer auf die Gabel. Warum! Warum! Heutzutage glauben die Leute, es gäbe für alles eine Erklärung. Aber das ist falsch. Warum passiert dieses, warum passiert jenes?
Wovon reden Sie?
Es gibt keine Erklärung!, schrie Heidl.
4
Da Heidl ein großer Magier war, verrauchte sein Zorn so schnell, wie er sich Bahn gebrochen hatte; und wie durch Zauberhand tauchte dort, wo eben noch der Zorn gewesen war, ein vermeintliches Geschenk auf.
Okay. Ich werde Ihnen eine einzige Sache verraten, sagte Heidl. Nur diese eine. Weil sie ohnehin bekannt ist.
Ich wartete. Und dann erzählte er mir die Geschichte von der kleinen Ziege zum zweiten oder ersten oder dritten Mal.
Die Ziege, sagte er. Eine kleine Ziege. Wie ist noch gleich das Wort?
Zicklein.
Er zeigte mit dem Finger auf mich. Das ist es! Ein Zicklein. Tja, man muss ein Zicklein großziehen.
Die CIA hat Ihnen eine Ziege überlassen?
Genau, raunte Heidl verschwörerisch. Verrückt, was? Das machen die, damit man was lernt.
Mussten Sie ihm die Flasche geben?
Heidl sah mich überrascht an.
Hübsche Tiere, diese Ziegenkinder. Hochintelligent.
Zicklein.
Zicklein? Zicklein sind hochintelligent. Dafür, dass sie Ziegen sind. Sie sind ziemlich anhänglich, nach einer Weile hat man sie richtig ins Herz geschlossen. Und dann eines Tages bekommt man den Befehl, sie zu erschießen.
Man lernt zu morden?
Nein. Nun ja, vielleicht. Aber darum geht es nicht.
Wohin soll man schießen? In den Kopf?
In den Kopf, sagte er.
Er wirkte unsicher.
Oder woandershin?
Eine Zeit lang schien er darüber nachzudenken, was dieses woanders bedeuten könnte. Seine Wange zuckte. Die Zeit verstrich. Irgendwann sprach er weiter.
In den Bauch.
Warum?
Heidl schwieg und fuhr mit dem Finger an der Schreibtischkante entlang. Offenbar dachte er an etwas anderes. Unmöglich zu sagen, ob er einer alten Erinnerung nachhing oder einen neuen Gedanken hatte. Bei Heidl konnte man nie wissen. Er war ständig mit Nachdenken beschäftigt, über seinen Gesprächspartner, über die Welt. Oder er dachte sich eine neue Geschichte aus. Meistens war es das.
Und dann … stirbt es, sagte er.
Langsam?
Langsam? Ja, sagte Heidl zögerlich. In den Bauch. Damit es langsam stirbt.
Er schien seine Worte eher abzuwägen als auszusprechen. Und dann klang er auf einmal selbstbewusst, fast schon bestimmend.
Und man wird gezwungen, sich das anzuschauen.
Das ist ja furchtbar, sagte ich probehalber.
Ja. Furchtbar! Heidl lächelte. Und beim Sterben stößt die kleine Ziege Laute aus. Entsetzliche Laute. Und der Gestank erst! Nach Scheiße. Ziegenscheiße. Und Pisse.
Wann war das?
Unerträgliche Laute. Wie von einem gefolterten Kind.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Keine Frage schien angemessen.
Es ist furchtbar, sagte Heidl, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie …
Wann war das?
Heidl riss die Hände in die Höhe.
Ich habe schon zu viel gesagt.
Geben Sie mir ein Datum!
Wissen Sie, die Sache ist die, man kann hören, wie die Ziege stirbt. Es klingt, als …
War es 1970? 1971?
… als würde einem Menschen die Haut vom Leib abgezogen, und man steht daneben und sieht ihn sterben.
Oder war es Ende der 1960er?
Das darf ich Ihnen nicht sagen.
Wo wurden Sie ausgebildet? Verraten Sie mir wenigstens das.