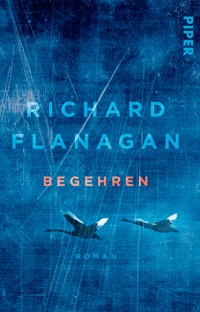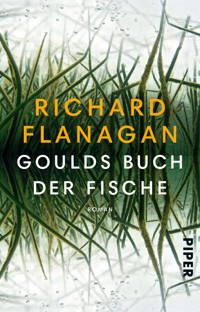
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Tasmanien unserer Tage stößt Sid Hammett, ein kleiner Antiquitätenfälscher, auf einem seiner Streifzüge auf die merkwürdige Hinterlassenschaft eines anderen Kunstfälschers. Das »Buch der Fische« eines gewissen William Buelow Gould birgt nicht nur wundervolle, akribisch hingetupfte Aquarelle der tasmanischen Fischwelt – es stellt auch ein Erinnerungswerk aus unheilvollen Tagen dar. Tiefer und tiefer zieht es Hammett hinein in die dunkelsten Kapitel britischer Kolonialzeit. Bald dämmert ihm, dass ihm der Aufstieg aus den ozeanischen Seelentiefen Goulds niemals mehr gelingen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem australischen Englisch von Peter Knecht
ISBN 978-3-492-97116-4
Dezember 2015
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
Covergestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de
Covermotiv: plainpicture/Nature-PL/Michel Roggo
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Das dickbäuchige Seepferd
Entdeckung des Buchs der Fische – Antiquitätenschwindel und heilender Glaube – Die Conga – Mr. Hung und Moby Dick – Victor Hugo und Gott – Ein Schneesturm – Warum Geschichte und Geschichten zweierlei sind – Das Buch verschwindet – Der Tod von Großtante Maisie – Meine Verführung – Ein männliches Seepferd kommt nieder – Der Sturz.
I
Das Staunen, das ich empfand, als ich das BuchderFische entdeckte, ist mir geblieben, licht wie das schillernde Marmormuster, das meinen Blick an jenem sonderbaren Morgen auf sich zog; glitzernd wie diese unheimlichen Strudel, die meinen Geist mit Farben erfüllten und meine Seele in ihren Bann schlugen – worauf mein Herz, ja, schlimmer noch mein Leben von diesem Wirbel erfasst und aufgerollt wurden zu dem armseligen, struppigen Garn dieser Geschichte, die Sie gleich lesen werden.
Was hatte es mit jenem sanften Strahlen auf sich, das mir, als wäre ich irgendein Hindu-Mystiker, gefangen im Großen Rad der Erscheinungen, den Gedanken aufzwang, ich hätte ein und dasselbe Leben immer wieder gelebt? das mir zum Schicksal werden sollte? das mir meine Persönlichkeit raubte? das meine Vergangenheit und meine Zukunft untrennbar voneinander in eins setzte?
War es der hypnotisierende Schimmer, den das unordentliche Manuskript spiralförmig auszusenden schien, ein Manuskript, aus dem bereits Seepferdchen und Seedrachen und Himmelsgucker herausschwommen und blendendes Licht in einen noch jungen trüben Tag brachten? War es einfach erbärmliche Eitelkeit des Geistes, wenn ich mir einbildete, in mir seien alle Menschen und alle Fische und alle Dinge enthalten? Oder war es etwas eher Prosaisches – schlechte Gesellschaft und noch schlechterer Fusel –, was mich auf diese monströse Bahn brachte?
Persönlichkeit und Schicksal, zwei Wörter, schreibt William Buelow Gould, für ein und dieselbe Sache – auch hier liegt er, wie immer, ganz entschieden falsch.
Der liebe, gute Billy Gould, dieser Spinner, und seine dummen Sprüche über die Liebe, über ein Maß an Liebe, das heute gar nicht mehr möglich ist und das schon damals nicht durchzuhalten war. Aber ich fürchte, ich schweife bereits ab.
Wir, unsere Geschichten, unsere Seelen – das haben seine stinkenden Fische mich gelehrt –, sind ständig dabei, uns zu zersetzen und wieder neu zu erfinden, und dieses Buch enthielt, wie ich entdecken sollte, die Geschichte des Komposthaufens, der mein Herz ist.
Selbst meine fiebrige Feder kann mein Entzücken nicht annähernd einfangen, als ich das BuchderFische aufschlug, ich war hingerissen, mir war, als ob der Rest meiner Welt – die ganze Welt! – im Dunkel versunken wäre und im Universum nur noch ein Licht existierte, das aus diesen vergilbten Seiten in meine staunenden Augen strahlte.
Ich hatte keine Arbeit – schon damals gab es wenig genug davon in Tasmanien, wenn auch nicht so wenig wie heute. Vielleicht war deswegen mein Geist für Wunder besonders empfänglich. Vielleicht erging es mir wie dem armen portugiesischen Bauernmädchen, das die Jungfrau Maria sah, weil es nichts anderes sehen wollte, vielleicht sehnte auch ich mich danach, meine Welt nicht wahrnehmen zu müssen. An irgendeinem anderen Ort als Tasmanien, wo normale Zustände herrschen, wo man einen richtigen Job hat, wo man ein paar Stunden im Gewühl unterwegs ist und dann etliche Stunden mit gewöhnlichen Ängsten und Sorgen zubringt, bevor man in die gewohnte häusliche Enge zurückkehrt, und wo kein Mensch je davon träumt, ein Seepferdchen zu sein, ja, dort kann einem vielleicht so etwas Anormales, wie ein Fisch zu werden, nicht passieren.
Ich sage vielleicht, aber sicher bin ich nicht.
Könnte ja sein, dass solche Sachen in Berlin und Buenos Aires andauernd vorkommen und dass es den Leuten bloß peinlich ist, das zuzugeben. Könnte sein, dass die Jungfrau Maria jeden Tag in den Sozialbauten und Hochhäusern von New York und Berlin und den Vorstädten im Westen von Sydney auftaucht, und alle tun so, als wäre sie nicht da, und hoffen, dass sie schnell wieder verschwindet und sie nicht weiter in Verlegenheit bringt. Könnte sein, dass das neue Fatima irgendwo in der endlosen Ödnis des Revesby Workers’ Club liegt, ein Heiligenschein über dem Bildschirm des Spielautomaten, der blinkend die Botschaft verkündet: »BLACKJACK FEVER«.
Könnte es sein, dass, weil alle ihr den Rücken zukehren, weil alle Augen starr auf die Automaten gerichtet sind, niemand Zeuge wird, wie eine alte Frau, die ihren Keno-Spielschein ausfüllt, vom Boden abhebt und schwebt? Vielleicht haben wir die Fähigkeit, jenen sechsten Sinn verloren, den man braucht, um Wunder wahrzunehmen, um Visionen zu haben, um zu verstehen, dass wir etwas anderes sind, etwas Größeres als das, was man uns immer eingeredet hat. Vielleicht ist eine umgekehrte Evolution schon länger im Gange, als ich dachte, und wir sind bereits triste, stumme Fische. Wie gesagt, ich bin nicht sicher, und die einzigen Leute, denen ich traue, unter ihnen Mr. Hung und die Conga, wissen es auch nicht genau.
Überhaupt bin ich, ehrlich gesagt, zu dem Schluss gelangt, dass nur wenige Dinge im Leben sicher sind. Auch wenn Sie im Folgenden vielleicht einen anderen Eindruck gewinnen werden, liegt mir sehr wohl etwas an der Wahrheit, aber ich frage mich – wie William Buelow Gould, der unermüdlich nach der Wahrheit seiner Fische forschte, auch wenn sie über seiner zwecklosen Suche längst gestorben waren –: Wo ist die Wahrheit zu finden?
Was mich betrifft, so sind mir das Buch und alles Übrige genommen worden, aber letztlich ist auf Bücher ja auch nicht mehr Verlass als auf Märchen, oder?
Es war einmal ein Mann namens Sid Hammet, und der entdeckte, dass er nicht der war, für den er sich gehalten hatte.
Es war einmal eine Zeit, da gab es noch Wunder, und jener Mann namens Hammet glaubte, er wäre in eines davon mitten hinein geraten. Bis zu dem Tag hatte er sich immer von seinem gesunden Menschenverstand leiten lassen, was weniger freundlich ausgedrückt heißt, dass sein Leben aus fortschreitender Ernüchterung bestand. Danach war er mit dem grausamen Gebrechen des Glaubens geschlagen.
Es war einmal ein Mann namens Sid Hammet, der in dem Licht eines sonderbaren Buchs über Fische seine eigene Geschichte aufscheinen sah. Sie begann wie ein Märchen und endete wie ein Kinderreim: ... reitet ein Pferdchen nach Banbury Cross.
Es war einmal, es war einmal, vor langer Zeit, da geschahen furchtbare Dinge, aber sie geschahen an einem fernen, vergessenen Ort, und der ist, wie wir alle wissen, nicht hier, nicht jetzt, nicht wir.
II
Bis zu jener Zeit beschäftigte ich mich damit, vergammelte alte Möbel zu kaufen, die ich auf alle mögliche Weise noch weiter demütigte und ramponierte. Wenn ich irgendwelche kläglichen Kommoden mit Hämmern bearbeitete, um ihnen die rechte Patina der Armseligkeit zu verleihen, wenn ich meine Pisse über die alten Metallbeschläge regnen ließ, um die Bildung von fauligem Grünspan zu befördern, wobei ich genüsslich ordinäre Flüche aller Art ausstieß, stellte ich mir immer vor, diese Möbelstücke wären die Touristen, die sie unweigerlich in der irrigen Vermutung kaufen würden, sie hätten es mit Treibgut einer romantischen Vergangenheit zu tun und nicht mit dem, was sie waren, Belegstücke einer verrotteten Gegenwart.
Meine Großtante Maisie sagte, es sei ein Wunder, dass ich überhaupt Arbeit gefunden hätte, und ich musste insgeheim zugeben, dass sie wahrscheinlich wusste, wovon sie redete, denn hatte sie mich nicht mit sieben auf den Rugbyplatz von North Hobart mitgenommen, um im wunderschönen roten Spätwinterlicht der Mannschaft von North Hobart auf wundersame Weise das Halbfinale gewinnen zu helfen? Sie hatte den aufgeweichten Rasen mit heiligem Wasser aus Lourdes besprenkelt. Der große John Devereaux war Captain und Coach, ich war eingewickelt in den rotblauen Schal der Demons wie eine ägyptische Katzenmumie, nur die großen neugierigen Augen waren zu sehen. In der Halbzeit rannte ich aufs Feld, um durch einen Wald stämmiger, schweißparfümierter Spielerbeine zu lugen und eine Brandrede des großen John Devereaux zu hören.
North Hobart lag weit zurück; ich wusste, dass er seinen Spielern etwas Bemerkenswertes sagen würde, und der große John Devereaux war nicht der Mann, der seine Anhänger enttäuschte. »Schlagt euch eure gottverdammten Sheilas aus dem Kopf«, sagte er. »Du, Ronnie, vergiss diese Jody. Und du, Nobby, reiß dich von dieser Mary los.« Und so weiter. Es war großartig, zuzuhören, wie er da die Namen von all den Mädchen aufzählte, und zu spüren, wie viel sie diesen Riesenkerlen bedeuteten. Und als sie dann wirklich loslegten und gewannen, wusste ich, dass Liebe und Wasser zusammen einfach unschlagbar sind.
Aber um auf meine Arbeit mit den Möbeln zurückzukommen, so war das, wie Rennie Conga (nur für den Fall, dass jemand von ihren Verwandten das liest und daran Anstoß nimmt, füge ich gleich hinzu, dass das nicht ihr korrekter Name ist, aber ihren vollen italienischen Namen kann sich kein Mensch merken, und irgendwie passt der andere ganz gut zu ihrer sehnigen Gestalt und den hochgeschlossenen, dunklen Sachen, in die sie ihre Schlangenfigur hüllt), meine Bewährungshelferin damals, es ausdrückte, ein Job mit Zukunft, vor allem dann, wenn die Kreuzfahrtschiffe voller dicker alter Amerikaner anlegten. Mit ihren hervortretenden Bäuchen, den komischen dünnen Beinen in Shorts und den noch komischeren großen weißen Schuhen, die den Punkt unter diese überdimensionalen Gestalten setzten, waren die Amerikaner liebenswerte Fragezeichen der Menschheit.
Ich sage liebenswert, aber was ich eigentlich sagen will, ist: Sie hatten Geld.
Sie hatten allerdings auch ihre besonderen, etwas merkwürdigen Vorlieben, aber was das Geschäft betrifft, kam ich mit ihnen gut zurecht und sie mit mir. Eine Zeit lang hatten die Conga und ich einen guten Lauf mit alten Stühlen, die sie auf einer Auktion ersteigert hatte, als wieder einmal der tasmanische Ableger einer australischen Bundesbehörde aufgelöst wurde. Ich malte die Dinger schön bunt an, ging mit Sandpapier drüber und machte mit einer Gemüsereibe hie und da Kratzer rein, ich pinkelte drauf, und am Ende kamen sie als Shaker-Möbel raus, die irgendwann im vorigen Jahrhundert, so sagten wir den Fragezeichen, mit Walfangschiffen aus Nantucket, immer auf der Jagd nach den Riesen des Meeres, in diese Breiten geraten waren.
Es war eigentlich die Geschichte – diese, und nur diese –, welche die Touristen kauften, eine erhebende, herzbewegende, maßgeschneidert amerikanische Geschichte – Wir finden die Unseren, wir retten sie und führen sie heim! –, und eine ganze Weile lief die Sache bestens. So gut, dass wir bald ausverkauft waren und die Conga das Unternehmen um eine Produktionsabteilung erweitern musste. Sie tat sich mit einem Vietnamesen zusammen, der mit seiner Familie neu zugezogen war. Ich kümmerte mich um die Geschichte, die ich schön ordentlich abtippte, und um unanfechtbare Echtheitszertifikate von einer extra zu diesem Zweck erfundenen Organisation, die wir die »Vandiemonische Antiquitätenhändler-Vereinigung« nannten.
Die Geschichte des Vietnamesen (er hieß Lai Phu Hung, aber die Conga, die Wert auf Respekt legte, bestand darauf, dass wir ihn Mr. Hung nannten) war nicht weniger interessant, die Flucht der Familie aus Vietnam gefährlicher, die Überfahrt nach Australien in einer überfüllten, heruntergekommenen Fischdschunke entbehrungsreicher als alles, was je in alten Walfängerlegenden erzählt werden könnte, und obendrein konnten es die Leute in der Kunst der Walbeinschnitzerei mit jedem Seemann aufnehmen. Diese Arbeiten – die Motive waren den Holzschnitten in einer alten Volksausgabe von MobyDick entnommen – brachten dem Laden recht beachtliche Nebeneinnahmen.
Aber Mr. Hung und seine Familie hatten keinen Melville, keinen Ishmael oder Queequeg oder Ahab auf dem Achterdeck, sie konnten nicht mit einer romantischen Vergangenheit aufwarten, sondern nur mit ihren ganz gewöhnlichen Sorgen und Träumen, und die waren so schmuddelig und unheilbar normal, dass die gefräßigen Fragezeichen ihnen keinerlei Beachtung schenkten. Sie wollten nur Sachen, die sie davor bewahrten, mit der Vergangenheit und den Menschen im Allgemeinen konfrontiert zu werden, sie wollten nichts, das irgendeine schmerzliche oder menschliche Verbindung mit sich brachte.
Sie wollten, das wurde mir nach und nach klar, Geschichten, in denen sie bereits gefangen waren, und nicht Geschichten, in denen sie gemeinsam mit dem Erzähler entkamen. Sie wollten das Stichwort »Walfänger« hören, damit sie prompt
»Moby Dick« antworten und die dazu passenden Fernsehserien, die sie im Kopf hatten, aufrufen konnten; und dann konnte man sagen: »Antik«, und sie konnten antworten:
»Wie viel?«
Solche Geschichten. Geschichten, die Geld bringen.
Das, was Mr. Hung zu erzählen hätte, wollten die Fragezeichen nicht hören, und diesem war das in gewisser Weise ganz willkommen, unter anderem, weil er im Grunde seines Herzens nicht Kranführer sein wollte wie früher in Hai-Phong, sondern Dichter, und dieser Traum ermöglichte es ihm, der Gleichgültigkeit einer kalten Welt in einer Haltung romantischer Resignation zu begegnen.
Denn Mr. Hungs eigentliche Religion war die Literatur. Er gehörte zu der buddhistischen Cao-Dai-Sekte, die Victor Hugo als eine Gottheit betrachtete. Aber er erwies nicht allein den Romanen dieses Gottes religiöse Verehrung, sondern war auch vertraut (und stand in offenbar innigem geistigen Verkehr) mit etlichen anderen Großen der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts, lauter Autoren, die ich allenfalls dem Namen nach kannte.
Die Touristen waren schließlich nach Hobart gekommen und nicht nach Hai-Phong, und deshalb interessierten sie sich nicht die Bohne für Mr. Hung und seinesgleichen, und sie dachten nicht daran, Geld für seine Geschichten von den Kormoranen, mit denen sein Vater gefischt hatte, auszugeben, und auch mit seiner Poesie und seinen Ideen von den Beziehungen zwischen Gott und der französischen Literatur war nichts zu verdienen. Und so richtete denn Mr. Hung im Keller seines alten Hauses in Lutana, das der Zinkbergwerksgesellschaft gehörte, eine kleine Werkstatt ein, wo er pseudoantike Stühle schreinerte und in falsches Walbein Illustrationen schnitzte, die die schmutzigeren unserer Lügengeschichten ergänzten.
Und warum hätten Mr. Hung und seine Familie, die Conga und ich uns deswegen je Gedanken machen sollen?
Die Touristen hatten Geld, und wir brauchten Geld. Sie wollten dafür lediglich belogen und betrogen werden, nur eines war ihnen wichtig, und das wollten sie von uns hören, nämlich, dass ihnen nichts geschehen konnte, dass ihr Gefühl von Sicherheit – von nationaler, persönlicher, spiritueller Sicherheit – nicht bloß eine tückische Illusion war, ein böser Streich einer gelangweilten, launischen Vorsehung. Sie wollten bestätigt bekommen, dass es keine Verbindung zwischen damals und jetzt gab, dass sie keine schwarze Armbinde tragen mussten und kein schlechtes Gewissen zu haben brauchten, weil sie reich und mächtig waren und alle anderen nicht, dass sie sich keine Vorwürfe machen mussten, weil niemand erklären konnte oder wollte, weshalb der Reichtum der wenigen auf so merkwürdige Weise mit dem Elend der vielen zusammenhing. Wir taten in aller Freundlichkeit so, als ginge es um ein Geschäft mit alten Stühlen, um Fragen von Preis und Herkunft, die wir gerne beantworteten.
Aber es ging nicht um Preis und Herkunft, es ging um nichts dergleichen.
Die Touristen hatten beharrlich drängende unausgesprochene Fragen, und wir antworteten, so gut es eben ging, mit falschen Antiquitäten. In Wirklichkeit fragten sie: »Sind wir sicher?«, und eigentlich lautete unsere Antwort: »Nein, aber wenn Sie genügend nutzlose Sachen vor sich auftürmen, sehen Sie nicht mehr so genau, was los ist.« Und weil Hybris nicht bloß irgendein altgriechisches Wort ist, sondern etwas, was der Mensch ganz tief in seinem Inneren, mit einem geradezu unfehlbaren Instinkt, spürt, wollten sie auch wissen:
»Wenn wir schuldig sind, müssen wir dann auch dafür büßen?«, und wir sagten: »O ja, und wie! Aber wenn Sie so einen Stuhl kaufen, ist uns beiden ein bisschen besser zu Mute.« Sicher, das alles war nicht so toll, aber es war auch nicht so schlimm, es war eben mein Lebensunterhalt damals, und ich musste zwar eine Menge Stühle rumtragen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Welt auf meinen Schultern lastete.
Man sollte meinen, so ein Unternehmen hätte den allgemeinen Beifall finden müssen, es hätte unweigerlich expandieren und sich immer weiter verästeln müssen, um zu einem von der ganzen Nation hoch geachteten riesigen Erlösungswerk zu werden. Ja, es hätte Exportpreise gewinnen müssen. In jeder Stadt, die auch nur einen Schuss Pulver wert ist – Sydney zum Beispiel –, wäre ein solch visionärer Schwindel reich belohnt worden. Aber wir befanden uns nun einmal in Hobart, wo Träume eine streng gehütete Privatsache blieben.
Und so machten verschiedene ortsansässige Antiquitätenhändler, deren Rechtsanwälte uns brieflich mit rechtlichen Schritten drohten, unseren hochgesinnten Bemühungen, den pensionierten Tribunen eines dahinsiechenden Imperiums Trost zu spenden, den Garaus. Die Conga sah sich gezwungen, zusammen mit dem vietnamesischen Möbelfälscher ein Ökotourismusprojekt aufzuziehen, und ich musste mich nach etwas Neuem umsehen.
III
So standen die Dinge an jenem Wintervormittag, der sich als schicksalsträchtig erweisen sollte, wenn er auch zunächst nicht mehr als Eiseskälte versprach. Ich trieb mich an jenem Morgen an den Kais von Salamanca herum. Ich kam an einem alten Lagerhaus aus Sandstein vorbei, das noch nicht geschmackvoll herausgeputzt und zu einem schicken Touristenrestaurant mit Garten umgewandelt war, sondern einen Trödlerladen beherbergte.
Dort fiel mir ein alter Fleischschrank aus Eisenblech auf, der halb versteckt hinter einigen schwarz gebeizten Kleiderschränken aus den 40er Jahren stand, unansehnlichen Dingern, die keinen Touristen je hätten reizen können, mochte er sich auch noch so sehr nach Absolution sehnen. Neugierig wie ein Kind, das hinter jeder geschlossenen Tür ein Geheimnis wittert, ging ich hin und schaute hinein.
Ich sah zuerst nur einen Stapel verstaubte alte Frauenzeitschriften. Enttäuscht wollte ich die Tür wieder schließen, als mir ein paar abgerissene feine Leinenfäden in die Augen sprangen, die sich von irgendwo unter all den vergilbten Klatschgeschichten und Sensationsberichten von sterbensunglücklichen Prinzessinnen frech ans Licht sträubten wie die Stoppeln meiner Großtante Maisie, ganz ohne Scham, wie von einer gewissen archaischen Vitalität hervorgetrieben.
Die Blechtür ächzte dumpf, als ich sie ganz aufzog, um genauer hineinzuschauen. Die Fäden standen, das sah ich jetzt, aus einem aufgeplatzten, nur unvollständig erhaltenen Buchrücken heraus. Ganz vorsichtig, als müsste ich einen kapitalen Fisch aus dem Gewirr meines Netzes befreien, fasste ich ins Innere des Schranks, hob die Zeitschriften hoch und zog sachte meine Beute darunter hervor, ein halb zerfallenes Buch.
Ich hielt es hoch.
Ich schnupperte daran.
Merkwürdig, es hatte nicht den süßlich dumpfen Geruch, den alte Bücher sonst haben, es roch vielmehr wie der salzige Wind, der von der Tasmansee hereinweht. Ich strich mit dem Zeigefinger über den Einband. Er war von einem feinen schwarzen Schmutzfilm überzogen, dennoch fühlte er sich seidig glatt an. Und als ich diesen Treibsand der Jahrhunderte wegwischte, geschah das erste von vielen erstaunlichen Dingen.
Ich hätte schon damals wissen müssen, dass dies kein gewöhnliches Buch war, und schon gar nicht eines, mit dem ein Verlierer wie ich sich einlassen sollte. Ich kannte, so dachte ich zumindest, die Grenzen meines Ganoventums, ich glaubte, ich hätte gelernt, mich vor Narreteien in Acht zu nehmen, die mit persönlichem Risiko verbunden sind.
Aber es war zu spät. Ich war, um einen Ausdruck zu verwenden, der mir im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verhandlungen öfter begegnet ist, bereits »verstrickt«. Denn unter dem feinen schwarzen Puder passierte etwas höchst Ungewöhnliches: Der marmorierte Einband des Buchs begann, erst schwach, dann immer intensiver, purpurrot zu glühen.
IV
Es war ein melancholischer Wintertag.
Schnee ummantelte den Berg über der Stadt. Nebel waberte über dem breiten Fluss und fiel langsam wie eine schwere Decke über das Tal, in dem die stillen, wenig belebten Straßen von Hobart lagen. Durch die eisige Schönheit des Morgens eilten ein paar in das gescheckte Bunt eines kalten Tages gekleidete Gestalten und verschwanden. Das Weiß des Berges verwandelte sich in Grau, dann verschwand er, um hinter einer schwarzen Wolke zu brüten. Die Stadt glitt in sanft dösenden Schlaf hinüber. Wie verlorene Träume tanzten Schneeflocken durch ihre verstummte Welt.
Alles das ist nicht ganz nebensächlich, denn was ich eigentlich sagen will, ist, dass es kalt war wie in einem Grab und zehnmal stiller, dass es an einem solchen Tag keine Vorzeichen gab, nichts, was mich vor dem, was sich anbahnte, hätte warnen können. Und natürlich verirrte sich außer mir kein Mensch an einem solchen Tag in einen düsteren, kaum beheizten Trödlerladen. Der Besitzer rührte sich nicht weg von seinem Platz am anderen Ende des Raums, wo ein Heizstrahler stand. Zusammengekauert saß er da, den Rücken mir zugewandt; er hatte die ordinäre Hymne moderner Verkaufskultur, Vivaldis VierJahreszeiten, verstohlen abgedreht und machte es sich bequem im gemütlichen Rubato der Rennberichte, schlüpfte hinein wie in einen goldenen Hausschuh des Lauts.
Keine Menschenseele außer mir wurde Zeuge dessen, was sich ereignete, als ich die Staubschicht vom Deckel dieses sonderbaren Buches abwischte, eines Wunders, das die ganze Welt auf den düsteren Winkel eines Trödlerladens und die Ewigkeit auf diesen einen Moment zusammenschnurren ließ.
Der Einband des Buches war wie die Haut eines Trompeterfisches, den man bei Nacht gefangen hat, eine einzige Masse von pulsierenden purpurroten Flecken. Und je mehr ich wischte, desto mehr breiteten sich diese Flecken aus, bis fast die ganze Fläche farbig glühte. Und so, wie sich das gesprenkelte Leuchten auf den nächtlichen Fischer überträgt, der den Trompeterfisch in die Hand nimmt, so begannen nun auch meine Hände zu phosphoreszieren, ein unregelmäßiges Muster von purpurroten Sommersprossen erschien, funkelnd wie die Lichter einer exotischen, unbekannten Stadt, die man nachts vom Flugzeug aus sieht. Als ich meine schimmernden Hände in ungläubigem Staunen hob und langsam vor meinem Gesicht hin und her drehte, Hände, die mir so vertraut und doch so fremd waren, hatte ich das Gefühl, dass eine verstörende Verwandlung begonnen hatte.
Ich legte das Buch auf die Resopalplatte eines Tisches, der neben dem Fleischschrank stand, strich mit meinem funkelnden Daumen über die weiche Flanke verletzlicher bebender Seiten und schlug es auf. Aus den geöffneten Seiten sprang mir das gemalte Bild eines dickbäuchigen Seepferds in die staunenden Augen. Umrahmt wie von angeschwemmtem Riementang und Seegras wurde es von unregelmäßigem handschriftlichen Gekrakel, in das immer mal mit Wasserfarben gemalte Fische eingestreut waren.
Es war, um die Wahrheit zu sagen, ein fürchterliches Tohuwabohu. Wie Kraut und Rüben lagen mehrere Schichten von mit Tinte und Bleistift geschriebenen Zeilen übereinander. Offenbar hatte der Schreiber, als er auf der letzten Seite angelangt war, das Buch einfach umgedreht und, sozusagen len weitergeschrieben, weil der Platz nicht ausreichte. Und als ob das noch nicht chaotisch genug gewesen wäre – und das war es –, hatte er noch eine Unmenge an Nachträgen und Anmerkungen hinzugefügt, teils irgendwo am Rand, wo sich ein freies Plätzchen fand, teils auf losen Blättern, einmal sogar auf etwas, was wie getrocknete Fischhaut aussah. Er schien alles verwendet zu haben, was ihm in die Finger kam – altes Segeltuch, aus irgendwelchen gedruckten Büchern herausgerissenes Papier, Sackleinen, ja sogar Jute – und hatte es in diesem ausdrucksvoll krakeligen Duktus, der ohnehin schwer zu entziffern war, vollgeschrieben.
Das chaotische Ganze machte den Eindruck eines Buchs, das weder einen richtigen Anfang noch ein Ende hatte. Es war, als schaute man in eines dieser hübschen Kaleidoskope: eine sonderbare, manchmal frustrierende, manchmal faszinierende Geschichte und überhaupt nicht das, was man erlebt, wenn man ein anständiges, ordentliches Buch aufschlägt.
Und doch war ich, bevor ich eigentlich wusste, wie mir geschah, mitgerissen im Strudel der Geschichten, die diese Fische begleiteten – sofern man das, was der Band enthielt, Geschichten nennen kann, denn es war eher eine Art Journal oder Tagebuch, das manchmal von Ereignissen aus den ordinären Niederungen der weltlichen Existenz berichtete, manchmal aber auch von so übergeschnappten Dingen, dass ich zuerst dachte, ich hätte es mit einer Chronik von Träumen oder Albträumen zu tun.
Offenbar war dieses seltsame Werk von einem Sträfling namens William Buelow Gould verfasst worden, der 1828 von dem Arzt der Strafkolonie Sarah Island angeblich im Dienst der Wissenschaft beauftragt worden war, alle Fische zu malen, die man dort fing. Die Bilder malte er auf Befehl, die Texte aber schrieb er aus eigenem Antrieb und obwohl es den Häftlingen ausdrücklich verboten war, solche Aufzeichnungen zu führen. Jede Geschichte war in einer anderen Farbe geschrieben; der Autor teilt mit, er habe die verschiedenen Tinten erfinderisch aus allerlei Materialien, die eben gerade zur Hand waren, selbst hergestellt: die rote aus Kängurublut, die blaue aus einem gestohlenen Edelstein, den er zu Pulver zerstieß, und so fort.
Der Mann schrieb farbig, ja, ich habe den Verdacht, er fühltefarbig. Ich meine damit nicht, dass er etwa endlos von weinroten Sonnenuntergängen geschwärmt hätte oder von der azurblauen Pracht einer stillen See. Es kommt mir eher so vor, als hätten gewisse Farbtöne in seiner Welt ihn überwältigt, als ergäbe sich das Universum aus den Farben und nicht umgekehrt. Erlöste ihn, überlegte ich, das Wunder der Farbe von den Schrecken seiner Welt?
Trotz – aber vielleicht auch wegen – des ungeschliffenen Stils, trotz vieler Ungereimtheiten, obwohl der Text so mühsam zu entziffern und von sehr befremdlicher Schönheit war, nicht zu reden von eher närrischen und manchmal schlichtweg abstrusen Momenten, schlug mich dieser Regenbogen von Geschichten, den er im Verborgenen geschaffen hatte, derart in seinen Bann, dass ich bereits das halbe Buch verschlungen hatte, ehe ich zu Sinnen kam.
Ich fand einen alten Lumpen auf dem Fußboden und wischte mir damit die Hände ab. Ich musste lange reiben, bis die letzte Spur der leuchtend roten Sprenkel getilgt war. Das Buch vergrub ich wieder unter den Illustrierten in dem Fleischschrank, den ich nach einigem Feilschen zu einem angemessen niedrigen Preis kaufte, denn natürlich durfte so ein halb verrosteter Blechkasten, der nicht einmal – noch nicht – in Mode war, nicht viel kosten.
Was ich eigentlich vorhatte, als ich, schwer beladen mit dem sperrigen Schrank, in das Schneegestöber hinaustrat, weiß ich bis heute nicht. Mir war klar, dass ich den Blechkasten auf antik spritzen und für das Doppelte dessen, was ich bezahlt hatte, irgendjemandem andrehen konnte, der seine Stereoanlage darin aufstellen würde, und wenn ich die alten Illustrierten einem Zahnarzt für sein Wartezimmer gab, so würde er mir dafür eine Füllung erneuern, aber was ich mit dem BuchderFischeanfangen würde, war mir schleierhaft.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich zuerst den niedrigen Impuls hatte, die Seiten mit den Fischaquarellen herauszureißen und zu rahmen, um sie an einen Antiquitätenhändler, der auf Kunstdrucke spezialisiert war, zu verhökern. Aber als ich das Buch las und immer wieder las in jener kalten Nacht und der folgenden und in vielen weiteren Nächten, schwand meine Gier, daraus Profit zu ziehen, mehr und mehr.
Die Geschichte verzauberte mich. Ich gewöhnte mir an, das Buch ständig mit mir herumzutragen, als wäre es eine Art Talisman, als enthielte es eine Magie, die mir irgendeine fundamentale Erkenntnis übermitteln oder mitteilen könnte. Aber was für eine Erkenntnis das sein sollte und warum sie so ungeheuer wichtig war, hätte ich unmöglich sagen können und kann es bis heute nicht.
Was ich mit trauriger Gewissheit sagen kann, ist, dass ich mit meiner Faszination allein blieb: Historiker, Bibliophile und Verleger, denen ich meine Entdeckung vorführte, spürten offenkundig nichts vom Zauber des Buches.
Zwar gestanden sie alle zu, dass es wirklich alt war, aber vieles darin – die angeblich authentische Geschichte, die erzählt wird, die abgebildeten Fische, die Schilderungen von Sträflingen und Wachleuten und Beamten im Strafvollzug – schien mit den bekannten Fakten immer nur gerade so weit übereinzustimmen, dass ein Streit darüber entstehen musste. Dieses kämpferische Buch, so machten die Experten deutlich, sei das durchaus kuriose, aber gleichwohl unbedeutende Produkt eines schwer gestörten Geistes einer längst vergangenen Zeit.
Ich konnte die Leute vom Museum dazu überreden, Papier und Tinten und Farben mit den allerneuesten naturwissenschaftlichen Verfahren gründlich zu untersuchen und mit Hilfe der Radiokarbonmethode zu datieren. Sie gaben zu, dass Materialien und Techniken zu der Periode passten, in der das Buch nach Aussage des Autors entstanden war, aber die Geschichte als solche schien ihnen derart unglaubwürdig, dass sie sich weigerten, das Werk als echte und beachtenswerte historische Quelle anzuerkennen. Sie gratulierten mir lediglich zu meiner technisch exzellent gemachten Fälschung und wünschten mir bei meinen weiteren Geschäften in der Touristenbranche viel Erfolg.
V
Meine letzte Zuversicht setzte ich in den prominenten Kolonialhistoriker Professor Roman de Silva. Einige Tage lang, nachdem ich ihm das BuchderFischegeschickt hatte, machte ich mir Hoffnungen, aber als ich dann viele Wochen vergeblich auf eine Antwort wartete, wurde ich wieder mutlos.
Irgendwann rief dann endlich an einem diesig feuchten Donnerstagnachmittag seine Sekretärin bei mir an, um mir zu sagen, dass der Gelehrte noch am selben Tag in seinem Zimmer in der Universität für zwanzig Minuten zu einem Gespräch zur Verfügung stehen werde.
Ich traf auf einen Mann, dessen äußere Erscheinung in einem sonderbaren Missverhältnis, ja in völligem Widerspruch zu seiner Reputation stand. Professor Roman de Silva wirkte mit seinen ruckartigen Bewegungen, der rundlich feisten Figur und der pechschwarz gefärbten Haartolle, die mit dem unwahrscheinlichen Schwung der frühen 60er Jahre über dem winzig kleinen Kopf wippte, wie die unglückselige Kreuzung einer Elvis-Puppe und eines nervösen Leghorngockels.
Es war von Anfang an klar, dass dem Buch derFischehier unnachsichtig der Prozess gemacht werden würde. Der Professor, eisern entschlossen, die Verhandlungen keinen Augenblick lang in eine bloße Unterhaltung abgleiten zu lassen, eröffnete sogleich sein Plädoyer, das zu einem Triumph der Anklage geraten sollte.
Er drehte sich um und kramte in einer Schublade, um plötzlich mit einer schnellen Bewegung, die dramatisch effektvoll sein sollte, aber nur ungeschickt wirkte, eine eiserne Kugel an einer Kette auf die Schreibtischplatte plumpsen zu lassen. Ein hässlich knackendes Geräusch zeigte an, dass Holz zu Bruch gegangen war, aber das focht Professor de Silva, ganz Könner in seinem Fach und mitgerissen von seinem eigenen schauspielerischen Elan, nicht im Geringsten an.
»Da, sehen Sie, Mr. Hammet!«, rief er.
Ich sagte nichts.
»Was sehen Sie da, Mr. Hammet?«
Ich sagte nichts.
»Eine Kugel an einer Kette, Mr. Hammet, das sehen Sie. Eine Sträflingskugel, nicht wahr?«
Ich nickte, ich wollte nicht unhöflich sein.
»O nein, Mr. Hammet, Sie sehen in Wahrheit nichts dergleichen. Einen Schwindel sehen Sie, Mr. Hammet. Sie blicken auf eine Kugel an einer Kette, die im späten 19. Jahrhundert von früheren Strafgefangenen hergestellt wurde – als Souvenir zum Verkauf an Touristen, die in die Strafkolonie Port Arthur gereist waren, um dieses Land des Schreckens aus der Nähe zu besehen. Ein billiges, gefälschtes Machwerk für Touristen sehen Sie, Mr. Hammet. Ein Stück Kitsch, das mit Geschichte nichts zu tun hat.«
Er hielt inne und stopfte mit dem Knöchel eines Zeigefingers nass glänzende schwarze Borsten, die lang und struppig aus seinen Nasenlöchern ragten, in ihre Höhlen zurück, dann fuhr er fort in seinem Monolog.
»Geschichte, Mr. Hammet, ist das, was man nicht sieht. Geschichte hat Kraft, eine Fälschung nicht.«
Ich war beeindruckt. Ich wurde hier offenbar mit der Vergangenheit meiner eigenen edlen Zunft konfrontiert. Und das Ding sah ganz so aus, als würde es sich gut verkaufen lassen. Ich überlegte, ob Mr. Hung Talent fürs Schmiedehandwerk hatte und ob ich nicht die Conga anrufen sollte, um ihr mitzuteilen, dass ich zufällig auf eine lukrative neue Produktlinie gestoßen war, und wie ich es im Verkaufsgespräch anstellen sollte, unsere amerikanischen Freunde unaufdringlich auf die erotische Brisanz aufmerksam zu machen, die sie unweigerlich in diesem Artikel entdecken würden (»Gibt es denn überhaupt nichts auf Gottes weiter Erde«, hatte die Conga eines Tages ausgerufen, »was die nicht mit Sex verbinden?«, und Mr. Hung hatte geantwortet: »Menschen«), und während ich nachdachte, ließ Professor Roman de Silva mit völligem Mangel an Respekt, fand ich, Goulds BuchderFischeneben Kugel und Kette auf den Schreibtisch fallen.
»Und das da, das ist um kein Haar besser. Eine alte Fäl-
schung vielleicht, Mr. Hammet« – er musterte mich mit betrübten wissenden Augen –, »obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob dieses Adjektiv hier angebracht ist.«
Er wandte sich ab, steckte die Hände in die Hosentaschen und blickte stumm lange, sehr lange, so kam es mir vor, zum Fenster hinaus auf einen Parkplatz einige Stockwerke tiefer.
»Aber gleichwohl eine Fälschung.«
Und dann fuhr er, immer noch mit dem Rücken zu mir, fort, in einem, wie ich vermute, an Generationen von leidenden Studenten geschärften Stil über das Buch der Fische herzuziehen: Die Strafkolonie, die dort geschildert werde, so teilte er dem Fenster und dem Parkplatz mit, sehe aus, auf den ersten Blick jedenfalls, wie diejenige, die tatsächlich auf der Insel existiert habe, ein Ort der Verdammnis, der den schlimmsten Bösewichtern vorbehalten war. O ja, die Lage sei durchaus korrekt geschildert: eine von aller Zivilisation abgeschnittene Insel in einer weiten Bucht, eingefasst von der undurchdringlichen Wildnis des westlichen Van Diemens Land, von unerforschten Gebieten, die in den Karten jener Zeit lediglich als eine düstere Ödnis namens Transsylvanien erschienen.
Er drehte sich um, strich zum hundertsten Mal seine von Schuppenkonfetti übersäte Haartolle zurück.
»Aber wenn es auch historisch verbürgt ist, dass Sarah Island von 1820 bis 1832 die gefürchtetste Strafkolonie im ganzen britischen Empire war, so stimmt doch im Übrigen fast gar nichts von dem, was das Buch der Fische über diese Hölle auf Erden berichtet, mit den bekannten Tatsachen überein. Nur wenige von den Namen, die in Ihrer kuriosen Chronik erwähnt werden, finden sich auch in offiziellen Dokumenten aus jener Zeit, und was wir über Identität und Lebenslauf dieser Personen wissen, straft die Schilderungen dieses ... dieses traurigen Machwerks Lügen.«
»Und wenn wir uns die Mühe machen, die historischen Dokumente zu überprüfen«, fuhr der Professor fort, aber da wusste ich bereits, dass er das Buch der Fische zutiefst verabscheute, dass er die Wahrheit in Fakten und nicht in Geschichten suchte, dass ihm die Beschäftigung mit der Vergangenheit lediglich dazu diente, die Übel einer schlechten Gegenwart als schicksalhaft und quasi naturnotwendig zu begreifen, dass ein Mann mit einer solchen Frisur notwendig zu seichter Nostalgie neigte, die ihn unfehlbar zu der Überzeugung führen musste, das Leben sei ebenso trivial wie seine eigene Existenz, »stellen wir fest, dass Sarah Island keineswegs unter der Knute eines Tyrannen schmachtete, dass es auch zu keiner Zeit zu einem Handelsplatz von einiger Bedeutung aufstieg oder gar zu einer selbstständig agierenden Handelsmacht, ganz zu schweigen von einer Nation, dass die Siedlung niemals von einem apokalyptischen Feuer in Schutt und Asche gelegt wurde, wie Ihr Buch der Fische, diese Chronik einer Katastrophe, behauptet.« Und so plapperte er immer weiter, flüchtete sich in das Einzige, was ihm Überlegenheit verlieh: Wörter.
Das BuchderFische, sagte er, werde vielleicht eines Tages seinen verdienten Platz im zweifelhaften, aber umfänglichen Ruhmestempel der literarischen Fälschungen finden, »dem Feld nationaler Literatur«, so drückte er sich aus, »auf dem Australien wie kaum eine andere Nation wahrhaft Bedeutendes geleistet hat«.
»Ich brauche kaum hinzuzufügen«, sagte er gleichwohl mit vertraulich verschmitztem Lächeln, wobei ihm die Haartolle übers Gesicht fiel wie einem Betrunkenen, der sich übergeben muss, »dass, wenn Sie es als Roman veröffentlichen, das Unvermeidliche geschehen mag: Es könnte Literaturpreise gewinnen.«
Das Buch der Fische mag ja vielleicht seine Schwächen haben, wenn ich für meinen Teil auch nicht bereit war, das einzusehen, aber dass es intellektuell unterbelichtet und aufgeblasen genug sein sollte, um mit zeitgenössischer australischer Literatur verwechselt zu werden, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich nahm die Bemerkung des Professors als einen taktlosen Scherz auf meine Kosten, verabschiedete mich kurz angebunden, schnappte mir mein Buch und ging.
VI
Eine Weile machten Argumente wie die des Professors durchaus einigen Eindruck auf mich, und auch ich neigte zu dem Glauben, das Buch müsse irgendeine Art von raffiniertem, verrücktem Schwindel sein. Aber als ein Mann, der selbst vom Fach ist, weiß ich auch, dass ein Betrüger nicht lediglich irgendwelche Lügen erzählt, vielmehr kommt es darauf an, bereits mehr oder weniger fertig ausgebildete Meinungen zu bestätigen, und genau dies tat das Buch nicht, es kam den Erwartungen dessen, was die Vergangenheit sein sollte, nicht entgegen, sondern widersprach ihm allenthalben.
Das Buch wurde mir immer rätselhafter, und ich war entschlossen, das Rätsel zu lösen. Ich sichtete das Material im Archiv von Tasmanien, einem glatten, völlig unspektakulären Bau, dessen Äußeres in keiner Weise vermuten lässt, dass dort der komplette Aktenbestand eines totalitären Staates aufbewahrt wird. Ich fand nur wenig, was mir weiterhalf, immerhin lernte ich den Archivar kennen, den weisen und verehrenswerten Mr. Kim Pearce, mit dem ich öfter einen trinken ging.
Problematisch an dem BuchderFische war nicht allein das, was Professor de Silva »diese unentwirrbaren Merkwürdigkeiten« genannt hatte, sondern auch die Identität des Berichterstatters, von dem der Professor sagte, er sei eine »lacuna lacunarum«, ein Ausdruck, der mir ebenso unverständlich war wie ihm die Person des William Buelow Gould.
In den Sträflingsakten machte Mr. Kim Pearce gleich mehrere William Goulds ausfindig, und später im Hope and Anchor lernte ich dank seiner Vermittlung sogar einen leibhaftigen Willy Gold kennen, außerdem, im Ocean Child, einen trunksüchtigen Maler mit Hasenscharte, der sich auf Vogelbilder spezialisiert hatte, und im gemütlichen Barroom des Crescent einen gewissen Pete, den Wirt der Kneipe.
Nur einer der historischen ( ich meine: toten) William
Goulds kam allenfalls als Autor des Buchs der Fische in Frage; was die Akten über sein kriminelles Vorleben mitteilten, stimmte ungefähr, außerdem enthielten sie einen Hinweis auf eine Tätowierung, die der Autor erwähnt, einen roten Anker mit blauen Flügeln über der linken Brust, dazu die Devise: »LOVE AN D LIBERTY«. Dieser William Buelow Gould, rückfälliger Verbrecher und Künstler, war es, der 1828 nach Sarah Island geschickt und dort vom Anstaltsarzt beauftragt wurde, Fische zu malen.
So weit stimmten die Gefängnisakte und das Buch überein, in allem Übrigen zeichnete das offizielle Dokument ein Bild von dem historischen Gould, das dem literarischen Porträt, das mich so sehr fasziniert hatte, vollständig widersprach. Manchmal kam es mir fast so vor, als wäre der Verfasser des Buchs der Fische, der Geschichtenerzähler William Buelow Gould, mit Erinnerungen geboren worden, denen aber keine tatsächlich erlebte Geschichte entsprach, und als hätte er sich sein Leben lang bemüht, zu erfinden, was nicht existiert – in dem sonderbaren Glauben, das Fantasierte könnte zu seiner Erfahrung werden und sein Leiden, eine untröstliche Erinnerung, zugleich erklären und heilen.
Sie können sich vorstellen, wie verblüfft ich war, als ich nach diesen bereits einigermaßen verwirrenden Recherchen in den stillen Sälen der Allport Library auf ein zweites Buch der Fische stieß, das ebenfalls dem Sträfling William Buelow Gould zugeschrieben wurde. Es enthielt haargenau die gleichen staunenswerten Gemälde wie das Exemplar aus Salamanca und unterschied sich von diesem nur in einem einzigen Punkt. Ich schnappte nach Luft vor Überraschung.
Ich nahm den freundlichen Mr. Pearce beiseite, der so hilfsbereit gewesen war, und erklärte ihm, warum ich so schwer geatmet hatte.
Ich sagte ihm, dass ich entdeckt hätte, dass es zwei Exemplare dieses Buchs gebe, die sich bis ins Kleinste glichen und doch in einem fundamental wichtigen Punkt verschieden seien: Während das eine, das aus der Allport Library, nicht ein Wort Text enthielt, wimmelte es im anderen ( in dem aus Salamanca) von Wörtern wie im Ozean von Fischen, und diese Wortschwärme formierten sich zu einer Chronik, die von der sonderbaren Entstehungsgeschichte der Bilder erzählte. Das eine Buch sprach mit der Überzeugungskraft der Wörter, das andere mit der des Schweigens, und es war unmöglich zu entscheiden, welches von beiden mysteriöser war.
»In der Tat«, sagte Mr. Kim Pearce und reichte mir ein paar Mylantatabletten, »das Geheimnis wird durch die verzerrte Spiegelung des einen Buches durch das andere noch erhöht.«
Ich eilte nach Hause, holte meine Fleischschrank-Ausgabe aus ihrem Versteck hinter dem Badezimmerspiegel hervor und zog mich in ein nahegelegenes Hotel zurück, um mich wieder einmal dem Alkohol und den Fischen hinzugeben.
Aber bevor ich fortfahre, muss ich etwas Wichtiges nachtragen. Das Buch besaß nicht allein die Fähigkeit, aus sich selbst heraus zu leuchten, sondern hatte noch eine andere Eigenschaft, die ebenfalls so etwas wie Leben suggerierte. Ich habe bereits erwähnt, dass das Buch keinen erkennbaren Schluss hatte, aber das ist noch nicht die volle Wahrheit. Selbst jetzt noch zögere ich, es hinzuschreiben, denn es ist allzu unglaublich: Die Geschichte weigerte sich, an ein Ende zu kommen!
Jedesmal wenn ich mir das Buch von neuem vornahm, stieß ich auf einen Fetzen Papier mit einem Stück Text, das mir noch nie zuvor begegnet war, oder auf eine Anmerkung, die mir vorher entgangen sein musste, oder auf zwei Blätter, die zusammenklebten, und wenn ich sie behutsam auseinanderzog, fand ich auf den Seiten eine Passage, die ein ganz neues Licht auf die mir bereits bekannte Geschichte warf und mich zwang, das Ganze noch einmal neu zu überdenken. Auf diese wundersame Weise kam jedesmal, wenn ich das Buch der Fische aufschlug, ein neues Kapitel hinzu. Auch an jenem Abend, als ich allein an der Bar des Republic saß – früher hieß es Empire –, war es so, nur mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal bei aller atemlosen Leidenschaft, die mich keinen klaren Gedanken fassen ließ, angesichts dessen, was ich da mit zunehmendem Grausen las, wusste, dass dies das letzte Kapitel war, das ich lesen würde.
Als ich mich dem Ende näherte, merkte ich, dass sich die
Blätter feucht anfühlten, dann nass, und schließlich – mein Herz raste jetzt, und ich keuchte – hatte ich das unerklärbare Gefühl, dass ich Wörter las, die auf dem tiefsten Meeresgrund geschrieben worden waren.
Ungläubig gelangte ich zu dem, was der Schluss sein musste. Ich begriff, dass keine weiteren vielfarbigen Kapitel wunderbar vor meinen Augen erscheinen würden. Ich blickte staunend nieder auf die schreckliche Geschichte des William Buelow Gould und seiner Fische, bestellte einen Ouzo, um mich zu beruhigen – meine Hände zitterten –, kippte ihn hinunter, stellte das Glas auf den Cascade-Bierdeckel vor mir und ging, immer noch wie betäubt, zur Toilette.
Als ich zurückkam, stellte ich fest, dass die Theke abgeräumt worden war.
Meine Kehle schnürte sich zusammen, und ich merkte, dass ich kaum noch Luft bekam.
VII
Da war kein Bierdeckel mehr.
Da stand kein leeres Ouzoglas.
Da war kein ... kein Buch der Fische !
Ich versuchte zu schlucken, aber mein Mund war trocken. Ich versuchte, gerade zu stehen, aber ich schwankte wie von Höhenangst befallen. Ich bemühte mich, nicht in Panik auszubrechen, aber mein Herzschlag war ein brüllendes Tosen, in mächtigen Wogen brandete Furcht unaufhörlich auf dem Meeresgrund meiner Seele. Dort, wo ich Goulds Buch der Fische liegen gelassen hatte, war nichts, nichts als eine große trübe Pfütze. Der Mann an der Bar wischte sie vor meinen Augen auf und wrang das Schwammtuch über der Spüle aus.
Erst jetzt wird mir klar, dass das Buch der Fische dahin zurückkehrte, woher es gekommen war, und dass es paradoxerweise in dem Augenblick, in dem es für mich endete, für andere begann.
Aber damals begriff ich von alledem nichts. Schlimmer noch, niemand unter den Leuten, die sich an jenem Abend in dem Hotel aufhielten, der Barmann nicht und ebenso wenig jemand von den Gästen, konnte auch nur bestätigen, dass ich das Buch dabeigehabt hatte. Ein untröstlicher Schrecken, ein Gefühl absoluter Verlassenheit, packte mich.
Etliche grausam deprimierende Wochen folgten, in denen ich vergeblich versuchte, die Polizei dazu zu bringen, etwas zu tun, um den Diebstahl – denn ganz offensichtlich war das Buch gestohlen worden – aufzuklären. In meiner Verzweiflung ging ich sogar in den Trödlerladen in Salamanca, wo ich es gekauft hatte; gegen meinen eigenen Unglauben und alle Vernunft redete ich mir ein, irgendwie, sozusagen auf dem Weg temporaler Osmose, könnte das Buch in seine Vergangenheit zurückgesickert sein. Immer wieder zog es mich ins Republic, um dort stundenlang jeden Winkel abzusuchen, unter der Bar und im Hinterhof, wo ich Mülltonnen auf den Kopf stellte und die Jugendlichen aufstörte, die dort mit ihren Skateboards herumlungerten. Ich stellte immer wieder Gäste und Personal zur Rede, bis man mich schließlich an die Luft setzte und mir sagte, ich sollte mich nie wieder sehen lassen. Lange Stunden verbrachte ich an Ausflüssen von Abwasserkanälen damit, auf den stinkenden Unrat, der dort herauskam, zu starren, in der irren Erwartung, das Buch würde wundersam verwandelt aus der Kloake auferstehen.
Aber nach einigen Monaten musste ich der furchtbaren
Wahrheit ins Gesicht sehen.
Das Buch der Fische mit seinen Myriaden Wundern und seiner fürchterlichen Erzählung, die sich unaufhörlich entfaltete und fortschrieb, war weg. Ich hatte etwas Grundlegendes verloren und mir dafür eine sonderbare Infektion zugezogen: die schreckliche Ansteckung unerwiderter Liebe.
VIII
»Reisen? Hobbies?«, fragte Doktor Bundy mit dieser in Watte gepackten Stimme, die ich in den fünf Minuten, die ich nun in diesem Behandlungszimmer zugebracht hatte, ebenso wie alles Übrige an Doktor Bundy hassen gelernt hatte. Während ich mich aufsetzte und mein Hemd wieder anzog, teilte er mir mit, er könne nichts Auffälliges feststellen, vielleicht brauchte ich ja bloß einen Tapetenwechsel, neue, andere Interessen. Und in diesem Stil ging es weiter. Ob ich schon daran gedacht hätte, einem Sportverein beizutreten? Oder einer Männergruppe?
Ich hatte wieder dieses Gefühl zu ersticken, das ich in der Bibliothek und dann an dem fatalen Abend in der Kneipe verspürt hatte, als das BuchderFische verschwunden war. Fluchtartig verließ ich das Behandlungszimmer. Da Doktor Bundy sich weigerte, an meine Krankheit zu glauben, schien es mir nur recht und billig, wenn ich mich meinerseits seiner Therapie verweigerte. Ohnehin hatte ich kein Geld für eine Reise, keine Lust, mir ein Hobby zuzulegen, und eine unüberwindliche Abneigung dagegen, mich bei Triathlon-Wettkämpfen vor fremden Leuten lächerlich zu machen oder schwitzende Zahnärzte zu umarmen, die bei irgendwelchen Selbsterfahrungsveranstaltungen in Indianerzelten sitzen und sich gegenseitig feierlich mit Federchen streicheln, während sie darüber flennen, dass sie ihre Väter nie wirklich kennen gelernt haben.
Und so ging es weiter wie vorher: Vom Essen wurde mir schlecht, in den Nächten starrte ich in ein Meer von Finsternis, in das ich doch nie eintauchen konnte, und meine wachen Stunden, die sich endlos hinzogen, brachte ich mit Albträumen von Seeungeheuern zu. Lange Zeit blieb ich unerklärlich krank.
Ein Unglück kommt selten allein, und so gesellten sich bald noch weitere Tragödien hinzu. Meine Großtante Maisie starb an einer Salmonelleninfektion. Ich brachte lange Stunden an ihrem Grab zu. Das Buch, so fiel mir jetzt auf, hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen tiefgefrorenen Quiches, die sie mit triumphaler Geste aus ihrem Gefrierschrank hervorzauberte, wo sie zwei Jahrzehnte über das Haltbarkeitsdatum hinaus geduldig ausgeharrt hatten, bis die Mikrowelle sie auf wundersame Weise zum Leben erweckte. Das Buch war der Rugbyplatz von North Hobart, der auf ein paar Tropfen Lourdeswasser und Gedanken an ferne Geliebte wartete. Das Buch, so begann ich zu ahnen, wartete auf mich.
Vielleicht waren es solche Gedanken, die bewirkten, dass meine Krankheit mehr und mehr die Form einer Berufung annahm. Oder vielleicht war es auch nur das schiere Entzücken über die Pracht all dessen, was Gould geschrieben und gemalt hatte, was mich zu dem Entschluss brachte, das BuchderFische neu zu schreiben, ein hoffnungsloses Projekt, das weder den Beifall eines größeren Publikums noch den der gelehrten Welt finden und mir keinen finanziellen Gewinn eintragen konnte und das sich einzig und allein aus meiner verrückten unseligen Leidenschaft erklärte.
Bei dieser aussichtslosen Aufgabe konnte ich mich auf mein Gedächtnis stützen, auf exakte und eher verschwommene Erinnerungen, ich hatte einiges recht und schlecht abgeschrieben, sogar ganze zusammenhängende Abschnitte, den Inhalt anderer Passagen hatte ich lediglich in Stichworten notiert, und schließlich war mir auch das Kopieren der Bilder aus dem textlosen Exemplar der Allport Library eine wertvolle Hilfe.
Vielleicht hat ja Mr. Hung mit seinem Schrein für Victor Hugo Recht: Wer ein Buch schreibt – selbst wenn es, wie dieses hier, gar kein eigenständiges Werk ist, sondern nur eine armselige Rekonstruktion –, macht die Erfahrung, dass er den Geschöpfen, die darin leben, nicht anders als mit Liebe begegnen kann. Vielleicht sind Lesen und Schreiben letzte Reservate menschlicher Würde, denn am Ende erinnern uns diese Tätigkeiten an etwas, das einst – bevor auch er sich in unserer Epoche der unablässigen Erniedrigungen in Luft auflöste – Gott selbst uns ins Bewusstsein rief: dass wir mehr sind, als wir sind, dass wir eine Seele haben. Und noch mehr.
Oder vielleicht auch nicht.
Ganz offensichtlich wurde Gott diese Aufgabe, die Leute daran zu erinnern, dass sie mehr sind als hungriger Staub, einfach zu anstrengend, kein Wunder – erstaunlich ist eher, dass Er überhaupt so lang durchhielt. Ich kann Ihn nur allzu gut verstehen, habe ich doch selbst im Umgang mit meinen vergleichsweise ungeschlachten Geschöpfen oft genug denselben Überdruss empfunden. Natürlich erwarte oder hoffe ich nicht, dass dieses Buch zu leisten vermag, was Er nicht vollbrachte. Was ich lediglich wollte, war, ein Vehikel zu schaffen – wie unvollkommen auch immer –, in dem alle Fische Goulds zurück ins Meer gebracht werden konnten.
Ich kann freilich nicht leugnen, dass ich ein immer größeres Unbehagen angesichts dieses Projekts empfinde, denn ich bin heute nicht mehr sicher, was darin Erinnerung und was Offenbarung ist. Wie genau die Geschichte, die Ihnen hier geboten wird, der Urfassung entspricht, ist unter den wenigen Leuten, denen ich damals das Buch der Fische im Original zu lesen gegeben hatte, heiß umstritten. Die Conga – eine unzuverlässige Zeugin, gewiss – meint, es gebe überhaupt keinen Unterschied oder zumindest keinen von Bedeutung. Immerhin können Sie sich darauf verlassen, dass das Buch, das Sie zu lesen kriegen, exakt dasselbe ist, an das ich mich erinnere; ich habe mich bemüht, das Staunen, das ich bei bei dieser Lektüre empfand, ebenso wahrheitsgetreu zu schildern wie die außerordentliche Welt des William Gould.
Von Mr. Hung hatte ich eigentlich ein solides Urteil erwartet, aber er konnte mir nichts Handfestes sagen. Als ich ihm – dem einzigen Menschen in meiner Bekanntschaft, von dem ich wusste, dass er etwas von Büchern verstand – an einem nasskalten Nachmittag im Hope and Anchor vor dem Kaminfeuer meine Zweifel gestand, in der Hoffnung, er würde meine wachsende innere Unruhe zerstreuen, antwortete er mit der alten Weisheit, ein Autor und sein Buch seien nicht voneinander zu trennen, und fügte dem – als eine Art von Erklärung, die mir allerdings etwas sibyllinisch vorkam – die Anekdote von Flaubert (wir tranken Pernod, auch so eine merkwürdige Hinterlassenschaft der Franzosen) hinzu, der, bedrängt von Plagegeistern, die unbedingt wissen wollten, welche Person für Madame Bovary Modell gestanden hatte, schließlich aufs Äußerste gereizt, doch zugleich in stolzem Hochgefühl, wie Mr. Hung mir versicherte, ausrief: »Madame Bovary, c’estmoi !«
Nach dieser jubilierenden Pointe, die der Conga und mir, da wir weder Französisch konnten noch etwas von Literatur verstanden, undurchsichtig blieb – und selbst als Mr. Hung die Übersetzung »Madame Bovary, das bin ich!« nachgeliefert hatte, wurden wir nicht recht schlau daraus –, meinte die Conga, sie wisse auch nicht, was sie von alldem halten sollte.
»Vielleicht«, sage ich zögernd, »hat de Silva Recht, und es ist bloß eine Fälschung.«
»Scheiß auf de Silva« – sagt die Conga, ihr Gesicht ist rot von Alkohol und Zorn –, »das ist doch alles Mist, was die daherreden.«
»Ja«, sage ich, »sicher.«
Aber in Wirklichkeit bin ich überhaupt nicht sicher.
Ich hatte mich in der tröstlichen Überzeugung an die Arbeit gemacht, aus Büchern spräche die göttliche Weisheit höchstselbst, und war am Ende zu der fadenscheinigen Ahnung gelangt, dass alle Bücher grandiose Torheiten sind, dazu verdammt, ewig missverstanden zu werden.
Mr. Hung sagt, ein Buch könne eine ganz neue Möglichkeit eröffnen, das Leben zu verstehen, es könne ein nie dagewesenes Universum sein, aber das dauere nicht lang; allzu bald sei so ein Werk nur mehr eine Fußnote der Weltliteratur, von Schmarotzern mit Lobhudelei überhäuft, von den Zeitgenossen verachtet, von niemandem gelesen. Das Ende aller Bücher ist bitter, ihr Schicksal absurd. Wenn sie die Gunst der Leser verlieren, sterben sie, und selbst wenn die Nachwelt den Daumen nach oben hält, werden sie doch immer missdeutet und entstellt, ihre Autoren werden zuerst zu Göttern erklärt und später unweigerlich, wenn sie nicht gerade Victor Hugo sind, zu Teufeln.
Sagt es, trinkt seinen letzten Pernod aus und geht.
Später wird dann die Conga leidenschaftlich, sie lehnt sich an mich, schmiegt sich an, so dass wir schwanken und schlingern wie ein Boot in rauer See, sie fasst mir sacht zwischen die Beine und zupft an meinen Eiern, als wären sie die Schnur, mit der man das Nebelhorn betätigt.
Tuuut – tuuut!
Wir landen bei ihr im Bett, die Körper und Gesichter mit einem Muster überzogen von den Schatten all der unverkauften vietnamesischen Shakerstühle, die da gestapelt stehen, geschreinert von einem Flüchtling, der glaubt, Gott sei Victor Hugo und Madame Bovary sei Gustave Flaubert, und plötzlich, von einem Moment zum nächsten, ist ihre Leidenschaft weg.
Ihre Augen werden stumpf. Ihre Lippen beben.
»Wer bist du?«, schreit sie plötzlich auf, »wer?«
Und sie hat Angst, sie ist starr vor Schrecken, sie sieht einen anderen, aber wen sie sieht, ist nicht herauszukriegen. Ihr Körper ist mit einem Mal wie tot und existiert nur mehr als ein vollkommen willenloses Ding, aber ich – es ist unsäglich – mache noch kurz weiter, ehe mein Grauen sogar meine animalische Begierde besiegt und ich mich zurückziehe.
»Was ist los, was hast du?«, schreit die Conga, aber mit einer ganz anderen Stimme, und ich merke, dass sie, wo immer sie gewesen sein mag, jetzt wieder da ist.
»Geh nicht weg, komm«, sagt die Conga und breitet die Arme aus, und ich lege mich erleichtert wieder zu ihr. Aber dann werden ihre Augen wieder stumpf, und ihr Körper erstirbt, und sie schreit immer wieder: »Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?«, und dieses Mal kann ich nicht mehr anders, ich muss aus diesem sonderbaren Teufelskreis ausbrechen, und ich rapple mich auf und ziehe mich hastig an, während die Conga, nun plötzlich wieder honigsüß und aufrichtig beunruhigt, auf mich einredet: »Aber was ist denn los mit dir? Warum gehst du?« Ich gehe, weil ich ihr keine Möbel zu bieten habe, mit denen sie sich trösten, keine falschen Stühle oder Tische, für die sie ihre Schuld und Traurigkeit in Zahlung geben könnte, weil ich weder ihr noch mir selbst die Frage beantworten kann, wer ich bin oder wer sie ist, und am allerwenigsten die, was es mit diesem Buch der Fische auf sich hat.
Wie könnte ich ihr sagen, dass mich spätnachts, wenn
Melancholie mit dem Abendtau herabsinkt, die Vorstellung in ihren Sog zieht, William Buelow Gould sei allein für mich geboren, er habe sein Leben für mich und ich dieses Buch der Fische für ihn geschaffen, unsere Schicksale seien immer schon eines gewesen?
Wissen Sie, dieses Buch wirkt oft so ungreifbar, lauter Schleier, die man lüftet und teilt, um dahinter wieder neue Schleier zu entdecken und endlich in einer wortlosen Leere anzukommen, wo es nur das Tosen der See gibt, das des großen Indischen Ozeans, auf dem Gould sich vor meinem inneren Auge Sarah Island nähert, um dann wieder zurückzuweichen, ein langsam rhythmisches Kommen und Gehen im Ton und im Bild, her und wieder zurück.
Ich sank in einen alten Korbsessel im dunklen Wohnzimmer der Conga, erschöpft von dem peinlichen Niedergang meines Daseins, und bevor ich es recht merkte, war ich schon fest eingeschlafen, tief in meinem Geist die immer gleiche Frage, die in einer endlosen Schleife herumfuhr.
Wer bin ich ... ?, fragte es in mir. Werbinich?
IX
Ich suchte eine Antwort auf diese immer rätselhaftere Frage, indem ich an den letzten Ort floh, der den Sprachlosen und Ausgemusterten, den Kranken und Alten und Unerwünschten bleibt: in die alten Pubs, wo die neuen Automaten blinken und das typische dumpfe Gebrabbel verlorener Seelen in der Luft hängt, die sich in irgendein fernes Universum wie in ein Totenreich verlieren.
Auf meinen Fahrten durch diese vom Flackern der Bildschirme erhellte Unterwelt lud ich alle, die gerade nicht spielten und weniger kaputt als ich zu sein schienen, zu einem Bier ein und forderte sie auf, mir ihre Meinung zu meiner
Geschichte zu sagen und zu meinen Bildern, die ich vor sie auf die Bar legte, während ich erzählte, abgegriffenen Fotos von den Aquarellen in dem Exemplar der Allport Library. Und ich stellte ihnen Fragen.
Einige fanden die Bilder ein bisschen unfertig, aber nicht schlecht gemacht, und die Geschichte – so wie ich sie ihnen verkürzt wiedergab – total verrückt. Ich hatte von den Akademikern, mit denen ich bei meinen Nachforschungen zu tun gehabt hatte, die Gewohnheit angenommen, spitzfindige Diskussionen vom Zaun zu brechen, und versuchte meine Kumpane davon zu überzeugen, dass vielleicht im Wahnsinn Wahrheit liege oder in der Wahrheit Wahnsinn.
»Wer war deine Mutter, und was für Geheimnisse hat sie dir an der Wiege ins Ohr geflüstert?«, wollte ich wissen. »War sie ein Fisch?« Ich wurde laut: »War sie einer?«
»Am Anfang war die Welt blöd«, höhnte einer, »und seitdem ist sie täglich blöder geworden.«
»Reisen wir in eine andere Zeit!«, krakeelte ich dann,
»fahrt mit mir, ihr blinden Plattfische und golden schillernden Flundern! Weit fort von diesem Land der durchweichten Bierdeckel und debilen Vergnügungen dahin, wo ihr vielleicht euer Herz findet! Wo ist dies ferne Land, durch das eure Seele streifen will? Was ist es, das im Bauch rumort und eure Träume behelligt? Welche Schatten der Vergangenheit quälen euch so? Welches Meerestier seid ihr?«
Aber ich muss schon sagen, mit diesen Leuten war nichts anzufangen. Ich bekam keine Antworten auf meine tausendundeine Fragen. Sie verdrückten sich, noch bevor ich den Mund aufmachte, um lieber ihre Abfindungen und Schwerbeschädigtenrenten und Arbeitslosenunterstützungen zu vergeuden, saßen mit ihren Plastikcolabechern voller Münzen vor den Spielautomaten, wie gebannt von den flitzenden Glücksrädern, die so präzise das unbarmherzige Walten ihres Schicksals abzubilden schienen.
Die wenigen, die überhaupt Interesse zeigten, hatten nur Hohn und Spott für mich übrig, wenn ich ihnen erklärte, dass Goulds Buch der Fische unendlich reich an Sinn sei; einige, die mich kannten, sagten, ich sollte doch lieber wieder amerikanische Touristen als mich selbst an der Nase herumführen. Einer, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, gab mir eine in die Fresse, dass ich vom Stuhl fiel. Die Leute lachten nur, als er dann mein Bier über mich schüttete und grölte:
»Schwimm, mein Fischlein, schwimm, schwimm heim ins Meer!« Alle diese kaputten Typen brüllten vor Lachen, nur Mr. Hung nicht, der in diesem Moment hereingekommen war.
Mr. Hung packte mich unter den Achseln und schleppte mich nach draußen. Als ich stöhnend auf dem nassen Asphalt lag, griff er in meine Tasche, fand meinen Geldbeutel und nahm alles Geld heraus. Er stand auf und sagte, so Victor Hugo will, werde er gewinnen und das nötige Startkapital für einen Handel mit gefälschten Bildern mitbringen. Ich sah ihn im zuckenden Neonlicht verschwinden.
Für diejenigen, die an meiner auf dem Boden ausgestreckten Gestalt vorbei auf den Spielsalon zuschwammen, waren meine Bilder von Petersfischen und Himmelsguckern wertlos, so unsinnig wie eine Reihe mit zwei Zitronen und einer Ananas, so enttäuschend wie ein Einser im Lotto. Das Einzige, was in ihren Augen den Fischen noch fehlte, war, dass da quer über dem Papier in blinkenden Leuchtbuchstaben, die mein und ihr Schicksal verkündeten, geschrieben stand:
»GAME OVER.«
X
Nachdem Mr. Hung mein ganzes Geld verspielt hatte, kam er wieder heraus, versprach, er werde alles zurückzahlen, und nahm mich mit zu sich nach Haus. Wir gingen auf Zehenspitzen in die Wohnung, denn seine Frau und die Kinder schliefen längst. Er verschwand in der Küche, um für uns beide Suppe zu kochen, ich blieb allein in dem kleinen Essund-Wohnzimmer zurück.
In einer Ecke stand ein Victor Hugo-Schrein. Auf einem Stück grünen Samts prangte in einem roten Plastikrahmen ein Bild des großen Mannes, die Fotokopie einer Lithografie, flankiert von zwei Kerzen, die nicht brannten, und vier qualmenden Weihrauchstäbchen, davor einige seiner Romane in Taschenbuchausgaben und ein paar verschrumpelte Aprikosen.
Daneben gab es ein Aquarium, in dem Mr. Hung ein großes, dickbäuchiges Seepferdchen hielt und ein ähnliches Tier, gut einen Fuß lang, mit hauchzarten blattartigen Flossen – ein Seedrache, so erfuhr ich später. Beide Tiere sahen genauso aus wie auf den Bildern, die mir im Buch der Fische begegnet waren. Ich betrachtete diese fremdartigen Kreaturen, die so heiter dahinzuschweben schienen.
Die winzigen Flossen des Seepferdchens mit seinen hornigen Ringen, der spitzen Schnauze und dem mächtig gewölbten Bauch waren in unablässiger flimmernder Bewegung wie der Fächer einer erhitzten Debütantin. Es hatte unmittelbar hinter den Wangen Brustflossen, die ihm als Seitenruder oder Steuertriebwerk dienten. Mr. Hung trat mit zwei Schalen voll dampfender Suppe herein. Er stellte sie auf den Tisch und erklärte mir, wozu das Seepferdchen in der Lage sei: Das männliche Tier gebäre Hunderte von winzig kleinen Jungen, die es in einer Bauchtasche ausgebrütet habe.
Und in diesem Moment, als hätte das Seepferdchen nur auf sein Stichwort gewartet, begann es zu gebären. Fasziniert sah ich zu, wie es in hektisch zuckende Pressbewegungen verfiel und in Abständen von etwa einer Minute aus einer Öffnung in der Mitte des geschwollenen Bauchs unter Schmerzen jeweils eines oder zwei kleine schwarze Stäbchen ausstieß, die aber schon die typischen großen Augen und die lange Schnauze hatten und sogleich zu schwimmen anfingen, lauter winzige Schnörkelchen, die auf und ab wimmelten wie die verschollenen Schriftzeichen in Goulds Buch. Ich fühlte mich ein bisschen wie das arme Seepferd am Ende seiner langen Mühen: Sein Bauch war jetzt schlaff, das Tier war erschöpft von all den zuckenden Anstrengungen.