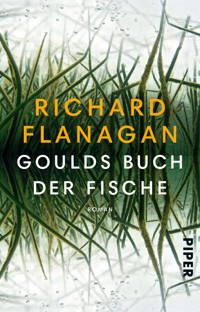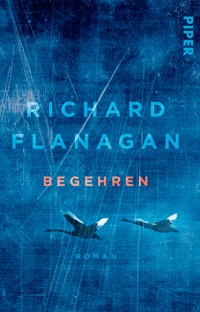
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1839: Der Gouverneur von Tasmanien und Polarforscher Sir John Franklin und seine Frau holen eine Aborigine-Waise zu sich ins Haus. Sie wollen Mathinna durch strenge Erziehung »zivilisieren«. Während Lady Jane ihre mütterlichen Gefühle unterdrückt, kann sich Sir John dem Mädchen gegenüber nicht beherrschen. Als er Jahre später nach England zurückbeordert wird, bleibt Mathinna entwurzelt und zutiefst verstört zurück … 1859: Im ewigen Eis soll Sir Franklin dem Kannibalismus verfallen sein. Lady Jane reist nach London zu Charles Dickens, um den berühmtesten Engländer der Zeit um Hilfe zu bitten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Kevin Perkins
Übersetzung aus dem australischen Englisch von Peter Knecht
ISBN 978-3-492-99010-3 © Richard Flanagan 2008 Titel der englischen Originalausgabe: »Wanting«, Knopf Publishing Group, Sydney, 2008 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH München 2018 Covergestaltung: zeromedia.net, München Covermotiv: Getty Images / Natphotos; FinePic®, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Zitate
Kapitel 1 – Der Krieg war …
Kapitel 2 – Als ihm ein …
Kapitel 3 – Ein kleines Mädchen …
Kapitel 4 – Wenn es stimmte, …
Kapitel 5 – Der Protektor fand, …
Kapitel 6 – Aber was ist …
Kapitel 7 – Erst später, als …
Kapitel 8 – Während der dritten …
Kapitel 9 – Als er die …
Kapitel 10 – Dickens stand auf …
Kapitel 11 – Mehrere Monate nachdem …
Kapitel 12 – Die letzte Vorstellung …
Kapitel 13 – »Wir sind mit …
Nachbemerkung des Autors
Guide
Sehen Sie, meine Herrschaften, der Verstand ist eine gute Sache, das ist nicht zu bestreiten, aber der Verstand ist nur Verstand und befriedigt nur die Verstandesfähigkeiten des Menschen, der Wille dagegen ist eine Manifestation des ganzen Lebens.
Fjodor Dostojewski
Krumm kann nicht gerade werden, noch, was fehlt, gezählt werden.
Prediger Salomo
1
Der Krieg war unerwartet zu Ende gegangen, wie es manchmal vorkommt. Ein unscheinbarer kleiner, dicker Mann, Schreiner und presbyterianischer Prediger, hatte unbewaffnet, begleitet von etlichen zahmen Schwarzen, die wilden Gebiete der Insel bereist und war mit einem zusammengewürfelten Haufen Eingeborener zurückgekehrt. Man nannte sie wilde Schwarze, aber sie waren alles andere als wild, räudige Gestalten, halb verhungert und oft auch noch schwindsüchtig. Sie waren, sagte er – und erstaunlicherweise schien es wirklich so zu sein –, alles, was von den einst gefürchteten Stämmen der Insel, die lange Zeit einen so erbitterten Krieg geführt hatten, noch übrig war.
Diejenigen, die sie sahen, meinten, man könne sich kaum vorstellen, wie so ein Häufchen Elender dem Empire so lang Trotz bieten, der erbarmungslosen Ausrottung entkommen und Furcht und Schrecken verbreiten konnte. Niemand wusste, was der Prediger den Schwarzen erzählt hatte oder was die Schwarzen sich von ihm erhofften, aber sie wirkten ganz fügsam, wenn auch ein bisschen traurig, als man sie schubweise auf ein Schiff verlud und auf eine ferne Insel in dem riesigen Seegebiet zwischen Van Diemens Land und dem australischen Festland brachte. Der Prediger nahm dort den mit 500 Pfund jährlich dotierten Titel eines Protektors an und machte sich, unterstützt von den Soldaten einer kleinen Garnison und einem Katecheten, daran, seine dunkelhäutigen Schützlinge auf das Niveau der englischen Kultur zu heben.
Seine Arbeit zeitigte durchaus einige Erfolge, keine großen, aber er war entschlossen, unbeirrt darauf aufzubauen. Waren sie denn nicht aller Ehren wert? Waren seine Leute nicht wohlvertraut mit Gott und Jesus, wie ihre prompten Antworten auf die Fragen des Katecheten und die Begeisterung, mit der sie Kirchenlieder sangen, bewiesen? Gingen sie nicht eifrig zum Wochenmarkt, um Häute und Muschelkettchen gegen Glasperlen und Tabak und dergleichen zu tauschen? Ohne Zweifel, sein Siedlungsprojekt entwickelte sich bestens, wenn man einmal davon absah, dass ihm seine schwarzen Brüder und Schwestern in solcher Eile wegstarben.
Nun ja, es gab einige Dinge, die ihn einfach fassungslos machten – es war gegen jede Vernunft. Obwohl er den Schwarzen beigebracht hatte, sich von Mehl und Zucker und Tee zu ernähren statt von Beeren, Wildpflanzen, Muscheln und Wildbret, schien ihr Gesundheitszustand viel schlechter zu sein als früher. Und je mehr sie davon abkamen, unzüchtig nackt herumzulaufen, und sich an englische Decken und Kleidung aus gutem englischen Tuch gewöhnten, desto schlimmer wurde das Husten und Röcheln und Sterben. Und je schlechter es ihnen ging, desto stärker wurde ihr Drang, die englischen Kleider abzuwerfen, die englische Nahrung zu verschmähen und die englischen Behausungen zu verlassen, in denen, wie sie sagten, der Teufel wohnte, und zum alten Leben zurückzukehren, tagsüber zu jagen und nachts am Feuer zu schlafen.
Man schrieb das Jahr 1839. Die erste Fotografie eines Menschen wurde aufgenommen, Abd al-Qadir rief zum heiligen Krieg gegen die Franzosen auf, und Charles Dickens stieg mit dem Roman Oliver Twist zu noch höherem Ruhm auf. Der Protektor heftete den jüngsten Totenschein ab, schloss den Aktenordner und wandte sich wieder seinen pneumatischen Studien zu. Es war, dachte er, einfach unerklärlich.
2
Als ihm ein Dienstmädchen, das von Charles Dickens’ Haus herbeigeeilt war, die Nachricht vom Tod des Kindes brachte, zögerte John Forster keinen Moment lang – Zögern war ein Zeichen von Charakterschwäche, und sein Charakter duldete keine Schwäche. Er hatte ein Bulldoggengesicht und eine stattliche Figur, war schwer und behäbig in allen Dingen – in seinen Ansichten, seiner Empfindungsweise, seiner Moral und seiner Konversation – und für Dickens das, was die Schwerkraft für einen Ballonflieger ist. Auch wenn er sich manchmal insgeheim über ihn lustig machte, schätzte Dickens diesen Mann, der ihm wie ein Privatsekretär in den verschiedensten Dingen des Lebens mit Rat und Tat zur Seite stand, über alles.
Seine Vertrauensstellung erfüllte Forster mit Stolz, und er beschloss zu warten, bis Dickens seine Rede gehalten hatte. Allen seinen Versicherungen zum Trotz, dass unter den gegebenen Umständen jedermann Verständnis für eine kurzfristige Absage haben würde, hatte Dickens darauf bestanden, vor der Gesellschaft zur Unterstützung Not leidender Bühnenkünstler zu sprechen. Sogar heute noch, als Forster ihn in Devonshire Terrace aufgesucht und ein letztes Mal gedrängt hatte, sich zu entschuldigen.
»Aber ich habe es versprochen«, hatte Dickens gesagt. Forster hatte ihn im Garten angetroffen, wo er mit seinen jüngeren Kindern spielte, auf dem Arm sein neuntes Kind, die kleine Dora. Er hatte sie hochgehoben und sie mit gespitzten Lippen angelächelt, während sie mit den Ärmchen schlug, zugleich wild und feierlich wie ein Regimentstrommler. »Nein, nein, ich bin es uns schuldig.«
Forster war das Herz aufgegangen, aber er hatte geschwiegen. Uns! Er wusste, dass Dickens sich manchmal mehr für einen Schauspieler als für einen Schriftsteller hielt. Das war natürlich Unsinn, aber so war er eben. Dickens liebte das Theater, er liebte diese Welt der Illusionen, wo man nur mit dem Finger zu schnipsen brauchte, um den Mond vom Himmel herabzurufen. Forster wusste, dass sich Dickens zu den Mitgliedern der wohltätigen Gesellschaft, vor der er heute sprechen sollte, seltsam hingezogen fühlte, und er sah diese Verbundenheit mit Leuten, die in seinen Kreisen nicht den besten Ruf genossen, mit zugleich besorgter wie gespannter Unruhe.
»Es scheint ihr besser zu gehen, finden Sie nicht?«, sagte Dickens und drückte den Säugling sanft an seine Brust. »Sie hatte heute Morgen leichtes Fieber, nicht, Dora?« Er küsste sie auf die Stirn. »Aber ich glaube, sie hat das Schlimmste überstanden.«
Und jetzt, wenige Stunden danach, hielt Dickens seine Rede. Großartig, dachte Forster. Der Saal war dicht gefüllt, das Publikum lauschte hingerissen, und Dickens sprach so brillant und bewegend wie nur je.
»Unsere Gemeinschaft«, sagte Dickens zu den Schauspielern, »schließt niemanden aus, jeder, der auf der Bühne steht, ob als Hamlet oder Benedikt, gehört zu uns, mag er einen Geist oder einen Straßenräuber darstellen oder auch in einer einzigen Person das ganze Heer des Königs. Und hinter den Kulissen, aus denen alle diese Schauspieler zu uns heraustreten, gibt es Krankheit und Leid, ja, auch der Tod geht dort um. Doch …«
Applaus kam auf, der jedoch gleich wieder verstummte, vielleicht, weil dem Publikum plötzlich die Taktlosigkeit zu Bewusstsein kam, die darin lag, dass man Dickens’ Auftritt nur zwei Wochen nach dem Tod seines Vaters beklatschte. Der alte Mann war nach einer fehlgeschlagenen Blasensteinoperation verblutet – eine grässliche Schlächterei, so hatte es Dickens Forster beschrieben.
»Doch wie oft kommt es vor«, fuhr Dickens fort, »dass wir unseren Herzen Gewalt antun und unsere wahren Empfindungen im Lebenskampf verbergen müssen, um tapfer unsere Pflicht zu erfüllen und unserer Aufgabe gerecht zu werden.«
Nachher nahm Forster Dickens beiseite.
»Auf ein Wort«, sagte Forster, der immer viel zu viele Worte machte, aber jetzt sehnlich wünschte, es bliebe ihm erspart, das eine auszusprechen. »Es tut mir leid …«
»Ja?« Dickens schaute über Forsters Schulter nach etwas oder jemandem, dann zwinkerte er ihm zu. »Ja, mein lieber Mammut?«
Dass er so unbefangen Forster mit seinem Spitznamen ansprach, offensichtlich überzeugt, dass er nur einen Scherz im Sinn hatte, seine heitere Laune, die Freude des Schauspielers nach einem erfolgreichen Auftritt – all das machte dem armen Forster seine Aufgabe nicht leichter.
»Die kleine Dora …«, sagte Forster. Seine Lippen zuckten, während er versuchte, den Satz zu Ende zu bringen.
»Dora?«
»Es tut mir …«, murmelte Forster hilflos. Er wollte in diesem Augenblick so vieles sagen und brachte es einfach nicht heraus. »Es tut mir so unendlich leid, Charles«, stieß er hervor. Jedes Wort kam ihm falsch und schlecht vor – er hätte so gern etwas Besseres gesagt. Seine Hand hob sich, wie um etwas zu unterstreichen, das aber nie ausgesprochen wurde, und sank dann wieder herab, hing schlaff neben seinem massigen Körper, der sich so aufgedunsen und nutzlos anfühlte. »Sie ist unter Krämpfen von uns gegangen«, sagte er endlich.
Dickens’ Gesicht blieb unbewegt. Was für ein großer Mann, dachte Forster.
»Wann?«, fragte Dickens.
»Vor drei Stunden. Kurz nachdem wir abgefahren waren.«
Man schrieb das Jahr 1851. Die Weltausstellung in London feierte den Triumph der Vernunft in einem Glaspavillon, den der Schriftsteller Douglas Jerrold spöttisch »Kristallpalast« nannte, in New York erschien ein erfolgloser Roman, der von der Suche nach einem weißen Wal handelte, während im eisengrauen Hafen von Stromness, Orkney, Lady Jane Franklin die zweite in der langen Reihe erfolgloser Expeditionen auf die Suche nach einem Mythos, der einst ihr Mann gewesen war, in den weißen Nebel hinausschickte.
3
Ein kleines Mädchen rannte keuchend durchs Wallabygras, das fast genauso hoch war wie sie selbst. Sie liebte das sanfte Kitzeln der feinen Grashalme, die Wassertröpfchen an ihren Waden abstreiften, sie genoss es, die Erde unter ihren nackten Fußsohlen zu spüren, feucht und breiig im Winter, trocken und staubig im Sommer. Sie war sieben Jahre alt, die Erde noch neu und ihre Freuden aufregend, sie liefen durch die Füße hoch zu ihrem Kopf in die Sonne, und es war möglich, dass das Rennen sie mit einem Gefühl vollkommener Heiterkeit erfüllte und dass zugleich der Grund, weswegen sie rannte und, ohne innezuhalten, rennen musste, ihr blanken Schrecken einflößte. Sie hatte Geschichten von Geistern gehört, die fliegen konnten, und überlegte, ob sie, wenn sie ein bisschen schneller rannte, auch abheben und so ihr Ziel früher erreichen könnte, aber dann fiel ihr ein, dass nur Tote fliegen konnten, und schlug sich den Gedanken aus dem Kopf.
Sie rannte an den Häusern der Schwarzen vorbei, zwischen gackernden Hühnern und bellenden Hunden hindurch, vorbei an der Kapelle immer noch in vollem Lauf, den Hang hinauf zum wichtigsten Gebäude der Siedlung Wybalenna. Sie stieg über die drei Stufen zur Tür und klopfte mit den Fingerknöcheln, wie man es ihr immer wieder gezeigt hatte, an.
Der Protektor blickte von seinen pneumatischen Studien auf und sah ein Eingeborenenmädchen hereinkommen. Sie war barfuß und trug einen schmuddeligen Kittel und eine rote Wollmütze, eine Rotzschliere schlüpfte aus ihrem rechten Nasenloch und wieder hinein wie ein lebendiges Wesen. Sie sah zur Decke hoch und an den Wänden herum. Meistens blickte sie auf den Boden.
»Ja?«, sagte der Protektor. Wie alle Schwarzen hatte sie die irritierende Angewohnheit, ihm nicht in die Augen zu sehen. Ihr richtiger Name, der, auf den der Protektor sie getauft hatte, war Leda, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund riefen alle sie bei ihrem Eingeborenennamen. Er ertappte sich dabei, dass er es auch tat, und ärgerte sich. »Ja, Mathinna?«
Mathinna schaute auf ihre Füße, kratzte sich unter dem Arm, sagte aber nichts.
»Also, was ist? Was ist los, Kind?«
Und plötzlich fiel ihr wieder ein, warum sie hier war. »Rowra«, sagte sie – das Wort, mit dem die Eingeborenen den Teufel bezeichneten –, atemlos, als flitzte ein Speer auf sie zu, »Rowra«, und dann »ROWRA!«
Der Protektor sprang von seinem Hocker auf, schnappte sich ein Taschenmesser aus einer offenen Schublade und hastete hinaus, das Kind vor ihm her. Sie rannten zu einer Zeile von Reihenhäuschen aus Backstein, die er für die Eingeborenen gebaut hatte, um sie an die englische Wohnkultur zu gewöhnen und von ihren primitiven Windschirmen abzubringen. Der Protektor, der Zimmermann gewesen war, bevor er Heiland wurde, freute sich jedes Mal beim Anblick der zwei Häuserzeilen: Wenn man sich den weißen mit roten Felsen und ledrigem Tang übersäten Strand dahinter wegdachte und den sonderbar verkrüppelten Wald auf der anderen Seite, wenn man diese ganze erbärmliche wilde Insel am äußersten Rand der Welt nicht beachtete und sich nur auf die Ziegelgebäude konzentrierte, dann kam es einem gerade so vor, als blickte man auf eine Straße in einem Neubauviertel von Manchester oder sonst einer modernen Großstadt.
Als sie sich dem Haus Nummer 17 näherten, blieb Mathinna plötzlich stehen und starrte zum Himmel hinauf, offenbar von einem namenlosen Schrecken erfasst. Der Protektor wollte schon an ihr vorbeieilen, da sah er das Omen, das die Eingeborenen am meisten fürchteten: Ein schwarzer Schwan, der Vogel, der die Seelen raubte, segelte heran in Richtung der Häuser.
Noch bevor er eintrat, schlug dem Protektor der starke Geruch von Sturmvogelfett und ungewaschenen Menschenleibern entgegen, und zugleich befiel ihn eine stumme, namenlose Angst, dass dieser ranzige Gestank etwas mit ihm, mit seinen Taten, seinen Überzeugungen zu tun hatte. Manchmal kam ihm der Gedanke, dass diese Menschen, die er so sehr liebte, die er vor räuberischen Überfällen der brutalsten unter den weißen Siedlern beschützt hatte – sie jagten die Eingeborenen und knallten sie völlig bedenkenlos, ja mit Lust, ab wie Kängurus –, dass diese Menschen, die er zum Licht Gottes geführt hatte, seinetwegen starben, dass er in irgendeiner Weise daran schuld war. Natürlich war das vollkommen abwegig, gegen alle Vernunft, es war unmöglich. Nur aus purer Erschöpfung konnte er auf diesen Gedanken verfallen. Und trotzdem wurde er ihn einfach nicht los. Er bekam dann jedes Mal Kopfweh, stechende Schmerzen direkt über den Augen, so schlimm, dass er sich hinlegen musste.
Bei den Obduktionen, die er durchführte, suchte er in ihren aufgeschlitzten Speiseröhren, in ihren ausgeweideten Bauchhöhlen, in ihren eitrigen Gedärmen und verschrumpelten Lungen nach Beweisen für seine Schuld oder Unschuld, fand aber keine. Er versuchte, den Gestank der Unmengen an Eiter, der ihm manchmal die einzige lebensfähige Substanz in ihren kaputten Eingeweiden zu sein schien, als Buße anzunehmen. Er versuchte, ihr Leid als seines zu verstehen, und an dem Tag, da er eine fingerdicke Schicht üppig wuchernden weißen Schimmels auf dem kraterartigen Geschwür sah, das sich von der Achselhöhle von Black Ajax bis fast zu seiner Hüfte erstreckte, und er prompt sein Mittagessen von sich gab, versuchte er sich einzureden, er begleiche damit eine geistliche Rechnung der allerhöchsten Notwendigkeit. Aber Kotzen beglich keine Schuld, und in seinem Innersten fürchtete der Protektor, dass seine Schuld niemals zu begleichen war. Tief in seinem Herzen fürchtete er, dass all das schreckliche Leid, das grauenhafte Sterben irgendwie von ihm kamen.
Er tat alles, was unter diesen Umständen möglich war, um sie zu retten – Gott wusste, dass er nichts, wirklich nichts unterließ –, sezierte gewissenhaft jede Leiche, um die Todesursache zu finden, stand mitten in der Nacht auf, um die Patienten mit Schröpfköpfen und Blutegeln und Zugpflastern zu behandeln oder sie, wie er es jetzt mit Mathinnas Vater tat, zur Ader zu lassen.
Der Protektor klappte sein Taschenmesser auf und machte Daumen und Zeigefinger nass, um das verkrustete Blut abzuwischen, das alles war, was noch an Wheezy Tom erinnerte. Den Patienten überlief ein Schaudern, als der Protektor das Messer am Handgelenk ansetzte. Er schnitt vorsichtig, nicht zu tief, wissenschaftlich exakt an der Stelle, wo er mit dem geringsten Schaden am meisten Blut abnehmen konnte.
Jeden Abend vor dem Schlafengehen, wenn er im Licht einer Kerze seinen Tagebucheintrag machte, suchte der Protektor nach Wörtern, die er passend zurichten konnte, so wie er in seinem früheren Leben manchmal Holz hatte biegen müssen. Er suchte nach einer Reihe von Wörtern, die sich dazu eignete, wie eine Art Abschlussleiste einen nicht näher beschreibbaren, doch gleichwohl äußerst peinlichen Fehler zuzudecken. Aber Wörter machten das Dunkel, das er empfand, nur noch schlimmer, sie deckten zu und erklärten nichts. Dann flüchtete er zum Gebet, zu Kirchenliedern, zu vertrauten Formeln und beruhigenden Rhythmen. Und manchmal hielten die heiligen Worte das Übel in Schach, und er wusste wieder, warum er Gott dankbar war, und auch, warum er den Herrn fürchtete.
In einer kleinen Fontäne schoss Blut hoch, spritzte dem Protektor ins Auge und lief dann seine Wange hinunter. Er setzte das Messer ab, trat zurück, wischte sich übers Gesicht und sah nieder auf den ausgemergelten Mann, der kaum hörbar ächzte. Der Protektor bewunderte seinen Stoizismus: Er ertrug den Aderlass wie ein Weißer.
King Romeo war früher ein lebhafter und freundlicher Mann gewesen, der Mann, der in den Fury River gesprungen war und ihn, den Protektor, gerettet hatte, als er bei dem Versuch, den reißenden Fluss zu durchqueren, weggespült worden war. Aber dieser Kranke mit den eingefallenen Wangen, den unnatürlich großen Augen und dem dünnen, glatten Haar hatte keine Ähnlichkeit mehr mit jenem Mann.
Der Protektor ließ das Blut eine gute Minute lang auslaufen und fing es, so gut es eben ging, mit einem großen Henkeltopf auf. King Romeo stöhnte leise. Die schwarzen Frauen, die auf dem Boden im Halbkreis um sein Lager herumsaßen, gaben ähnliche dunkle Klagelaute von sich. Der Protektor wusste, dass es ihnen sehr naheging.
Als er King Romeos Wunde verband, um die Blutung zu stillen, spürte er, wie nutzlos seine Behandlung war: Der Tod ließ sich nicht aufhalten. Panik stieg in dem Protektor auf. Er sah, dass King Romeo schwer atmete, und ihm wurde bewusst, dass der Aderlass sinnlos gewesen war, dass er dem Schwarzen hatte wehtun wollen, ihn für seine unheilbare Krankheit bestrafen, für alle diese unheilbaren Krankheiten, für ihr Versagen, dafür, dass sie ihm nicht ermöglicht hatten, sie zu heilen, sie zu zivilisieren, ihnen die Chance zu verschaffen, die niemand sonst ihnen geben wollte.
Murmelnd erklärte der Protektor, dass es nötig sei, das Gleichgewicht der inneren und äußeren pneumatischen Kräfte wiederherzustellen – nicht nur, um seinem Publikum deutlich zu machen, dass er sich, wie immer, in seinem Handeln von der richtigen Mischung aus wissenschaftlicher Vernunft und christlicher Barmherzigkeit leiten ließ, sondern auch zu seiner eigenen Beruhigung –, und packte King Romeos anderen Arm. Der Schwarze schrie auf vor Schmerz, als das Messer ihn ziemlich brutal stach.
Der Protektor ließ es bluten, bis er wieder ruhig wurde und King Romeos Haut sich klamm anfühlte, dann verband er die Wunde. Den Henkeltopf, der bis oben hin mit Blut gefüllt war, gab er einer der Schwarzen, die herumsaßen, und wies sie an, ihn draußen auszuleeren.
Der Protektor richtete sich auf, senkte den Kopf und begann zu singen.
»Führe mich, freundliches Licht; zeig du mir den Weg!«
Seine Stimme klang zittrig und schrill. Er schluckte, dann fuhr er tiefer, lauter und männlich entschlossen fort.
»Die Nacht ist dunkel, und ich bin fern von daheim; zeig du mir den Weg!«
Die schwarzen Frauen fielen recht misstönend ein, so jedenfalls dachte er zuerst, aber dann merkte er, dass sie lediglich den Rhythmus ihrer ächzenden Klage seinem Lied angepasst hatten.
»Gedenke nicht der Jahre, die vergangen sind!«, sang er aus vollem Hals, aber manchmal fiel es selbst ihm schwer, die vergangenen Jahre aus seinem Gedächtnis zu tilgen. Er brach mitten im Vers ab, die Frauen klagten weiter. Er krempelte seine Ärmel herunter, drehte sich um und sah erstaunt Mathinna, die ihn anstarrte, als wäre ihr plötzlich der Gedanke gekommen, er verfüge über Zauberkräfte und versuche sie zu ergründen, und als begänne sie zugleich, an seiner Zaubermacht zu zweifeln. Verunsichert suchte er nach neuen Versen, die seine Nerven beruhigen konnten.
»Jetzt kommt die Phase, in der King Romeos Atmungssystem zu seinem Gleichgewicht findet«, sagte der Protektor. »Dann geht es ihm besser … in dem Maß, in dem das Blut …«
Mathinna schaute auf ihre nackten Füße hinunter, und der Protektor folgte ihrem Blick, doch sofort befiel ihn ein Gefühl von Peinlichkeit, fast wie eine unerklärliche Scham, und er sah auf und weg und ging hinaus in die wohltuend kalte Meeresluft.
Er war zornig, und er verstand selbst nicht recht, wieso. Eigentlich war es nicht seine Sache, Kranke zu behandeln, aber der Arzt war vor einigen Wochen elend gestorben, und es konnte noch Monate dauern, bis der versprochene Ersatz eintraf. Und wenn auch der Protektor auf den alten Arzt wütend war, weil er an der Ruhr gestorben war, und auf den Gouverneur, weil er ihm nicht schneller einen Nachfolger schickte, war er doch zugleich stolz auf seine medizinischen Fähigkeiten: Er konnte Patienten zur Ader lassen und ihnen Zugpflaster auflegen und Klistiere verabreichen, er konnte Leichen sezieren und Obduktionsberichte verfassen, er, ein Laie, ein Zimmermann, konnte all das aus ureigener Kraft und Klugheit, er hatte es sich selbst beigebracht – ein Triumph der Selbstständigkeit.
Den Nachmittag widmete der Protektor einem besonders lohnenden Projekt, seinen Plänen für einen neuen, größeren Friedhof, der der hohen Mortalität in seiner Siedlung Rechnung tragen sollte. Gegen Abend ging er mit den Eingeborenen über den alten Friedhof und fragte sie nach den Namen der Bestatteten. Sie sträubten sich – offenbar hatten sie große Angst davor, die Namen von Toten auszusprechen –, und er schickte sie fort, verstimmt angesichts solcher Undankbarkeit.
Er war entschlossen, seine Begräbnisstätte rechtzeitig zum Besuch des Gouverneurs von Van Diemens Land, Sir John Franklin und seiner Gattin Lady Jane, fertigzustellen, die in einer Woche auf der Insel erwartet wurden. Wenn der kräftige Südwind weiter anhielt, würden die beiden sogar noch früher kommen. Sir John war ein Mann der Wissenschaft, einer der großen Entdecker seiner Epoche und überaus rührig; so erforschte er etwa die Wildnis Transsilvaniens im Westen der Insel, gründete wissenschaftliche Gesellschaften und sammelte Muscheln und Pflanzen für Kew Gardens.
Ja, dachte der Protektor, während er die Grenzen des Geländes abschritt, ein neuer Friedhof und eine deutliche Verbesserung des Kirchengesangs waren realistische und vernünftige Ziele, die man durchaus bis zum Besuch des Vizekönigs erreichen konnte. Mehr als auf alles andere war der Protektor stolz auf seinen Realismus.
Am Abend hielt er dann seinen Vortrag über Pneumatik vor den Offizieren, deren Angehörigen und den Eingeborenen. Sein Text umfasste mittlerweile einhundertvierundvierzig Seiten. Der Protektor fand, dass es ihm gut gelungen war, seine Beweisführung logisch zu untermauern und gelegentlich mit praktischen Beispielen zu illustrieren, etwa indem er eine Flasche über Dampf erhitzte und dann an die Öffnung ein gekochtes und geschältes Ei hielt, das langsam durch den Flaschenhals eingesaugt wurde.
Troilus lachte, als er das sah, und sagte laut: »Wybalenna ist Flasche, Schwarze sind Ei«, womit er aber nur bewies, dass er nichts verstanden hatte.
Danach saß der Protektor noch bei Schinkensandwiches und einem Glas Wein mit den Offizieren zusammen. Um zu demonstrieren, dass er keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß machte, trank er auch von dem Tee, der den Eingeborenen gereicht wurde und der ihnen, wie er dachte, sehr gut schmeckte.
Am nächsten Morgen fand man King Romeo tot in seinem Bett. Sein Ableben war, um die Wahrheit zu sagen, weder unerwartet noch ohne Beispiel, und als der Protektor hinging, um den Leichnam zu untersuchen, fühlte er, dass sich dort, wo früher nichts als Erbarmen gewesen war, Langeweile breitmachte. Eine Frau, mit der King Romeo ein Verhältnis angefangen hatte, nachdem er Witwer geworden war, befand sich in jenem übererregten Zustand, der bei den Eingeborenen normal war: Sie wehklagte wie eine Totenglocke, die ein Irrer läutet, ihr Gesicht war voller Blut von den Schnitten, die sie sich mit Glasscherben beigebracht hatte.
King Romeos Tochter dagegen schien es in eher christlichem Geist aufzunehmen. Ihre verhaltene Trauer ermutigte den Protektor zu der Hoffnung, sein Lebenswerk könnte doch mehr sein als nur ein Monument monströser Eitelkeit. Das Mädchen war so gefasst, dass er sich fragte, ob es nicht doch weit empfänglicher für zivilisierende Einflüsse war, als er angenommen hatte.
Sein Verweilen bei King Romeos Leichnam hatte zur Folge, dass er zu spät zum Unterricht kam, was ihn gegen den Toten aufbrachte, denn er wusste wohl, was die Kraft des Vorbilds vermochte. Wenn er, der Lehrer, es an Pünktlichkeit fehlen ließ oder sonst ein schlechtes Beispiel gab, wie konnte er dann von den Eingeborenen verlangen, dass sie sich besserten?
Tatsächlich missdeuteten die Schüler seine Verspätung als Zeichen gelockerter Disziplin und schwatzten und lachten unbekümmert weiter, während er zu ihnen sprach. Das machte ihn zornig, und statt den Tag mit dem Katechismus zu beginnen, überschüttete er seine Klasse mit bitteren Reden. Hatte er jemals ihr Vertrauen enttäuscht? Hatte er ihnen nicht gute, warme, solide Häuser aus Ziegel geschenkt? Gute Kleidung? Nahrung im Überfluss? Sorgte er nicht auch für ihre Toten, hatte er nicht einen Plan ersonnen, Ordnung zu schaffen unter ihnen und an jedem Grab Zeichen anzubringen, damit man wusste, wer wo beerdigt war?
Nach einer leichten Mittagsmahlzeit, bestehend aus ein paar Sturmtauchern und Brot, ging er zu der Hütte, in der er chirurgische Eingriffe und Obduktionen vornahm. Auf einem langen Tisch aus Kiefernholz lag die Leiche von King Romeo. Später fasste er die gewonnenen Erkenntnisse so zusammen:
Gestorben an allgemeinem Verfall natürlichen Ursprungs: Die Lunge haftete so fest am Brustfell, dass es einiger Gewalt bedurfte, sie zu lösen; die Brusthöhle enthielt eine große Menge Flüssigkeit. Krankes Lungengewebe, die Milz und die Urethra samt Anhängseln wurden entnommen und werden nach Hobarton zu Dr. Arthur zur Untersuchung geschickt. Er war ein interessanter Mann.
Am Ende der Sektion nahm der Protektor aus einem Holzkasten eine Fleischersäge, die er immer scharf geschliffen hielt und nur zu einem einzigen Zweck verwendete. Er schätzte den Griff aus geriffeltem Ebenholz, an dem die Hand, auch wenn sie nass war, guten Halt fand, sodass man sauber und ordentlich damit arbeiten konnte.
Er wollte eben damit beginnen, als es an der Tür klopfte. Er öffnete und sah die Eingeborene Aphrodite draußen stehen, die ihn anflehte, schnell zu ihrem Haus zu kommen, ihr Mann Troilus habe einen Anfall. Der Protektor sprach in allerfreundlichstem Ton mit ihr, in erbarmungsvollem Ton, fand er. Er sagte ihr, sie solle zu ihrem Mann zurückgehen, er, der Protektor, werde bald kommen, um ihm beizustehen. Er schloss die Tür und trat wieder an die Leiche. Er setzte die Säge sorgsam am Nacken an.
War er Gott geworden? Er wusste es nicht mehr. Das Sterben ging immer weiter. Er war umgeben von Leichen, Schädeln, Autopsieprotokollen, Plänen für die Kapelle und den Friedhof. Seine Träume waren voll von den Tänzen und Liedern der Eingeborenen, von der Schönheit ihrer Dörfer, dem Rauschen ihrer Flüsse, voll von Erinnerungen an Liebenswürdigkeiten, die sie ihm erwiesen hatten, und doch hörte das Sterben nicht auf, und nichts, was er tat, vermochte etwas daran zu ändern. Sie starben und starben, und er, der in ihrer alten Welt gelebt hatte und unermüdlich daran arbeitete, diese neue zivilisierte, christliche, englische Welt zu vervollkommnen, er war ihr Beschützer, und trotzdem starben sie. Wenn er Gott war, was für ein Gott war er?
Er zeichnete mit der Säge exakt eine rote Linie in die Haut, dann brachte er mit langen, kräftigen Schnitten, wie es sich für einen tüchtigen Handwerker gehört, die Sache zu Ende. Sechsmal – er zählte mit – fuhr die Säge durch Fleisch und Knochen, dann war King Romeos Kopf abgeschnitten. Trotz aller Vorsicht musste der Protektor zu seinem Ärger feststellen, dass seine Hände schmierig waren von Blut.
4
Wenn es stimmte, was sie gehört hatte, war der Mann schon auf dem absteigenden Ast. Lord Macaulay hatte ihr gesagt, sein neuester Roman sei einfach nur verbohrter Sozialismus, die Handlung unglaubwürdig und die platten politischen Parolen machten das Ganze vollends ungenießbar. Sie selbst hatte das Buch nicht gelesen; sie mochte keine Unterhaltungsliteratur und hielt sich an die Klassiker. Er war kein Unsterblicher wie Thackeray.
Lady Jane hob die Teekanne, beugte sich etwas nach vorn und musterte den Mann. Er war klein und wirkte über seine Jahre hinaus gealtert. Sein Haar, das er immer noch modisch lang trug, wurde schon dünn und grau, es umrahmte ein hageres, zerfurchtes Gesicht. Möglicherweise, dachte sie, ist die eigentlich interessante Frage nicht so sehr, ob das Werk den Mann, als vielmehr, wie lange er noch sein Werk überleben wird. Aber wie auch immer, vorerst jedenfalls blieb er der beliebteste Autor der Nation. Solange er noch am Leben war, konnte er, wenn er seine Stimme erhob, Einfluss auf das Handeln von Regierungen nehmen. Und solange er atmete, war er der beste Verbündete, den sie gewinnen konnte.
»Noch Tee?«, fragte sie.
Er nickte lächelnd. Sie bemühte sich, nicht auf die Finger zu achten, die ihr Tasse und Untertasse hinhielten – dicke, kurze Finger, die besser zu einem Seemann als zu einem Schriftsteller passten –, sie ebenso zu ignorieren wie die viel zu auffällige Kleidung, das Übermaß an Schmuck und die Art, sie mit den Augen zu verschlingen, so gierig, wie er vorher den Mohnkuchen in sich hineingestopft hatte, von dem noch gelbe Krümel und schwarze Samenkörner an seinen Lippen hingen. Er erinnerte sie an einen Einsiedlerkrebs, der sie aus der Deckung seiner schreiend bunten Schale heraus anstarrte. Das alles zusammen hätte sie fast abstoßend unangenehm berühren können, wenn dieser Mann nicht der gewesen wäre, der er tatsächlich war. Und nur darauf kam es an.
»Milch, Mr Dickens?«
So kam es, dass sie ihm an diesem Wintermorgen in London ihre Geschichte erzählte, auf Hochglanz poliert und spiegelglatt geschliffen in tausend Wiederholungen, die Geschichte einer Expedition, eines Unternehmens, das zu wagen allein der englische Geist in seiner ganzen Großartigkeit sich vermessen konnte: hinzufahren, wo noch nie jemand gewesen war, am äußersten Rand der Welt den Seeweg zu finden, von dem man seit Jahrhunderten immer nur geträumt hatte, die sagenhafte Nordwestpassage durchs arktische Eis.
Obwohl Dickens vieles davon bereits kannte – wer nicht? –, hörte er geduldig zu. Lady Jane sprach von den zwei herrlichen Schiffen, der Terror und der Erebus, die man nach der Rückkehr von ihrer berühmten Antarktisreise mit den allerneuesten Wundern der Technik ausgerüstet hatte, mit Dampfmaschinen und Antriebsschrauben, die bei Bedarf weggeklappt werden konnten, mit Kupferverkleidung und Dampfheizung – sogar eine dampfbetriebene Orgel gab es, die automatisch populäre Weisen spielte. Dank einer bemerkenswerten neuen Erfindung konnte man Unmengen von Proviant mitnehmen, konserviert in Tausenden von Blechdosen. Und sie verstand es, jedes Detail der Expedition, der teuersten und spektakulärsten, die je von der Royal Navy ausgeschickt worden war, interessant, ja geradezu fesselnd zu schildern.
Aber am längsten verweilte sie bei den Offizieren und Seeleuten – lauter außerordentliche Männer, das Beste, was England zu bieten hatte, darunter der große Captain Crozier, der schon eine Forschungsreise in die Antarktis mitgemacht hatte, und schließlich der Leiter des Unternehmens, ihr Ehemann Sir John Franklin. Sie sprach von seinem unbeugsamen Charakter, seinem bei aller Sanftheit eisenharten Willen, seinen bemerkenswerten Führungsqualitäten, von den Leistungen, die er voller Heldenmut im Dienst der Polarforschung erbracht hatte, er, der in seiner Person alle Tugend und Größe der englischen Kultur verkörperte. Und man hatte weder von ihm noch von einem seiner hundertneunundzwanzig Männer jemals etwas gehört, seit sie vor neun Jahren in die arktischen Gewässer ausgefahren waren.
»Ist es ein Wunder, wenn dieses Rätsel, wo sie geblieben sein mögen, die zivilisierte Welt nach wie vor in Atem hält?«, fragte Lady Jane, etwas irritiert von dem saugenden Geräusch, das Dickens in selbstvergessener Konzentration von sich gab. »Wie ist es möglich, dass so viele außergewöhnliche Männer so lange Zeit spurlos vom Angesicht der Erde verschwunden bleiben?«
Als er da in seinem Sessel saß, hatte er plötzlich eine Vision, die er nicht mehr loswerden sollte, zugleich ein Talisman, ein Mysterium, eine Erklärung, ein wegweisender Magnet: das eingefrorene Schiff, in einem unnatürlichen Winkel schräg überhängend, hochgehoben und gekippt von der Gewalt des Eises, das hinter den schiefen Masten in ungeheuren weißen Mauern aufragte, das Glitzern des Mondlichts auf endlosem Schnee, das trostlose Stöhnen Sterbender, das über die windgepeitschte weiße Fläche hallte. Eine seltsame halluzinatorische Gabe bewirkte, dass Dickens sich in Eisschollen und fallendem Schnee wiedererkannte; es war ein sehr sonderbares Gefühl: als ob er selbst eine grenzenlos weite gefrorene Welt wäre, die auf eine unmögliche Erlösung wartete.
Er versuchte, sich von dieser schrecklichen Vision frei zu machen. »Größe, wie sie Sir John eigen ist, gibt es nur einmal in jeder Epoche«, sagte er. »Magellan, Kolumbus, Franklin, solche Männer verschwinden nicht spurlos, weder vom Angesicht der Erde noch aus der Geschichte.«
Lady Jane Franklin hatte viele Bekannte und Mundgeruch, sie war in manchen Kreisen gefürchtet. Warum sie gleichwohl in der Gesellschaft Triumphe feiern konnte, blieb ein Geheimnis. Man sagte ihr berückenden Charme nach, aber Dickens konnte an diesem Morgen nichts dergleichen entdecken. Sie trug nicht Schwarz wie eine Witwe, sondern ein rot-grünes Kleid, an einem Kettchen hing vor ihrer Brust ein Medaillon mit einem Bildnis von Sir John in schimmernd weißem Wedgwood-Porzellan. Der Anblick berührte Dickens seltsam – Sir John sah aus wie ein Mann aus Eis.
»Mit diesem knallbunten Kleid kam sie mir eher wie ein Flaggenmatrose als wie eine große Dame vor«, berichtete er später seinem Freund Wilkie Collins. »Es war, als signalisierte sie der Admiralität und den Damen der Gesellschaft immerfort diesen einen Text: Mein Gatte ist nicht tot! Ich weiß nicht«, fügte er nachdenklich hinzu, »ob es eher von Geschmacklosigkeit oder von geradezu übermenschlicher Treue zeugt, wenn jemand so seine Gattenliebe demonstriert.«