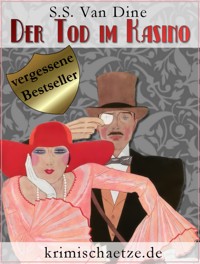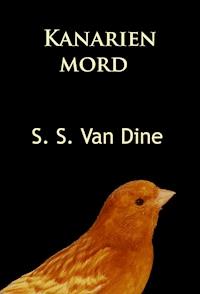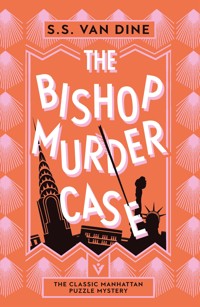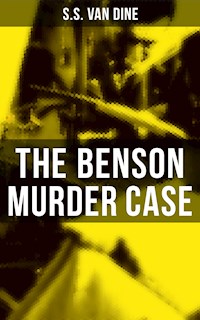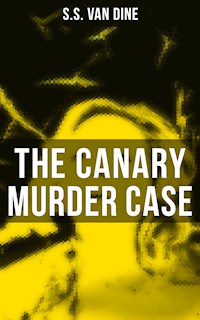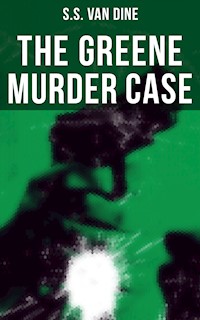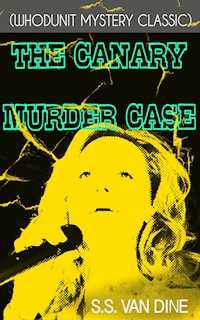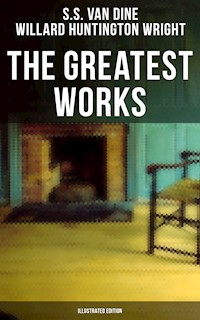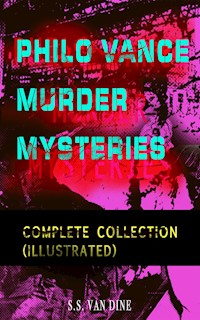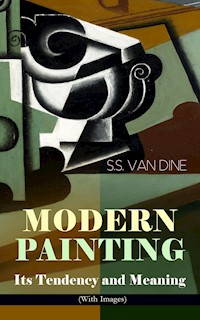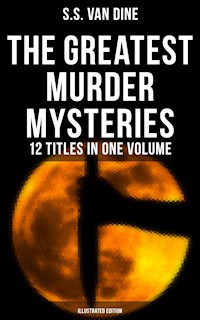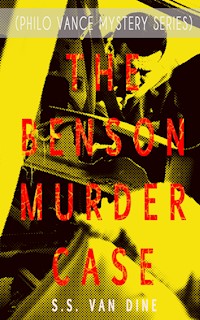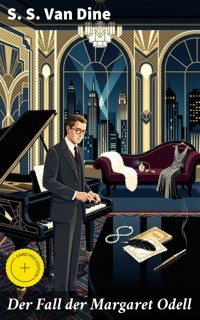
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In "Der Fall der Margaret Odell" entführt S. S. Van Dine die Leser in die intricate Welt der Kriminalermittlungen der 1920er Jahre. Der Roman vereint einen elegant strukturierten Plot mit einem scharfen psychologischen Verständnis seiner Charaktere. Van Dine gelingt es, die Spannung durch präzise Beschreibungen und einen fesselnden Dialog aufrechtzuerhalten, während er gleichzeitig die soziale Dynamik der damaligen Zeit reflektiert. Die komplexe Handlung dreht sich um das mysteriöse Verschwinden von Margaret Odell und die darauf folgenden Ermittlungen, die die Grenzen zwischen Evidenz und Spekulation verwischen. S. S. Van Dine, dessen bürgerlicher Name Willard Huntington Wright war, ist bekannt für seinen Einfluss auf das Genre des Detektivromans und gilt als einer der ersten, der den modernen Krimi mit literarischem Anspruch kombiniert hat. Sein umfangreiches Wissen über Kunst und Literatur fließt in seine Werke ein und hebt den anspruchsvollen, stilvollen Narrativ hervor. Van Dines persönliche Erfahrungen und seine Leidenschaft für Rätsel und psychologische Charakterstudien treiben ihn an und verleihen seinen Erzählungen Tiefe. "Der Fall der Margaret Odell" ist ein unverzichtbares Werk für Liebhaber von Kriminalromanen und bietet einen fesselnden Einblick in die menschliche Psyche und die Herausforderungen der Gerechtigkeit. Seine geschickte Verbindung von Spannung und Raffinesse macht es zu einem Muss für alle, die das literarische Erbe des Genres schätzen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Fall der Margaret Odell
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Im grellen Licht des Showbusiness prallen Verführung und Vernunft aufeinander, und ein Verbrechen zwingt eine schillernde Gesellschaft, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Der Fall der Margaret Odell von S. S. Van Dine bündelt diesen Konflikt in einem Kriminalrätsel, das Glanz und Abgrund der modernen Großstadt nebeneinanderstellt. Der Roman verfolgt, wie Logik und kühle Beobachtung gegen Eitelkeit, Gerüchte und Selbstinszenierung antreten. Das zentrale Versprechen lautet: Aus Schein und Stimmengewirr lässt sich durch präzises Denken eine eindeutige Linie ziehen. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen öffentlicher Pose und privater Wirklichkeit, dessen Reibung die Handlung vorantreibt.
Der Roman gehört zur klassischen Detektivliteratur und ist Teil der Philo‑Vance‑Reihe des Autors S. S. Van Dine, einem Pseudonym des amerikanischen Schriftstellers Willard Huntington Wright. Erstveröffentlichung und Schauplatz verorten das Buch in die späten 1920er‑Jahre, in das New York der Jazz Age, wo Broadway, Clubs und elegante Apartments den Hintergrund liefern. Der literarische Kontext ist die Hochphase des sogenannten Golden Age des Kriminalromans, in dem rätselhafte Morde, begrenzte Verdächtigenkreise und eine faire Spurführung die Form prägen. Van Dine kultiviert darin eine urbane Variante des Rätselromans, die amerikanische Moderne und analytische Strenge miteinander verschränkt.
Ausgangspunkt ist der gewaltsame Tod einer gefeierten Bühnengestalt: Margaret Odell, von der Presse als The Canary bekannt, wird in ihrer Wohnung aufgefunden. Um sie gruppiert sich ein Kreis von Bewunderern, Geschäftspartnern und ehemaligen Vertrauten, deren Motive zwischen Begehren, Ehrgeiz und gekränkter Eitelkeit changieren. Philo Vance nimmt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit Polizei und Staatsanwaltschaft auf und tastet sich durch widersprüchliche Aussagen, public relations und persönliche Geheimnisse. Das Leseerlebnis ist geprägt von kultivierter Stimme, präziser Beobachtung und kontrollierter Spannung: kein hastiges Spektakel, sondern ein sorgfältig gebautes Rätsel mit stetig wachsendem Sog.
Stilistisch verbindet der Roman gesprächsintensive Szenen, knappe Beobachtungen und die geduldige Rekonstruktion von Zeitabläufen. Dialoge sind nicht bloß Informationsträger, sondern verbale Duelle, in denen Feinheiten der Sprache Indiziencharakter gewinnen. Vance’ Methode ist die einer schrittweisen, logisch sauberen Reduktion: Alibis werden geprüft, Routinen entlarvt, kleine Unstimmigkeiten zu entscheidenden Hebeln der Erkenntnis. Ein sachlich‑ironischer Erzähler rahmt diese Bewegungen und hält den Ton zugleich elegant und distanziert. Lesende erhalten Hinweise in einer Weise, die zur aktiven Teilnahme einlädt: Das Spiel besteht darin, zwischen Trugbild und relevanter Spur zu unterscheiden, bevor der Ermittler es tut.
Inhaltlich kreist das Buch um Themen, die die Bühne und das gesellschaftliche Parkett miteinander teilen: Identität als Inszenierung, die Ökonomie der Aufmerksamkeit und die Zerbrechlichkeit von Reputation. Machtverhältnisse – finanziell, medial, intim – strukturieren Beziehungen ebenso wie der Druck, ständig eine Rolle zu spielen. Der Roman beobachtet, wie öffentliche Bilder private Wahrnehmungen überlagern und wie Begehren, Stolz und Berechnung moralische Grauzonen erzeugen. Zugleich stellt er die Frage, was Erkenntnis im Lärm der Stadt bedeutet: Ist Wahrheit nur das, was sich beweisen lässt, oder auch das, was dem Blick standhält, wenn das grelle Rampenlicht erlischt?
Gerade darin liegt seine heutige Relevanz: In einer Gegenwart, die von Prominenz, Schlagzeilen und sozialer Sichtbarkeit geprägt ist, wirkt die nüchterne Methodik der Aufklärung wie ein Gegenentwurf zum impulsiven Urteil. Der Roman zeigt, wie schnell Narrative entstehen – und wie beharrlich sie geprüft werden müssen. Leserinnen und Leser, die intellektuelles Rätseln schätzen, finden hier ein faires Angebot: Spuren werden gelegt, Annahmen getestet, Schlussfolgerungen begründet. Gleichzeitig eröffnet die Geschichte einen Blick auf die Mechanik von Ruhm und Gerücht, der über den Kriminalfall hinaus nachhallt und Fragen nach Verantwortung, Wahrnehmung und Wahrhaftigkeit aufwirft.
Wer Der Fall der Margaret Odell aufschlägt, betritt ein elegant konstruiertes, entschleunigtes Erzählgefüge, das die Atmosphäre des New York der späten 1920er‑Jahre lebendig macht. Erwartet werden dürfen präzise Milieustudien, pointierte Charakterzeichnungen und eine Ermittlungsarbeit, die intellektuelle Konsequenz mit feinem Gespür für soziale Dynamik verbindet. Ohne vorzugreifen bleibt festzuhalten: Die Spannung wächst weniger durch Verfolgungsjagden als durch die allmähliche Klärung dessen, was wirklich gesehen, gesagt und getan wurde. So ist der Roman zugleich Zeitbild und Denkspiel – ein Werk, das die Anziehungskraft des Glanzes nutzt, um Schritt für Schritt zur Klarheit vorzustoßen.
Synopsis
Der Fall der Margaret Odell von S. S. Van Dine führt in das New York der späten Zwanzigerjahre, wo Glamour und Gier eng beieinanderliegen. Im Mittelpunkt steht die gefeierte Tänzerin Margaret Odell, in den Klatschspalten als The Canary bekannt. Als sie tot in ihrem Apartment aufgefunden wird, ruft der Fall sofort die Öffentlichkeit auf den Plan. District Attorney Markham übernimmt die Leitung, Sergeant Heath organisiert die Ermittlungen, und der kunstsinnige Amateurdetektiv Philo Vance bietet seine Hilfe an. Aus der Perspektive nüchterner Polizeiarbeit und scharfzüngiger Logik beginnt eine Untersuchung, die die glitzernde Oberfläche der Broadway-Welt aufbricht.
Der Tatort wirkt zugleich geordnet und rätselhaft. Es gibt Anzeichen eines späten Besuchs, aber keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Margaret Odell scheint ihren Besucher gekannt und eingelassen zu haben. Hinweise auf Schmuck, Geschenke und Blumen deuten auf eine Vielzahl von Verehrern, die um ihre Gunst rivalisierten. Die Hausangestellten, der Portier und Nachbarn liefern erste Aussagen zu Geräuschen, Schritten und nächtlichen Anrufen. Die Ermittler sichern Telefonprotokolle und prüfen, wer Zugang zum Haus hatte. Schon in dieser frühen Phase entsteht ein breites Tableau möglicher Motive: Eifersucht, verletzte Eitelkeit, Geldnöte und der Wunsch, kompromittierende Geheimnisse zu verbergen.
Im Fokus stehen mehrere Männer aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die alle Beziehungen zu der Toten hatten. Ein vermögender Geschäftsmann will seine Reputation schützen, ein eifersüchtiger Verehrer sucht späte Genugtuung, ein zwielichtiger Unterweltkontakt fürchtet Enthüllungen. Auch ein Bühnenmanager und ein Modehändler geraten in den Blick, weil sie Glaubwürdigkeit und Gelegenheit vereinen könnten. Bei jedem Verdächtigen werden Bewegungen rekonstruiert, Alibis überprüft und frühere Auseinandersetzungen beleuchtet. Die Presse treibt die Dramatik voran, doch Markham und Heath halten am strukturierten Vorgehen fest. Vance beobachtet still, stellt präzise Fragen und ordnet die Fülle widersprüchlicher Details zu plausiblen Mustern.
Die Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf die letzten Stunden vor dem Tod. Wer telefonierte mit Odell, wer erhielt eine Einladung, wer wurde abgewiesen. Portierbücher, Taxiquittungen und Theaterpläne ergeben eine lückenhafte Zeitleiste, in der sich Lücken und Überschneidungen zeigen. Vance interessiert sich für scheinbar nebensächliche Details: die Platzierung eines Stuhls, die Art des Parfüms, der Rhythmus des Abends. Während Zeugen zwischen Erinnerung und Selbstdarstellung schwanken, vergleicht die Polizei Aussagen mit überprüfbaren Daten. Aus kleinen Differenzen erwachsen Vermutungen, dass einige Alibis planvoll konstruiert wurden, um eine nahe Begegnung mit der Toten zu verschleiern.
Philo Vance verfolgt zwei parallele Linien: die psychologische Analyse der Beteiligten und die strikte Logik des Tatablaufs. Er entwirft Profile, in denen Temperament, Stolz und Angst miteinander ringen. Zugleich prüft er, was physisch möglich war: wann jemand das Haus betreten konnte, wie lange eine Begegnung realistischerweise dauerte, und welche Gegenstände am Tatort etwas über die Intention verraten. Ein verrückter Winkel, ein nicht stimmiger Lichtschalter, ein verstautes Schmuckstück – solche Kleinigkeiten gewinnen Gewicht. Vance vermeidet vorschnelle Schlüsse und lässt Hypothesen gegeneinander antreten, bis Widersprüche die schwächeren Erklärungen verdrängen.
Ein Wendepunkt zeichnet sich ab, als mehrere scheinbar sichere Alibis unter Druck geraten. Ein Telefonat stimmt zeitlich nicht, ein Zeuge hat mehr gehört als zunächst ausgesagt, und ein Geschenk taucht an unerwarteter Stelle auf. Daraus entstehen neue Verknüpfungen zwischen den Verdächtigen. Vance erkennt ein Muster von Täuschungen, das auf eine geschickte Steuerung der Ereignisse hindeutet. Anstatt einer spontanen Tat sieht er Planung und die Ausnutzung von Gewohnheiten. Gleichzeitig wird klar, dass Odell über Informationen verfügte, die anderen gefährlich werden konnten. Der Kreis derjenigen, die dringende Gründe hatten, sie zum Schweigen zu bringen, verengt sich merklich.
Um die Fassade zu erschüttern, arrangieren Markham und Vance gezielte Gegenüberstellungen. In Einzelgesprächen variiert Vance Fragen, prüft Reaktionen und vergleicht Sprachmuster. Ein praktischer Versuch rekonstruiert, wie der Täter unauffällig ein- und ausgehen konnte, ohne das Personal zu alarmieren. Dabei spielen Routine, Verkleidung und die Erwartungshaltung der Beteiligten eine Rolle. Sergeant Heath steuert handfeste Beobachtungen bei, besonders zu Türen, Schlüsseln und Blickachsen im Flur. Der Fall erhält dadurch Kontur: Ein Täter mit Gelegenheit, Ortskenntnis und der Fähigkeit, Misstrauen zu reduzieren. Die psychologische Linie und die materiellen Fakten beginnen zusammenzufallen.
Als die Bausteine zusammenrücken, schlägt Vance eine abschließende Demonstration vor, um Annahmen zu verifizieren und einen letzten Widerspruch offenzulegen. In einer angespannten Zusammenkunft legt er die logische Kette aus Motiv, Gelegenheit und Täuschung dar, ohne Namen zu nennen, und zwingt den Schuldigen indirekt, Position zu beziehen. Der entscheidende Fehler besteht nicht in einem dramatischen Geständnis, sondern in einem kleinen, verräterischen Verhalten. Damit ist die Beweiskette vollständig und juristisch belastbar. Markham sorgt für die rechtsstaatliche Abwicklung. Der Fall endet ohne Spektakel, doch mit dem Gefühl einer rationalen, nachvollziehbaren Klärung.
Das Buch vermittelt die zentrale Idee, dass nüchterne Beobachtung und klare Logik selbst in einem Milieu aus Ruhm, Illusion und Sensationslust verlässlich zum Ziel führen. Es zeigt, wie öffentliche Bilder und private Motive auseinanderfallen, und wie Verletzlichkeit hinter Glanz verborgen liegt. Der Roman ist zugleich Gesellschaftsporträt der Jazz Age und ein fair konstruiertes Rätsel, das Leserinnen und Leser Schritt für Schritt mitdenken lässt. Philo Vance verkörpert dabei eine intellektuelle, distanzierte Ermittlungsweise, die Widersprüche erhellt statt Instinkten zu folgen. Am Ende steht die Einsicht, dass Wahrheit sich in Details versteckt und Geduld belohnt.
Historischer Kontext
Der Fall der Margaret Odell spielt im New York der späten 1920er Jahre, im Epizentrum Manhattan zwischen Broadway, Times Square und den eleganten Apartmenthäusern an Park und Fifth Avenue. Die Stadt ist von Prohibition, elektrischer Reklame und nächtlicher Mobilität geprägt: Taxis, Telefone, Aufzüge und Portiers schaffen neue städtische Rhythmen. Nach dem Ersten Weltkrieg (1918) erlebt New York eine Wachstums- und Vergnügungswelle, während das Einwanderungsgesetz von 1924 die Zuwanderung begrenzt. In diesem urbanen Gefüge verschränken sich Bühne, Reichtum und Halbwelt. Van Dines Kriminalfall nutzt exakt diese Orte und Milieus als realistische Kulisse für Intrige und Mord.
Die Prohibition (18. Verfassungszusatz 1919; Volstead Act seit 17. Januar 1920 in Kraft, aufgehoben am 5. Dezember 1933) formte New Yorks Nachtleben. New Yorks Mullan-Gage-Gesetz (1921) wurde 1923 unter Gouverneur Al Smith aufgehoben, was die Hauptstadt des „nassen“ Amerika begünstigte: Speakeasies, Flüsterkneipen und private Clubs florierten. Schmuggelrouten, Schutzgeld und politische Protektion strukturierten die Vergnügungsindustrie. Im Roman bewegt sich die ermordete Showgröße Margaret Odell in genau diesem Milieu aus Champagner hinter verschlossenen Türen und diskreten Gastgebern. Die Fallkonstellation – geheime Treffen, teure Geschenke, verborgene Abhängigkeiten – spiegelt die Schattenökonomie der Prohibition.
Organisierte Kriminalität wuchs durch Schmuggel und Glücksspiel zu gesellschaftlicher Macht. Arnold Rothstein (1882–1928), berüchtigt seit dem Black-Sox-Skandal von 1919, wurde am 4. November 1928 im Park Central Hotel angeschossen und starb kurz darauf; Owney Madden kontrollierte ab 1923 den Cotton Club in Harlem; „Big Bill“ Dwyer dominierte den Rumhandel. Netzwerke aus Gangstern, Gastronomen und wohlhabenden Gönnern verbanden Bühne und Unterwelt. Der Roman zeigt, wie eine gefeierte Künstlerin in die Umlaufbahn wohlhabender Männer und dubioser Beschützer gerät und wie solche Verflechtungen Erpressung, Eifersucht und Gewalt begünstigen. Van Dine, der in den 1920er Jahren in Manhattan lebte, zeichnet diese Machtkreise kenntnisreich nach.
Broadway etablierte seit den Ziegfeld Follies (ab 1907) ein Star-System: Revue, Glanz und schwerreiche Förderer. Times Square – die „Great White Way“ – verband Bühne, Werbung und Kommerz. Prominente Affären prägten das öffentliche Gedächtnis: 1906 erschoss Harry K. Thaw den Architekten Stanford White wegen Evelyn Nesbit; im März 1923 wurde die „Broadway Butterfly“ Dorothy King ermordet, der Fall blieb ungeklärt. Diese Konstellationen aus Showgirl, Gesellschaft und Skandal bilden den Resonanzraum für Margaret Odell, die „Canary“. Der Roman nutzt Garderoben, Bühnenhinterausgänge und Produzentenbüros als Schauplätze und verweist so auf die prekäre Verbindung von Glamour und Gefährdung.
Mit dem 19. Verfassungszusatz (1920) erhielten Frauen das Wahlrecht; zugleich entstand die Flapper-Kultur: Bubikopf, kurze Kleider, Charleston, Rauchen in der Öffentlichkeit. Aktivistinnen wie Margaret Sanger (erste Klinik 1916; American Birth Control League 1921) standen für neue Selbstbestimmung, doch moralische Doppelstandards hielten an. In New York mieteten unverheiratete Frauen eigene Apartments und arbeiteten auf und hinter der Bühne. Van Dines Opferfigur verkörpert diese Ambivalenz: eine wirtschaftlich scheinbar selbständige Entertainerin, die dennoch von Geschenken, Rollenangeboten und männlicher Protektion abhängt. Der Roman macht sichtbar, wie männliche Besitzansprüche und Rufmord weibliche Autonomie bedrohen.
Die Boulevardpresse veränderte ab 1919 die Öffentlichkeit: New York Daily News (1919), Daily Mirror (1924) und Evening Graphic (1924–1932) lebten von Fotografie, „Composographs“ und reißerischen Titeln. Spektakuläre Prozesse – etwa der Snyder-Gray-Fall in Queens (Mord 1927, Hinrichtung 1928) – zeigten, wie Medien Atmosphäre und Ermittlungsdruck formen. Van Dines New York ist von Reportern, Überschriften und öffentlicher Neugier erfüllt; der Mord an einer Berühmtheit wird zum Medienspektakel. Der Roman spiegelt damit eine Ära, in der Presseaufmerksamkeit Ermittlungsstrategien beeinflusst, Karrieren von Staatsanwälten prägt und das Bild der Beteiligten festschreibt, noch bevor Gerichte entscheiden.
New Yorks Strafverfolgung modernisierte sich in den 1920er Jahren: Fingerabdrücke setzten sich endgültig durch; die vergleichende Ballistik gewann mit Calvin Goddards mikroskopischen Verfahren (1925) an Gewicht. Zugleich standen Polizei und Staatsanwaltschaft unter politischem Einfluss von Tammany Hall; Joab H. Banton war 1922–1929 District Attorney von New York County, während Bürgermeister Jimmy Walker (1926–1932) ein laissez-faires Vergnügungsklima verkörperte. Van Dines Staatsanwalt John F.-X. Markham und der methodische Dilettant Philo Vance spiegeln die Spannung zwischen formaler Behörde, wissenschaftlichen Ansätzen und sozialer Macht. Der Fall zeigt, wie Logik, Verhörtechnik und gesellschaftliche Netzwerke konkurrieren – und wie Politik Ermittlungen rahmt.
Als Gesellschaftsdiagnose entlarvt der Roman die Heuchelei einer Epoche, in der Prohibition öffentlich Moral beschwört, aber privat Luxus und Regelbruch feiert. Er zeigt Klassengegensätze: reiche Beschützer, die Diskretion kaufen, und Entertainerinnen, deren Glamour soziale Verwundbarkeit überdeckt. Die Verflechtung von Politik, Polizei und Vergnügungsindustrie weist auf Korruption und selektive Gerechtigkeit hin. Indem er den Tod einer berühmten Frau durch ein Geflecht aus Eitelkeit, Gier und Macht erklärt, kritisiert Van Dine die Kommodifizierung weiblicher Körper und den Zynismus der Öffentlichkeit. Der Roman macht sichtbar, wie Medienrummel, Geld und Einfluss Wahrheit verzerren und Rechtsgleichheit unterminieren.
Der Fall der Margaret Odell
Der Kanarienvogel
Im Sekretariat der Kriminalabteilung der New Yorker Polizei, im dritten Stock des Polizeipräsidiums, befindet sich eine große Kartothek mit Stahlfächern. Dort, unter tausenden ihresgleichen, wird eine kleine grüne Karte aufbewahrt, auf der in Maschinenschrift steht: Odell, Margaret. 184 West – 71. Straße, 10. Sept. Mord: Gegen elf Uhr abends erwürgt. Wohnung durchstöbert. Juwelen gestohlen. Leiche von Amy Gibson, Bedienerin, entdeckt.
Dies ist in ein paar dürren Worten die sachliche Feststellung eines der erstaunlichsten Fälle in der Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten, eines einzigartigen, widerspruchsvollen, genial ausgeführten Verbrechens, das viele Tage lang die besten Kräfte der Detektivabteilung und des Polizeipräsidiums völlig ratlos ließ. Jede Fährte, die die Untersuchung aufnahm, bewies anscheinend nur, daß niemand Margaret Odell ermordet haben konnte; aber die Leiche, die zusammengekrümmt auf dem großen, seidenbespannten Sofa in ihrer Wohnung lag, strafte diese groteske Mutmaßung Lügen.
Margaret Odell gehörte zur Halbwelt-Boheme des Broadway. Die beiden letzten Jahre vor ihrem Tod war sie die auffälligste, in einem gewissen Sinn populärste Erscheinung im Nachtleben der Stadt. Ihre Berühmtheit rührte zum Teil von Gerüchten über Liebesaffären in Europa mit einer oder zwei unbekannten Fürstlichkeiten her. Nach ihrem ersten Erfolg in dem Singspiel »Das Mädchen aus der Bretagne«, durch den sie überraschend schnell zum Star aufgestiegen war, hatte sie zwei Jahre auf Reisen verbracht. Ihr Presseagent beutete, wie man sich denken kann, diese Abwesenheit in vollem Umfange aus, um phantastische Berichte über ihre Eroberungen in Umlauf zu setzen.
Die Erscheinung der Odell trug viel dazu bei, ihren etwas zweifelhaften Ruf glaubhaft zu machen. Ich erinnere mich, daß ich sie einmal im Autler-Klub, dem bekannten nachmitternächtlichen Treffpunkt der Vergnügungssüchtigen, tanzen sah. Sie erschien mir damals als ein Wesen von ganz ungewöhnlichem Reiz, trotz ihres berechnenden und gierigen Ausdrucks. Sie war mittelgroß, schlank, graziös wie ein Panther, ihre Manieren erschienen mir etwas hochmütig, was sich vielleicht auf jene, gerüchtweisen Beziehungen zu europäischen Fürstlichkeiten zurückführen ließ. Sie hatte das typische Gesicht einer Kokotte, geschminkte Lippen, lange schmale Augen – wollüstig und voll dunkler Geheimnisse –, eines jener Gesichter, die die Gefühlswelt des Mannes beherrschen, sein Denken unterjochen und ihn zu verzweifelten Taten treiben können.
Margaret Odell erhielt den Spitznamen »Der Kanarienvogel« nach einer Rolle, die sie in einem Ballett gespielt hatte, in dem die Tänzerinnen als Vögel auftraten. Ihr war die Partie des Kanarienvogels zugefallen; ihr Kostüm aus weißem und gelbem Satin, ihr üppiges, leuchtend goldnes Haar, ihr rosig weißer Teint verliehen ihr in den Augen des Publikums einen außergewöhnlichen Reiz. Ehe noch vierzehn Tage vergingen – so überschwenglich war das Lob der Zeitungen, und so einwandfrei galt der Applaus des Publikums vor allem ihr – wurde das »Vogelballett« in ein »Kanarienballett« verwandelt, und Miß Odell war erste Solotänzerin. Die Einlage eines Walzers für sie und eines Songs gaben ihr dann weitere Gelegenheit, ihre Reize und ihr Talent spielen zu lassen.
Am Ende der Spielzeit hatte sie die »Follies« verlassen. In ihrer folgenden glänzenden Laufbahn in den Nachtlokalen am Broadway wurde sie allgemein »Der Kanarienvogel« genannt. So kam es, daß, nachdem man sie von brutaler Hand erwürgt in ihrer Wohnung gefunden hatte, das Verbrechen sofort bekannt und »der Mord an dem Kanarienvogel« genannt wurde.
Meine persönliche Teilnahme an der Untersuchung dieses Falles – oder, genauer gesagt, meine Rolle als Zuschauer – gehört zu den denkwürdigsten Begebenheiten meines Lebens. Zur Zeit des Mordes an Margaret Odell war John F. Markham Polizeichef in New York. Dort war damals gerade, als unmittelbare Folge des Alkoholverbot[1]s, eine gefährliche und höchst unerwünschte Art Nachtleben aufgekommen. Eine Menge wohlfinanzierter Kabaretts, die sich »Nachtklubs« nannten, waren am Broadway und in dessen Seitenstraßen eröffnet worden, und eine beängstigende Anzahl schwerer Verbrechen, für deren Brutplätze man diese übelbeleumdeten Zufluchtstätten hielt, lag vor.
Markham war wochenlang in den regierungsfeindlichen Zeitungen aufs schärfste angegriffen worden, weil das Polizeipräsidium mangels ausreichender Beweise außerstande war, gewisse Verbrecher aus der Atmosphäre dieser Unterwelt zu überführen. So hatte er – ungeachtet seiner übrigen Amtsgeschäfte – beschlossen, seine persönliche Arbeitskraft den unerträglichen Kriminalverhältnissen zu widmen, und er zeichnete sich durch seinen geradezu unheimlichen Erfolg bei den Untersuchungen aus. Die Anerkennung jedoch, die ihm hierfür ausgesprochen wurde, war ihm im höchsten Grade peinlich. Denn als Mann vor ausgeprägtem Ehrgefühl schrak er davor zurück, der Kredit für Leistungen anzunehmen, die nicht voll und ganz seine eigenen waren. Tatsache ist nämlich, daß Markham lediglich die Rolle eines Mitarbeiters in den meisten seiner berühmten Kriminalfälle spielte. Das Lob für deren Lösung gebührte einem der nächsten Freunde Markhams Dieser aber verbat sich ausdrücklich, öffentlich genannt zu werden.
Dieser Mann war ein junger Aristokrat, für den ich aus Gründen der Anonymität den Namen Philo Vance gewählt habe. Vance war ein Mensch von erstaunlichen Fähigkeiten. Er war Kunstmaler in kleinem Stil, begabter Pianist und gründlich bewandert in allen Fragen der Ästhetik und Psychologie. Er war Amerikaner, hatte jedoch eine sorgfältige Erziehung in Europa genossen. Er verfügte über ein recht beträchtliches Einkommen und verbrachte viel Zeit mit der Erledigung seiner gesellschaftlichen Pflichten. Er war damals noch nicht fünfunddreißig und sah sehr gut aus. Leute, die ihn nur flüchtig kannten, hielten ihn für einen Snob. Ich aber stand ihm sehr nahe, und so war ich leicht imstande, den wirklichen Menschen in ihm zu schätzen. Ich wußte, daß sein Zynismus und seine Distanziertheit nicht Pose waren, sondern einer sensitiven und einsamen Natur entsprangen.
Im allgemeinen hielt sich Vance von den Angelegenheiten der Welt absichtlich fern. Er betrachtete das Leben wie sich ein leidenschaftsloser, aber innerlich amüsierter Zuschauer eine Theatervorstellung ansieht. Seine lebhafte intellektuelle Neugier trieb ihn, sich an Markhams Kriminaluntersuchungen zwar aktiv, jedoch inoffiziell, gewissermaßen als »amicus curiae«, zu beteiligen.
Fußspuren im Schnee
Der Stuyvesant Club[2] wurde ganz in der Art eines renommierten Hotels betrieben. Seine zahlreiche Mitgliedschaft setzte sich aus politischen, juristischen und Finanzkreisen zusammen. Wir drei, Markham, Vance und ich, waren Mitglieder und trafen uns dort oft in einer verschwiegenen Ecke der großen Halle, um zu plaudern.
»Es ist schlimm«, bemerkte Markham an diesem Abend, »daß die halbe Stadt das Amt des Polizeichefs für eine Art oberste Sammelstelle hält. Ich hätte sonst wirklich nicht nötig, Detektiv zu spielen, bloß weil mir die Beamten keine zulänglichen Indizien liefern, um eine Überführung des Täters zu sichern.«
Vance blickte Markham spöttisch an. Über sein schmales, sehr bewegliches Gesicht huschte ein Lächeln.
»Die Schwierigkeit«, entgegnete er lässig, »liegt wohl darin, daß die Polizei in den Spitzfindigkeiten des juristischen Verfahrens nicht bewandert ist. Sie glaubt, daß Schuldbeweise, wie sie einen Durchschnittsmenschen überzeugen, auch einen Gerichtshof überzeugen müßten. So was ist natürlich albern. Ein Polizist denkt viel zu gerade, als daß er je den umständlichen Forderungen der Juristen gerecht werden könnte.«
»Ganz so schlimm ist es doch wohl nicht«, beschwichtigte Markham. »Gäbe es nicht Regeln zur Aufnahme einwandfreier Tatbestände, dann müßte mancher Unschuldige büßen. Selbst ein Verbrecher kann Schutz vor einer ungerechten Verurteilung verlangen.«
Vance gähnte gelangweilt. »Markham, du hättest Schullehrer werden sollen. Es ist erstaunlich, wie du eine Kritik mit Gemeinplätzen totschlägst. Ich bin keineswegs deiner Meinung. Entsinnst du dich jener Erbschaftssache in Wisconsin? Ein paar Interessenten hatten dafür gesorgt, daß ein gewisser Mann rechtzeitig von der Bildfläche verschwand. Die Gerichte erklärten den Verschollenen für tot. Eines Tages erschien er jedoch wieder und lebte gesund und munter unter seinen früheren Nachbarn. Sein Zustand als offizieller Toter konnte aber gesetzlich nicht geändert werden. Die offenbare Tatsache, daß er am Leben war, wurde von den Juristen für unwichtig gehalten ... Verlangst du wirklich, daß ein Laie das versteht?«
»Wozu diese akademische Dissertation?« fragte Markham ein wenig gereizt.
»Sie legt die Axt an die Wurzel des Übels«, erwiderte Vance gleichmütig. »Einzig die Tatsache, daß die Polizei juristisch ungebildet ist, hat deine gegenwärtigen Scherereien verursacht. Warum bringst du keinen Gesetzvorschlag ein, daß alle Kriminalschutzleute eine Rechtshochschule besuchen müssen?«
»Na, du bist mir ein schöner Gehilfe!« gab Markham zurück.
Vance zog die Augenbrauen leicht in die Höhe. »Die Anregung ist gar nicht zu übel. Ein Nichtjurist klammert sich an Tatsachen. Ein Gerichtshof aber hört sich freilich eine Masse wertloser Zeugenaussagen an und fällt dann seine Entscheidung nicht nach der wirklichen Sachlage, sondern nach pedantischen Vorschriften. Das Ergebnis: das Gericht läßt oft den Schuldigen laufen, und mancher Richter hat schon zum Angeklagten gesagt: Ich weiß, und das Gericht weiß es, daß du das Verbrechen begangen hast, aber mit Rücksicht auf die Beweise, die das Gesetz fordert, erkläre ich dich für unschuldig. Geh und sündige wieder!«
Markham brummte: »Ich würde mich kaum beliebt machen, wenn ich die Anwürfe gegen mich damit beantwortete, daß ich juristische Kurse für die Polizei vorschlüge.«
»Dann verrate mir wenigstens«, sagte Vance, »wie du den vernünftigen Befund der Polizei mit dem, was man feinsinnig die Korrektheit des juristischen Verfahrens nennt, in Einklang bringen willst.«
»Ich hatte gestern eine Konferenz mit meinen Bezirksvorstehern«, unterrichtete ihn Markham. »In Zukunft werde ich die Untersuchung in den wichtigsten Kriminalfällen der Nachtklubs selbst in die Hand nehmen. Ich werde mit allen Mitteln versuchen, Schuldbeweise, die ich zu Verurteilungen brauche, in die Hände zu bekommen.«
Vance nahm langsam eine Zigarette aus seinem Etui und tippte sie auf seine Stuhllehne.
»Aha! Du gedenkst also den Freispruch des Schuldigen durch die Aburteilung des Unschuldigen zu ersetzen?«
Markham fuhr ärgerlich herum und blickte Vance stirnrunzelnd an.
»Ich will nicht behaupten, daß ich diese Bemerkung mißverstehe«, sagte er bitter. »Du bist einmal wieder hinter deinem Lieblingsthema, der Unzulänglichkeit des Indizienbeweises, her.«
»Stimmt!« sagte Vance ruhig. »Dein kindlich reines Vertrauen in den Indizienbeweis macht mich tatsächlich wehrlos. Ich zittre schon für die schuldlosen Opfer, die du in deinen gesetzlichen Netzen fangen wirst. Schließlich wird es so weit kommen, daß der bloße Besuch eines Kabaretts zum Wagnis wird.«
Markham schwieg eine Zeitlang und rauchte. Die Bitterkeit, die gelegentlich in den Gesprächen der beiden aufkam, hatte keinen Einfluß auf ihre Stellung zueinander. Sie waren alte Freunde, und trotz der Verschiedenheit ihrer Temperamente und Standpunkte hatten sie im Grunde tiefe Achtung voreinander.
»Warum eigentlich verwirfst du den Indizienbeweis so restlos?« begann Markham wieder. »Zugegeben, daß er zuweilen in die Irre führt, aber er ist und bleibt die stärkste Handhabe, die wir Kriminaljuristen haben. Es liegt in der Natur des Verbrechens, daß unmittelbare Schuldbeweise beinah nie zu beschaffen sind. Wären die Gerichte auf sie angewiesen, dann befände sich die Mehrzahl aller Verbrecher auf freiem Fuß.«
»Ich habe den Eindruck, daß diese kostbare Mehrzahl sich ohnehin stets ihrer uneingeschränkten Freiheit erfreut.«
Markham überhörte diese Unterbrechung.
»Nimm ein Beispiel: ein Dutzend Erwachsene sehen einen Vogel durch den Schnee laufen. Sie bezeugen: es war ein Huhn. Ein Kind aber erklärt, es war eine Ente. Die Spuren im Schnee werden untersucht, die schwimmfüßige Fährte einer Ente wird festgestellt. Ist es dann nicht klar, daß der Vogel eine Ente und nicht ein Huhn war, trotz der überwiegenden direkten Zeugenangaben?«
»Na, ich schenke dir die Ente!« pflichtete Vance bei.
»Dein Geschenk wird dankbar angenommen. Nun ein Folgerungsbeispiel: ein Dutzend Erwachsene sehen eine menschliche Gestalt durch den Schnee fliehen. Sie beschwören, es war eine Frau. Ein Kind aber besteht darauf, es sei ein Mann gewesen. Nun, willst du nicht zugeben, daß also die Stapfen von Männerschuhen im Schnee den Beweis liefern, die Gestalt war tatsächlich ein Mann und nicht eine Frau?«
»Nie und nimmer, lieber Justinian«, erwiderte Vance und streckte behaglich seine Beine aus, »es sei denn, daß du beweisen kannst, daß der Mensch kein besseres Gehirn besitzt als die Ente.«
»Was haben denn Gehirne damit zu tun?« fragte Markham ungeduldig. »Gehirne beeinflussen doch Fußabdrücke nicht.«
»Entengehirne gewiß nicht. Aber Menschengehirne könnten es sehr wohl, und ohne Zweifel tun sie es sogar oft.«
»Hältst du mir da eine Vorlesung über Anthropologie oder spekulative Metaphysik?«
»Ganz und gar nicht«, versicherte Vance. »Ich rede von einer simplen, oft beobachteten Tatsache.«
»Schön! Würden also diese Männerfußtapfen nach deinem mit Scharfsinn entwickelten Denkprozeß einen Mann oder eine Frau beweisen?«
»Zwangsläufig keins von beiden«, antwortete Vance; »oder richtiger: die Möglichkeit von beiden. Dein Beispiel auf Menschen angewandt, das heißt auf Geschöpfe mit logischem Verstand, würde nur besagen: die Gestalt, die über den Schnee floh, war entweder ein Mann in seinen eigenen Schuhen oder eine Frau in Männerschuhen oder vielleicht sogar ein langbeiniges Kind, kurz: die Spuren stammen von irgendeinem Nachkommen des Pithecanthropus erectus, unbekannten Alters und Geschlechts, der Männerschuhe trug. Bei den Fährten der Ente aber würde ich dem Augenschein Glauben schenken.«
»Erfreulich«, entgegnete Markham, »daß du wenigstens die Möglichkeit ausschließt, die Ente könnte sich die Schuhe des Gärtners angezogen haben.«
Vance schwieg eine Weile, dann begann er wieder.
»Ihr modernen Solone versucht ständig, die Menschennatur auf eine Formel zu bringen. Tatsächlich aber ist der Mensch genau so wie das Leben unendlich kompliziert. Er ist gerissen und spitzfindig, seit Jahrhunderten in allen Teufelsschikanen geschult. Er lügt neunundneunzigmal, bevor er einmal die Wahrheit sagt. Eine Ente dagegen hat nicht die himmelstürmenden Vorteile der Zivilisation genossen, sie ist ein geradedenkender und ungemein ehrlicher Vogel.«
»Wie aber«, fragte Markham, »willst du ohne die üblichen Handhaben zu einer Feststellung über das Geschlecht und die Art der Person, von der die Männerspuren im Schnee stammen, gelangen?«
Vance blies einen Rauchring gegen die Zimmerdecke. »Zunächst würde ich mir alle Zeugenaussagen der zwölf kurzsichtigen Erwachsenen und des einen scharfsichtigen Kindes schenken. Dann würde ich die Fußtapfen im Schnee überhaupt nicht beachten. Und dann erst würde ich, ungetrübt vom Vorurteil zweifelhafter Zeugenaussagen, unbeeinflußt durch materielle Fingerzeige, die psychologische Natur des Verbrechens bestimmen, das die fliehende Person beging. Nach einer gründlichen Analyse könnte ich dir nicht nur sagen, ob der Täter ein Mann oder eine Frau war, sondern dir auch seine Gewohnheiten, seinen Charakter und seine Persönlichkeit beschreiben.«
Markham konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich fürchte, du wärst noch schlimmer als die Polizei, wenn es darauf ankäme, mir brauchbare Tatbeweise zu beschaffen.«
»Jedenfalls würde ich nicht Indizien gegen eine harmlose Person beibringen, deren Stiefel sich der wirkliche Täter angeeignet hätte«, wandte Vance ein. »Denn solange du dich auf Fußtapfen verläßt, wirst du unausweichlich immer gerade die Leute verfolgen, die die Verbrecher von dir verhaftet sehen möchten und die nichts mit dem Verbrechen zu tun haben.« Er wurde plötzlich sehr ernst. »Glaube aber deshalb nicht, daß ich einen Heller für diese Theorie gebe, daß sich zur Zeit in den Nachtklubs eine Bande von Halsabschneidern zusammengerottet hat. Verbrechen entspringt nicht aus Masseninstinkten. Verbrechen ist ein persönliches, ein individuelles Geschäft. Man setzt sich nicht zu einem Mord zusammen wie zu einer Partie Bridge ... Und außerdem läßt heutzutage kein Verbrecher auch nur eine Fußspur zurück für deine Zollstöcke und Meßzirkel.« Er seufzte und sah Markham mit spöttischem Mitleid an. »Hast du überhaupt bedacht, daß dein nächster Fall einer ohne jegliche Fußspuren im Schnee sein könnte? He? Wie willst du ihn dann anpacken?«
»Ganz einfach«, schlug Markham ironisch vor, »ich würde dich mit auf die Untersuchung nehmen. Wie wär's damit, mein Lieber?«
»Ich bin begeistert von dem Gedanken«, sagte Vance.
Zwei Tage später brachten die Zeitungen der Metropole auf der ersten Seite in riesengroßen Überschriften die Nachricht vom Mord an Margaret Odell.
Der Mord
Es war knapp nach halb neun an jenem denkwürdigen Morgen des 11. September, als Currie, Vances Kammerdiener, mir meldete, daß Markham im Wohnzimmer sei. Ich lebte damals mit Vance zusammen in seiner Wohnung in East 38. Straße, zwei obere Stockwerke eines stattlichen Wohnhauses. An diesem Morgen war ich sehr früh aufgestanden und arbeitete bereits in der Bibliothek. Vance, der sich selten vor zwölf Uhr mittags erhob und jede Störung seines Morgenschlummers haßte, mußte erst geweckt werden.
Ich fand Markham erregt im Zimmer auf und ab gehend. Er war groß, breitschultrig und sehr muskulös, grauhaarig und glattrasiert: eine sehr vornehme Erscheinung. Seine Manieren waren zuvorkommend und liebenswürdig, verbargen jedoch die straffe, energische Strenge seines Wesens kaum. Er hatte mich gerade mit knappen Worten von dem Mord an dem »Kanarienvogel[3]« unterrichtet, als Vance in einem reichgestickten Seidenkimono und Sandalen in der Tür erschien.
»Nanu?« begrüßte er uns erstaunt und sah auf die Uhr. »Seid ihr denn noch nicht im Bett?«
Er ging zum Kamin und zündete sich eine Zigarette an. Markhams Augen wurden schmaler. Er war zu Späßen nicht aufgelegt.
»Der Kanarienvogel ist ermordet worden«, platzte ich heraus.
»Wessen Kanarienvogel?« fragte Vance.
»Margaret Odell ist heute morgen erdrosselt aufgefunden worden[1q]«, verbesserte Markham brüsk. »Sogar du in deinem verführerischen Talar dürftest von ihr gehört haben. Du kannst dir die Sensation vorstellen. Ich bin unterwegs, um selber an Ort und Stelle nach meinen beliebten Fußspuren im Schnee zu suchen. Wenn du mitkommen willst, wie du mir letzte Nacht angedeutet hast, dann mußt du dich beeilen.«
Vance drückte seine Zigarette aus.
»Margaret Odell? Broadways blonde Aspasia? ... oder war es Phryne, die eine ›coiffure d'or‹ hatte.« Sein Interesse war erwacht. »Verdammt rücksichtslos von diesen Herren Verbrechern! Entschuldige mich, ich werfe mich in ein angemessenes Kostüm für diese Angelegenheit.« Er verschwand in sein Schlafzimmer.
Markham begann energisch eine lange Zigarre zu rauchen, während ich zu meinen Büchern zurückkehrte. Zehn Minuten später erschien Vance im Straßenanzug. »Voilà, mein Alter!« Der Diener reichte ihm Hut, Handschuhe und Spazierstock. »Allons!«
Margaret Odells Wohnung lag Haus Nr. 184 in der 71. Straße, ganz nahe beim Broadway. Als wir vor dem Haus hielten, mußte uns der dort postierte Schutzmann einen Weg durch die Menge bahnen, die seit der Ankunft der Polizei die Tür belagerte.
Feathergill, Markhams Assistent, wartete im Hausflur auf die Ankunft seines Chefs.
»Es ist ein Elend«, klagte er, »eine ganz verruchte Geschichte ... und gerade jetzt ...« Entmutigt zuckte er die Achseln.
»Kann ja sein, daß sich der Fall rasch aufhellt«, sagte Markham und schüttelte ihm die Hand. »Wie steht die Sache bisher? Sergeant Heath rief kurz nach Ihnen an und sagte, die Angelegenheit sähe auf den ersten Blick ziemlich verzwickt aus.«
»Verzwickt?« erwiderte Feathergill trübselig. »Sie ist völlig undurchdringlich. Heath ist angedreht wie eine Turbine. Inspektor Moran kam vor zehn Minuten und gab ihm den amtlichen Auftrag.«
»Na, Heath ist ja eine erste Kraft«, erklärte Markham. »Wir werden es schon schaffen. Welches ist die Wohnung?«
Feathergill zeigte auf eine Tür am Ende des Hausflurs. »Hier. Ich mache mich jetzt davon. Brauche Schlaf. Viel Glück!« – Und fort war er.
Eine kurze Beschreibung des Hauses und seiner Wohnungen wird hier notwendig sein. Es war ein vierstöckiger Backsteinbau älteren Datums, der offenbar umgebaut worden war, um den Ansprüchen an moderne Kleinwohnungen gerecht zu werden. In jedem Stock gab es drei bis vier getrennte Wohnungen. Der Tatort lag im Erdgeschoß, dort befanden sich drei Wohnungen und die Ordinationsräume eines Dentisten.
Von der Straße trat man durch die Haupttür in einen langgestreckten Hausflur. An seinem entgegengesetzten Ende war die Tür zur Wohnung der Odell, die die Nummer drei trug. Rechts, ungefähr in der Mitte des Flurs, kam die Treppe zu den oberen Stockwerken. Ein Fahrstuhl war nicht im Haus. Hinter der Treppe, ebenfalls rechts, lag ein kleiner Empfangsraum mit offenem Türbogen. Linker Hand, der Treppe gegenüber, stand der Telefontisch mit der Schalttafel in einer kleinen Wandnische. Am Ende des Hausflurs führte ein schmaler Korridor nach rechts zu einem Nebeneingang, dessen Tür auf einen kleinen Hof an der Westseite des Hauses hinausging. Dieser kleine Hof war mit der Straße durch einen anderthalb Meter breiten Gang zwischen den Brandmauern verbunden.